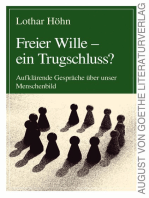Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
(9783111578118 - Wollen Und Wert) B. Phnographische Analyse Der Ziele Des Wollens
Hochgeladen von
Miau SiauOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
(9783111578118 - Wollen Und Wert) B. Phnographische Analyse Der Ziele Des Wollens
Hochgeladen von
Miau SiauCopyright:
Verfügbare Formate
B Phänographische Analyse der Ziele des Wollens
I. Abhebung des "Wollens von den „Trieben"
i. D a s Wollen
Willentlichkeit als notwendige Ausprägung der Eigenart menschlichen
Seins
Das Phänomen des „Willens", die Tatsache des Wollenkönnens
überhaupt, bildet nach K E L L E R ( 1 9 5 4 ) ein entscheidendes Kernstück im
Ganzen des menschlichen Daseins. Die Eigenart des menschlichen Seins
hat Willentlichkeit und willentliches Verhalten als mögliche und notwen-
dige Ausprägung. Wenn er sich gegen den Begriff einer „Willensfunk-
tion" im Sinne einer eigenen primären psychologischen Kategorie, wie
wir sie etwa noch im Begriff des „Willensvermögens" bei S C H W A R Z fin-
den ( S C H W A R Z 1 9 0 0 ) , wendet, so deshalb, weil für ihn eine Kategori-
sierung nur zweitrangig „gegenüber der Tatsache des ursprünglichen
Wollendseins des menschlichen Daseins . . . " (KELLER 1954, S. 295) ist.
Eine Kategorisierung wäre nur eine mögliche Folge dieser primären
Tatsache.
Phänographische Analyse des Wollens und Gefallens I
Unabhängig von jeder Kategorisierung des „Wollens" als Funktion
kann jedoch die Frage gestellt werden, ob das Wollen als eigenständiges,
originäres psychologisches Phänomen gekennzeichnet werden kann
(Autogenese), oder aber, ob das Wollen ein Sekundäres ist, das aus der
Verknüpfung anderer, primärer psychologischer Phänomene folgt (Hete-
rogenese). Die zweite Ansicht ist die in der experimentellen Psychologie
historisch frühere, sie wird etwa von KÜLPE, der im Wollen einen Kom-
plex mehr oder weniger lebhafter Organempfindungen sieht ( K Ü L P E I 8 9 3 ) ,
von EBBINGHAUS, für den Gefühle, Empfindungen und Vorstellungen
die Komponenten des Willenslebens sind (EBBINGHAUS 1 9 1 1 ) , von
ZIEHEN, nach weldiem der Wille im wesentlichen eine Verknüpfung von
Vorstellungen und Assoziationen der die Handlungen begleitenden Span-
nungsempfindungen ist ( Z I E H E N 1 9 1 1 ) , aber auch anderen vertreten.
24
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Eine Mittelstellung zwischen heterogenetischen und autogenetischen
Willenstheorien nimmt die Lehre von B R E N T A N O ein, der den Willens-
regungen immerhin eine gewisse Eigenart — sie gelten ihm als mit kei-
nem der übrigen geistigen Vorgänge identisch — zuspricht, sie jedoch
für nahe verwandt hält mit den Gefühlen, deren Gattungscharakter sie
teilen ( B R E N T A N O 1874).
Die Eigenständigkeit des Wollens als primäres phänomenal Unhin-
tergehbares hat schon S C H W A R Z in seiner „Psychologie des Willens" ge-
gen die Auffassung der heterogenetischen Theorien sichergestellt
( S C H W A R Z 1900). Auch A C H vertritt die Meinung, „daß der Willensakt
als solcher in seinem unmittelbaren Gegebensein wohl charakterisiert ist
und als ein spezifisches Erlebnis angesprochen werden muß" (ACH 1910,
S. 247). E R I S M A N N , der sich mit der Frage der Selbständigkeit des Wol-
lens befaßt hat, kommt zu der Ansicht, daß das Wollen ein spezifisches
Erlebnis sei, das von allen anderen wesensverschieden ist. „Die einfache
Analyse des Willensaktes ergibt ja einleuchtend, daß er sich von einer
einfachen Empfindung schon durch seine Transzendenz, sein Gerichtet-
sein auf eine bestimmte Zukunft hin, unterscheidet; aber auch von einem
transzendenten Denkakt unterscheidet er sich, und zwar dadurch, daß
er die Zukunft nicht nur zu denken, sondern sie auch zu bestimmen
sucht" ( E R I S M A N N 1924, S. 1 1 0 , zit. nach R O H R A C H E R 1 9 J I , S. 524).
So unterscheiden auch wir das Wollen von den Zuständlichkeiten des
Ich (vgl. S . 7 ff.), es ist ein Vorgang ( R O H R A C H E R 19 51) oder besser ein
Akt, in dem das wollende Ich sich ein Ziel setzt. Das heißt, im Haben des
Willenserlebnisses ist immer ein dieses Erlebnis Transzendierendes not-
wendig mitgegeben, wir bezeichnen dies als „Willensziel". Hieraus folgt
der allgemeine Grundsatz:
Wollen geht auf Willensziele.
Diese Willensziele sind im Willensakt als nichtseiend gesetzt, ihre
Existenz kann nur mittelbare Folge eines Willensaktes sein.
Die Willensregungen, die sich auf Willensziele als Seiendes oder auf
die Repräsentationen von Willenszielen in Form von Vorstellungen,
Erinnerungen oder Ideen richten, bezeichnen wir als „Gefallen". Wollen
und Gefallen sind zwei unterschiedliche Aspekte des übergeordneten
Begriffes der Willentlichkeit, wobei Wollen weder ohne Gegenstand
noch ohne Gefallen am Gegenstand denkbar ist. Im Unterschied zum
zielsetzenden Wollen, das nur auf Nichtseiendes gerichtet sein kann und
sich im Augenblick der Verwirklichung seines Zieles selbst aufhebt, ist
das Gefallen, obwohl vom wollenden Subjekt ausgehend, den Gegen-
ständen verhaftet, auf die es sich richtet, mögen sie nun in der Vorstel-
lung bestehen oder aber infolge einer Verwirklichung des Willenszieles
25
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
real sein. Gefallen kann also nur auf Bestehendes in irgendeiner Form
gerichtet sein, Wollen hingegen transzendiert das Bestehende in Richtung
auf Nichtbestehendes, indem es Ziele setzt. Daraus folgt der Grundsatz:
Gefallen kann keine Ziele setzen; was gefällt, kann zum Ziel des Wol-
lens werden; die Ziele des Wollens gefallen.
Wird die einzelne auf Bestehendes gerichtete Willensregung als „Ge-
fallen", der einzelne zielsetzende Willensakt als „Wollen" bezeichnet,
so verstehen wir unter „Willen" die Gesamtheit der Willensakte oder
-regungen eines Individuums. Der Begriff „Wille" ist also ein Oberbe-
griff und somit ein Allgemeines, wohingegen „Wollen" und „Gefallen"
ein je Spezielles meinen.
Phänographische Analyse des Wollens und Gefallens II
„Die unerläßliche Voraussetzung für die Entstehung eines Wollens
ist eine Situation, die mehrere, mindest aber zwei Verhaltensmöglich-
keiten bietet" ( R O H R A C H E R 1 9 5 I , S. 486 f.). Das heißt, Wollen tritt
immer da auf, wo ein Ich sich für oder gegen die Existenz eines Begriffs-
gegenstandes entscheidet, wo die implizite oder explizite Verbalisation
eines „ich will, daß das so und so ist", oder „ich will nicht, daß das so
und so ist", bzw. „das gefällt mir" oder „das mißfällt mir" vorliegt.
Im Gegensatz hierzu steht das Sollen, das keine Entscheidung zuläßt,
sondern kategorisch eine bestimmte Seins- oder Verhaltensweise fordert
oder ausschließt. Im Sollen wird einer Entscheidung vorgegriffen.
Das Problem der Willensfreiheit
Der Umstand, daß Wollen immer Entscheidung bedeutet, umfaßt die
prinzipielle Möglichkeit der Freiheit des Willens. „Und in genau dem
Sinn und dem Umfang, in dem für das reflektierende Denken das Wol-
len zum Problem wird", so meint K E L L E R , „ist es die Freiheit, die den
Kern dieser Problematik bildet; das Anliegen besteht in der Ergründung
von Sinn, Bewandtnis und Möglichkeit dieses beharrlichen Anspruchs.
Ubergreifend gesehen ist der Unterschied, ob die Freiheit im naiven
Wollensbewußtsein selbstverständlich vorausgesetzt ist oder ob sie im
reflektierenden Denken über das Wollen problematisch wird, nur sekun-
där gegenüber der Tatsache, daß es eindeutig um sie geht, wo immer es
um das Wollen geht. Ob stillschweigend vorausgesetzt oder bewußt ge-
glaubt, ob ausdrücklich bejaht oder gar verneint, ob wie immer bewie-
sen, bezweifelt oder bestritten, stets ist sie es, in der das Wesensmoment
des Wollens liegt" ( K E L L E R 1954, S. 50 f.).
26
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Wenn auch die Freiheit des Willens oftmals bestritten wurde (so
SCHOPENHAUER, N I E T Z S C H E und in neuerer Zeit etwa R O H R A C H E R ) , SO
wird sie doch von bedeutenden Denkern entweder als Notwendigkeit
und Folge des menschlichen Seins (so bei K E L L E R 1 9 5 4 ) , als Grundbedin-
gung moralischen Handelns (KANT 18 r8) oder als notwendige Voraus-
setzung des Tuns, das wir „Wissenschaft" nennen (so bei D I N G L E R 1926,
H O L Z K A M P 1968), postuliert.
Dadurch, daß man in der experimentellen Psychologie wiederholt
„nachwies", daß die Entscheidung für die eine oder andere Möglichkeit
des Verhaltens in einer Wahlsituation (eine durchaus legitime Operatio-
nalisierung des Begriffes der „Freiheit des menschlichen Verhaltens")
abhängig sei von „Trieben" oder „Bedürfnissen" — demnach also auch
die dem Verhalten zugrundeliegende Willensentscheidung nicht mehr
frei, sondern „determiniert" sei —, glaubte man die Freiheit des Willens
ad absurdum geführt zu haben ( R O H R A C H E R 1 9 5 I ) .
Das sogenannte „Freiheitsbewußtsein", das von philosophischer Seite
immer wieder als Beleg für die Willensfreiheit angeführt wird, sei, so
argumentiert R O H R A C H E R , „das Erleben des Fehlens von Motiven" ( 1 9 5 1 ,
S. 508). R O H R A C H E R , der sich dabei auf eigene Untersuchungen stützt
(1932), kommt weiter zu der Ansicht, daß das Freiheitsbewußtsein um so
mehr schwinde, je größere persönliche Bedeutung die einzelnen Wahl-
möglichkeiten haben, je stärker also „Triebe" und „Interessen" wirksam
werden.
Nun wird aber nach einiger Überlegung klar, daß es ebenso unsinnig
ist, die Freiheit des Willens experimentell „nachweisen" zu wollen wie
zu versuchen, den Grundsätzen der klassischen Logik und dem Kausali-
tätsprinzip eine diese „beweisende" experimentelle Basis zu geben. Die
Berechtigung des Begriffes der Freiheit des Willens ist prinzipiell nicht
experimentell nachzuweisen, der Begriff impliziert vielmehr eine funda-
mentale Voraussetzung, die wir, da sie jenseits der Prüfbarkeit der Ein-
zelwissenschaften und sogar auch — wie sich zeigen wird — jenseits der
Prüfbarkeit einer Logik oder Wissenschaftstheorie liegt, dem Bereich
der Metaphysik zuweisen müssen. Da unsere Aufgabe aber nicht in den
Bereich der Metaphysik, sondern in den der Psychologie fällt, die nur
empirisch prüfbare Aussagen gelten lassen kann, entschließen wir uns,
das Problem der Willensfreiheit zu umgehen, so gut es möglich ist. Dabei
wird sich zeigen, wie schwer es oft ist, die Konsequenzen eines solchen
Entschlusses zu tragen, zumal wenn man selbst (als Leser oder Autor) ein
überzeugter Parteigänger der einen oder der anderen Auffassung ist und
Andersdenkende gern von der „Richtigkeit" der eigenen Meinung über-
zeugen möchte.
Innerhalb des Kapitels über die „Begründung der Werte" müssen wir
allerdings dem Problem einige formale Überlegungen widmen, bei denen
27
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
wir uns jedoch durchaus bewußt sind, daß ihre psychologische Relevanz
lediglich darin besteht, Grenzen dieser Wissenschaft aufzuzeigen.
Vom Problem der Willensfreiheit ist das der Eigenständigkeit des
Wollens und der Willensziele zu trennen, d. h. die Frage, ob Willentlich-
keit mit ihren Implikationen und Konsequenzen hinreicht, um inten-
diertes Verhalten in allen seinen Ausprägungen zu erklären und voraus-
zusagen. Es wird daher zunächst zu prüfen sein, welcher Stellenwert
überhaupt der Annahme von „Trieben", die für R O H R A C H E R etwa eine
so große Rolle spielen, wenn es um das Phänomen des Willens geht, in
einer streng psychologisch konzipierten Motivationslehre zukommt.
2. D i e Triebe
NIETZSCHES „physiologische Willensmetaphysik"
,,,Ich', sagst du und bist stolz auf diess Wort. Aber der Grössere ist
. . . dein Leib und seine grosse Vernunft: die sagt nicht Ich, aber thut Ich
. . . Dein Selbst lacht über dein Ich und seine stolzen Sprünge. ,Was sind
mir diese Sprünge und Flüge des Gedankens?' sagt es sich. Ein Umweg
zu meinem Zwecke. Ich bin das Gängelband des Ich's und der Einbläser
seiner Begriffe" ( N I E T Z S C H E 1925, S. 36 f.).
Mit diesen Worten N I E T Z S C H E S ist jene ganze Forschungsrichtung
gekennzeichnet, die die Motivation des menschlichen Handelns von den
Ansprüchen des menschlichen Organismus her versteht. Wir bezeichnen
diese Grundannahme mit S C H W A R Z als „physiologische Willensmeta-
physik" ( S C H W A R Z 1900, S. 1 9 ff.). Darin wird nicht nur angenommen,
daß jene Entscheidungen, die wir im täglichen Leben auf das Wirken
eines freien Willens zurückführen, lediglich körperlichen Ansprüchen
genügen, sondern auch, daß diese Ansprüche „angeboren" seien. Der
Wille, so argumentiert man, sei ganz und gar mit angeborenen Zwecken
erfüllt; keineswegs eine „tabula rasa", sondern von Anfang an eine voll-
beschriebene Tafel, trage er alle die Ziele, auf die er sich während des
ganzen Lebens richte, schon von Hause aus in sich. „Der gewöhnliche
Name für diese Willensrichtungen, die auf angeborene Zwecke gehen
sollen, ist .Triebe'. Die in Rede stehende Auffassung heisst daher pas-
send die Trieblehre oder noch genauer die nativistische Trieblehre. Sollen
die angeborenen Willensrichtungen ihren Trägern im Kampfe ums Da-
sein nützen, so müssen sie unseren leiblichen Lebensbedingungen genau
entsprechen. Die Triebe mit den ihnen mitgegebenen Willenszielen, so
fährt man daher fort, ständen durchgehends mit körperlichen Erforder-
nissen in Einklang" ( S C H W A R Z 1900, S. 23 f.). Hierbei vermeidet
S C H W A R Z , wie er sagt, absichtlich den Begriff der „körperlichen Bedürf-
28
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
nisse", „weil der Begriff des Bedürfnisses ein psychischer ist" (S. 24,
Anm. 1). „Als dunkler Drang in uns schaltend, träten sie von Zeit zu
Zeit ins Bewusstsein; hiermit zeigten sie diesem an, was das physische
Dasein in eben dem Augenblicke am meisten erhalte und fördere. Bei
solcher prästabilierten Harmonie, die zwischen unserem leiblichen Nut-
zen und unseren Willensbethätigungen bestehen soll, gilt nach der stren-
gen monistischen Anschauung, insbesondere nach Nietzsches Lehre, der
Wille durchaus als der passive Teil. Er sei in allen seinen angeborenen
Richtungen nur das Ab- und Spiegelbild des Leibes, unseres eigentlichen
Selbst. Der Leib regiere unseren Willen und durch ihn all unser Thun
und Denken, das wir so stolz und eingebildet auf ein freies Ich bezögen"
(S. a 4 ).
Vergleicht man mit diesen Ausführungen von S C H W A R Z die Defini-
tion der Triebe bei R O H R A C H E R , SO findet sich mit der Ausnahme, daß
R O H R A C H E R die Begriffe „Trieb" und „Bedürfnis" (wie wir meinen un-
berechtigterweise) miteinander vermengt, kaum ein Unterschied. „Ein
zweites wesentliches Merkmal aller Triebe ist es, daß sie von selbst ent-
stehen. Natürlich hat ihr Auftreten bestimmte Ursachen im Organismus;
aber von diesen Ursachen wird nichts bewußt. Die Triebe kommen, ohne
daß man sie ruft; sie entstehen autogen. Man kann es noch genauer sa-
gen: sie treten ohne Mitwirkung des Bewußtseins auf, unabhängig vom
Wollen und Denken. Sie sind auf einmal da, in einer einschleichenden
Art, langsam in ihrer Stärke zunehmend bis zur Kraft von Naturgewal-
ten, gegen die es keinen Widerstand gibt" ( R O H R A C H E R 1 9 5 I , S. 383).
Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Trieblehren
Die angeborene physiologisch-metaphysische Grundlage des inten-
dierten menschlichen und (vergleichbar damit) auch tierischen Verhal-
tens wurde von anderen Autoren als „Instinkt" bezeichnet (so etwa
M C D O U G A L L 1908); abgesehen davon, daß in den „Instinkt"-Lehren in
der Grundannahme des Getriebenseins noch die Annahme der daraus
ableitbaren mehr oder weniger begrenzten Verhaltensweisen miteingeht,
ist die physiologisch-metaphysische Grundposition die gleiche wie in den
nativistischen Trieblehren.
Die Annahme der grundsätzlichen Gelenktheit menschlichen und tie-
rischen Verhaltens durch Erfordernisse des Körpers wird, wenn man von
begrifflichen Unterschieden auf anderen Gebieten absieht, übereinstim-
mend von einer großen Anzahl zeitgenössischer Psychologen vertreten
(so Y O U N G 1936, ALLPORT 1937, MASSERMAN 1946, FREEMAN 1948,
MAIER 1949, TINBERGEN 1 9 5 1 , H U L L 1952, aber auch T O L M A N 1932).
Auch FREUD glaubte ja, daß die von ihm konzipierte „Libido" letztlich
29
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
wie alle „psychologischen Vorläufigkeiten" auf physiologische Prozesse
reduzierbar sei ( F R E U D 1967 a). Interessant ist, daß S K I N N E R eine Reduk-
tion der in die Analyse des Verhaltens eingehenden Definition auf phy-
siologische Begriffe ablehnt: „The causes to be sought in .the nervous
system are, therefore, of limited usefulness in the prediction and control
of specific behavior" ( S K I N N E R 1953, S . 28). Dabei steht S K I N N E R S Vor-
gehen, die Auftretenshäufigkeit bestimmter „operants" dadurch zu be-
einflussen, daß er Ratten eine definierte Zeit lang hungern läßt, zumin-
dest in implizitem Widerspruch zu dieser wissenschaftstheoretischen
Grundhaltung.
Biologisch-physiologische Kennzeichnung der Triebe und ihrer „Zwecke"
Formal gesehen sind die so gekennzeichneten Triebe Normen, die dem
handelnden Ich von „außen" Handlungen abfordern, deren Folge ein
biologisch-physiologisch definierbarer Sollzustand ist. Treten Abweichun-
gen vom Sollzustand auf, so wird das Individuum dazu „getrieben", jene
auszugleichen und diesen wieder herzustellen. Dieser Mechanismus wird
im allgemeinen als „Homöostase"15 bezeichnet; dabei ist es gleichgültig,
ob dieser Sollzustand auf einen spezifischen Trieb (Hunger, Durst, Se-
xualtrieb usw.) oder ein unspezifisches „drive-level" (so bei H U L L ) be-
zogen ist.
All diese Triebe, so argumentiert man, hülfen dem jeweiligen Indivi-
duum beim Kampf ums nackte Dasein und/oder garantierten die Arter-
haltung, wobei entweder offen bleibt, warum das Individuum überhaupt
ums Dasein kämpfen oder warum es die Art erhalten soll (es werden nur
Mechanismen konzipiert, die beschreiben, wie es das tut), oder aber es
werden die Triebe in den Status der „wirksamen Einrichtung der Natur"
(wobei letzterer Begriff den Urgrund allen Seins meint, also eine Art
Synonym für „Gott" ist) erhoben und damit zu Werkzeugen „höherer"
Zwecke, die für uns bisher noch im Dunkel liegen, uns aber vielleicht
irgendwann einmal erhellt werden. „Viel interessanter und aufschluß-
reicher als die Einteilung der Triebe . . . ist die Entwicklungsgeschichte
der Triebe; sie zeigt, daß man es dabei mit außerordentlich sinnreichen
und höchst wirksamen Einrichtungen der Natur zu tun hat, die den
Menschen zu Handlungen veranlassen, die nicht nur zur Erhaltung des
15
Der Begriff wurde von dem Physiologen W . B . CANNON 1 9 3 2 in die Wissenschafts-
sprache eingeführt. E r bezog sich zunächst auf rein physiologische Prozesse (z. B.
die Konstanthaltung der Körpertemperatur innerhalb eines Organismus), w i r d aber
heute auch in der Psychologie vielfach angewendet. So ist etwa audi die „sensory-
tonic field theory" von WERNER und WAPNER ein homöostatisches Modell (vgl. das
Postulat I in WAPNER & WERNER I J J J , S. I f.).
30
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
einzelnen Lebens und der Gattung, sondern auch zur Entstehung der
menschlichen Kultur führen" ( R O H R A C H E R 1 9 5 1 , S. 385 f.).
Wir haben also auf der einen Seite ein sinn- und zweckloses „Dahin-
wesen" des seienden Individuums, ohne daß wir etwa sagen könnten,
„es sei da, bloß um da zu sein", denn dies wäre eine metaphysische An-
nahme, deren Berechtigung erst nachzuweisen wäre. Auf der anderen
Seite ist das handelnde Individuum eine Marionette im Rahmen einer
„Weltmaschine" 18 , deren Zweck wir nicht kennen und deren Initiator
uns für ewig verborgen bleibt. In beiden Fällen ist die Möglichkeit, daß
das handelnde Ich seine Handlungen aus sich selbst frei bestimmen
könnte, ausgeschlossen.
Repräsentation der Triebe im Bewußtsein
Da die Triebe per definitionem auf Grund ihrer biologisch-physiologisch
faßbaren Eigenarten „unbewußt", d. h. dem sich und die Welt bewußt
habenden Ich nicht gegeben sind, müssen die jeweiligen Abweichungen
vom biologisch-physiologischen Sollzustand der „zentralen Instanz" (die
wir mit dem bewußtseinspsychologischen Begriff des „Ich" 1 7 bezeichnen),
welche die für den Sollzustand jeweils notwendigen Handlungen inten-
diert und steuert, irgendwie erkennbar sein. Außerdem muß dieser zen-
tralen Instanz erkennbar sein, wann sie eine bestimmte intendierte
Handlung oder Handlungsfrequenz abzubrechen hat, da der vorgeschrie-
bene Sollzustand erreicht ist.
Diese „Vermittler"-Funktion nehmen z. B. im HuLLschen System die
„drive produced Stimuli" ein, deren Auftreten und Abklingen Signal für
Beginn, Fortführung oder Beendigung eines bestimmten Verhaltens oder
einer bestimmten Verhaltenssequenz sind.
In anderen, mehr kognitiven Theorien, werden Gefühle als Begleiter
bestimmter biologisch-physiologischer Sollzustände — und/oder Abwei-
chungen davon — angenommen. So zeige in den meisten Fällen ein un-
lustbetontes Gefühl oder eine unlustbetonte Leiblichkeitsempfindung
eine Abweichung von einem Sollzustand an, ein lustbetontes Gefühl
oder eine lustbetonte Leiblichkeitsempfindung dagegen sei das Anzeichen
dafür, daß der Sollzustand entweder schon erreicht sei oder nach kurzer
Zeit ohne Dazutun des Individuums erreicht sein werde. „Allgemein
gilt: Befriedigung eines Triebes ist von Lust, der unbefriedigte Trieb von
Unlust begleitet" ( R O H R A C H E R 1 9 5 1 , S. 383). Allerdings, so schränkt
18
Vgl. hierzu DINGLER 1 9 3 2 .
17
Unser Begriff des „Ich" deckt sich mit dem ersten der bei ALLPORT 1 9 4 3 (s. S. 4 5 3 f.)
abgehandelten acht Ichbegriffe.
31
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
ROHRACHER ein, könne aber auch „ein starkes Trieberleben, wenn Aus-
sicht auf Befriedigung besteht, als ausgesprochen lustvoll empfunden
werden" (S. 383).
Um es in unsere Terminologie zu fassen: Eine Abweichung des biolo-
gisch-physiologischen Zustandes eines Individuums vom Sollzustand ist
von einer unangenehmen Zuständlichkeit begleitet. Eine Übereinstim-
mung eines biologisch-physiologischen Zustandes mit dem Sollzustand
oder ein Zustand, der diesen Sollzustand antizipiert, ist von einer ange-
nehmen Zuständlichkeit begleitet.
Unterscheidung zwischen „monothematischen", „polythematischen" und
„athematischen" Trieblehren
Bevor wir den physiologisch-willensmetaphysischen Ansatz der nati-
vistischen Trieblehre einer eingehenden Kritik unterwerfen, wollen wir
kurz ein anderes Problem behandeln: Die monothematische in Abhebung
von der polythematischen Auffassung von den Trieben.
Im monothematischen Ansatz wird versucht, das gesamte intendierte
menschliche (und auch tierische) Verhalten auf das Wirken eines einzigen
Triebes zurückzuführen. Diese Annahmen, die etwa im Selbsterhaltungs-
trieb oder im Fortpflanzungstrieb das eigentliche Agens des menschlichen
Handelns sehen, werden, soweit wir sehen, heute kaum noch vertreten.
Stellvertretend für andere Ansätze mag hier die frühe FREUDsche Lehre
stehen, die in der „Libido", der „sexuellen Energie", den Antrieb des
menschlichen Verhaltens sieht ( F R E U D 1961). In einer späteren Phase
wich F R E U D von dieser monothematischen Annahme ab und konzipierte
den der Libido konträren „Todestrieb" ( F R E U D 1967c, S. 40 ff.).
Im polythematischen Ansatz wird Verhalten als durch eine ganze
Anzahl von Trieben bedingt gesehen. Die betreffenden Autoren fassen
die von ihnen konzipierten Triebe dann meist in entsprechenden „Listen"
zusammen. Eine Aufzählung der in diesen Listen enthaltenen Triebe
würde an dieser Stelle zu weit führen, zumal die Listen der verschie-
denen Autoren oft mehr oder weniger voneinander abweichen. Als be-
deutende Vertreter der polythematischen Trieblehre sind zu nennen:
J A M E S (1920), M C D O U G A L L (1937), R O H R A C H E R ( 1 9 5 I ) , M U R R A Y (195I),
R O T H A C K E R (1942), L E R S C H ( 1 9 5 1 ) .
Eine weder monothematische noch polythematische, sondern athema-
tische Auffassung von Trieb ist uns (jedenfalls in der hier angezielten
radikalen und ausschließlich physiologisch-metaphysischen Ausprägung)
nicht bekannt. Zwar ist bei H U L L der Begriff des „drive level" allgemein
und unspezifisch gehalten, jedoch so konzipiert, daß er sich aus verschie-
32
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
denen (operationalisierbaren) Trieben konstituiert, womit der ange-
strebte Athematismus wieder in Frage gestellt wird.
Der bei L E W I N verwendete allgemeine Begriff der „Spannung" kann
jedoch auch (so L E W I N 1926) psychischen Ursprungs (etwa eine bestimm-
te „Vornahme" oder ein allgemeines „Willensziel") sein und ist nicht an
biologisch-physiologische Ansprüche gebunden, er fällt also nidit in den
Bereich der rein physiologischen Triebansätze.
3 . K r i t i k der Trieblehren
Kritik des monothematischen Ansatzes unter Berücksichtigung der
F R E U D sehen monothematischen Trieblehre
Der monothematische Ansatz stößt, wie sich deutlich in der F R E U D -
schen Libidotheorie zeigt (die hier paradigmatisch für andere stehen soll),
sehr bald auf Schwierigkeiten prinzipieller Art. Da versucht werden
muß, sämtliches Verhalten als durch eine einzige spezifische Triebfeder 18
verursacht und gesteuert zu erklären, sind oftmals komplizierte und aus-
gedehnte Kausalketten oder mehr oder weniger ad hoc konzipierte Hilfs-
annahmen nötig, um Verhalten, das in keiner unmittelbaren Verbindung
mit der Befriedigung dieses spezifischen Triebes gesehen wird, zu deuten.
So fällt es von der FREUDschen Libidotheorie her schwer, zu erklären,
warum denn so viele Menschen in ihren Neigungen und ihrem Verhalten
ganz im kulturellen Bereich aufgehen. Warum ein Musikfanatiker ein
bestimmtes Musikstück allen anderen vorzieht, ja warum er überhaupt
Musik liebt, muß für eine Theorie, die im Sexualtrieb die Kraft sieht, die
unser intendiertes Verhalten treibt, unerklärlich bleiben, solange sie in
letzter Konsequenz vertreten wird.
Eine Möglichkeit, das gesteckte Erklärungsziel doch noch zu erreichen,
liegt in der Annahme, die F R E U D anläßlich des Problems der Versagung
der Triebbefriedigung macht: „Ferner zeigen die Partialtriebe der Se-
xualität, ebenso wie die aus ihnen zusammengefaßte Sexualstrebung, eine
große Fähigkeit, ihr Objekt zu wechseln, es gegen ein anderes, also auch
gegen ein bequemer erreichbares, zu vertauschen; diese Verschiebbarkeit
und Bereitwilligkeit, Surrogate anzunehmen, müssen der pathogenen
Wirkung einer Versagung mächtig entgegenarbeiten. Unter diesen gegen
die Erkrankung durch Entbehrung schützenden Prozessen hat einer eine
18
Anfänglich unterschied FREUD nodi eine zweite Art von Trieben, die „Iditriebe",
die jedoch für Erklärungszwecke kaum herangezogen wurden. Bedeutsam war ledig-
lidi die objektbezogene „Libido". Durch die Einführung des „ N a r z i ß m u s " (FREUD
1967 a) wurde die ursprüngliche Trennung wieder rückgängig gemacht, im Narziß-
mus kann das eigene Ich Objekt der Libido sein. Damit wird die FREUDsche Trieb-
lehre endgültig zur rein monothematischen Libidotheorie.
3 Keiler, Wollen
33
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
besondere kulturelle Bedeutung gewonnen. Er besteht darin, daß die
Sexualstrebung ihr auf Partiallust oder Fortpflanzungslust gerichtetes
Ziel aufgibt und ein anderes annimmt, welches genetisch mit dem auf-
gegebenen zusammenhängt, aber selbst nicht mehr sexuell, sondern sozial
genannt werden muß. Wir heißen den Prozeß ,Sublimierung', wobei wir
uns der allgemeinen Schätzung fügen, welche soziale Ziele höher stellt
als die im Grunde selbstsüchtigen sexuellen. Die Sublimierung ist übri-
gens nur ein Spezialfall der Anlehnung von Sexualstrebungen an andere
nicht sexuelle" ( F R E U D 1966, S. 3 5 8 ) .
Das würde bedeuten, daß alle intendierten Handlungen, die nicht
unmittelbar mit einer Triebbefriedigung in Beziehung stehen, ihren Ur-
sprung in der Versagung der prinzipiell angestrebten Befriedigung des
einen und einzigen Triebes haben. Gegen diese Argumentation sind ge-
wichtige Einwände zu erheben:
1. Es ist bisher noch niemals empirisch nachgewiesen worden, daß die
Intensität der Bemühungen eines Menschen im sozialen oder kultu-
rellen Bereich proportional zum Ausmaß der von ihm erlittenen Ver-
sagung der Befriedigung seines Sexualstrebens anzusetzen ist. Die
Ergebnisse der Untersuchung von T A Y L O R lassen vielmehr eher die
Vermutung zu, daß sexuelle Betätigung und Betätigung im sozialen
und/oder kulturellen Bereich positiv miteinander korrelieren, was
eindeutig gegen die FREUDsche Sublimierungsannahme sprechen
würde ( T A Y L O R 1933).
2. Der zweite Einwand ist ein methodischer. Da aus der angenommenen
Möglichkeit der Verschiebung der sexuellen Strebungen auf Objekte,
die nicht unmittelbar der Triebreduktion dienen, nicht abzuleiten ist,
wie dieser Mechanismus im einzelnen ablaufen soll, wie also „Subli-
mierung" recht eigentlich vor sich geht, sind weitestreichenden Speku-
lationen keine Grenzen gesetzt; man benötigt nur die von S C H U L T Z -
H E N C K E geforderte „Vorstellungsfülle", um alles auf alles zurück-
führen zu können.
3. Die Einführung des Begriffes der „Sublimierung" stellt zweifellos
eine Exhaustion (vgl. hierzu D I N G L E R 1926, H O L Z K A M P 1964, 1968)
der ursprünglichen Libidotheorie dar, die von ihr abweichende empi-
rische Befunde nicht mehr zu decken vermochte. Die „sozialen Triebe"
sind phänomenal keineswegs sexuell (was in der Begriffserklärung
auch zugegeben wird); da F R E U D jedoch nur den Sexualtrieb als ein-
zigen gelten lassen will, ist er genötigt, durch den Vorgang der „Sub-
limierung" diese phänomenal nichtsexuellen Strebungen genetisch auf
sexuelle zurückzuführen, wodurch der monothematische Anspruch
gesichert wird, freilich auf Kosten einer eindeutigen Verletzung des
logischen Prinzips „vom ausgeschlossenen Dritten".
34
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
4. Anläßlich der Darstellung der T A Y L O R S c h e n Befunde ( T A Y L O R 1933)
wäre der Einwand möglich, die positive Korrelation zwischen sexu-
eller Betätigung und Betätigung im sozialen Bereich schließe nicht
aus, daß die sozial aktiven Männer im Verhältnis zu ihren Ansprü-
chen immer noch mehr Versagungen ihrer sexuellen Bedürfnisse er-
lebten als sozial nicht so aktive, die auch keine so starken sexuellen
Bedürfnisse hätten. Wie soll man das jedoch nachprüfen? Diese Argu-
mentation entzieht das Problem dem Kriterium der empirischen
Prüfbarkeit.
Vor ähnlichen Schwierigkeiten stehen auch andere monathematische
Auffassungen von „Trieb". Wenn man etwa den „Nahrungstrieb" als
einziges Konstituens menschlicher und tierischer Motivation postulieren
würde, stünde man ebenfalls vor der Aufgabe, Verhalten, das unmittel-
bar mit Triebbefriedigung nichts zu tun hat, durch weiträumige Kausal-
ketten oder die Annahme ähnlicher, der Spekulation Tür und Tor öffnen-
der Mechanismen wie der FREUDschen „Sublimierung" zu erklären.
Abschließend läßt sich sagen: Wenn auf den ersten Blick auch die Ein-
fachheit einer monothematischen Trieblehre besticht, so erkennt man
doch bald, daß infolge der Notwendigkeit, durch unüberprüfbare gene-
tische Verknüpfungen oder die Annahme von Hilfshypothesen das ge-
steckte Erklärungsziel noch zu erreichen, den wissenschaftlichen Wert-
kriterien zuwidergehandelt wird. Insbesondere ist der Integrationswert
( H O L Z K A M P 1964) der eigentlichen theoretischen Grundannahme ent-
schieden geringer, als man glauben machen möchte. Von daher ist die
Annahme monothematischer Triebtheorien als nach wissenschaftlichen
Wertgesichtspunkten unzweckmäßig gekennzeichnet.
Kritik der polythematischen Trieblehren
„Welche Triebe darf man aufstellen und wie viele? Dabei ist offen-
bar der Willkür ein weiter Spielraum gelassen" ( F R E U D 1967b, S. 2x6).
In diesen Worten FREUDS zeigt sich die ganze Problematik der poly-
thematischen Trieblehren. D a es offensichtlich kein verbindliches Krite-
rium für Anzahl und Zielinhalt der Triebe gibt, bleibt es wiederum der
„Vorstellungsfülle" des einzelnen Psychologen überlassen, ob er mit
einem „sparsamen" Modell mit zwei Trieben (z. B. die späte FREUDsche
Lehre 19 ) auskommt oder ob er ein umfangreicheres in Form einer Trieb-
liste (z. B. die Theorie von M U R R A Y ) aufstellt, um damit die empirische
Wirklichkeit zu erfassen. „Wie man sieht, haben verschiedene Forscher
nicht nur verschiedene Grundtriebe angenommen, sondern auch verschie-
19 Es wurde schon darauf hingewiesen, daß die FREUDsche Lehre in ihrer frühesten
Fassung auch zwei A r t e n v o n Trieben unterschied.
35
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
dene Anzahlen von solchen zum Triebinventar des Menschen erklärt",
meint T O M A N (1954, S. 16), nachdem er in seiner „Dynamik der Motive"
die Trieblisten von J A M E S , M C D O U G A L L und M U R R A Y referiert hat.
Gewiß lassen sich durch verbale Umformungen einzelne Triebe unter-
schiedlicher Trieblisten zur Deckung bringen, aber insgesamt herrscht
doch der Eindruck einer Uneinigkeit zwischen den einzelnen Forschern
vor. In vielen Fällen wird auch der angestrebte biologisch-physiologische
Rahmen gesprengt oder nichts darüber ausgesagt, wie das physiologische
Korrelat des jeweilig postulierten Triebes zu kennzeichnen sei. Ist es
relativ einfach, als physiologische Entsprechung des Sexualtriebes die
hormischen Veränderungen innerhalb des Blutkreislaufes anzunehmen
oder in Mangelerscheinungen spezifischer Zellen oder des gesamten Orga-
nismus die Ursache des Nahrungstriebes zu sehen, so dürfte es doch
Schwierigkeiten bereiten, dem „ästhetischen Trieb" ( R O H R A C H E R 1 9 5 1 )
oder den „Strebungen der enthebenden Teilnahme" ( L E R S C H 1 9 5 1 ) ein
aufweisbares physiologisches Korrelat zuzuweisen. Hierbei wird immer
wieder übersehen, daß diese Schwierigkeiten nicht etwa — wie man viel-
leicht meinen könnte — „in der Natur der Sache" liegen, sondern daß sie
methodischer Art sind. Die Trieblisten sind die Folge einer Klassifikation
von menschlichen und tierischen Verhaltensweisen; jeweils einer Anzahl
von als zusammengehörig gekennzeichneten Verhaltensweisen wird als
erklärendes Prinzip ein „Trieb" unterlegt. In naiver Ontologisierung
verlegt man nun das von einem selbst eingeführte begriffliche Erklä-
rungsprinzip als ursprünglich vorgefunden in die Wirklichkeit. Diesem
vermögenspsychologischen Irrtum entspringt dann die Suche nach einem
„organischen Substrat", das diesem „Trieb" zugrundeliegen muß, da er
ja ein „vorgefundenes tatsächlich Seiendes" ist.
Methodische Schwierigkeiten der athematischen Trieblehren
Ähnliche Schwierigkeiten hätte eine athematische physiologisch-meta-
physische Triebtheorie. Selbst wenn ein ganz „allgemeiner Mangel und/
oder Uberfluß des Organismus" einen „unspezifischen Triebspiegel" be-
dingen würde, wäre damit noch nichts darüber ausgesagt, warum sich ein
Individuum in einer spezifischen Situation ganz speziell verhält, sondern
nur, daß es sich überhaupt verhält, womit natürlich nichts erklärt wäre.
Und außerdem begibt man sich beim Versuch des Aufweises physiologi-
scher Korrelate wiederum nur allzu leicht in die Gefahr eines vermögens-
psydiologischen Irrtums. Läßt man dagegen den „unspezifischen Trieb-
spiegel" sich aus je einzelnen Mangel- oder Überflußerscheinungen kon-
stituieren (so bei H U L L 1952), die dadurch wieder in den physiologischen
Sollzustand überführt werden, daß der „unspezifische Triebspiegel"
36
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
spezifisches Verhalten verursacht, so steht man erstens vor den gleichen
Schwierigkeiten wie die monothematischen und polythematischen Trieb-
lehren, da man ja immer entscheiden muß, welche Mangel- oder Uber-
flußerscheinungen den unspezifischen Triebspiegel bedingen sollen und
wie dieser unspezifische Triebspiegel spezifisches Verhalten auslösen soll,
das triebreduzierend wirkt. Zweitens wäre durch diese Annahme natür-
lich der Anspruch auf Athematik der Trieblehre verwirkt.
„Nahrungstrieb" vs. „Scheuen von Unlust" bei SCHWARZ
Bezog sich unsere bisherige Kritik ausschließlich auf das Problem der
Thematik der Trieblehren und damit ein inhaltliches Moment, so sollen
sich unsere weiteren Überlegungen darauf richten, ob denn überhaupt ein
physiologisch-metaphysischer20 Ansatz notwendig ist, wenn es darum
geht, Aussagen über die Motiviertheit menschlichen und tierischen Ver-
haltens zu machen. Richtet sich denn „tatsächlich" unser Verhalten auf
bewußseins jenseitige physiologisch-metaphysische Ziele? SCHWARZ schreibt
in diesem Zusammenhang: „Der blinde Wille zum L e b e n . . . soll aus
unserem Willen zur Nahrung sprechen? Indessen, nicht allein darauf,
dass hier ein Wollen in den Dienst des Körpers tritt, muss man sehen,
sondern auch darauf, wie es geschieht. — Wie regelt sich nun aber unsere
Speisezufuhr? In einer Weise, die im Gegenteil erkennen lässt, dass sich
die Strebethätigkeit gar nicht unmittelbar auf die Leibeserfordernisse rich-
t e t . . . Wenn nämlich der Zeitpunkt naht, wo die leiblichen Funktionen
ohne erneuerte Nahrungsaufnahme gestört werden würden, . . . haben
wir die Organempfindung des Hungers und begleitende Unlustgefühle.
Der Stachel dieser Unlust ist das eine Mittel, mit dem die Natur unseren
Willen in ihren Dienst zwingt. Unlust aller A r t möchten wir meiden;
auch das Schmerzgefühl des Hungers scheuen wir, und die physiologische
Verkettung des Nervennetzes giebt schon dem Kinde die Mittel, es los zu
werden" (SCHWARZ 1900, S. 27 f.). Wenn dem hungrigen Kind der ge-
eignete Gegenstand von außen dargeboten wird, so gelangt durch
Schnapp-, Saug- und Schluckbewegungen neuer Nahrungsstoff in den
Magen, der Hunger hört auf und die ihn begleitenden unangenehmen
Organempfindungen vergehen. (Unter „geeignetem Gegenstand" soll
hier alles verstanden werden, was auf Grund seiner Größe auf natür-
lichem Wege in den Magen gelangen kann und dort durch chemische Um-
20 Es muß angemerkt werden, daß FREUD sich des Umstandes, daß seine Trieblehre
metaphysisdie Annahmen implizierte, völlig bewußt war. So in den Gesammelten
Werken ( X V , 1967f, S. 101): „ D i e Trieblehre ist sozusagen unsere Mythologie. D i e
Triebe sind mythische Wesen, großartig in ihrer Unbestimmtheit. Wir können in
unserer Arbeit keinen Augenblick von ihnen absehen und sind dabei nie sicher,
sie scharf zu sehen."
37
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Setzung zu eigentlicher Nahrung wird; daß darüber hinaus das Kind
reflektorisch auch nach „nicht geeigneten Gegenständen" schnappt, die
entweder auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht in den Magen gelangen
können oder dort nicht in eigentliche Nahrung umgesetzt werden, kann
als Beleg dafür angesehen werden, daß die genannten Schnapp-, Saug-
und Schluckbewegungen keineswegs gezielt mit den körperlichen Erfor-
dernissen in Beziehung stehen.)
„Damit ist die erste Erfahrung von der hungerstillenden Wirkung
jenes Gegenstandes, Speise genannt, gemacht. In dem Grade, wie sie öfter
gemacht wird, stellt sich ein immer deutlicheres Verlangen nach ihm ein;
immer mehr lenkt es die Aufmerksamkeit auf die Mittel hin, Speise zu
erlangen. So kommt es, dass der Erwachsene in sich stets zugleich mit dem
Gefühl des Hungers das Begehren entdeckt, zu essen. Er wünscht seinen
Hunger zu beseitigen und hat gleichzeitig die Vorstellung der Mittel,
durch die das geschehen kann 21 . Das zeigt, wie der Wille zu essen erst
allmählich entsteht. Er sondert sich nicht ohne weiteres bei Ge-
legenheit des körperlichen Nahrungserfordernisses aus einem blinden
Lebenswillen heraus, der unabhängig von physischem Zwange schon an-
fangs in uns hauste. Noch führt ihn der Nutzen des Leibes direkt und
unmittelbar herbei und spiegelt sich in jenem Willen gleichsam wieder;
letzterer hat gar nicht seinen positiven Gegenstand an dem, was das
Leben fördert. Sondern wir widerstreben der Unlust des Hungers und
wollen positiv nichts weiter als die Mittel, sie los zu werden. W i r sind
nicht Wesen, die leben wollen, sondern Wesen, die Unlust fliehen"
(SCHWARZ 1900, S. 28).
Vermeidung von unangenehmen Zuständigkeiten und Realisation von
angenehmen Zuständlichkeiten als Ziele menschlichen Verhaltens
D a unter Abwesenheit störender Bedingungen die Tendenz, Unlust
zu vermeiden, eine generelle ist (siehe unsere operationale Kennzeich-
nung der unangenehmen Zuständlichkeiten, S. 12 f.) und unangenehme
Zuständlichkeiten nicht nur organische Ursachen haben, sondern auch
nur mit psychologischen Begriffen faßbare, wird dem unbegrenzten An-
spruch der nativistisch-physiologischen Triebtheorien, durch willensjen-
seitige „Triebe" das gesamte intendierte menschliche und tierische Ver-
halten zu erklären, durch unsere Grundannahme widersprochen: Eines
21 Diese von SCHWARZ im Jahre 1900 formulierten Annahmen decken sich — soweit
w i r sehen — was den Lernvorgang betrifft, weitgehend mit den Überlegungen der
effektorientierten Lerntheorien neueren Datums, wenn hier auch „mentalistische"
Begriffe wie „Begehren" und „Vorstellung" vermieden werden. Den ScHWARZschen
Überlegungen scheint uns die Theorie TOLMANS am nächsten zu stehen.
38
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
der Ziele intendierten menschlichen Verhaltens ist die Vermeidung von
unangenehmen Zuständlichkeiten.
Die Vermeidung der bei Abweichung vom biologisch-physiologischen
Sollzustande auftretenden unangenehmen Zuständlichkeiten ist also Ziel
unseres Verhaltens und nicht der Sollzustand selber. Ebenso ist unser
Verhalten auf die angenehmen Zuständlichkeiten gerichtet, die einen
Sollzustand begleiten oder kurz vor seiner Realisation auftreten. D a
unter Abwesenheit störender Bedingungen die Tendenz, angenehme Zu-
ständlichkeiten anzustreben, eine generelle ist, folgt daraus ein weiterer
Grundsatz: Eines der Ziele intendierten menschlichen Verhaltens ist die
Realisation angenehmer Zuständlichkeiten. In diesem Grundsatz ist der
Umstand einbegriffen, daß unter angenehmen Zuständlichkeiten nicht
nur in Verbindung mit einem physiologischen Sollzustande auftretende
Leiblidikeitsempfindungen und Gefühle verstanden werden, sondern
auch Zuständlichkeiten, deren Ursachen und/oder mit ihnen vom Subjekt
in Grund-Folge-Beziehung gebrachten Umstände in psychologischen Be-
griffen definiert sind.
Koppelung von physiologischen Sollzuständen und angenehmen und
unangenehmen Zuständlichkeiten
Nun mag der Schluß naheliegen, daß, wie es SCHWARZ ausdrückt,
durch die Koppelung von physiologischen Sollzuständen mit angeneh-
men Zuständlichkeiten und die Koppelung von Abweichungen von jenen
mit unangenehmen Zuständlichkeiten „die Natur unseren Willen in
ihren Dienst zwingt" (SCHWARZ 1900, S. 27), was wiederum bedeuten
würde, daß das handelnde und erlebende Ich doch nur eine „Marionette"
in einem „Stück" wäre, in dem es eine Rolle spielt, die ihm ein unbe-
kannter „Autor" und „Regisseur" vorschreiben, ohne daß ihm die Frei-
heit einer eigenen Interpretation dieser Rolle bliebe. Eine kurze Uber-
legung zeigt, daß dieser Standpunkt einige ungeklärte Voraussetzungen
impliziert, die ihn von der Sichtweise einer einzelwissenschaftlichen Psy-
chologie her belasten. Was heißt denn „der Natur dienen"? Welchen In-
halt hat denn das „Stück", in dem wir spielen? Was ist der Inhalt der
Rolle für jeden einzelnen? Schon allein diese Fragen zeigen daß das
Problem die Kompetenzen des einzelwissenschaftlichen Psychologen
überschreitet. Macht man sich darüber hinaus klar, daß die zunächst ein-
deutig scheinende „Mittel-Zweck-Beziehung" von Zuständlichkeiten und
Sollzuständen gar nicht eindeutig ist (sind die Zuständlichkeiten „Mit-
tel", um den „Zweck" des Sollzustandes zu erreichen — oder ist der
Sollzustand „Mittel", um den „Zweck" der Zuständlichkeit zu errei-
chen?), so erkennt man, daß wir uns jenseits der theoretischen und empi-
39
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
rischen Möglichkeiten der einzelwissenschaftlichen Psychologie im Be-
reiche unüberprüfbarer Spekulationen bewegen, wenn wir nach einer
„Absicht" fragen, die Zuständlidikeit und Sollzustand miteinander kop-
pelt. Wir können im Rahmen der Psychologie nur auf das vorfindbare
Phänomen hinweisen, daß unter bestimmten Voraussetzungen Sollzu-
stände und Zuständlichkeiten in raumzeitlidier Kontiguität (zur gleichen
Zeit beim gleichen Individuum) vorliegen, Vermutungen über ein
„Warum" sind empirisch nicht überprüfbare Spekulation und haben in
der Psychologie keinen Ort.
Daß diese Koppelung zwischen Sollzuständen und Zuständlichkeiten
keine generelle ist, wurde weiter oben schon erwähnt. Wir essen z. B.
nicht nur, weil uns die den Hunger begleitenden Zuständlichkeiten unan-
genehm sind, sondern auch, weil es uns schmeckt, weil wir Lust am Essen
haben. „So kommt es, dass wir zuletzt weiter essen, in anderen Fällen
weiter trinken, auch wenn das Hunger- und Durst-Gefühl vorüber ist.
Ebendeshalb i s t . . . der Gaumen- und Schlundkitzel beim Essen und
Trinken... nicht ungefährlich. Er ladet ein, zu viel und zu oft zu essen
und zu trinken, so dass das Mittel, das dem Leben des Leibes nützen
sollte, leicht dahin'umschlägt, ihm zu schaden" ( S C H W A R Z 1900, S. 29).
Diese Überlegungen führen zu der Vermutung, daß in den „klassi-
schen" Effekttheorien des Lernens von H Ü L L (1943) und M I L L E R & D O L -
LARD (1941) eine unangemessene Auffassung von dem vertreten wurde,
was als „Verhalten verstärkend" zu betrachten sei.
Denn es sind ja keineswegs die physiologischen Sollzustände (die als
Kennzeichen dafür gelten, ob ein „Trieb" vorliegt oder nicht), auf die
das Verhalten gerichtet ist, sondern die diese Sollzustände begleitenden
oder ihnen vorangehenden angenehmen Zuständlichkeiten. Die Motiva-
tion für viele Arten von Verhalten ist also ganz „vordergründig", wir
brauchen keinen geheimnisvollen, im Verborgenen wirkenden Trieb-
mechanismus, wenn wir Verhalten erklären wollen, dessen „Reinforce-
ment" in Form der Realisation angenehmer oder der Vermeidung unan-
nehmer Zuständlichkeiten (in der behavioristischen Terminologie würde
man von einem „positiven Stimulus" sprechen) offen vor uns liegt.
Diese Annahme wird durch die Ergebnisse der bekannten Unter-
suchung von SHEFFIELD & R O B Y (1950) gestützt, die in einem einfachen
Rattenexperiment nachwiesen, daß hungrige Ratten ein Verhalten lern-
ten, dessen zielbildende Endhandlung in der Aufnahme einer stark kon-
zentrierten süßschmeckenden Saccharinlösung bestand, die überhaupt
keinen Nährwert hatte, den Hunger also keineswegs reduzierte. Die
Vermutung, daß es sich bei dem Belohnungswert der Saccharinlösung um
eine „erworbene" verstärkende Eigenschaft des Stimulus handelt, wurde
zurückgewiesen: „The possibility that the sweet taste was an acquired
40
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
reward rather than a primary reward was shown to be extremely un-
likely" ( S H E F F I E L D & R O B Y 1950, S . 481). Die Zurückweisung basiert vor
allem auf zwei Argumenten: „For one thing, previously experienced
sweet tastes (e. g., rat's milk, conversion of starch to sugar in the mouth,
etc.) are very unlikely to have been as sweet as the concentrated sacchar-
ine solution used. Thus the sweet taste used would be at an unfavorable
point on the generalization gradient as an acquired reward stimulus if we
make the usual assumption that the generalization gradient falls in
either direction from the stimulus intensity reinforced. Moreover, the
sweet taste did not lose its reward value throughout the three experi-
ments, with the ingestion of thousands of ccs. of saccharine solution and
no doubt millions of instrumental tongue movements. Since the visual,
kinesthetic, tactile, and gustatory pattern accompanying this ingestion in
all three experiments (drinking from a glass tube protuding from a
visible graduated cylinder through quarter-inch wire mesh) received no
primary reinforcement, it would be expected that any acquired reward
value of a sweet taste would have extinguished for this pattern" S H E F -
FIELD & R O B Y 1 9 J O , S. 479). Allein die Tatsache, daß das, was ihnen
angeboten wurde, süß schmeckte (ihnen also, wie wir annehmen, zu einer
angenehmen Zuständlidikeit verhalf), genügte den Ratten, um ihr Ver-
halten auf dieses Angebotene zu richten. Ob diese Substanz, die süß
schmeckte, zur Realisation eines physiologischen Sollzustandes beitrug
oder nicht, war völlig irrelevant.
Darauf, daß der verstärkende Effekt einer Belohnung in der Quali-
tät der Stimulation liegt, die von der Belohnung hervorgerufen wird,
hatte schon T R O L A N D in seiner ziemlich unbekannten „beneceptor"-
Theorie hingewiesen ( T R O L A N D 1928). "Wir befinden uns aber auch mit
der Theorie von T H O R N D I K E (1913) in Einklang, nach der ein „satisfying
state of affairs" eine entscheidende Variable bedeutet, die den Erwerb
von Verhalten steuert; obwohl der von T H O R N D I K E verwendete Begriff
als außerhalb des Rahmens einer Erlebnis- und Bewußtseinspsychologie
stehend konzipiert ist, scheint er unter anderem audi das zu decken, was
wir als „angenehme Zuständlidikeit" bezeichnen.
Elektrische Hirnreizung und Zuständlichkeiten
Interessant sind in diesem Zusammenhang die Untersuchungen von
OLDS&MILNER (19 J4) und O L D S & O L D S (1965), in denen Ratten ein
bestimmtes Verhalten lernten, wenn dieses Verhalten eine elektrische
Reizung des Rattenhirns zur Folge hatte.
„When electrodes were implanted in the forebrain system and a
circuit was arranged to make a brief train of electric stimulation occur
4i
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
as a regular consequence of some response in the behavior repertory of
the rat, that response soon came to predominate, occurring eventually at
its maximum possible rate. In this and many other kinds of experiments,
the electric stimulation appeared to serve as a maximal source of animal
gratification; in the parlance of the behavioral psychologist, it was a
source of 'positive.reinforcement'" ( O L D S & O L D S 1965, S. 335 f.). Ent-
scheidend bei dem Experiment von O L D S & M I L N E R war der Umstand,
daß die Ratten durch die elektrische Selbst-Stimulation in der Septal-
Area keinen explizit definierten „Trieb" reduzierten, also keinen physio-
logisch aufweisbaren „Sollzustand" herbeiführten. „ . . . as the animals
are given free access to food and water at all times except while actually
in the Skinner boxes, there is no explicitly manipulated drive to be
reduced by electrical stimulation" ( O L D S & M I L N E R 1954, S. 425).
Daß die Ratten durch die elektrische Reizung auf irgendeine Weise
„positiv affiziert" wurden, läßt der „klinische Eindruck" vermuten, den
die Autoren von dem Verhalten der Ratten haben: „As there is no evi-
dence of a painful condition preceding the electrical stimulation... It is
perhaps fair in a discussion to report the 'clinical impression' of the Es
that the phenomenon represents strong pursuit of a positive stimulus
rather than escape from some negative condition" (S. 425 f.).
Zwar sind die Autoren um eine rein behavioristische Terminologie be-
müht, jedoch dürfte es keine zu eigenwillige Interpretation der Ergeb-
nisse unsererseits sein, wenn wir annehmen, daß die elektrische Reizung
der Septal-Area einer Ratte für diese von einer angenehmen Zuständ-
lichkeit begleitet war. Daß wir nicht unberechtigt „mentalistisch" argu-
mentieren, beweist die Verwendung des ebenfalls „mentalistischen" Be-
griffes „painful" durch O L D S & M I L N E R 2 2 . A U S der Untersuchung folgt
demnach eindeutig, daß Verhalten auch dann auf die Realisation von
angenehmen Zuständlichkeiten gerichtet sein kann, wenn diese Zuständ-
lichkeiten mit keinem physiologischen Sollzustand in Beziehung stehen,
wie wir es ja schon weiter oben postuliert haben.
Wer nun behaupten wollte, die Untersuchung von O L D S & M I L N E R be-
sitze keinen Aussagewert im Rahmen unseres Problems, weil die dort
eingeführten Bedingungen „nicht natürlich" seien, der macht sich, außer
daß er eine unbewiesene Behauptung aufstellt (da er zunächst beweisen
müßte, daß die elektrophysiologischen Prozesse, die gleichzeitig mit der
Realisation angenehmer Zuständlichkeiten an entsprechender Stelle ab-
laufen, nicht mit denen identisch sind, die bei elektrischer Reizung von
„außen" auftreten), der impliziten Annahme einer prästabilierten Har-
monie von physiologischen Sollzuständen und Zuständlichkeiten ver-
22
Wir werden auf dieses Problem noch näher eingehen.
42
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
dächtig, die er niemals empirisch psychologisch beweisen könnte, da es
sich hierbei wieder um ein metaphysisches Prinzip handelt.
„Prästabilierte Harmonie" würde in diesem Zusammenhang bedeu-
ten, daß irgendeine „höhere Instanz" physiologische Sollzustände und
Zuständigkeiten einander zuordnet, und zwar immer und notwendiger-
weise. Dem gegenüber steht unsere Annahme, daß aus dem Umstand der
möglichen Zuordenbarkeit von Zuständlichkeiten und Sollzuständen
unter bestimmten genau definierbaren Umständen (wobei diese Zuord-
nung niemals direkt vorgefunden ist, sondern als integrierendes Prinzip
vom Forscher eingeführt wird) niemals eine vorgegebene notwendige
Zuordnung abzuleiten ist. Vielmehr ist aus den Ergebnissen der zuletzt
geschilderten Untersuchungen ersichtlich, daß das Integrationsprinzip
der Zuordnung durchaus begrenzt ist. Die Argumentation, das in den
Untersuchungen geschilderte Verhalten der Tiere würde „in der Natur"
zu einem Aussterben dieser Tiere führen, trifft das Problem aus zwei
Gründen nicht: Einmal werden psychologische Aussagen niemals über
Vorgänge „in der Natur" gemacht, sondern über Vorgänge unter Be-
dingungen, die der Psychologe zur Realisation seiner Theorien (vgl. hier-
zu H O L Z K A M P 1964, 1968) experimentell herstellt. Aussagen über „Na-
tur" werden nur insofern gemacht, als die Bedingungen „in der Natur"
den Bedingungen im Experiment entsprechen. Das Verfahren, aus Vor-
gefundenem konstituierende Bedingungen zu isolieren (wie in der psy-
chologischen oder soziologischen „Feldforschung"), hat weitaus geringere
Dignität, da eine echte Kontrolle der konstituierenden und störenden Be-
dingungen niemals möglich ist, weil man sie ja nicht selbst herstellt. Zum
anderen hat die Psychologie das Verhalten und Erleben von Individuen
zum Gegenstand, solange diese leben. Ob es sich dabei um ein Indivi-
duum handelt, das sich fortpflanzt, oder um eines, das zwei Wochen nach
der Untersuchung stirbt, ist völlig irrelevant. (Hier muß eingefügt wer-
den, daß, soweit uns bekannt ist, Ratten, die an Lernexperimenten teil-
nehmen, gewöhnlich nach Beendigung dieser Experimente getötet wer-
den. Wird deshalb der Behaviorismus zu einer Wissenschaft über aus-
sterbende Tiere?)
Wenn wir uns hier und im folgenden gegen die Annahme eines gene-
rellen „Arterhaltungsprinzips" oder „-triebes" wenden, so bedeutet das
nicht, daß wir gegen die Aufstellung von Theorien sind, die solche E f -
fekte wie Art- und Selbsterhaltung erklären, sondern nur dagegen, daß
man bestimmte Mechanismen durch einen Effekt erklärt, der sich erst
am Ende des Medianismus ergibt. Man kann zwar von bestimmten Be-
dingungen sagen, daß ihr Vorhandensein Art- und Selbsterhaltung oder
aber Art- und Selbstvernichtung zur Folge habe, aber nicht, sie seien
dazu da, um Art- und Selbsterhaltung oder aber Art- und Selbstvernich-
tung zu gewährleisten. Im letzteren Falle würde man nämlich den Effekt
43
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
dem Mechanismus logisch vorordnen. Das wäre so, als ob man etwa auf
dem Gebiet der Wahrnehmungspsychologie behaupten wollte, die funda-
mentale Unterscheidung in Figur und Grund liege „nur" vor, um das
Erlebnis der Größenkonstanz zu sichern.
„Laster" und „Süchte" vs. „Arterhaltung"
Ähnliche Einwände, die mit „Unnatürlichkeit der Bedingungen"
argumentieren, sind daher von vornherein ad absurdum geführt, wenn
wir im folgenden aufweisen, daß Verhalten auch dann auf die Realisa-
tion von angenehmen Zuständlichkeiten gerichtet ist, wenn dieses Ver-
halten eine extreme Abweichung von physiologischen Sollzuständen zur
Folge hat, was dem (metaphysisch postulierten) „Zwecke der Art- und/
oder Selbsterhaltung" eindeutig abträglich wäre. Wir meinen damit all
jene Verhaltensweisen und Verhaltenstendenzen, die gewöhnlich als
„Laster" oder „Süchte" bezeichnet werden. Hier wird eindeutig Lust-
gewinn angestrebt bei gleichzeitig auftretendem Verfall des Leibes und
der leiblichen Fähigkeiten (als Beispiele mögen hier nur die Rauschgift-
sudit und die Alkoholsucht stehen). Gewiß treten bei vielen Süchten
neue physiologische Sollzustände auf, die das Individuum durch sein
Verhalten herstellt, aber entscheidend ist einmal, daß diese Sollzustände
sekundär, d. h. eine nichtintendierte Folge des lustbringenden Verhaltens
sind, zum anderen letztlich zu einer vorzeitigen Auflösung des Organis-
mus führen, weil sie von den ursprünglich und primär vorfindbaren phy-
siologischen Sollzuständen zu stark abweichen.
Daß das Haben einer angenehmen Zuständlichkeit bei gleichzeitiger
Abweichung von primären physiologischen Sollzuständen nicht nur im
menschlichen Bereich auftritt, zeigt auf eindrucksvolle Weise ein von
O L D S & O L D S (1965) referiertes Experiment mit Ratten, die sich nicht
selbst reizten, sondern in regelmäßigen Abständen von „außen" elek-
trisch gereizt wurden, ohne daß eine erkennbare Beziehung zwischen
Verhalten und Reizung vorlag. Die elektrische Stimulation erfolgte am
gleichen Ort und auf die gleiche Weise, die sich bei anderen Versuchen als
positiv verstärkend herausgestellt hatten. Diese Reizung desorganisierte
ein Verhalten der Ratten, durch das sie Futter erlangen konnten. Die
Scores des zum Futter führenden Verhaltens wichen um mehr als drei
Standardabweichungen von entsprechenden Kontrollwerten ab. Es ist
nicht anzunehmen, daß die „Qualität" der Reizung in den beiden Ex-
perimenten unterschiedlich war; der Schluß liegt nahe, daß die wäh-
rend der elektrischen Stimulation auftretende angenehme Zuständlich-
keit die Ratte davon abhielt, das zum Futter führende und damit den
physiologischen Sollzustand hervorrufende Verhalten zu zeigen, da ent-
44
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
weder eine durch entsprechende unangenehme Zuständigkeiten signali-
sierte „subjektive" Abweichung vom physiologischen Sollzustand (bei
einer objektiv vorliegenden Abweichung von diesem Sollzustand) nicht
gegeben war, weil während der elektrischen Reizung die unangenehmen
Zuständlichkeiten nicht existent waren oder sogar eine angenehme Zu-
ständlichkeit vorherrschte (Summationsannahme). Oder aber die Ratte
„entschied" sich bei den beiden möglichen Verhaltensmodi „ungeregeltes
Verhalten — angenehme Stimulation" gegenüber „geregeltes Verhalten —
Reduktion der durch Abweichung vom physiologischen Sollzustand her-
vorgerufenen unangenehmen Zuständlichkeiten" für den ersten, was als
Hinweis auf eine Präferenz und somit eine Hierarchie der Zuständlich-
keiten anzusehen wäre (Konfliktannahme).
Beide Interpretationen würden unsere These stützen, daß intendier-
tes Verhalten primär nicht auf die „Erfüllung" physiologischer „Nor-
men", die als organisches Kennzeichen „primärer Triebe" anzusehen
wären, gerichtet ist, sondern daß die Realisation angenehmer und das
Vermeiden unangenehmer Zuständlichkeiten viel entscheidender sind.
Die Untersuchung von OLDS ( 1 9 5 8 ) demonstriert, daß auch bei Tie-
ren „Laster" oder „Süchte" auftreten können, die schließlich eine Schädi-
gung des Organismus zur Folge haben. Ratten, denen Elektroden in den
Hypothalamus eingepflanzt worden waren, kamen zu einer ESB-Rate
(ESB = electrical Stimulation of the brain) bis zu 1 0 0 0 0 (zehntausend)
Selbstreizungen in der Stunde: "5s with hypothalmic electrodes main-
tained rapid rates until slowed by sheer pbysical exhaustion" (OLDS
1958, S. 676; Hervorhebung v. Ref.). Die Ratten strebten also die ange-
nehmen Zuständlichkeiten auch dcinn an, wenn diese von einem körper-
lichen Zustand totaler Erschöpfung gefolgt waren; kann man sich einen
konsequenteren „Epikuräismus" vorstellen?
Die Ergebnisse dieser interessanten Untersuchung, die uns später noch
einmal beschäftigen wird, sprechen eindeutig für unser Postulat vom
psychologischen Primat der Zuständlichkeit gegenüber dem biologisch-
physiologischen Zustand.
Kritik der Annahme einer „prästabilierten Harmonie" bei KRAFT
Damit befinden wir uns im offenen Widerspruch zu den Behauptun-
gen, die K R A F T im Rahmen seiner „Grundlagen einer wissenschaftlichen
Wertlehre" aufstellt. K R A F T sieht die Nahrungssuche und Nahrungswahl
als unabhängig von den angenehmen Zuständlichkeiten, die die Nahrung
hervorruft: „Die spezifische Nahrung wird in ganz unmittelbarer Weise
45
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
aus dem Chemismus des Körpers heraus ohne Einfluß des Bewußtseins,
von Erfahrung oder von Lustbetonung als annehmbar charakterisiert,
als das Nahrungsbedürfnis befriedigend" ( K R A F T 1 9 5 1 , S. 140). K R A F T
kommt zu dieser Auffassung anläßlich der Diskussion des Verhaltens
einiger Tiere, wenn bei diesen Tieren ein definierbarer Mangel bestimm-
ter Substanzen im Organismus vorliegt. „So fressen Hennen zur Zeit des
stärksten Eierlegens gern Eierschalen und überhaupt kalkhaltige Stoffe,
während es der Hahn nie tut. Oder Kaninchen fressen bei Beginn der
Stillzeit mehr Grünzeug, das dem Blut Eisen zuführt" ( K R A F T , S. 139 f.).
Die Argumentation von K A T Z (1932), daß sich auch die Geschmacks- und
Geruchscharaktere der Objekte gemäß der Abgestimmtheit des Organis-
mus ändern, daß kalkhaltige Stoffe den Hennen eben gut schmecken,
sobald sie sie brauchen, weist K R A F T mit der Begründung zurück, daß
wir nicht mehr wissen, „als daß solche Stoffe von den Tieren gern ange-
nommen werden, daß sie ihnen willkommen sind. Darüber, daß ihr Ge-
schmack dann besonders lustvoll ist, wissen wir nichts" ( K R A F T , S. 140).
Wir könnten deshalb auch nicht sagen, „daß die Kalkstoffe von den Hen-
nen deshalb so gern gefressen werden, weil sie ihnen so gut schmecken,
weil sie besondere Lustgefühle bei ihnen auslösen" (S. 140). Abgesehen
davon, daß diese seltsame Auffassung K R A F T S durch die Ergebnisse der
Untersuchung von SHEFFIELD & R O B Y (1950) auf eindrucksvolle Weise
empirisch widerlegt worden ist (vgl. S. 40 f.), wirft sie noch andere Pro-
bleme auf.
Zunächst einmal gibt K R A F T keine Auskunft darüber, wie denn „in
ganz unmittelbarer Weise aus dem Chemismus des Körpers heraus ohne
Einfluß des Bewußtseins, von Erfahrung oder von Lustbetonung" die
spezifische Nahrung als annehmbar zu charakterisieren sei. Welches sind
die Mechanismen, die unter Ausschaltung des Bewußtseins, der Erfah-
rung oder der Lustbetonung das Aufsuchen und Finden gerade der „rich-
tigen" Nahrung ermöglichen? Liegt hier eine besondere Form prästabi-
lierter Harmonie vor? Oder ist es etwa ein weiteres Phänomen, das durch
den Begriff „außersinnliche Wahrnehmung" gedeckt wird?
Zum anderen scheint uns K R A F T hier eine besondere Form von „be-
havioristischem Solipsismus" zu vertreten: Weil uns die Zuständlich-
keiten der Tiere nicht direkt gegeben sind, soll es uns verboten sein, sie
als Erklärungsvariable einzuführen. Nun sind K R A F T ja die Z u s t ä n d i g -
keiten anderer Leute auch prinzipiell nicht gegeben, sondern bestenfalls
auf diese Zuständlichkeiten bezogenes Verhalten, aber dennoch widmet
er einen großen Teil seines Buches den Phänomenen der Lust und der Un-
lust, als wären dies allgemeine bei allen Menschen vorfindliche Zuständ-
lichkeiten, während er doch eigentlich nur über „seine" Lust und Unlust
schreiben dürfte, da nur diese ihm direkt gegeben sind. Hier scheint uns
zumindest eine gewisse einseitige Inkonsequenz vorzuliegen, die durch
46
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
nichts explizit begründet wird. Ist allein die Tatsache, daß Tiere uns
nicht „sagen" können, ob und was sie „fühlen", ausreichend, um der
Einführung des Begriffes der Zuständlichkeiten auch für Tiere als Er-
klärungsmoment jegliche Berechtigung abzusprechen? Giltallein „Sprache"
als Kennzeichnung für Zuständlichkeiten? Dann müßte man auch dem
Kleinkind, das noch nicht sprechen kann, die Möglichkeit, zu erleben,
konsequent absprechen. Wir meinen, daß die Einführung des Begriffes
Zuständlichkeit in Form eines „hypothetical construct" (vgl. die Unter-
scheidung zwischen „intervening variable" und „hypothetical construct"
bei MacCoRQUODALE & MEEHL 1948) auch für Tiere theoretisch und
empirisch von größerer Bedeutsamkeit und Fruchtbarkeit ist als die An-
nahme einer alles und nichts erklärenden „unmittelbaren Weise" bei
KRAFT. Im übrigen befinden wir uns damit auf gleicher Linie mit moder-
neren behavioristischen Theorien, die explizit von „drive produced Sti-
muli" sprechen (etwa HULL 1952).
Wir hoffen, im vorangegangenen aufgezeigt zu haben, wie gering
der Erklärungswert einer „physiologischen Willensmetaphysik" ist. Statt
durch verborgene „Triebmechanismen" kann unser Verhalten viel besser
als durch Ziele gesteuert erklärt werden, die explizit aufweisbar sind.
Körperliche Erfordernisse und Zuständlichkeiten
Nun soll hier keineswegs geleugnet werden, daß die Leiblichkeit unseres
psychophysischen Ich Ansprüche an uns stellt (SCHWARZ spricht in diesem
Zusammenhang von den „Erfordernissen unserer körperlichen Maschine"
— SCHWARZ 1900, S. 29). Gewiß müssen wir das einzige für uns un-
mittelbar vorfindliche „Werkzeug", das uns zur Erreichung unserer Wil-
lensziele dient, „pflegen". A n dieser Stelle sei uns ein veranschaulichen-
des Beispiel erlaubt, ohne daß wir damit den Standpunkt beziehen woll-
ten, der Mensch sei eine Maschine: Auch ein Auto müssen wir pflegen,
müssen es waschen, müssen tanken, ö l wechseln, abschmieren. Gewiß —
manchen Leuten wird die Pflege ihres Autos zum Selbstzweck, ebenso
wie anderen die Pflege ihres Leibes zum Selbstzweck wird; aber dies ist
doch nicht generell so. Wenn wir die uns gesteckten Willensziele errei-
chen wollen, müssen wir zwar den Ansprüchen unseres Körpers Genüge
tun, aber dieser „Vertrag", dem wir uns unser ganzes Leben lang nicht
entziehen können, ist ein „Vertrag auf Gegenseitigkeit". Wenn wir den
Ansprüchen unserer Leiblichkeit genügen, „handeln" wir dafür die Re-
alisation angenehmer und die Vermeidung unangenehmer Z u s t ä n d i g -
keiten ein; außerdem wird es uns möglich, andere viel entscheidendere
Willensziele zu verfolgen. Wir befinden uns damit in Widerspruch zu
47
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
NIETZSCHE, der im Wollen des Ichs einen Umweg zum Zwecke des
Leibes sieht. Nicht stehen die Ziele des "Willens im „Dienst der Zwecke
des Leibes", sondern nur mit einem intakten Leib können wir die
„Ziele und Zwecke des Willens" erreichen. Deshalb müssen wir essen,
trinken, schlafen23, uns gegen Angriffe verteidigen. Aber weit davon
entfernt, unsere eigentlichen Willensziele darzustellen, ist die Realisation
der angezielten physiologischen Sollzustände eher geeignet, uns von der
Verwirklichung unserer Ziele und somit von intendiertem Verhalten
abzuhalten: Die Sollzustände können nicht als Ursache und Steuerung
dieses intendierten Verhaltens gelten. Wie oft erzwingt nicht die Inten-
tion, die den Hunger und die Müdigkeit begleitenden unangenehmen Zu-
ständlichkeiten zu vermeiden, eine Unterbrechung wichtiger zielgerichte-
ter Tätigkeiten. Das Beispiel von der „Befriedigung des Schlaftriebes", die
uns ja bekanntlich ungefähr ein Drittel unseres Lebens zur Inaktivität
zwingt, zeigt deutlich, daß das, was man in den Trieblehren als „An-
trieb" des Verhaltens ansieht, in sehr vielen Fällen das Verhalten lahm-
legt.
Ausblick auf den Hedonismus
Nachdem wir somit die Ansprüche der nativistischen physiologisch
orientierten Trieblehren zurückgewiesen haben, die all unser Verhalten
als durch physiologische „Normen" geprägt ansehen, wird es unsere
Aufgabe sein, unsererseits die Ziele intendierten menschlichen und tieri-
schen Verhaltens aufzuzeigen. Auf eines dieser Ziele haben wir schon
hingewiesen; es ist die Realisation angenehmer und die Vermeidung un-
angenehmer Zuständigkeiten. Die Lehre, die in dem Versuch der Ver-
wirklichung dieses Willenszieles den Kern der menschlichen und tieri-
schen Motivation sieht, heißt von alters her „Hedonismus". W i r werden
zu untersuchen haben, wieweit nun wiederum der hedonistische Anspruch
auf Alleingeltung seiner Annahmen gerechtfertigt ist. Kann das Streben
nach angenehmen und das Scheuen vor unangenehmen Zuständlidikeiten
alle unsere gewollten Handlungen erklären, oder gibt es noch andere
Willensziele?
Bevor wir diese Frage beantworten, sind jedoch noch einige einlei-
tende Begriffsklärungen notwendig, in denen wir Rechenschaft über die
formale Beschaffenheit von Willenszielen überhaupt ablegen.
23 Das enthaltsame Leben vieler Asketen beweist, daß die Befriedigung sexueller Be-
dürfnisse nidit unbedingt notwendige Voraussetzung der Verwirklichung von mehr
geistigen Willenszielen ist (ohne daß dies freilidi als Argument für die Berechtigung
der FREUDsdien Sublimierungsannahme anzuführen wäre).
48
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
II. Die Willensziele
i. W e r t e u n d W e r t g e g e n s t ä n d e
Verwirklichung von Werten als Ziel willentlichen Verhaltens
Das Wollen hat seinen Gegenstand in Willenszielen. Die umfassende
Bezeichnung, die S C H W A R Z allen mittelbaren oder unmittelbaren Wil-
lenszielen gibt, ist „Wert" ( S C H W A R Z 1900, S . 34).
Wir können demnach von jedem Verhalten, das logisch mittelbar
oder unmittelbar auf einen Willensakt folgt, sagen, daß es auf die Ver-
wirklichung der im Willensakt als nichtseiend gesetzten Werte geht24.
Daraus folgt der Grundsatz: Jedes Verhalten infolge eines Willensaktes
geht auf die Verwirklichung von Werten. Dies wird im folgenden klarer
werden, wenn wir uns die begrifflich-logischen Eigenarten des Begriffs-
gegenstandes „Wert" verdeutlichen.
Unterscheidung zwischen Wert und Wertgegenstand
Die ScHWARZsche Definition des Wertbegriffes ist insofern unscharf,
als sie nicht klar zwischen einem Wert als solchem und dem Gegenstande
oder Sachverhalte unterscheidet, in dem sich der als primär nichtseiend
gesetzte Wert „verwirklicht".
Die von S C H E L E R (1916) getroffene Unterscheidung zwischen Werten
und Wertträgern (Wertvollem) — (hierin folgen ihm auch u. a. R I C K E R T
1921, H O N E C K E R 1923, H E Y D E 1926 sowie K R A F T 195 I ) — ist deshalb
für eine Analyse des Wertbegriffes eine notwendige Voraussetzung. „Was
wertvoll ist, hat Wert, ist aber kein Wert, sondern ein Wertträger, ein
Gut. Ein Wertträger ist dasjenige, dem Wert zugeschrieben wird" ( K R A F T
1951, S. 10). Wertträger kann alles empirisch Vorfindbare sein: „Güter
sind etwas Konkretes, Individuelles" ( K R A F T , S. I I ) . Sind Wertträger
somit ein Spezielles, jetzt und hier Vorfindbares, so verstehen wir unter
„Werten" Begriffe, die Wertträger zum „Gegenstand" (im eigentlichen
Sinne)25 haben. „Werte im eigentlichen Sinn sind damit allgemeine, be-
griffliche Gehalte. Wie dem Wertvollen treten die Werte auch den Wer-
tungen gegenüber. Wertungen sind einzelne konkrete Erlebnisse in der
Zeit, sind empirische Tatsachen. Die Werte sind etwas, das in den viel-
14
V g l . unsere Kennzeichnung des Willensaktes auf S. 2$.
25
W i r sprechen in der Folge deshalb statt von „Wertträgern" nur noch von „ W e r t -
gegenständen", wobei es gleichgültig ist, ob es sich dabei um einen einzelnen oder
mehrere reale Gegenstände, einen Sachverhalt oder andere empirische Gegebenhei-
ten (z. B. Erlebnisse) handelt.
4 Keiler, Wollen
49
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
fachen "Wertungen als dasselbe aufzuweisen ist. Sie sind ihnen gegenüber
etwas Einheitliches und etwas Zeitloses. Werte sind .ideelle Bedeutungs-
einheiten' — eben als Begriffsgehalte. Diese stellen sich in den Wert-
begriffen dar" (KRAFT 1 9 j r , S. 11).
Die logische Ordnung von Wert und Wertgegenstand
Durch einen Wertbegriff wird ein Wertgegenstand als mittelbar oder
unmittelbar einen Wert verwirklichend gekennzeichnet (z. B.: „dieser
Gegenstand ist ,schön'" bedeutet „dieser Gegenstand verwirklicht den
Wert des , S c h ö n e n ' „ d i e s e r Mensch ist ,gut'" bedeutet „dieser Mensch
verwirklicht den Wert des .Guten'" usw.). Auch wenn ich von einem
bestimmten realen Urteilsgegenstand sage, er „gefalle" mir, so ist das
eine Kennzeichnung dieses Gegenstandes als wertverwirklichend. Wie die
Normen ihrer Erfüllung in einem bestimmten Sollsein und/oder einem
Sollzustand logisch vor- und übergeordnet sind, sind auch die Werte
ihrer Verwirklichung in einem Wertgegenstand logisch vor- und über-
geordnet. Das heißt, aus dem Sein und/oder Sosein des Wertgegenstandes
ist über die Feststellung hinaus, daß dieser Gegenstand einen bestimm-
ten Wert verwirkliche, nichts weiteres über den begrifflichen Inhalt des
Wertes ausgesagt; wir können also nicht vom Wertgegenstand auf den
Wert schließen. Ebenso ist es in der Regel nicht möglich, aus einem
bestimmten Sollsein und/oder Sollzustand begrifflich die Norm abzu-
leiten, die darin erfüllt ist. Jedoch gilt die Ausnahme, daß die begriff-
liche Fassung eines bestimmten Sollseins und/oder Sollzustandes als
Norm gilt, wenn eben dieses Sollsein und/oder eben dieser Sollzustand
in ihrem Gesamt als einzig mögliche Erfüllung der Norm anzusehen
sind, wenn also die Norm einen bestimmten Begriffsgegenstand in
seiner Individualität völlig erfaßt. Analog hierzu gilt, daß, wenn ein
Wert einen bestimmten Wertgegenstand in seiner Individualität völlig
anzielt und allein in diesem Wertgegenstand eine Verwirklichung des
Wertes möglich ist, die begriffliche Fassung des Wertgegenstandes den
Wert darstellt. Für diesen speziellen Fall gehen sowohl der Anspruch
der Norm als auch der Anspruch des Wertes, als allgemeine Begriffe zu
gelten, verloren.
Nicht Werte, sondern ihre Verwirklichungen sind Gegenstand
des Wollens
W a r durch die Setzung einer Norm das Sosein der normerfüllenden
Begriffsgegenstände eindeutig festgelegt, ist mit dem Wollen eines
Wertes nur das Wollen von Wertgegenständen mitgesetzt, ohne daß
50
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
individuelle Begriffsgegenstände oder Klassen von Begriffsgegenständen
in ihrer Existenz oder ihrem Sosein angezielt wären. Wenn ich den
Wert der „Schönheit" will, ist damit noch nichts über jene Frau aus-
gesagt, die, sobald ich ihrer ansichtig werde, mir gefällt und von mir
als den Wert der „Schönheit" verwirklichend beurteilt wird. Das heißt,
ich kann von der Verwirklichung eines Wertes sprechen, wenn bestimmte
aus dem Wert ableitbare Bedingungen vorliegen, ohne daß jedoch die
Erfüllung eben dieser Bedingungen positiv zwingend aus dem Wollen
eines Wertes folgt.
Aus diesen begrifflichen Festlegungen folgt, daß das Wollen nie auf
die speziellen Werte direkt gehen kann (man kann keine Begriffe wol-
len), sondern nur auf die Verwirklichung von Werten; d. h., ein Willens-
akt setzt nicht den Wert als Begriff, als ideelle Bedeutungseinheit, son-
dern setzt diesen Begriff als „zu verwirklichenden". Diese Bestimmung
ist nötig, da sonst zwischen der Setzung eines zu verwirklichenden
Wertes und der rein kognitiven Setzung eines Begriffes kein Unter-
schied bestünde.
Begriffslogische Bestimmungen über die Verwirklichung von Werten
(in Anlehnung an S C H E L E R )
Welcher Begriff soll nun aber für das Gesamt aller Verwirklichungen
von Werten gelten? In Anlehnung an S C H E L E R (1930, S . 21) kommen wir
zu der Feststellung, daß in der Verwirklichung von Werten ebenfalls
ein Wert zu sehen ist, und zwar ein umfassenderer, als er sich in den
speziellen Werten darstellt. Die Verwirklichung von Werten ist somit
der allgemeinste Wert, er wird in der Realisation spezieller Werte
verwirklicht (wir werden auf dieses Problem anläßlich der Unterschei-
dung zwischen „realen" und ¿irrealen" Werten zurückkommen).
Wie der einzelne Willensakt, die einzelne Willensregung, die ein-
zelne Strebung auf die je spezielle Verwirklichung eines je speziellen
Wertes oder auf einen je speziellen Wertgegenstand gehen, geht das
Gesamt dieser Willensakte und -regungen, der Wille, auf die Ver-
wirklichung von Werten und auf Wertgegenstände überhaupt. Der posi-
tive Gegenstand des Willens sind die Verwirklichung von Werten und
Wertgegenstände überhaupt.
Nun geht das Wollen aber nicht nur auf das, was ihm als zu Ver-
wirklichendes gilt, sondern auch auf das, was ihm als „nicht zu Ver-
wirklichendes" gilt, auf das, dessen Existenz und/oder Sosein es „nicht
will". So stehen den Werten (positiven Werte) Unwerte (negative
Werte) gegenüber. Wie wir den Werten Wertgegenstände oder Güter
4.
5i
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
zuordnen, werden den Unwerten Übel zugeordnet. In den Übeln (die
wiederum einzelne oder mehrere reale Gegenstände oder Sachverhalte
sein können) werden die negativen Werte oder Unwerte verwirklicht.
Das Wollen geht demnach positiv auf die NichtVerwirklichung von
Unwerten, auf die Nichtexistenz von Übeln26. Da die Verwirklichung
von Unwerten überhaupt als allgemeinster Unwert gelten muß und die
NichtVerwirklichung von negativen Werten überhaupt als positives
Ziel des Wollens gilt, folgt daraus tautologisch, daß die Nichtverwirk-
lichung eines Unwertes selbst einen positiven Wert darstellt. Da das
Wollen einen weiteren negativen Gegenstand in der Nichtverwirk-
lichung positiver Werte hat, ergeben sich in Anlehnung an S C H E L E R fol-
gende Grundsätze.:
1. Die Verwirklichung eines positiven VPettes ist selbst ein positivet
Wert.
2. Die NichtVerwirklichung eines positiven Wertes ist selbst ein negati-
ver Wert.
j. Die Verwirklichung eines negativen Wertes ist selbst ein negativer
Wert.
4. Die NichtVerwirklichung eines negativen Wertes ist selbst ein posi-
tiver Wert.
(Vgl. hierzu SCHELER 1930, S. 21 f.)
So ist in dem Satz „der positive Gegenstand des Willens ist die
Verwirklichung von Werten überhaupt" tautologisch der Umstand mit-
gegeben, daß damit die NichtVerwirklichung von Unwerten überhaupt
ebenfalls positiver Gegenstand des Willens ist. Eine analoge tautolo-
gische Umformung ist für den Satz „der negative Gegenstand des Willens
ist die Verwirklichung von Unwerten überhaupt" möglich27.
Die Operationalisierbarkeit von Werten und die Widerstände, die einer
Wertverwirklichung entgegenstehen
Die Festsetzung, daß Werte in Wertgegenständen und Unwerte in
Übeln verwirklicht werden, gibt der Möglichkeit Raum, Werte zu
26
Aus diesen Überlegungen soll klar werden, daß ein Gegenstand nicht schon deshalb
zum „ Ü b e l " wird, weil sich das Wollen nidit auf ihn richtet, weil er dem Wollen
„gleichgültig" ist, sondern Voraussetzung für ein „ Ü b e l " ist vielmehr, daß es ein
„negativer Gegenstand" des Wollens ist, also ein Gegenstand des Wollens über-
haupt.
17
A u d i hier muß berücksichtigt werden, daß es sidi bei diesen begrifflichen Fest-
legungen stets um echte „Gegenstände des Wollens" handelt. Gegenstände, die dem
Wollen „gleichgültig" sind, gehen nicht in die Definition ein (vgl. A n m . 26).
52
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
operationalisieren; und zwar gilt der Satz: Sofern ein Wert als zu
verwirklichender gesetzt wird, ist gleichzeitig die Möglichkeit seiner
Operationalisierung gesetzt28.
Der tatsächliche Erfolg oder Mißerfolg der Operationalisierung und
somit der Verwirklichung eines Wertes oder Unwertes entscheiden dar-
über, ob wir diesen Wert als „realen" oder als „irrealen" bezeichnen.
Analog zu den Normen gilt für Werte und Unwerte, daß ein realer
Wert oder Unwert durch einmalige Verwirklichung als solcher gekenn-
zeichnet ist. Die Kennzeichnung eines Wertes oder Unwertes als irreal
ist jedoch in vielen Fällen nur eine Kennzeichnung auf Zeit, weil wir
nur sagen können, daß bisher eine Operationalisierung und damit eine
Verwirklichung nicht möglich war.
Als allgemeinster Wert wird auf Grund seiner begrifflichen Fassung
der Wert der „Verwirklichung von positiven Werten überhaupt" im-
mer dann verwirklicht, wenn ein positiver Wert überhaupt verwirklicht
wird, denn sein Wertgegenstand liegt ja per definitionem in der Ver-
wirklichung von positiven Werten überhaupt. Analoges gilt für die
Verwirklichung des allgemeinsten Unwertes, der „Verwirklichung von
Unwerten überhaupt". So sind unter der Voraussetzung, daß die Ver-
wirklichung von Werten und/oder Unwerten überhaupt möglich ist, der
allgemeinste positive und der allgemeinste negative Wert a priori als
„reale" Werte gekennzeichnet.
Auch die Widerstände, die der Verwirklichung von Werten entgegen-
stehen, können in „materiale" und „methodische" unterteilt werden (vgl.
die Kategorisierung der einer Erfüllung einer Norm entgegenstehenden
Widerstände, S. 22). Sofern sie in der „Materie" der angezielten Gegen-
sltände liegen, werden die Widerstände als „materiale" bezeichnet; unter
den Begriff der „methodischen" Widerstände fallen z. B. jene, die aus
den Prinzipien der klassischen Logik erwachsen, die uns als Grundlage
jeder Operationalisierbarkeit gilt. Werte, deren Verwirklichung gegen
die Prinzipien der klassischen Logik verstieße, sind somit a priori als
„irreale" gekennzeichnet, da sie sich selbst die Möglichkeit der Opera-
tionalisierung absprechen und somit als „reale" einen Widerspruch in
sich darstellen.
Außer materialen und methodischen Widerständen, die wir als
„passive" bezeichnen, können der Verwirklichung von Werten Wider-
stände entgegenstehen, die sich aus der Setzung anderer Werte ableiten,
diese werden analog als „aktive" bezeichnet. So erwachsen z. B. einem
Arzt, der einen todkranken Patienten durch eine Injektion für immer
von seinen unerträglichen Schmerzen erlösen will, Widerstände aus
88 A u f gewisse formale Übereinstimmungen zwischen den Begriffen „Wert" und
„Theorie" soll später in einem Exkurs eingegangen werden.
53
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
dem Wert, der in der Erhaltung des menschlichen Lebens seinen Gegen-
stand hat. Die beiden für den Arzt verbindlichen Werte der „Leidens-
ersparung" und der „Lebenserhaltung" schließen sich in diesem konkre-
ten Fall offensichtlich gegenseitig von der Verwirklichung aus. Wir
haben hier die Situation, daß die Verwirklichung oder der Versuch der
Verwirklichung eines positiven Wertes die NichtVerwirklichung eines
anderen positiven Wertes mit sich bringt, so daß ein „Gut" durch die
Existenz eines „Übels" erkauft wird (die NichtVerwirklichung eines po-
sitiven Wertes ist selbst ein negativer Wert)29. Daß ein wollendes Indi-
viduum in einer solchen Situation meistens dennoch handlungsfähig
bleibt, liegt darin begründet, daß in den meisten Fällen für das Indi-
viduum entscheidbar ist, welches Gut als das „höhere" und/oder welches
Übel als das „geringere" anzusetzen sei, so daß auch aus einer „Konflikt-
situation" eindeutig determinierte Handlungen abzuleiten sind. Das
Phänomen des Konfliktes und seiner Lösung wird uns später noch be-
schäftigen, wenn wir das Problem der Rangreihen und Hierarchien der
Werte behandeln.
„Güter", „Übel" und „wertneutrale" Gegenstände
Nach diesen begrifflichen Festlegungen können wir empirische Ge-
gebenheiten in drei Kategorien unterteilen:
1. Empirische Gegebenheiten, in denen ein positiver Wert verwirklicht
wird („Wertgegenstände", „Güter").
2. Empirische Gegebenheiten, in denen ein Unwert verwirklicht wird
(„Übel").
3. Empirische Gegebenheiten, in denen weder ein Wert noch ein Un-
wert verwirklicht wird. Diese bezeichnen wir als „wertneutrale
Gegenstände"; sie sind weder positiver noch negativer Gegenstand
des Wollens.
Audi wertneutrale Gegenstände können gemäß unserer Definition
einzelne oder mehrere reale Gegenstände, Sachverhalte oder andere em-
pirische Gegebenheiten (z. B. Erlebnisse) sein.
Ein durch eine Norm gefordertes Sollsein und/oder ein durch eine
Norm geforderter Sollzustand sind per se zunächst wertneutral. Erst
wenn die Erfüllung einer Norm positiver Gegenstand des Wollens ist,
" Hieraus ergibt sich, daß jenen Werten, deren Verwirklichung den Prinzipien der
klassischen L o g i k widerspräche, in der Verwirklichung Widerstände zweifacher A r t
entgegenstehen: einmal sind es methodische, zum anderen ist es der Umstand, daß
den meisten Leuten explizit (in der Wissenschaft) oder implizit (im A l l t a g ) die
Prinzipien der klassischen L o g i k als Werte gelten.
54
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
wird der die Norm erfüllende Gegenstand zu einem Gut. Analog wird
ein eine Norm erfüllender Gegenstand zum Übel, wenn die Erfüllung
der Norm negativer Gegenstand des Wollens ist. So sind Normen, die
einem positiven Wert entgegenstehen, als negative Werte gekennzeich-
net, Normen im Sinne eines positiven Wertes dagegen als positive
Werte.
Diese Bestimmung hat zur Folge, daß die im Rahmen einer Operatio-
nalisierung eines positiven Wertes aus diesem Wert ableitbaren Hand-
lungsanweisungen formal zunächst imperativische Normen sind, die
unter Wertgesichtspunkten als positive Werte angesprochen werden müs-
sen, da sie ja als „Normen im Sinne eines positiven Wertes" gekenn-
zeichnet sind.
Sofern die Erfüllung einer Norm von einem Subjekt eine inten-
dierte Handlung (die nur einem Willensakt folgen kann) fordert (z.B.
in einer imperativischen Norm), kann diese Norm nicht mehr wert-
neutral sein. Als echter „Gegenstand" (im eigentlichen Sinne) des Wol-
lens ist in diesem Falle die Erfüllung der Norm nur entweder ein „Gut"
oder ein „Übel" (Satz vom ausgeschlossenen Dritten). Vom jeweiligen
„Vorzeichen" des in der Erfüllung der Norm angezielten Gegenstandes
ist es abhängig, ob die in diesen Überlegungen angesprochene Norm
als Wert oder Unwert gekennzeichnet ist. Alle Normen, die das inten-
dierte Verhalten eines Subjektes determinieren, sind deshalb notwen-
digerweise entweder Werte oder Unwerte („ich will, was ich soll" — „ich
will nicht, was ich soll"; „ich will, was ich nicht soll" — „icäi will nicht,
was ich nicht soll").
Aus dem Umstand, daß die im Rahmen der Operationalisierung
eines Wertes aus diesem Wert ableitbaren Handlungsanweisungen im-
perativische Normen sind, wird deutlich, daß mit dem im Willensakt
gesetzten Wert eine Norm gesetzt wird, die sich von anderen Normen
dadurch unterscheidet, daß sie eindeutig in einem Wollen ihre Ursache
hat und nicht als von „außen" gesetzt dem Wollen als vorgefundener
positiver oder negativer Gegenstand entgegensteht.
Ausblick auf die inhaltliche Analyse der Willensziele
Nachdem wir den Begriff des Wertes in seiner formalen Eigenart als
mittelbares (im Falle eines speziellen Wertes) oder unmittelbares (im
Falle des allgemeinsten Wertes der Verwirklichung von Werten über-
haupt) Ziel analysiert haben, wollen wir uns nun einer inhaltlichen
Analyse dessen widmen, was als Ziel des Wollens und somit des inten-
dierten Verhaltens angesehen werden kann.
55
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
D a wir wissen, daß das Wollen überhaupt Gegenstände haben kann
und wie diese Gegenstände formal beschaffen sind, muß darüber hinaus
auch eine inhaltlich-qualitative Kennzeichnung dessen möglich sein, was
dem Wollen als positiver oder negativer Gegenstand gilt. Die positiven
und negativen Zielinhalte des Wollens aufzuzeigen wird unsere nächste
Aufgabe sein.
2. Zustandswerte
Ausdehnung der erarbeiteten Begriffe auf die Tierpsychologie —
Kennzeichnung von angenehmen und unangenehmen Zuständlichkeiten
als Güter und Übel
Im Rahmen der Zurückweisung des physiologisch-metaphysischen
Willensansatzes in Form der „nativistischen Trieblehren" wurde als ein
Ziel intendierten menschlichen und tierischen Verhaltens die Realisation
angenehmer und die Vermeidung unangenehmer Zuständigkeiten auf-
gewiesen. D a intendiertes Verhalten tautologisch immer mittelbar oder
unmittelbar auf einen Willensakt folgt, ist mit dem Aufweis dieser
Willensziele zweierlei ausgesagt: Einmal ergibt sich als logische Folge
unserer Einführung des Begriffes „Zuständlichkeit" in Form eines
„hypothetical construct" auch für Tiere die Einführung eines weiteren;
auch Tieren muß die Möglichkeit, zu „wollen", zugesprochen werden.
Hierbei ist es unwichtig, ob tatsächlich jemals der Willensakt eines
Tieres als Phänomen aufweisbar ist (auch ein menschlicher Willensakt
kann uns ja als Phänomen immer nur in Form eines eigenen Willens-
aktes gegeben sein; dennoch sprechen wir auch anderen die Möglichkeit,
zu „wollen", zu, weil die Einführung dieses Begriffes uns eine bessere
Integration in bezug auf Interpretation und Voraussage des Verhaltens
anderer ermöglicht), es ist lediglich nachzuweisen, daß wir mit diesem
von uns eingeführten Erklärungsprinzip das uns gesteckte Ziel der
Erklärung und Voraussagbarkeit tierischen Verhaltens auf kürzerem und
eindeutigerem Wege erreichen, als es Theorien möglich ist, die diesen
Begriff nicht verwenden 30 .
Zum anderen sind die im willentlichen Verhalten angestrebten oder
gescheuten Zuständlichkeiten in ihrer allgemeinen begrifflichen Fassung
als Werte bzw. Unwerte gekennzeichnet; und zwar gelten uns ange-
30 Es sei darauf hingewiesen, daß in der Weltsicht der „naiven" Alltags-,,Theorien"
dem „Wollendsein" tierischen Verhaltens nicht nur als Erklärungsprinzip, sondern
sogar als „vorfindbare Tatsache" Rechnung getragen wird (was in diesem Zusam-
menhang natürlich nichts beweisen soll, sondern lediglich zeigt, daß dieses K o n -
struktum nicht völlig aus der Luft gegriffen ist).
56
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
nehme Zuständlichkeiten (besonders in ihrer extremen Ausprägung als
„Lust") als positive, unangenehme dagegen (besonders in ihrer extremen
Ausprägung als „Unlust") als negative Werte (Unwerte). D a die Güter
bzw. Übei dieser Werte bzw. Unwerte die je einzelnen Zuständlichkeiten
sind, bezeichnen wir diese Art von Werten mit S C H W A R Z als „Zustands-
werte". Als allgemeinster positiver Zustandswert gilt demnach die Re-
alisation von angenehmen Zuständlichkeiten überhaupt, als allgemein-
ster negativer die Realisation von unangenehmen Zusitändlichkeiten
überhaupt.
Nichtrückführbarkeit des Wertcharakters von angenehmen und
unangenehmen Zuständlichkeiten
Die Verwirklichung von Zustandswerten ist dem erlebenden Ich in
ganz unmittelbarer Weise Gegenstand seines Wollens; warum uns an-
genehme Zuständlichkeiten wert, unangenehme unwert sind, können wir
nicht erklären. Auch der mögliche Hinweis, der Wert oder Unwert liege
eben in der „Qualität" des „Angenehmen" oder „Unangenehmen", ver-
schiebt das Problem lediglich auf die Ebene, auf der wir fragen, was
denn an diesen „Qualitäten" sei, daß wir sie für unmittelbar wert oder
unwert halten. „Einen lustvollen Gefühlszustand halten wir unmittelbar
wert, einem unlustvollen schreiben wir unmittelbar Unwert zu; d. h. die
Zustände der Lust begehren wir um ihrer selbst willen, vor denen der
Unlust beben wir zurück. Die neutralen Gefühle dagegen, wie Staunen,
Verwunderung, Ehrfurcht, lenken den Willen überhaupt nicht auf sich;
eher sind es die Ursachen jener, die ihn fesseln" ( S C H W A R Z 1900, S. 37).
Wir können nicht erklären, warum es nicht umgekehrt ist, warum wir
nicht unangenehme Zuständlichkeiten statt angenehmer anstreben 31 ;
und zwar ist diese generelle Bevorzugung der angenehmen Zuständlich-
keiten gegenüber den unangenehmen so allgemein, daß sich immer dort,
wo eine unangenehme Zuständlichkeit als erlebte „Folge" eines inten-
dierten Verhaltens auftritt, nachweisen läßt, daß die unangenehme Zu-
ständlichkeit als Folge entweder nicht mitintendiert oder als „geringeres
Übel" einem „höheren Gut" untergeordnet wurde. Warum streben wir
nicht „Unlust" um ihrer selbst willen als höchstes Gut an, wo wir doch
die Möglichkeit haben, dies zu tun? Wir wissen es nicht; wir wissen
nur, daß uns niemand dazu zwingen kann, angenehme Zuständlichkeiten
zu wollen und unangenehme nicht zu wollen. D a ß wir es tun, erscheint
uns als nicht weiter rückführbares Phänomen.
81 D a ß dem Masochisten „Schmerz" als positives Willensziel gilt, darf hier nicht ver-
wirren, denn es muß angenommen werden, daß dem Masochisten „Schmerz" eine
angenehme Zuständlichkeit ist.
57
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Hier müssen wir dem möglichen Einwand entgegentreten, wir hätten
ja sdion in unserer operationalisierenden Kennzeichnung der angeneh-
men Zuständlichkeiten als Ziel eines „approach" und der unangenehmen
als Ziel einer „avoidance" „defini torisch" festgelegt, warum uns An-
genehmes als Wert und Unangenehmes als Unwert gilt; eben weil wir es
anstreben und damit wollen, oder aber es vermeiden und damit nicht
wollen. Dieser (mögliche) Einwand beruht auf zwei falschen Voraus-
setzungen: Einmal haben wir Streben und Scheuen nicht zur „Defini-
tion" der Begriffe „angenehm" und „unangenehm" verwandt, sondern
uns nur die vorgefundene nicht weiter rückführbare Koppelung von
„angenehm — Streben" und „unangenehm—Scheuen" für eine opera-
t i o n a l „Kennzeichnung" zunutze gemacht. Zum anderen wird übersehen,
daß ja das „Werthalten" nicht sekundäre „Folge" des Verhaltens ist, son-
dern umgekehrt das Werthalten der Zuständlichkeiten eindeutig „Ur-
sache" des Verhaltens. Warum wir Angenehmes unmittelbar für wert
und Unangenehmes unmittelbar für unwert halten, ist mithin immer
noch nicht geklärt.
Auch Y O U N G vermag in seiner interessanten Arbeit über „affective
arousal" ( Y O U N G 1967) dieses Problem nicht zu lösen. Zwar weist er
eindrucksvoll Korrelationen zwischen elektrophysiologischen Erregun-
gen bzw. Hemmungen im Bereich des Hypothalamus und angenehmen
bzw. unangenehmen Zuständlichkeiten auf, aber über die Feststellung
hinaus, daß „available evidence suggests that pleasantness is related to
nonspecific excitation and unpleasantness to nonspecific inhibition"
(S. 35), vermag er nur die (metaphysisch-biologisierende) Annahme an-
zubieten, daß „during the long course of evolution, structures have
developed that associate unpleasantness with biological harm and plea-
santness with biological welfare of individual or species" ( Y O U N G 1967,
S. 39). Abgesehen davon, daß diese Behauptung sachlich nicht ganz
richtig ist (denn diese Assoziation liegt ja, wie wir gesehen haben, nicht
generell und notwendigerweise vor), gibt sie keinen Aufschluß darüber,
warum denn nicht generell „biological harm" und „pleasantness" mit-
einander assoziiert sind, so daß wir zum Zwecke der „biological
welfare" „unpleasantness" anstreben. Implizit in alle „Koppelungs-
Annahmen" geht nämlich die Voraussetzung ein, daß angenehme Zu-
ständlichkeiten unmittelbar für wert, unangenehme jedoch unmittelbar
für unwert gehalten werden. Woher jedoch dieses unmittelbare Wert-
halten kommt, darüber legt man keine Rechenschaft ab. So muß auch
Y O U N G zugeben: „We do not yet know why sugar solutions are
immediately accepted and quinine immediately rejected" ( Y O U N G 1967,
S. 3 J)-
Diese Überlegungen zeigen, daß audi Versuche, die Grenzen der
einzelwissenschaftlichen Psychologie zu überschreiten und Hilfe bei be-
58
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
nachbarten Disziplinen zu suchen, scheitern, wenn es um die Frage
geht, warum wir angenehme Zuständlichkeiten gegenüber unangenehmen
bevorzugen. Daß diese Bevorzugung von der „Qualität" der Phänomene
her evident ist, sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, daß wir sie
nicht erklären können.
Unterscheidung zwischen „extremem" und „gemäßigtem" Hedonismus
Wir haben im Rahmen der Einführung des Begriffes der Zuständ-
lichkeiten bereits nachgewiesen, daß ein „extremer Hedonismus", der in
der Realisation von Lust und der Vermeidung von Unlust die einzigen
Willensziele sieht, von vornherein auf Schwierigkeiten stößt. Wir hielten
es für eine unangemessene Ausweitung der Begriffe Lust und Un-
lust, wenn diesen auch kognitionsnähere Zuständlichkeiten,, wie wir sie
z. B. in den Gefühlen, die ihre erlebte Ursache in den Ergebnissen des
eigenen Handelns haben (z.B. Erfolgs- und Mißerfolgserlebnisse) vor-
finden, subsumiert werden. Die Begriffe Lust und Unlust sollten uns
nur für jene Zuständlichkeiten gelten, bei denen die Dimension „ange-
nehm — unangenehm" für eine qualitative Kennzeichnung die entschei-
dendste ist (etwa in den Phänomen des „Schmerzes" oder der „Wollust").
Es soll hier noch einmal betont werden, daß wir in „Lust" und „Unlust"
nur Spezialfälle der umfassenderen begrifflichen Bestimmung „ange-
nehme" bzw. „unangenehme Zuständlichkeit" sehen.
So wäre denn die Ansicht, die Realisation angenehmer und die Ver-
meidung unangenehmer Zuständlichkeiten sei das einzige Ziel des Wol-
lens und Handelns, als „gemäßigter Hedonismus"32 zu bezeichnen. Die
Beispiele, die für eine Berechtigung der gemäßigten hedonistischen
Annahme sprechen, sind vielfältig und überzeugend. Den kurzen Abriß
einer einfachen gemäßigten hedonistischen Theorie gibt Y O U N G in dem
erwähnten Artikel ( Y O U N G I967). Hier scheint uns das hedonistische
Prinzip auf einleuchtende Weise auch in dem Bereich der experimentel-
len Tierpsychologie konsequent und fruchtbar angewandt. Y O U N G läßt
im übrigen keinen Zweifel daran, daß seine hedonistische Theorie auch
im Bereich der Tierpsychologie den Wertbegriff involviert: „The pre-
ferential behavior of my rats is definitely evaluative and indicative of
built-in evaluative mechanisms. These mechanisms can be studied objec-
tively, quantitatively, experimentally, critically. Although complex
32
U m Mißverständnisse zu vermeiden, weisen w i r darauf hin, daß w i r unter „ H e d o -
nismus" im Rahmen unserer Probleme ein wissensdiaftlidies „Erklärungsprinzip"
verstehen, keineswegs die als „Epikuräismus" bekannte Weltanschauung, die im
Streben nach Lust die entscheidende Lebensmaxime sieht (z. B. in O . WILDES „Dorian
Gray").
59
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
human evaluations are largely cognitive processes, the primary evalua-
tions of lower animals are mainly affective" ( Y O U N G 1967, S . 39).
Bei sehr vielen intendierten Handlungen läßt sich ohne weiteres
nachweisen, daß entweder die als „Folge" der Handlung anzusetzende
Zuständlichkeit als angenehme oder aber als Vermeidung einer unan-
genehmen Zuständlichkeit zu kennzeichnen ist. (Hierbei darf natürlich
das die angezielten Zuständlichkeiten zur „Folge" habende Verhalten
nicht als Kennzeichnung der Zuständlichkeiten verwandt werden, weil
dies ein Zirkel wäre, sondern eine legitime Kennzeichnung der Zuständ-
lichkeiten ist nur durch Verhalten mit Zeichencharakter33 — z. B. Sprache
oder Ausdruck — oder „Demonstration" möglich.) Gelangt eine gewollte
Handlung nicht zum Abschluß, so läßt sich auf dem angegebenen Wege
sehr oft nachweisen, daß ihr Ziel in der Verwirklichung eines positiven
Zustandswertesoder der NichtVerwirklichung eines Zustandsunwertes lag.
Die Bezogenheit von „Spiel" auf angenehme Zuständlichkeiten
Das „Reinforcement" einer gewollten Handlung muß aber nicht
unbedingt in der tatsächlichen oder der erwarteten „Folge" einer Hand-
lung liegen, vielmehr zeigt sich im Phänomen des „Spiels", daß Ver-
halten um seiner selbst willen auftreten kann. Diese Erkenntnis ver-
danken wir K A R L G R O O S , der sich in seinen beiden Büchern „Die Spiele
der Thiere" (1. Aufl. Jena 1896) und „Die Spiele der Menschen" (1. Aufl.
Jena 1899) auch mit der Frage nach der Motivation des Spiels befaßt
hat. „Als die ursprünglichste psychische Begleiterscheinung des Spiels
wird das Lustgefühl bezeichnet werden müssen" ( G R O O S 1896, S. 293).
Aus dieser „Begleiterscheinung" wird für ihn das Definitionskriterium
für jenes Verhalten, das wir als „Spiel" bezeichnen: „Daher entspricht
dem biologischen das psychologische Kriterium: wo eine Thätigkeit rein
um der Lust an der Thätigkeit selbst willen stattfindet, da ist ein Spiel
vorhanden" ( G R O O S 1899, S. 7), oder in der 3. Auflage der „Spiele der
Tiere": „Erst wenn das Lebewesen die Erfahrung gemacht hat, daß die
Tätigkeit, um die es sich handelt, ihm Freude bereitet, und wenn es sie
dann um ihrer Lustwirkung willen erstrebt und wiederholt, haben wir
unserer Begriffsbestimmung nach das Recht, von einem spielenden Ver-
halten zu reden. Die aus der Erfahrung bekannte Lust ist hier also
* 3 Daß bei Tieren der A u f w e i s von Verhalten mit Zeichencharakter wegen des Fehlens
einer Sprache i. e. S. z w a r erschwert, aber dennodi möglich ist, zeigen die interessan-
ten Untersuchungen v. FRISCHS ( 1 9 2 3 ) . Auch in den Alltags-„Theorien" gilt ja z. B.
das „Schnurren" von Katzen als eindeutiges Zeichen dafür, daß diese sich in einer
angenehmen Zuständlichkeit befinden, usw.
60
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
ein Motiv" ( G R O O S 1930, S. 17). G R O O S führt auch das von B A L D W I N
(1898) mit dem Namen „Zirkulärreaktion" belegte Phänomen des sich
ständig ohne Ziel und Ende wiederholenden Verhaltens kleiner Kinder
auf die erlebte „Freude an der Tätigkeit" zurück ( G R O O S 1930, S. 24).
Unter diesem Aspekt werden auch scheinbar „sinnlose" Verhaltensweisen
zu sinnvollen gewollten Handlungen. Es ist also ein „Wiederholungs-
spiel", das K Ö H L E R beschreibt, wenn es von der Schimpansin N U E V A
heißt: „Nachdem sie festgestellt hatte, daß sie mit einem kleinen Becher
Wasser aus einem größeren Gefäß zu schöpfen vermochte, war sie un-
ermüdlich darin, den Becher zu füllen und das Wasser sogleich zurück-
zugießen" ( K Ö H L E R 1922, S. 31). Daß in vielen Fällen Verhalten, das
sonst nur in Spielsituationen gezeigt wird, ein Tier zu einem Zeitpunkt,
„wo es ernst wird", in die Lage versetzt, den „Kampf ums Dasein"
erfolgreich zu bestehen und sich fortzupflanzen, mag man G R O O S zu-
geben, daß aber generell das Spiel als „Vorbereitung auf den Lebens-
kampf" zu deuten sei, erscheint uns doch eine zu grobe Vereinfachung,
die der Vielfalt des Phänomens nicht gerecht wird. So mag man, wenn
ein Hund spielerisch einen alten Knochen benagt oder die Katze mit
einem Wollknäuel spielt, mit einigem Recht von einer „Übung für den
Ernstfall" sprechen, dies aber bei menschlichen Aktivitäten, wie „Kar-
tenspiel", „Fußball" oder „Skispringen", zu tun, scheint uns das Prinzip
vom „Kampf ums Dasein" doch über die Maßen zu strapazieren (schon
beim Verhalten der erwähnten Schimpansin N U E V A hat man wohl
gewisse Schwierigkeiten, sich eine Situation vorzustellen, bei der es
„selbst-" oder „arterhaltend" wirken könnte).
Übrigens relativiert G R O O S selbst die „Triebbezogenheit" der Spiele,
um einen Widerspruch zu seiner Definition zu vermeiden, die das
spielerische Verhalten als an keinen „Zweck" gebundene Tätigkeit um
ihrer selbst willen versteht: „Und jetzt wollen wir für unsere tier-
psychologischen Zwecke das mit dem Nahrungstrieb zusammenhängende
Beispiel so umändern, daß es sich nicht um den Wohlgeschmack einer
Speise, sondern um die Reize der Kaubewegung handeln soll, die ja bei
gesunden Zähnen ebenfalls lustvoll sein kann und es jedenfalls (trotz
des Kaugummis) bei einem jungen Tier noch mehr ist als bei einem
erwachsenen Menschen. Die Bewegung des Zubeißens kann, isoliert be-
trachtet, als Reflex bezeichnet werden, ist aber natürlich zugleich ein
Glied in der Äußerung des Ernährungsinstinktes. Wenn nun ein gesät-
tigtes junges Raubtier an einem fleisch- und marklosen Knochen oder
an einem Stück Holz mit großem Eifer herumnagt, so handelt es sich
um ein Spiel, sofern das Tier sich zwar in den Bahnen der ererbten
Disposition bewegt, aber doch nicht vom Hunger getrieben ist, sondern
die Kaubewegung wegen der mit ihr selbst verbundenen Lust erstrebt
und fortsetzt, ohne darum an den weiteren Verlauf der Ernsttätigkeit
61
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
(z.B. das Schlucken) gebunden zu sein. Man sieht: wir lassen an dem
zweiten Merkmal unserer Definition die positive Seite bestehen; die
negative Formulierung wird dagegen, um für die Tierpsychologie ver-
wendbar zu sein, dahin verändert, daß nicht der von dem Arbeitszweck
ausgehende, sondern der mit dem vollständig entfalteten Instinkt ver-
bundene Zwang gemindert wird. Das geschah bei unserem Beispiel zu-
nächst dadurch, daß die dem ererbten Trieb entspringende Emotion des
Hungers nicht mehr das maßgebende Motiv war. Und es ist zweitens
bemerkt worden, daß die Instinkthandlung beim Spiel nicht vollständig
abzulaufen braucht (das Tier schluckt die Holzsplitter nicht, sondern
entfernt sie aus seinem Munde). In ähnlicher Weise wird bei einem
Kampfspiel der sonst zu dem Instinkt gehörende wütende Zorn samt
seinen zerstörenden Folgen, beim spielenden Gejagtwerden und sich
Verstecken die Furcht aus ihrer leitenden Stellung verdrängt, und es
bleibt nur das Angenehme der freier gewordenen und sozusagen ,auf-
gelockerten' Betätigung übrig" ( G R O O S 1930, S. 6 f.).
Hier zeigt sidi, daß G R O O S ebenfalls einem vermögenspsyciiologi-
schen Irrtum unterliegt: Die aus einer Klassifizierung des Verhaltens
entspringende Ähnlichkeit von Spiel und „Instinkt"-bezogenem Ver-
halten verleitet ihn zu der naiv-ontologisierenden Annahme, beiden
unterliege als „Eigentliches" das gleiche, ein „Trieb". Dabei läßt er un-
berücksichtigt, daß diese Ontologisierung trotz aller Vorsicht einmal in
Widerspruch zur Definition des Spiel-Begriffs steht und zum anderen
einen Widerspruch in sich darstellt; denn wie kann ein Verhalten gleich-
zeitig „triebbezogen" und „doch nicht triebbezogen" sein? Entweder das
eine oder das andere; Verhalten, das auf die Erfordernisse der Leib-
lichkeit geht, ist eben prinzipiell etwas anderes als Spielverhalten, daran
ändert die äußere Ähnlichkeit gar nichts. Die Definition, daß Spiel
Verhalten um der damit direkt verbundenen Lust willen sei, wodurch
natürlich auch der logisch fragwürdige Anspruch auf „Zweckfreiheit"
des spielerischen Verhaltens verwirkt ist (logisch fragwürdig deshalb,
weil ja auch Verhalten um seiner selbst willen nie zweckfrei wäre, son-
dern sich selbst zum Zweck hätte), ist zunächst völlig ausreichend für
Klassifikation, Interpretation und Voraussage, wenn es um das hier
angezielte tierische und menschliche Verhalten geht.
Daß diese Definition, die nur die Bezogenheit des Spiels auf an-
genehme Zuständlichkeiten berücksichtigt, dennoch nicht ausreicht, wenn
auch in anderer als in der von G R O O S intendierten Richtung, welche
„Triebe" berücksichtigt, wird klarwerden, wenn wir im Rahmen der
Einführung des Begriffes der „Personwerte" nachweisen, daß im Spiel
auch Personwerte verwirklicht werden. Zunächst interessiert uns jedoch
nur das erste Motiv für das Spiel, die „Lustbezogenheit".
62
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Funktionslust
Aus dem Umstand, daß bestimmte Bewegungen des Körpers oder
Bewegungen überhaupt vom erlebenden Ich als „Ursache" angenehmer
und umgekehrt Bewegungsmangel als „Ursache" unangenehmer Zu-
ständigkeiten kategorisiert werden, folgt eindeutig, daß diese bestimm-
ten Bewegungen oder Bewegung überhaupt zum positiven Gegenstand
des Wollens 34 wird. Der in der Bewegung oder der Tätigkeit verwirk-
lichte Zustandszvert wurde von SCHWARZ als „Thätigkeitslust" (SCHWARZ
1900, S. 30, Anm. 1) und später von BÜHLER als „Funktionslust" 35 be-
zeichnet (BÜHLER 1918), letzteren Begriff erwähnt dann auch GROOS in
der 3. Auflage seiner „Spiele der Tiere" (1930). Durch Einführung dieses
Terminus wird die Gültigkeit der hedonistischen Annahme, die ja zu-
nächst nur die angenehmen oder unangenehmen „Folgen" einer Hand-
lung in Betracht zieht, erheblich erweitert, sie kann auch dort noch er-
klärend wirken, wo die als „Folge" eines Verhaltens anzusetzende Zu-
ständlichkeit als neutral oder gar unangenehm bezeichnet werden muß.
Vorläufige Zurückweisung des hedonistischen Anspruches auf universelle
Gültigkeit
Trotz dieser Erweiterung muß jedoch eine universelle Gültigkeit der
hedonistischen Annahme angezweifelt werden, denn es lassen sich genug
Beispiele von intendiertem Verhalten anführen, dessen Folge- und/oder
Begleitzuständlichkeiten keineswegs angenehm sind. Es dürfte sdiwer
sein, einem politischen oder religiösen Märtyrer nachzuweisen, sein Ver-
halten sei durch das Streben nach der Verwirklichung von Zustands-
werten motiviert (oder sollte man von CHRISTUS und GANDHI wirk-
lich ernsthaft annehmen, sie seien Masochisten gewesen?).
Der Märtyrer weiß um die unangenehmen Folgen oder Begleit-
umstände seines Verhaltens, und dennoch läßt er sich von seinen Hand-
lungen nicht abbringen. Warum? Sieht er etwa, abweichend von anderen
Menschen, im Leiden einen Wert und im Wohlbefinden einen Unwert
(ohne daß hierbei Leiden und Wohlbefinden für ihn eine andere Qualität
haben als für andere Menschen)? Gibt er ein Beispiel dafür, daß prinzi-
84 Unter bestimmten Bedingungen, wenn nämlich die in dem angezielten Verhalten
betätigten Organe des Körpers zu lange und zu einseitig betätigt wurden, kann
dieses Verhalten unangenehme Zuständlidikeiten als Begleiter haben („Muskelkater").
Das Verhalten wird dadurch zum negativen Gegenstand des Wollens und tritt nicht
mehr oder nur selten auf. Nach einer gewissen Zeit, wenn das Verhalten wieder
lustvoll ist, richtet sidi das Wollen wieder positiv darauf.
45 „Funktionslust" darf nicht mit dem von UTITZ (1911) verwendeten Begriff der
„Funktionsfreuden" verwechselt werden.
63
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
piell auch unangenehme Befindlichkeiten um eben ihrer selbst willen
angestrebt werden können? Wir sagen: nein. Dem Märtyrer mißfällt
das Leiden ebenso wie anderen auch, aber sein individuelles Leiden ist
ihm ein geringeres Übel verglichen mit dem Gut, das er in der Verwirk-
lichung eines ihm höher stehenden Wertes anstrebt. Die Annahme, daß
es sich bei diesem „höheren" Wert um einen allgemeineren Zustands-
wert handle, muß (zumindest in vielen Fällen) zurückgewiesen werden,
denn in der angezielten Situation wird ja nicht nur der je spezielle
Zustandswert nicht verwirklicht, sondern — sofern statt dessen kein
anderer spezieller Zustandswert verwirklicht wird — der allgemeinste
Zustandswert der Verwirklichung von Zustandswerten überhaupt eben-
falls nicht, so daß mit der Verwirklichung des speziellen Zustandsunwer-
tes der allgemeinste Zustandsunwert der Verwirklichung von Zustands-
unwerten überhaupt gleichzeitig mitverwirklicht wird.
Es muß außer den Zustandswerten also noch andere Werte geben, auf
deren Verwirklichung unser Verhalten gerichtet sein kann. Erst wenn
wir diese aufgewiesen haben, wird es uns möglich sein, die Zustands-
werte als nur eine von mehreren möglichen Wertkategorien darzustellen.
3. P e r s o n w e r t e
„Person" als Gegenstand des Wollens
Der Beliebigkeit des Wechsels der Zuständlichkeiten wird, wie wir
gesehen haben, dadurch Einhalt geboten, daß das intendierte Verhalten
auf Realisation angenehmer und die Vermeidung unangenehmer Zu-
ständlichkeiten gerichtet ist. Aber dennoch läßt sich nicht abstreiten, daß
Zustandswerte nur unter bestimmten Voraussetzungen zu bestimmten
Gelegenheiten verwirklicht werden, daß wir also nicht ständig Zustands-
werte verwirklichen. Wären die Verwirklichung von Zustandswerten der
einzige positive und die Verwirklichung von Zustandsunwerten der ein-
zige negative Gegenstand des Wollens, so bliebe eine große Anzahl von
Handlungen als „sinnlos" gekennzeichnet zurück. Wenn wir jedoch nach-
weisen können, daß sich das Gefallen auch auf Gegenstände richtet, die
dauerhafter sind als die Zuständlichkeiten, werden einige der verbleiben-
den Handlungen zu „sinnvollen". Wir lesen bei S C H W A R Z : „Neben dem
blossen Gelegenheitswert oder -Unwert, der in unseren Zuständen
liegt und mit ihnen wechselt, haben wir nämlich noch die Vorstel-
lung eines ganz andern Werts und Unwerts, desjenigen unserer Person.
Macht, Ruhm, Schönheit z. B. sind solche Personwerte, Schmach, Schuld,
Dummheit Personunwerte. Das, was wir Zustandswert und -Unwert
nannten, Lust und Unlust, trifft nur das Äussere unseres Wesens,
64
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
nicht seinen Kern. Vom Zustands-Werte und -Unwerte wissen wir,
dass er mit dem Augenblick kommt und stirbt und nicht noch nachher
von uns besessen wird. Jener andere Wert und Unwert aber geht auf
unser Sein; er trifft uns im Innersten. W i r sind genötigt, ihn an unsere
Person zu heften; ja wir können von ihm glauben, er überdauere selbst
deren physische Existenz. Wer z. B. für seinen Nachruhm lebt und
schafft, thut das für einen Wert, von dem er hofft, er werde sich nach dem
Tode an seiner Person verwirklichen" (SCHWARZ 1900, S. 37 f.). In einer
Anmerkung läßt SCHWARZ auch Vergangenes als Person wert gelten:
„Ähnlich bezüglich der Vergangenheit: eine alternde Frau kann noch
immer auf ihre frühere Schönheit stolz sein" (1900, S. 38).
Soseinslage und Personwert („erhöhte" und „verminderte" Soseinslagen)
So werden wir selbst, unsere eigene Person, zum positiven oder nega-
tiven Gegenstand des Gefallens und ebenso alles, was damit assoziiert ist
wie: Fähigkeiten, sozialer Status, Name usf. D a ß die Setzimg von Per-
sonwerten ein eigenständiges psychologisches Phänomen ist, das die Exi-
stenz eines kognitiv wertenden Bewußtseins notwendig voraussetzt,
dürfte aus den vorangegangenen Überlegungen klarwerden. Es sind
kognitive Prozesse, in denen wir das erlebte Sosein unseres Selbst mit
den angestrebten Möglichkeiten vergleichen und danach unser Verhalten
einrichten.
Dazu gehört u. a. auch das Innesein des eigenen Könnens und der
eigenen Kraft, das Wissen, daß man selbst es ist, der mit seinen Hand-
lungen Veränderungen in der Welt sdiafft. So sieht auch GROOS in den
die Bewegungen der Glieder begleitenden angenehmen Zuständlichkeiten
nicht die einzige Motivation für das Spiel, als ebenso wichtig gilt ihm die
Freude am Ursacbesein' (am Können, an der Macht)" (GROOS 1896,
S. 29 j). Z w a r ist die hier angesprochene Freude eindeutig eine ange-
nehme Zuständlidikeit, sie unterscheidet sich jedoch von anderen Zu-
ständlichkeiten dadurch, daß sie sekundär ist und Folge eines kognitiven
Prozesses (des Gefallens), der etwas anderes zum Gegenstand hat als eine
Zuständlichkait, nämlich die eigene Person 36 . In der Verwirklichung eines
Personwertes liegt in diesem Falle der positive Gegenstand des Wollens
und nicht in der Realisation der darauffolgenden angenehmen Zuständ-
lichkeit. So liegt zwar in vielen Fällen — jedoch niemals notwendiger-
weise — eine Koppelung der Verwirklichungen von Zustandswerten und
Personwerten vor, aber in den meisten Fällen ist es der Personwert und
nicht der Zustandswert, auf dessen Verwirklichung unser Wollen gerich-
86 A u f das Problem der „sekundären Zuständlidikeiten" werden wir später noch zu-
rückkommen.
5 Keiler, Wollen
65
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
tet ist. So mag zwar der Bergsteiger Lust aus der Bewegung seiner Glie-
der schöpfen und sich am Ende seiner Mühen über den gelungenen A u f -
stieg und die schöne Aussicht freuen, aber all dies, die Funktionslust und
die Freude, die er auf anderem "Wege viel leichter und gefahrloser haben
kann, gilt ihm nicht so viel wie die Tatsache, daß er etwa als erster diese
schwierige Steilwand bezwungen hat, daß er die Widerstände der Reali-
tät überwunden hat, daß er mehr kann als andere, daß er einen Person-
wert verwirklicht hat. „So allgemein ist das Streben nach Personwert,
dass jeder, auch der Ärmste und Geringste, Grund zu finden glaubt, ihn
sich zuzusprechen. Der eine meint schon dann persönlichen Wert zu be-
sitzen, wenn ihm andere die Versicherung dieses Besitzes glauben (der
Prahler). Ein Zweiter schreibt ihn sich auf die leere Einflüsterung dritter
zu (er ist Schmeicheleien zugänglich). Die Eiteln, Ehrgeizigen, Tugend-
süchtigen, ferner die, die sich selber sehr klug, geschickt, lebensgewandt,
talentiert vorkommen, dann die Stolzen, die auf ihre Macht, K r a f t , Mut,
Energie, ihre Kenntnis oder ihren Wohlstand pochen, auch sie suchen
und finden alle, jeder in seiner Art, etwas, was sie vor sich selbst persön-
lich hebt" (SCHWARZ 1900, S. 38). In der erlebten „Soseinslageerhöhung
der eigenen Person" liegt also, was das qualitativ Einzigartige des Per-
sonwertes ausmacht. Analog gilt von einem Personunwert, daß in seiner
Verwirklichung eine „mindere Soseinslage der eigenen Person" erlebt
wird.
Was unter „Soseinslage" allgemein zu verstehen sei, haben wir schon
am Anfang dieser Untersuchung klargelegt (vgl. S. 6 f.); was verstehen
wir nun aber unter „erhöhter" oder „verminderter" Soseinslage? Das
Gesamt der Begriffsbestimmungskriterien für den jeweiligen Urteils-
gegenstand stellt die Begriffsbestimmungsnorm dar. Die Erfüllung der
Begriffsbestimmungsnorm in einem realen Urteilsgegenstand ist zunädist
völlig wertfrei, weil sie unabhängig von einem Wollen lediglich einer be-
griff slogischen Forderung entspricht, dem in Frage stehenden Urteils-
gegenstand wird eine neutrale Soseinslage zugesprochen, er gefällt weder,
noch mißfällt er (vgl. unsere Kennzeichnung eines normerfüllenden Ur-
teilsgegenstandes auf S. 19). N u n kann ein in Frage stehender Urteils-
gegenstand jedoch in einer je speziellen Situation in einer Soseinslage an-
getroffen werden, welche nicht nur alle notwendigen und hinreichenden
Kriterien der Identität und Individualität des Urteilsgegenstandes er-
füllt, sondern darüber hinaus „mehr" ist als „bloßer" Urteilsgegenstand
und stärker gefällt, ohne etwas anderes zu sein als dieser Gegenstand.
Das soll an einem Beispiel erläutert werden: Damit eine Speise als eben
diese identifizierbar ist, muß sie bestimmte Kriterien erfüllen, die sich
auf ihre Zusammensetzung und Zubereitung beziehen. Darüber hinaus
gibt es jedoch die Möglichkeit, die Speise noch zu würzen, ohne daß dies
ein zu erfüllendes Kriterium zur Identifikation der Speise wäre. Indem
66
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
wir nun die Speise würzen und ihren Wohlgeschmack heben, wird sie
„mehr", gefällt sie stärker, ohne jedoch etwas anderes zu sein als diese
Speise. So wird die Soseinslage eines Urteilsgegenstandes ganz allgemein
dadurch zu einer „erhöhten", daß sie mehr Kriterien erfüllt, als zur
Identifikation eben dieses Gegenstandes notwendig und hinreichend
wären, und dieses „mehr" positiver Gegenstand eines Wollens ist, ohne
daß jedoch dabei der Urteilsgegenstand zu etwas anderem würde als
eben diesem Gegenstand.
Analog nimmt ein Urteilsgegenstand eine „mindere" Soseinslage ein,
wenn er nicht alle notwendigen und hinreichenden Kriterien erfüllt, um
als dieser Gegenstand zu gelten, ohne jedoch etwas anderes zu sein als
dieser Gegenstand (wenn z. B. der in Frage stehenden Speise eine be-
stimmte Zutat fehlt, sie dadurch aber nicht zu einer anderen Speise wird).
Entscheidend für eine Einstufung als mindere Soseinslage ist jedoch nicht
das offensichtliche „weniger", sondern daß dieses „weniger" negativer
Gegenstand eines Wollens ist, sich also auch das Gefallen gegenüber dem
Urteilsgegenstand in negativer Richtung ändert.
Es wäre z. B. auch der Fall denkbar, daß ein Urteilsgegenstand, wenn
er mehr Kriterien erfüllt, als zur Identifikation eben dieses Gegenstandes
notwendig und hinreichend wären, dadurch auch nicht zu etwas anderem
als eben diesem Gegenstand würde, man seine Soseinslage aber dennoch
als „verminderte" bezeichnet, weil das Uberschreiten der Kriterien nega-
tiver Gegenstand eines Wollens ist und er daher mißfällt. Dieser Fall
liegt vor, wenn etwa die in Frage stehende Speise versalzen, also zu stark
gewürzt ist.
Die Begriffe „Erhöhung" und „Verminderung" dienen zur Abhebung
entweder von einer anderen Soseinslage desselben Urteilsgegenstandes
oder von den Soseinslagen anderer Urteilsgegenstände. Einstufungen der
Soseinslage eines Urteilsgegenstandes als „erhöht" oder „vermindert"
werden gewöhnlich durch Wertprädikate gekennzeichnet; so bezieht sich
z. B. „schön" oder „gefällig" auf eine erhöhte, „häßlich" oder „mißfal-
lend" auf eine mindere Soseinslage des angezielten Urteilsgegenstandes.
Dadurch, daß Erhöhung oder Verminderung zur Abhebung unterschied-
licher Soseinslagen gegeneinander herangezogen werden, werden sie zu
relativen Begriffen. Das heißt, die je spezielle Soseinslage eines Urteils-
gegenstandes kann als verminderte bezeichnet werden, verglichen mit
einer vorangegangenen, die stärker gefiel, obwohl jene die Begriffsbe-
stimmungskriterien durchaus in positiver Hinsicht überschreitet, nur ist
eben die vorangegangene Soseinslage dem Wollen ein positiverer Gegen-
stand als die jetzige 37 , und bekanntlich ist ja „das Bessere der Feind des
Guten". Ähnliche Bestimmungen wie für erhöhte Soseinslagen gelten für
37 Es ist natürlich auch eine umgekehrte Bestimmung möglich.
5' 67
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
die Kennzeichnung einer verminderten Soseinslage, die Einstufung als
„minder" gilt auch nie absolut, sondern stets verglichen mit einer weni-
ger minderen oder höheren.
So wird zwar ursprünglich jene Soseinslage, die lediglich die notwen-
digen und hinreichenden Begriffsbestimmungskriterien des Urteilsgegen-
standes erfüllt, als „neutrale" bezeichnet, eben weil die Erfüllung dieser
Kriterien zunächst nur einer logischen Forderung, also einer Norm, ent-
spricht und als solche unabhängig von einem Wollen besteht. Wird die
Erfüllung der Begriffsbestimmungsnormen jedoch als positiver Gegen-
stand eines Wollens einer minderen Soseinslage, die durch nicht gewollte
Nichterfüllung der Kriterien gekennzeichnet ist, gegenübergestellt, be-
zeichnen wir die ursprünglich neutrale, aber jetzt positiv gewollte So-
seinslage als erhöht. Ein Urteilsgegenstand kann jedoch auch eine höhere
Soseinslage als vorher einnehmen, wenn er so lange „verändert" wird
(sei es durch „echte" Veränderung oder durch Einordnung in einen neuen
kognitiven Kontext), bis er nicht mehr in die ursprüngliche Kategorie
eingeordnet werden kann, sondern in eine neue, die dem Wollen wert-
voller ist als die ursprüngliche. Hat die „Veränderung" die Einordnung
in eine Kategorie zur Folge, die dem Wollen weniger wert ist als die
ursprüngliche, so ist die entsprechende Soseinslage des Urteilsgegenstan-
des eine mindere.
Phänographische Kennzeichnung der „erhöhten" Soseinslage einer Person
Ähnliche Bestimmungen wie für die Kennzeichnung erhöhter und
minderer Soseinslagen allgemein können wir für den speziellen Fall der
erhöhten oder verminderten Soseinslagen einer Person oder eines person-
haften Individuums aufstellen. Audi eine Person in erhöhter Soseinslage
ist „mehr" als bloße Person, ohne etwas anderes als Person zu sein.
LERSCH schließt im „personalen Selbst" die Möglichkeit des „über sich
hinaus Seins" ein (LERSCH 19JI), worin nach unserer Terminologie eine
Verlagerung auf eine höhere Soseinslage der eigenen Person zu sehen
wäre. In vielen Kulturen gilt das Erwachsenwerden als das Hineinwach-
sen in eine höhere Soseinslage der Person. Der Erwachsene hat gegenüber
dem Kind und Jugendlichen entscheidende Vorrechte, er ist „mehr".
Dementsprechend wird der Abschied von Kindheit und Jugend oft auch
mit großem Aufwand gefeiert. So kann sich ein und dieselbe Person, die
sich gestern noch als Kind in einer minderen Soseinslage befand, heute in
der erhöhten des Erwachsenen wiederfinden, ohne daß sich ihre Identität
geändert hätte.
Trifft sich das psychophysische Ich in einer höheren Soseinslage der
eigenen Person an, so erlebt es sich selbst als „mehr", „gehoben", „wert-
68
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
voll", gefällt sich stärker usw. Ähnlich gilt für ein personhaftes Indivi-
duum, das in seinem Verhalten und Erscheinen eine erhöhte Soseinslage
einnimmt; auch hier erscheint es in seiner Personhaftigkeit als „mehr",
„gehoben", „gefälliger". Wie höhere Soseinslagen der Person oder Per-
sonhaftigkeit im einzelnen gekennzeichnet werden können, wird klarer
werden, wenn wir einige Aspekte der Persönlichkeitstheorien von A D L E R ,
J U N G , M A S L O W und R O G E R S weiter unten darstellen. Allgemein gilt je-
doch der aus den vorhergehenden Begriffsbestimmungen deduzierbare,
empirisch nicht weiter rückführbare Grundsatz: Wir streben hohe So-
seinslagen der Person als Verwirklichung von Personwerten an und ver-
meiden mindere Soseinslagen als Verwirklichung von Personunwerten.
Gilt die je einzelne erlebte Soseinslageerhöhung als Verwirklichung
eines speziellen Personwertes, so sehen wir in Soseinslageerhöhungen
überhaupt den allgemeinsten Personwert verwirklicht. Analoges läßt sich
über die Verwirklichung von Personunwerten in je einzelnen erlebten
Soseinslageminderungen oder Soseinslageminderungen überhaupt aus-
sagen.
Abgesehen von dieser generellen operationalen Kennzeichnung durch
Anstreben und Vermeiden kann keine allgemeine Aussage darüber ge-
macht werden, was im je konkreten Fall als soseinslageerhöhend oder
soseinslageminderad angesehen werden kann. Was für den einen eine So-
seinslageerhöhung darstellt, kann für den anderen völlig gleichgültig
oder gar eine Soseinslageminderung sein. Im je individuellen Fall ist je-
doch über die operationale Kennzeichnung durch Anstreben und Vermei-
den hinaus von seiten der angezielten Person durch Verhalten mit Zei-
chencharakter — z. B. Sprache oder Ausdruck — ein Hinweis darauf
möglich, ob die in Frage stehende Soseinslage als erhöhte oder vermin-
derte zu kategorisieren sei.
Ausdehnung des Personwertbegriffes auf die Tierpsychologie
Ebenso wie das Anstreben der Verwirklichung von Zustandswerten
ist unserer Ansicht nach das Streben nach Verwirklichung von Person-
werten nicht nur auf den Bereich menschlicher Willenshandlungen be-
schränkt. Auch bei Tieren gibt es Verhaltensweisen, die nur durch Attri-
bution einer angestrebten Soseinslageerhöhung als „sinnvoll" interpre-
tiert werden können, wie z. B. in den Balzspielen mancher Vögel oder
den Vorbereitungsakten bei Rivalenkämpfen. Zwar wird man nicht an-
nehmen können, daß auf Tiere sämtliche bewußtseinspsychologischen
und philosophischen Implikationen des Wertbegriffes anzuwenden sind,
es erscheint uns aber dennoch zweckmäßig, in Analogie zum mensch-
69
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
liehen Verhalten auch für Tiere den Begriff „Personwert" einzuführen.
Einmal scheint uns dies durch die Möglichkeit begründet, den Begriff
„Personhaftigkeit" intersubjektiv sowohl für Menschen als auch für Tiere
durch konsistentes Verhalten und Verhaltensdispositionen zu definieren,
zum anderen folgen wir damit nur konsequent einer früheren Fest-
setzung, die auch Tieren das Anstreben von Zustandswerten zusprach
(wir wollen deshalb hier nicht noch einmal begründen, warum eine solche
Festsetzung auch aus methodischen und ökonomischen Gründen durch-
aus berechtigt ist, vgl. S. 56). Dennoch bleibt ein Vorbehalt bestehen:
Wir verwenden den Begriff „Personwert" für Tiere nur als Analogon
zum menschlichen Personwert-Begriff, er gilt uns nicht als dasselbe, weil
wir nicht entscheiden können, ob Tieren die von „außen" attribuierte
Konsistenz ihres Verhaltens „kognitiv gegeben" ist, ob sie wie Menschen
„Personen" sind. Deshalb impliziert in der Folge der von uns verwendete
Begriff des Personwertes hinsichtlich der Tiere immer ein „vergleichbar
mit menschlichen Per sonwerten", er ist somit ein „uneigentlicher" Begriff.
Bei einigen Handlungen wird man zugeben müssen, daß die Ver-
wirklichung des Personwertes nur Mittel zum Zweck der Verwirklichung
von Zustandswerten ist (die etwa aus sexuellen Vorrechten oder Vor-
rechten der Nahrungsaufnahme erwachsen) und darüber hinaus selbst-
und arterhaltend wirken kann, aber dies muß nicht generell und not-
wendigerweise so sein. Als Beispiel hierfür mag das Verhalten von
Schimpansen stehen, wie es K Ö H L E R in unnachahmlicher Weise in seinen
„Intelligenzprüfungen an Menschenaffen" beschreibt38: „Eine große An-
zahl verschiedener Gegenstände wird gern am eigenen Körper irgendwie
angebracht. Fast täglich sieht man ein Tier mit einem Seil, einem Fetzen
Zeug, einer Krautranke oder einem Zweig auf den Schultern dahergehen.
Gibt man Tschego eine Metallkette, so liegt diese sofort um den Nacken
des Tieres, Gestrüpp wird mitunter in größeren Mengen auf dem ganzen
Rüdken ausgebreitet getragen. Seil und Zeugfetzen hängen dabei ge-
wöhnlich zu beiden Seiten des Halses über die Schultern zu Boden;
Tercera läßt Schnüre auch um den Hinterkopf und über die Ohren lau-
fen, so daß sie zu beiden Seiten des Gesichtes herunterbaumeln. Fallen
die Dinge immer wieder ab, so werden sie auch mit den Zähnen gehalten
oder unter das Kinn geklemmt, aber baumeln müssen sie auf jeden Fall.
. . . Die Bedeutung dieser Dinge geht aus den Umständen und dem Ver-
halten der Tiere unzweideutig hervor: Sie spielen..(KÖHLER 1963,
S. 66 f.). K Ö H L E R läßt auch keinen Zweifel daran, daß er in diesen Dra-
38
H i e r b e i ist uns selbstverständlich k l a r , daß die Beschreibungen KÖHLERS durchaus
methodisch anfechtbar u n d die „ G r ü n d e " , die er f ü r das V e r h a l t e n der Schimpansen
angibt, nicht beobachtet, sondern „ a t t r i b u i e r t " sind; seine Schilderungen gelten uns
jedoch als anschauliches Beispiel, ohne d a ß w i r uns direkt mit den Ausführungen
KÖHLERS identifizieren.
7°
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
pierungen Handlungen um ihrer selbst willen sieht, daß sich seinem Ein-
druck nach die Schimpansen mit den Gegenständen, die sie am Körper
tragen „schmücken": „Sehen wir von Sultans Blechtopf und Chicas
Athletenstein ab, bei denen starke Zweifel möglich sind, so gilt von den
meisten übrigen Fällen — und der Zuschauer kann sich diesem Eindrucke
durchaus nicht entziehen — , daß die am Körper hängenden Gegenstände
Schmuckfunktion im weitesten Sinne haben. Das Trotten der behängten
Tiere sieht nicht nur mutwillig aus, es wirkt auch als naiv-selbstgefällig.
Freilich darf man kaum annehmen, daß die Schimpansen sich eine op-
tische Vorstellung von ihrem eigenen Aussehen unter dem Einflüsse der
Toilette machen, und nie habe ich gesehen, daß die äußerst häufige Be-
nutzung spiegelnder Flächen irgend Beziehung auf das Behängen ange-
nommen hätte; aber es ist sehr wohl möglich, daß das primitive
Schmücken gar nicht auf optische Wirkungen nach außen rechnet — ich
traue so etwas dem Schimpansen nicht zu — , sondern ganz auf der merk-
würdigen Steigerung des eigenen Körpergefühls, Stattlichkeitseindrucks,
Selbstgefühls beruht, die auch beim Menschen eintritt, wenn er sich mit
einer Schärpe z. B. behängt oder lange Troddelquasten an seine Schenkel
schlagen. Wir pflegen die Selbstzufriedenheit vor dem Spiegel zu er-
höhen, aber der Genuß unserer Stattlichkeit ist durchaus nicht an dem
Spiegel, an optische Vorstellungen unseres Aussehens oder an irgend ge-
nauere optische Kontrolle überhaupt gebunden; wie sich so etwas mit
unserem Körper mitbewegt, fühlen wir ihn reicher und stattlicher"
( K Ö H L E R 1963, S. 67 f.). Zwar muß hier klargestellt werden, daß diese
Schilderungen K Ö H L E R S keineswegs Beweischarakter haben, sondern eher
den Status einer mehr kontemplativen vorwissenschaftlichen Alltagstheo-
rie für sich beanspruchen können. Wir sind jedoch der Ansicht, daß man
auch unter Anlegung strengerer methodischer Maßstäbe das von K Ö H L E R
angeführte Verhalten von Schimpansen am besten durch Bezug auf Ver-
wirklichung von „Personwerten" erklären kann. Insbesondere scheint
uns die Attribution der „Schmuckfunktion" der umgehängten Gegen-
stände theoretisch und empirisch fruchtbar.
Personwert vs. „Selbst"- und „Arterhaltung"
Im Sich-Schmücken sehen wir eine Möglichkeit zur Verwirklichung
von Personwerten, die so allgemein ist, daß sie nicht nur in den verschie-
denen Kulturen unabhängig voneinander beobachtet wird, sondern auch
Tieren attribuiert werden kann. Die Art, sich zu schmücken, ist freilich
von Individuum zu Individuum und von Kultur zu Kultur verschieden
und innerhalb einer Kultur oft von einem Phänomen abhängig, das wir
als „Mode" bezeichnen.
71
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Daß wir es beim Schmuck tatsächlich mit der Verwirklichung eines
Personwertes zu tun haben, dürfte kaum zweifelhaft sein. Warum je-
mand vorzugsweise ein schwarzes Hemd mit türkisfarbenen aufgedruck-
ten Rosen trägt, läßt sich sicherlich weder von der Erfüllung einer phy-
siologischen Norm (also einer bewußtseinstranszendenten „Triebbefriedi-
gung") noch von der Verwirklichung eines Zustandswertes her erklären.
(Es wäre absurd, anzunehmen, ein schwarzes Hemd mit türkisfarbenen
aufgedruckten Rosen halte wärmer oder rufe eine angenehmere Haut-
empfindung hervor als ein einfarbiges schwarzes; daß jedoch der Träger
eines solchen Hemdes sich durch das Tragen in einer erhöhten Soseinslage
der Person erleben kann, leuchtet unmittelbar ein.)
Einige andere Beispiele sollen zeigen, daß „Tüchtigkeit im, Lebens-
kampf" sowie „Selbst-" und „Arterhaltung", die man uns als „eigent-
liche Zwecke" der Verwirklichung von Personwerten entgegenhalten
könnte, in vielen Fällen selbst „Mittel zum Zweck" sind. Bei den Kwa-
kiutl, einem Indianerstamm, der entlang der Küste der Vancouver-Insel
lebt, wird z. B. Kinderreichtum als Druckmittel im ständigen Kampf um
einen höheren sozialen Status eingesetzt (vgl. die Arbeiten über die
Kwakiutl von B O A S 1925 und G O L D M A N 1937). Je mehr Kinder ein
Mann in eine Geheimgesellschaft einführen kann, um so besser für ihn.
Auch Eigentum erwerben die Kwakiutl nicht, um es in zweckmäßiger
Weise zu benutzen, sondern um damit einen Rivalen „auszuschalten".
Hierzu schreibt N E W C O M B : „Ansprüche auf adlige Stellung macht man
geltend, indem man Eigentum, Decken und Kästen verteilt und Feste
g i b t . . . Bei diesen Festen werden große Mengen wertvoller Güter vor
aller Augen zerstört... Eigentum häuft man vor allem zu dem Zweck
an, es einem Rivalen zu geben" ( N E W C O M B 1959, S. 34). Das Streben
nach Gewinn und Kinderreichtum ist also nicht Selbstzweck, sondern
dient indirekt einer Soseinslageerhöhung der eigenen Person.
Interessant sind in diesem Zusammenhange die Untersuchungen von
WEBER (1904, 1905), W I N T E R B O T T O M (1953) sowie die Analysen von
M C C L E L L A N D (1966), in denen versucht wird, das unterschiedliche Lei-
stungsstreben bei Protestanten und Katholiken auf deren unterschiedliche
Einstellung zur eigenen Person und deren Befindlichkeit in der Welt zu-
rückzuführen. So wird Leistungsstreben zum Zwecke der Personwertver-
wirklichung u. a. besonders bei den Calvinisten angetroffen, denen der
Erfolg im „Lebenskampf" als Indiz für ihre Auserwähltheit in religiöser
Hinsicht gilt.
Erfolgreiches Bestehen im Kampf ist in vielen kriegerischen Kulturen
Voraussetzung für Personwertverwirklichungen, und zwar gilt das nicht
nur für eine erfolgreiche Verteidigung des eigenen Lebens, sondern in
besonderem Maße für ein siegreiches Bestehen bei einem Angriff, den die-
jenige Person ausführt, die ihr Ansehen erhöhen will. K A R D I N E R schreibt
72
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
über den Indianerstamm der Comanchen: „ W a r was the main activity
of Comanche m e n . . . T h e life story of the average old Comanche is
nothing but a long collection of w a r stories. Other events — marriages,
deaths — are mentioned casually as having taken place between such
and such raids. W a r parties were constantly going out, either for loot or
for honor, frequently both . . . In addition, the young men went out con-
tinually on their own, to gain honors. In the old days, any band of the
Comanche w o u l d have t w o or three w a r parties out at the same time"
(KARDINER 1963, S. 61). In einer kriegerischen K u l t u r ist Selbstbehaup-
tung im K a m p f mit Feinden und damit Selbsterhaltung überhaupt die
Voraussetzung, daß der kämpfende Mann als „mächtig", „stark",
„großer Krieger", „furchteinflößend", als die positiven Personwerte über-
haupt verwirklichend beurteilt wird, „schwach und hilflos" oder gar
„ f e i g e " zu sein gilt in einer soldien K u l t u r dementsprechend als
„Schande". „ A brother-in-arms w h o l e f t his brother wounded on the
field of battle w o u l d lose respect completely" (KARDINER, 1963, S. 62).
W e r nun behaupten wollte, die in diesen Beispielen angeführten Per-
sonwerte seien lediglich ein Mittel, um die Verwirklichung der „eigent-
lichen" Werte 3 9 , der Selbst- und Arterhaltung, „attraktiver" zu machen,
muß, sofern er keine metaphysisch prästabilierte Harmonie zwischen
Selbst- und Arterhaltung auf der einen und der Verwirklichung von
Personwerten auf der anderen Seite annimmt, begründen, w a r u m denn
die „eigentlichen W e r t e " überhaupt noch „ a t t r a k t i v " gemacht werden
müssen, da sie dies doch eigentlich gemäß der Definition durch ihre Set-
zung als „ W e r t " v o n selbst sind. Außerdem bliebe zu erklären, warum
die erhöhte „ A t t r a k t i v i t ä t " durch eine Koppelung gerade mit Person-
werten zustande kommt, deren Eigenständigkeit und Eigenwirksamkeit
ja damit anerkannt werden muß, da eine Koppelung nur zwischen nicht-
identischen Gegebenheiten möglich ist. Auch Begriffe w i e „ u n b e w u ß t "
oder „bewußtseinstranszendent" sind hier fehl am Platze, denn in allen
Beispielen sind Selbst- b z w . Arterhaltung bewußte Zwischenziele auf
dem Wege zur Verwirklichung v o n Personwerten (die ja per definitio-
nem „ b e w u ß t " , weil „ g e w o l l t " sind), in einigen Fällen werden sie sogar
bewußt aufs Spiel gesetzt, um einen Personwert zu verwirklichen.
Kritik der Ontologisierung des Selbst- und Arterhaltungsprinzips
W i r sehen also immer wieder, in welche „Sackgassen der Wissen-
schaft" man sich verirrt, wenn man einmal dem vermögenspsychologi-
59 Sofern man Selbst- und Arterhaltung als intendierten „ Z w e c k " des Verhaltens eines
Organismus und nicht als bloß beliebige Folge dieses Verhaltens ansieht, sind ge-
mäß unserer Definition Selbst- und Arterhaltung notwendigerweise als Werte ge-
kennzeichnet (vgl. GOLDSTEIN 1965).
73
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
sehen Irrtum unterlegen ist, in naiver Ontologisierung dem von einem
selbst in die Wissenschaft eingeführten Erklärungsprinzip seine Eigenart
als theoretisches Konstruktum abzusprechen und es in den Status eines
empirisch vorgefundenen Seienden zu erheben (vgl. H O L Z K A M P 1964,
S. 179 ff.). Wenn man sich in den Reihen der biologisch-evolutionstheo-
retisch ausgerichteten Psychologen endlich darüber klar wäre, daß es sich
bei „Selbst-" und „Arterhaltung" lediglich um von Wissenschaftlern ein-
geführte Erklärungsprinzipien handelt (die ebenso begrenzt sein können
wie andere Erklärungsprinzipien auch) und nicht um etwas unabhängig
von einer Wissenschaft in der Wirklichkeit Vorfindbares, wäre man nicht
genötigt, Erscheinungen, die man von der Genese her als „art-" und/oder
„selbsterhaltend" versteht, die aber de facto eher als „art-" und/oder
„selbstzerstörend" zu deuten sind (vgl. das von uns auf S. 44 ff. als
„Süchte" oder „Laster" bezeichnete Phänomen und besonders die in die-
sem Zusammenhang referierten Untersuchungen von O L D S und Mitarbei-
tern), mit fragwürdigen und die eigentliche Grundannahme überschrei-
tenden Argumenten „wegzuerklären". Außerdem scheint man sich kaum
darüber im klaren zu sein, daß „art-" und „selbsterhaltend" alles andere
als wertfreie Begriffe sind. Implizit ist mit der Art- bzw. Selbsterhal-
tungsannahme nämlich die Festsetzung von „Art-" und „Selbsterhal-
tung" als positive Werte mitgegeben, ohne daß man Rechenschaft dar-
über ablegt, warum. Wir haben hier die paradoxe Situation, daß der
Wissenschaftler aus seinem eigenen Wertsystem bewußt ein Prinzip ab-
leitet, dem er ontologisierend ein „unbewußtes" organisches Substrat
unterlegt. Hieraus wäre verständlich, warum die FREUDsche Lehre vom
„Todestrieb" im Gegensatz zu den Lehren, die die Begriffe „Selbst-"
und/oder „Arterhaltung" involvieren, niemals populär wurde. Selbst-
und Arterhaltung sind den meisten Menschen Werte, und sie sind sich
dessen vollauf bewußt, hingegen sind Sterben und Tod fast durchweg
unwertbezogen.
Mit dieser Feststellung widersprechen wir keineswegs unseren voran-
gegangenen Ausführungen, denn es ist prinzipiell etwas anderes, ob man
Selbst- und Arterhaltung als unbewußten alles wirkenden Trieben ent-
springend oder aber als bewußte, weil gewollte Werte unter anderen
Werten versteht. Wir folgen keinem dunklen „Drang zum Leben", son-
dern wir wollen leben; diejenigen, die nicht leben wollen, denen Leben
als Unwert gilt, verwirklichen im „Selbstmord" den Wert der eigenen
Nichtexistenz. (Dieses Phänomen, daß jemand nicht leben will, ist durch
die Argumentation von evolutionstheoretischer Seite, der „sterbe dann
ja auch aus", natürlich nicht erklärt, sondern es wird nur die Folge dieses
Wollens aufgewiesen, was lediglich teleologischen Erklärungswert hätte,
der, soweit wir unterrichtet sind, auch bei Evolutionstheoretikern nicht
hoch im Kurs steht.)
74
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Selbsterhaltung als Personwert
Damit ist „Selbsterhaltung", sofern sie positiver Gegenstand des
Wollens ist, als Personwert gekennzeichnet, da „Selbsterhaltung" ein
Wert ist, der an der eigenen Person als Gegenstand verwirklicht wird.
Die Existenz der eigenen Person ist zwar notwendige Voraussetzung
aller Personwerte überhaupt, aber in der bloßen Weiterexistenz der eige-
nen Person erschöpfen sich nicht alle Möglichkeiten des Gefallens, das
die eigene Person zum Gegenstand hat; in der Verwirklichung anderer
Personwerte ist noch eine Erhöhung dieser Existenz über ihre ursprüng-
liche Soseinslage hinaus möglich, die in der bloßen Existenz der Person
besteht. Insofern scheint N I E T Z S C H E das Problem nicht richtig gesehen zu
haben, wenn er Z A R A T H U S T R A in der Rede „Von der Selbst-Überwin-
dung" sagen läßt: „Der traf freilich die Wahrheit nicht, der das Wort
nach ihr schoss vom ,Willen zum Dasein': diesen Willen — giebt es nicht!
Denn: was nicht ist, das kann nicht wollen; was aber im Dasein ist, wie
könnte das noch zum Dasein wollen!" ( N I E T Z S C H E 1925, S. 1 4 9 ) ; denn
aus der Unmöglichkeit eines „Willens zur Existenz" ist notwendigerweise
noch nichts über die Möglichkeit eines „Willens zur Weiterexistenz" aus-
gesagt, diese kann, da sie ja im Augenblicke des Willensaktes als nicht-
seiend gesetzt ist (in der Zukunft liegt), durchaus positiver oder nega-
tiver Gegenstand des Wollens sein. Daher ist unsere Formulierung vom
„Wollen der Selbsterhaltung" logisch legitim. Steht dem Wert der Wei-
terexistenz als Unwert die Nichtexistenz der Person, der Tod, gegen-
über, so besteht prinzipiell auch die umgekehrte Möglichkeit: dem Tod
als Wert steht die Weiterexistenz der eigenen Person als Unwert gegen-
über. Audi hier ist die Existenz der Person zunächst Voraussetzung, da
ja ein Nichtexistierendes weder seine Existenz noch seine Nichtexistenz
wollen kann. Wird von einem wollenden Subjekt der Tod als Wert ge-
setzt, so begibt sich dieses Individuum mit der Verwirklichung dieses
Personwertes jeder Möglichkeit, noch andere Personwerte zu verwirk-
lichen, sofern diese nicht unmittelbar mit dem Tod selbst oder seinen
Umständen verbunden sind (z. B. Selbstaufopferung für andere).
Der „Wille zur Macht" bei ADLER
Dem „Willen zum Dasein" stellt N I E T Z S C H E den „Willen zur Macht"
entgegen: „Wo ich Lebendiges fand, da fand ich Willen zur Macht; und
noch im Willen des Dienenden fand ich den Willen, Herr zu sein. Dass
dem Stärkeren diene das Schwächere, dazu überredet es sein Wille, der
über noch Schwächeres Herr sein w i l l . . . also gibt sich auch das Grösste
noch hin und setzt um der Macht willen — das Leben dran" ( N I E T Z S C H E
75
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
1925, S. 148). D a „Macht", wie sie N I E T Z S C H E versteht, nach unserer
Definition eine Soseinslageerhöhung der „mächtigen" Person mit sich
bringt, ist sie ebenfalls dem Begriff des „Personwertes" zu subsumieren;
„Schwäche" oder „Unterlegenheit" wären demnach „Personunwerte",
sofern dem wollenden Subjekt die Ausübung von Macht positiver
Gegenstand des Wollens ist. Ist bei N I E T Z S C H E der „Wille zur Macht"
etwas Primäres, so versteht der Tiefenpsychologe A D L E R diesen Macht-
willen als Reaktion auf ein ursprüngliches Erleben der eigenen „Minder-
wertigkeit" (zunächst als „Organminderwertigkeit" verstanden, vgl.
hierzu A D L E R 1927). Der Wille zur Überlegenheit ist lediglich eine
„neurotische Zwecksetzung" zur „Uberkompensation" dieser ursprüng-
lichen Unterlegenheit. „Am Anfang der Entwicklung zur Neurose steht
drohend das Gefühl der Unsicherheit und Minderwertigkeit und ver-
langt mit Macht eine leitende, sichernde, beruhigende Zwecksetzung, um
das Leben erträglich zu machen. Was wir das Wesen der Neurose nennen,
besteht aus dem vermehrten Aufwand der verfügbaren psychischen Mit-
tel. Unter diesen ragen besonders hervor: Hilfskonstruktionen und Fik-
tionen im Denken, Handeln und Wollen" ( A D L E R 1 9 1 9 , S. 6). „Als diese
neurotische Zwecksetzung hat sich uns die Erhöhung des Persönlichkeits-
gefühls ergeben, dessen einfachste Formel im übertriebenen ,männlichen
Protest' zu erkennen ist. Diese Formel: ,ich will ein ganzer Mann sein!'
ist die leitende Fiktion in jeder Neurose, f ü r die sie in höherem Grade
als für die normale Psyche Wirklichkeitswerte beansprucht. Und diesem
Leitgedanken ordnen sich auch Libido, Sexualtrieb und Perversions-
neigung, wo immer sie hergekommen sein mögen, ein. N I E T Z S C H E S ,Wille
zur Macht' und ,Wille zum Schein' umfassen vieles von unserer A u f -
fassung. . . " ( A D L E R 1 9 1 9 , S. 4 f.). Wichtig in diesem Zusammenhang ist
die Feststellung, daß der „Wille zur Macht" für A D L E R nicht organi-
schen Ursprungs ist, sondern eine psychologisch zu deutende Reaktion
auf erlebte Minderwertigkeit (diese ist allerdings in den meisten Fällen
nach A D L E R organischer Natur) darstellt 40 .
Kritik des universellen Machtwillens bei NIETZSCHE durch SCHWARZ
Solange man das „Wollen von Macht" lediglich als eine Möglichkeit
unter vielen auf dem Wege zu einer „höheren Soseinslage der eigenen
Person" betrachtet, also „Macht" als nur einen Personwert unter vielen
anderen möglichen, mag man N I E T Z S C H E und A D L E R (und diesem auch
40
Es muß darauf hingewiesen werden, daß w i r uns nicht mit dem tiefenpsydiologi-
schen Ansatz v o n ADLER identifizieren, er soll uns lediglich als Beispiel einer
extrem personwertzentrierten Motivationslehre dienen, ohne daß w i r ihn in seinen
Einzelheiten bewerten wollen.
76
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
im „normalen" nichtpathologischen Bereich) zustimmen. Darüber hinaus
gibt es gewiß Leute, denen Macht und Überlegenheit über andere als
höchster Personwert oder höchster Wert überhaupt gilt; aber daraus
eine Allgemeingültigkeit zu machen und im Streben nach Macht die
einzigen Willenshandlungen zu sehen, das scheint uns genauso verfehlt
wie die Annahme einer monothematischen Trieblehre (vgl. unsere Kritik
der monothematisdien Trieblehren auf S. 33 ff.). Wir folgen in dieser
Auffassung S C H W A R Z , der in seiner Kritik des „Willens zur Macht"
(der ihm im Sinne N I E T Z S C H E S als angeborener „physiologisch-meta-
physischer Trieb" gilt) die begriffslogische Unmöglichkeit einer „Einheit"
des Machtstrebens nachweist und das Machtstreben auf das viel allge-
meinere „Wollen persönlichen Wertes" zurückführt: „Dazu kommt, dass
die angeborenen Triebe an Bestimmtheit verlieren, sobald wir sie näher
betrachten. 2 . B. der Wille zur Macht soll einer sein. Aber das, was wir
Macht nennen, ist vieles und verschiedenes. Wir besitzen materielle
Macht über andere, wenn uns die äusseren Machtmittel dazu eignen.
Wir können Menschen auch durch geistigen Einfluss beherrschen. Oder
wir können mit der sittlichen Macht des Vorbilds auf sie wirken, indem
wir uns selber an große Ziele hingeben und dadurch Nacheiferung
wecken. Wieder eine andere ist die Macht über Tiere und Sachen... Da
der angeborene Machtwille einer sein soll, so kann er sich nicht auf alle
diese konkreten Machtarten zusammen richten. Müssten wir sie doch
auch erst erfahren haben, um sie zu kennen und zu schätzen... Das
Ziel jenes Machtwillens kann also höchstens das gemeinsame sein, was
alle jene Arten zur Gattung vereinigt: die Steigerung des eigenen, per-
sönlichen Wertes, indem man über irgend etwas anderes herrscht...
So bleibt vom Willen zur Macht nur das leere Wollen persönlichen
Wertes ü b r i g . . . Bei gründlicher Prüfung wird jener .angeborene Macht-
wille' (Oberwille) auch in anderer Hinsicht einer blossen Anlage immer
ähnlicher, die freilich seltsamerweise nicht ruht, sondern thätig, aktuell
sein müsste. In welchem Verhältnis mögen zu ihm jene einzelnen Macht-
bestrebungen (Unterwillen) stehen, die wir oben kennen lernten, die
durch ihre Inhalte konkret sind und später in uns auftreten? Bilden sie
sich neben ihm und unabhängig von ihm, indem besondere Vorstellungen
oder Gefühle auf uns wirken? Gäbe man das zu, so wäre der Oberwille
überflüssig" ( S C H W A R Z 1 9 0 0 , S. 6 2 f.). So wird für S C H W A R Z der ange-
borene Machtwille zur „psychologischen Ungestalt", ebenso wie der
Wille zur Zeugung, zur Betätigung, zum Wissen usw.
Aus den vorangegangenen Überlegungen sollte klar geworden sein,
daß im „Machtstreben" lediglich eine der vielen Möglichkeiten zur Ver-
wirklichung von Personwerten überhaupt zu sehen ist. Im Phänomen
der Macht wird jener Aspekt der Person angesprochen, den man als
„Potenz" bezeichnen könnte. Die Einführung dieses Begriffes in un-
77
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
seren Problemkreis scheint uns berechtigt, da die Anwendung der von
E R T E L aufgeführten Begriffe, die sich in der Faktorenanalyse als hoch
mit dem „Anmutungs"-Faktor „Potenz" geladen erwiesen hatten (vgl.
besonders E R T E L 1965 a, 1965 b), auf eine reale Person genau das deckt,
was wir in unseren Ausführungen meinten. In einer Erhöhung der
eigenen „Potenz" sehen wir also eine Möglichkeit unter anderen, Person-
werte zu verwirklichen.
„Personwerte" bei JUNG, ROGERS und MASLOW
In anderen Theorien wird das Wollen der Verwirklichung von Per-
sonwerten allgemeiner gefaßt; hier richtet sich das Wollen nicht nur auf
einzelne Aspekte der Person wie „Potenz", „Aussehen", „soziales Ver-
halten" usw., sondern auf eine Soseinslageerhöhung der Person über-
haupt. Bei dem Tiefenpsychologen J U N G geschieht das in dem Prozesse
der „Individuation", dem Finden zu sich selbst. „Je mehr man sich aber
durch Selbsterkenntnis und dementsprechendes Handeln seiner selbst
bewußt wird, desto mehr verschwindet jene, dem kollektiven Unbe-
wußten aufgelagerte Schicht des persönlichen Unbewußten. Dadurch
entsteht ein Bewußtsein, das nicht mehr in einer kleinlichen und per-
sönlich empfindlichen Ich-Welt befangen ist, sondern an einer weitern
Welt, am Objekte, teilnimmt" ( J U N G 1938, S. 99). Das Zentrum der
Persönlichkeit, die den Individuationsprozeß erfolgreich durchlaufen
hat, liegt — so G O L D B R U N N E R — „nicht mehr im Ich, als der Summe
der Bewußtseinsinhalte, sondern in einem virtuell gedachten Punkt
zwischen Bewußtsein und Unbewußtem. Ihn nennt Jung das Selbst...
Individuation bezweckt die Bildung des Selbst, weshalb man audi Selbst-
werdung oder Selbstauszeugung sagen kann" ( G O L D B R U N N E R 1949,
S. 139). An diesem Selbst sind die „Persona" (die äußere Erscheinung
im sozialen Kontext), das „Ich", das „persönliche Unbewußte", die
„Anima" sowie das „kollektive Unbewußte" mit seinen „Archetypen"
widerspruchsfrei beteiligt. Da das „Selbst", dem eine höhere Soseins-
lage der Person entspricht, nicht von Anfang an existiert, ist seine
Existenz dem wollenden Individuum ein positiver Gegenstand des
Wollens, eine „Aufgabe"; der Verwirklichung dieses Wertes unterzieht
es sich im Prozeß der Individuation. Der Nachteil der JuNGschen Kon-
zeption liegt in der schweren empirischen Uberprüfbarkeit der invol-
vierten Annahme, so daß sich J U N G ZU einer eher kontemplativen analo-
gisierenden Methode bekennen muß, von der er selbst zugibt, daß sie
nicht unbedingt überzeugend ist: „Ich kann daher nichts Überzeugendes
vorbringen, d. h. nichts, was den Leser so überzeugt, wie es den über-
zeugt, dem es eigenstes Erlebnis ist. Wir müssen es ihm schon glauben
78
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
in Analogie mit dem, was wir selber erfahren haben. Schließlich — wenn
alles fehlt — können wir doch das Endresultat, nämlich die Veränderung
der Persönlichkeit, unzweifelhaft wahrnehmen" ( J U N G 1938, S. 174 f.).
Auch R O G E R S läßt in seiner Theorie vom Selbst Raum für eine
„Erhöhung" der Person: „Ideal self (or self-ideal) is the term used
to denote the self-concept which the individual would most like to
posses, upon which he places the highest value for himself. In all other
respects it is defined in the same way as the self-concept" ( R O G E R S 1959,
S. 200). „Self-concept" wird von R O G E R S synonym auch mit „seif",
"concept of self" bezeichnet. „These terms refer to the organized,
consistent conceptual gestalt composed of perceptions of characteristics
of ,1* or ,me' and the perceptions of the relationships of the ,IC or ,me'
to others and to various aspects of life, together with the values
attached to these perceptions. It is a gestalt which is available to
awareness though not necessarily in awareness. It is a fluid and changing
gestalt, a process, but a any given moment it is a specific entity which
is at least partially definable in operational terms by means of a Q
sort or other instrument or measure. The term self or self-concept is
more likely to be used when we are talking of the person's view of
himself, self-structure when we are looking at this gestalt from an ex-
ternal frame of reference" ( R O G E R S 1959, S. 200).
M A S L O W sieht in dem Bedürfnis nach „Selbstaktualisierung" (self-
actualisation) das Motiv, das die Handlungen des Subjekts steuert, wenn
die „fundamentaleren" Bedürfnisse befriedigt sind: „Even if all these
needs are satisfied, we may still often (if not always) exspect that a
new discontent and restlessness will soon develop, unless the individual
is doing what he is fitted for. A musician must make music, an artist
must paint, a poet must write, if he is to be ultimately happy. What a
man can be, he must be. This need we may call self-actualisation...
It refers to the desire for self-fulfillment, namely, to the tendency for
him to become actualized in what he is potentially. This tendency
might be phrased as the desire to become more and more what one is,
to become everything that one is capable of becoming" ( M A S L O W 1943,
S.382).
Abschließendes zum Begriff der Personwerte
Nun muß das Streben nach Verwirklichimg von Personwerten nicht
notwendigerweise auf das Gesamt der Person gerichtet sein, sondern
kann sich, wie wir am Beispiel des Machtstrebens gesehen haben, auch
auf Teilaspekte der Person richten. „Der Geizige misst gerne viele ein-
zelne Freuden des Lebens, um seinen Reichtum zu erhalten und zu ver-
79
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
mehren, der ihm wie ein Stück des eigenen Ich geworden ist und dessen
Sein hebt; der Eitle opfert seine Bequemlichkeit, um seine Schönheit
zu pflegen, der Mutige verachtet die Furcht in Gefahren usw." (SCHWARZ
1900, S. 39).
In den vorangegangenen Abschnitten sollte keine „Theorie der
Personwerte" abgehandelt werden, das kann im Rahmen unseres Pro-
blems nicht geschehen, sondern lediglich eine begriffslogische Voraus-
setzung geschaffen werden, die die Interpretation und Voraussage von
Verhalten ermöglicht, das unter hedonistischen Gesichtspunkten „sinn-
los" erscheinen muß. Die Kurzdarstellung einiger Theorien, in denen
der Begriff des Personwertes (wenn auch in anderen Formulierungen)
auftaucht, diente der Veranschaulichung des von uns Gemeinten.
Kennzeichnung von Zustands- und Personwerten als „Eigenwerte"
Da sich die in den beiden letzten Kapiteln abgehandelten Werte
immer entweder auf die eigene Person (Personwerte) oder aber auf die
Zuständlichkeiten der eigenen Person (Zustandswerte) beziehen, scheint
es uns berechtigt, sie mit SCHWARZ zur Kategorie der Eigenwerte zu-
sammenzufassen, wodurch eine bessere Abhebung von einer weiteren
Wertkategorie, nämlich der Fremdwerte, möglich ist, die wir im näch-
sten Kapitel einführen wollen.
Nachfolgende tabellarische Ubersicht soll das Verständnis der von
uns getroffenen formal-inhaltlichen Einteilung der Eigenwerte er-
leichtern:
Tabellarische Übersicht I
Formal-inhaltliche Einteilung der
Eigenwerte
Gegenstand Vorzeichen des Bezeichnung des Wertes
Gegenstandes
Zuständlichkeit :
angenehme
Zuständlidikeit + Zustandswert
unangenehme
Zuständlidikeit Zustandsunwert
Soseinslage der Person (Personhaftigkeit) :
erhöhte Soseinslage + Personwert
verminderte Soseinslage Personunwert
(Die Tabelle ist von links nach rechts zu lesen)
80
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
4- F r e m d w e r t e
Einführung der Fremdiverte
Die Klassifikation menschlicher und tierischer Verhaltensweisen als
die Verwirklichung von Zustands- und/oder Personwerten intendierend
oder die Verwirklichung von Zustands- und/oder Personunwerten ver-
meidend ermöglicht uns in vielen Fällen eine Voraussage und Erklä-
rung des jeweiligen zu erwartenden Verhaltens, sofern wir Aussagen
darüber machen können, welche speziellen Zustands- und/oder Person-
werte oder -unwerte involviert sind und wie deren Verwirklichung oder
NichtVerwirklichung operational zu kennzeichnen ist. Es gibt jedoch
Verhalten, das wir mit Rekurs auf die Verwirklichung von Zustands-
oder Personwerten nicht erklären und voraussagen können, das aber
dennoch als zielgerichtet zu klassifizieren ist, wenn wir die handelnden
Personen befragen. D a gemäß unserer Definition zielgerichtetes Verhal-
ten nur auf einen Willensakt folgen kann und in einem Willensakt
stets ein Wert gesetzt wird, muß es außer den bisher aufgeführten
Wertkategorien noch eine dritte geben, die sich mit den beiden ersten
nicht überschneidet. „Denn nur ein Teil unserer Wollungen geht auf
persönlichen (Eigen-)Wert. Andere zielen darauf, Fremdes zu verwirk-
lichen, zu fördern oder zu erhalten. Wenn wir ringen in der Kunst,
uns mühen in der Wissenschaft, nicht aus Rücksicht auf Lohn oder
Nutzen oder auf Ehre und Ruhm, sondern um hier Wahrheit, dort
Echtheit des Ausdrucks zu finden, so bethätigen wir solche Willens-
regungen. Wenn wir dem Elenden helfen, nicht weil wir unsere eigne
sympathische Unlust an seinem Zustande los werden wollen, noch weil
wir hoffen, Lohn von ihm zu ernten, noch weil wir uns damit bei uns
selber eines Verdienstes schmeicheln möchten, so ist es auch hier wieder
ein unmittelbarer, mächtiger Impuls, der Herrschaft über unseren Wil-
len gewinnt" (SCHWARZ 1900, S. 41 f.). In einer Anmerkung weist
SCHWARZ darauf hin, daß es psychologisch notwendig sei, „auch die
Ziele der wissenschaftlichen und künstlerischen Bethätigung als Fremd-
werte anzusprechen" (S. 41, Anm. 1). Er rechnet sie den inaltruistischen
zu, die er von altruistischen abhebt, „welche letzteren wir als ein Gutes
denken, das man seinen Mitmenschen thut oder gönnt" (S. 41, Anm,. 1).
Auseinandersetzung mit den Egoismus-Theorien (SPENCER, STIRNER,
NIETZSCHE) und ihre Zurückweisung
Bei der Setzung eines Fremdwertes wird völlig von der eigenen
Person und ihren Zuständlichkeiten abgesehen. „Arbeitend, helfend,
6 Keiler, Wollen gj
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
schenkend, dienend geben wir uns an Fremdes hin. Wer Zustandswerte
(Lust aller Art) begehrt, will geniessen. Wer Person wert (Macht, Schön-
heit, Ehre, Reichtum usw.) erstrebt, will besitzen. Sdiaffen will, wer
sich einem Fremdwerte weiht. Ein Fremdes wird ihm zum Werte, indem
dessen Vorstellung unmittelbar auf seinen Willen wirkt; dieses zu ver-
wirklichen, zu erhalten, in seinem Sein zu fördern, ist der Sinn und
das Werk seines Schaffens" ( S C H W A R Z 1 9 0 0 , S. 4 2 ) . Wirkt das, was wir
zunächst als Verwirklichung eines Fremdwertes ansahen, in irgendeiner
Form auf die wollende Person zurück und war dieses Zurückwirken
von dem wollenden Subjekt intendiert (wenn wir z. B. jemandem in der
Hoffnung etwas schenken, er würde wiederschenken), so war das, was
wir als Verwirklichung eines Fremdwertes ansahen, nicht der eigentliche
Gegenstand des Wollens, sondern nur Mittel zum Zwecke der Ver-
wirklichung eines Zustands- oder eines Person wertes; dadurch wird der
Anspruch auf Verwirklichung eines Fremdwertes verwirkt. Das gilt
auch, wenn ein Rüdewirken auf die eigene Person zwar intendiert war,
aber nicht erfolgte. Denn in einem Fremdwert setzt sich das wollende
Ich ein Ziel, dessen Verwirklichung zwar ursächlich an dieses Ich ge-
bunden scheint, das jedoch, wenn einmal verwirklicht, ohne Beziehung
auf das Ich bestehen kann, auf dessen Wollen es mittelbar (nämlich durch
eine Handlung) folgt.
Nach Ansicht der Egoismus-Theoretiker (z. B. S P E N C E R , S T I R N E R ,
NIETZSCHE) ist alles Streben nach Fremdwerten Täuschung, ein Umweg
zum eigentlichen Ziele, das im Ich des einzelnen den alleinigen Gegen-
stand des Wollens hat. Bei S P E N C E R und S T I R N E R ist das Wohl des je
einzelnen der Zweck; die Gesellschaft das Mittel zur Erreichung dieses
Zweckes. Für S P E N C E R ist Altruismus nur Anlaß zu höherem egoistischen
Genuß, deshalb gilt ihm Selbstlosigkeit als ausgereifter Egoismus
( S P E N C E R 1 8 9 6 ) . S T I R N E R S „Der Einzige und sein Eigentum" ist geradezu
als ein Manifest des Egoismus anzusehen; da man in der Absicht, einem
höheren Ziele als dem eigenen Selbst zu dienen, doch nur dem Egoismus
eines anderen oder einer Sache diene, sei es doch eigentlich besser, sein
Bemühen auf sich zu richten, da die anderen ja das gleiche täten. „Ich
brauche gar nicht an jedem, der seine Sache Uns zuschieben möchte, zu
zeigen, dass es ihm nur um sich, nicht um Uns, nur um sein Wohl,
nicht um das Unsere zu thun ist. Seht Euch die Übrigen nur an. Begehrt
die Wahrheit, die Freiheit, die Humanität, die Gerechtigkeit etwas
anderes, als dass Ihr Euch enthusiasmiert und ihnen dient?" ( S T I R N E R
2. Aufl. 1892, S. 13). „Fort denn mit jener Sache, die nicht ganz und
gar Meine Sache ist! Ihr meint, Meine Sache müsse wenigstens die ,gute
Sache' sein? Was gut, was böse! Ich bin ja selber Meine Sache, und Ich
bin weder gut noch böse. Beides hat für Midi keinen Sinn. Das Göttliche
ist Gottes Sache, das Menschliche Sache ,des Menschen'. Meine Sache ist
82
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
weder das Göttliche noch das Menschliche, ist nicht das Wahre, Gute,
Recht, Freie usw., sondern allein das Meinige, und sie ist keine allge-
meine, sondern ist — einzig, wie Ich einzig bin. Mir geht nichts über
M i c h ! " (STIRNER 1892, S. 14).
Für NIETZSCHES Zarathustra entspringt die Nächstenliebe nur einem
Mangel an Eigenliebe: „Ihr haltet es mit euch selber nicht aus und
liebt euch nicht genug: nun wollt ihr den Nächsten zur Liebe verführen
und euch mit seinem Irrthum v e r g o l d e n . . . Ihr ladet euch einen Zeugen
ein, wenn ihr von euch gut reden wollt; und wenn ihr ihn verführt
habt, gut von euch zu denken, denkt ihr selber gut von euch" (NIETZSCHE
1925, S. 74 f.). D a infolgedessen in Abwandlung eines Sprichwortes
„jeder sich selbst der Fernste" ist, sieht Zarathustra in der Eigenliebe
eine Zwischenstation auf dem Wege zum „Ubermenschen", deshalb lehrt
er: „Meine Brüder, zur Nächstenliebe rathe ich euch nicht: ich rathe euch
z u r Fernsten-Liebe" (NIETZSCHE 1925, S. 76).
Nun, wäre es tatsächlich so, wie die Egoismus-Theoretiker behaup-
ten, dann hätte die Kategorie der Fremdwerte freilich nur eine rein
theoretische systematische Bedeutung, ohne jemals den Anspruch erheben
zu können, auf Realität angewandt zu werden. Eine kurze Betrachtung
der Egoismus-Theorien zeigt jedoch, daß sie sich keineswegs ausschließ-
lich auf „Tatsachen" beziehen, namentlich STIRNER und NIETZSCHE41
fordern ja erst einen weltweiten Egoismus, der also noch gar nicht vor-
handen sein kann, um in seiner Allgemeingültigkeit das Streben nach
Fremdwerten als nicht existent ad absurdum zu führen. Die Gegenüber-
stellung von Eigenwerten und Fremdwerten mit dem Hinweis, das
Streben nach jenen sei doch recht eigentlich höher zu werten als das
Streben nach diesen, beweist doch lediglich, daß es mindestens einen
Menschen geben muß, dem Fremdes höher gilt als Eigenes (oder für
den zumindest Fremdes ohne Bezug auf Eigenes besteht), sonst wären
Gegenüberstellung und Hinweis sinnlos. Und auch SPENCER scheint uns
einen entscheidenden Irrtum zu begehen, wenn er im „Genuß" an der
Verwirklichung von Fremdwerten ein egoistisches Ziel sieht. Gewiß
affiziert das Gefallen an Wertverwirklichungen unsere Zuständlichkei-
ten positiv, gewiß freuen wir uns über Fremdwertverwirklichungen, aber
diese sekundären angenehmen Zuständigkeiten, namentlich die Freude,
sind doch nicht unser eigentliches Willensziel, sondern treten sozusagen
„automatisch" auf (man versuche einmal, sich über eine Fremdwert-
verwirklichung zu ärgern!), wie sie ganz allgemein sekundär durch das
41 Für LAUTERBACH (Einführung zu „Der Einzige und sein Eigentum", z. A u f l . 1892)
ist Zarathustras „Übermensch" ein „Descendent" des „Einzigen" bei STIRNER. Er
kommt zu dieser Ansicht, obwohl er meint, daß NIETZSCHE „aller Wahrscheinlichkeit
nach" den „Einzigen" nicht gekannt habe.
83
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
kognitive Erfassen einer Wertverwirklichung hervorgerufen werden (vgl.
S C H A C H T E R 1 9 6 4 , S . 5 2 f.)- Daß die durch. Wertverwirklichungen hervor-
gerufenen angenehmen Zuständlichkeiten — wir werden später näher
darauf eingehen — eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung einer
tatsächlichen Fremdwertverwirklichung spielen, soll hier nicht geleugnet
werden, aber ihre Bestätigungsfunktion erhebt sie doch nicht in den
Rang eines primären Willenszieles!
Deshalb stellen wir mit S C H W A R Z in Widerspruch zu den Egoismus-
Theoretikern die Kategorie der Fremdwerte als eine eigenständige
Kategorie neben die der Eigenwerte. Fremdwertverwirklichung gilt uns
prinzipiell als etwas anderes denn Eigenwertverwirklichung.
War in der Setzung von Eigenwerten (Person- und Zustandswerten)
das Ziel des Wollens auf die wollende Person beschränkt, war in irgend-
einer Form diese Person selbst Gegenstand des Wollens, so ist im
Fremdwert der Gegenstand des Wollens notwendigerweise „ichtranszen-
dent", „über das Ich hinausgehend". Das Wollen von Fremdwerten ist
deshalb stets auf „Welt außer mir" gerichtet; das wollende Ich kann
nur Verursacher von Fremdwertverwirklichungen sein, niemals wird es
der Verwirklichung seiner Fremdwerte teilhaflig (bei der Verwirklichung
von Eigenwerten wird das wollende Ich notwendigerweise dieser Ver-
wirklichung teilhaftig, denn das Wollen zielt ja auf die eigene Person
und nichts „außer ihr"). So besteht der gewollte Urteilsgegenstand fort,
ohne daß dieses Weiterbestehen dem Ich, dessen Wollen er mittelbar
entsprang, auch weiterhin positiver Gegenstand oder überhaupt Gegen-
stand des Wollens zu sein braucht.
Hinweis auf die bisher unzureichende Bestimmung des Wertbegriffs
Durch diese Bestimmung könnte der Eindruck entstehen, wir seien
der Ansicht, ein Wertgegenstand könne als solcher unabhängig von einem
Wollen überhaupt bestehen, sofern sein Dasein nur einmal gewollt sei
und diesem Wollen mittelbar die Verwirklichung des angezielten Wertes
folge. Das ist jedoch mit unserer Bestimmung keineswegs ausgesagt, sie
bezieht sich lediglich auf das Wollen desjenigen, der als Verursacher des
Wertgegenstandes gilt. Mit dem Umstand, daß jemand etwas „außer-
halb seiner Person" und deren Zuständlichkeiten will, ist nämlich noch
nicht festgelegt, daß dieses Etwas „außerhalb" von ihm Gegenstand
allein seines Wollens ist. Sofern es sich um einen Urteilsgegenstand
handelt, der prinzipiell auch dem Wollen anderer zugänglich ist, besteht
die Möglichkeit, daß auch andere in ihm einen Gegenstand ihres Wollens
sehen. So kann mein Wollen in bezug auf einen bestimmten Urteils-
84
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
gegenständ, der der „Welt für uns alle" 4 2 angehört (also auch inter-
subjektive Ideen und Wissenschaftssysteme), mit dem Wollen eines
anderen oder aller anderen übereinstimmen oder ihm widersprechen. Im
ersten Fall besteht unabhängig von meinem Wollen der Urteilsgegen-
stand als Gut weiter, im zweiten Fall gilt er, der positiver Gegenstand
allein meines Wollens war, unabhängig von meinem Wollen den anderen
als Übel. Hier scheint trotz unserer Bemühungen um Eindeutigkeit der
Wertbegriff mehrdeutig und schillernd zu sein. Der Eindruck eines Wert-
relativismus verstärkt sich noch, wenn wir berücksichtigen, daß ja auch
unsere Zuständlichkeiten und unsere Person dem Wollen anderer zum
Gegenstand werden können.
Das, was uns an unserer Person als Gut gilt, kann anderen, die uns
übelwollen, durchaus ein Übel sein. Auch der Einwand, unsere Zuständ-
lichkeiten und unsere Person, wie wir sie erleben, könnten ja niemals
einem anderen Gegenstand seines Wollens werden, da sie ihm ja als
solche prinzipiell nicht gegeben seien, sondern ihm nur ein erschlossenes
„hypothetical construct" sein können, bewahrt uns vor einem Relativis-
mus nur so lange, wie wir schlüssig nachweisen können, daß sich unsere
Erlebnisse und die sie anzielenden „hypothetical constructs" formal und
inhaltlich prinzipiell nicht decken. D a eine solche Annahme, die aus
methodologischen Gründen (die wir hier nicht alle aufzählen wollen)
weder zu beweisen noch zu widerlegen ist, im Widerspruch zu unseren
Überlegungen am Anfang dieser Untersuchung (s. S. 5) stehen würde,
können wir sie nicht akzeptieren. Dort hatten wir ja festgelegt, daß eine
inhaltliche Deckung möglich sein kann. Es muß also unter Beibehaltung
unserer Voraussetzung diese Form des Wertrelativismus überwunden
werden, wenn wir uns nicht in neue Widersprüche verwickeln wollen.
Was wäre auch schließlich durch diesen fragwürdigen Kunstgriff ge-
wonnen, der sich ja doch nur auf die Eigenwerte bezöge und das Problem
der Relativität der Fremdwerte überhaupt nicht berührt?
Unterscheidung von „individuellen" und „überindividuellen" Werten
Eine genauere Analyse zeigt, daß wir es hier recht eigentlich mit
einem Scheinproblem zu tun haben. Indem wir nämlich nur einen
inhaltlichen Aspekt der Wertbegriffe berücksichtigen, ließen wir un-
bemerkt die Tür für Widersprüche offen, über die wir jetzt stolpern.
42 D e m Terminus „Welt für uns alle" stellt HOLZKAMP den Begriff der „ W e l t für jeden
einzelnen" gegenüber. Die Annahme einer „Welt für uns alle" stellt nicht nur eine
Absage an jede Form von Solipsismus dar, sondern ist unseres Erachtens die V o r -
aussetzung für jede A r t v o n intersubjektiver Wissenschaft (vgl. HOLZKAMP 1964,
S. 66 f.).
85
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Die früher von uns getroffene Bestimmung der "Werte als Willensziele
besagt ja lediglich, daß überhaupt ein Wollen vorhanden sein muß,
damit wir von einem Wert sprechen können; ob dieses Wollen nun ein
allgemeines oder individuelles zu sein hat, war nicht festgelegt. Aber
jetzt erweist sich die Frage nach dem Allgemeinheitsgrad der Werte als
notwendig, um die Eindeutigkeit des Wertbegriffes (insbesondere des
Fremdwertbegriffes) zu gewährleisten.
Gilt die Verwirklichung eines bestimmten Wertes nur dem Wollen
eines einzigen Individuums als Gegenstand, so sprechen wir von einem
individuellen Wert. Der entsprechende Wertgegenstand wird je nach-
dem, ob er positiver oder negativer Gegenstand des individuellen Ge-
fallens ist, als individuelles Gut oder individuelles Übel bezeichnet.
Stimmen mehrere oder alle Individuen in ihrem Wollen in bezug auf
einen bestimmten Gegenstand überein, so bezeichnen wir den in Frage
stehenden Wert als überindividuellen Wert. Die auf überindividuelle
Werte bezogenen Wertgegenstände werden je nach Vorzeichen als über-
individuelle Güter oder überindividuelle Übel bezeichnet.
Gemäß dieser Einteilung sind Eigenwerte individuelle Werte. Sind
meine Zuständlichkeiten oder meine Person nicht nur Gegenstand meines
Gefallens, sondern auch des der anderen, werden sie zu überindividuel-
len Wertgegenständen. Eine entsprechende Einteilung ist auch für
Fremdwerte möglich, auch diese können individuell oder überindividuell
sein.
So klären sich denn auch die scheinbaren Widersprüche: Es ist niemals
ein identisches Wollen, das sich in einem Urteilsgegenstand gleichzeitig
ein Gut und ein Übel setzt, sondern es ist stets das Wollen verschie-
dener Individuen; außerdem ist der jeweilige Urteilsgegenstand je
nachdem, von welchem Individuum man ausgeht, unterschiedlichen
Wertbereichen zuzuordnen. So enthält der Umstand, daß eine be-
stimmte Zuständlichkeit meiner Person für mich ein Gut darstellt, wäh-
rend sie anderen oder einem anderen als Übel gilt, keinen Widerspruch.
Das eine ist das Wollen eines individuellen Eigenwertes, das andere das
Wollen eines überindividuellen oder individuellen Fremdwertes. Und
da aus der Definition des Wertbegriffes nicht abzuleiten ist, daß alle,
dasselbe wollen, ist die Eindeutigkeit des Wertbegriffes nicht gefährdet.
Die Fragwürdigkeit der Begriffsbestimmung von „Altruismus" bei
SCHWARZ
So besteht eine z. B. „gute T a t " unabhängig von dem Weiterbestehen
(sei es physisch, sei es im Andenken der Mitmenschen) und Gefallen
des „Wohltäters" als solche nur weiter, wenn sie auch anderen (zumin-
86
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
dest demjenigen, an dem sie verwirklicht wurde) positiver Gegenstand
des Gefallens ist. A u f diese Weise kann ein identisches Geschehen unter
den verschiedenen Wertgesichtspunkten gleichzeitig positiv und negativ
wertbesetzt sein: dem Handelnden gilt seine Tat als Verwirklichung
eines Fremdwertes; der, an dem er handelt, erlebt darin eine Soseins-
lageminderung der eigenen Person, also die Verwirklichung eines Eigen-
Unwertes. Dies geschieht etwa, wenn wir die wirtschaftliche Lage einer
Person verkennen und ihr z. B. Kleidung schenken, die sie aus ihrer
Sicht gesehen gar nicht nötig hat. Wir glauben, ihr damit wohlzutun,
und sie sieht darin eine Demütigung.
Aus diesen Überlegungen geht hervor, daß die Trennung von Fremd-
werten in altruistisches und inaltruistische gar nicht so problemlos ist,
wie es SCHWARZ anzunehmen scheint, wenn er festlegt: „Es sind
altruistische Fremdwerte, wenn wir das Wohl von Mitmenschen wollen;
es sind inaltruistische, genauer inaltruistisch-ideelle Fremdwerte, wenn
uns z. B. der Gedanke der Wahrheit, Schönheit, Sittlichkeit zum Han-
deln bewegt" (SCHWARZ 1900, S. 42). Woran kann ich denn erkennen,
ob es das „Wohl" des Mitmenschen ist, das ich will, wo doch das, was
ich „gut" meine, von anderen „übel" aufgefaßt werden kann. Liegt
das „Wohl" des anderen in dem, was er will, oder habe ich das Recht,
zu behaupten, der andere wisse nicht, was eigentlich gut für ihn ist,
während ich dieses Wissen habe? Welches sind die Kriterien jener Leute,
die von sich behaupten, sie wüßten um die wahren Bedürfnisse und
Wünsche des Volkes und wären in der Lage, ihm diese Wünsche auch zu
erfüllen?
Gibt es als entscheidendes Kriterium einen „Gesamtwillen", wie ihn
etwa ROUSSEAU und WUNDT annehmen, und wodurch wird er begrün-
det? Ist er überindividueller Ausdruck des tatsächlichen Wollens aller
in einer bestimmten Gesamtpopulation, einer Mehrheit, einer Elite?
Oder besteht er zeitlos und überindividuell in dem Wollen eines jeden
wollenden Subjektes überhaupt? Wir berühren mit diesen Fragen ein
Problem, das wir innerhalb unserer psychologischen Wertlehre von
vornherein als Randproblem zu kennzeichnen haben, denn hier geht es
nicht mehr um Werte als Gegenstand eines faßbaren Wollens (als
legitimer Gegenstand der Psychologie), sondern losgelöst davon um Werte
als ideelle „Dinge an sich". Wir können zwar im Rahmen unserer A b -
handlung klären, wie Werte formal und inhaltlich als Gegenstände des
Wollens konkreter Individuen zu erfassen sind, aber wir können als
Psychologen keine Auskunft darüber geben, ob das, was wir als die
Handlungen eines bestimmten Subjektes auslösend und steuernd be-
zeichnen, losgelöst von dem Wollen dieses Individuums „gültig" sei.
Wir können mit den Methoden unserer psychologischen Wissenschaft
nicht klären, ob es „wahre" Werte gibt oder nicht. Das ist Aufgabe einer
87
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Wertmetaphysik, der wir in einem späteren Kapitel einige Überlegungen
widmen wollen, wenn es um die historische Gegenüberstellung von
Wertempirismus und Wertabsolutismus geht. Und auch dort wird uns
lediglich ein kritischer Vergleich möglich sein, ohne daß wir uns auf
eine der beiden Positionen festlegen.
Eigene Unterscheidung zwischen „altruistischen" und „inaltruistischen"
Werten
Da wir uns in unseren Ausführungen auf empirisch Prüfbares be-
schränken, aber dennoch nicht den Begriff des „altruistischen" Fremd-
wertes aufgeben wollen, weil er uns für eine differenzierte Unterschei-
dung zielgerichteten Verhaltens nützlidi scheint, muß es uns möglich
sein, „altruistisch" unabhängig von einem allgemeingültigen „Guten" zu
definieren. Hier scheint uns ein hinreichendes Kriterium in der erlebten
oder erwarteten Konkordanz oder Diskordanz unseres Wollens eines
fremden Zustands- oder Personwertes mit dem Wollen des angezielten
Individuums bezüglich eben dieses Zustands- oder Personwertes als
Eigenwert zu liegen. Erleben wir unser Wollen mit dem des betreffenden
Subjekts als konkordant, so sprechen wir von einem altruistischen
Fremdwert, und zwar ist er positiv altruistisch, wenn der Gegenstand
des konkordanten Wollens ein positiver ist, und negativ altruistisch,
wenn der Gegenstand des konkordanten Wollens ein negativer ist. Da-
mit beschränkt sich unsere Definition eindeutig auf eine im Rahmen der
Psychologie mögliche operationalisierbare Bestimmung, ohne daß dar-
über entschieden wird, ob der Gegenstand des konkordanten Wollens
unabhängig von diesem Wollen ein „Gut" oder ein „Übel" darstellt. Wie
sind nun aber — im Gegensatz zu den altruistischen — die inaltrui-
stischen Fremdwerte zu bestimmen? Hier scheint uns folgende Fest-
legung empirisch fruchtbar: Immer dann, wenn die Verwirklichung eines
individuellen oder überindividuellen Fremdwertes als diskordant dem
Wollen desjenigen Urteilsgegenstandes erlebt oder erwartet wird, an
dem er verwirklicht wird oder verwirklicht werden soll, oder wenn die
Verwirklichung nicht Gegenstand des Wollens des involvierten Urteils-
gegenstandes ist, sprechen wir von einem inaltruistischen Fremdwert.
Damit sind einmal jene Handlungen als Verwirklichung oder ver-
suchte Verwirklichung eines inaltruistischen Fremdwertes gekennzeich-
net, deren zugrundeliegendes Wollen bezüglich der Zuständlichkeiten
oder Person eines anderen Subjekts dem Wollen eben dieses Subjekts
widerspricht. Zum anderen sprechen wir von einem inaltruistischen
Fremdwert, wenn der Gegenstand des Wollens die Soseinslageminde-
rung oder Soseinslageerhöhung einer „Sache" ist, die nicht wollen kann,
88
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
womit das zweite mögliche Kriterium erfüllt wäre. Ein inaltruistischer
Fremdwert ist positiv, wenn seine Verwirklichung positiver Gegenstand
des Wollens desjenigen ist, der den Wert setzt, er ist negativ, wenn seine
Verwirklichung negativer Gegenstand des Wollens desjenigen ist, der den
Wert setzt. Nachfolgende tabellarische Übersicht soll das Verständnis der
von uns getroffenen formalen Einteilung der Fremdwerte erleichtern:
Tabellarische Übersicht I I
Formale Einteilung der Fremdwerte
Gegenstand Vorzeichen des Allgemeinheitsgrad Bezeichnung
Gegenstandes des Wollens des Wertes
altruistisch: individueller
—> individuell
altruistischer Wert
+
konkordant 4 ® dem Wollen überindividueller
überindividuell
des angezielten Subjektes altruistischer W e r t
(oder der angezielten S u b -
jekte) bezüglich seiner (oder individueller
ihrer) Eigenwerte individuell —»
altruistischer Unwert
überindividueller
überindividuell —>
altruistischer Unwert
inaltruistisch: individueller
individuell
inaltruistischer Wert
+
diskordant 4 ' dem Wollen überindividueller
—> überindividuell — »
des angezielten Subjektes inaltruistischer Wert
(oder der angezielten S u b -
jekte) bezüglidi seiner (oder individueller
ihrer) Eigenwerte oder So- individuell ~* inaltruistischer
seinslage einer „Sache" Unwert
(oder mehrerer „Sachen"),
die nicht wollen kann (kön-
überindividueller
nen)
—> überindividuell inaltruistischer
Unwert
Die Tabelle ist von links nach rechts (Pfeilrichtung) zu lesen.
43 Indem wir als Kriterium der Kategorisierung „altruistisch" oder „inaltruistisch" die
erlebte oder erwartete Konkordanz oder Diskordanz unseres Wollens mit dem der
anderen wählten, schlössen wir die Möglichkeit einer Täuschung aus, die den R a h -
men des Lebensraumaspektes überschritten hätte. Es ist also nicht entscheidend, was
der andere „wirklich" will, sondern wie uns sein Wollen gegeben ist. Diese Bestim-
mung läßt jedoch die Möglichkeit offen, daß ein Wollen meinerseits zu verschie-
denen Zeitpunkten einmal als konkordant, das andere Mal als diskordant dem
Wollen der anderen beurteilt werden kann. Wir werden auf dieses Problem später
zurückkommen.
89
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Grenzfälle
So ist eine Zuordnung zu altruistischen oder inaltruistischen Werten
in den meisten Fällen eindeutig möglich; es gibt jedoch Zweifelsfälle, in
denen eine Entscheidung nicht so ohne weiteres möglich ist. Handeln
wir altruistisch oder inaltruistisch, wenn wir in der Sorge um die
menschliche Gemeinschaft aufgehen? SCHWARZ sagt in diesem Zusam-
menhang: „Nach der Meinung mancher Ethiker, jener der utilitaristi-
schen Schule, dächten wir an unsere Mitmenschen, während wir all das
wollten. Wir hätten d a b e i . . . das Wohl der ungezählten Einzelnen im
S i n n e . . . , wie ja auch alle soziale Organisation ausgesprochen oder still-
schweigend darauf ziele, dass sich die Menschen gegenseitig hülfen oder
förderten. Altruistische Fremdwerte wären es daher, für die wir in allen
den genannten Fällen einträten. — Anderes lehrt WUNDT. Nach ihm
sollen wir hier ganz und gar nicht an die Mitmenschen . . . denken, son-
dern wir weihten uns einem übergreifenden Gesamtwillen... Er lebe
in jeglicher sozialer Gemeinschaft und schaffe sich seine Zwecke, ohne
dass er im Wollen aller Gesamtheitsglieder seinen Wiederhall zu finden
brauche. — Unstreitig etwas Unpersönliches hiesse nach dieser letzteren
Auffassung Gesamtwille; und so wären es eben danach inaltruistische
Fremdwerte, deren Vorstellung das Handeln in obigen Beispielen re-
gierte" (SCHWARZ 1900, S. 43). Wenn SCHWARZ sich bei den angeführten
Beispielen — zwar abweichend von WUNDT, gegen dessen „Gesamt-
willen" er sich wendet, der ihm nicht realer ist „als der W a l d neben
den einzelnen Bäumen" — gegen die utilitaristische Auffassung ein-
deutig für die inaltruistischen Werte entscheidet, was er dadurch be-
gründet, daß der Wille des Einzelnen durch die „Vorstellung eines Gan-
zen (totum) gefangen" sei (1900, S. 44), so können wir ihm nicht
zustimmen, da eine generelle Bestimmung unserer Ansicht nach nicht
eindeutig möglich ist. Z w a r hebt SCHWARZ diese A r t der inaltruistischen
Werte von anderen dadurch ab, daß er sie als „inaltruistisch-soziale"
bezeichnet, aber damit ist u. E. das Problem nicht zufriedenstellend ge-
löst. Warum sollen in den genannten Fällen nicht vielen Menschen
altruistische Werte vorschweben, warum soll sich das nur, wie SCHWARZ
annimmt, auf „wenige Theoretiker" erstrecken? Und wäre nicht auch
schon die Werthaltung „weniger Theoretiker" ein entscheidendes Hin-
dernis für die Annahme, daß in den aufgeführten Beispielen generell die
Verwirklichung inaltruistischer Werte angestrebt würde? W i r meinen,
es kommt immer auf den Gesichtspunkt an, unter dem das Wollen
ansetzt: Habe ich mit meinen Bemühungen das Wohl der Mitglieder
einer Gemeinschaft, die ich als Individuen mit ihren Wünschen respek-
tiere, im Auge (und daß dies in der Wirklichkeit auch tatsächlich vor-
kommen kann, wird keiner leugnen) und kogniziere ich mein Wollen
90
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
als dem Wollen dieser Individuen konkordant, so ist zweifelsfrei die
Anwendung des altruistischen Wertbegriffes berechtigt. Sehe ich jedodi
vom Wollen der Individuen einer Gemeinschaft ab, fasse ich die Ge-
meinschaft als von den Individuen losgelöstes Abstraktum auf (was,
wie jeder zugeben wird, in der Wirklichkeit auch vorkommen kann),
so strebe ich per definitionem die Verwirklichung eines inaltruistischen
Wertes an, da ja ein Abstraktum nicht wollen kann. Inaltruistisch ist
der Wert auch dann, wenn ich bei der Verwirklichung zwar Zuständ-
lichkeiten oder Person der die Gemeinschaft bildenden Individuen im
Auge habe, aber mein Wollen dem dieser Individuen diskordant ist.
Inhaltliche Analyse altruistischen und inaltruistischen Wollens
Läßt sich über diese formale Einteilung der Fremdwerte in altrui-
stische und inaltruistische hinaus noch eine inhaltliche Bestimmung tref-
fen, die eine bessere Differenzierung ermöglicht? Wenn wir die Bedeu-
tung des altruistischen Wertbegriffes analysieren, zeigt sich, daß bei der
Verwirklichung eines individuellen oder überindividuellen altruistischen
Wertes tautologisch die Realisation angenehmer Zuständlichkeiten oder
die Soseinslageerhöhung einer Person oder eines personhaften Indivi-
duums angestrebt wird. Altruistische Unwerte beziehen sich demnach
meistens auf die Realisation unangenehmer Zuständlichkeiten oder die
Soseinslageminderung einer Person oder eines personhaften Individuums.
H a t unser inaltruistisches Wollen die Veränderung der Soseinslage einer
„Sache" zum Gegenstand, so geht unser Verhalten in den meisten Fällen
auf eine Soseinslageerhöhung der „Sache" als Verwirklichung eines
individuellen oder überindividuellen inaltruistischen Wertes. Die So-
seinslageminderung einer „Sache" ist dementsprechend zumeist ein
individueller oder überindividueller inaltruistischer Unwert. Dort, wo
unser Wollen bezüglich der Zuständlichkeiten oder der Person eines
anderen Subjektes als diskordant dem Wollen dieses Subjektes kogni-
ziert wird, wir also ebenfalls die Verwirklichung eines inaltruistischen
Wertes anstreben, ist unser Verhalten ebenfalls in den meisten Fällen
auf etwas gerichtet, das wir als Soseinslageerhöhung der Person oder
Personhaftigkeit des anderen oder als angenehme Zuständlichkeit kogni-
zieren, nur bezieht sich unser Wollen nicht auf einen Gegenstand in der
Gegenwart, sondern auf etwas in der Zukunft, d. h., wir können durch-
aus für den Augenblick eine Soseinslageminderung der Person eines
anderen (z. B. eine Demütigung) oder eine unangenehme Zuständlichkeit
eines anderen wollen (und somit das augenblickliche Wollen des anderen
als unserem Wollen diskordant kognizieren) in der Hoffnung, daß der
Verwirklichung dieser negativen Werte die Verwirklichung positiver
91
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Werte folgt, die den Wert der augenblicklich möglichen Verwirklichung
positiver Werte um ein beträchtliches übersteigt. Dies geschieht z. B.,
wenn wir von jemandem verlangen, daß er sich für ein begangenes
Unrecht entschuldigt (was die wenigsten Leute gern tun), um danach
die Soseinslage seiner Person zu erhöhen, indem wir ihn wieder in
Ehren aufnehmen. So kann auch der A r z t den Schmerz eines Patienten
wollen, wenn er ihn operiert, um sein Leben zu erhalten oder ihn von
anderen Schmerzen zu befreien.
Eine genauere Analyse der beiden letzten Beispiele läßt Zweifel
aufkommen, ob wir hier überhaupt berechtigt sind, von „inaltruistischen"
Werten zu sprechen, denn unser Gefallen geht ja beide Male nicht eigent-
lich auf die augenblickliche Zuständlichkeit oder die augenblickliche
Soseinslage des anderen, sondern auf etwas, das in der Zukunft liegt
und von dem wir hoffen, daß unser Wollen konkordant dem Wollen
des anderen ist, an dem wir im Augenblick Unwerte verwirklicht sehen
wollen. Es sind also demnach altruistische Werte, die unser Handeln
auslösen und steuern, denn das inaltruistische Willensziel war ja ledig-
lich Mittel zum Zweck eines altruistisdien. Ebenso ist es, wenn wir
Leben und Ehre einer fremden Person um der „guten Sache" willen
opfern und diese Person weder Ehre noch Leben opfern will. Hier ist
das, was wir als „gute Sache" sehen, das eigentliche Willensziel und
nicht die zur Erreichung dieses Ziels notwendige Soseinslageminderung
des anderen. Das, was man als negativ bewerten müßte, wenn es um
seiner selbst willen geschähe, wird ja von uns gar nicht als negativ
bewertet, weil es im Dienste eines positiven Wertes steht. Negativ be-
werten wir unsere Handlung am anderen erst, wenn sich herausstellt,
daß auch das eigentliche Ziel dem Wollen des anderen widerspricht
oder sich die angeblich „gute" Sache zu einer „schlechten" entwickelt
oder wir sie unter neuen Gesichtspunkten als „schlecht" erkennen.
Dann wird jedoch auch nachträglich die unangenehme Zuständlichkeit
oder die Soseinslageminderung der Person des anderen zum negativen
Gegenstand unseres Wollens, wir bereuen unsere Tat und wünschen, sie
ungeschehen zu machen.
Kritik der K R A F T sehen Thesen über Genese und Begründung der
Fremdwerte
So scheint unser Wollen in bezug auf unsere Mitmenschen stets
altruistisch zu sein, sofern Zuständlichkeiten oder Person des anderen
der tatsächliche Gegenstand unseres Gefallens sind und nicht lediglich
eine Zwischenstation auf dem Wege zum eigentlichen Willensziel. Wie
kommt es zu dieser Konkordanz des Wollens, warum sind uns die
92
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
angenehmen Zuständlichkeiten oder die Seinserhöhung der Person eines
anderen positiver Gegenstand des Gefallens, wo sie doch ebensogut ne-
gativer Gegenstand sein könnten? Geht es uns (wie die Egoismus-
Theoretiker meinen) letztlich gar nicht um den anderen, sondern um
uns und unsere Zuständlichkeiten, die sekundär auf das Erleben einer
Wert- oder Unwertverwirklichung an einem anderen folgen? Dieser
Meinung scheint KRAFT zu sein, der in der „Einfühlung" das Erklä-
rungsprinzip für jene Phänomene sieht, die wir als Setzung eines
altruistischen Wertes bezeichnen. „Der Mensch kann, wenn jemand an-
derer in einer bestimmten Situation vor ihm steht, ganz unmittelbar die
dieser Lage entspringenden Gefühle und Strebungen in sich erleben, und
weil man nicht sich, sondern den anderen in dieser Lage weiß, intro-
jiziert man diesem solche Gefühle und Strebungen. Man weiß so unmittel-
bar, wie ihm zumute ist. Dadurch ergibt es sich, daß auch dasjenige,
was dem andern Unlust oder Lusit bringt, was dem andern unwillkom-
men oder erwünscht ist, was den andern schädigt oder fördert, ebenfalls
positiv oder negativ ausgezeichnet wird. Aus der Einfühlung ergeben
s i c h . . . Strebungen, das Leid und das Unerwünschte abzuwehren, die
Lust und das Erwünschte herbeizuführen. Wer diesen Strebungen Erfül-
lung bringt, wird dadurch ebenfalls ausgezeichnet. . . . Es ist nur eine
Verallgemeinerung dessen, was so an individuellen Fällen erlebt und
bewußt geworden ist, wenn sich diese Strebungen zur Forderung des
Altruismus verdichten. . . . Jedenfalls wird man durch Mitgefühl dazu
geführt, daß man das, was man für sich selber wünscht, auch für an-
dere wünscht — und in der Ausgestaltung zum Ideal des Altruismus
auch für die anderen wünscht. . . . Ein solches selbstgesetztes und frei-
willig anerkanntes Ideal hat seinen Wertcharakter nicht mehr lediglich
von außen her erhalten, sondern er wurzelt im Persönlichen, in den
Lebenserfahrungen und in ursprünglichen Stellungnahmen dazu. Es ist
die eigentliche Grundlage des sittlichen Wertes" (KRAFT 1951, S. 179 f.).
Diese Ausführungen KRAFTS sind in verschiedenen Punkten durchaus
anfechtbar: Einmal gibt KRAFT keine Auskunft darüber, wie denn der
Mechanismus dieser „Einfühlung" zu denken sei und warum er ein-
deutig und notwendig ein konkordantes Erleben zur Folge habe, das
ja laut KRAFT Voraussetzung der Bewertung ist. Das führt in einigen
Fällen, w o wir Diskordanz zwischen unseren Zuständlichkeiten und
denen anderer feststellen müssen, zu Paradoxien, die KRAFT mit seinem
Ansatz nicht auflösen kann. Wie kommt es z. B., daß dem Sadisten die
Leiden der anderen eine Quelle der Lust sind? Etwa weil er eigentlich
selbst leidet? Warum bin ich traurig, wenn andere mich auslachen,
usw.? Und gibt man KRAFT die Bewertung durch „Einfühlung" trotz
der gewichtigen Einwände zu, die seit Einführung dieses Begriffes durch
LIPPS (1907) immer wieder erhoben wurden (vgl. besonders HOLZKAMP
93
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
1957)5 8 0 widerspricht das eindeutig seiner eigenen Formulierung, daß es
sich beim Altruismus um ein „freiwillig anerkanntes Ideal" handele; denn
wenn die positive oder negative Bewertung abhängig von meinen Gefühlen
erfolgt, so ist sie nicht mehr freiwillig, sondern durch diese Gefühle
erzwungen. Außerdem gibt K R A F T ZU, daß der Mechanismus der „Ein-
fühlung" kein primärer ist (was er sein müßte, wenn er den Erklärungs-
wert haben soll, den K R A F T ihm zuschreibt), sondern in einem kogni-
tiven Prozeß der „Einsicht" und „Verallgemeinerung" erst aufgebaut
werden muß; der eigentliche Mechanismus, welcher der altruistischen
"Wertsetzung zugrundeliegt, ist also kein emotionaler, sondern ein
kognitiver. Hier zeigt sich auch, daß K R A F T sekundäre Zuständig-
keiten als Ursache der Bewertung ansieht, also die bloße Begleiterschei-
nung für die Ursache nimmt. Denn wir „fühlen" nicht unmittelbar durch
eine besondere parapsychologische Fähigkeit die Gefühle der anderen,
sondern beziehen ihr zielgerichtetes Verhalten oder ihr Ausdrucksver-
halten auf ihre Zuständlichkeiten (was ein kognitiver Prozeß ist);
gemäß dem vermuteten Vorzeichen der Zuständlichkeiten beurteilen wir
diese als Verwirklichung eines positiven oder negativen Wertes, der uns,
sofern unser "Wollen als konkordant dem Wollen des anderen kogniziert
wird, zum positiven oder negativen altruistischen Wert wird (was wie-
derum ein kognitiver Prozeß ist), und als Folge dieser Bewertung tritt
dann schließlich eine sekundäre Zuständlichkeit auf (diese ist emo-
tional)44. Die Bewertung ist also nicht Folge unserer Zuständlichkeiten,
die auf dem geheimnisvollen Wege der „Einfühlung" in uns entstehen,
sondern vielmehr die Ursache sekundärer Zuständlichkeiten. Hiermit
stellen wir uns mit S C H W A R Z auf den Standpunkt, daß das Gefallen an
altruistischen Gütern eine unmittelbare von Zuständlichkeiten unabhän-
gige Willensregung ist, dem allerdings als Begleiterscheinung Zuständ-
lichkeiten folgen können. Der von S C H W A R Z in diesem Zusammenhang
gewählte Begriff der „nachahmenden Lust- oder Unlustgefühle"
( S C H W A R Z 1900, S. 38, Anm. z) scheint uns jedoch irreführend, denn es
wird ja nicht unterscheidungslos jedes Gefühl eines anderen „nachge-
ahmt", wie die oben erwähnten Beispiele (Gefallen des Sadisten an den
Leiden der anderen, meine Traurigkeit, wenn andere mich auslachen) ge-
zeigt haben. Entscheidend ist vielmehr — und hier legt sich auch
S C H W A R Z eindeutig fest —, daß die Ursache unserer „sympathischen"
Gefühle im Erlebnis einer Wert- oder Unwertverwirklichung zu sehen
ist. „Sehen wir zuständlichen Wert oder Unwert, Lust oder Unlust
anderer, so erfüllt uns das mit nachahmenden Lust- oder Unlustgefühlen.
Wir erleiden Mitfreude oder Mitleid, die sogenannten symphatischen
Gefühle" ( S C H W A R Z ebd.). Hier scheint uns in der Freude über die
44
Diese funktionale Kennzeichnung der altruistischen Wertung schließt nicht aus, daß
uns phänomenal die Zuständlichkeit des anderen unmittelbar gegeben scheint.
94
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Freude des anderen und im Leid wegen des Leides des anderen ein Son-
derfall eines schon weiter oben angeführten allgemeinen Phänomens vor-
zuliegen: Das Erlebnis von Wert- oder Unwertverwirklichungen affiziert
allgemein unsere Gefühle. Das Vorzeichen dieser in ihrer Qualität kogni-
tiv determinierten Zuständlichkeiten bestimmt sich aus dem Vorzeichen
des verwirklichten Wertes. Es kommt nämlich zu einem Mitleiden oder
Mitfreuen nur dort, wo unser Wollen als dem Wollen jener Person kon-
kordant kogniziert wird, an der wir einen Zustandswert oder -unwert
verwirklicht sehen. Von daher wird meine Zuständlichkeit der Traurig-
keit verständlich; obwohl die anderen sich freuen, also eine angenehme
Zuständlichkeit realisieren, gilt mir diese Zuständlichkeit als negativer
Gegenstand meines Gefallens, denn sie ist die Reaktion auf eine vermin-
derte Soseinslage meiner Person und somit unwertbesetzt. Dem Sadisten
ist dementsprechend das Leid der anderen die Verwirklichung eines posi-
tiven Wertes, die seine Gefühle positiv affiziert. In beiden Fällen kogni-
zieren wir unser Wollen als dem Wollen der anderen diskordant; so
leiden wir, wo andere sich freuen, und genießen, wo andere leiden. Der
von uns angenommene Mechanismus wäre auch auf die Setzung anderer
inaltruistischer Werte anwendbar, wodurch wir uns K R A F T gegenüber
entschieden im Vorteil befinden, denn er kann ja die bei der Bewertung
von „Sachen" auftretenden angenehmen oder unangenehmen Zuständ-
lichkeiten nicht auch auf „Einfühlung" zurückführen; bei uns sind in
beiden Fällen die Zuständlichkeiten Folge der wertenden Stellungnahme,
die von uns als primär gesetzt wird. Es bleiben schließlich noch zwei
weitere Einwände gegen K R A F T S Auffassung: Wäre unsere Stellung-
nahme von unseren Zuständlichkeiten abhängig, so werteten wir ein-
deutig einen Eigenwert und unser angeblich altruistisches Verhalten wäre
gar nicht altruistisch (auf den anderen) ausgerichtet, sondern auf uns
selbst. Immer wenn wir vorgäben, einen altruistischen Wert zu verwirk-
lichen, ginge es uns in Wahrheit um einen Eigenwert ( K R A F T scheint sich
hier auf einer Linie mit SPENCER ZU befinden). Dadurch wird der Begriff
des Altruismus, der sich auf einen Fremdwert bezieht, überflüssig und
irreführend. Daß es aber tatsächlich Verhalten gibt, das sich nur durch
seine Bezogenheit auf altruistische Fremdwerte erklären und voraussagen
läßt, scheint uns in überzeugender Weise SCHELER aufgezeigt zu haben,
der nachweist, daß es im Phänomen der Liebe, primär um die Soseinslage-
erhöhung der geliebten Person geht (SCHELER 1923) 45 . Ginge es uns je-
doch bei der Verwirklichung von altruistischen Werten in Wahrheit um
die Verwirklichung von Eigenwerten in Form angenehmer Zuständlich-
keiten, so wäre das, um mit K R A F T ZU reden, tatsächlich ein „raffinierter
Epikuräismus" (was bei K R A F T ein durchaus negativ besetzter Wertbe-
45
Bei F R O M M hat Liebe sowohl einen Fremdwertaspekt als audi den Aspekt der Selbst-
verwirklidiung ( F R O M M 1 9 6 8 ) .
95
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
griff ist, den er allerdings nicht auf seine Auffassung der altruistischen
Werte anwendet).
Inaltruistisches Wollen — Das „Böse"
Auf der anderen Seite ist es fraglich, ob wir in bezug auf andere Per-
sonen überhaupt inaltruistisch wollen. Daß die theoretische Möglichkeit
besteht, die wir in unserer Begriffsbildung vorgesehen haben, ist ja noch
lange kein Beweis dafür, daß diese Einteilung mehr als nur einen forma-
len Zweck erfüllt. Tritt der Fall der Diskordanz unseres Wollens mit
dem Wollen anderer in bezug auf deren Eigenwerte denn auch in Wirk-
lichkeit auf? Wir meinen, ja. Wenn uns die Handlungen einer Person als
zur Realisation einer unangenehmen Zuständlichkeit oder Soseinslage-
minderung der Person oder des personhaften Individuums führend er-
scheinen, ist die Verhinderung dieser Handlungen in den meisten Fällen
positiver Gegenstand unseres Wollens. Und zwar ist unser Wollen dem
der angezielten Person nicht nur in den Fällen diskordant, wo diese Per-
son die Folgen der Handlung in bezug auf ihre Eigenwerte nicht reali-
siert, sondern auch dort, wo sich ihr in einer Umkehrung der Werte das,
was ihr bisher als Unwert galt, zum Wert wird (z. B. wenn jemand den
eigenen Untergang zum positiven Gegenstand seines Wollens macht und
Selbstmord verübt). Hier hat unser Wollen, wenn wir den Selbstmord
verhindern, einen Zweck, der gemeinhin als „sittlich" bezeichnet wird,
auch wenn unser Wollen als dem des anderen diskordant kogniziert wird.
Daß es sich tatsächlich um einen inaltruistischen Wert handelt, der hier
verwirklicht wird, beweist der Umstand, daß wir bemüht sind, auch
wiederholte Selbstmordversuche zu verhindern, das Wollen des anderen
sich also als konsistent diskordant unserem Wollen herausstellt. Daß wir
bei unseren Handlungen nicht aus Eigennutz den anderen von der Ver-
wirklichung seiner Werte abhalten, dürfte unmittelbar einleuchten. Und
in den meisten Fällen geht es uns auch bei einer Lebensrettung nicht um
eine abstrakte Idee, die wir in unserer Tat verwirklichen; es zählt für
uns allein das, was wir als „Wohl" des anderen ansehen.
Es gibt auch den umgekehrten Fall, wo wir Elend und Untergang des
anderen wollen, wo wir — diskordant dem Wollen des anderen — einen
„unsittlichen" Zweck verfolgen oder zulassen, daß dem anderen ein Leid
oder eine Demütigung widerfährt. „Das Zweckwidrige im sittlichen
Leben hat zwei Quellen: die sittliche Schwäche und die sittliche Bos-
heit . . . Jene führt zu dem Zweckwidrigen in negativer Form, der Un-
terlassung des Guten, diese zum Zweckwidrigen in positiver Form, der
Erzeugung des Schlechten. Wer einen Nebenmenschen den er retten
könnte umkommen läßt, weil er Gefahr oder Ungemach für sich selbst
96
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
fürchtet, handelt sittlich schwach; wer einem Andern nachstellt, weil die-
ser dem eigenen Vortheil im Wege steht, handelt schlecht. Beide Formen
des Zweckwidrigen können natürlich in den verschiedensten Gradab-
stufungen vorkommen" ( W U N D T 1886, S. 435). Wenn wir auch W U N D T S
Terminologie nicht völlig zustimmen, da sie die begriffliche Anerken-
nung des „Gesamtwillens" voraussetzt, die wir nicht nach vollziehen, so
nehmen wir doch seine Bestimmung des auf den Untergang oder das
Elend des anderen bezogenen Verhaltens als Kennzeichnung dessen, was
man gewöhnlich als inaltruistisches Wollen mit dem Ziel der Verwirk-
lichung eines negativen Eigenwertes eines anderen ansehen wird.
Für L O R E N Z entspringt das „sogenannte Böse" einem „Aggressions-
trieb", dem er arterhaltende Funktion zuspricht, und zwar soll dieser
„Aggressionstrieb" nicht nur für aggressives Verhalten innerhalb einer
Art (Rivalenkämpfe) verantwortlich sein, sondern soll auch Aggressionen
zwischen den einzelnen Arten erklären. Davon abgesehen, daß die stän-
dige Heranziehung des Arterhaltungsprinzips in der LoRENZSchen „Ver-
haltenslehre" manchmal die merkwürdigsten psycho-lamarckistischen46
Blüten treibt — wenn er etwa von Nahrungspflanzen spricht, „die sich
durch Einlagerung von Kieselsäure und andere Schutzmaßnahmen gegen
das Zerkautwerden nach Möglichkeit schützen" ( L O R E N Z 1963, S. 39) —,
erklärt die Hypostasierung eines „Aggressionstriebes" natürlich gar
nichts, am allerwenigsten das Phänomen der Bosheit, das durch Annahme
eines arterhaltenden „Triebes" einfach „wegerklärt" wird; denn wie
kann etwas „Arterhaltendes"47 böse sein? Viele der von L O R E N Z ange-
führten Beispiele lassen sich zudem durch die „Frustrations-Aggressions-
Hypothese" ( D O L L A R D et. al. 1961; vgl. S. 197 ff. dieser Untersuchung),
für einen Psychologen viel überzeugender erklären als durch einen „Ag-
gressionstrieb". Falls man nicht gerade konsumatorische Akte wie „Fres-
sen" und „Schlingen" sowie die diesen Akten vorangehenden Verhaltens-
weisen als „bösartig" oder „aggressiv" bezeichnen will, so bleibt von der
„arterhaltenden" Funktion des „Bösen" nichts übrig.
Nicht im mindesten „arterhaltend", aber durchaus „boshaft" er-
scheint dagegen das Verhalten von Schimpansen beim Spiel mit Hüh-
nern, wie es K Ö H L E R beschreibt. Die Abfälle des Brotes, das die Schim-
pansen in der Nähe des Drahtgitters ihres Käfigs fraßen, lockten mit
Regelmäßigkeit die Hühner des Nachbargrundstückes an das Gitter, weil
vermutlich bisweilen Krumen durch die Maschen des Netzes fielen, die
sie dann aufpickten. „Da die Schimpansen sich ihrerseits für die Hühner
interessieren, so macht es sich, daß nun die Affen ihr Brot dicht am Git-
ter zu verzehren pflegen und dabei die Vögel mustern oder auch durch
46
LORENZ selbst bezeichnet sich im übrigen als „guten Darwinisten" ( 1 9 6 3 , S. 48).
47
Z u unserer Kritik der unangemessenen Ausweitung und Anwendung des Arterhal-
tungsprinzips siehe S. 7 1 ff.
7 Keiler, Wollen
97
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
einen Tritt gegen das Netz verscheuchen. Daraus haben sich drei Spiele
entwickelt . . . i. Der Schimpanse hält zwischen einem Biß und dem
nächsten sein Brotstück in die weite Masche des Netzes, das Huhn nähert
sich zum Picken, und wie es gerade zufahren will, zieht der A f f e das
Brot schnell wieder f o r t . . . 3. Das Huhn wird mit dem Brot am Gitter
nähergelockt, aber in dem Augenblick, w o es arglos zupicken will, rennt
ihm die freie Hand desselben Schimpansen oder ein anderer, der daneben
hockt, einen Pfahl oder, noch schlimmer, einen starken Draht in den
ungeschützten Leib" (KÖHLER1963, S. 61). Zur Interpretation (nicht zur
Erklärung) dieses Verhaltens zieht sich KÖHLER nicht wie LORENZ auf
einen „Trieb" zurück, sondern verweist statt dessen auf eine vergleich-
bare menschliche Boshaftigkeit: „Weshalb? N u r Gassenjungen, welche an
fremden Häusern klingeln und dann fortlaufen oder andere derartige
Dinge treiben, können vielleicht diese Frage beantworten" (KÖHLER
1 9 6 3 , S. 6 0 ) .
Im Grunde erscheint also boshaftes Verhalten „sinnlos", es erfüllt
keinen „Zweck", das wollende und handelnde Individuum „will" ganz
einfach „Böses", ohne dabei auf die Verwirklichung eines Eigenwertes
oder eines anderen Fremdwertes zu reflektieren. Von daher gesehen ist
das Wollen, das WUNDT als „schlecht" bezeichnet, nicht „bösartig", denn
es geht uns ja dabei recht eigentlich nicht um den anderen, sondern um
"uns und unsere Eigenwerte, deren Verwirklichung wir durch den anderen
gefährdet sehen. Ebenso ist es mit der Aggression bei LORENZ; diese ver-
liert mit dem Hinweis auf ihre (bewußte oder unbewußte) „arterhal-
tende" Funktion das Anrecht, als Verwirklichung eines Fremdwertes ein-
gestuft zu werden.
Zur Kennzeichnung unseres Wollens als boshaft-inaltruistisch sind
wir nur dann berechtigt, wenn unangenehme Zuständlichkeiten oder eine
mindere Soseinslage der Person eines anderen der eigentliche Gegenstand
unseres Gefallens ist. So kann für mich ohne weiteres der Schmerz ande-
rer positiver Gegenstand des Gefallens sein, ohne daß für mich Schmerz
eine angenehme Zuständlichkeit ist oder ich dem anderen unterstelle,
Schmerz sei für ihn angenehm; ebenso kann ich danach trachten, das An-
sehen eines anderen zu schmälern, die Soseinslage seiner Personhaftigkeit
zu mindern, ohne daß der andere darin die Verwirklichung eines Person-
wertes erblickt. Und dies alles, ohne Konsequenzen für meine Person
oder meine Zuständlichkeiten daraus abzuleiten. Gewiß wird in vielen
Fällen die Hoffnung auf Soseinslageerhöhung der eigenen Person oder
die Realisation angenehmer Zuständlichkeiten bei mir der eigentliche
Grund sein, wenn für mich die unangenehmen Zuständlichkeiten oder
die Soseinslageminderung der Person oder Personhaftigkeit eines ande-
ren positiver Gegenstand des Wollens ist; aber wenn ich ein schwaches
Tier quäle und Gefallen an seinem Leid finde, so doch nicht deshalb, weil
98
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
das Sosein meiner Person dadurch erhöht wird oder ich mich besonders
„wohl" fühle; vielmehr ist mir das Leid des Tieres unmittelbarer Gegen-
stand meiner Bestrebungen. Sind sie dagegen — wie bei WUNDT und
LORENZ — lediglich ein Zwischenziel auf dem Wege zu einer Wertver-
wirklichung, deren wir teilhaftig werden, so treffen die Begriffe „altrui-
stisch" oder „inaltruistisch" den Sachverhalt keineswegs. Und so läßt
sich in vielen Fällen, wo wir inaltruistisches Wollen mit dem Ziel der
Realisation unangenehmer Zuständlichkeiten oder einer verminderten
Soseinslage der Person oder Personhaftigkeit eines anderen zu sehen
glauben, nachweisen, daß sie nicht das eigentliche Ziel des Wollens ist,
sondern lediglich eine Zwischenstation auf dem Wege zur Verwirklichung
eines Eigenwertes oder eines nicht auf diese Person oder dieses person-
hafte Individuum bezogenen Fremdwertes. So ist z. B. dem Sadisten das
Leid des anderen nicht Selbstzweck, sondern Anlaß zu eigener Lust, ein
Geschäftsmann zieht aus dem Ruin des anderen Vorteil für sich selbst
usw.
Trotz dieser Vorbehalte bleibt jedoch die Möglichkeit, daß es auch an
„Bosheit" im eigentlichen Sinne orientierte Werthaltungen geben kann.
Davon geht etwa die christliche Moraltheologie aus, die dem göttlichen
Prinzip der Liebe und Güte das stets verneinende Prinzip des Bösen
gegenüberstellt (vgl. auch GOETHES „Faust"). Zwar muß angenommen
werden, daß die Kognition einer tatsächlichen Fremdwertverwirklichung
des „Bösen" die Zuständlichkeiten des wollenden Individuums ebenso
positiv affiziert wie die Kognition einer tatsächlichen Fremdwertver-
wirklichung des „Guten", sofern sie dem in Frage stehenden Individuum
positiver Gegenstand des Wollens ist; aber diese sekundären angenehmen
Zuständlichkeiten sind im Falle des „Bösen" ebensowenig das eigentliche
Willensziel wie im Falle des „Guten". Wir nehmen also an, daß es neben
dem „Willen zum Guten, Schönen, Wahren" auch den „Willen zum
Bösen, Häßlichen und Falschen" geben kann.
Zum „Bereich" der Fremdwerte
So ist unser Wollen bezüglich fremder Personen entweder altruistisch
(konkordant dem Wollen dieser Personen) oder aber in diskordantem
Wollen einmal auf angenehme Zuständlichkeiten oder eine Soseinslage-
erhöhung der anderen gerichtet, zum anderen auf unangenehme Zuständ-
lichkeiten oder Soseinslageminderungen fremder Personen oder person-
hafter Individuen (diese Bestimmungen gelten, wie weiter oben festge-
stellt, nur für den Fall, daß es uns in unserem Wollen tatsächlich nur um
den anderen und nichts außer ihm geht). Ähnlich steht es mit unserem
Wollen hinsichtlich von „Sachen" oder „Abstrakta" (Ideen, Urteile,
T
99
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Wissenschaftssysteme usw.); auch hier •wollen wir positiv, wenn es uns
wirklich nur um diesen Gegenstand als Teilhaber der Verwirklichung
eines Fremdwertes geht, zumeist eine Erhöhung der Soseinslage. Das
heißt, von „Sachen" wollen wir, daß sie „schön" sind oder „originell",
von Urteilen wollen wir nicht nur, daß sie formuliert werden, sondern
auch, daß sie „richtig" (in Übereinstimmung mit den Regeln der klassi-
schen Logik) und/oder „wahr" (in Übereinstimmung mit dem angeziel-
ten Sachverhalt) sind. Auch ganze Wissenschaftssysteme wollen wir
„richtig" und „empirisch brauchbar". In der Kunst geht unser Wollen
auf „Neuheit" (Originalität) und „Harmonie" (zwei Seinsaspekte, die
HENLE [1962] als wesentlich für jegliches kreative Schaffen ansieht) oder
ganz allgemein auf „Schönheit". Gegenstand unseres Wollens ist in allen
genannten Beispielen stets eine Seinserhöhung der „Welt außer uns".
D a ß in vielen Fällen die Verwirklichung angeblicher Fremdwerte ledig-
lich zum Zwecke der Verwirklichung von Eigenwerten erfolgt, ist kein
Hinderungsgrund dafür, daß ebenso oft tatsächlich der Fremdwert im
Mittelpunkt unseres Wollens steht, es uns also tatsächlich um die „Sache
selbst" zu tun ist.
Das mögliche Wollen einer Soseinslageminderung um ihrer selbst
willen muß auf der anderen Seite ebenso zugestanden werden. Die
Falschheit eines Urteils wäre für uns dann kein negativer Gegenstand
des Wollens, sondern ein positiver, eben weil ein falsches Urteil „höhe-
ren" Wert hätte als ein „richtiges". Ein „häßlicher" Gegenstand hätte
eine höhere Soseinslage als ein „schöner", und so wollten wir auch „ H ä ß -
lichkeit" um ihrer selbst willen, sie wäre für uns nicht negativer Gegen-
stand des Wollens.
Der systematische Ort der Fremdwerte
Läßt sich die Genese des Wollens von „Schönheit" eindeutig dort
zurückverfolgen, wo „Schönheit" mit „Zweckmäßigkeit" gepaart ist, so
bleibt sie uns dort unverständlich, wo ein Gegenstand bloß „schön" ist,
ohne überhaupt „zweckmäßig" zu sein. Und warum bevorzugen wir bei
zwei Gegenständen, die gleich zweckmäßig sind, den schöneren? Warum
wollen wir über die auf unsere Person bezogene Soseinslage eines ande-
ren oder einer „Sache" hinaus eine Soseinslageerhöhung der Person des
anderen oder der Sache48? Warum sind für uns überhaupt Dinge „außer
uns", die sich in keiner Weise auf unsere Person oder ihre Zuständlich-
keiten beziehen, Gegenstand des Wollens? Wir müssen eingestehen, daß
wir nicht erklären können, warum wir überhaupt die Verwirklichung
48 Die gleichen Fragen können natürlidi bezüglich des Wollens von „Häßlichem" oder
»Bösem" gestellt werden.
100
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
von Fremdwerten wollen und warum für uns in den meisten Fällen ge-
rade angenehme Zuständlichkeiten und Soseinslageerhöhung der Person
des anderen positiver Gegenstand des Wollens sind und nur selten unan-
genehme Zuständlichkeiten und Soseinslageminderung. Erscheint es ein-
leuchtend, daß unsere Zuständlichkeiten und unsere Person Gegenstand
unseres Wollens werden, weil wir uns dem Erlebnis der eigenen Zu-
ständlichkeiten und dem Erlebnis der eigenen Person niemals völlig ent-
ziehen können, so wäre in bezug auf die Außenwelt nur eine Beschrän-
kung unseres Wollens unmittelbar auf jene Gegenstände verständlich,
die sich auf unsere Zuständlichkeiten oder unsere Person beziehen. Die
gleiche Beschränkung müßte für wissenschaftliches Bemühen gelten. Stellt
man sich jedoch auf diesen Standpunkt, so kommt man lediglich bis zur
Erklärung der „Zweckmäßigkeit". Warum wir „Schönheit um der
Schönheit willen" oder „Erkenntnis um der Erkenntnis willen" wollen,
muß letztlich unerklärt bleiben. So bleibt schließlich als empirisch nicht
rückführbarer Grundsatz, daß wir unabhängig von unserer Person und
ihren Zuständlichkeiten unser Wollen auf Welt „außer uns" richten kön-
nen. Und indem wir Fremdes wollen, geht unser Streben zumeist auf
Realisation angenehmer Zuständlichkeiten und die Soseinslageerhöhung
Kennzeichnung von Eigen- und Fremdwerten als „verbindliche" Werte
der Person des anderen oder auf eine Soseinslageerhöhung von „Sachen".
Damit ist nach der Einführung der Fremdwerte die Kategorisierung
der „verbindlichen" Werte abgeschlossen. Jede intendierte und somit auf
einem Wollen beruhende Handlung ist eindeutig klassifizierbar als ent-
weder einen Eigenwert oder einen Fremdwert betreffend. Dennoch
scheint uns unsere Einteilung noch nicht vollständig, da wir bisher nicht
den Fall berücksichtigt haben, daß mir Wertsetzung durch das Wollen
eines anderen kognitiv gegeben ist, ohne daß ich den von einem anderen
gesetzten Wert als für mich verbindlich anerkenne. Der genauen Kenn-
zeichnung dieser „unverbindlichen" Werte soll unser nächstes Kapitel ge-
widmet sein.
j. U n v e r b i n d l i c h e Werte
Einführung der unverbindlichen Werte
Wir haben bisher immer nur den Fall berücksichtigt, daß ein be-
stimmter Wertgegenstand dem jeweils angezielten Subjekt als Gut oder
Übel Gegenstand seines Wollens ist. Die hier involvierten Werte haben
wir, da sie für eben dieses Subjekt verbindlich sind, als „verbindliche"
Werte bezeichnet.
Nun ist jedoch die Situation denkbar, daß ein bestimmter Gegenstand
zwar nicht Gegenstand meines Wollens (also für mich wertneutral) ist, aber
IOI
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
dennoch einem oder mehreren anderen als Wertgegenstand gilt. Sofern mir
diese Art der Wertbezogenheit kognitiv gegeben ist, ist für midi der invol-
vierte Wert je nach seinem Allgemeinheitsgrad ein unverbindlicher indivi-
dueller oder ein unverbindlicher überindividueller Wert. Dem entsprechend
heißen die Wertgegenstände unverbindliche individuelle oder überindivi-
duelle Güter oder Übel. Hierbei ist das kognitive Gegebensein der
„Wertbezogenheit des Gegenstandes für andere" notwendiges Kriterium
der Kennzeichnung dieses Objektes als „unverbindlicher Wertgegen-
stand"; wird dieses Kriterium nicht erfüllt, so ist der Gegenstand für
mich eindeutig wertneutral. Ebenso wie die verbindlichen können auch
die unverbindlichen Werte in Eigen- und Fremdwerte unterteilt werden.
Ein unverbindlicher Eigenwert liegt dann vor, wenn ich zwar um das
Streben eines Individuums nach bestimmten Zustands- und Personwerten
weiß, das Streben nach eben diesen Eigenwerten aber nicht Gegenstand
meines Wollens ist. Ein unverbindlicher Fremdwert ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß ich zwar um die z. B. künstlerischen, sozialen und wissen-
schaftlichen Bestrebungen eines Individuums weiß, ohne daß jedoch diese
Bestrebungen Gegenstand auch meines Wollens sind. Unverbindliche
Werte sind somit keine Werte im eigentlichen Sinne.
Als Beispiel unverbindlicher überindividueller Wertgegenstände sol-
len hier ausländische Banknoten oder Münzen stehen, bei denen ich
weder Gelegenheit habe, sie in gültige Valuta umzutauschen noch über
dritte irgend etwas dafür einzuhandeln, das mir als Wertgegenstand gilt.
Unverbindliche individuelle Wertgegenstände dagegen wären solche,
die lediglich für ein anderes Subjekt von Interesse sind, weil sie für eben
dieses Subjekt ein nur ihm eigenes Wertsystem repräsentieren.
Unverbindlicher Wert und „Tauschwert"
Sofern ich mir die Wertbezogenheit für andere von Objekten, die
bisher nicht Gegenstand meines Wollens waren, bezüglich meiner Eigen-
und Fremdwerte zunutze mache, weil ich sie zu Mitteln für die Errei-
chung des Zweckes der Verwirklichung von verbindlichen Werten er-
hebe, werden die bisher unverbindlichen Wertgegenstände zu verbind-
lichen. Dies ist z. B. der Fall, wenn ein Kaufmann für ihn völlig wertlose
Glasperlen bei afrikanischen Eingeborenen gegen Elfenbein oder Edel-
holz eintauscht, das den Eingeborenen im Vergleich zu den Glasperlen als
geringerer Wertgegenstand gilt. Für den Kaufmann repräsentieren Elfen-
bein und Edelholz dagegen den höheren Wert. Aus diesem Beispiel geht
hervor, daß der Tauschwert eines Objektes nicht so sehr davon abhängig
ist, daß er Gegenstand des eigenen Wollens, sondern daß er Gegenstand
eines fremden Wollens ist.
102
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Diese Überlegung führt zu der Konsequenz, daß der Aufweis „ech-
ter" unverbindlicher Wertgegenstände sehr schwer sein dürfte, da ein
Objekt, solange es Gegenstand überhaupt eines Wollens ist, für den, der
es besitzt, dessen Wollen sich jedoch nicht darauf richtet, immer nodi
einen „Tauschwert" hat und somit ein verbindlicher Wertgegenstand ist.
Es gibt auch Situationen, in denen ein Objekt zwar prinzipiell „Tausch-
wert" hat andere Bedingungen jedoch einen Einsatz des Objektes als
„Tauschmittel" unmöglich machen, sei es durch räumlich« Entfernung
oder soziale „Barrieren". So wurde in einer unserer Untersuchungen zum
Problem der Akzentuierung ( H O L Z K A M P , K E I L E R & P E R L W I T Z 1968) in
der Kontrollgruppe die Information gegeben, daß die vorhandenen Sti-
mulusobjekte (weiße Plastikstäbchen) in anderen Gruppen als Zensuren
für Schulleistungen dienten, ohne daß wir befürchten mußten, das Wis-
sen um eine Wertbezogenheit in diesen anderen Gruppen würde auch in
der Kontrollgruppe zu einer Wertbesetzung führen. D a die Gruppen
räumlich getrennt waren und über die Anzahl der in der Kontrollgruppe
ausgeteilten Stäbchen Buch geführt wurde, konnten diese für die Vpn
auch keinen „Tauschwert" bekommen und blieben somit unverbindliche
Wertgegenstände. Prinzipiell bleibt jedoch der Einwand bestehen, daß
Gegenstände, die man selbst besitzt, dadurch zu verbindlichen Wert-
gegenständen werden können, daß sie zwar nicht Gegenstand des eigenen
Wollens sind, sondern — weil sie von anderen begehrt werden —
„Tauschwert" haben.
N u r bei jenen Gegenständen, die wir nicht haben und deren Besitz wir
auch nicht anstreben, die aber für andere Gegenstand des Wollens sind,
können wir mit einiger Berechtigung von unverbindlichen Wertgegen-
ständen sprechen, sofern uns die Wertbezogenheit für andere kognitiv
gegeben ist. Jedoch sind auch hier Einschränkungen zu machen: Es wäre
z. B. denkbar, daß die intendierten Handlungen eines Individuums dar-
auf gerichtet sind, anderen zur Verwirklichung ihrer Werte zu verhelfen.
D a dieses Verhalten eindeutig als Verwirklichung eines Fremdwertes zu
kategorisieren wäre, ist in diesem Falle die Kennzeichnung als Verwirk-
lichung eines unverbindlichen Wertes in sich widersprüchlich. So kön-
nen die Handlungen eines Individuums lediglich „absichtslos" der Ver-
wirklichung von unverbindlichen Werten dienen, beabsichtigte Handlun-
gen in dieser Richtung hingegen sind gewollt und somit auf die Ver-
wirklichung eines verbindlichen Wertes gerichtet.
Indirekter Einfluß von unverbindlichen Werten auf das Verhalten
Aber die nichtintendierten Folgen meiner Handlung bleiben nur so
lange unverbindlicher Wertgegenstand für mich, wie ich zwar weiß, daß
durch meine Handlung für einen anderen ein Wert oder Unwert ver-
103
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
wirklicht worden ist, jedoch diese meine Handlung nicht selbst werte. In
dem Augenblick, in dem ich meine eigene Handlung bezüglich ihrer nicht-
intendierten Folgen nachträglich gutheiße oder verwerfe, erhebe ich sie
aus dem Status der Verwirklichung eines unverbindlichen Wertes in den
der Verwirklichung eines verbindlichen Wertes. Da diese kognitive Ein-
ordnung Konsequenzen bezüglich des verbindlichen Wertsystems hat,
folgt daraus, daß das Ziel der Verwirklichung des allgemeinsten Wertes
der Verwirklichung von Werten überhaupt am ehesten dann erreicht
wird, wenn die möglichen nichtintendierten Folgen einer Handlung, die
einen unverbindlichen Wert verwirklichen, entweder niemals zum Gegen-
stand des eigenen Wollens werden (also immer unverbindlich bleiben)
oder bezüglich des verbindlichen Wertsystems als positiv beurteilt wer-
den. Das erste ist der Fall bei Individuen, deren Wollen extrem auf die
Verwirklichung von Eigenwerten zentriert ist, denen also die Wert-
systeme anderer Individuen als möglicher Gegenstand von Fremdwerten
gleichgültig sind. Die zweite Möglichkeit ergibt sich aus der altruistischen
Ausrichtung der nichtintendierten Folgen des eigenen Handelns, sofern
das eigene Wollen auch auf die Verwirklichung von Fremdwerten ge-
richtet ist.
Abschließende Bemerkungen
Hieraus wird verständlich, daß unser intendiertes Verhalten nicht
nur von der Setzung primär verbindlicher Werte ausgelöst und gesteuert
wird, sondern stets auch Werte berücksichtigt, die zwar primär unver-
bindlich, jedoch — da sie mit verbindlichen Fremdwerten in Beziehung
stehen — sekundär verbindlich sind.
Auslösung und Steuerung eines Verhaltens lediglich durch das kogni-
tive Gegebensein einer Wertbezogenheit für andere ist, das dürfte aus
den vorangegangenen Überlegungen klar geworden sein, nicht möglich;
erst wenn zu diesem kognitiven Gegebensein die Beteiligung des eigenen
Wollens kommt, wir das Wollen des oder der anderen befürworten oder
ablehnen und somit in das eigene Wertsystem integrieren, berücksichtigt
unser Verhalten auch das, was primär nicht Gegenstand unseres Wollens
war.
6. D i e V o l l s t ä n d i g k e i t d e r Willensziele
Die Vollständigkeit der vorgenommenen Kategorisierungen
Indem wir nachwiesen, daß sich unser Wollen auf Eigenwerte in
Form von Zustands- und Personwerten, auf Fremdwerte in Form von
altruistischen und inaltruistischen Werten richtet, haben wir — das zeigt
104
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
eine Analyse der eingeführten Wertbegriffe — deutlich gemacht, daß
intendiertes Verhalten sich auf alle Aspekte eines je individuellen Lebens-
raumes (im Sinne von LEWIN) ausrichten kann. Somit ist jedes Streben
eindeutig in den Dienst der Verwirklichung irgendeines Wertes gestellt,
dessen formale und inhaltliche Kategorisierung gemäß den von uns ange-
führten Kriterien möglich ist.
Tabellarische Übersicht III
D a somit jedes zielgerichtete Verhalten (das gemäß unserer Definition
nur auf einen Willensakt folgen kann) eindeutig einordenbar ist, kön-
nen wir den Anspruch erheben, sämtliche möglichen Willensziele be-
griffslogisch erfaßt zu haben. Nachfolgende Aufstellung soll als Veran-
schaulichung der Ergebnisse der Überlegungen der letzten Kapitel dienen:
I Verbindliche Werte
a) Eigenwerte
Das Wollen des Individuums ist auf die Verwirklichung von Zu-
standswerten (Streben nach Realisation angenehmer und Vermei-
dung unangenehmer Zuständlichkeiten) und die Verwirklichung von
Personwerten (Streben nach Soseinslageerhöhung der eigenen Person
und Vermeidung der Soseinslageminderung der eigenen Person) ge-
richtet.
b) Fremdwerte
Das Wollen eines Individuums oder mehrerer Individuen ist auf die
Verwirklichung altruistischer Werte gerichtet (Streben konkordant
mit dem Wollen eines Individuums oder mehrerer Individuen bezüg-
lich dessen oder deren Personwerte). Das Wollen eines Individuums
oder mehrerer Individuen ist auf die Verwirklichung inaltruistischer
Werte gerichtet (Streben diskordant mit dem Wollen eines Indivi-
duums oder mehrerer Individuen bezüglich dessen oder deren Per-
sonwerte — oder Streben bezüglich der Soseinslage einer Sache oder
mehrerer Sachen).
II Unverbindliche Werte
Die unter a) und b) aus dem jeweiligen Wertbegriff analytisch ab-
leitbaren Gegenstände sind nicht Gegenstand des Wollens des jewei-
lig betrachteten Individuums oder mehrerer jeweilig betrachteter
Individuen, sondern dieWertbezogenheit der Gegenstände für andere
ist diesem Individuum oder diesen Individuen lediglich kognitiv ge-
geben. Unverbindliche Werte sind somit keine Werte im eigentlichen
Sinne.
105
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Ausblick auf die Ontologie der Werte
Nachdem wir die Ziele des Willens und des intendierten Verhaltens
formal und inhaltlich gekennzeichnet haben, wollen wir im nächsten
Kapitel die beiden wertphilosophischen Richtungen des „Wertempiris-
mus" und des „Wertabsolutismus" gegenüberstellen. Diese Gegenüber-
stellung wird zwar über den Rahmen psychologischer Argumentation
hinausgehen. Es erscheint uns aber gerade deshalb sinnvoll, diese Frage
im folgenden zu behandeln, weil wir dadurch die Möglichkeit haben,
Wertpsychologie und Wertontologie besser gegeneinander abzugrenzen.
Beschäftigten wir uns in unserer in der Begriffswahl psychologisch orien-
tierten Wertlogik bisher hauptsächlich mit der phänographischen Be-
stimmung der Werte, so versucht die Wertontologie die Frage nach der
vom wertenden Subjekt unabhängigen Herkunft der Werte und ihrer
interindividuellen „Gültigkeit" zu beantworten. Danach ist die Klärung
der Seinsverankerung der Werte, wie sich zeigen wird, kein wertpsycho-
logisches, sondern ein wertmetaphysisches Problem.
106
Bereitgestellt von | Staats- und Universitätsbibliothek SuUB Bremen
Angemeldet
Heruntergeladen am | 27.02.20 10:20
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Theodor Adorno - Zu Subjekt Und ObjektDokument18 SeitenTheodor Adorno - Zu Subjekt Und ObjektwesenlosNoch keine Bewertungen
- Wahsner R.. - Das Auseinanderlegen Des Konkreten Und Seine AufhebungDokument128 SeitenWahsner R.. - Das Auseinanderlegen Des Konkreten Und Seine AufhebungannipNoch keine Bewertungen
- AGAMBEN Was Ist Ein DispositivDokument50 SeitenAGAMBEN Was Ist Ein Dispositivlectordigitalis100% (1)
- Das Leib-Seele ProblemDokument2 SeitenDas Leib-Seele ProblemFranz StrasserNoch keine Bewertungen
- Bewußtseinstheorien Karen GloyDokument14 SeitenBewußtseinstheorien Karen GloylordkafkaNoch keine Bewertungen
- Hubig, Christoph - Natur Und Kultur - Von Inbegriffen Zu ReflexionsbegriffenDokument23 SeitenHubig, Christoph - Natur Und Kultur - Von Inbegriffen Zu Reflexionsbegriffenmaurice florenceNoch keine Bewertungen
- Bieri, Unser Wille Ist FreiDokument4 SeitenBieri, Unser Wille Ist FreikobbanNoch keine Bewertungen
- Christian Martin - Hegel. Die Verwandlung Von Metaphysik in LogikDokument14 SeitenChristian Martin - Hegel. Die Verwandlung Von Metaphysik in LogikCristián IgnacioNoch keine Bewertungen
- Böhme, Gernot Der Begriff Des Leibes. Die Natur, Die Wir Selbst SindDokument11 SeitenBöhme, Gernot Der Begriff Des Leibes. Die Natur, Die Wir Selbst SindnicolasberihonNoch keine Bewertungen
- Husserl Transzendentaler IdealismusDokument24 SeitenHusserl Transzendentaler IdealismusPhiblogsophoNoch keine Bewertungen
- Menke - Autonomie Und Befreiung Dzph.2010Dokument20 SeitenMenke - Autonomie Und Befreiung Dzph.2010lucianogattiNoch keine Bewertungen
- Wissenschaft und Demokratie: Wissenschafts- und DemokratietheorieVon EverandWissenschaft und Demokratie: Wissenschafts- und DemokratietheorieNoch keine Bewertungen
- Aristo KopieDokument13 SeitenAristo KopieCan TumaniNoch keine Bewertungen
- Steinweg Marcus DeutschDokument10 SeitenSteinweg Marcus Deutschperseus89Noch keine Bewertungen
- Die Logik Der ReflexionDokument21 SeitenDie Logik Der ReflexionRicardoLuisMendívilRojo100% (1)
- Zwischen Kant Und de SadeDokument8 SeitenZwischen Kant Und de SadeHelmut Hampl [urspr. Clara]Noch keine Bewertungen
- Hegels objektive Vernunft: Kritik der VersöhnungVon EverandHegels objektive Vernunft: Kritik der VersöhnungNoch keine Bewertungen
- Hubig, Christoph - Identität Und NichtidentitätDokument9 SeitenHubig, Christoph - Identität Und Nichtidentitätmaurice florenceNoch keine Bewertungen
- Schwab Completo Alemán Cap 4Dokument32 SeitenSchwab Completo Alemán Cap 4Gonzalo Martín MozoNoch keine Bewertungen
- 3563 Auszug Kapitel1 P2 PDFDokument18 Seiten3563 Auszug Kapitel1 P2 PDFMon HernándezNoch keine Bewertungen
- Solipsismus - WikipediaDokument4 SeitenSolipsismus - WikipediaHA WillNoch keine Bewertungen
- Wörterbuch Der Philosophischen BegriffeDokument797 SeitenWörterbuch Der Philosophischen BegriffeBernard Allenstein100% (1)
- Leben Ohne ZweckDokument10 SeitenLeben Ohne ZweckReal JiggaNoch keine Bewertungen
- Ontologie, Ethik, Erkenntnistheorie: Eine kleine Einführung in die PhilosophieVon EverandOntologie, Ethik, Erkenntnistheorie: Eine kleine Einführung in die PhilosophieNoch keine Bewertungen
- Buchheim (2012) - Der Begriff Der 'Menschlichen Freiheit' Nach Schellings 'Freiheitsschrift'Dokument16 SeitenBuchheim (2012) - Der Begriff Der 'Menschlichen Freiheit' Nach Schellings 'Freiheitsschrift'mgarromNoch keine Bewertungen
- HORST MAHLER Brief An Ronald SchleyerDokument34 SeitenHORST MAHLER Brief An Ronald Schleyer485868100% (1)
- Badiou ITPDokument14 SeitenBadiou ITPThomas Rudhof-SeibertNoch keine Bewertungen
- Die Manifestation des Selbstbewußtseins im konkreten "Ich bin": Endliches und Unendliches Ich im Denken von S. T. ColeridgeVon EverandDie Manifestation des Selbstbewußtseins im konkreten "Ich bin": Endliches und Unendliches Ich im Denken von S. T. ColeridgeNoch keine Bewertungen
- Das Evangelium Als Norm Un KritikDokument8 SeitenDas Evangelium Als Norm Un KritikOrlando DuineaNoch keine Bewertungen
- Foucault - Traum Und ExistenzDokument47 SeitenFoucault - Traum Und ExistenznighbNoch keine Bewertungen
- Kategorien Bei Der WahrnehmungDokument20 SeitenKategorien Bei Der WahrnehmungLeon LeoNoch keine Bewertungen
- Süsske, Ralf - Lebenswelt Bei HusserlDokument12 SeitenSüsske, Ralf - Lebenswelt Bei HusserlGuacamole Bamako ShivaNoch keine Bewertungen
- XakjdbajbxojaDokument4 SeitenXakjdbajbxojaArtur FilipeNoch keine Bewertungen
- Vermittelte Unmittelbarkeit Teil 14Dokument1 SeiteVermittelte Unmittelbarkeit Teil 14menoitiosNoch keine Bewertungen
- Die Sinnlich Affektive Verflechtung VonDokument26 SeitenDie Sinnlich Affektive Verflechtung Vonasef antonioNoch keine Bewertungen
- Hans-Georg Pott - Das Subjekt Bei LuhmannDokument15 SeitenHans-Georg Pott - Das Subjekt Bei LuhmannJulian HennebergNoch keine Bewertungen
- [2020] RUHLIG, N. George Batailles Philosophie der Souveranität - Kritik an Hegels Dialektik Herr und KnechtDokument29 Seiten[2020] RUHLIG, N. George Batailles Philosophie der Souveranität - Kritik an Hegels Dialektik Herr und KnechtmarhansaraivaNoch keine Bewertungen
- Funda IIDokument16 SeitenFunda IIJesus MariaNoch keine Bewertungen
- Die Freiheit, das Ich und die Liebe: Grundlagen einer Philosophie der GegenwartVon EverandDie Freiheit, das Ich und die Liebe: Grundlagen einer Philosophie der GegenwartNoch keine Bewertungen
- Protokoll Kritik Der UrteilskraftDokument4 SeitenProtokoll Kritik Der UrteilskraftJon GOIRI DITTRICHNoch keine Bewertungen
- Kuhn - Das Problem Des Standpunkts Und Die Geschichtliche Erkenntnis (Kant.1930.35.1-4.496)Dokument15 SeitenKuhn - Das Problem Des Standpunkts Und Die Geschichtliche Erkenntnis (Kant.1930.35.1-4.496)kafirunNoch keine Bewertungen
- Irene Breuer - Ontologie - Der - Person - Und - Geschichte - BeiDokument10 SeitenIrene Breuer - Ontologie - Der - Person - Und - Geschichte - BeiChoi PeterNoch keine Bewertungen
- Zusammenfassung KantDokument2 SeitenZusammenfassung KantReza KhajeNoch keine Bewertungen
- Beckermann - Rezension Gerhard RothDokument3 SeitenBeckermann - Rezension Gerhard RothRené SchoemakersNoch keine Bewertungen
- Auszug Aus Die Entstehung Der HermeneutikDokument8 SeitenAuszug Aus Die Entstehung Der Hermeneutikinhale84Noch keine Bewertungen
- INGEKAMP. Gestalt Als Gestaltung. Zum Fragenkreis Schopenhauer Und Der PlatonismusDokument9 SeitenINGEKAMP. Gestalt Als Gestaltung. Zum Fragenkreis Schopenhauer Und Der PlatonismusAlex Julio BarbosaNoch keine Bewertungen
- Peter Pörtner Das Wichtigste Aber Ist Die HarmonieDokument25 SeitenPeter Pörtner Das Wichtigste Aber Ist Die HarmoniepetzpoertnerNoch keine Bewertungen
- Immanente Kritik heute: Grundlagen und Aktualität eines sozialphilosophischen BegriffsVon EverandImmanente Kritik heute: Grundlagen und Aktualität eines sozialphilosophischen BegriffsJosé M. RomeroNoch keine Bewertungen
- Subjektivität denken: Anerkennungstheorie und BewusstseinsanalyseVon EverandSubjektivität denken: Anerkennungstheorie und BewusstseinsanalyseNoch keine Bewertungen
- Hegel TechnikDokument10 SeitenHegel TechnikDaniel FalbNoch keine Bewertungen
- Freier Wille - ein Trugschluss?: Aufklärende Gespräche über unser MenschenbildVon EverandFreier Wille - ein Trugschluss?: Aufklärende Gespräche über unser MenschenbildNoch keine Bewertungen
- BernetDokument21 SeitenBernethobowoNoch keine Bewertungen
- Fabbianelli On Lipps Das WissenDokument17 SeitenFabbianelli On Lipps Das WissenalfonsougarteNoch keine Bewertungen
- Loidolt, Sophie - Ist Husserls Späte Ethik Existenzialistisch?Dokument11 SeitenLoidolt, Sophie - Ist Husserls Späte Ethik Existenzialistisch?Pavel Veraza TondaNoch keine Bewertungen
- (GA 6.2) Martin Heidegger - Nietzsche IIDokument255 Seiten(GA 6.2) Martin Heidegger - Nietzsche IICarolNoch keine Bewertungen
- Fahrverbote Für Diesel Transporter Sind MöglichDokument1 SeiteFahrverbote Für Diesel Transporter Sind MöglichMiau SiauNoch keine Bewertungen
- Was Ist Sexuelles Kapital - (Sexuelles Kapital Als Mehrwert Des Körpers)Dokument9 SeitenWas Ist Sexuelles Kapital - (Sexuelles Kapital Als Mehrwert Des Körpers)Miau SiauNoch keine Bewertungen
- Zentralbankkapitalismus Transformationen Des Globa... - (Titel)Dokument1 SeiteZentralbankkapitalismus Transformationen Des Globa... - (Titel)Miau SiauNoch keine Bewertungen
- (9783110825565 - Theorie Und Experiment in Der Psychologie) B. EXKURS BER DEN DREIFACHEN GEGENSTAND DER PSYCHOLOGIEDokument51 Seiten(9783110825565 - Theorie Und Experiment in Der Psychologie) B. EXKURS BER DEN DREIFACHEN GEGENSTAND DER PSYCHOLOGIEMiau SiauNoch keine Bewertungen
- Handbuch Psychoanalytischer Grundbegriffe Affekt Emotion GefhlDokument9 SeitenHandbuch Psychoanalytischer Grundbegriffe Affekt Emotion GefhlMiau SiauNoch keine Bewertungen
- 5 Ernährungssituation: 5.1 Ernährungssituation in Den D-A-CH-Län-dern (Deutschland, Österreich, Schweiz)Dokument12 Seiten5 Ernährungssituation: 5.1 Ernährungssituation in Den D-A-CH-Län-dern (Deutschland, Österreich, Schweiz)Miau SiauNoch keine Bewertungen
- 6 Ernährung Und GesundheitDokument26 Seiten6 Ernährung Und GesundheitMiau SiauNoch keine Bewertungen
- (9783110825565 - Theorie Und Experiment in Der Psychologie) LITERATURVERZEICHNISDokument10 Seiten(9783110825565 - Theorie Und Experiment in Der Psychologie) LITERATURVERZEICHNISMiau SiauNoch keine Bewertungen
- 2011 Book DieSanktionImRechtDerEuropà IscDokument367 Seiten2011 Book DieSanktionImRechtDerEuropà IscMiau Siau100% (1)
- Downloadering 13Dokument17 SeitenDownloadering 13Miau SiauNoch keine Bewertungen











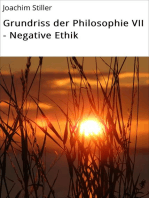







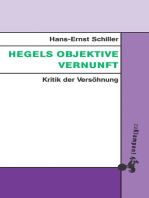





















![[2020] RUHLIG, N. George Batailles Philosophie der Souveranität - Kritik an Hegels Dialektik Herr und Knecht](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/723611814/149x198/9afe7eea42/1713279423?v=1)