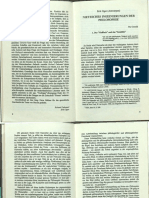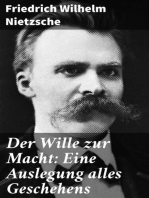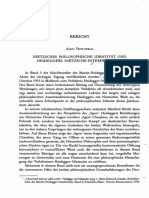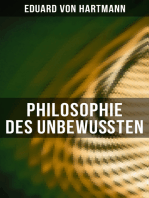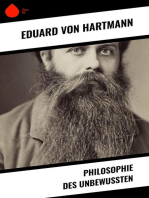Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Müller-Lauter - Nietzsches Lehre Vom Willen Zur Macht
Müller-Lauter - Nietzsches Lehre Vom Willen Zur Macht
Hochgeladen von
João Pedro Azevedo LimaOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Müller-Lauter - Nietzsches Lehre Vom Willen Zur Macht
Müller-Lauter - Nietzsches Lehre Vom Willen Zur Macht
Hochgeladen von
João Pedro Azevedo LimaCopyright:
Verfügbare Formate
WOLFGANG MÜLLER-LAUTER, BERLIN
NIETZSCHES LEHRE VOM WILLEN ZUR MACHT
„Audi hier, wie so oft, verbürgt die Einheit
des Wortes Nichts für die Einheit der
der Sache/ (MA I, Aph. 14)
Wenn Nietzsche schreibt, die Welt sei der Wille zur Macht und nichts
außerdem, so scheint er uns mit dieser klaren Aussage einen Schlüssel zum
Verständnis seines Denkens in die Hand zu geben, mit dessen Gebrauch die
philosophischen Interpreten vertraut sind: Er nennt den Grund des Seienden
und bestimmt von ihm her das Seiende im ganzen; sein Denken ist Meta-
physik in dem uns aus der langen Geschichte der abendländischen Philo-
sophie geläufigen Sinne. Das Verständnis dieses Denkens stellt uns dann
nicht vor grundsätzlich neue Probleme. Mag Nietzsche sich auch ausdrück-
lich gegen die Metaphysik wenden, so können wir uns doch rasch davon
überzeugen, daß er von dieser nur in der Bedeutung einer Zweiwelten-
theorie spricht. Sehen wir von einer solchen Verengung ab, so ist Nietzsches
Anspruch, seine Philosophie sei keine Metaphysik, doch wohl nicht auf recht
zu erhalten. Nietzsche verlängert nur, so könnten wir sagen, die Kette
metaphysischer Weltdeutungen um ein weiteres Glied.
Heidegger hat der Philosophie Nietzsches eine besondere Bedeutung
innerhalb der Geschichte der Metaphysik zugesprochen. Er deutet sie als
die Vollendung der abendländischen Metaphysik, insofern sich in der
von ihr vollzogenen Umkehrung der Metaphysik deren Wesensmöglich-
keiten erschöpfen sollen. In Nietzsches Denken geschieht aber noch mehr:
die Zerstörung der Metaphysik aus ihr selbst heraus. Es läßt sich zeigen, daß
ihr gerade als der höchsten Aufgipfelung der ,Metaphysik der Subjektivität*
diese Subjektivität ins Grund-lose hinabsinkt. Der metaphysische ,Wille
zum Willenc wird in der Gestalt des Willens zur Macht, der sich als er selbst
durchschaut, zum gewollten Wollen, das nicht mehr auf ein Wollendes, auf
den Willen zurückverweist, sondern nur noch auf das Gefüge von Wollen-
dem, welches sich, auf sein letztes faktisches Gegebensein hin befragt, ins
Un-fest-stell-bare entzieht. Kein Zweifel, daß Nietzsche Metaphysiker
bleibt. Kein Zweifel, daß er Metaphysik restauriert: so etwa, wenn er in
der Wiederkunftslehre die höchste Annäherung des Werdens an das Sein
denkt. Aber wesentlicher scheint mir, daß hinter den von ihm immer wieder
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
2 Wolfgang Müller-Lauter
aufgerichteten Fassaden in Konsequenz seines unablässigen Fragens Meta-
physik zerfällt. Die volle Bedeutung dieses Vorgangs könnte nur im
Rahmen einer weitgespannten Erörterung angemessen interpretiert werden,
in der Metaphysik in ihrer Vielschichtigkeit zum Problem gemacht würde.
Es sei angemerkt, daß meine Nietzsche-Interpretation der Heideggers
zwar fundamental widerspricht, daß ich mich deswegen aber nicht im
Gegensatz zu Heideggers Bemühen um eine ,Verwindung der Metaphysike
sehe. Vielmehr scheint mir deren Notwendigkeit — wie auch die Notwen-
digkeit des von Heidegger vorbereiteten ,anderen Anfangs' — in noch
stärkerem Maße aus dem Denken Nietzsches zu erwachsen, als es durch die
bisherigen Interpretationen zutage getreten ist.
In dieser Untersuchung geht es um die Frage nach dem Willen zur
Macht. Wir wollen versuchen, uns dabei gänzlich im Horizont der Philo-
sophie Nietzsches zu bewegen. Es wird sich zeigen, welche komplexe Proble-
matik hinter der so einfach klingenden Aussage steht, die Welt sei der Wille
zur Macht und nichts außerdem.1 In diese Problematik wollen wir Schritt
für Schritt eindringen. Angesichts ihrer Komplexität erscheint es mir ange-
bracht, mit der Anführung einiger charakteristischer Aussagen Nietzsches
über das zu beginnen, was er unter ,Wille zur Macht" versteht. Sie sollen
einen ersten Zugang zu dem eröffnen, was im folgenden expliziert wird.2
1. Vorläufige Charakterisierung des Willens zur Macht
Wille zur Macht ist nicht ein Spezialfall des Wollens. Ein Wille ,an sidic
oder ,als solcher" ist eine bloße Abstraktion: faktisch gibt es ihn nicht. Alles
Wollen ist Nietzsche zufolge Etwas-Wollen. Das in allem Wollen wesenhaft
gesetzte Etwas ist: Macht. Wille zur Macht sucht zu herrschen und seinen
Machtbereich unablässig zu erweitern. Machterweiterung vollzieht sich in
1
In Grundzügen habe ich meine Deutung des ,Willens zur Macht* in meinem Buch
Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensätze und die Gegensätze seiner Philosophie,
Berlin-New York 1971, vorgelegt. In ausführlicherer Kritik haben sich bisher mit ihr
auseinandergesetzt: W. Weischedel in einem Diskussionsbeitrag unter dem Titel Der
Wille und die Willen. Zur Auseinandersetzung Wolfgang Müller-Lauters mit Martin
Heidegger, in: ZfphF 27/1, 1973, 71—76 und P. Köster in Die Problematik wissen-
schaftlicher Nietzsche-Interpretation. Kritische Überlegungen zu Wolfgang Müller-
Lauters Nietzschebuch, in Nietzsche-Studien 2, 1973, 31—60. Ich werde im folgenden
auf die wesentlichen Einwände vor allem dieser Kritiker, soweit sie sich auf die
Problematik des Willens zur Macht beziehen, in Anmerkungen eingehen. Wo dies nicht
ausdrücklich geschieht, meine ich den Einwänden doch im Zuge meiner Ausführungen
Rechnung getragen zu haben.
2
Die nachstehenden Ausführungen sind hervorgegangen aus einem Vortrag, den ich
unter dem Titel Überlegungen zu Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht auf Ein-
ladung der Wijsgerig Gezelschap am 13. Mai 1973 in Löwen gehalten habe.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 3
Überwältigungsprozessen. Deshalb ist Maditwollen nicht etwa nur ^be-
gehren', streben, verlangen". Zu ihm gehört der „Affekt des Commando's"?
Kommando und Ausführung gehören in dem Einen des Willens zur Macht
zusammen. So ist „ein Machtquantum ... durch die Wirkung, die es übt und
der es widerstrebt, bezeichnet".4
Überall findet Nietzsche den Willen zur Macht am Werke. „Am deut-
lichsten" läßt sich „an allem Lebendigen ... zeigen, daß es alles thut, um
nicht sich zu erhalten, sondern um mehr zu werden".5 Aber auch im un-
organischen Bereich ist der Wille zur Macht das einzig Tätige. Nietzsche
grenzt sich von Schopenhauers ,Willen zum Leben' als Grundform des
Willens ab: „das Leben ist bloß ein Einzelfall des Willens zur Macht, — es
ist ganz willkürlich, zu behaupten, daß Alles danach strebe, in diese Form
des Willens zur Macht überzutreten".6
Nicht nur in dem, was herrscht und seine Herrschaft ausdehnt, äußert
sich der Wille zur Macht, sondern auch in dem Beherrschten und Unter-
worfenen. „Selbst das Verhältnis des Gehorchenden zum Herrschenden"
muß „als ein Widerstreben" im genannten Sinne verstanden werden.7
Audi der Mensch ist — in welchen Verhaltensweisen auch immer — im
Grunde Wille zur Macht. Nietzsche führt alle unsere intellektuellen und
seelischen Tätigkeiten auf unsere „Wertschätzungen" zurück, die „unsern
Trieben und deren Existenzbedingungen" entsprechen. In einer nachgelas-
senen Aufzeichnung heißt es dazu weiter: „Unsere Triebe sind reducirbar
auf den Willen zur Macht. Der Wille zur Macht ist das letzte Faktum, zu
dem wir hinunterkönnen."8 Damit wird deutlich, daß für Nietzsche „das
innerste Wesen des Seins Wille zur Macht ist".9
3
Nachlaß Nov. 1887— März 1888, 11 [114]; KGW VIII 2, 296 (WM 668). — Die
von Nietzsche veröffentlichten oder zur Veröffentlichung vorbereiteten Werke werden
unter möglichst genauer Angabe von Schrift und Abschnitt, Aphorismus etc. aus der
KGW zitiert. Der Nachlaß wird, soweit schon in dieser Ausgabe erschienen, ebenfalls
nach der KGW, ansonsten nach der GA zitiert. Da für den in der KGW bisher ver-
öffentlichten Nachlaß der Achtziger Jahre zum Teil noch gar keine Konkordanzen zur
Verfügung stehen (V l und 2), zum Teil nur solche von der KGW zur GA (VIII 2
und 3), ist es möglich, daß aus dem einen oder anderen schon in der KGW erschienenen
Nachlaßfragment noch nach der GA zitiert wurde. Sofern Texte aus der KGW nach-
gewiesen werden, die in früheren Ausgaben in der Nachlaßkompilation ,Der Wille zur
Macht* abgedruckt sind, wird in Klammern auch die Aphorismus-Nummer dieser
Kompilation angegeben, ohne auf eventuelle Unterschiede in der Entzifferung und Ab-
grenzung des Aphorismus bzw. auf Textveränderungen, die die Herausgeber der GA
vorgenommen haben, einzugehen.
4
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [79]; KGW VIII 3, 50 (WM 634).
s Nadilaß Frühjahr 1888, 14 [121]; KGW VIII 3, 93 (WM 688).
• Ebd. (WM 692).
* Nadilaß ;GA XIII, 62.
8
Nachlaß; GA XIV, 327, vgl. GA XVI, 415.
9
Nadilaß Frühjahr 1888, 14 [80]; KGW VIII 3, 52 (WM 693).
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
4 Wolfgang Müller-Lauter
Diese ersten Ausführungen zur Thematik des Willens zur Macht orien-
tierten sich am Nachlaß Nietzsches. Es fragt sich, ob eine solche Orientie-
rung legitim ist. Sollte man sich in einer so wichtigen Frage nicht besser
allein — oder wenigstens primär — an die von Nietzsche selbst veröffent-
lichten Schriften halten? Wie steht es denn um die philologische Zuver-
lässigkeit des edierten Nachlasses? Welches philosophische Gewicht haben
die von Nietzsche nicht publizierten Aufzeichnungen im Verhältnis zu dem
von ihm autorisierten Werk?
2. Bemerkungen zur Nachlaß-Problematik
Der größere Teil von Nietzsches unveröffentlichten Aufzeichnungen ist,
soweit er unmittelbare philosophische Relevanz besitzt, im Rahmen der so-
genannten ,Groß-Oktav-Ausgabe" der Nietzsche-Diskussion zugänglich ge-
macht worden. Der vollständige Nachlaß wird freilich erst vorliegen, wenn
die von G. Colli und M. Montinari veranstaltete Kritische Gesamtausgabe
zu ihrem Abschluß gelangt sein wird. Schon nach den bisher veröffentlichten
Bänden dieser Ausgabe kann allerdings gesagt werden, daß sich die
Nietzsche-Forschung auf Grund des nun erst bekannt gemachten Materials
in vielerlei Hinsicht vor eine neue Situation gestellt sieht.
Ob aus den bisher noch unveröffentlichten Texten wesentliche neue
Einsichten für eine Beantwortung der fundamentalen Fragen nach dem
Willen zur Macht erwachsen können, läßt sich derzeit nicht sagen. Ich wage
es zu bezweifeln: nicht zuletzt deshalb, weil die früheren Herausgeber
gerade ihr ein besonderes Augenmerk geschenkt haben. So ist unter dem
Titel ,Der Wille zur Machtf zuerst im Jahre 1901 eine auf 483 Aphorismen
begrenzte, im Jahre 1906 eine andere, 1067 Aphorismen enthaltende Zu-
sammenstellung von nachgelassenen Aufzeichnungen Nietzsches erschienen.
Deren Herausgeber orientierten sich bei ihren Kompilationen an einem von
zahlreichen Plänen, die Nietzsche für ein künftiges Werk zwar entworfen,
aber nicht verwirklicht hat. Indem sie ihrem Unternehmen Nietzsches Dis-
position vom 17. 3. 1887 zugrunde legten, stellten sie, Nietzsches sehr all-
gemeiner Gliederung folgend, Texte zusammen, die in mancherlei Hinsicht
unterschiedlichen Charakters sind und nur zu einem — wenn auch beträcht-
lichen — Teil zur Klärung dessen, was er unter dem ,Willen zur Machtc ver-
steht, beitragen. Zwar sind darüber hinaus auch jeweilige Auswahl und
systematisierende Ordnung der Aphorismen mehr als fragwürdig, von
editorischer Leichtfertigkeit im einzelnen ganz zu schweigen. Ferner läßt
sich aus anderen Nachlaßbänden der Groß-Oktav-Ausgabe Bedeutsames für
Nietzsches Verständnis des Willens zur Macht gewinnen. Daß das Problem
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 5
des Willens zur Macht ins öffentliche Bewußtsein trat, und zwar im guten,
philosophisch fragenden Sinne wie auch im schlechten, sdilagwortartigen
Gebrauch, dies ist jedoch vor allem darauf zurückzuführen, daß mit der
Ausgabe von 1906 ein B unter dem Titel ,Der Wille zur Macht* erschien
und zur Wirkung gelangte, von dem behauptet wurde, es stelle das philo-
sophische Hauptwerk Nietzsches dar.
Es verbietet sich, von einem solchen Hauptwerk Nietzsches zu spre-
chen. Aber es verbietet sich auch, die in den genannten Kompilationen wie
in anderen Bänden der Groß-Oktav-Ausgabe veröffentlichten Aphorismen
und Fragmente als bloßen Nachlaß beiseitezuschieben. Zwar bedarf es der
Differenzierung zwischen ,editem Nachlaß" einerseits und paraphrasierenden
Exzerpten, die Nietzsche anfertigte, sowie ,Vorstufenc zu von ihm selbst
noch Veröffentlichtem andererseits. Hier wird die neue Kritische Gesamt-
ausgabe noch wesentliche Einsichten eröffnen. Aber schon um das Verhält-
nis zwischen früheren Niederschriften und späteren, für die Publikation
umgearbeiteten Texten steht es im Falle Nietzsche nicht so wie bei anderen
Autoren. Nietzsche hielt nicht nur viele seiner Einsichten zurück. Er gab
auch mancher von ihnen in seinen Schriften nur in verdeckender, lediglich
andeutender Weise oder auch in hypothetischer Form Ausdruck. Der Hin-
weis auf die eigentümliche Bedeutung des Nachlasses Nietzsches verliert an
Befremdlichkeit, wenn wir hören, daß Nietzsche sich selbst als der Ver-
steckteste aller Versteckten verstanden hat.10 In Jenseits von Gut und Böse*
schreibt er sogar, man liebe seine Erkenntnis nicht mehr genug, sobald man
sie mitteile.11 Und in einer nachgelassenen Aufzeichnung aus dem Jahre
1887 heißt es: „Ich achte die Leser nicht mehr: wie könnte ich für Leser
schreiben? ... Aber ich notire midi, für midi."12 Was Nietzsdie zurückge-
halten hat, bekommt von solchen Äußerungen her besonderes Gewidit. So
finden sidi gute Gründe für M. Heideggers Auffassung, daß „die eigent-
liche Philosophie Nietzsdies... nicht zur endgültigen Gestaltung und nidit
zur werkmäßigen Veröffentlichung, weder in dem Jahrzehnt zwischen 1879
und 1889 noch in den voranliegenden Jahren" gekommen sei. Was
Nietzsche selbst veröffentlicht habe, sei „immer Vordergrund". Die eigent-
lidie Philosophie Nietzsches sei als ,Nadilaßc zurückgeblieben.13
10
Vgl. E. Fink, Nietzsches Philosophie, Stuttgart I960, 10.
11
JGB 160; KGW VI 2, 100.
12
Nadilaß Herbst 1887, 9 [188]; KGW VIII 2, 114.
13
M. Heidegger, Nietzsche, 2 Bde., Pfullingen 1961; hier: 1,17.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
6 Wolfgang Müller-Lauter
3. Die Bedeutung des Nachlasses in K. Schlechtas Nietzsche-Verständnis
Der an der besonders markanten Ausführung Heideggers exemplifi-
zierten Bewertung des Nietzsche-Nachlasses steht als das andere Extrem die
Überzeugung K. Sdilechtas gegenüber, Nietzsche habe „sich völlig eindeutig,
völlig unmißverständlich in den von ihm selbst veröffentlichten oder von
ihm zur Veröffentlichung eindeutig bestimmten Werken ausgesprochen. In
bezug auf eine echte Verständnismöglidikeit bleibt nichts Wesentliches zu
wünschen übrig." Man müsse Nietzsche nur in dem verstehen wollen, was er
publiziert habe.u Schlechta hat eine vielbeachtete Ausgabe von Nietzsches
Werken in drei Bänden herausgebracht, die seither von nicht wenigen
Autoren als einzige Textgrundlage für ihre Interpretationen herangezogen
wird. Diese Ausgabe beschränkt sich freilich nicht, wie nach der darge-
legten Auffassung ihres Herausgebers zu erwarten wäre, auf die Veröffent-
lichungen Nietzsches. Vielmehr hat Schlechta in den dritten Band seiner
Edition — neben anderen Texten — die in der 1906 erschienenen Ausgabe
des jWillens zur Macht" zusammengestellten Nachlaßstücke aufgenommen.
Man kann hierin eine Inkonsequenz Schlechtas sehen. Doch das ,ge-
schiditliche Gewicht", das Nietzsches angeblichem Hauptwerk in der Litera-
tur zugesprochen wurde, läßt es ihm gerechtfertigt erscheinen, die Texte der
Kompilation ,Der Wille zur Macht" erneut und vollständig zu veröffent-
lichen. Dies geschieht allerdings so, daß Schlechta die systematische Zusam-
menstellung der früheren Herausgeber auflöst und statt dessen eine streng
chronologische Anordnung der Aphorismen herzustellen sucht, aus denen
die Kompilation besteht. Letzteres ist ihm nicht zureichend gelungen und
konnte ihm, da ihm die Originalmanuskripte nicht zur Verfügung standen,
auch nicht gelingen. Das Verdienst der Ausgabe Schlechtas besteht nicht
zuletzt darin, daß er die Hauptwerk-Legende für das öffentliche Bewußt-
sein endgültig zerstört hat. Daß er jedoch allein diejenigen Texte publi-
zierte, die schon die Herausgeber der Kompilation von 1906 ausgewählt
hatten, zeitigte allerdings den fatalen Effekt, daß die Benutzer seiner Aus-
gabe allein diesen Teil des Nachlasses vor Augen hatten und dieser so im
14
K. Schlechta, Der Fall Nietzsche, München 19592, 11, vgl. 90 und im Nachwort zu
Sdilechtas Nietzsche-Ausgabe, SA III, 1433. — Daß Schlechta die Möglichkeit nicht
ausschließt, im noch nicht edierten Nachlaß könne sich nodi wichtiges Material finden,
zeigt eine Bemerkung im Philologischen Nacbbericht zu seiner Nietzsche-Ausgabe:
„Wenn ich gesagt habe: ,Der Wille zur Macht* biete nichts Neues, so bezieht sich diese
Behauptung nur auf die genannte Nachlaß-Auswahl. Allerdings sieht es mit dem in der
G<roß> O<ktav) A(usgabe), XII f. (1903 f.) Publizierten auch nicht besser aus — aber
meine Behauptung bezieht sich nicht auf den ganzen Nachlaß. Das kann gar nicht sein,
denn dieser Nachlaß ist ja z. T. noch gar nicht oder nicht einwandfrei entziffert; es gibt
also noch unbekannte Texte darin." (SA III, 1405)
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsdies Lehre vom Willen zur Madit 7
Unterschied zu dem von Sdiledita nicht publizierten Nachlaß erneut be-
sondere sachliche Relevanz erhielt. Dabei hatte Sdiledita zu recht darauf
hingewiesen, daß es eigentlidi nicht erklärlich sei, wieso die Herausgeber
von ,Der Wille zur Macht' nicht audi diejenigen Aufzeichnungen Nietzsches
in ihre Aphorismen-Sammlung aufgenommen haben, die als ,weiterer Nach-
laß' in den Bänden XIII und XIV der Groß-Oktav-Ausgabe zu finden sind.
Man kann den gleichen Vorwurf gegen Sdiledita selbst vorbringen: wenn
schon Bemühung um chronologisch orientierte Nachlaß-Edition, weshalb
dann nicht chronologisch geordnete Einbeziehung des ,weiterenc Nadi-
lasses?15 Hat Sdiledita nicht faktisch — wenn audi entgegen seiner er-
klärten Intention — einer Höherbewertung der Niederschriften Vorschub
geleistet, die in ,Der Wille zur Macht* publiziert worden sind?16
4. Zu Äußerungen Nietzsches über den Willen zur Macht
im veröffentlichten Werk
Die geringe Einschätzung der philosophischen Relevanz des veröffent-
lichten Nachlasses Nietzsdies durch Sdiledita hatte eine Kontroverse zur
15
In einem Bericht über die Vorüberlegungen der Herausgeber einer italienischen Ober-
setzung von Nietzsches Werken und Nachlaß schreibt M. Montinari: (Wir konnten)
„auch keinen rechten Gebrauch der Schlechta-Ausgabe zu unseren Zwecken machen. Wir
hatten zwar in deren ersten zwei Bänden eine meist getreue Wiedergabe der Erstdrucke
Nietzsches vor uns, im dritten Band aber hatten wir — obwohl einigermaßen chrono-
logisch geordnet — genau dasselbe Material, das 1906 durch die Veröffentlichung der
zweiten Ausgabe des »Willens zur Macht* bekannt wurde. In Florenz hätten wir freilich
noch ein weiteres über Schlecbta hinaus machen können: wir hätten nämlich mit Hilfe
des Apparats von Otto Weiß zum »Willen zur Macht* (im 16. Band der Großoktav-
ausgabe) manche grobe Verstümmelung beseitigen können; außerdem hätten wir auch
den ersten einbändigen ,Willen zur Macht* (1901) zu Rate ziehen und dadurch eine ge-
wisse Anzahl wichtiger Fragmente bergen können, welche sonderbarer Weise aus dem
zweiten endgültigen, doch viel umfangreicheren ,Willen zur Macht* (1906) verschwun-
den waren; endlich hätten wir aufgrund der Manuskriptverzeichnisse in den Bänden
XIII und XIV der Großoktavausgabe die für den ,Willen zur Macht* benutzten
Manuskripte (also die, welche in den Bänden XV und XVI der Großoktavausgabe
auch verzeichnet waren) ergänzen können. Auf diese Weise hätten wir einen umfang-
reicheren, nach den Manuskripten einigermaßen chronologisch geordneten Nachlaß aus
den 80er Jahren herstellen können.** Im folgenden geht Montinari auf weitere edi-
torische Probleme ein; er beschreibt den Weg, der zur Herausgabe der KGW führte,
und nennt deren Aufgabe. Das Zitat ist der Originalfassung eines Aufsatzes Montinaris
entnommen, die mir der Vf. freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Von diesem
Aufsatz ist bisher lediglich eine von D. S. Thatcher vorgenommene Übersetzung ins
Englische unter dem Titel The New Critical Edition of Nietzsate's Complete Works
(in: The Malahat Review 24, Victoria 1972, 121—134) publiziert worden.
16
Eine gründliche und detaillierte Kritik an Schlechtas Verfahren hat E. Heftrich in
seinem Buch Nietzsches Philosophie. Identität von Welt und Nichts (Frankfurt a. M.
1962, 291—295) vorgelegt. Auf sie sei hier nachdrücklich hingewiesen.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
8 Wolfgang Müller-Lauter
Folge, in der es auch um die sachliche Problematik des Willens zur Macht
ging. K. Löwith warf Schledita vor, eine neue Nietzsche-Legende ver-
breitet zu haben, die nämlich, „daß es den Willen zur Macht als ein von
Nietzsche gestelltes und durchdachtes Problem von weitester Herkunft und
größter Tragweite nicht gäbe."17 In seiner Antwort führt Schlechta aus18, er
bestreite natürlich nicht, „daß Nietzsche in dem von ihm veröffentlichten
Werk des öfteren den Willen zur Macht als eine Grundeigenschaft des
Lebens" apostrophiere, so etwa, wenn er Zarathustra sagen lasse: „Wo ich
Lebendiges fand, da fand ich Willen zur Macht". Aber wo Nietzsche
„diesen seinen Gedanken auseinanderzulegen und zu präzisieren" suche, sei
er zu einem „vorzeigbaren Resultat" nicht gelangt.
Dieses Urteil Schlechtas läßt sich nicht aufrechterhalten. Zwar bietet
das von Nietzsche autorisierte Werk keine zureichende Grundlage für ein
Verständnis des Willens zur Macht. Die Abgründigkeit dessen, was er mit
diesem Wortgefüge zu nennen sucht, öffnet sich nur, wenn man den Nachlaß
heranzieht. Schlechta zufolge aber bietet der in der Groß-Oktav-Ausgabe
publizierte Nachlaß nichts Neues gegenüber dem, was Nietzsche in seinen
Veröffentlichungen gesagt hat. So gelangt er zu der grundsätzlichen Über-
zeugung, daß es dem Gedanken des Willens zur Macht an Tragfähigkeit
mangele. Aber wenn sich auch in Nietzsches Schriften oft nur , Vorder-
gründiges' zum Willen zur Macht findet, so ist ihnen für eine Klärung dieses
Problems doch mehr zu entnehmen, als Schlechta wahrhaben will.
Lassen wir uns hier nur auf das ein, was Schlechta selber anführt. In
seiner Antwort an Löwith legt er „zwei Proben" aus Werken Nietzsches
vor, die er als repräsentativ für das erörterte Problem betrachtet. Sie sind —
so will Schlechta zeigen — nicht nur miteinander unvereinbar. Jede der
beiden Ausführungen soll darüber hinaus auch in sich selbst problematisch
sein. Im folgenden werde ich die beiden ,Probenc einer genaueren Betrach-
tung unterziehen. Ich verstehe die in ihnen herangezogenen Texte ebenfalls
als repräsentativ für das von Nietzsche Veröffentlichte.
Die ,erste Probe" Schlechtas ist der Aphorismus 36 in Jenseits von Gut
und Böse*. Nietzsche stellt hier seinen Gedanken des Willens zur Macht im
Kontext einer Reihe von Überlegungen vor, die in die Form von Hypo-
thesen gekleidet sind. Sie brauchen hier im einzelnen um so weniger vor-
geführt zu werden, als es dem Interpreten Schlechta allein um den hypo-
thetischen Charakter geht, welcher sich in Wendungen ausdrückt wie: „Ge-
setzt dass...", „man muss die Hypothese wagen ...", „gesetzt endlich, dass
es gelänge..." — und dergleichen. Nietzsche schließt seine Ausführungen
17
K. Löwith, Zu Schlechtas neuer Nietzsche-Legende, Merkur 12, 1958, 782.
18
Zu den im folgenden herangezogenen Ausführungen Sdilechtas s. Der Fall Nietzsche,
a. a. O. 120—122.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 9
ab mit der Überlegung: „... so hätte man damit sich das Recht verschafft,
alle wirkende Kraft eindeutig zu bestimmen als: Wille zur Macht. Die Welt
von innen gesehen, die Welt auf ihren ,intelligiblen Charakter* hin be-
stimmt und bezeichnet — sie wäre eben ,Wille zur Machtc und nichts
ausserdem. —a19
Schledita findet die Vorsicht bemerkenswert, mit der sich Nietzsche in
dieser seiner ersten veröffentlichten Auseinanderlegung der Problematik des
Willens zur Macht äußert. Daß Nietzsche den Konjunktiv wählt: die Welt
wäre ,Wille zur Macht' und nichts außerdem, veranlaßt ihn zu schreiben:
„Das klingt für einen Gedanken, der tragen soll, nicht sehr zuversichtlich/
Gegen Schlechtas Auffassung läßt sich zweierlei ins Feld führen.
A. Nietzsche spricht in dem herangezogenen Aphorismus nicht nur hypothe-
tisch. Nachdem er geschrieben hat: „Gesetzt endlich, dass es gelänge, unser
gesammtes Triebleben als die Ausgestaltung und Verzweigung Einer Grund-
form des Willens zu erklären", fügt er die Parenthese ein: "— nämlich des
Willens zur Macht, wie es mein Satz ist —". Zu recht schreibt E. Heftrich:
„Das deutliche notum est der Parenthese aber schränkt die Hypothese, als
welche der Aphorismus durchgeführt wird, ein; ja, setzt sie gänzlich in die
Klammer. Damit wird, was in der Parenthese steht, zur Lösung, zum
Grundsatz (,mein Satz')."20 Mit der Einfügung geht Nietzsche in der Tat
über die von ihm in jenem Aphorismus als frag-würdige Annahmen vorge-
tragenen Überlegungen hinaus und nennt in ihr seine Grundüberzeugung.
Von mangelnder Zuversicht kann da wohl nicht gesprochen werden. —
B. Der genannte Aphorismus steht in Jenseits von Gut und Böse unter dem
Zwischentitel Der freie Geist (Zweites Hauptstück). Die freien Geister
sollen die neuen „Philosophen des gefährlichen Vielleicht in jedem Ver-
stande" sein, wie Nietzsche schon vorher, im Ersten Hauptstück seines
Buches, schreibt. Er empfiehlt ihnen ihre „Maske und Feinheit", auf daß
man sie verwechsle. Hierin soll sich ihr Stil ausdrücken.21 Sie stellen einen
Ubergangstypus dar: es geht Nietzsche darum, wie es in einer Notiz zu den
Schriften seiner mittleren Schaffensperiode heißt, „den Zugang zum Ver-
ständniss eines noch höheren und schwierigeren Typus zu erschliessen, als es
selbst der Typus des freien Geistes ist: — es führt kein andrer Weg zum
Verständniss."22 Betrachtet man die im Aphorismus 36 von Jenseits vonGut
und Böse vorgeführten Gedankenexperimente unter diesem Aspekt, so wird
man A. Baeumler in seiner Kritik an Schledita zustimmen müssen. Baeumler
19
JGB36;KGWVI2,50f.
20
Heftrich, Nietzsches Philosophie, a. a. O. 72.
21
JGB25;KGWVI2, 38.
22
Nachlaß; GA XIV, 349.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
10 Wolfgang Müller-Lauter
schreibt, es sei verfehlt, „ein Stilmittel als eine sachliche Distanzierung im
Hauptpunkt" auszulegen.23
In einer abschließenden Bemerkung zu Schlechtas erster ,Probec sei auf
eine nachgelassene Aufzeichnung Nietzsches hingewiesen, die uns im folgen-
den noch näher zu beschäftigen haben wird.24 Sie stammt aus dem Jahre
1885 und gehört zu den Materialien, die er bei der Abfassung von Jenseits
von Gut und Böse berücksichtigte. Nietzsche hat sich am Schluß dieser
Aufzeichnung in ähnlicher Weise über die Welt als Wille zur Macht ge-
äußert. Der uns in diesem Zusammenhang allein interessierende Unter-
schied zwischen den beiden Texten25 besteht nun darin, daß Nietzsche sich
in dem früher niedergeschriebenen Text nicht hypothetisch, sondern mit
unzweideutiger Entschiedenheit ausspricht: „... wollt ihr einen Namen für
diese Welt? Eine Lösung für alle ihre Räthsel? Ein Licht auch für euch, ihr
Verborgensten, Stärksten, Unerschrockensten, Mitternächtlichsten? — Diese
Welt ist der Wille zur Macht — und Nichts· ausserdem!"26 Es wird im fol-
genden noch zu zeigen sein, mit welcher unangefochtenen Uberzeugtheit
Nietzsche die Weltwirklichkeit von seinem Grundgedanken des Willens zur
Macht her denkt. Geht es um die Herausarbeitung von Nietzsches letzten
,Einsiditenc und nicht um die Problematik der Fragehaltung der ,freien
Geister", so verdient hier — wie in anderen Fällen aus anderen Gründen —
23
A. Baeumler, Nachwort zu ,Der Wille zur Ma<ht\ in: KTA 9 (196410), 714.
24
Nachlaß, WM 1067; GA XVI, 401 f.
25
Zur Problematik des Verhältnisses von veröffentlichtem und nachgelassenem Text vgl.
Heftrich, Nietzsches Philosophie, a. a. O., 69 ff. — Man kann darüber hinaus noch eine
frühere Fassung des Schlusses des Aph. WM 1067 heranziehen, die in GA XVI, 515
abgedruckt ist. K. Löwith hat im Zusammenhang einer Auseinandersetzung mit L. Kla-
ges in seinem Buch Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen (Stutt-
gart 19562, 97) die beiden Fassungen gegenübergestellt. Die erste Fassung rückt den
„Willen zum Wieder-und-und-noch-einmal-Wollen" in den Vordergrund. Sie könnte nur
unter Einbeziehung der Problematik von Nietzsches Wiederkunftslehre interpretiert
werden, die im Rahmen dieser Abhandlung ausgespart bleiben muß. Löwith schreibt:
„Während in der ersten Fassung das Problem eines Wollens der ewigen Wiederkehr im
Bilde der wechselseitigen Spiegelung von Weltverfassung und Selbstverhalten dadurch
eine scheinbare Lösung findet, daß das Sichselberwollen der Welt als ein Sich-immer-
wieder-Wollen von der ewigen Wiederkunft her gedacht ist und der menschliche Wille
als ein zurück und voran wollender sich ebenfalls im Kreise bewegt, wird die Frag-
würdigkeit eines Wollens der Fatalität in der zweiten Fassung mit der abrupten Formel
vom ,Willen zur Macht', der im Menschen und in der Welt einfach derselbe sein soll,
eher verdeckt als zur Sprache gebracht." (A. a. O. 98.) Löwith findet, daß Nietzsches
Lehren vom Willen zur Macht und von der ewigen Wiederkunft einander wider-
sprechen. Dementgegen habe ich in meinem Nietzsche-Buch ihre Vereinbarkeit aufzu-
weisen versucht (a. a. O. 135 ff.). Es geht mir dort u. a. darum, zu zeigen, inwiefern
der höchste Wille zur Macht die ewige Wiederkunft des Gleichen wollen muß. Von
meiner Deutung her löst sich der Schein einer sachlichen Diskrepanz zwischen den
beiden Textfassungen auf.
28
Nachlaß, WM 1067; GA XVI, 402.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 11
der Nadilaßtext, der ,Vorstufec ist, den interpretatorischen Vorrang gegen-
über der veröffentlichten Fassung.
Indem wir Schlechtas zweite ,Probec heranziehen, geraten wir tiefer in
die Schwierigkeiten hinein, die sich einstellen, wenn nach dem Willen zur
Macht gefragt wird. Mochte man aus dem ersten Text schließen können,
Nietzsche suche nach einem metaphysischen ,Grundprinzipc, auf das sich
alle ,wirkenden Kräfte' zurückführen lassen könnten, so verweist die
Stelle, die Schledita nun heranzieht, auf eine andersgeartete Struktur des
Willens zur Macht. Es handelt sich um den Aphorismus 12 der zweiten Ab-
handlung von Zur Genealogie der Moral27, aus dem er allerdings nur einige
wesentliche Passagen berücksichtigt. Nach seiner Meinung ist dieser Text
„mindestens ebenso aufschlußreich" für den Mangel an Tragfähigkeit von
Nietzsches Gedanken wie der zuvor von ihm herangezogene. Nietzsche
wendet sich hier ebenso gegen den Gedanken einer Teleologie in der Natur
wie auch gegen den herrschenden Zeitgeschmack, „welcher lieber sich noch
mit der absoluten Zufälligkeit, ja mechanistischen Unsinnigkeit alles Ge-
schehens vertragen würde, als mit der Theorie eines in allem Geschehen sich
abspielenden Macht-Willens". Schlechta findet, daß beide von Nietzsche
abgelehnten Positionen, sowohl der „progresses auf ein Ziel hin", als auch
die ,mechanistisdie Unsinnigkeit', nur „verbale Gegenpositionen" im Ver-
hältnis zu Nietzsches jeigentlichem' Weltverständnis darstellen, das in der
Annahme „einer Welt des absoluten Zufalls" bestehe. Nun ist für Nietzsche
,Zufallc und ,Zufallc zweierlei, wie auch ,Notwendigkeitc und ,Notwendig-
keitc für ihn zweierlei ist: je nachdem, ob er diese Wörter im Sinne ,mecha-
nistischer' Begriiflichkeit oder im Zusammenhang seiner Deutung des
Willens zur Macht gebraucht. Wenn Schlechta etwa meint, Nietzsches Kraft-
begriff stamme „aus dem Arsenal der positivistischen Naturwissenschaft",
so nimmt er nicht ernst genug, was Nietzsche im letzten Teil des Aphorismus
von der modernen Entwicklung der „strengsten, anscheinend objektivsten
Wissenschaften" sagt. Demokratischer Idiosynkrasie" gegen alles Herr-
schaftliche entspringend, verkennen sie, so etwa die zeitgenössische Physio-
logie, das Wesen des Lebens, seinen Willen zur Macht. „Damit ist der
principielle Vorrang übersehn, den die spontanen, angreifenden, übergrei-
fenden, neuauslegenden Kräfte haben". Der Wille zur Macht wird hier von
Nietzsche als Pluralität von Kräften vorgestellt.
Gerade dies irritiert Schlechta. Im Bemühen, den Gedanken der Viel-
heit deutlich herauszustellen, überzieht er ihn. Er akzentuiert, daß Nietzsche
von ,voneinander unabhängigen Uberwältigungsprozessen' spricht. Schledita
bemerkt dazu: „Sind die Uberwältigungsprozesse tatsächlich voneinander
27
GM II, 12; KGW VI 2, 329—332.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
12 Wolfgang Müller-Lauter
unabhängig, so ist jeder Zwischensinn Unsinn." Mit dem Wort ,Zwischen-
sinnc spielt er offensichtlich auf ,den' Willen zur Macht an. Freilich zitiert er
unvollständig, und zwar in einer Weise, die das von Nietzsche Gemeinte
entstellt. Ergänzen wir die Formulierung, die Schlechta aus dem Aphorismus
12 herausgezogen hat, wenigstens soweit, als dies für das Verständnis des
Textes unumgänglich ist. Nietzsche schreibt: „,Entwicklung' eines Dings,
eines Brauchs, eines Organs i s t . . . die Aufeinanderfolge von mehr oder
minder tiefgehenden, mehr oder minder von einander unabhängigen, an ihm
sich abspielenden Uberwältigungsprozessen...". Diese sind also mehr oder
minder voneinander unabhängig. Damit wird die Unabhängigkeit einge-
schränkt. Auch Uberwältigungsprozesse, die ,mehrc Unabhängigkeit von-
einander haben, sind doch nicht völlig voneinander unabhängig, wie
Schlechta interpretiert. Daß Nietzsche, der die Bezogenheit von allem auf
alles andernorts so betont, in diesem Zusammenhang von Unabhängigkeit
spricht, hat seinen Grund darin, daß er hier gegen jede kausal oder teleo-
logisdh orientierte Bestimmung von Geschehensabläufen polemisiert. In der
Relation zu solchen Bestimmungen sind die Uberwältigungsprozesse der
Machtwillen, die in Wahrheit alle ,Entwicklungenf konstituieren, mehr oder
minder voneinander unabhängig.
Dessenungeachtet haben die beiden ,Probenc Schlechtas uns vor zwei
scheinbar unvereinbare Deutungsmöglichkeiten der Lehre vom Willen zur
Macht geführt. Hat Nietzsche das Problem des Willens zur Macht tatsäch-
lich nicht zureichend „durchdacht"? Denn entweder ist doch der Wille zur
Macht das Prinzip, welches die Welt gründet, oder die Welt ist das unge-
gründete, prinziplose Zusammenvorkommen von Vorgängen, in denen
jeweils „ein Wille zur Macht über etwas weniger Mächtiges Herr geworden
ist", wie es in dem herangezogenen Aphorismus heißt.
5. Zur Deutung des Willens zur Macht als metaphysisches Prinzip
In den Nietzsche-Interpretationen überwiegt die Auffassung, der Wille
zur Macht sei als das metaphysisch Gründende zu verstehen. Selbst wenn
man es ablehnt, den Willen zur Macht als „eindeutig" metaphysischen
Willen im Sinne Schopenhauers aufzufassen — nämlich als „ein in sich ge-
gründetes, substantielles und transzendentes Prinzip der Wirklichkeit" —,
so kann man noch immer darauf beharren, daß Nietzsche „die vielen kon-
kreten Willen zur Macht doch schließlich als Manifestationen eines einheit-
lichen, die ganze Wirklichkeit bestimmenden Prinzips denkt", wie dies
W. Weischedel tut.28 Seine Deutung bleibt — ungeachtet aller sonstigen
28
W. Weischedel, Der Wille und die Willen, a. a. O. 76 und 75.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 13
Unterschiede — der von Jaspers verwandt, welcher ausführt, Nietzsche
substantiiere das eigentliche Sein zum Willen zur Macht innerhalb einer
transzendenzlos gedachten Wirklichkeit, in der Welt ,reiner Immanenz'29.
Unter wieder ganz anderem Vorzeichen geht auch Heidegger von der sich
selbst erhaltenden und sich selbst übermächtigenden Einzigkeit des Willens
zur Macht aus. Im Sidi-selbst-übermächtigen trete der „Steigerungscharak-
ter" des von Nietzsche ausgelegten Willens hervor30. Und W. Schulz hat, in
Übereinstimmung mit Heideggers Interpretation, ausgeführt, wogegen der
Wille zur Macht angehe, das sei „kein Äußeres mehr, sondern immer nur er
selbst". Er überwinde immer nur sich in ewig sich setzender Selbstauf-
hebung.31 Diese Hinweise mögen genügen.
Daß Nietzsche — insbesondere im Nachlaß — sehr häufig von dem
Willen zur Macht spricht, scheint Deutungen von der eben genannten Art zu
untermauern. Und wenn er, wie schon ausgeführt wurde, von der Welt
schreibt, sie sei der Wille zur Macht und nichts außerdem, so verbietet sich
scheinbar jede Auffassung, in der die Wirklichkeit im Verständnis
Nietzsches nicht als metaphysisch gegründete Einheit angesehen wird32. Daß
es in derselben Niederschrift heißt, die Welt sei als „ein Ungeheuer von
Kraft * . . zugleich Eins und Vieles", schließt eine metaphysische Deutung im
genannten Sinne nicht aus. Läßt sich doch ,das Viele' von ,dem Eins' her be-
greifen. Gleichwohl will ich im Ausgang von dieser Bestimmung Nietzsches
ein andersartiges Verständnis von Wille zur Macht und Welt entwickeln.
Ich meine, daß es dem angemessener ist, worum es Nietzsche geht32.
29
K. Jaspers, Nietzsche, Einführung in das Verständnis seines Philosophierens, Berlin
19472, 310.
80
S. dazu Vf., Nietzsche, a. a. O. 30 ff.
31
W. Schulz, Der Gott der neuzeitlichen Metaphysik, Tübingen 1957, 101.
82
In Der Wille und die Willen fragt Weischedel: „Ist Nietzsche Metaphysiker, wie
Heidegger will, oder ist er es nicht, wie Müller-Lauter behauptet?" (a. a. O. 74) Mit
der Frage wird ein gemeinsames Verständnis von Metaphysik bei den Befragten vor-
ausgesetzt. Ob dies zu recht geschieht, soll wenigstens andeutungsweise erörtert
werden.
Nach Nietzsche entsteht Metaphysik dadurch, daß das Denken „zu dem Bedingten das
Unbedingte hinzudenkt, hinzuerfindet". Es geht Nietzsche immer wieder darum, den
„Unsinn aller Metaphysik als einer Ableitung des Bedingten aus dem Unbedingten"
herauszustellen. (Nachlaß, WM 574; GA XVI, 71) An Nietzsches eigenem Verständnis
von Metaphysik orientiere ich mich, wenn ich auf die Genealogie der Metaphysik aus
der Logik eingehe (Vf., Nietzsche, a. a. O. 13) und wenn ich Nietzsches Philosophie von
der Schopenhauers abhebe. Für Nietzsche handelt es sich um Metaphysik, wenn „aus
einem Ersten, Einfachen eine Vielheit deduziert wird". Daß sich mein eigenes Ver-
ständnis von Metaphysik in dieser Formulierung erschöpft, wie Weischedel offensicht-
lich meint (Der Wille und die Willen, a. a. O. 72), trifft nicht zu. Wichtig ist mir die
Herausstellung von Nietzsches Verständnis von Metaphysik auch für meine Ausein-
andersetzung mit anderen Nietzsche-Interpretationen. Man wird Nietzsche nicht ge-
recht werden können, wenn man ihm unterstellt, er falle selber in die von ihm ge-
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
14 Wolfgang Müller-Lauter
6. Wille zur Macht als Eins und Vieles
Die Welt ist Eins und Vieles. Die Welt ist der Wille zur Macht. Danach
läßt sich vermuten, daß auch der Wille zur Macht Eins und Vieles ist. Gehen
wir davon aus, der Wille zur Macht sei Eins. Wie kann dann dieses Eins-
sein verstanden werden? Das Eins als theologisch oder metaphysisch Grün-
dendes weist Zarathustra zurück. „Böse" heißt er „all dies Lehren vom
Einen".33 Auch ist das Eins für Nietzsche keineswegs ,das Einfache<. „Alles
was einfach ist, ist bloß imaginär, ist nicht ,wahr*. Was aber wirklich, was
wahr ist, ist weder Eins, noch auch nur reduzirbar auf Eins"34. Was aber
besagt dann Einheit für Nietzsche? Er antwortet: „Alle Einheit ist nur als
Organisation und Zusammenspiel Einheit: nicht anders, als wie ein mensch-
liches Gemeinwesen eine Einheit ist"35. Dies nötigt uns, auch das Eins des
sehene und kritisierte Gestalt von Metaphysik zurück. Dies geschieht bei Heidegger, wie
ich zu zeigen versucht habe (Vf., Nietzsche, a. a. O. 30 ff.). Dies geschieht auch bei
Weischedel, wenn er schreibt, Nietzsche könne „zwar als der große Zerstörer der über-
lieferten Metaphysik gelten. Aber das besagt doch nur, daß er diese durch seine neue
Metaphysik des Willens zur Macht ersetzt. Auch er kann im Philosophieren nicht dar-
auf verzichten, ein Absolutum zu setzen." (Der Gott der Philosophen, Erster Band,
Darmstadt 1971, 455).
Von Nietzsches nichtmetaphysischem Denken spreche ich nur, wenn ich in immanenter
Darstellung sein Verständnis von Metaphysik zugrunde lege. Versteht man aber unter
Metaphysik sehr viel umfassender das Fragen nach dem Seienden im ganzen und als
solchem, so muß man auch nach meiner Auffassung Nietzsche als Metaphysiker be-
zeichnen. Es muß dann freilich auf die Zeichen der Auflösung in Nietzsches Metaphysik
geachtet werden: ,das Ganze* ist nur noch als ,Chaos* gegeben, das Seiende als solches
ist nicht mehr feststellbar*. Deutet man Metaphysik in ihrem , Wesen* mit Heidegger
als Seinsvergessenheit, so stellt Nietzsches Philosophie, in der ,Sein* als bloße Fiktion
gilt, eine Metaphysik hervorgehobener Art dar. Jedenfalls stimme ich insoweit mit
Heidegger überein, als ich nicht bereit bin, Nietzsche aus der Geschichte der Metaphysik,
gar aus der Metaphysik der Subjektivität herauszunehmen, wie B. Taureck in seiner Be-
sprechung meines Buches vermutet (in: Wissenschaft und Weltbild 1972, Heft 3, 236 f.).
Daß die aufs Äußerste gesteigerte Subjektivität zugleich ihren eigenen Zerfall signali-
siert, soll im folgenden oben noch deutlicher dargestellt werden.
Diese wenigen Andeutungen müssen genügen, um Weischedels eingangs genannte Frage
einzugrenzen. Nur insoweit Heidegger dem Denken Nietzsches eine Metaphysik unter-
stellt, gegen die dieser sich ausdrücklich gewandt hat, erfolgt die in der Frage vorge-
nommene Entgegensetzung zu recht. Weischedel bleibt selbst nicht bei der Entgegen-
setzung stehen. Er weist darauf hin, daß die Bestimmung des Willens zur Macht als
Seinsverfassung durch Heidegger und meine Ausführungen zum Willen zur Macht als
der einzigen Qualität „einander näher sind, als es auf den ersten Blick erscheint" (Der
Wille und die Willen, a. a. O. 75). In der Tat arbeiten sowohl Heidegger als auch ich
den Willen zur Macht als Essenz heraus. Doch schon in der Ausarbeitung dessen, was
bei Nietzsche Essenz und Existenz besagen, endet die Gemeinsamkeit.
33
Za II, Auf den glückseligen Inseln; KGW VI l, 106.
34
Nachlaß Frühjahr 1888, 15 [118]; KGW VIII 3, 272 f. (WM 536).
85
Nachlaß, WM 561; GA XVI, 63.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 15
WLlens zur Macht unter diesem Aspekt zu bedenken. Das Viele tritt in den
Vordergrund. Nur eine Mannigfaltigkeit kann zur Einheit organisiert
werden. Bei dem organisierten Vielen muß es sich um ,Machtquantenc han-
deln, wenn denn die eine Welt nichts anderes ist als der Wille zur Macht. Ich
kann nun an das anknüpfen, was zu Schlechtas ,zweiter Probe" ausgeführt
worden ist.
Der Wille zur Macht ist die Vielheit von miteinander im Streite liegen-
den Kräften. Auch von der Kraft im Sinne Nietzsches kann man Einheit
nur in der Bedeutung von Organisation aussagen. Zwar ist die Welt „eine
feste, eherne Grosse von Kraft", sie bildet „Ein Quantum von Kraft".36
Aber dieses Quantum ist allein im Gegeneinander von Quanten gegeben. Zu
recht bemerkt G. Deleuze: «Toute force est... dans un rapport essentiel
avec une autre force. L'etre de la force est le pluriel; il serait proprement
absurde de penser la force en singulier.»37 Sind die Kräfte aber nichts ande-
res als die ,Willen zur Macht', so läßt sich auch Heideggers Behauptung
nicht aufrecht erhalten, Wille zur Macht sei „nie Wollen eines Einzelnen,
Wirklichen", Wille zur Macht sei „immer Wesenswille".38
Als Spiel und Gegenspiel von Kräften resp. Machtwillen enthüllt sich
die Welt, von der Nietzsche spricht. Bedenken wir zunächst, daß die Zusam-
menballungen von Machtquanten sich unablässig mehren oder mindern, so
kann nur von sich fortlaufend ändernden Einheiten gesprochen werden,
nicht aber von der Einheit. Einheit ist immer nur Organisation unter der
kurzfristigen Herrschaft dominierender Machtwillen. Nietzsche radikali-
siert seine Auffassung noch durch die Bemerkung, daß jede solche Einheit
als ein „Herrschafts-GebiIde" nur „Eins" bedeute, jedoch „nicht Eins" sei?*
Das Eins ist nicht. Dann ist auch der Wille zur Macht nicht als Eins. Die
Einheit von Herrschafts-Gebilden, in denen eine Vielheit von Machtquan-
ten zusammengefügt ist, hat kein Sein. Andererseits aber sagt Nietzsche, wie
wir gehört haben: Die Einheit ist Einheit als Organisation. Gerät Nietzsche
hier nicht in Widerspruch mit sich selbst? Wenn wir an „die , Vernunft' in
der Sprache" glauben, so müssen wir die Frage bejahen. Doch für Nietzsche
ist die Sprach-Vernunft „eine alte betrügerische Weibsperson". Nichts habe
bisher „eine naivere Uberredungskraft gehabt", so heißt es im gleichen
Zusammenhang, „als der Irrthum vom Sein, wie er zum Beispiel von den
Eleaten formuliert wurde: er hat ja jedes Wort für sich, jeden Satz für sich,
den wir sprechen!"40 Nietzsche ist überzeugt, daß die Sprache uns täuscht,
s
» Nadilaß, WM 1067 und 638; GA XVI, 401 und 115.
37
G. Deleuze, Nietzsche et la philosophic, Paris 1970*, 7.
38
M. Heidegger, Nietzsche, a. a. O., I, 73. — Heidegger führt aus (a. a. O. II, 36): „Statt
,Wille zur Macht* sagt Nietzsche oft und mißverständlich »Kraft'."
39
Nadilaß, WM 561; GA XVI, 63.
40
GD, Die „Vernunft" in der Philosophie 5; KGW VI 3, 72.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
16 Wolfgang Müller-Lauter
wenn wir das Wort beim Wort nehmen, d. h. wenn wir bei ihm stehen-
bleiben und uns nicht durch es hinweisen lassen auf die Sachverhalte, die in
ihm nicht aufgehen. Weil Nietzsche solcherart hinweisend spricht, kann er
sowohl ,istc sagen und dem ,istc zugleich Wirklichkeit absprechen.41 Gefragt
werden muß freilich, in welchem Sinne es kein Sein gibt. ,Seinc ist Nietzsche
zufolge „eine leere Fiktion". Daß er sich mit dieser Behauptung auf
Heraklit berufen zu können glaubt42, zeigt wie schon sein Hinweis auf die
Eleaten an, welche „Beschränkung des Seins", mit Heidegger zu reden43, für
Nietzsches Seins Verständnis konstitutiv ist: das Sein wird dem Werden ent-
gegengesetzt und als ,Täuschungc aus diesem abgeleitet44. Als das dem
Werden Entgegengesetzte gilt ,Seinc als das Beständige. Der Gedanke der
Beständigkeit verträgt sich nun aber durchaus mit dem Gedanken der Viel-
heit. Nietzsche bemerkt: „Auch die Gegner der Eleaten unterlagen noch der
Verführung ihres Seins-Begriffs: Demokrit unter Anderen, als er sein Atom
erfand .. ,"45.
Nietzsche unterliegt einer solchen Verführung nicht. Wenn es kein Sein
im Sinne von Beständigem gibt, dann gibt es auch keine Atome. Nicht nur
das Eins eines organisierten Herrschafts-Gebildes hat kein solches jSein',
sondern auch das Viele, das in einem Gebilde ,zusammenspielt', ,istf nicht,
sofern es als aus festen Einheiten zusammengesetzt gedacht wird. Das Viele
von Machtquanten ist also nicht als Pluralität von quantitativ irreduziblen
Letztgegebenheiten, nicht als Pluralität von unteilbaren ,Monadenc zu ver-
stehen.46 Machtverschiebungen innerhalb der instabilen Organisationen
41
Köster kritisiert meine im Hinblick auf Nietzsche vorgenommene Differenzierung
zwischen fixierendem Begriff und hinweisendem Wort (Die Problematik ..., a. a. O. 40).
Die sich in diesem Zusammenhang stellenden Fragen sind von J. Salaquarda (in Der
Antichrist, Nietzsche-Studien 2, 1973, 91 ff.; hier: 133 ff.) weitergeführt und vertieft
worden. Aus Salaquardas Ausführungen erhellt, wieso Nietzsche seinen ,Begriffen* z. B.
„eine eigene Zwielicht-Farbe, einen Geruch ebensosehr der Tiefe als des Moders" zu-
kommen lassen kann (Nachlaß; GA XIV, 355).
42
GD, Die „Vernunft" in der Philosophie 2; KGW VI 3, 69.
43
M. Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Tübingen 1953, 71 ff.
44
Gelegentlich gebraucht Nietzsche das Wort ,Sem' allerdings auch im Sinne von ,Leben*.
Dann wird Sein selber als das Werden verstanden. Auch in der Bedeutung von , Wesen*,
von , Wirklichkeit*, von ,besonderem Seienden* wie von ,Seiendem im ganzen* findet es
manchmal Verwendung.
45
GD, Die „Vernunft" in der Philosophie 5; KGW VI 3, 72.
48
Wenn ich die Annahme zurückweise, man könne Nietzsches Willen zur Macht eine Sub-
stantialität im Leibnizschen Sinne zusprechen (Vf., Nietzsdne, a. a. O. 32 f.), so ver-
birgt sich dahinter nicht der Gedanke, den Willen zur Macht komme Substantialität in
irgendeinem anderen Sinne zu, wie Köster argwöhnt (Die Problematik..., a. a. O.
43 ff.). Ich gerate auch nicht in die Gefahr einer Substantialisierung, wenn ich, Nietzsches
Gedankengängen folgend, den Menschen als Einheit von relativer Eigenständigkeit ver-
stehe. ,Der Mensch* erwacht in meiner Deutung nach seiner vorangegangenen „Destruk-
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 17
lassen aus einem Machtquantum zwei werden oder aus zweien eines. Wenn
wir uns der Zahlen in einem fest-stellenden und abschließenden Sinne be-
dienen, so muß gesagt werden, daß die ,Zahlc der Wesen immer im Fluß
bleibt.47 Es gibt kein Jndividuum', es gibt kein letztes unteilbares Quantum
Macht, zu dem wir hinunterkommen. Nietzsche nimmt für sich in Anspruch,
jradikal' zu denken, insofern er „die ,kleinste Welt' als das überall-Ent-
scheidende entdeckt" habe48. Dieses Kleinste kann als faktisches nie ein
Letztes sein. Es ist als Welt immer ein Gebilde, das konstituiert ist durch
„Kraft-Quanta, deren Wesen darin besteht, auf alle anderen Kraft-Quanta
Macht auszuüben"49.
Ein Herrsdiafts-Gebilde ,istc nicht Eins, es bedeutet Eins. Was meint
hier ,bedeutenc? In Jenseits von Gut und Böse schreibt Nietzsche, Wollen er-
scheine ihm vor allem als „etwas Complicirtes, Etwas, das nur als Wort eine
Einheit ist"50. Daß uns die Sprache Einheiten vorgaukelt, haben wir schon
vernommen. Doch das Bedeuten ist ursprünglicheren Wesens als das
Sprechen. Sprechen ist eine Ausdrucksweise des Machtwollens.51 Es be-
siegelt, was vorgängig schon als etwas ausgelegt worden ist. Alle Auslegung
erwächst aus dem Machtstreben der Herrschafts-Gebilde. Diese legen sich
dasjenige zurecht, was sie überwinden, vielleicht sich einverleiben wollen
oder gegen das sie sich zur Wehr setzen. Das Zurechtmachen ist immer ein
fälschendes Gleichmachen und Festmachen. Das gleich und fest Gemachte ist
für den Zugriff oder auch für die Abwehrhaltung eines Machtwollens prä-
pariert.52 Nietzsche schreibt: „Wenn ich alle Relationen, alle ,Eigenschaftenc
alle ,Thätigkeitenc eines Dinges wegdenke, so bleibt nicht das Ding übrig:
weil Dingheit erst von uns hinzufingirt ist, aus logischen Bedürfnissen, also
zum Zwecke der Bezeichnung, der Verständigung."53 ,Dasc Ding bedeutet
dem Auslegenden Eins, obwohl ihm in Wirklichkeit nur eine Vielheit gegen-
übersteht. Doch auch ,der' Auslegende ist nichts anderes als eine Vielheit
„mit unsicheren Grenzen"54. Wir sind „eine Vielheit, welche sich eine Einheit
tion" damit nicht „zu neuem Leben", wie Köster schreibt (a. a. O. 46), er ist vom Be-
ginn meiner diesbezüglichen Ausführungen an (Vf., Nietzsche, a. a. O. 18 ff.) als zur
Einheit organisierte Vielheit von Kräften im Blick.
47
Vgl. Vf., Nietzsche, a. a. O. 33.
48
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [37]; KGW VIII 3, 28.
49
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [81]; KGW VIII 3, 53.
50
JGB 19; KGW VI 2, 26.
51
„Das Herrenrecht, Namen zu geben, geht so weit, daß man sich erlauben sollte, den
Ursprung der Sprache selbst als Machtäußerung der Herrschenden zu fassen: sie sagen
,das ist das und das4, sie siegeln jegliches Ding und Geschehen mit einem Laute ab und
nehmen es dadurch gleichsam in Besitz", heißt es in Zur Genealogie der Moral (I, 2;
KGW VI 2, 274).
52
S. dazu Vf., Nietzsche, a. a. O. 11 if.
53
Nachlaß Herbst 1887, 10 [202]; KGW VIII 2, 246 (WM 558).
54
Nachlaß; GA XIII, 80.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
18 Wolfgang Müller-Lauter
eingebildet hat", notiert Nietzsche55. Als Mittel, mit dem ,ichc , ' über
,mich selbst* täusche56, dient das Bewußtsein, der Intellekt. Zwar muß es
„eine Menge Bewusstseins und Willens in jedem complizirten organischen
Wesen geben", doch „unser oberstes Bewusstsein hält für gewöhnlich die
anderen geschlossen."57 Das Herrschafts-Gebilde, das ich bin, gibt sich sich
selbst durch dieses Bewußtsein als Eins zu bedeuten: durch „Vereinfachen
und Übersichtlich-machen, also Fälschen". Auf diese Weise werden die
scheinbar einfachen Willensakte ermöglicht.58
Aus all dem dürfte deutlich geworden sein, daß Nietzsche immer fak-
tische Vielheiten von Willen zur Macht im Blick hat, die jeweils Eins im
Sinne von Einfachheit bzw. Stabilität bedeuten, in Wahrheit jedoch kom-
plexe und unaufhörlich sich wandelnde Gebilde ohne Beständigkeit sind, in
denen sich ein Gegeneinander von in mannigfachen Abstufungen organi-
sierten Kraftquanten abspielt. Mit welchem Recht kann Nietzsche dann
aber immer wieder von dem Willen zur Macht sprechen, als wäre er nicht
nur in der charakterisierten Vielheit gegeben, als wäre er faktisch Eins? Als
gründe der Wille zur Macht als Einfaches die Welt?59
55
Nachlaß; GA XII, 156.
56
„Ich und Mich sind immer zwei verschiedene Personen." Auch mein ,Michc ist „er-
dichtet und erfunden" (Nachlaß; GA XII, 304).
57
Nadilaß; G A XIII, 239 f.
58
Nadilaß; GA XIII, 249. — Vgl. Vf., Nietzsche, a. a. O. 25 f.
59
Sowohl Weischedel als auch Köster wenden gegen die von mir in meinem Nietzsche-
Buch vorgelegte Deutung des ,Willens-zur-Macht-Pluralismus' ein, daß Nietzsche doch
immer wieder von dem Willen zur Macht spreche. Beide Kritiker beziehen sich dabei
auch auf Nietzsches Satz, diese Welt sei der Wille zur Macht und nichts außerdem. Es
stelle sich die Frage, so schreibt Weischedel, warum Nietzsche „nicht — im Sinne Müller-
Lauters — sagt: Diese Welt ist die unendliche Fülle der Willen zur Macht" (Der Wille
und die Willen, a. a. O. 75). Köster führt aus, der Satz hätte „nach Müller-Lauter
eigentlich zu lauten ...: ,Diese Welt ist die (Vielheit von) Willen zur Macht.. ."* (Die
Problematik..., a. a. O. 39). Der genannte Satz verlangt in der Tat, wie ich in dieser
Abhandlung ausführlich zu zeigen versuche, eine Explikation in die von meinen
Kritikern charakterisierte Richtung. In welchem Sinne Nietzsche von dem Willen zur
Macht als der Welt sprechen kann, soll in den folgenden beiden Abschnitten deutlich
gemacht werden.
Die Folgerung, die Weischedel aus jenem Satz zieht, dieser lege nahe, „daß Nietzsche
die vielen konkreten Willen zur Macht doch schließlich als Manifestationen eines einheit-
lichen, die ganze Wirklichkeit bestimmenden Prinzips denkt", „dies freilich so, daß
dieser umgreifende Wille in einzelnen Willen zur Macht Gestalt gewinnt" (Der Wille
und die Willen, a. a. O. 75), verweist Nietzsches Denken in jene metaphysische Dimen-
sion, die es verlassen hat. Nietzsche verfiele selber jener Verdoppelung der Wirklichkeit,
die er bekämpft: der Wille zur Macht bestünde einmal als Umgreifendes, als Prinzip,
und dann noch in seinen Besonderungen. Weischedel nähert sich andererseits meiner
Auffassung, wenn er schreibt, die vielen Machtwillen seien „darin verbunden, daß sie
alle vom Wesen des Willens zur Macht sind" (a. a. O. 75), der Wille zur Macht habe
„seine Daseinsweise in den konkreten Willen, deren Verfassung er bildet". Er entfernt
sich wieder von ihr, wenn er ausführt, Nietzsche sei „unterwegs von der Metaphysik
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 19
7. ,Wille zur Macht' im Singular
Nietzsche gebraucht den Singular in dreifacher Bedeutung. In der
ersten Bedeutung wird der Wille zur Macht auf das Ganze des Wirklichen
bezogen. Wir haben gehört: Die Welt ist der Wille zur Macht und nichts
außerdem. Das Ganze in seiner Mannigfaltigkeit wird mit dem Namen ,Der
Wille zur Macht" benannt. Worauf weist dabei der Gebrauch des Singulars
hin? Nietzsche bringt mit ihm zum Ausdruck, daß der Wille zur Macht die
einzige Qualität ist, die sich auffinden läßt, was immer man auch in Betracht
zur konkreten Realität" (a. a. O. 76). Damit denkt Weischedel doch die Vielheit von
dem Willen zur Macht als einem sie allererst Gründenden her.
Die Problematik einer Deutung, die den Willen zur Macht als ein Quasi-Subjekt an-
sieht, das sich selber will, tritt in Kösters Auseinandersetzung mit mir deutlich hervor.
Köster findet in meinem „Insistieren auf der Vielheit der Letztgegebenheiten** eine „Ein-
seitigkeit" (Die Problematik ..., a. a. O. 48). Der „im Willen zur Macht zweifellos kon-
stitutive(n) Aspekt der Vielheit" dürfe nicht »auf Kosten des ebenso konsumtiven
Aspekts der Einheit" herausgestellt werden (a. a. O. 41). Im Zuge seiner Deutung eines
Nachlaßfragments aus dem Frühjahr 1888 (das freilich nun erst unzerstückt und voll-
ständig in KGW VIII 3, 49—51, Frgm. 14 [79], vorliegt) kommt er zu dem Resultat:
„Im Willen zur Macht scheint somit die Vielheit der (mit ihm identischen) Quanten
ihren einen Grund zu haben." (a.a.O. 41, Anm. 22) Das erscheint mir fragwürdig.
Die Frage, die hier gestellt werden muß, ist die nach dem Verhältnis von ,Identität*
und ,Grund*. Köster gerät in Gefahr, in einen von Nietzsches Denkvoraussetzungen her
unangemessenen Dualismus abzugleiten, wenn er zwischen den Machtwillen des Indi-
viduums und dem Willen zur Macht unterscheidet. Was für jene gelte, so schreibt er,
könne „nicht ohne weiteres verallgemeinert und auf den Willen zur Macht angewendet
werden". Meine Ausführung, alles Einfache stelle sich als Produkt einer wirklichen
Vielheit dar, gelte zwar „durchaus für Nietzsches Destruktion des Individual willens,
sie gilt aber nicht in gleicher Weise (sie!) für den damit nicht zu verwechselnden (sie!)
, Willen zur Macht*" (a. a. O. 42). Andererseits betont Köster, daß trotz aller Unter-
scheidung die beiden Bestimmungen zusammengehören. Zusammeni/en&en lassen sie
sich ihm zufolge jedoch nicht. Der „Gesamtcharakter der Welt und damit der Wille zur
Macht meldet sich im undenkbaren und gerade so gewollten Zugleich von Eins und
Vielem", wofür „Nietzsche den Begriff des Dionysischen gebraucht" habe. Jedenfalls sei
„die dionysische Identität... von Nietzsche trotz und wegen ihrer Unmöglichkeit ge-
wollt" worden (a. a. O. 42 f.). Trotz des Monitums von Köster (a. a. O. 36, Anm. 16)
kann ich auch hier nicht auf Nietzsches Verständnis des Dionysischen eingehen. In
Kösters Kritik erhält das Dionysische jedenfalls die Funktion, die Gegensätze im ge-
wollten Undenkbaren zur Synthese zu bringen (a. a. O. 36, vgl. bes. auch 57) und von
diesem Undenkbaren her die Ausarbeitung von Nietzsches Gegensätzen als rationali-
stisch abzuqualifizieren (s. dazu im folg. S. 54 ff., Anm. 188).
Wenn Köster sich bei seiner Unterscheidung zwischen dem Willen zur Macht und den
Willen zur Macht Nietzsches Gebrauch der Anführungszeichen zuwendet, so steht die
Art seiner Argumentation in Kontrast zu der Subtilität ihres Gegenstandes. Er weist
darauf hin, daß Nietzsche an zwei von mir zitierten Stellen den Plural in Anfüh-
rungszeichen setzt, während der Singular nicht in ihnen steht (a. a. O. 48 f., Anm. 33).
Dies sei „die Feinheit, auf die hier zu achten gewesen wäre". Wenn Köster nun schreibt,
es sei „auch sonst fast durchgehend in den anderen Nachlaßtexten... der Begriff des
Willens zur Macht zunächst singularisch gebraucht und nicht in Anführungszeichen ge-
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
20 Wolfgang Müller-Lauter
zieht.60 Wir müssen uns aber davor hüten, die Qualität in irgendeiner Weise
zu substantialisieren, sei diese Weise auch noch so sublim. Es gibt die Quali-
tät nicht als etwas Für-sich-bestehendes, nicht als Subjekt oder Quasi-
Subjekt, auch nicht als das Eine, dessen „Hervorbringungen" erst die kom-
plexen Gebilde von relativer Dauer sind, wie Heidegger ausführt61. Die
einzige Qualität ist vielmehr immer schon in solchen quantitativen Besonde-
rungen gegeben, sonst könnte sie diese Qualität nicht sein. Ist doch jeder
Wille zur Macht auf den Gegensatz zu anderen Machtwillen angewiesen,
um Wille zur Macht sein zu können. Die Qualität ,Wille zur Macht' ist
nicht ein wirkliches Eins; dies Eins besteht weder in irgend einer Weise für
sich, noch ist es gar ,Seinsgrundc. , Wirkliche' Einheit gibt es allein als Orga-
nisation und Zusammenspiel von Machtquanten.
setzt", so ist dies, gelinde gesagt, eine Ubertreibung. Es gibt viele Ausführungen, in
denen Nietzsche den Plural ohne Anführungszeichen gebraucht, und es gibt viele
Stellen, wo er den Singular in Anführungszeichen setzt. Sie hier aufzuzählen, erscheint
mir überflüssig. — Aber auch wenn man von der zitierten, zur Generalisierung tendie-
renden Äußerung Kösters absieht und seine Forderung ernst nimmt, daß die Bedeutung
der von Nietzsche gesetzten Anführungszeichen „nur dann hervortritt, wenn man den
(sc. besonderen) Text als ganzen nimmt", zeigt sich sogleich, daß man den besonderen
Text überschreiten muß, um den Sinn dieser Auszeichnungen zu verstehen (a. a. O. 49).
Ein instruktives Beispiel hierfür bietet Heftrichs Bemühung, die Anführungszeichen, in
die Nietzsche am Beginn des Aphorismus WM 1067 die beiden Wörter „die Welt"
genommen hat, zu interpretieren. Es zeigt sich bald, daß Heftrich weit über den langen
Aphorismus hinausgehen muß: „denn die Anführungszeichen interpretieren heißt na-
türlich, den Begriff ,Welt* bestimmen" (Nietzsches Philosophie, a. a. O. 54). Auch die
Deutung, die mir Köster als Beispiel vorhält — Heideggers Exegese eines Binde-
strichs —, ist nur von einem Verständnis des Willens zur Macht her möglich, das nicht
aus dem interpretierten Aphorismus zu ziehen ist. — Schränkt man Kösters Vorhaltung
noch weiter ein, bezieht man sie nur auf die Stelle, von der seine Argumentation aus-
geht, nämlich auf Nietzsches Rede von „zwei ,Willen zur Macht* im Kampfe", so muß
man feststellen, daß Köster seine eigene Deutung nicht nur aus dem herangezogenen
Aphorismus (WM 401) gewinnt: daß der Wille zur Macht aus dem Widerspruch von
Leben und Nichts „die mannigfachen Gegensätze desjenigen nichtigen Scheins, der
,Welt' geheißen wird, produziert und zugleich vernichtend in sich zurücknimmt" (a. a.
O. 49), ist der Textvorlage nicht zu entnehmen, wie man der genannten Forderung
gemäß erwarten dürfte.
Daß auch meine Deutung der Anführungszeichen in der Wendung von den zwei
, Willen zur Macht* im Kampfe sich aus einem Gesamtverständnis von Nietzsches Den-
ken speist, ist selbstverständlich. Es sind hier wie auch anderwärts mehrere Gründe, die
eine solche Auszeichnung angebracht erscheinen lassen. In diesem Falle: die extreme Ver-
einfachung (worauf ich schon in meinem Buch, a. a. O. 76, hingewiesen habe); die Ver-
deutlichung dessen, daß auch der Wille zum Nichts Wille zur Macht ist; der Sachver-
halt, daß die zwei Willen zur Macht (der Starken und der Schwachen) keine fak-
tischen Machtwillen sind, denkt man sie in ihrer Allgemeinheit und nicht als Besonde-
rungen in Organisationen (dazu oben S. 27 f.). — Warum Nietzsches Philosophie über-
haupt „immer wie eine Philosophie der ,Gänsefüßchen' aussehn" müsse, wie er selbst
schreibt (Nachlaß; GA XIV, 355), bedürfte einer eigenen Erörterung.
60
S. hierzu Vf., Nietzsche, a. a. O. 21 ff.
61
M. Heidegger, Nietzsche, a. a. O. II, 106.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 21
Spricht Nietzsche vom Willen zur Macht als der einzigen Qualität, so
läßt er sehr häufig den Artikel fort. Dadurch wird besonders deutlich, daß
es sich bei dem Machtwillen nicht um ein Prinzip oder ein ens metaphysicum
handelt. Dies geschieht auch in zwei Formulierungen Nietzsches, die be-
sondern gern herangezogen werden, um seine Philosophie in ein metaphy-
sisches Schema zu pressen, in das sie nicht paßt. So spricht er im Zusammen-
hang einer Schopenhauer-Kritik in Jenseits von Gut und Böse von der
„Welt, deren Essenz Wille zur Macht ist"62, und im Nachlaß heißt es (wie
schon eingangs zitiert), „das innerste Wesen des Seins" sei „Wille zur
Macht". Ob Nietzsche nun schreibt: „der Wille zur Macht" oder „Wille zur
Macht", er meint doch immer die einzige Qualität, abgesehen selbstver-
ständlich von den Fällen, in denen er mit der Bezeichnung ,der Wille zur
Macht' einen Machtwillen in seiner besonderen Konstitution herausstellt.
Nun zur zweiten Bedeutung von Nietzsches ,singularischer Redeweise*.
Da der Wille zur Macht die einzige Qualität des Wirklichen ist, kann
Nietzsche den Singular auch im Hinblick auf allgemeine Bestimmungen an-
wenden, mit denen üblicherweise Mannigfaltiges in Bereiche zusammen-
gefaßt wird oder die in irgendeiner sonstigen umfassenden Weise Bedeutung
haben. Als Beispiel sei der Entwurf eines Planes vom Frühjahr 1888 heran-
gezogen, der die Überschrift trägt: „Wille zur Macht. Morphologie." In
dieser Aufzeichnung stellt Nietzsche die Titel zusammen:
„Wille zur Macht als ,Naturc
als Leben
als Gesellschaft
als Wille zur Wahrheit
als Religion
als Kunst
als Moral
als Menschheit"63.
Uns können hier weder die einzelnen Titel noch die Reihenfolge ihrer
Zusammenstellung beschäftigen64. Im Ausgang von dieser Aufzeichnung
62
JGB 186; KGW VI 2, 109.
63
Nadilaß Frühjahr 1888, 14 [72]; KGW VIII 3, 46. — Unmittelbar vor diesem Text
findet sich folgende Aufstellung Nietzsches:
„Wille zur Macht als ,Naturgesetzc
Wille zur Macht als Leben
Wille zur Macht als Kunst
Wille zur Macht als Moral
Wille zur Macht als Politik
Wille zur Macht als Wissenschaft
Wille zur Macht als Religion" (Ebd., 14 [71]).
64
Hier ist vergleichende ,Gänsefüßdien-Philologie' am Platz. Das Wort ,Natur* ist in der
Aufzählung als einziges Wort in Anführungszeichen gesetzt. In der von Nietzsche zu-
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
22 Wolfgang Müller-Lauter
soll deutlich gemacht werden, wie (der) Wille zur Macht nicht verstanden
werden darf. Er ist nicht ein der Welt Zugrundeliegendes, das Leben her-
vorbringt oder sich als Kunst entäußert oder sich als Menschheit verwirk-
licht. Vielmehr sind die von Nietzsche aufgeführten ,Gestaltungenc ihrem
Wesen nach: Wille zur Macht. Dieses Wesen in den verschiedenartigen Be-
reichen' sichtbar zu machen, ist die Aufgabe einer „Morphologie des ,Willens
zur Macht'", von der auch in einem anderen Plan Nietzsches aus der ersten
Jahreshälfte 1888 die Rede ist65. Dies gilt gerade dann, wenn der Wille zur
Macht in bestimmten Ausdrucksweisen (nicht Hervorbringungen!) ver-
borgen bleibt. Aus einem weiteren Entwurf Nietzsches aus dem gleichen
Jahre, der die Überschrift trägt: „Der Wille zur Macht. Versuch einer Um-
werthung aller Werthe", sei ein Teil der Gliederung angeführt. Er zeigt, in
welcher Weise der Wille zur Macht z. B. als Moral und Religion verstanden
werden muß:
„II. Die falschen Werthe.
1. Moral als falsch.
2. Religion als falsch.
3. Metaphysik als falsch.
4. die modernen Ideen als falsch.
///. Das Kriterium der Wahrheit.
1. der Wille zur Macht."66
Moral und Religion sind in ihren überlieferten, das Zeitalter noch
immer bestimmenden Gestaltungen vom Wesen des Willens zur Macht, auch
wenn in ihnen dieses Wesen in einer Verkehrung erscheint. Das Kriterium
für ,falschc und ,wahre ist in dem zu finden, was Wille zur Macht unverdeckt
als Wille mr Macht ist. „In der Steigerung des Machtgefühls" tritt es
zutage67.
Wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Die allgemeinen Gestal-
tungen und Bestimmungen sind nicht nur ,falschc, insoweit in ihnen be-
sondere Inhalte zu Einheiten zusammengefaßt werden. Sie sind schon ihrer
vor niedergeschriebenen Aufzeichnung steht allein das Wort »Naturgesetz* in Anfüh-
rungszeichen. Es liegt daher nahe, ,Natur' im oben zitierten Text als mechanistisch
interpretierte Natur zu verstehen. Dies wiederum würde bedeuten, daß sich auch von
daher eine Deutung der Reihenfolge im Sinne eines Entwicklungsganges eines metaphy-
sisch gedachten Willens zur Macht verbietet. Es liegt hier kein Quasi-Hegelianismus vor.
65
Nadilaß; Frühjahr 1888, 14 [136]; KGW VIII 3, 112. — Nietzsche legt Wert auf die
Feststellung, daß morphologische Darstellungen nichts erklären können, sondern ledig-
lich Tatbestände zu beschreiben in der Lage sind: s. Nachlaß, WM 645; GA XVI,
118 f. und GA XIV, 331.
66
Nachlaß Frühjahr-Sommer 1888, 16 [86]; KGW VIII 3, 311 f.
67
Nachlaß, WM 534; GA XVI, 45. — Zu Nietzsches Wahrheitskriterium s. Vf.,
Nietzsche, a. a. O. 108—115.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 23
Allgemeinheit wegen ,falsdic. Zumindest gilt das, wenn dem Allgemeinen
,Existenze zugesprochen wird. Audi dem Willen zur Macht, gedacht gar als
allgemeines und höchstes Prinzip, kommt keine Existenz zu. Faktisch gibt es
ihn als die einzige Qualität nur in Machtquanten, bzw. als Wesen nur im
unüberblickbar vielfältigen Daß-sein, bzw. als Essenz nur in der Fülle
gegenstrebiger ,Existenzenc.68 „Die ,höchsten Begriffe', das heisst die all-
gemeinsten, die leersten Begriffe", so lesen wir in Götzen-Dämmerung, bil-
den „den letzten Rauch der verdunstenden Realität"69. Solches Allgemeine
ist nur ein Rauch, die Realität besteht im je besonderen Gesamtspiel von
Aktionen und Reaktionen, die innerhalb komplexer Gebilde von Kraft-
68
Heidegger sucht darzulegen, »wie in Nietzsches Metaphysik der Unterschied von
essentia und existentia verschwindet, warum er verschwinden muß im Ende der Meta-
physik, wie gleichwohl so die weiteste Entfernung vom Anfang erreicht ist" (Nietzsche,
a. a. O. II, 476). Im Zusammenhang seiner metaphysikgeschichtlichen Betrachtungen
versteht Heidegger den Willen zur Macht als essentia, die ewige Wiederkehr des
Gleichen als existentia. Eine solche Zuordnung ist Nietzsches Denken unangemessen,
worauf hier jedoch nicht weiter eingegangen werden kann. Für das hier zu Erörternde
ist wesentlich, daß schon hinsichtlich des Willens zur Macht das Verhältnis Essenz -
Existenz bedacht werden muß. Zwar scheint auch dabei der Unterschied zu verschwin-
den: zumindest zeugen die herrschenden Nietzsche-Deutungen dafür. Wenn es sich um
ein „Verschwinden" handelt, dann gilt allerdings Heideggers im zitierten Zusammen-
hang vorgebrachter Satz, daß sich ein solches Verschwinden „nur zeigen" lasse, „indem
versucht wird, den Unterschied sichtbar zu machen". Dies soll oben versucht werden.
Zum Verständnis des Wesens des Willens zur Macht im metaphysischen Sinne faßt
Heidegger einige Bestimmungen des Willens, die sich bei Nietzsche auffinden lassen, zu-
sammen : „Wille als das über sich hinausgreifende Herrsein über..., Wille als Affekt
(der aufregende Anfall), Wille als Leidenschaft (der ausgreifende Fortriß in die Weite
des Seienden), Wille als Gefühl (Zuständlichkeit des Zu-sich-selbst-stehens) und Wille
als Befehl". Zu recht lehnt es Heidegger ab, aus diesen und weiteren möglichen Be-
stimmungen „eine der Form nach saubere Definition', die all das Angeführte aufsam-
melt, herzustellen". (Nietzsche, a. a. O., I, 70 f.) Auch im Fortgang dieser Untersuchung
wird auf ,Definitionen' verzichtet: mit ihnen verfiele man der von Nietzsche unter-
laufenen Logik. Was die von Heidegger genannten Bestimmungen angeht, so interessiert
hier vor allem die erste. Wie ist das über sich hinausgreifende Herrsein zu verstehen?
Heidegger deutet es als Sz'c&übermächtigen des Willens. Das „eine einheitliche Wesen
des Willens zur Macht regelt die ihm eigene Verflechtung. Zur Ubermächtigung gehört
solches, was als jeweilige Machtstufe überwunden wird, und solches, was überwindet.
Das zu Überwindende muß einen Widerstand setzen und dazu selbst ein Ständiges sein,
das sich hält und erhält. Aber auch das Überwindende muß einen Stand haben und
standhaft sein, sonst könnte es weder über sich hinausgehen, noch in der Steigerung
ohne Schwanken und seiner Steigerungsmöglichkeit sicher bleiben." (A. a. O. II, 269 f.)
Das Überwindende bedarf des Widerstands des zu Überwindenden. Hierin stimme ich
mit Heidegger überein. Wenn er jedoch das faktische Gegenspiel von Übermächtigenden
und zu Übermächtigenden als Stufengang ,eines Einheitlichen* begreift (s. z. B. a. a. O.
II, 36 und 103), so erhebt er das Wesen des Willens zur Macht zu einem absoluten
Seienden, das sich aus sich selbst zur Vielheit entfaltet und gleichwohl in sich bleibt.
Damit aber wird Nietzsches Gedanke verfehlt.
69
GD, Die „Vernunft" in der Philosophie 4; KGW VI 3, 70.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
24 Wolfgang Müller-Lauter
Zentren gesteuert werden.70 Hiervon ist auszugehen, bei ihnen der Anfang
zu machen. Eine der ,Idiosynkrasien der Philosophene besteht aber darin,
„das Letzte und das Erste zu verwechseln. Sie setzen Das, was am Ende
kommt (sc. die ^ochsten' und allgemeinsten Begriffe) — leider! denn es
sollte gar nicht kommen! ... an den Anfang als Anfang." Stützt man sich
auf die Vernunft (soweit diese nicht dem historischen Sinn Rechnung trägt
und das zu Ende denkt, was die Sinne bezeugen), so bleibt man bei der
„Missgeburt und Noch-nicht-Wissenschaft" stehen, was da heißt bei „Meta-
physik, Theologie, Psychologie, Erkenntnistheorie". Oder bei „Formai-
Wissenschaft, Zeichenlehre: wie die Logik und jene angewandte Logik, die
Mathematik." Nietzsche sagt von diesen sich in verschiedenen inhaltlichen
oder formalen Bestimmungen allgemeiner Art bewegenden Disziplinen: „In
ihnen kommt die Wirklichkeit gar nicht vor".71
Auch im Hinblick auf diejenigen ,allgemeinen Bestimmungen* (im Rah-
men dieser Ausführungen muß es bei diesem undiiferenzierten Ausdruck
bleiben), die nicht — als eigentlich entbehrlich — ,am Endec kommen, son-
dern die für menschliches Existieren unentbehrlich geworden sind, spricht
Nietzsche von Unwirklichkeit und Falschheit': „Ehemals nahm man die
Veränderung, den Wechsel, das Werden überhaupt als Beweis für Schein-
barkeit ... Heute umgekehrt sehen wir, genau so weit als das Vernunft-
Vorurteil uns zwingt, Einheit, Identität, Dauer, Substanz, Ursache, Ding-
lichkeit, Sein anzusetzen, uns gewissermaassen verstrickt in den Irrthum,
necessitirt zum Irrthum; so sicher wir auf Grund einer strengen Nachrech-
nung bei uns darüber sind, dass hier der Irrthum ist."72 Auch hier ist das
,Falsdiec Umwandlung des wahren Wesens des Willens zur Macht. Dieses
wahre Wesen kann jedoch in allem Umgewandelten, ja noch als Bedingung
von Möglichkeit und Notwendigkeit solcher Umwandlung aufgewiesen
werden. Dies wird in einer anderen Aufzeichnung Nietzsches deutlich. Sie
nennt:
„,Zweck und Mittel·
,Ursache und Wirkung" als Ausdeutungen (nicht als Thatbestand) und
,Subjekt und Objekt" inwiefern vielleicht nothwendige Ausdeutun-
,Thun und Leiden" gen? (als ,erhaltendec) — alle im Sinne eines
,Ding an sich und Willens zur Macht."73
»Erscheinung"
Betrachtet man etwas als Zweck oder als Mittel zu einem Zweck, so
hat man keinen Tatbestand vor Augen, man nimmt eine Ausdeutung vor.
70
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [184]; KGW VIII 3, 162 f. (WM 567).
71
GD, Die „Vernunft" in der Philosophie 4 und 3; KGW VI 3, 70.
72
Ebd. 5; KG W VI 3, 71.
73
Nachlaß, WM 589; GA XVI, 91.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 25
Audi wenn Machtwollen eine solche Ausdeutung ernötigt, so erhält das
Ausgedeutete damit nicht die Dignität von Wirklichem.74
Im zuletzt zitierten Text spricht Nietzsche von einem Willen zur
Macht. Damit geraten wir in die Problematik der dritten Bedeutung, die
der Singular bei ihm erhält. Ein Wille zur Macht ist ein besonderer, von
anderen unterschiedener Machtwille. In der herangezogenen Aufzeichnung
ist offenkundig vom Menschen als einem Willen zur Macht die Rede. Wille
zur Macht meint hier nicht nur die Essenz der Wirklichkeit als soldier,
sondern ein Wirkliches in seiner Wirklichkeit. Oft, besonders häufig in
kurzen Nadilaßaufzeidmungen, ist nicht eindeutig zu unterscheiden, ob
Nietzsche dieses oder jene meint. Nicht selten geht er in seinen Erörterun-
gen vom einen zum anderen über. Ich ziehe ein Beispiel hierfür aus einem
Text heran, in dem u. a. die schon angeschnittene Frage nach der Weise des
Gegebenseins von ,Zweckf behandelt wird. Nietzsche schreibt, „daß alle
,Zwecke*, ,Zielec, ,Sinnec nur Ausdrucksweisen und Metamorphosen des
Einen Willens sind, der allem Gesdiehen inhärirt: der Wille zur Macht...
(und) daß der allgemeinste und unterste Instinkt in allem Thun und Wollen
eben deshalb der unerkannteste und verborgenste geblieben ist, weil in
praxi wir immer seinem Gebote folgen, weil wir dies Gebot sind.. ,"75 Der
Übergang ist hier leicht aufzufinden. Bis zum letzten Komma in der zitier-
ten Passage wird von der Wesensallgemeinheit des Willens zur Macht ge-
sprochen. Wenn es anschließend heißt, daß wir selbst Wille zur Macht ,als
Gebot' sind, so denkt Nietzsche existierende ,Seiende* als Willen zur Macht.
In dieser Bedeutung ist selbstverständlich nicht nur der Mensch, sondern jede
organisierte Einheit von Maditquanten ein Wille zur Macht. So notiert
Nietzsche: „Die größere Complicirtheit, die scharfe Absdieidung, das
Nebeneinander der ausgebildeten Organe und Funktionen, mit Verschwin-
den der Mitglieder — wenn Das Vollkommenheit ist, so ergibt sich ein
Wille zur Macht im organischen Process, vermöge deren herrschaftliche,
gestaltende, befehlende Kräfte immer das Gebiet ihrer Macht mehren
und innerhalb desselben immer wieder vereinfachen: der Imperativ
wachsend."76
Wenn Nietzsche in solcher Weise von einem Willen zur Macht spricht,
so setzt er mit der singularisdien Rede den Plural als gegeben voraus. Dies
gilt natürlich auch für diejenigen Äußerungen, in denen er ,Wille zur Macht'
mit einem Possessivpronomen verbindet. So ist z. B. jedes Volk durch seinen
74
Nietzsche nennt die ,anscheinende Zweckmäßigkeit* auch einmal „die Folge... (des)
Willens zur Macht" (Nachlaß Herbst 1887, 9 [91]; KGW VIII 2, 50; WM 552).
75
Nachlaß Nov. 1887 — März 1888, 11 [96]; KGW VIII 2, 286 f. (WM 675).
76
Nachlaß, WM 644; GA XVI, 118.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
26 Wolfgang Müller-Lauter
besonderen Willen zur Macht ausgezeichnet. Zarathustra sagt, daß über
jedem Volke eine Gütertafel als die Tafel seiner Überwindungen hänge: sie
sei „die Stimme seines Willens zur Macht".77 In einer nachgelassenen Auf-
zeichnung schreibt Nietzsche, ein Volk, das noch an sich glaube, verehre „die
Bedingungen, durch die es obenauf ist", durch Projektion seines Macht-
gefühls in seinen Gott. Dieser stellt „die aggressive und machtdurstige Seele
eines Volkes, seinen Willen zur Macht dar".78 Wir dürfen uns durch das
Possessivpronomen nicht in die Irre führen lassen: die Völker ,besitzenc ihre
unterschiedlichen Machtwillen nicht neben anderem, was ihnen noch eigen-
tümlich wäre. Sie sind besondere Machtwillen — und nichts außerdem. Dies
gilt für alles, dem Nietzsche Wirklichkeit zuspricht. Jedes Spezifische" ist
das, was es ist, allein als ,seinc Wille zur Macht. Nietzsche führt im Zusam-
menhang einer Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Naturwissen-
schaft aus, „daß jeder spezifische Körper darnach strebt, über den ganzen
Raum Herr zu werden und seine Kraft auszudehnen (— sein Wille zur
Macht:) und Alles das zurückzustoßen, was seiner Ausdehnung widerstrebt.
Aber er stößt fortwährend auf gleiche Bestrebungen anderer Körper und
endet, sich mit denen zu arrangiren (,vereinigen'), welche ihm verwandt
genug sind: — so conspiriren sie dann zusammen zur Macht. Und der
Prozeß geht weiter .. ,"79. Ein Wille zur Macht in diesem Sinne ist eine sich
gegenüber anderen Machtwillen besondernde Organisation von Macht-
quanten. Die Besonderung ist in sich immer schon ein Zurückstoßen des
Widerstrebenden, sie ermöglicht die Überwältigung wie die Unterwerfung,
die Einverleibung und das Arrangement in bezug auf anderes, das sich
besondert. Sich sondern und in der Sonderung sich agierend und reagierend
beziehen auf das andere sich Sondernde: auf diese Weise vollzieht sich alles
Geschehen.
Uns ist „keine Veränderung vorstellbar, bei der es nicht einen Willen
zur Macht giebt", schreibt Nietzsche. Und damit wir nicht meinen, hier sei
vom ,einzigenc Willen zur Macht die Rede, müssen wir weiterlesen: „Wir
wissen eine Veränderung nicht abzuleiten, wenn nicht ein Übergreifen von
Macht über andere Macht statt hat."80 Hat ein Wille zur Macht „die Über-
macht über eine geringere Macht erreicht", so arbeitet „letztere als Funktion
der grösseren"81.
Die Rede von einem Willen zur Macht, der sich einen anderen unter-
wirft, ist natürlich eine Vereinfachung. Daß ein Wille zur Macht jeweils
77
Za I, Von tausend und Einem Ziele; KGW VI l, 70.
78
Nachlaß Mai-Juni 1888, 17 [4]; KGW VIII 3, 321.
79
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [186]; KGW VIII 3, 165 f. (WM 636).
80
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [81]; KGW VIII 3, 52 (WM 689).
81
Nachlaß Herbst 1887, 9 [91]; KGW VIII 2, 50 (WM 552).
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 27
ein hierarchisch strukturiertes Gefüge vieler besonderer Machtwillen dar-
stellt, hat Nietzsche in seinen Ausführungen zum menschlichen Leib beson-
ders eindringlich dargelegt.82 „Man kann es nicht zu Ende bewundern",
schreibt er, „wie eine solche ungeheure Vereinigung von lebenden Wesen,
jedes abhängig und unterthänig und doch in gewissem Sinne wiederum be-
fehlend und aus eigenem Willen handelnd, als Ganzes leben, wachsen und
eine Zeit lang bestehen kann"83. Wieder werden wir von dem ,Einen* auf die
,Vielenc verwiesen, die in sich selber je organisierte und instabile Einheiten,
ohne einen beständigen Seinskern, sind. „Auch jene kleinsten lebendigen
Wesen, welche unseren Leib constituiren ..., gelten uns nicht als Seelen-
Atome, vielmehr als etwas Wachsendes, Kämpfendes, Sich-Vermehrendes
und Wieder-Absterbendes: sodass ihre Zahl unbeständig wechselt." Um die
gründende Wirklichkeit der Vielheit für all das, was sich als Einheit ,zu be-
deuten gibtc, vollends deutlich zu machen, hat Nietzsche dem zitierten Satz
eine Parenthese eingefügt. Er spricht von „jene(n) kleinsten lebendigen
Wesen, welche unseren Leib constituiren (richtiger: von deren Zusammen-
wirken Das, was wir ,Leibc nennen, das beste Gleichniss ist —)".84
Was Nietzsche jeweils einen Willen zur Macht nennt, ist faktisch
Gegenspiel und Zusammenspiel von vielen in sich ebenfalls zu Einheiten
organisierten Willen zur Macht. Und jener Wille ist seinerseits in das
Gegen- und Miteinander eines umfassenderen Machtwillens eingefügt. So
bildet z. B. ein Mensch ein Machtquantum, das zahllose Machtquanten in
sich organisiert. Er selber gehört in Gegensatz zu und im Verein mit anderen
Menschen umfassenderen ,Organismenc an. Die Frage stellt sich, welcherart
das äußerste Organisierte, der weitestgespannte Wille zur Macht ist. Als
„die letzten Organismen, deren Bildung wir sehen", nennt Nietzsche:
Völker, Staaten, Gesellschaften.85 Im Unterschied zu den ,allgemeinen
Gestaltungen und Bestimmungen', die nur Ausdrucksweisen, Ausdeutungen,
,Folgenc oder ,Anzeidienc86 des Willens zur Macht darstellen, sind sie wirk-
liche Herrschaftsgebilde. Da in ihnen, als existierenden Organismen, das
Wesen des Willens zur Macht in faktischem Daß-sein gegeben ist, können
die genannten letzten und höchsten Organismen „zur Belehrung über die
82
„Am Leitfaden des Leibes" — wie Nietzsche oft formuliert — sollen wir am besten
erfahren können, was wir selbst sind. Dieser sei im Vergleich mit dem Geist „das viel
reichere Phänomen, welches deutlichere Beobachtung zuläßt" (Nachlaß, WM 532, vgl.
492; GA XVI, 44, vgl. 18).
83
Nachlaß; GA XIII, 247 f.
84
Nachlaß; G A XIII, 248 f.
85
Nachlaß Frühjahr-Herbst 1881, 11 [316]; KGW V 2, 461.
8e
GM II, 12; KGW VI 2, 330.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
28 Wolfgang Müller-Lauter
ersten Organismen benutzt werden".87 Ist hier doch eine Ruck-Übersetzung
des falschen Allgemeinen in das wahre Besondere nicht nötig. Das Wesen
von Besonderung in der Weise von Organisation, wie es für alle Macht-
quanten konstitutiv ist, läßt sich an den Makro-Organismen leichter heraus-
arbeiten als an den ,kleineren Einheiten'.
Mögen nun auch im Hinblick auf menschliche Organisationsformen die
drei genannten Gebilde die ,letztene sein, so bleibt doch die Frage, ob nicht
die Wirklichkeit im Ganzen, die Welt, organisierte Wirklichkeit ist. Fände
die Frage eine bejahende Antwort, dann müßte noch einmal die Möglich-
keit der Existenz des Willens zur Macht als des Wirklichkeitsgrundes ge-
prüft werden.
Wir sind von zwei Behauptungen Nietzsches ausgegangen: die Welt
sei Eins und Vieles; die Welt sei der Wille zur Macht und nichts außerdem.
Wir haben dann der Vermutung Raum gegeben, daß auch der Wille zur
Macht Eins und Vieles sei. Das Ergebnis unserer bisherigen Überlegungen
lautet: Es existiert nur eine Vielheit von Willen zur Macht. Der Wille zur
Macht ist eine essentielle Bestimmung. Wirkliche Einheit kommt einem
Willen zur Macht allein als Zusammenspiel im Gegensatz zu anderen
Machtwillen zu. Im folgenden soll die erste Behauptung Nietzsches themati-
siert werden: die Welt sei Eins und Vieles.
8. Die vielen Welten und die eine Welt
In dem herangezogenen Satz bedeutet ,Welt£ das, was man das ,A11 des
Seiendenc oder das ,Seiende im ganzen" zu nennen pflegt. Nun ist dies nicht
die einzige Bedeutung von Welt in der Philosophie Nietzsches. So schreibt
er: „Das Ganze der organischen Welt ist die Aneinanderfädelung von
Wesen mit erdichteten kleinen Welten um sich: indem sie ihre Kraft, ihre
Begierden, ihre Gewohnheiten in den Erfahrungen ausser sich heraussetzen,
als ihre Aussenwelt."ss Welt ist demzufolge einmal ein Ganzes: Welt des
87
Nachlaß Frühjahr-Herbst 1881, 11 [316]; KGW V 2, 461. — Nietzsche spricht von
den letzten Organismen im Plural: Völker, Staaten, Gesellschaften. Bedarf doch jeder
Wille zur Macht eines Gegenwillens, um Wille zur Macht sein zu können. Über den
genannten drei letzten Gebilden noch ein allerletztes als faktisch bestehend anzunehmen,
verbietet sich daher. So kann Nietzsche sagen: „Die Menschheit* avancirt nicht, sie
existirt nicht einmal" (Nachlaß Frühjahr 1888, 15 [8]; KGW VIII 3, 202; WM 90).
Daß er den Ausdruck »Menschheit* häufig bei der Darstellung seiner eigenen Anliegen
verwendet (z. B. im Sinne von Masse, von Summe aller Menschen, von Wesen des
Menschen) muß hier unerörtert bleiben. Die Menschheit ist jedenfalls für ihn kein
Organismus und damit nicht ein Wille zur Macht.
88
Nachlaß; GA XIII, 80.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 29
Organischen. Wenn wir in der gleichen Niederschrift lesen, „dass es keine
unorganische Welt giebt", so können wir unter ,Weltc als Welt des Orga-
nischen das Ganze der Wirklichkeit verstehen. Zum anderen ist in der Auf-
zeichnung von den erdichteten kleinen Welten der besonderen Wesen die
Rede. Die Vermutung liegt nahe, solche Erdichtungen hätten kein besonde-
res Gewicht. Wesentlich scheint allein der erstgenannte ,Weltbegriffc zu
sein. Wenn wir jedoch hören, daß das in ihm gefaßte Ganze die Anein-
anderfädelung der Wesen mit den ,kleinen Welten' bildet, so werden wir
doch wieder von jenem an diese gewiesen. Und wenn wir uns daran er-
innern, daß Nietzsche die ,kleinste Weltc das überall-Entscheidende nennt89,
so ist es wohl sinnvoll, die Frage nach Nietzsches Verständnis von Welt von
diesem Entscheidenden her zu entfalten.
Die Rede von den kleinen und kleinsten Welten erwächst aus Nietz-
sches Willen-zur-Macht-Pluralismus. „Jedes Kraftcentrum hat für den
ganzen Rest" der Kräfte, zu denen es sich verhält, „seine Perspektive d. h.
seine ganz bestimmte Werthung, seine Aktions-Art, seine Widerstandsart".
Ein solches perspektivisch wertendes Agieren und Reagieren konstituiert
jeweils „eine Welt". Dem Einwand, auf diese Weise gelange man immer nur
zu scheinbaren Welten, hält Nietzsche entgegen: „Als ob eine Welt noch
übrig bliebe, wenn man das Perspektivische abrechnete! Damit hätte man ja
die Relativität abgeredinet."90 Die Relativität aber gehört wesenhaft zu
den sich gegeneinander organisierenden Willen zur Macht. So lebt infolge
der unaufhebbaren Perspektivität „jedes von uns verschiedene Wesen ... in
einer anderen Welt, als wir leben"91. Kann nur von perspektivischen Welten
gesprochen werden, so löst sich das Problem ihrer angeblichen Scheinbarkeit
auf. Nietzsche stellt die Frage: ,,/5i für uns die Welt nicht nur ein Zusam-
menfassen von Relationen unter einem Maaße?" Der nächste Satz enthält
die bejahende Antwort: „Sobald dies willkürliche Maaß fehlt, zerfließt
unsere Welt."92 Wenn es keinen ,absoluten Maßstab' gibt, dann „bleibt kein
Schatten von Recht mehr übrig,... von Schein zu reden".93
Die Entfaltung der Welt-Problematik scheint zu dem gleichen Ergebnis
zu führen wie die Erörterung des Willens zur Macht. Vom Singular werden
wir auf den Plural verwiesen. Nehmen wir Nietzsches Ausführungen zur
Perspektivität ernst, so bleibt uns unverständlich, mit welchem Recht er
noch von der Welt sprechen kann. Müssen wir nicht folgern: es gibt nicht
die Welt, es gibt nur Welten? Doch Nietzsche gebraucht den Ausdruck ,die
89
Vgl. S. 17.
90
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [184]; KGW VIII 3, 162 f. (WM 567).
91
Nachlaß, WM 565; GA XVI, 65.
92
Nachlaß Frühjahr-Herbst 1881, 11 [36]; KGW V 2, 352.
93
Nadilaß Frühjahr 1888, 14 [184]; KGW VIII 3, 163 (WM 567).
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
30 Wolfgang Müller-Lauter
Weltc immer wieder im Sinne von Wirklichkeit im ganzen. Am Anfang
dieses Abschnittes haben wir auch ein Beispiel dafür herangezogen, daß er
das Verhältnis der vielen kleinen Welten zur Welt als ganzer bedenkt. Wir
müssen daher versuchen, dieses Verhältnis zu klären.
Dabei ist festzuhalten, daß wir unsere Perspektivik nicht in Abzug
bringen können, um auf diese Weise die Welt übrig zu behalten. „Die Welt,
abgesehen von unserer Bedingung, in ihr zu leben, ... existirt nicht als Welt
,an sich'".94 Setzen wir nun voraus, es gebe die Welt als das Ganze von
Wirklichkeit, so können wir die Aussage des zitierten Satzes ins Positive
wenden. Zu dieser Welt gehören dann unsere besonderen Lebensbedingun-
gen und damit unsere Perspektiven, wie zu ihr die perspektivisch bestimm-
ten Aktionen und Reaktionen aller Einzelwesen gehören. Wenn Nietzsche
sagt, die ,Weltf sei „nur ein Wort für das Gesammtspiel dieser Aktionen"95,
so bedeutet das, daß er die Welt als „Welt der Kräfte"96 auffaßt. Jede
Kraft entwirft sich zwar eine eigene Welt. Aber dieses je Eigene führt nicht
zur Abkapselung gegenüber den Welten der anderen Kräfte. Ist doch jede
Kraft (d. h. jeder Wille zur Macht) auf die anderen Kräfte in Widerstreit
oder in Akkommodation bezogen. Zwar hat die Welt, „unter Umständen,
von jedem Punkt aus ihr verschiedenes Gesicht". Aber sie bildet doch als das
Aggregat aller Kräfte das ,Materialc für alle besonderen Weltentwürfe.
Nicht aus den „Summirungen" der perspektivischen Welten ergibt sich die
Welt: sind jene doch „in jedem Falle gänzlich incongruent"97. Auch die
,Aneinanderfädelungc, von der oben die Rede war, stellt keinen Zusammen-
hang der besonderen Welten her. Wohl aber ist die Welt die Summe der
Wesen, die Welten erdichten, die Summe der Kräfte, die faktisch gegeben
sind.
Die, Summe der Kräfte ist Nietzsche zufolge begrenzt. „Das Maaß der
All-Kraft ist bestimmt, nichts Unendliches'."98 Er nennt die Welt „eine
feste, eherne Grosse von Kraft, welche nicht grosser, nicht kleiner wird, die
sich nicht verbraucht, sondern nur verwandelt, als Ganzes unveränderlich
gross, ein Haushalt ohne Ausgaben und Einbussen, aber ebenso ohne Zu-
wachs, ohne Einnahmen"99. Nietzsche nimmt nicht nur eine Begrenzung der
Gesamtsumme von Kraft an, sondern auch eine Begrenzung der möglichen
Zahl von Kraftlagen. Er gerät dabei in Widerspruch mit sich selbst: die
94
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [93]; KGW VIII 3, 63 (WM 568).
95
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [184]; KGW VIII 3, 163 (WM 567).
96
Nachlaß Frühjahr-Herbst 1881, 11 [148]; KGW V 2, 396.
97
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [93]; KGW VIII 3, 63 (WM 568).
98
Nachlaß Frühjahr-Herbst 1881, 11 [202]; KGW V 2, 421.
99
Nachlaß, WM 1067; GA XVI, 401.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsdies Lehre vom Willen zur Macht 31
unendliche Teilbarkeit der Kräfte, durch die jeder Gedanke an eine Quasi-
Substantialität der Willen zur Macht ausgeschlossen wird, läßt dem Ge-
danken von unendlich vielen Kräfte-Kombinationen Raum. Nietzsche muß
jedoch eine Begrenzung der Kraftlagen annehmen, wenn denn seine hier
nicht zu erörternde Lehre von der ewigen Wiederkunft des Gleichen kosmo-
logisdie Gültigkeit haben soll.100 Zur Begründung der Begrenztheit notiert
er: „Das unendlich neue Werden ist ein Widerspruch, es würde eine un-
endlich wachsende Kraft voraussetzen. Aber wovon soll sie wachsen! Woher
sich ernähren, mit Überschuß ernähren!"101 Die Argumentation hat Über-
zeugungskraft im Hinblick auf die Unveränderlichkeit der Kraftmenge: Die
Annahme einer unendlich wachsenden Gesamtkraft ist absurd. Doch sind, so
ist hier gegen Nietzsche einzuwenden, unendlich wechselnde Kraftkombi-
nationen innerhalb der gleichbleibenden Kraftmenge keineswegs ausge-
schlossen, wenn denn die Kraftquanten unendlich teilbar sind.
Unsere Frage nach der Welt orientiert sich an der Problematik des
Willens zur Macht. Für sie ist wesentlich, daß Nietzsche seinem Begrün-
dungsversuch hinzufügt, die Annahme, das All sei ein Organismus, wider-
streite dem Wesen des Organischen.102 Und so wenig die Welt als All ein
lebendiges Wesen ist103, so wenig ist sie eine Organisation in irgendeinem
anderen Sinne. Nun haben wir gehört, daß Einheit nur als Organisation
Einheit ist. Deshalb kann Nietzsche vom All nicht als von der einheitlichen
Welt sprechen. Es ist aufschlußreich, daß er in einer späteren Niederschrift
die Möglichkeit zurückweist, die Welt sei das , als Einheit: „Es scheint
mir wichtig, dass man das All, die Einheit los wird". Noch aufschlußreicher
ist die Begründung, die er hierfür gibt. Zu solcher Einheit müßte „irgend
eine Kraft, ein Unbedingtes" gehören. „Man würde nicht umhin können, es
als höchste Instanz zu nehmen und ,Gottc zu taufen." Zur Konstituierung
der Einheit des Alls bedürfte es eines ursprünglich Gründenden, welches die
totale Vielheit organisierte. Damit aber verfiele man dem von Nietzsche
bekämpften metaphysischen Vorurteil. So fordert er: „Man muss das All
zersplittern; den Respekt vor dem All verlernen; Das, was wir dem Unbe-
kannten und Ganzen gegeben haben, zurücknehmen für das Nächste,
Unsere."104 Damit verwirft Nietzsche ausdrücklich den Gedanken, die Welt
könne in dem Willen zur Macht als einem faktisch bestehenden Seinsgrund
verwurzelt sein.
100
Vgl. dazu Vf., Nietzsche, a. a. 0.180 ff.
101
Nachlaß Frühjahr-Herbst 1881,11 [213]; KGW V 2, 423.
102
Ebd. — Vgl. auch Nachlaß; GA XII, 60: „Wenn das All ein Organismus werden
könnte, wäre es einer geworden. Wir müssen es als Ganzes uns gerade so entfernt wie
möglich von dem Organischen denken."
los FW 109; KGW V 2, 145.
104
Nachlaß, WM 331; GA XV, 381.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
32 Wolfgang Müller-Lauter
,Diec Welt ist kein All als Einheit, wenn denn alle Einheit Organisa-
tion ist. Gibt es doch keine sie zu einem Ganzen organisierende Grundkraft.
Von einer Welt zu sprechen hat dann für Nietzsche nur die Bedeutung, daß
er eine begrenzte Kraftmenge annimmt, die in unablässiger Veränderung
begriffen ist. Um begrenzte Kraftmengen handelt es sich auch, wenn
Nietzsche von der organischen Welt, der unorganischen Welt und dgl. in
einem bereichhaften Sinn redet. Solche ,Weltenc existieren nicht für sich,
auch stellen sie keine organisierten Einheiten dar. Es handelt sich dabei
um Einteilungen aus letztlich heuristischen Gründen.
,Die Welt' ist Chaos, wie Nietzsche sagt105: Gesetzlosigkeit von Aggre-
gationen und Disgregationen von Kräften. Da die Welt nicht ein organi-
siertes Ganzes ist, so gibt es auch nicht den Willen zur Macht als das diese
konstituierende ens metaphysicum. Es existieren nur Vielheiten von Willen
zur Macht, der Wille zur Macht existiert nicht.
9. .Die' Willen zur Macht in ,der( Welt
Über das, was einen Willen zur Macht als Willen zur Macht kenn-
zeichnet, ist das Wichtigste bereits gesagt worden. Im folgenden soll Seien-
des in seiner Besonderheit als Machtwille in der Welt aufgewiesen werden.
Alle Seienden werden von Nietzsche als Herrschaftsgefüge, als hierar-
chisch organisierte Machtquanten aufgefaßt. Auch der Mensch ist, wie wir
schon gehört haben, ein solches Gefüge. „Was der Mensch will, was jeder
kleinste Theil eines lebenden Organismus will, das ist ein plus von
Macht."106 Jeder ,Triebc in ihm ist selber ein Wille zur Macht. Jeder ist
„eine Art Herrschsucht, jeder hat seine Perspektive, welche er als Norm
allen übrigen Trieben aufzwingen möchte"107. Triebe schließen sich zusam-
men, um den Gegensatz zu anderen Triebkomplexen auszutragen. Die
Gegensätze der Triebe führen zu unaufhörlichen Verschiebungen der Macht-
konstellationen: „durch jeden Trieb wird auch sein Gegentrieb erregt"108.
Wie in allem, was ist, so muß auch im Menschen „alles Geschehen, alle Be-
wegung, alles Werden als ein Feststellen von Grad- und Kraftverhältnissen,
als ein Kampf"109 gedeutet werden. In diesem Sinne hat Nietzsche^dgs. ego
105
So führt Nietzsche z.B. im Nachlaß (Nov. 1887 —März 1888, 11 [74]; KGW VIII 2,
279; WM 711) aus, „daß die Welt durchaus kein Organism ist, sondern das Chaos".
106
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [174]; KGW VIII 3, 152 (WM 702).
107
Nachlaß, WM 481; GA XVI, 12.
108
Nachlaß; GA XI, 283.
109
Nachlaß Herbst 1887, 9 [91]; KGW VIII 2, 49 (WM 552).
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 33
als „Mehrheit von personenartigen Kräften" beschrieben, „von denen bald
diese, bald jene im Vordergrund" stehe und „nach den anderen wie ein
Subject nach einer einflussreidien und bestimmenden Aussenwelt" hinsehe.
Die Herrschaft innerhalb der Triebkomplexe wechselt: „Der Subjectpunkt
springt herum."110 Dieser darf keineswegs als stabiles Eins verstanden
werden. Es ist nicht angebracht, hinter der Vielheit unserer Affekte „eine
Einheit anzusetzen: es genügt, sie als eine Regentschaft zu fassen"111.
Was für den Menschen gelten soll, trifft nach Nietzsche für alles Leben-
dige zu: im ,Wirklichkeitsbereich' des Organischen gibt es nichts anderes als
komplexe Zusammenhänge von Machtquanten, „eine Vielheit von mitein-
ander kämpf enden Wesen", von denen jedes in seiner besonderen Perspek-
tivität gemeinsam mit anderen Quanten oder in Gegensatz zu ihnen um
Herrschaft innerhalb relativer Einheiten ringt. Unter diesem Aspekt er-
scheint selbst ein Protoplasma „als eine Vielheit von diemischen Kräften"112,
dem jEinheit* nur zukommt, insofern sich die Vielheit als sich abschirmendes
Zusammenspiel ,zu bedeuten' gibt. Vom Menschen bis zum Protoplasma
herab gilt nun, daß das Lebendige infolge der Vielheit der in ihm wirk-
samen Perspektiven das ihm Entgegenstehende in vielfältiger Weise wahr-
nimmt. Was ihm entgegensteht, ist. u. U. nur zeitweise das ihm Entgegen-
stehende. Ein Organismus kann sich das ihm anfänglich Fremde einver-
leiben, ist doch Einverleibung eine Grundweise, in der das Machtwollen
wirksam ist. In jedem Falle bedarf das Machtwollen des ihm Widerstehen-
den. „Der Wille zur Macht kann sich nur an Widerständen äußern; er sucht
nach dem, was ihm widersteht, — dies die ursprüngliche Tendenz des Proto-
plasma, wenn es Pseudopodien ausschickt und um sich tastet. Die Aneignung
und Einverleibung ist vor allem ein Uberwältigen-wollen, ein Formen, An-
und Umbilden, bis endlich das Überwältigte ganz in die Macht des An-
greifers übergegangen ist und denselben vermehrt hat. — Gelingt diese
Einverleibung nicht, so zerfällt wohl das Gebilde; und die Zweiheit er-
scheint als Folge des Willens zur Macht: um nicht fahren zu lassen, was er-
obert ist, tritt der Wille zur Macht in zwei Willen auseinander."113 „Das
110
Nachlaß, GA XI, 235.
111
Nachlaß, GA XIII, 245. — In einer anderen Nachlaßaufzeichnung heißt es zum
Menschen „als Vielheit**: „Es wäre falsch, aus einem Staate nothwendig auf einen ab-
soluten Monarchen zu schliessen (die Einheit des Subjects)" (Nachlaß; GA XIII, 243). —
Nietzsche spricht gelegentlich von einer „Art Aristokratie von ,Zellen' in denen die
Herrschaft ruht" (Nachlaß, WM 490; GA XVI, 16). Er hebt so die Vielheit auch im je
dominierenden Machtwillen hervor.
112
Nachlaß; GA XIII, 227.
113
Nadilaß Herbst 1887, 9 [151]; KGW VIII 2, 88 (WM 656). — Vgl. Nachlaß Frühjahr
1888, 14 [174]; KGW VIII 3, 152 (WM 702).
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
34 Wolfgang Müller-Lauter
sich theilende Protoplasma */2 + */2 nicht = l, sondern = 2", notiert
Nietzsche114.
Wenn die Welt der Wille zur Macht ist und nichts außerdem, so müssen
auch die Vorgänge im unorganischen , Wirklichkeitsbereich' als Machtkämpfe
gedeutet werden. Nietzsche nimmt diese Deutung immer wieder im Zu-
sammenhang seiner Kritik am mechanistischen Denken vor. Daß er diesem
seine „Theorie eines in allem Geschehen sich abspielenden Macht-willens"
entgegenstellt, haben wir schon gelegentlich der Erörterung von Schlechtas
,zweiter Probec vernommen115. In der sachgebotenen Ausführlichkeit kann
hier auf Nietzsches Kritik nicht eingegangen werden. Wir müssen uns auf
einige Hinweise beschränken, aus denen erhellen soll, wie er von seiner
jTheorie' her die des Mechanismus kritisiert.
„Mechanik" reduziert die Welt „auf die Oberfläche", um sie „begreif-
lich" zu machen. Sie ist „eigentlich nur eine Schematisir- und Abkürzungs-
kunst, eine Bewältigung der Vielheit durch eine Kunst des Ausdrucks, —
kein ,Verstehenc, sondern ein Bezeichnen zum Zweck der Verständigung"1™.
Mechanistisches Denken „imaginirt" die Welt so, „daß sie berechnet werden
kann". Es fingiert „ursächliche Einheiten ..., jDinge* (Atome), deren Wir-
kung constant bleibt". Wie hierbei die Übertragung unseres falschen Sub-
jektbegriffs als einer festen Idi-Einheit auf den „Atombegriff" wie auch auf
den „Dingbegriif" erfolgt, so steckt auch unsere vorgetäuschte ,Subjektivitätc
z. B. hinter dem mechanistischen Bewegungsbegriif wie auch dem „Thätig-
keitsbegriff (Trennung von Ursache-sein und Wirken)". Die Mechanik hat
nun nicht nur dieses psychologische Vorurteil zu ihrer Voraussetzung, son-
dern auch das Vorurteil, das uns unsere „Sinnensprache" — vor allem beim
Begriff der Bewegung — unterschiebt. In der mechanistischen Weltdeutung
haben wir „unser Auge, unsere Psychologie immer noch darin".117 Was das
konkret besagt, kann am Beispiel des Begriffs Ursache erläutert werden. In
einem besonders aufschlußreichen Nachlaßtext Nietzsches, aus dem nur
einige Passagen herangezogen werden können, heißt es: „Psychologisch
nachgerechnet, kommt uns der ganze Begriff aus der subjektiven Über-
zeugung, daß wir Ursache sind, nämlich, daß der Arm sich bewegt... wir
114
Nachlaß; GA XIII, 259, vgl. XIV, 325.
115
S. 11 f.
116
Nachlaß; GA XIII, 85.
117
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [79]; KGW VIII 3, 51 (WM 635). — In derselben Auf-
zeichnung (= WM 634) notiert Nietzsche, es mache keinen Unterschied, ob wir von
„der Fiktion eines Klümpchen-Atoms oder selbst von dessen Abstraktion, dem dyna-
mischen Atom", ausgehen. In diesem wird „immer noch ein Ding gedacht, welches wirkt,
— d. h. wir sind aus der Gewohnheit nicht herausgetreten, zu der uns Sinne und
Sprache verleiten."
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 35
unterscheiden uns, die Thäter, vom Thun und von diesem Schema machen
wir überall Gebrauch, — wir suchen nach einem Thäter zu jedem Ge-
schehen ... Wir suchen nach Dingen, um zu erklären, weshalb sich etwas
verändert hat. Selbst noch das Atom ist ein solches hinzugedachtes ,Ding*
und ,Ursubjektc. .. Endlich begreifen wir, daß Dinge, folglich auch Atome
nichts wirken: weil sie gar nicht da sind ... daß der Begriff Causalität voll-
kommen unbrauchbar ist... Es giebt weder Ursachen, noch Wirkungen.
Sprachlich wissen wir davon nicht loszukommen. Aber daran liegt nichts.
Wenn ich den Muskel von seinen ,Wirkungenc getrennt denke, so habe ich
ihn negirt.. ,"118 Wir müssen alle „Zuthaten* unserer irrtümlichen subjek-
tiven Überzeugung „eliminiren", um zu dem zu gelangen, was im mecha-
nistischen Wirklichkeitsverständnis verdeckt ist. Wir finden dann „dyna-
mische Quanta, in einem Spannungsverhältnis zu allen anderen dyna-
mischen Quanten: deren Wesen in ihrem Verhältniß zu allen anderen Quan-
ten besteht, in ihrem ,Wirken" auf dieselben."119 Auch für den unorganischen
,Wirklichkeitsbereich' gilt der Satz, „daß alle treibende Kraft Wille zur
Macht ist". Eine andere Kraft gibt es nicht. Gerade das agierende und
reagierende Treiben, die Mehrung und Minderung von Kräften, werden
als diese „in unserer Wissenschaft" nicht bedacht, das Bedenkenswerte bleibt
hinter dem Ursache-Wirkung-Schema verborgen.120
118
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [98]; KGW VIII 3, 66 f. (WM 551).
119
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [79]; KGW VIII 3, 51 (WM 635).
120
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [121]; KGW VIII 3, 92 (WM 688). — Man darf Nietzsche
nicht mißverstehen, wenn er schreibt: „Der siegreiche Begriff jKraft', mit dem unsere
Physiker Gott und die Welt geschaffen haben, bedarf noch einer Ergänzung: es muß
ihm ein innerer Wille zugesprochen werden, welchen ich bezeichne als ,Willen zur
Macht"* (Nachlaß, WM 619; GA XVI, 104). Deleuze bezeichnet diesen Satz als «un des
textes les plus importants que Nietzsche pour expliquer ce qu'il entendait par
de puissance» (Nietzsche et la philosophic, Paris 19703, 56). Er nimmt
Nietzsches Ausführung, der physikalische Kraftbegriff bedürfe der Ergänzung
(«complement») durch den Willen zur Macht, freilich allzu wörtlich. Zwar schreibt er
zu recht: «La de puissance... n'est jamais separable de teile et teile forces
determines». Es ist ihm auch zuzustimmen, wenn er ausführt: «La volonte de puissance
ne peut pas etre s&p&rie de la force, sans tomber dans Pabstraction metaphysique.»
(A. a. O. 57) Die Problematik seiner Interpretation tritt jedoch zutage, wenn er hinzu-
fügt: «Inseparable ne signifie pas identique», und die Unterscheidung einführt: «La
force est ce qui peut, la de puissance est ce qui veut» (a. a. O. 56). Damit
Differenziert* er, wo Nietzsche nicht Differenziert', nicht differenzieren darf, ohne die
innere Geschlossenheit seines Denkens aufzugeben. Es sei für diesen Zusammenhang
über das schon Ausgeführte hinaus nur noch auf Nietzsches Ausführungen im Aphoris-
mus 36 von Jenseits von Gut und Böse hingewiesen, in denen es darum geht, „alle
wirkende Kraft eindeutig zu bestimmen als: Wille zur Macht". „,Wille* kann natürlich
nur auf ,Wille* wirken..., man muß die Hypothese wagen, ob nicht überall, wo
, Wirkungen* anerkannt werden, Wille auf Wille wirkt — und ob nicht alles mecha-
nische Geschehen, insofern eine Kraft darin thätig wird, eben Willenskraft, Willens-
Wirkung ist" (KGW VI 2, 51). Nietzsche gebraucht den Kraftbegriff in seinen Schriften
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
36 Wolfgang Müller-Lauter
Mit dem Ziel, die Konsequenzen aufzuzeigen, zu denen Nietzsche in
der Ausarbeitung seiner Lehre vom Willen zur Macht getrieben wird, sollen
in diesem Zusammenhang noch zwei Probleme erörtert werden: das der
Wahrnehmung im ,unorganisdien Bereich' und das der Notwendigkeit in
allem Geschehen. Wir wenden uns zunächst dem zweiten zu.
A. Wir beginnen mit einer Frage. Weist uns nicht die ausnahmslose
Anwendbarkeit der ,Naturgesetzec auf eine ursprüngliche Beständigkeit in
allem durch ihre Formeln bestimmten Geschehen? Nietzsche schreibt dazu:
„Die unabänderliche Aufeinanderfolge gewisser Erscheinungen beweist kein
,Gesetzc, sondern ein Machtverhältniss zwischen zwei oder mehreren Kräf-
ten. Zu sagen ,aber gerade dies Verhältniss bleibt sich gleich!" heisst nichts
Anderes als: ,ein und dieselbe Kraft kann nicht auch eine andere Kraft
sein'."121 „Ich hüte mich, von chemischen 3Gesetzen' zu sprechen ... Es han-
delt sich ... um eine absolute Feststellung von Machtverhältnissen: das
Stärkere wird über das Schwächere Herr, soweit dies eben seinen Grad von
Selbständigkeit nicht durchsetzen kann."122 An die Stelle der in den Ge-
setzen ausgedrückten Notwendigkeit tritt bei Nietzsche die Notwendigkeit,
mit der die Kämpfe der Machtquanten verlaufen. Wenn gilt, „daß eine be-
stimmte Kraft eben nichts anderes sein kann, als eben diese bestimmte
Kraft", so bedeutet das, „daß sie sich an einem Quantum Kraft-Widerstand
nicht anders ausläßt, als ihrer Stärke gemäß ist". Und dies wiederum heißt:
in zweierlei Bedeutung: zum einen im Sinne des mechanistischen Vorstellens, zum
anderen im Sinne von ,Wille zur Macht*. Jener muß letztlich genealogisch von diesem
her abgeleitet werden. Zwar kann Nietzsche, wenn er von der mechanistischen Denk-
weise ausgeht, von der Notwendigkeit einer Ergänzung des Kraftbegriffs ,der Physiker*
sprechen, die Deleuze als Forderung nach «addition» (er gebraucht in diesem Zusam-
menhang auch das Wort «ajouter») mit einem ,inneren Willen* versteht (a. a. O. 57).
Nietzsche denkt hier aber in Wahrheit so wenig ,additiv', wie die in einem anderen
Aphorismus (WM 634) verlangte Entfernung des populären mechanistischen Not-
wendigkeitsbegriffes eine bloß subtrahierende Bedeutung hat. Was sich aus der Er-
setzung des mechanistischen Kraftbegriffes durch den Nietzsches für das Verständnis der
Wirklichkeit ergibt, läßt ein fundamentales Neubedenken der Vorgänge in der Natur
unumgänglich werden, wobei keinem ,Restbestand* der Mechanik noch Wahrheit zu-
gesprochen werden kann. Daß Nietzsche damit nicht die Nützlichkeit* der Mechanik
bestreitet, steht auf einem anderen Blatt. Davon wird oben noch die Rede sein.
P. Valadier führt in Bulletin Nietzscheen (Archives de Philosophie 36/1, 1973, 141)
aus, daß die Arbeiten von Deleuze «n'ont pas peu contribue ... a ^interpretation de la
volonte que defend aussi Müller-Lauter». Ich stimme ihm im Hinblick auf die Gemein-
samkeit einiger Tendenzen bei Deleuze und mir in den Erörterungen der Wille-zur-
Macht-Problematik zu; durch seinen Hinweis bin ich überhaupt erst darauf aufmerksam
gemacht worden. Die tiefreichenden Unterschiede der Interpretationen dürfen aber nicht
außer acht gelassen werden. Nur ,exemplarisch* konnte von ihnen hier die Rede sein.
121
Nachlaß, WM 631; GA XVI, 109.
122
Nachlaß, WM 630; GA XVI, 108 f.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 37
„Geschehen und Nothwendig-Gesdiehen ist eine TautoLogie."12* Es scheint
bei der Notwendigkeit zu bleiben, von der auch in der mechanistischen
Theorie die Rede ist, wenn sie von Nietzsche auch anders interpretiert wird.
Daß dies nicht der Fall ist, wird in Nietzsches Bemühen deutlich, den
Geltungsanspruch der Naturgesetze in zweifacher Hinsicht zu bestreiten
(ohne dabei die Anwendbarkeit, ja Nützlichkeit dieser Gesetze in Zweifel
zu ziehen). Erstens wendet er sich gegen die Überzeugung, die Naturgesetze
seien von zeitloser Gültigkeit; zweitens weist er die Auffassung zurück, in
diesen Gesetzen werde Geschehen fundamental erfaßt.
So schreibt er: „Wir können von keinem Naturgesetz* eine ewige
Gültigkeit behaupten, wir können von keiner chemischen Qualität ihr
ewiges Verharren behaupten, wir sind nicht fein genug, um den muth-
maaßlichen absoluten Fluß des Geschehens zu sehen: das Bleibende ist nur
vermöge unserer groben Organe da, welche zusammenfassen und auf
Flächen hinlegen, was so gar nicht existirt."124 Von den chemischen Quali-
täten'125 heißt es an anderer Stelle, daß sie fließen und sich ändern, „mag
der Zeitraum auch ungeheuer sein, daß die jetzige Formel einer Zusammen-
setzung durch den Erfolg widerlegt wird. Einstweilen sind die Formeln
wahr: denn sie sind grob; was ist denn 9 Theile Sauerstoff zu 11 Theilen
Wasserstoff! Dies 9 :11 ist vollends unmöglich genau zu machen, es ist
immer ein Fehler bei der Verwirklichung, folglich eine gewisse Spannweite,
innerhalb deren das Experiment gelingt. Aber ebenfalls innerhalb derselben
ist die ewige Veränderung, der ewige Fluß aller Dinge, in keinem Augen-
blick ist Sauerstoff genau dasselbe wie im vorigen, sondern etwas Neues:
wenn auch diese Neuheit zu fein für alle Messungen ist, ja die ganze Ent-
wicklung aller der Neuheiten während der Dauer des Menschengeschlechts
vielleicht noch nicht groß genug ist, um die Formel zu widerlegen."126 Die
mechanistische Deutung der Wirklichkeit, von den täuschenden Vorurteilen
der Sprache, der Sinne und der ,Psychologiec geleitet, nimmt die fundamen-
talen Veränderungen kleinster und feinster Art nicht zur Kenntnis. Sie
simplifiziert, indem sie stabile Einheiten fixiert, zwischen denen sie Ver-
bindungen konstruiert. Sich im Groben haltend, stellt sie auf der Grundlage
solcher Verbindungen Gesetze fest, denen sie unverrückbare Notwendigkeit
zuspricht. Doch solche ,Notwendigkeitc ist in Wahrheit nicht unverrückbar,
ist überhaupt nicht Notwendigkeit. Unablässiges Anderswerden kommt
noch dem Kleinsten und Feinsten zu. Nichts bleibt dasjenige, was es zu
128
Nachlaß Herbst 1887, 10 [138]; KGW VIII 2, 202 (WM 639).
124
Nachlaß Frühjahr-Herbst 1881, 11 [293]; KGW V 2, 452.
125
Daß es in Wahrheit keine Qualitäten gebe, steht am Schluß des im folgenden zitierten
Textes. Gibt es doch nur die einzige Qualität ,Wille zur Macht*.
12
Nachlaß Frühjahr-Herbst 1881, 11 [149]; KGW V 2, 397.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
38 Wolfgang Müller-Lauter
einem Zeitpunkt ist. Seine Veränderungen überschreiten unter Umständen
auch jene ,gewisse Spannweite", die gegeben sein muß, um ein Gesetz, eine
Formel in Anwendung bringen zu können. Hinter der ,unwahren Not-
wendigkeit" der Mechanik sucht Nietzsche die ,wahre Notwendigkeit" auf-
zuweisen. Sie besteht darin, daß jedes Machtquantum zu jeder Zeit nur eine
bestimmte Konsequenz in seiner Relation zu den anderen Machtquanten
ziehen kann.
5. Auch die unorganischen ,Seiendenc sind Willen zur Macht. Ein
Machtwille sucht z. B. einen anderen Machtwillen zu überwältigen. Zur
Überwältigung gehört eine — je spezifische — Weise von ,Erkennenc des-
jenigen, das überwältigt werden soll. Kein Wille zur Macht ist ein ,blinder
Wille". Daher ist Nietzsche genötigt, ein „Erkennen"127, ein „Wahrnehmen
auch für die unorganische Welt" einzuräumen. In einigen nachgelassenen
Aufzeichnungen finden wir spärliche Andeutungen hierzu. Er sucht ein
solches Wahrnehmen in dessen Unterschied zum Wahrnehmen in der orga-
nischen Welt zu charakterisieren. Dabei geht er so weit zu sagen, „in der
chemischen Welt" herrsche „die schärfste Wahrnehmung der Kraftver-
schiedenheit". Schon ein Protoplasma hat, als Vielheit chemischer Kräfte,
demgegenüber „eine unsichere und unbestimmte Gesammt-Wahrnehmung
eines fremden Dinges". Unsicherheit und Unbestimmtheit rühren daher, daß
die vielen Kräfte „miteinander kämpfende Wesen" sind, deren Gegensätz-
lichkeit auch dann zum Aus trag kommt, wenn das Protoplasma „sich der
Aussenwelt gegenüber fühlt". Die Schärfe der Wahrnehmung, die den
chemischen Kräften als solchen eigen sein soll, liegt in der Sicherheit und
Bestimmtheit. Diese können nur in „festen Wahrnehmungen" gegeben sein,
welche Nietzsche dem Unorganischen in der Tat zuspricht. Insofern Festig-
keit im Sinne von Beständigkeit das Kriterium des traditionellen Wahr-
heitsbegriffes ausmacht, kann er vom Wahrnehmen innerhalb der unorga-
nischen Welt sagen: „da herrscht, Wahrheit"!"128
Ich glaube, man kann eine kaum verhüllte Sehnsucht Nietzsches nach
jener ,Wahrheit" aus diesen und anderen Aufzeichnungen heraushören, nach
der Wahrheit, deren Destruktion doch ein Hauptanliegen seiner Philosophie
bildet. Diese Sehnsucht klingt auch an, wenn er notiert, daß die hinter dem
organischen Leben stehende „unorganische Welt... das Höchste und Ver-
ehrungswürdigste" sei. „Der Irrthum, die perspectivische Beschränktheit"
fehle da. Alles Organische stelle schon „eine Specialisirung" dar. „Der Ver-
lust bei aller Specialisirung" besteht offenkundig im Verlust an Schärfe und
Festigkeit der Wahrnehmungen. Im Mangel an letzteren läge dann die
127
Nachlaß; GA XIII, 230.
128
Nadilaß; GA XIII, 227 f.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 39
perspektivische Beschränktheit', von der Nietzsche spricht.129 „Alles Fühlen
und Vorstellen und Denken" müsse „ursprünglich Eins gewesen sein", heißt
es in einer anderen Aufzeichnung. „Im Unorganischen muß diese Einheit
vorhanden sein: denn das Organische beginnt mit der Trennung bereits."130
Das Eins-sein des Unorganischen bildet die unabdingbare Voraussetzung für
die Festigkeit von dessen Perspektiven. „Alles Organische unterscheidet sich
vom Anorganischen dadurch, dass e s . . . niemals sich selber gleich ist, in
seinen Processen."131 Das Anorganische ist also das sich selber Gleiche. Hier
projiziert Nietzsche selber die Identität in das , Verehrungswürdigste' hinein,
während er sie doch sonst überall als bloße Projektion entlarvt.
Wir dürfen dieser sich ja nur in spärlichen Andeutungen findenden In-
konsequenz Nietzsches nicht allzu großes Gewicht beilegen. Der breit aus-
geführte Grundgedanke Nietzsches ist, daß es kein Eins im Sinne von Be-
ständigkeit gibt. Einheit ist immer nur als Organisation eines Gegen- und
Miteinander von Machtquanten Einheit. Die hierin gegebenen „Relationen
constituiren erst Wesen"132. Wobei immer zu beachten ist: „Daß ein Ding in
eine Summe von Relationen sich auflöst, beweist nichts gegen seine Reali-
tät."133 Dies gilt natürlich auch für die ,kleinstenc unorganischen Einheiten.
Kehren wir noch einmal zu Nietzsches Äußerung über die unorganische
Welt zurück: da herrsche ,Wahrheitc! In derselben Aufzeichnung ist davon
die Rede, daß mit der organischen Welt der ,Scheinc beginne. Wir können
nun Nietzsches Kritik am traditionellen Gegensatzschema Wahrheit —
Schein heranziehen. Für unseren Zusammenhang muß der Hinweis auf ihr
Ergebnis genügen. Indem Nietzsche vom je perspektivischen Überwältigen
ausgeht, wird jede ,Wahrheitc zum ,Scheinc und jeder ,Scheinc zur ,Wahr-
heitc. Am Ende löst sich der Gegensatz auf. Jede Erkenntnis, jede Wahr-
nehmung erweist sich als ,Zurechtmachungc von etwas im Dienste eines je-
weilig dominierenden Willens zur Macht. Die Zurechtmachungen haben die
129
Nachlaß; GA XIII, 228. — Vgl. dazu Nachlaß Frühjahr-Herbst 1881, 11 [70]; KGW
V 2, 366: „Grundfalsche Wertschätzung der empfindenden Welt gegen die todte.
Weil wir sie sind! Dazu gehören\ Und doch geht mit der Empfindung die Ober-
flächlichkeit, der Betrug los... Die ,todte* Welt! ewig bewegt und ohne Irrthum, Kraft
gegen Kraft! und in der empfindenden Welt alles falsch, dünkelhaft! Es ist ein Fest,
aus dieser Welt in die ,todte Welt* überzugehen — und die größte Begierde der Er-
kenntniß geht dahin, dieser falschen dünkelhaften Welt die ewigen Gesetze entgegen-
zuhalten, wo es keine Lust und keinen Schmerz und Betrug giebt... Laßt uns die
Rückkehr in's Empfindungslose nicht als einen Rückgang denken! Wir werden ganz
wahr, wir vollenden uns. Der Tod ist umzudeuten). Wir versöhnen (uns) so mit dem
Wirklichen d. h. mit der todten Welt."
130
Nachlaß; GA XIII, 229.
181
Nachlaß; GA XIII, 231.
132
Nachlaß Frühjahr 1888,14 [122]; KGW VIII 3, 95 (WM 625).
133
Nachlaß Frühjahr-Herbst 1881, 13 [11]; KGW V 2, 518. — Vgl. oben S. 17.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
40 Wolfgang Müller-Lauter
Form von ,Fest-stellungenc des in Wirklichkeit unaufhörlich sich Wandeln-
den. Um zurechtmachende Test-Stellungen des Widerstehenden handelt es
sich bei den Perspektiven des Unorganischen (denen höchstens eine relative
,Festigkeit' zugesprochen werden kann134) ebenso wie bei den Wahrnehmun-
gen ,aus vielen Augen', wie Nietzsche sie in der organischen Welt konsta-
tiert. Alles Seiende stellt fest, und zwar mit Notwendigkeit. Das Fest-
stellen ist ein Grundzug des Willens zur Macht. Nun ändern sich Fest-stel-
lendes und Fest-gestelltes fortlaufend. Will ein fest-stellendes Machtquan-
tum herrschendes Machtquantum bleiben, so muß es auf immer neue Weise
(denn es selbst ändert sich unaufhörlich und damit ändert sich seine Per-
spektivik) das sich ändernde Beherrschte immer neu fest-steilen. Das Wahr-
nehmen aller Willen zur Macht läßt sich formal beschreiben als die Bezie-
hung von Geschehnissen zueinander, die sich nicht als Geschehnisse erfassen
können, sondern sich wechselseitig fixieren, um — dem Geschehen Tribut
zollend — jede Fixierung immer wieder fahren lassen zu müssen.135
Von den Erörterungen zur Wahrnehmung in der unorganischen Welt
ausgehend, haben wir das Fest-steilen als Wesenszug herausgearbeitet, der
allen Willen zur Macht zukommt. Blicken wir auf die , Wirklichkeitsbe-
reiche' zurück, die wir, Nietzsches Ausführungen folgend, durchmustert
haben, so läßt sich sagen, daß wir überall dieselbe Grundgegebenheit
fanden: Prozesse von Aggregationen und Disgregationen der Willen zur
Macht. Es fragt sich, ob angesichts dieses Sachverhalts rechtens von Be-
reichen* gesprochen werden kann. Welche Bedeutung kommt Nietzsches
Unterscheidung der organischen von der unorganischen Welt zu? Keines-
wegs dürfen wir eine qualitative Verschiedenheit solcher Bereiche annehmen.
Das Protoplasma ist als Synthesis chemischer Kräfte nicht etwas essentiell
anderes als die diemischen Kräfte selber. Daß Nietzsche keine Grenzen
zwischen ,den Welten' zieht, zeigt sich selbst dort, wo er in der darge-
stellten problematischen Weise von der Besonderheit des ,unorganischen
Wahrnehmens' spricht. Vom „Übergang aus der Welt des Anorganischen in
die des Organischen" ist da die Rede.136 Wenn er einmal das Organische als
Spezialisierung des Unorganischen faßt und ein andermal ausführt, es gebe
keine unorganische Welt (worauf in anderem Zusammenhang schon ein-
gegangen wurde137), so liegt hierin nur scheinbar ein Widerspruch. Im
134
Ich erinnere an Nietzsdies Hinweis, daß z. B. der Sauerstoff in jedem Augenblick etwas
Neues sei. S. oben S. 37.
135
Zur Problematik, die sich in diesem Zusammenhang für Nietzsches Lehre vom Willen
zur Macht ergibt, s. Vf., Nietzsche, a. a. O. 95—115.
136
Nachlaß; GA XIII, 227.
137
S. S. 28 f.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 41
ersten Falle denkt er ,genealogischc.138Im zweiten Falle wendet er sich gegen
das mechanische Denken: in der unorganischen Welt herrschen nicht Druck
und Stoß, auch in ihr gibt es nur das Gegeneinander von ,Organismenc in
jenem Sinne, in dem auch Volk, Staat, Gesellschaft Organismen sind. Wir
müssen also bei Nietzsche einen engen von einem weiten Begriff des Orga-
nismus unterscheiden. Daß wir uns vor der Annahme hüten müssen, die
,organische Weltc als , Wirklichkeitsbereich' werde umfaßt von der orga-
nischen Welt als Wirklichkeit im ganzen, bedarf nach dem weiter oben Aus-
geführten139 kaum noch der Erwähnung. Die Welt ist nicht organische Welt,
sondern Welt von »Organismen*: das Chaos von fortlaufend sich wandeln-
den Machtorganisationen.
10. Wille zur Macht als Interpretation
Wir haben uns Nietzsches Deutung der Wirklichkeit vor Augen ge-
führt. Nun gibt es viele solcher Deutungen. Vermehrt Nietzsches Philo-
sophie nur ihre Zahl, wie wir schon zu Anfang dieser Abhandlung fragten?
Oder hat sie einen Vorzug gegenüber den anderen? Wir wollen hier nicht
nach einem Vorzug fragen, der ihr von einem anderen Denken her einge-
räumt werden könnte. Es geht uns um Nietzsches Selbstverständnis. Er
selbst erhebt einen Anspruch auf Überlegenheit gegenüber anderen Welt-
deutungen. Indem wir sein Denken auf diesen Anspruch hin befragen,
stoßen wir auf das Problem der Begründbarkeit seiner ,Lehre vom Willen
zur Maditc.
Wir gehen vom Aphorismus 22 in Jenseits von Gut und Böse aus.140
Nietzsche weist dort auf die Unzulänglichkeit der mechanischen Weltdeu-
tung hin. Wir kennen seine Argumente schon und haben sie auf der Grund-
lage anderer Aphorismen und Fragmente, in denen sie eine ausführlichere
Darstellung erfahren, erörtert oder wenigstens genannt141. Für das, worum
es uns hier geht, ist wesentlich, daß er ,den Physikern' schlechte ,Philologiec
vorwirft. Die „Gesetzmäßigkeit der Natur" sei „kein Thatbestand, kein
Text", sondern „Interpretation". Er stellt dieser seine eigene Deutung
138
Damit soll nicht gesagt sein, daß sich in Nietzsches Ausführungen zum Verhältnis
Unorganisches-Organisches nicht Widersprüche fänden. Wird das Organische einmal aus
dem Unorganischen Abgeleitet', so heißt es in einer anderen Niederschrift, das Orga-
nische (im engeren Sinne) sei nicht entstanden (Nachlaß; G A XIII, 232). Auch wird
die jEntwicklung* vom Unorganischen bis zum Menschen manchmal als Aufstieg, manch-
mal als Abstieg aufgefaßt.
139
S. S. 31 f.
140
JGB 22; KGW VI 2, 31.
141
Vgl. oben S. 11 f. und S. 34 ff.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
42 Wolfgang Müller-Lauter
gegenüber: „Es könnte jemand kommen, der, mit der entgegengesetzten
Absicht und Interpretationskunst, aus der gleichen Natur und im Hinblick
auf die gleichen Erscheinungen, gerade die tyrannisch-rücksichtslose und un-
erbittliche Durchsetzung von Machtansprüchen herauszulesen verstünde, —
ein Interpret, der die Ausnahmslosigkeit und Unbedingtheit in allem
, Willen zur Macht* dermaassen euch vor Augen stellte, dass fast jedes Wort
und selbst das Wort ,Tyranneic schliesslidi unbrauchbar oder schon als
schwächende und mildernde Metapher — als zu menschlich — erschiene;
und der dennoch damit endete, das Gleiche von dieser Welt zu behaupten,
nämlich dass sie einen ,nothwendigenc und ,berechenbareni Verlauf habe,
aber nicht, weil Gesetze in ihr herrschen, sondern weil absolut die Gesetze
fehlen, und jede Macht in jedem Augenblick ihre letzte Consequenz zieht."
Nietzsche fügt dieser Ausführung nun noch hinzu: „Gesetzt, dass auch dies
nur Interpretation ist — und ihr werdet eifrig genug sein, dies einzuwen-
den? — nun, um so besser. —"
Der mögliche Einwand der ,Physikerc wird nicht nur hingenommen, er
wird offenkundig angenommen. Wie die mechanistische Theorie ist auch die
Maditwillen-Theorie ,nure Interpretation. Steht nun nicht Interpretation
gegen Interpretation? Muß man dann nicht sagen, daß beide den gleichen
Wahrheitsanspruch erheben dürfen? Doch Nietzsche schreibt, wenn die
Physiker jenen Einwand erhöben, so sei es ,um so besser'. Inwiefern besser,
für wen besser?
Der Einwand kommt Nietzsches Deutung gelegen. Er enthält in dem
,auch... nur* das Zugeständnis, die These von der Gesetzmäßigkeit der
Natur sei Interpretation. Wird dies aber zugestanden, so befindet man sich
auf der Ebene, wo nach dem Interpretieren als solchem gefragt werden
muß. Wer sagt, das und das ist Interpretation, der muß der Frage nach dem,
was Interpretation überhaupt ist, Raum gewähren. Interpretation erweist
sich als selber interpretationsbedürftig. Nun beansprucht Nietzsche, das
Interpretieren angemessen interpretiert zu haben. Jaspers findet bei Nietz-
sche „die Theorie allen Weltseins als eines bloßen Ausgelegtseins, des Welt-
wissens als einer jeweiligen Auslegung", welche Theorie „aus einer Ver-
wandlung der Kantischen kritischen Philosophie" gewonnen sei.142 „Die
endlose Bewegung des Auslegens scheint zu einer Art von Vollendung zu
kommen im Selbsterfassen dieses Auslegens: in der Auslegung der Aus-
legungen"*** „Nietzsches Auslegung, die weiß, daß alles Wissen Auslegen
ist", nehme „dieses Wissen in die eigene Auslegung durch den Gedanken"
hinein, „daß der Wille zur Macht selber der überall wirkende, unendlich
142
K. Jaspers, Nietzsche, a. a. O., 290.
143
A. a. O. 296.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 43
mannigfache Antrieb des Auslegens" sei. „Die Auslegung Nietzsches ist in
der Tat eine Auslegung des Auslegens und dadurch für ihn von allen
früheren, damit verglichen naiven Auslegungen, die nicht das Selbstbewußt-
sein ihres Auslegens hatten, geschieden."144
Bei aller Problematik der Nietzsche-Deutung von Jaspers, in deren
Zusammenhang diese Ausführungen gehören145, ist dies doch richtig ge-
sehen: Alles Wissen ist für Nietzsche Auslegung, alles Wissen um dieses
Wissen ist Auslegung von Auslegung. Wir können nach dem von uns hier
Ausgeführten auch sagen: Die Auslegungen in ihrer Mannigfaltigkeit sind
Interpretationen von Machtwillen; daß sie dies sind, ist ebenfalls Inter-
pretation. Was das genauer besagt und welche Konsequenzen sich daraus
ergeben, soll im folgenden erörtert werden.
Zuerst müssen wir uns die Weite von Nietzsches Interpretations-
Begriff vor Augen führen. Alle Willen zur Macht legen aus, interpretieren.
So sind z. B. auch die perspektivischen Wahrnehmungen des Anorganischen
Interpretationen. Und nicht nur alle Wahrnehmungen, alle Erkenntnisse
und alles , Wissen* sind Auslegungen, sondern auch alle Taten und Aus-
formungen, ja alle Geschehnisse.146 So handelt es sich z. B. „bei der Bildung
eines Organs... um eine Interpretation". „Der Wille zur Macht interpre-
tirt", das besagt jeweils: „er grenzt ab, bestimmt Grade, Machtverschieden-
heiten. Blosse Machtverschiedenheiten könnten sich noch nicht als solche
empfinden: es muss ein wachsenwollendes Etwas da sein, das jedes andre
wachsenwollende Etwas auf seinen Werth hin interpretirt... In Wahr-
heit ist Interpretation ein Mittel selbst, um Herr über etwas zu werden."
Nietzsche fügt hinzu: „Der organische Process setzt fortwährend Inter-
pretiren voraus."147
Die von Nietzsche hier gewählte Ausdrucksweise legt ein Mißverständ-
nis nahe. Man könnte meinen, der Wille zur Macht (ob als ein Machtwille
verstanden oder als der Wille zur Macht im Sinne eines ens metaphysicum
mißdeutet) sei ein Subjekt, von dem das Interpretieren prädiziert werden
könne, das seinerseits die vorgängige Voraussetzung für Prozesse bilde. Wir
dürfen der Verführung der Grammatik nicht erliegen und trennen, was un-
trennbar zusammengehört. So heißt es in einer anderen Aufzeichnung:
„Man darf nicht fragen: >wer interpretirt denn?'". Die Frage ist verfehlt,
144
A. a. O. 299.
145
Auf sie kann hier natürlich nicht eingegangen werden. Für Jaspers' Verständnis von
Nietzsches Auslegung der Auslegung wären insbesondere seine Ausführungen zur Pro-
blematik von ,Wahrheit und Leben* heranzuziehen (Nietzsche, a. a. O. 184 ff.).
146
Vgl. Nachlaß, GA XIII, 64: „Der interpretative Charakter allen Geschehens. Es giebt
kein Ereignis an sich. Was geschieht, ist eine Gruppe von Erscheinungen, atisgelesen
und zusammengefasst von einem interpretirenden Wesen."
147
Nachlaß, WM 643; GA XVI, 117 f.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
44 Wolfgang Müller-Lauter
weil „das Interpretiren selbst... Dasein" hat148; es ist „Dichtung", „den
Interpreten noch hinter die Interpretation zu setzen"149. ,Dasc Interpretieren
hat nicht „Dasein ... als ein ,Seinf" im Sinne von Beständigkeit, sondern
„als ein Process, ein Werden"1™. Wenn wir am Ende des vorigen Abschnitts
das Wahrnehmen der Machtwillen als Relation von Geschehnissen zuein-
ander charakterisiert haben, die sich wechselseitig fest-steilen, so läßt sich
unter dem hier herausgearbeiteten Aspekt sagen, daß sich Machtwillen als
ständig wechselnde Interpretationen gegenüberstehen. Nach alledem wird
deutlich, daß Nietzsche gegen den Positivismus ins Feld führen kann:
„Thatsachen giebt es nicht, nur Interpretationen."151
In den uns inzwischen vertrauten Gedankengängen Nietzsches bewegen
wir uns weiterhin, wenn wir in Rechnung stellen, daß jede Interpretation
perspektivisch ist. Nietzsche, der die philologische Relation Text—Auslegung
gern zur Erläuterung der fundamentalen Wirklichkeitsbezüge gebraucht152,
schreibt, derselbe Text erlaube unzählige Interpretationen153. Denken wir an
die unendliche Teilbarkeit der perspizierenden Machtquanten154, so können
wir nicht überrascht sein, wenn wir in der Fröhlichen Wissenschaft lesen:
„Die Welt ist uns ... noch einmal ,unendliche geworden: insofern wir die
Möglichkeit nicht abweisen können, dass sie unendliche Interpretationen in
sich schliesst."155
Die Perspektivität jeder Interpretation wird nun zum Problem, das
letztlich auf Nietzsches eigenes Philosophieren zurückschlägt, wenn wir be-
denken, daß es unter den unzähligen Auslegungen eines Textes „keine
,richtigec Auslegung" gibt156. Wir haben kein Recht, ein „absolutes Er-
kennen" anzunehmen: „der perspektivische, täuschende Charakter gehört
zur Existenz".157 Dann ist auch jede Weltdeutung nur eine perspektivisch-
täuschende Interpretation, die mechanistische nicht weniger als diejenige,
welche das Weltgeschehen als das Chaos von kooperierenden und mitein-
ander kämpfenden Willen zur Macht versteht. ,Diec Welt, als Summe von
Kräften aufgefaßt, wäre demzufolge eine perspektivische Weltinterpreta-
tion neben zahllosen anderen. Was könnte angesichts der fundamentalen
148
Nachlaß, WM 556; GA XVI, 61.
149
Nachlaß, WM 481; GA XVI, 12.
150
Nachlaß, WM 556; G A XVI, 61.
151
Nachlaß, WM 481; GA XVI, 11.
152
Zum philosophischen „Gleichnis der Auslegung" bei Nietzsche vgl. Jaspers, Nietzsche,
a. a. O. 292 ff.
153
Nachlaß; GA XIII, 69.
154
S. oben S. 16 f.
155
FW (5. Buch) 374; KGW V 2, 309.
156
Nachlaß; GA XIII, 69.
157
Nachlaß; G A XIV, 40.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 45
Relativität allen Weltdeutens zugunsten der , Wahrheit' von Nietzsches
Interpretation angeführt werden?
Nun hat uns Nietzsche selbst ein Kriterium für das angegeben, was er
unter Wahrheit versteht. Es beruht in der Machtsteigerung.158 Unter dieses
Kriterium wird die „unendliche Ausdeutbarkeit der Welt" gestellt. „Jede
Ausdeutung" soll sich dabei als „ein Symptom des Wachsthums oder des
Untergehens" erweisen.159 Dient eine Deutung der Machtsteigerung, so ist
sie im genannten Sinne wahrer als diejenigen, die das Leben bloß erhalten,
erträglich machen, verfeinern oder auch das Kranke separieren und zum
Absterben bringen160. Wir wollen zunächst die mechanistische Weltdeutung,
die Nietzsche ja immer wieder als den wesentlichen zeitgenössischen Wider-
part zu seiner eigenen Philosophie auffaßt161, unter dieses Kriterium
bringen.
In welchem Sinne die mechanistische Denkweise nur „eine Vorder-
grunds-Philosophie" ist162, haben wir uns von Nietzsche schon vorführen
lassen163. Wichtiger noch ist, daß sie falsch ist. Sie schematisiert, kürzt ab,
wählt jBezeichnungen' um der allgemeinen Verständlichmachung willen. Sie
fingiert konstante Einheiten, konstante Wirkungen, Gesetze. Sie imaginiert
die Welt auf Berechenbarkeit hin. Die „gemeinsame Zeichensprache ... zum
Zwecke der leichtern Berecbenbarkeit" dient der Beherrschung der Natur16*.
Hier stutzen wir. Wenn durch die mechanistische Perspektivik eine solche
Beherrschung wirklich wird, die dazu noch ständig wächst, so mag sie zwar
,falsdic sein, insofern in ihr das Geschehen in seinen ,wirklichen Abläufen*
nicht in den Blick kommt. Ist sie aber nicht im Sinne von Nietzsches Wahr-
heitskriterium ,wahrerc als alle früheren Weltdeutungen, da sie die Macht
des Menschen wie keine andere zuvor gesteigert hat und steigert? Von daher
können wir dann verstehen, daß sich Nietzsche gelegentlich anerkennend
über diese Weltdeutung äußert. Sie gilt ihm „nicht als die bewiesenste Welt-
betrachtung, sondern als die, welche die größte Strenge und Zucht nötig
macht und am meisten alle Sentimentalität beiseite wirft". Nietzsche spricht
ihr sogar eine selektive Funktion zu mit Worten, die uns an die , Wirkung*
erinnern, welche seine Lehre von der ewigen Wiederkunft hervorrufen
158
S. S. 22.
159
Nachlaß, WM 600; GA XVI, 95.
160
Nachlaß; G A XIV, 31.
161
»Von den Welt-Auslegungen, welche bisher versucht worden sind, scheint heutzutage
die mechanistische siegreich im Vordergrund zu stehen" (Nachlaß, WM 618; GA XVI,
103).
162
Nachlaß; GA XIII, 82.
163
Dazu und zum folgenden s. oben S. 34 f.
164
Nachlaß; GA XIII, 83 f.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
46 Wolfgang Müller-Lauter
soll165: Die mechanistische Vorstellung sei „zugleich eine Probe für das
physische und seelische Gedeihen: missrathene, willensschwache Rassen
gehen daran zu Grunde".166
Mag die mechanistische Welt-Interpretation auch „eine der dümmsten"
sein, ja mag man mit ihr sogar „dem Prinzip der grosstmöglidien Dumm-
heit" huldigen167, so spricht das doch nicht gegen ihre machtsteigernde
,Wahrheitc. Mag es sich bei ihr auch um eine Oberflächen-Perspektive han-
deln, es bleibt doch „wunderbar, dass für unsere Bedürfnisse (Maschinen,
Brücken usw.) die Annahmen der Mechanik ausreichen". Und mag es sich
dabei um „sehr grobe Bedürfnisse" handeln und „die ,kleinen Fehler*...
nicht in Betracht" kommen168: sind wir mit dieser Interpretation die über
die Natur Herrschenden, so muß es doch unerheblich bleiben, ob die Aus-
legung dumm, grob, fehlerhaft ist.
Hingegen scheint es nicht ausgemacht zu sein, daß die Einsicht, die
Welt sei allein in einer Unendlichkeit perspektivischer Interpretationen der
Willen zur Macht gegeben, für das Machtwollen förderlich ist — ganz ab-
gesehen von der weiter unten noch zu erörternden Frage, wie denn eine
solche Einsicht über den ausschließlichen Perspektivismus möglich sein kann.
Ist die mechanistische Deutung falsch im Sinne von Aufdeckung des wirk-
lichen Geschehens und wahr im Sinne von Nietzsches eigenem Wahrheits-
verständnis, so könnte es sein, daß die Deutung der Welt als Vielheit von
Willen zur Macht zwar in dem Sinne ,wahrc ist, der dem mechanistischen
Weltbild abgesprochen werden mußte, gleichwohl aber verfehlt im Sinne des
Wahrheitskriteriums von Machtsteigerung. Liegt der Gedanke nicht nahe,
daß die Einsicht in die Relativität unserer Interpretationen unser Macht-
streben lahmt, während sich im Nichtwissen um die Relativität unser
Machtwollen unbefangen und gerade deswegen erfolgreich entfalten läßt?
Nietzsche selbst weist oft genug auf die Notwendigkeit von Unwissenheit
oder gar Selbsttäuschung für Zusammenhalt wie Machtmehrung jener Or-
ganisation hin, die der Mensch ist. Zu unserer „Subjekt-Einheit", in der wir
„Regenten an der Spitze eines Gemeinwesens" denken müssen, gehört „die
gewisse Unwissenheit) in der der Regent gehalten wird über die einzelnen
Verrichtungen und selbst Störungen des Gemeinwesens": als Bedingung für
die organisierende Regentschaft. Wir sollen eine Hochschätzung gewinnen
„auch für das Nichtwissen, das Im-Grossen-und-Groben-Sehen, das Ver-
165
Vgl. Nachlaß Frühjahr-Herbst 1881, 11 [336]; KGW V 2, 470: „Die zukünftige
Geschichte: immer mehr wird dieser Gedanke siegen — und die nicht daran Glaubenden
müssen ihrer Natur nach endlich aussterbenl"
166
Nachlaß;GA XIII, 82.
167
FW (5. Buch) 373; KGW V 2, 308. — Nachlaß, WM 618; GA XVI 103.
168
Nachlaß Frühjahr-Herbst 1881, 11 [234]; KGW V 2, 429.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 47
einfachen und Fälschen, das Perspektivische". Insbesondere für unseren
Geist gilt, „dass es für seine Thätigkeit nützlich und wichtig sein könnte,
sich falsch zu interpretiren".169 Der »Psychologe der Zukunft hat zu be-
achten, daß „der große Egoismus unseres dominirenden Willens" von uns
verlangt, „daß wir hübsch vor uns die Augen schließen"170.
Es ist nun zu zeigen, wie sich für Nietzsche letztlich doch, am Maßstab
seines eigenen Wahrheitsverständnisses gemessen, die Bewertung von mecha-
nistischer Theorie und Theorie des Machtwollens umkehrt. In jener sind
nämlich die Naturgesetze die eigentlichen Herren, wir sollen uns als die die-
sen Unterworfenen verstehen. „Dass etwas immer so und so geschieht, wird
hier interpretirt, als ob ein Wesen infolge eines Gehorsams gegen ein Gesetz
oder einen Gesetzgeber immer so und so handelte: während es, abgesehen
vom ,Gesetzc, Freiheit hätte, anders zu handeln. Aber gerade jenes So-und-
nidit-anders könnte aus dem Wesen selbst stammen, das nicht in Hinsicht
erst auf ein Gesetz sich so und so verhielte, sondern als so und so beschaf-
fen."171 „Es ist Mythologie zu denken, dass hier Kräfte einem Gesetz ge-
horchen, sodass infolge ihres Gehorsams wir jedesmal das gleiche Phänomen
haben."172 Nietzsche, der bekanntlich hinter allen geistigen Erscheinungen
der abendländischen Geschichte — und nicht nur dieser — ,Sklaven-Moralc
wittert, findet sie zuguterletzt auch hinter der mechanistischen Weltdeu-
tung: „Ich hüte midi, von chemischen ^Gesetzen* zu sprechen: das hat einen
moralischen Beigeschmack." In Wahrheit wird überall das Stärkere über das
Schwächere Herr, da gibt es keine „Achtung vor ,Gesetzenc".173 Wer sich
aber als der Gesetzen notwendig Gehorchende auffaßt, der erleidet Einbuße
an Gefühl und Bewußtsein eigener Mächtigkeit und damit Einbuße an
dieser selbst.
Demgegenüber will Nietzsdies „neue Auslegung... den zukünftigen
Philosophen als Herrn der Erde die nöthige Unbefangenheit" geben174.
^Nun sdiien gerade der radikale Perspektivismus den Wollenden in die Be-
fangenheit zu führen. Seine jeweilige Auslegung ist relativ, folglich scheint er
als der dies Wissende nur nodi in Gebrodienheit denken und mit geschwäch-
ter Überzeugung handeln zu können. Doch dies ist nur der Fall, so sudit
Nietzsdie zu zeigen, wenn man die Perspektivität nidit in ihrer letzten
Konsequenz bedenkt und auf sidi nimmt. Fassen wir seinen Gedankengang
1W
Nachlaß, WM 492; GA XVI, 17 f.
170
Nachlaß Frühjahr 1888, 14 [27]; KGW VIII 3, 23 (WM 426).
171
Nachlaß, WM 632; GA XVI, 110.
172
Nachlaß, WM 629; GA XVI, 108.
178
Nachlaß, WM 630; GA XVI, 108 f.
174
Nachlaß; GA XIV, 31.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
48 Wolfgang Müller-Lauter
zusammen: Alle Interpretationen sind perspektivisch; es gibt keinen abso-
luten Maßstab, an dem man prüfen könnte, welche ,richtigerc ist und welche
,weniger richtig* ist; das einzige Kriterium für die Wahrheit einer Auslegung
der Wirklichkeit besteht darin, ob und in welchem Maße sie sich gegen
andere Auslegungen durchzusetzen imstande ist. Jede Auslegung hat soviel
Recht, wie sie Macht hat. Die Einsicht in die Perspektivität aller Inter-
pretationen, vor die Nietzsches ,Lehre vom Willen zur Machtc führt, kann
demzufolge den Machtstarken das ,gute Gewissen* für die unbedingte
Durchsetzung ihrer ,Idealec verschaffen. Nur die ,Ideale' anderer Macht-
willen, anderen Perspektiven zugehörig, stehen ihrem Wollen entgegen.
Keine Werte sind ihnen vorgegeben, die sie binden. Würde eine solche
Bindung doch eine feststehende welttranszendente oder weltimmanente
Autorität voraussetzen. Autorität hat aber jeweils nur der überwältigende
Machtwille. So müssen die Starken schließlich auch mit dem Glauben daran,
sie seien Naturgesetzen unterworfen, brechen, indem sie ihn unter das
Wahrheitskriterium der Machtsteigerung bringen. Betrachten wir dies von
einem Grundgedanken Nietzsches her: „Der moralische Gott"175 ist tot.
Aber sein „Schatten" wird noch gezeigt. Ihn gilt es noch zu „besiegen".170
Auch die mechanistische Weltdeutung steht noch in diesem ,Schattenc. Der
,moralische Beigeschmack', der ihren Naturgesetzen anhaftet, verrät es.
Die neue Werte setzende Interpretation künftiger Mächtiger kann
ebenfalls nur perspektivisch sein. Dazu gehört, daß sie abgrenzt und aus-
wählt. Vieles nimmt sie, um ihrer Geschlossenheit willen, nicht zur Kennt-
nis. Das Nichtwissen erhält eine konstitutive Bedeutung für das Inter-
pretieren zugesprochen, es muß sogar zum Nichtwisseme;o//en werden. Audi
das Vergessen ist für das Auslegen der Mächtigen — wie für jede Aus-
legung — wesentlich. Das Wissen um die Perspektivität selber soll nun aber
nicht , vergessen' werden.177 Gibt dieses Wissen doch frei für die unein-
geschränkte Übermächtigung.
Sollen die zukünftigen Philosophen zu Herren der Welt werden, so
muß ihre Interpretation andererseits auch die dazu nötige inhaltliche Weite'
haben. Sie muß die Wirklichkeit in ihrer Ganzheit wie auch in ihren Beson-
derungen auslegen, um nicht hinter den schon vorliegenden Gesamtdeutun-
gen zurückzubleiben und dadurch zu unterliegen. Die anderen Weltdeutun-
gen muß sie als Interpretationen entlarven, die sich selbst nur mißverstehen
können, weil sie sich entweder überhaupt nicht als Interpretationen ver-
stehen oder zumindest das Wesen des Interpretierens nicht durchschauen.
175
Nadilaß, WM 55; GA XV, 183.
176
FW108;KGWV2, 145.
177
S. dazu Vf., Nietzsche, a. a. O. 118 f.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 49
Dies schließt nicht aus, daß sie sich einer anderen Interpretation als eines
Instruments bedienen kann, soweit diese der Machtsteigerung nützt, wie
das bei der Mechanik in Hinsicht auf die Naturbeherrschung der Fall ist. Sie
faßt diese Deutung damit nicht als wahr im Sinne von deren eigenem
Geltungsanspruch auf.
Wenn Nietzsches Philosophie des Willens zur Macht die Wahrheit über
die Wirklichkeit auszusagen beansprucht, so gerät sie also nicht in Wider-
spruch mit dem aus dieser Philosophie selber erwachsenden Wahrheits-
kriterium. Von diesem her gesehen ist sie sogar die einzige konsequente
Weltdeutung. Wir bewegen uns im Zirkel. Solche Zirkelhaftigkeit gehört zu
allem Verstehen. Nietzsche weiß das durchaus, sein Denken wird von
diesem Wissen geleitet. „Der Mensch findet zuletzt in den Dingen nichts
wieder, als was er selbst in sie hineingesteckt hat: — das Wiederfinden heisst
sich Wissenschaft, das Hineinstecken — Kunst, Religion, Liebe, Stolz. In
Beidem, wenn es selbst Kinderspiel sein sollte, sollte man fortfahren und
guten Muth zu Beidem haben — die Einen zum Wiederfinden, die Ändern
— wir Ändern! — zum Hineinstecken!"178 Letzteres besagt natürlich nicht,
daß die Einen nur wiederfinden, was die Anderen nur hineingesteckt haben.
Hineinstecken und Wiederfinden gehören in der jeweiligen Einheit von Aus-
legung zusammen. Wohl aber akzentuiert Nietzsche das Hineinstecken als
das Entscheidende. Das von ihm Geforderte ist ein Hineinstecken im Schaf-
fen neuer Werte. Das Wiederfinden ist nicht nur ein Aufmerksamwerden
auf das Hineingesteckte, sondern darüber hinaus das Entdecken des Hin-
eingesteckten in allem Ausgelegten, das Ausbreiten des Hineingesteckten auf
das Verständnis alles Wirklichen. Entfaltet nun Nietzsches Philosophie, die
künftige Philosophen zu neuen Wertsetzungen ermutigen will, nicht selber
nur das in perspektivischer Interpretation, was sie ursprünglich ,hineinge-
steckt* hat? Kommt in dem, was er schreibt, nicht allein seine besondere
Perspektive zu Wort? Schlägt die von ihm behauptete Relativität aller
Deutungen nicht auf seine eigene Deutung zurück?
Im folgenden versuchen wir, die Zirkelhaftigkeit von Nietzsches Den-
ken aufzuhellen. Es kommt wie bei allem Verstehen darauf an, in den
Zirkel „auf die rechte Weise hineinzukommen", um eine Wendung Heid-
eggers zu gebrauchen179. Daß Nietzsche den Anspruch seiner Philosophie,
die wahre Weltdeutung zu sein, mit dem aus dieser Philosophie selbst erst
entspringenden Wahrheitskriterium begründen kann, haben wir dargestellt.
Diesem Kriterium gemäß muß sich eine Deutung gegen die anderen Welt-
deutungen durchsetzen. Können sich doch nur darin ihre Stärke und ihre
178
Nachlaß, WM 606; GA XVI, 97.
179
M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 19537, 153.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
50 Wolfgang Müller-Lauter
Macht zeigen. Fragen wir genauer nach dem, was Stärke und Macht einer
Deutung besagen, so geraten wir tiefer in den Zirkel hinein. Sie lassen sich
nicht einfach am ,Erfolgc, etwa an der bisherigen Geschichte, ablesen. Ist für
Nietzsche doch die Jahrtausende währende Herrschaft des moralisch be-
stimmten Weltverständnisses nicht Ausdruck von dessen Stärke, sondern das
Zeichen von Schwäche. Das Machtwollen ist hier gerade nicht als das wahre
Machtwollen freigesetzt. Wir müssen Nietzsches eigene Interpretation von
Stärke im Sinne von rückhaltlosem Ubermäditigenkönnen zugrunde legen,
wenn wir den Anspruch seiner Philosophie, sie sei wahrer weil stärker als
die anderen Weltdeutungen, nachvollziehen wollen. Und wieder zeigt sich
der Zirkel, wenn Nietzsche eine ,vormoralische Periode der Mensdiheite an-
nimmt, die die prähistorische Zeit umfassen soll, auf die allererst die mora-
lische Periode folgte. Wir finden hier eine Konstruktion der ,Geschichtec des
Menschen, die aus der Rückwendung zu dem, was anfänglich gewesen sein
soll, die Notwendigkeit künftiger Stärke in einem nachmoralischen Zeit-
alter begründen soll. Diese Stärke wäre dann wahre Stärke.
Jaspers schreibt, bei Nietzsche werde „in einem Zirkel gedacht, der sich
aufzuheben scheint und doch von neuem hervortreibt"180. Der Zirkel kann
nicht aufgehoben werden. Blicken wir auf ihn nur als auf eine formale
Struktur, so bleiben uns Besonderheit und Radikalität von Nietzsches Inter-
pretation verborgen. Bewegen wir uns in ihm, so können diese sichtbar ge-
macht werden. Es gilt herauszuarbeiten, daß Nietzsche nicht nur alles Welt-
auslegen wesenhaft als vom Willen zur Macht konstituiert begreift, sondern
daß er auch die Konsequenzen bedenkt, die aus dem Selbstverständnis seiner
Philosophie als Auslegung erwachsen. Seine Philosophie des Willens zur
Macht kann ja keinen bloß kontemplativen Charakter haben. Sie ist selber
Ausdruck des Machtwollens. In ihr wird gewollt, daß die künftigen Werte-
schaffenden sich als Willen zur Macht verstehen. „Ihr selber seid dieser
Wille zur Macht — und nichts ausserdem!",ruft er den Menschen zu. Das ist
ein Appell. Er besagt: ,Begreift endlich, was Ihr in Wahrheit seid! Gott ist
tot, bekämpft auch noch seine Schatten! Die Wertetafeln, die Ihr bisher
über Euch gehängt habt, haben keine Gültigkeit! Laßt Euch nicht mehr von
diesen Werten bestimmen, bestimmt selbst die Werte! Wertet die alten
Werte um, schafft aus Eurem Selbstverständnis als Machtwollen heraus neue
Werte !c Audi Nietzsche kommt es darauf an, die Welt nicht nur zu ,inter-
pretierene, sondern sie zu verändern. Er hat freilich verstanden, daß alles
Verändern Interpretieren ist und alles Interpretieren Verändern. Zwar ist
auch die moralische Periode der Menschheit durch die Abfolge immer neuer
Weltinterpretationen gekennzeichnet. Aber die grundlegende Veränderung
180
K. Jaspers, Nietzsae, a. a. O. 294.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 51
steht noch aus. Über ihre Notwendigkeit gilt es nicht nur zu reflektieren, es
muß dazu aufgefordert werden. Aus dem Verständnis des Wirklichen als
Wille zur Macht heraus wird Nietzsche zum Verkünder. In Also sprach
Zarathustra gleitet seine Philosophie nicht in ,Dichtungc ab. Zarathustra ist
das Sprachrohr seiner Verkündigung. Da sein Ruf ungehört verhallt, sieht
sich Nietzsche auf die Aufgabe zurückgeworfen, den Menschen die noch
immer dominierenden moralischen Weltauslegungen in ihrer Nichtigkeit vor
Augen zu führen. Da er auch damit nur wenig Gehör findet, werden in
seinen letzten Schaifensjahren die Argumentationen, die er anführt, immer
gröber, die Selbstdarstellung immer übersteigerter, die Töne, die er an-
schlägt, immer schriller. Mit all dem fordert er: ,Hört mich endlich!'
Wir dürfen aber Nietzsches Philosophie nicht allein unter dem Aspekt
von Verkündigung und Appell betrachten, so wesentlich dieser auch für das
Verständnis seiner Schriften besonders vom Zarathustra an ist. In der Aus-
faltung seiner Interpretation sieht er sich genötigt, den ihr immanenten
Denkvoraussetzungen nachzugehen. Erst in der Reflexion auf sie kann seine
Philosophie ihren Anspruch auf grundlegende Deutung der Wirklichkeit im
ganzen erfüllen. Beginnen wir mit der Frage: Inwiefern kann Nietzsche den
Anspruch erheben, seine Interpretation des interpretierenden Wirklichen
treffe dessen Interpretationscharakter?
Damit rückt noch einmal der perspektivische Charakter allen Inter-
pretierens ins Thema. Im Fünften Buch der Fröhlichen Wissenschaft hat
Nietzsche dazu ausgeführt: „Wie weit der perspektivische Charakter des
Daseins reicht oder gar ob es irgend einen andren Charakter noch hat,...
ob, andrerseits, nicht alles Dasein essentiell ein auslegendes Dasein ist — das
kann, wie billig, auch durch die fleissigste und peinlich-gewissenhafteste
Analysis und Selbstprüfung des Intellekts nicht ausgemacht werden: da der
menschliche Intellekt bei dieser Analysis nicht umhin kann, sich selbst unter
seinen perspektivischen Formen zu sehn und nur in ihnen zu sehn. Wir
können nicht um unsre Ecke sehn: es ist eine hoffnungslose Neugierde,
wissen zu wollen, was es noch für andre Arten Intellekt und Perspektive
geben könnte: zum Beispiel, ob irgend welche Wesen die Zeit zurück oder
abwechselnd vorwärts und rückwärts empfinden können (womit eine andre
Richtung des Lebens und ein andrer Begriff von Ursache und Wirkung ge-
geben wäre)."181 Nietzsches Argumentation ist in sich überzeugend. ,Wirc
sind perspektivisch interpretierende Wesen; ob alle anderen Wesen auch
interpretieren, vermag unser Intellekt freilich nicht zu ergründen. Mit der
Annahme anderer perspizierender Wesen ist über den besonderen Charakter
von deren Perspektiven noch nichts ausgemacht. Wir können nur unter
181
FW (5. Buch) 374; KGW V 2, 308 f.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
52 Wolfgang Müller-Lauter
unserer Perspektive sehen; selbst wenn wir unser Perspizieren perspizieren
wollen, so bleiben wir unter unserer Perspektive. Nun ist zwar im zitierten
Text von der Selbstprüfung des Intellekts die Rede. Deren Unmöglichkeit
ist von Nietzsche häufig herausgestellt worden.182 Aber wieso sollte nur für
den Intellekt gelten, daß er nicht um die Ecke sehen kann? Ist doch alles
Auslegen, auch wenn es nicht auf den Intellekt beschränkt wird, perspekti-
visch. Dann aber sind die kritischen Vorbehalte berechtigt, die Nietzsche
hier für unser Erkennen von ,anderem Dasein' anführt. Dies wiederum be-
sagt doch wohl, daß, im Lichte kritischer Selbstreflexion des Interpretierens,
Nietzsches Ausführungen über das Gegeneinander von perspektivisch inter-
pretierenden Willen zur Macht als der Weltwirklichkeit schlechthin sich als
bloße Konstruktion erweisen. Hatte Nietzsche diese Selbstreflexion noch
nicht vollzogen, hat er sie nach dem Vollzug wieder vergessen, wenn er vom
perspektivischen Wahrnehmen im organischen und unorganischen ,Bereidic
spricht? Das kann wohl nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden. Hat
Jaspers recht, wenn er ausführt, Nietzsche habe „alles in seiner Kraft lie-
gende zur Eröffnung und Offenhaltung des Möglichen" getan, schließe aber
„am Ende wieder" zu „durch Verabsolutierung" des Willens zur Macht; die
„in schlechthin allen Erscheinungen" durchgeführte „Metaphysik des
Willens zur Macht" sei „auch von der Art früherer dogmatischer Meta-
pbysik"18*? Jaspers mißversteht Nietzsche, wenn er ihm einen solchen Dog-
matismus unterstellt. Aber seine Argumentation bleibt auch in sich unbe-
friedigend. Was könnte Nietzsche ,am Ende' dazu veranlaßt haben, wieder
zuzuschließen, da doch Eröffnen und Offenhalten seine Sache war?
Eine Antwort darauf bietet sich allerdings von den in dieser Unter-
suchung erarbeiteten Voraussetzungen her an. Ist Nietzsches Philosophie
selber Machtwollen, das die künftigen Starken zur Übernahme der Macht
ermächtigen will, so müssen alle besonderen Auslegungen wie auch die Aus-
legung der Wirklichkeit als ganzer in den Dienst dieser Aufgabe gestellt
werden. Wird den Menschen vor Augen geführt, daß es überall in der Welt
Machtkämpfe von Willensquanten gibt, in denen das Stärkere die Oberhand
gewinnt, und nichts außerdem, so müssen die starken Menschen angesichts
182
„Es ist beinahe komisch, dass unsre Philosophen verlangen, die Philosophie müsse mit
einer Kritik des Erkenntnissvermögens beginnen: ist es nicht sehr unwahrscheinlich, dass
das Organ der Erkenntniss sich selber ,kritisiren' kann, wenn man misstrauisch ge-
worden ist über die bisherigen Ergebnisse der Erkenntniss?" — »Ein Werkzeug kann
nicht seine eigne Tauglichkeit kritisiren: der Intellect kann nicht selber seine Grenze,
auch nicht sein Wohlgerathensein oder sein Missrathensein bestimmen." — „Ein Er-
kenntniss-Apparat, der sich selber erkennen will!! Man sollte doch über diese Ab-
surdität der Aufgabe hinaus sein! (Der Magen, der sich selber aufzehrt! —)" (Nachlaß;
GA XIV, 3).
183
K. Jaspers, Nietzsche, a. a. O. 309 f., vgl. z. B. 330.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 53
der Ausnahmslosigkeit des Gesetzes', daß jede Macht in jedem Augenblick
ihre Konsequenz zieht, die letzten, aus ihrem Verwurzeltsein in der Tradi-
tion herrührenden jHemmungen* verlieren, rückhaltlos ihre Macht im Setzen
neuer Werte ausüben. Die Deutung ,derc Welt als ,Wille zur Macht" bildete
dann zwar, unter selbstkritischer Prüfung dieser Interpretation, nur eine
Fiktion. Von Nietzsches eigenem Wahrheitskriterium her wäre sie gleich-
wohl Wahrheit. Gegen dieses Verständnis von Nietzsches Weltdeutung
läßt sich allerdings sofort einwenden, daß Nietzsche den Starken, denen er
mit der Wiederkunftslehre das Äußerste zumutet, in der Lehre vom Willen
zur Macht zu wenig zumuten würde. Warum soll ihnen nicht abverlangt
werden können, die Fiktion als Fiktion zu durchschauen? Da Nietzsche doch
selbst auf die perspektivische jBeschränktheit' allen Interpretierens auf-
merksam gemacht hat, wäre dies um so unverständlicher. Sollen die künf-
tigen Mächtigen — eben um der Macht willen — als die Stärksten zugleich
die Weisesten sein184, so darf ihnen der fiktive Charakter der Deutung der
ganzen Wirklichkeit gerade nicht verborgen werden. Würden sie sich doch
gegenüber dem Hinweis auf den aus ihren eigenen Voraussetzungen heraus
angemessenen Dogmatismus ihrer Interpretation der gesamten Wirklichkeit
als die weniger Weisen, also als die Schwächeren ,fühlene müssen.
Wir kommen aus dem Dilemma, in dem wir uns befinden, heraus,
wenn wir, uns weiter im Zirkel bewegend, die Interpretation Nietzsches
daraufhin befragen, welche Möglichkeiten des Interpretierens sie dem
Menschen einräumt und wodurch sie diese bestimmt sieht. Diese Frage ist, so
wird sich zeigen, nur scheinbar beantwortet worden, als wir uns auf den
Aphorismus 374 in der Fröhlichen Wissenschaft beriefen. Schon die Aus-
führungen, die der zitierten Passage folgen, nehmen die Möglichkeit ernst,
daß die Welt unendliche Interpretationen in sich schließe. Und die Über-
schrift des Aphorismus lautet: „Unser neues ,Unendlichesc<<. Zwar können
wir dem entnehmen, welches Gewicht trotz aller kritischen Einwände der
Gedanke für Nietzsche behält, es gebe auch nichtmenschliches Dasein, das
auslegt. Aber die kritischen Einwände werden dadurch doch nicht ausge-
räumt. Einen Schritt weiter führt uns eine Nachlaßaufzeichnung, die aus
den Jahren 1885 oder 1886 stammt.185 Nietzsche wendet sich dort gegen die
„Bescheidenheit der philosophischen Skepsis oder... religiöser Ergebung",
die vom Wesen der Dinge sage, es sei ihr unbekannt oder zum Teil unbe-
kannt. Sie sei in Wahrheit Unbescheidenheit, insofern sie um die Recht-
184
Zur Problematik, in die Nietzsche gerät, indem er den künftigen großen Menschen
und schließlich den Übermenschen als Synthese von Stärke und Weisheit zu denken
sucht, s. Vf., Nietzsche, a. a. O. 117—134.
185
Nachlaß; GA XIII, 48 f.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
54 Wolfgang Müller-Lauter
mäßigkeit der „Unterscheidung von einem , Wesen der Dingec und einer
,Erscheinungs-Welt<cc Wissen zu haben vorgebe. „Um eine solche Unter-
scheidung machen zu können, müsste man sich unsern Intellect mit einem
widerspruchsvollen Character behaftet denken: einmal, eingerichtet auf das
perspectivische Sehen (wie dies noth thut, damit gerade Wesen unserer Art
sich im Dasein erhalten können), andrerseits zugleich mit einem Vermögen,
eben dieses perspectivische Sehen als perspectivisches, die Erscheinung als
Erscheinung zu begreifen. Das will sagen: ausgestattet mit einem Glauben
an die jRealität', wie als ob sie die einzige wäre, und wiederum auch mit der
Einsicht über diesen Glauben, dass er nämlich nur eine perspectivische Be-
schränktheit sei in Hinsicht auf eine wahre Realität. Ein Glaube aber, mit
dieser Einsicht angeschaut, ist nicht mehr Glaube, ist als Glaube aufgelöst.
Kurz, wir dürfen uns unsern Intellect nicht dergestalt widerspruchsvoll
denken, dass er ein Glaube ist und zugleich ein Wissen um diesen Glauben
als Glauben." Am Schlüsse dieser Betrachtung fordert Nietzsche die Ab-
schaffung der Begriffe ,Ding an sich' und jErscheinung*. Ihr Gegensatz sei
ebenso „unbrauchbar" wie der „ältere von ,Materie und Geist'".
Der unbrauchbare Gegensatz Ding an sich — Erscheinung entspringt
einer Denkweise, die einen Widerspruch in unseren Intellekt hineinlegt. Der
Widerspruch macht die Unhaltbarkeit der Konstruktion jenes Gegensatzes
deutlich. Nietzsche verwendet hierbei aber nicht „ausnahmsweise einmal
den Widerspruch als letztes Wahrheitskriterium für seine Behauptungen",
wie Jaspers im Zusammenhang seiner Interpretation der zitierten Nieder-
schrift ausführt186. Der ,Satz vom Widerspruch" ist für Nietzsche eine grobe
und fälschende ,Zurechtmachungc, die den wirklichen Gegensatzcharakter
des Daseins verschleiert.187 Als unhinnehmbare Widersprüche müssen ihm
aber diejenigen gelten, welche zur Aufhebung seines eigenen Wahrheits-
kriteriums führen. Faktische Machtausübung kann nicht sowohl möglich als
auch unmöglich sein.188 Auch unser Intellekt steht im Dienste der Macht-
186
K. Jaspers, Nietzsae, a. a. O. 329.
187
S. Vf., Nietzsthe, a. a. O. 13 ff.
188
Zu Anfang seiner kritischen Ausführungen bezeichnet es Köster als „generelles Charak-
ter istikum" meines Nietzsche-Buches, ich stellte mich „entschieden auf den Boden der
rationalen, den Argumenten der Logik vertrauenden Wissenschaft" (Die Problema-
tik ..., a. a. O. 34). Gründlicher konnte meine Interpretation nicht mißverstanden
werden. Dieses unangemessene Vorverständnis prägt alle Einwände Kösters, die er im
folgenden vorträgt. Es ist um so unverständlicher, als ich meine Nietzsche-Darstellung
mit Nietzsches Destruktion der logischen Gegensätzlichkeit beginne, um hinter dieser
die wirklichen Gegensätze der Machtwillen aufzuzeigen. Köster findet, daß ich
Nietzsches Logikkritik nicht radikal genug auffasse (a. a. O. 40), „daß demzufolge
Nietzsches Aufhebung* des Satzes vom Widerspruch für den Fortgang der Unter-
suchung in eigentümlicher Weise ohne durchgreifende Konsequenz bleibt" (a. a. O. 41).
Da ich nun aber im Fortgang meiner Untersuchung die Konsequenzen von Nietzsches
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 55
ausübung, er ist, wie wir gehört haben, ein Organ, das sich die vielen
Machtwillen geschaffen haben, welche ,wirc sind. Soll er als Werkzeug dieser
Machtwillen den ,Glauben an die Realität* konstituieren, so kann er als ein
solches Werkzeug nicht zugleich dazu bestimmt sein, diesen Glauben zu
negieren, indem er ihn als perspektivische Fiktion auffaßt. Das bedeutet,
daß auch im hier diskutierten Falle nicht die Vermeidung von Wider-
sprüchlichkeit im formallogischen Sinne das Wahrheitskriterium bildet —
so wenig wie schon Nietzsches Ausführung, ein Werkzeug könne über seine
Tauglichkeit als Werkzeug selber nicht befinden, als ,logisches Argument*
angesehen werden darf —, sondern die faktische Unmöglichkeit, daß dem-
selben Organ des Maditwollens einander wechselseitig aufhebende Funk-
tionen zugeordnet worden sein können.
Die Frage, wie es denn dazu kommen konnte, daß der Intellekt sich
selber in dem charakterisierten Sinne mißverstehen lernte, ließe sich von
Nietzsche her nur im ausgebreiteten Zusammenhang einer Genealogie des
Logikkritik voraussetze, stellt sich die Frage: Wie kommt Köster dazu, mich bei jener
Logik zu behaften, die ich mit Nietzsche zurücklasse? Wo es mir um die Frage nach
Möglichkeit oder Unmöglichkeit eines philosophischen Aufweises der Synthese von
Gegensätzen bei Nietzsche geht, findet Köster, daß „alle Indizien" darauf hinweisen,
daß ich „damit eine rational argumentierende Beweisführung** von Nietzsche erwarte
(a. a. O. 57). Muß ich sagen, daß ich so töricht nicht bin? Wenn ich Gegensätze in
Nietzsches Denken konstatiere, so halte ich nach Köster lediglich an ihrer „logischen
Unvereinbarkeit" fest (a. a. O. 37). Auch die Vorsicht, mit der ich meine Worte wähle
(Plausibilität, Vereinbarkeit, philosophischer Auf weis), hat Köster nicht dazu veran-
laßt, seinen Rationalismus-Vorwurf in Frage zu stellen. Man muß den Eindruck gewin-
nen, daß er widerspruchaufweisend = rational = logisch = wissenschaftlich setzt, und
solcher Gleichung, die er unter das Vorzeichen ,Denkbarkeit* bringt, nur das von
Nietzsche ,als undenkbar Gewollte' gegenüber sieht. Als ob es nicht ein sich aus-
weisendes Denken gäbe, das Rationalität hinter sich läßt, als ob es nicht — zum Bei-
spiel — Hegels ,Wissenschaft der Logik* gäbe, die den Rechtsanspruch formaler Logik
bestreitet. Es ist grotesk, meine Auslegung in dieser Hinsicht „in einem klaren Gegen-
satz zu Heideggers Umgang mit Nietzsche" zu sehen (a. a. O. 34). Als ob es Heidegger
nicht ebenfalls immer wieder darum ginge, die Vereinbarkeit von Nietzsches Aussagen
darzulegen. Nennen wir nur die Frage nach dem Verhältnis von Nietzsches Lehren des
Willens zur Macht und der ewigen Wiederkehr, wie sie sich für Heidegger stellt. Er
schreibt in einer Kritik an Baeumlers Nietzschedeutung: „Aber gesetzt, es besteht ein
Widerspruch zwischen beiden Lehren...: seit Hegel wissen wir, daß ein Widerspruch
nicht notwendig (sie!) ein Beweis gegen die Wahrheit eines metaphysischen Satzes ist,
sondern ein Beweis dafür. Wenn ewige Wiederkehr und Wille zur Macht sich also
widersprechen, dann ist vielleicht dieser Widerspruch gerade die Aufforderung, diesen
schwersten Gedanken zu denken (sie!), statt ins »Religiöse* zu flüchten. Aber selbst zu-
gegeben, es liege ein unaufhebbarer Widerspruch vor und der Widerspruch zwinge zur
Entscheidung: entweder Wille zur Macht oder ewige Wiederkehr, warum entscheidet
sich dann Baeumler gegen Nietzsches schwersten Gedanken und Gipfel der Betrachtung
und für den Willen zur Macht?" (Nietzsche, a. a. O. I, 30 f.) Heidegger stellt Nietzsche
uneingeschränkt unter den Anspruch des Denkens; selbst fundamentale Widersprüche
bilden für ihn keine Aufforderung, ins ,Undenkbare* zu entfliehen; er räumt die Mög-
lichkeit ein, daß es bei Nietzsche unaufhebbaren Widerspruch geben könne, der zur
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
56 Wolfgang Müller-Lauter
menschlichen Selbstverständnisses beantworten. Auf eine solche Darstellung
muß hier verzichtet werden. Die Problematik, deren Nietzsche im Hinblick
auf den Intellekt als auf ein bestimmtes Organ von seinen Voraussetzungen
her Herr zu werden vermag, kommt aber in Hinblick auf das Interpretieren
noch einmal auf uns zu. Gewiß können wir nach dem weiter oben Aus-
geführten sagen, daß das Selbstverständnis einer Interpretation als Inter-
pretation nicht gegen das Machtwollen gerichtet sein muß, sondern das
Interpretieren gerade freisetzen kann und freisetzen soll. Das Interpretieren
als ganzes ist nicht auf bestimmte Funktionen eingeschränkt wie der Intel-
lekt. Gleichwohl sind die Fragen nicht abzuweisen: Wie ist es möglich, daß
sich das perspektivische Interpretieren überhaupt als solches Interpretieren
verstehen kann? Welches Recht kann Nietzsche für seinen Anspruch geltend
machen, seine Interpretation der Wirklichkeit als des Gegeneinanders von
perspektivischen Interpretationen sei mehr als eine bloß menschliche Per-
spektive, sei mehr als gar nur die besondere Perspektive des Philosophen
Nietzsche?
Wenn wir versuchen wollen, diese Frage aus der Interpretation
Nietzsches selbst heraus zu beantworten, so müssen wir davon ausgehen,
Entscheidung zwingen könne. Bekanntermaßen sieht Heidegger im Unterschied zu
Baeumler keinen unaufhebbaren Widerspruch zwischen den beiden Lehren Nietzsches:
er sucht vielmehr — selbstverständlich auf seine Weise — ihre Vereinbarkeit, ja ihre
„innere Einheit" und zwar durchaus „im Gesichtskreis der Metaphysik und mit Hilfe
ihrer Unterscheidungen" (a. a. O. I, 14) herauszuarbeiten.
Köster will jedoch erkannt haben, daß ich (im Gegensatz zu Heidegger) rationale Maß-
stäbe an Nietzsche anlege, wenn ich nach der Vereinbarkeit von dessen Grundaussagen
frage. Besteht für Köster die Radikalisierung von Nietzsches Bestreitung des Satzes vom
Widerspruch darin, daß Nietzsche sich nur noch in Widersprüchen äußern können soll?
Was ich oben gegen Jaspers anführe, gilt grundsätzlich für Nietzsches Denken: Wenn
Nietzsche im Zusammenhang der Darlegung seiner eigenen Position keine Wider-
sprüche zulassen darf, so unterwirft er sich nicht dem Wahrheitskriterium der Logik.
Der Anspruch auf die »Stimmigkeit* seines Denkens ist von fundamentaler Art, er wird
von formalen Forderungen nach »logischer Übereinstimmung* nicht betroffen. Nur auf
diesen Anspruch hin befrage ich in meinem Buch Nietzsches Denken.
Einig sind wir, Köster und ich, offenkundig über die innere Unvereinbarkeit von
Grundgedanken Nietzsches. Kösters Unterstellung, ich könnte meinen, Nietzsche habe
die Unvereinbarkeit „nicht gesehen" (Die Problematik..., a. a. O. 58), ist absurd: Geht
es mir doch gerade darum zu zeigen, wie Nietzsche um Vereinbarkeit ringt. Wenn ich
ausführe, die Synthese von Stärke und Weisheit im Übermenschen könne von Nietzsche
nur noch als Geglaubtes offengehalten werden, so springe ich mit dem ,nur noch* nicht
aus der immanenten Kritik heraus, wie Köster meint (a. a. O. 58 f., Anm. 50), ich messe
ihn mit solcher »Einschränkung* auch nicht an einem , Wissen Schaftsanspruch', sondern
spreche aus der Forderung heraus, die Nietzsche selber mit bewundernswürdiger Inten-
sität an sein Denken stellt. Wenn man das Unvereinbare in seiner vollen Unvereinbar-
keit herausarbeitet, wird man, wie ich meine, dieser Intensität gerechter, als wenn man
die Bewegung seines Denkens im Undenkbaren zur Ruhe geleitet. Gerade letzteres
hieße, ,vor den Gefahren die Augen zu verschließen* (a. a. O. 60), die mit Nietzsches
Philosophie auf uns zugekommen sind.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 57
daß der Mensch für ihn „nicht nur ein Individuum, sondern das fortlebende
Gesammt-Organische in Einer bestimmten Linie" ist.189 Von dieser Vor-
aussetzung her wird uns vollends deutlich, warum die ,Analysis und Selbst-
prüfung des Intellekts' weder etwas über die Richtigkeit unseres Er-
kennens noch auch Zureichendes über den Intellekt selber auszumachen
imstande ist: in ihr wird nicht einmal der Mensch, sondern nur eins seiner
, Werkzeuge' dem Flusse des Werdens entrissen, für sich genommen, isoliert
und durch sich selbst auf seine Tauglichkeit hin angesehen. Nietzsche will
dementgegen „den Menschen... zurückübersetzen in die Natur", „taub"
bleiben „gegen die Lockweisen alter metaphysischer Vogelfänger, welche
ihm allzulange zugeflötet haben: ,du bist mehr! du bist höher! du bist
anderer Herkunft!"'190 Die Herkunft des Menschen liegt in der Natur, und
,mehrc ist er nicht in einem qualitativen, wohl aber in einem quantitativen
Sinne. Das Gesamt-Organische lebt in ihm fort. Und insofern alles Orga-
nische eine Synthesis von unorganischen Kräften ist, ,lebt' auch das Un-
organische in ihm.191 Ältestes, ihm „fest einverleibt", steht mit Jüngerem im
Kampf. Der Mensch trägt das Viele in sich, das er interpretiert. Und er
könnte es nicht in sich aufgenommen haben, er könnte nicht der Inter-
pretierende sein, der er ist, wenn das Aufgenommene nicht selber vom
Wesen des Interpretierens wäre. Nietzsche kann von der genannten Vor-
aussetzung her noch einen Schritt weiter gehen: Daß der Mensch besteht,
„damit ist bewiesen, dass eine Gattung von Interpretation (wenn auch
immer fortgebaut) auch bestanden hat, dass das System der Interpretation
nicht gewechselt hat".192
189
Nachlaß, WM 678; GA XVI, 143.
190
JGB 230; KGW VI 2, 175.
191
„Das Unorganische bedingt uns ganz und gar: Wasser Luft Boden Bodengestalt Elek-
tricität usw. Wir sind Pflanzen unter solchen Bedingungen", lautet eine Aufzeichnung
(Nachlaß Frühjahr-Herbst 1881, 11 [210]; KGW V 2, 423). Das Bedingende bleibt
nicht als Ursache außer uns, wir sind das, was uns bedingt.
192
Nachlaß, WM 678; GA XVI, 143. — Bei Nietzsche sind transzendentales und natura-
listisches Denken nicht nur eine Symbiose eingegangen, sie durchdringen einander, ver-
schmelzen gänzlich ineinander. Jede Betonung von Nietzsches Naturalismus bedarf der
Korrektur durch den Hinweis darauf, daß alles Seiende interpretiert, Interpretation ist.
Und umgekehrt gilt, daß jede Interpretation ,naturhaft* ist. Es ist unzureichend und
führt zu Mißverständnissen, wenn man, wie J. Habermas (s. sein Nachwort zu Fr.
Nietzsche, Erkenntnistheoretische Schriften, Frankfurt/M. 1968)> in der Erörterung von
Nietzsches Revision des ,BegrifTs des Transzendentalen* bei der Perspektivenlehre der
menschlichen Affekte halt macht. Diese Perspektivität muß ihrerseits von der Vielfalt
der ,naturhaften' Perspektiven her verstanden werden, die in das Menschsein einge-
gangen sind. Eine solche Deutung ermöglicht es Nietzsche, Aussagen über den Inter-
pretationscharakter auch des unorganischen und organischen Seienden zu machen und
zugleich den möglichen Vorwurf zu unterlaufen, seine Philosophie des Willens zur
Macht sei dogmatischer Naturalismus. Ansatzpunkte für eine Kritik an Nietzsche sind
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
58 Wolfgang Müller-Lauter
Damit haben wir den Schlüssel zur Antwort auf die beiden gestellten
Fragen in der Hand. Nietzsche kann das vielfältige Wirkliche, das natur-
haft Seiende, als vielfältiges Interpretieren interpretieren, weil der Mensch
selber interpretierendes Wesen ist und dies nur sein kann, weil das, was in
ihm zusammenfließt, als unorganisches und organisches Seiendes selber
schon interpretiert. Als Synthesis und Vielheit von Interpretationen kann
der Mensch seines perspektivischen Interpretierens inne werden, insofern
,der Subjektpunkt herumspringtc und von jedem neuen Punkt aus die Per-
spektivik wechselt. Das Wissen um dieses Herumspringen hat er, weil er,
wie alles Organische, Erfahrungen sammelt, über Gedächtnis verfügt.193 Die
Möglichkeit, das Interpretieren zu interpretieren, entspringt so dem Wech-
sel der Interpretationen. Weder bedarf es dazu eines besonderen Vermö-
gens, noch wird damit die Perspektivität des Interpretierens verlassen.
Nietzsche hat einmal zusammengefaßt: „Dass der Werth der Welt in
unserer Interpretation liegt (— dass vielleicht irgendwo noch andre Inter-
pretationen möglich sind, als bloss menschliche —), dass die bisherigen
Interpretationen perspektivische Schätzungen sind, vermöge deren wir uns
im Leben, d. h. im Willen zur Macht, zum Wadisthum der Macht, erhalten,
dass jede Erhöhung des Menschen die Überwindung engerer Interpreta-
tionen mit sich bringt, dass jede erreichte Verstärkung und Machterweite-
rung neue Perspektiven aufthut und an neue Horizonte glauben heisst —
das geht durch meine Schriften."194 Wir beschränken uns, von dieser Selbst-
darstellung Nietzsches ausgehend, auf die Hervorhebung von zwei Gesichts-
punkten. A. Machtvermehrung besagt Gewinnung neuer Perspektiven (weil
weitere Machtquanten einverleibt worden sind) und damit Erweiterung der
Interpretationen. Diese wiederum kennzeichnet die Erhöhung des Menschen.
Umgekehrt gilt: „die Mehrheit der Deutung (:) Zeichen der Kraft"195. Die
Umkehrung gilt freilich nur dann, wenn die vielen Deutungen sich zur Ein-
heit organisieren lassen und nicht die Disgregation bewirken, wie Nietzsche
dies besonders für ,die Moderne' herausstellt196. B. Nietzsches Interpretation
der Interpretationen versteht sich selbst nicht als absolute Philosophie. Zwar
setzt sich in seinem Denken die Überzeugung durch, daß alles, was ist,
auch auf der damit gewonnenen Verständnisebene gegeben. Aber sie muß erst einmal
erreicht sein, wenn eine sachgegründete Kritik von Nietzsches ,Erkenntnistheoriec ver-
sucht werden soll.
193
„Vielleicht ist sogar nichts furchtbarer und unheimlicher an der ganzen Vorgeschichte
des Menschen, als seine Mnemotechnik", schreibt Nietzsche in Zur Genealogie der Moral
(GM II, 3; KGW VI 2, 311). Ausgehend von der Frage nach der Möglichkeit des
Versprechenkönnens, gibt er dort Hinweise auf seine Genealogie des Gedächtnisses.
194
Nachlaß, WM 616; GA XVI, 100.
195
Nachlaß, WM 600; GA XVI, 95.
19e
S. Vf., Nietzsche, a. a. O. 35 ff.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht 59
Interpretation sei. Aber er schließt nicht aus, daß es noch andere Inter-
pretationen gibt, die nicht in das Menschsein eingegangen sind. Ist der
Mensch doch ,nurc das fortlebende Gesamt-Organische „in Einer bestimmten
Linie"197. Damit wird zugleich die Möglichkeit offen gehalten, daß künftige
Menschen, jUbermenschen', durch Einverleibung von uns Heutigen noch
unzugänglichen Interpretationen ihr Wirklichkeitsverständnis im Vergleich
mit den jetzt Lebenden noch erweitern könnten. „Die Erkenntnis wird, bei
höherer Art von Wesen, auch neue Formen haben, welche jetzt noch nicht
nöthig sind."198 Nietzsches Interpretation bezieht die Möglichkeit, ja Not-
wendigkeit ihrer eigenen Erweiterung und damit Modifizierung als einen
ihr wesentlichen Aspekt in sich selbst ein.
Nachdem wir uns auf mannigfache Weise im Zirkel der Interpretation
Nietzsches bewegt haben, sei zum Schluß noch einmal auf die Frage nach
dem Wer seiner Interpretation eingegangen. Wir haben schon gehört, daß
diese Frage unzulässig ist, insofern es nicht erst ein Etwas gebe, das dann
interpretiere. Das Interpretieren selber habe Dasein. Nietzsches Perspekti-
vismus als Subjektivismus zu verstehen, ist daher verfehlt. „,Es ist Alles
subjektiv', sagt ihr: aber schon das ist Auslegung", schreibt Nietzsche und
weist solche Rede zurück.199 In einer längeren Aufzeichnung aus dem Jahre
1885 heißt es: „Der Gedanke ... taucht in mir auf — woher? wodurch? das
weiss ich nicht. Er kommt, unabhängig von meinem Willen, gewöhnlich um-
ringt und umdunkelt durch ein Gedräng von Gefühlen, Begehrungen, Ab-
neigungen, auch von ändern Gedanken. .. Man zieht ihn aus diesem Ge-
dränge, reinigt ihn, stellt ihn auf seine Füsse...: wer das Alles thut — ich
weiss es nicht und bin sicherlich mehr Zuschauer dabei als Urheber dieses
Vorgangs ... Dass bei allem Denken eine Vielheit von Personen betheiligt
scheint —: dies ist nicht gar zu leicht zu beobachten, wir sind im Grunde
umgekehrt geschult, nämlich beim Denken nicht an's Denken zu denken. Der
Ursprung des Gedankens bleibt verborgen; die Wahrscheinlichkeit dafür
ist gross, dass er nur das Symptom eines viel umfänglicheren Zustandes ist;
darin dass gerade er kommt und kein anderer, dass er gerade mit dieser
grösseren oder minderen Helligkeit kommt, mitunter sicher und befehle-
risch, mitunter schwach und einer Stütze bedürftig . ..: in dem Allen drückt
sich irgend Etwas von unserem Gesammtzustande in Zeichen aus."200 An
dem, was hier der ,Psychologec Nietzsche als der sich selbst Beobachtende
schreibt — er, der die Selbstbeobachtung sonst so entschieden zurückweist
197
Nachlaß, WM 678; GA XVI, 143.
198
Nachlaß, WM 615; GA XVI, 100.
199
Nachlaß, WM 481; GA XVI, 12.
200
Nachlaß; GA XIV, 40 f.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
60 Wolfgang Müller-Lauter
oder zumindest vor ihr warnt —, läßt sich der Geschehnischarakter von
Interpretationen deutlich machen. Als Interpretation ist der Mensch Wille
zur Macht, gewiß. Aber dieser Wille zur Macht ist die fortlaufend sich
wandelnde Organisation von Machtwillen, die in sich selbst organisierte
Machtwillen sind. Je ,umfänglicher' die Machtorganisationen werden, desto
abhängiger sind die organisierenden Kräfte von den organisierten. Sind es
doch letztlich deren wechselnde Machtkonstellationen, die über die Regent-
schaft entscheiden. Der Mensch ist eine so komplexe Machtorganisation, daß
er nicht mehr erfahren kann, was ihn ,im Grunde' treibt. Er ist Interpreta-
tion, aber er wird interpretiert. Er ist Wille zur Macht, aber — als ,Wille
des Menschen" — ohnmächtiger Wille zur Macht hinsichtlich seiner Selbst-
konstitution. Dies einzusehen, heißt das Eingesehene als das letztlich Wahre
uneingeschränkt bejahen. ,Amor fati' ist das letzte Won der Philosophie des
Willens zur Macht. Aber auch dieses Wort konnte ihr selbst nur aus ihrer
eigenen Abgründigkeit heraus ,zugesprochenc werden.201
Nichts wäre verfehlter, der Interpretation Nietzsches unangemessener,
als zuletzt doch noch den Willen zur Macht, einem deus ex machina gleich,
wenn schon nicht als das eine metaphysische Subjekt, so doch als das eine
Grundgeschehnis hervortreten zu lassen. Es gibt für Nietzsche zwar Ge-
schehniszusammenhänge, aber es gibt nicht das Grundgeschehnis. Es gibt
nicht das Eine, es gibt immer nur Vielheiten, sich zusammenfügend, aus-
einandertretend. Nietzsches Philosophieren schließt die Frage nach dem
Grund des Seienden im Sinne überlieferter Metaphysik als eine für das
wirkliche Geschehen relevante Frage aus.
201
Nietzsches »Fatalismus* gerät nicht in Widerstreit mit seinem Selbstverständnis als des-
jenigen, der an die Menschen appellieren muß, die Wahrheit der Lehre vom Willen zur
Macht auf sich zu nehmen. , * und , Verkündigung* sind ihrerseits ernötigt, wie dies
auch die Aufnahme des Appells durch die künftigen großen Menschen wäre.
Brought to you by | Universitaetsbibliothek Frankfurt/Main
Authenticated
Download Date | 3/20/18 9:13 PM
Das könnte Ihnen auch gefallen
- (Martin Heidegger) Nietzsche Erster Band (BookFi) PDFDokument666 Seiten(Martin Heidegger) Nietzsche Erster Band (BookFi) PDFMatíasIgnacioPizzi100% (1)
- Nietzsches Inszenierung Der PhilosophieDokument15 SeitenNietzsches Inszenierung Der PhilosophieRomano ZattoniNoch keine Bewertungen
- Christian Clement Rudolf Steiner Und Sein Romantischer Doppelgänger": Zum Einfluss Schellings Auf Die Beiden Theoretischen Grundlegungen Der Anthroposophie.Dokument23 SeitenChristian Clement Rudolf Steiner Und Sein Romantischer Doppelgänger": Zum Einfluss Schellings Auf Die Beiden Theoretischen Grundlegungen Der Anthroposophie.Davor KatunarićNoch keine Bewertungen
- Manfred Frank, Der Unendliche Mangel An Sein. Schellings Hegelkritik Und Die Anfänge Der Marxschen Dialektik OCRedDokument393 SeitenManfred Frank, Der Unendliche Mangel An Sein. Schellings Hegelkritik Und Die Anfänge Der Marxschen Dialektik OCReddanielgaid100% (2)
- Manfred Frank Der Unendliche Mangel An Sein Schellings Hegelkritik Und Die Anfänge Der Marxschen Dialektik 1992Dokument393 SeitenManfred Frank Der Unendliche Mangel An Sein Schellings Hegelkritik Und Die Anfänge Der Marxschen Dialektik 1992István DrimálNoch keine Bewertungen
- Patrick Wotling - La Culture Comme Problème.Dokument50 SeitenPatrick Wotling - La Culture Comme Problème.Yochil100% (1)
- FREUDENTHAL - Spinoza Und Die ScholastikDokument30 SeitenFREUDENTHAL - Spinoza Und Die Scholastikkarmoo0% (1)
- George Bertram Kritik, Reflexivität Und Subjektivität Nach NietzscheDokument13 SeitenGeorge Bertram Kritik, Reflexivität Und Subjektivität Nach NietzscheNicolasCaballeroNoch keine Bewertungen
- Nietzsche Studien 24 - 17-44 - Philosophie Als 'Leidenschaft Der Erkentnis' - S. EbbersmeyerDokument28 SeitenNietzsche Studien 24 - 17-44 - Philosophie Als 'Leidenschaft Der Erkentnis' - S. EbbersmeyerPolar666Noch keine Bewertungen
- Der Wille zur Macht: Eine Auslegung alles GeschehensVon EverandDer Wille zur Macht: Eine Auslegung alles GeschehensNoch keine Bewertungen
- Heidegger - Nietzsche - Erster BandDokument666 SeitenHeidegger - Nietzsche - Erster BandAlbertino Chirita100% (1)
- Der Wille zur Macht: Eine Auslegung alles GeschehensVon EverandDer Wille zur Macht: Eine Auslegung alles GeschehensNoch keine Bewertungen
- NS 29 - 1-11 - Ns Philosophie Der Interpretation - Günter FigalDokument11 SeitenNS 29 - 1-11 - Ns Philosophie Der Interpretation - Günter FigalPolar666Noch keine Bewertungen
- Nietzsche Studien 24 - 354-357 - Bericht - Ns... Und Heideggers N-Interpretation - A. VenturelliDokument4 SeitenNietzsche Studien 24 - 354-357 - Bericht - Ns... Und Heideggers N-Interpretation - A. VenturelliPolar666Noch keine Bewertungen
- (De Gruyter Studienbuch) Abel, Günter - Nietzsche - Die Dynamik Der Willen Zur Macht Und Die Ewige Wiederkehr (, de Gruyter)Dokument493 Seiten(De Gruyter Studienbuch) Abel, Günter - Nietzsche - Die Dynamik Der Willen Zur Macht Und Die Ewige Wiederkehr (, de Gruyter)marhansaraivaNoch keine Bewertungen
- Nietzsche Studien 24 - 124-136 - Eine Quelle Der Frühen Schop-Kritik Ns - S. BarberaDokument13 SeitenNietzsche Studien 24 - 124-136 - Eine Quelle Der Frühen Schop-Kritik Ns - S. BarberaPolar666Noch keine Bewertungen
- (Monographien Und Texte Zur Nietzsche-Forschung 20) Thomas Böning - Metaphysik, Kunst Und Sprache Beim Frühen Nietzsche-Walter de Gruyter (1988)Dokument538 Seiten(Monographien Und Texte Zur Nietzsche-Forschung 20) Thomas Böning - Metaphysik, Kunst Und Sprache Beim Frühen Nietzsche-Walter de Gruyter (1988)marhansaraivaNoch keine Bewertungen
- AnhangDokument33 SeitenAnhangduka227Noch keine Bewertungen
- Kapitel 1Dokument38 SeitenKapitel 1Dunja LariseNoch keine Bewertungen
- Babich-Die Beitraege Als Heideggers Wille Zur Macht-Kap VII Babich-Eines Gottes Glueck-LibreDokument33 SeitenBabich-Die Beitraege Als Heideggers Wille Zur Macht-Kap VII Babich-Eines Gottes Glueck-LibreJo PliNoch keine Bewertungen
- Vortrag LW Teil 2Dokument22 SeitenVortrag LW Teil 2Victor CantuárioNoch keine Bewertungen
- Nietzsche Vortrag VerffentlichtefassungDokument11 SeitenNietzsche Vortrag VerffentlichtefassungJorge Hernando PachecoNoch keine Bewertungen
- Revolution 100 Years After: System, Geschichte, Struktur und Performanz einer politisch ökonomischen TheorieVon EverandRevolution 100 Years After: System, Geschichte, Struktur und Performanz einer politisch ökonomischen TheorieNoch keine Bewertungen
- Ansell-Pearson, Keith - Nietzsche, The Sublime, and The Sublimities of PhilosophyDokument32 SeitenAnsell-Pearson, Keith - Nietzsche, The Sublime, and The Sublimities of PhilosophyCostin ElaNoch keine Bewertungen
- NANCY, Jean-Luc. 'Notre Probité!' (Sur La Verité Au Sens Moral Chez Nietzsche)Dokument18 SeitenNANCY, Jean-Luc. 'Notre Probité!' (Sur La Verité Au Sens Moral Chez Nietzsche)Incognitum MarisNoch keine Bewertungen
- Resilienz und Literatur: Methodisch-theoretische GrundlagenVon EverandResilienz und Literatur: Methodisch-theoretische GrundlagenNoch keine Bewertungen
- Brief An Richardson PDFDokument11 SeitenBrief An Richardson PDFAnonymous 6N5Ew3Noch keine Bewertungen
- Scheler MitleidDokument16 SeitenScheler MitleidElisaNoch keine Bewertungen
- Kommentarzusammenfassung Für Nietzsche I PDFDokument1.340 SeitenKommentarzusammenfassung Für Nietzsche I PDFAlexander RitterNoch keine Bewertungen
- 21 Babich Zu Nietzsches WissenschaftsphilosophieDokument21 Seiten21 Babich Zu Nietzsches WissenschaftsphilosophieBabette BabichNoch keine Bewertungen
- Odo Marquard - Hegel Und Das SollenDokument17 SeitenOdo Marquard - Hegel Und Das Sollen나경태Noch keine Bewertungen
- 1996 DecherDokument19 Seiten1996 DecherM.F.Noch keine Bewertungen
- Friedrich Nietzsche Und Der HedonismusDokument6 SeitenFriedrich Nietzsche Und Der HedonismusFreundinnen und Freunde des Lebens100% (1)
- SKA02 01 VorwortDokument10 SeitenSKA02 01 VorwortMichael V.Noch keine Bewertungen
- Manfred Frank - Selbstbewusstsein Und SelbserkenntniseDokument16 SeitenManfred Frank - Selbstbewusstsein Und SelbserkenntnisecvejicNoch keine Bewertungen
- Hühn L. - Die Wahrheit Des NihilismusDokument40 SeitenHühn L. - Die Wahrheit Des Nihilismusannip100% (1)
- (GA 6.2) Martin Heidegger - Nietzsche IIDokument255 Seiten(GA 6.2) Martin Heidegger - Nietzsche IICarolNoch keine Bewertungen
- Nietzsche Ästhetik PolitikDokument20 SeitenNietzsche Ästhetik PolitikOrlando Nada OksNoch keine Bewertungen
- »Aufzeichnungen eines Vielfachen«: Zu Friedrich Nietzsches Poetologie des SelbstVon Everand»Aufzeichnungen eines Vielfachen«: Zu Friedrich Nietzsches Poetologie des SelbstNoch keine Bewertungen
- (Klassiker Auslegen - 72) Eike Brock (Editor) - Jutta Georg (Editor) - Friedrich Nietzsche - Menschliches, Allzumenschliches-De Gruyter (2020)Dokument312 Seiten(Klassiker Auslegen - 72) Eike Brock (Editor) - Jutta Georg (Editor) - Friedrich Nietzsche - Menschliches, Allzumenschliches-De Gruyter (2020)Leandro CamargoNoch keine Bewertungen
- Dynamis: Eine materialistische Philosophie der DifferenzVon EverandDynamis: Eine materialistische Philosophie der DifferenzNoch keine Bewertungen
- Zur Dissertation Hans WagnersDokument30 SeitenZur Dissertation Hans WagnerscuneiformNoch keine Bewertungen
- Grundriss des Eigentümlichen: in Rücksicht auf das theoretische Vermögen als Handschrift für seine Zuhörer (1795)Von EverandGrundriss des Eigentümlichen: in Rücksicht auf das theoretische Vermögen als Handschrift für seine Zuhörer (1795)Noch keine Bewertungen
- Kaulbach, Friedrich - Kritik Der Vernunft Und Vernunft Der Sinnwahrheit Bei NietzscheDokument20 SeitenKaulbach, Friedrich - Kritik Der Vernunft Und Vernunft Der Sinnwahrheit Bei NietzscheLuca GuerreschiNoch keine Bewertungen
- SKA02 02 EinleitungDokument113 SeitenSKA02 02 EinleitungMichael V.Noch keine Bewertungen
- Philosophie des Unbewußten: Speculative Resultate nach inductiv-naturwissenschaftlicher MethodeVon EverandPhilosophie des Unbewußten: Speculative Resultate nach inductiv-naturwissenschaftlicher MethodeNoch keine Bewertungen
- Selbst und Welt: Zur Metaphysik des Selbst bei Heidegger und CassirerVon EverandSelbst und Welt: Zur Metaphysik des Selbst bei Heidegger und CassirerNoch keine Bewertungen
- Subjektivität denken: Anerkennungstheorie und BewusstseinsanalyseVon EverandSubjektivität denken: Anerkennungstheorie und BewusstseinsanalyseNoch keine Bewertungen
- Das Argument 90Dokument205 SeitenDas Argument 90king_buzzoNoch keine Bewertungen
- Das Argument 85Dokument178 SeitenDas Argument 85cihamNoch keine Bewertungen
- Bondeli - Zur Fichtes Kritik An Reinhold - 1997Dokument15 SeitenBondeli - Zur Fichtes Kritik An Reinhold - 1997Federico OrsiniNoch keine Bewertungen
- Nietzsches Einfluss Auf Reiner Maria RilkeDokument8 SeitenNietzsches Einfluss Auf Reiner Maria RilkeIrynaRosenrotNoch keine Bewertungen
- Zeitschrift Für Philosophie Und Philosophische Kritik - Unknown - Anna's ArchiveDokument4 SeitenZeitschrift Für Philosophie Und Philosophische Kritik - Unknown - Anna's ArchiveleanderasbarrosNoch keine Bewertungen
- Nietzsche Lesen - W. de GruyterDokument224 SeitenNietzsche Lesen - W. de GruyterNéstor González100% (2)
- Tomonaga Tairako, Materialismus Und Dialektik Bei MarxDokument9 SeitenTomonaga Tairako, Materialismus Und Dialektik Bei Marxmarx_dialectical_studiesNoch keine Bewertungen
- Warenform Und DenkformDokument23 SeitenWarenform Und DenkformErna Von Der WaldeNoch keine Bewertungen
- Manfred Dahlmann - Warenform Und DenkformDokument10 SeitenManfred Dahlmann - Warenform Und DenkformGerd LudwigNoch keine Bewertungen
- Manfred Baum HegelDokument386 SeitenManfred Baum HegelTu Alex100% (1)
- Harris LuegenDokument37 SeitenHarris LuegenDelungNoch keine Bewertungen
- Elementarmathematik I: Wintersemester 2019/2020Dokument10 SeitenElementarmathematik I: Wintersemester 2019/2020Carmen CorbescuNoch keine Bewertungen
- Arbeitspapier KuratierenDokument25 SeitenArbeitspapier Kuratierenjp45wwjqgvNoch keine Bewertungen
- Diamant Sutra deDokument13 SeitenDiamant Sutra deWU GANGJIENoch keine Bewertungen
- Kaufmann, IDILIOS Kommentar PDFDokument155 SeitenKaufmann, IDILIOS Kommentar PDFLaura Rodríguez FríasNoch keine Bewertungen
- Dennett - Kein Bewusstsein Ohne SpracheDokument2 SeitenDennett - Kein Bewusstsein Ohne SprachelercheNoch keine Bewertungen