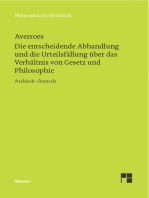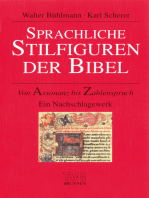Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
ToralNiehoff WienerZeitschriftfr 2018
ToralNiehoff WienerZeitschriftfr 2018
Hochgeladen von
Ulisse SantusOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
ToralNiehoff WienerZeitschriftfr 2018
ToralNiehoff WienerZeitschriftfr 2018
Hochgeladen von
Ulisse SantusCopyright:
Verfügbare Formate
Department of Oriental Studies, University of Vienna
Review
Reviewed Work(s): The Rhetorical Fabric of the Traditional Qaṣīda in Its Formative Stages:
A Comparative Study of the Rhetoric in Two Traditional Poems by ˁAlqama l-Faḥl and
Bashshār b. Burd. (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 98) by Ali Ahmad
Hussein
Review by: Isabel Toral-Niehoff
Source: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes , 2018, Vol. 108 (2018), pp. 373-
375
Published by: Department of Oriental Studies, University of Vienna
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/10.2307/26808042
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
Department of Oriental Studies, University of Vienna is collaborating with JSTOR to digitize,
preserve and extend access to Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:01:51 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Arabistik 373
sondern gerade auch bei den zweisprachigen Sprechern auf dem Land (mit einer berberi-
schen Familiensprache): diese lernen diese Varietät als eine transparent ausgeglichene
Zweitsprache, statt eine der dialektal geprägten Varietäten. Die im Buch vorgenommene
Auswahl der Formvarianten des mar. Arabischen ist in diesem Sinne durchweg plausibel
(und zeigt die Vertrautheit des Verfassers mit den Verhältnissen in Marokko). Dass bei
Einzelheiten auch andere Sichtweisen möglich sind, ist unvermeidlich. Das gilt z.B. für
das Feld der Diphthonge, deren Monophthongierung vor allem durch eine Morphemgrenze
blockiert werden kann; insofern ist es nicht unproblematisch, wie im Buch Formen wie
/fajn/ „wo“ als Koiné-Variante ohne Erläuterung vorzugeben (gegenüber /fin/).
Durchgehend, vor allem so in den späteren ausführlichen Texten, ist die Variation in
Richtung auf das Standarabische (die Fuᵴћa) im Blick. Sie dominiert die Einführung aber
nicht. Das ist ein Unterschied zu der o.g. Einführung von Chekayri, die gewissermaßen
von der Hochsprache (d.h. der Schriftsprache) ausgeht und in den Textbeispielen geradezu
eine „mittlere Sprache“ (luʁa wuᵴᵵa) präsentiert, wie sie auch in den Medien zu hören ist
(allerdings auch von entsprechend schulisch Gebildeten als Kontaktform gegenüber Frem-
den mit Arabischkenntnissen gerne ins Spiel gebracht wird).
Da Marokko in Anbetracht der Verhältnisse in der arabischen Welt inzwischen eine
Ausnahme darstellt, weil man sich dort relativ ungefährdet aufhalten kann, erhält auch die
Beschäftigung mit dem mar. Arabischen einen anderen Stellenwert, auch im Studium. Die-
ses Einführungswerk bietet vorzügliche Voraussetzungen, um auf seiner Grundlage in Ma-
rokko mit den Menschen in ihrer Sprache umgehen zu können. Damit kommt aber auch
eine Sprache in den Fokus, die es wert ist, in ihrer Besonderheit gewürdigt zu werden –
gerade auch in ihrer Verschiedenheit von den anderen arabischen Varietäten (denen des
Maschriq), die meist im Vordergrund stehen.
Utz Maas (Graz)
H u s s e i n , A l i A h m a d : The Rhetorical Fabric of the Traditional Qaṣīda in Its Form-
ative Stages: A Comparative Study of the Rhetoric in Two Traditional Poems by
ˁAlqama l-Faḥl and Bashshār b. Burd. Wiesbaden: Harrassowitz, 2015 (Abhandlungen
für die Kunde des Morgenlandes 98). 292 pp. ISBN 978-3-447-10467-8. € 78,00.
Nach allgemeiner Forschungsauffassung unterscheidet sich die arabische Poesie der Ab-
basidenzeit (750-1258) grundlegend von der vor- und frühislamischen, und zwar ganz be-
sonders in Hinblick auf die Verwendung rhetorischer Mittel. So gebrauchten die Dichter
der frühen Abbasidenzeit nun anders als zuvor komplexe Tropen, vielfältige Redefiguren
und andere ausgefeilte Stilmittel, die diesem poetischen Stil das Epitheton badīˁ „modern“
einbrachten, und den Dichtern, die sie verwendeten, den Ruf, muḥdaṯ („Neuerer“) zu sein.
Diese Innovationen fanden in der damaligen Öffentlichkeit ein geteiltes Echo, wie z.B. die
lebhaften Kontroversen um den muḥdaṯ Dichter Abū Tammām zeigen.1
Die Bewertung dieses Wandels fällt in der Forschung unterschiedlich aus: Während
einige darin ein neues Phänomen sehen, das letztendlich mit den radikalen gesellschaftli-
chen und kulturellen Veränderungen dieser Zeit in Zusammenhang steht, wodurch eine
neue, urbane Elite Träger und Adressat dieser Dichtung wurde, verstehen ihn andere eher
1 Cf. Beatrice Gründler, „Modernity in the Ninth Century: The Controversy around Abū
Tammām“, Studia Islamica 112 (2017), S. 131-48.
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:01:51 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
374 Besprechungen
als Weiterentwicklung schon vorhandener Tendenzen, die sich schon in der vorislami-
schen Poesie finden. Die Kontinuitätsthese deckt sich auch weitestgehend mit der Auffas-
sung, die wir in der ersten Monographie zum badīˁ in arabischer Sprache finden, nämlich
das Kitāb al-badīˁ, verfasst vom Prinzen Ibn al-Muˁtazz (gest. 296/908). Darin identifiziert
er fünf zentrale und typische Figuren des badīˁ: istiˁāra (Metapher), ṭibāq (Antithese),
ǧinās (Paronomasie), radd ˁalā ˁaǧūz ˁalā al-ṣadr (Echo) und al-maḏhab al-kalāmī (Ar-
gumentation nach Art des Kalām). Seiner Meinung nach wurden diese allerdings auch von
früheren Dichtern verwendet, das Neue im badīˁ war nur die höhere Frequenz und der
bewusste Gebrauch. Die Frage ist: Liegt bei Ibn al-Muˁtazz über die Betonung der Konti-
nuität etwa eine Legitimierung für den als problematisch empfundenen „neuen Stil“ vor
(wie oft behauptet)? Oder können wir tatsächlich schon in der vorislamischen Poesie die
Verwendung aufwendiger rhetorischer Mittel nachweisen? Anders gefragt – inwieweit ist
die arabische Dichtung schon vor der Einführung des badīˁ rhetorisch?
Ali Ahmad Hussein [H.] nimmt sich dieser Fragestellung an und nähert sich ihr über
eine komparatistische Fallstudie, indem er zwei Qasiden, die jeweils vor oder nach der
postulierten Zäsur verfasst wurden, erst separat einer sorgfältigen rhetorischen Analyse
unterzieht, und dann die verwendeten Stilmittel gegenüberstellt. Er bemängelt zu recht,
dass es an einer solchen Einzelstudie bis jetzt fehlt und setzt sich in seiner Arbeit zum Ziel,
auf der Grundlage dieses Vergleichs eine solidere Basis für die Diskussion zu gewinnen.
Stellvertretend für die vor- und frühislamische Dichtung behandelt er die Qaside (n.2 in
seinem Dīwān, auf mīm) des ˁAlqama l-Faḥl (gest. ca. 603 n.Chr.), der als ˁabīd al-šiˁr für
die besonders sorgfältige Ausarbeitung seiner Poesie bekannt war; als Repräsentant des
badīˁ Stils dient die Qaside (n.3 in seinem Dīwān, auf dāl) des Baššār b. Burd (gest.
167/784), der als einer von dessen frühesten Vertretern gilt. Beide Oden haben zudem den
Vorteil, von fast genau gleicher Länge zu sein (55 bzw. 52 Verse). H. konzentriert sich
dabei auf den bayān (Bildersprache) und den badīˁ (stilistische Verzierung, „embellish-
ment“), und lässt die Diskussion der maˁānī (syntaktische Rhetorik) aus, die seines Erach-
tens zu weit führen würden und im badīˁ wenig relevant sind.
Zunächst stellt er in einem einführenden Kapitel (S. 1-27) die Diskussion des badīˁ in
klassisch arabischen Quellen dar, indem er die Behandlung in Grammatik, Korankommen-
taren und Adab skizziert; dann diejenige in den ersten Monographien zum Thema von al-
Mubarrad (gest. 286/899), des genannten Ibn al- Muˁtazz und in den iˁjāz al-Qurˀān Wer-
ken; im Anschluss die Schriften von ˁAbd al-Qāhir al-Ǧurǧānī (gest. 471/1078) und seinen
Schülern; um schließlich noch kurz die Werke des 7./13. Jahrhunderts zu streifen. Deutlich
wird eine zunehmende Ausdifferenzierung der Terminologie. Zur Illustration der Vorge-
hensweise dieser vormodernen arabischen Literaturkritiker (Vers für Vers, Analyse der
Bildersprache vor allem in Hinblick auf den erzielten ästhetischen Effekt) stellt er den
ausführlichen Korankommentar von vier Koranversen (S. 13-27; Q 1:5; Q 2:7; Q 3:90; Q
2:17) des al-Zamaḫšarī (gest. 538/1144) vor.
Im zweiten Kapitel (S. 28-41) diskutiert H. die moderne Forschungsdiskussion über
den badīˁ. Im Zentrum stehen hierbei die Thesen von Wolfhart Heinrichs, Suzanne Stet-
kevych und Ewald Wagner zum Aufkommen des badīˁ, und dann die Vorarbeiten von Abū
Mūsa und Julie Meisami in Hinblick auf eine rhetorische Analyse von literarischen Texten.
Diesem Abschnitt schließt H. im dritten Kapitel (S. 42-59) eine detaillierte und syste-
matische Darlegung der arabischen Terminologie rhetorischer Termini an. In Anbetracht
der sehr unsystematischen Verwendung in den Quellentexten bietet dieser Abschnitt dem
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:01:51 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Arabistik 375
Leser/der Leserin eine sehr nützliche Übersicht. Zu bemängeln ist hier allerdings, dass die
Analyseebenen unscharf getrennt werden, so dass gelegentlich nicht deutlich wird, ob es
sich um eine Begriffsgeschichte oder um die Darstellung des Phänomens selbst handelt.
Die Übersetzung in englische und damit in der westlichen Rhetoriktradition verwurzelte
Termini (z.B. kināya = metonymy) birgt zudem eigene Gefahren, hier muss man H. aller-
dings zugutehalten, dass er das Problem auch benennt.
Im vierten und fünften Kapitel übersetzt, kommentiert und analysiert er jeweils die
genannte Qaside von ˁAlqama (S. 60-121) und die des Baššār (S. 122-174) separat. Dabei
geht er, so wie in klassischen Kommentaren, Vers für Vers einzeln durch und kommentiert
ihn im Anschluss; die englische Übersetzung ist hierbei sehr wörtlich und damit etwas
holprig, sie dient aber vor allem der wissenschaftlichen Erschließung.
Diesen beiden Kapiteln schließt das Kernkapitel VI (S. 175-233) an, in dem H. die
Bildersprache analysiert („the literary images“), und die er in fünf Gruppen aufteilt (Me-
tonymie, Simile, Metapher, Analogie und Synekdoche). Er vergleicht jeweils Frequenz,
Struktur und Gebrauch und setzt sie in Bezug zu den jeweiligen Themen und Gedichtab-
schnitten. Im siebten Kapitel (S. 234-251) untersucht er schließlich „Verzierungsmittel“,
also Figuren, die vor allem die syntaktische Struktur der Verse und ihren akustischen Ef-
fekt betreffen. Diese sind im Schnitt häufiger im Gedicht des Baššār.
In seinem Abschlusskapitel (S. 252-266) führt er alle Ergebnisse zusammen und illus-
triert sie zudem in vier Tabellen. H.s Analyse zeigt anschaulich, dass sich die absolute
Frequenz der Verwendung rhetorischer Figuren bei ˁAlqama und Baššār nicht signifikant
unterscheidet. Die Differenz ist eher graduell und qualitativ: so verwendet Baššār nur noch
selten Metonymie und Simile, die in ˁAlqama zentrale Elemente sind, und zieht eher Me-
tapher und Analogie vor. Hinzu kommt, dass Baššār auch Figuren verwendet, die bei
ˁAlqama kaum vorkommen (Antithese, Ableitung, Echo, Doppelreim). H.s Befund stützt
somit die Ansicht des Ibn al-Muˁtazz, wonach schon vor- und frühislamische Poeten rhe-
torische Mittel vielfach verwendeten, und der damit die Kontinuität betont. Grundsätzlich
bleibt allerdings die Frage offen, weshalb die abbasidische Öffentlichkeit diesen Wandel
teilweise als Skandal empfand und im badīˁ einen scharfen Bruch der Tradition sah. Ent-
weder wurde diese Veränderung im Nachhinein überspitzt (und da fragt man sich, warum),
oder die Bewertungskriterien waren andere, und schon eine geringe Abweichung des klas-
sischen Kanons galt als Modernismus. Hier wären im Anschluss noch weitere literaturso-
ziologische Studien notwendig.
Ohne Zweifel leistet diese sorgfältige und solide komparatistische Studie einen wich-
tigen Beitrag zur Diskussion um die Geschichte und Ursprung des badīˁ und zeigt das
Potential einer vergleichenden Herangehensweise, die hier zum ersten Mal rigoros durch-
geführt wird. Zur Untermauerung der These von H. sollten allerdings noch weitere, ähnlich
strukturierte Studien folgen, um die Befundlage zu erweitern.
Isabel Toral-Niehoff (Berlin)
L a m e e r , J o e p : The Arabic Version of Ṭūsī’s Nasirean Ethics with an Introduction and
Explanatory Notes. Leiden/Boston: Brill, 2015 (Islamic Philosophy, Theology and
Sciences 96). IX + 550 pp. ISBN 9789004304505. € 136,00.
Der vorliegende Band enthält die Erstedition der Übersetzung der von Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
auf Persisch verfassten Ethik ins Arabische durch Rukn al-Dīn al-Ǧurǧānī, die offenbar
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:01:51 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Brockelmann-Syrische Grammatik-1912 PDFDokument376 SeitenBrockelmann-Syrische Grammatik-1912 PDFphilologusNoch keine Bewertungen
- 24 Grammatik Des Klassischen ArabischDokument139 Seiten24 Grammatik Des Klassischen Arabischlebanesefree50% (2)
- Erlaeuterungen Zur MHD GrammatikDokument123 SeitenErlaeuterungen Zur MHD GrammatikAlan ArenalesNoch keine Bewertungen
- Arabischpersisch 00 StumDokument72 SeitenArabischpersisch 00 Stumfernandes soaresNoch keine Bewertungen
- Kerr Robert - Der Aramäische Wortschatz Des Koran PDFDokument33 SeitenKerr Robert - Der Aramäische Wortschatz Des Koran PDFWuNoch keine Bewertungen
- Die entscheidende Abhandlung und die Urteilsfällung über das Verhältnis von Gesetz und Philosophie: Zweisprachige AusgabeVon EverandDie entscheidende Abhandlung und die Urteilsfällung über das Verhältnis von Gesetz und Philosophie: Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Gesenius. Ausführliches Grammatisch-Kritisches Lehrgebäude Der Hebräischen Sprache Mit Vergleichung Der Verwandten Dialekte. 1817.Dokument936 SeitenGesenius. Ausführliches Grammatisch-Kritisches Lehrgebäude Der Hebräischen Sprache Mit Vergleichung Der Verwandten Dialekte. 1817.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNoch keine Bewertungen
- Gegenwartsliteratur - Weltliteratur: Historische und theoretische PerspektivenVon EverandGegenwartsliteratur - Weltliteratur: Historische und theoretische PerspektivenGiulia RadaelliNoch keine Bewertungen
- DativDokument13 SeitenDativsaraNoch keine Bewertungen
- Arnzen, R. - LiteraturDokument54 SeitenArnzen, R. - LiteraturmuhmahNoch keine Bewertungen
- Word Order in Sanskrit and Universal Grammar by J.F.StaalDokument111 SeitenWord Order in Sanskrit and Universal Grammar by J.F.StaalSangeetha Krishnamurthi67% (3)
- Vedic RecitationDokument12 SeitenVedic RecitationAnonymous HxLd544Noch keine Bewertungen
- Polysemy and Semantic Change in The Arab PDFDokument34 SeitenPolysemy and Semantic Change in The Arab PDFbauwauhofNoch keine Bewertungen
- Der Text Als Gewebe - Lexikalische Studien Im Sinnbezirk Von Webstuhl Und Kleid - PanaglDokument10 SeitenDer Text Als Gewebe - Lexikalische Studien Im Sinnbezirk Von Webstuhl Und Kleid - PanaglAlfonso FlórezNoch keine Bewertungen
- 978 3 95650 945 2 - Alea - 9 - BauerDokument32 Seiten978 3 95650 945 2 - Alea - 9 - BauerErdoğan SevimNoch keine Bewertungen
- Quack Kritische Bemerkungen Zur Bearbeitung Von Aegyptischen Hymnen Nach Dem Neuen Reich 2007 PDFDokument22 SeitenQuack Kritische Bemerkungen Zur Bearbeitung Von Aegyptischen Hymnen Nach Dem Neuen Reich 2007 PDFImhotep72Noch keine Bewertungen
- Handout_01Dokument9 SeitenHandout_01LizaNoch keine Bewertungen
- Behzadi Ed Concepts of Authorship in Premodern Arabic TextsDokument240 SeitenBehzadi Ed Concepts of Authorship in Premodern Arabic TextshasanNoch keine Bewertungen
- 3) EinleitungDokument4 Seiten3) EinleitungHaidar Kamal AbboudNoch keine Bewertungen
- 43317625Dokument59 Seiten43317625cerealinaNoch keine Bewertungen
- (9783110197136 - Volume 1) 1a. Phraseologie Objektbereich Terminologie Und ForschungsschwerpunkteDokument10 Seiten(9783110197136 - Volume 1) 1a. Phraseologie Objektbereich Terminologie Und ForschungsschwerpunkteIliescu MariaNoch keine Bewertungen
- Abessinisches Aus Den Arabischen Überlieferungen: January 2014Dokument15 SeitenAbessinisches Aus Den Arabischen Überlieferungen: January 2014Mo Za PiNoch keine Bewertungen
- Brill: BRILL Is Collaborating With JSTOR To Digitize, Preserve and Extend Access To Iran &the CaucasusDokument3 SeitenBrill: BRILL Is Collaborating With JSTOR To Digitize, Preserve and Extend Access To Iran &the CaucasusShanaz Othman Faqe MohamedNoch keine Bewertungen
- Werner Sundermann - Mittelpersische Und Parthische Kosmogonische Und Parabeltexte Der Manichäer (1973)Dokument203 SeitenWerner Sundermann - Mittelpersische Und Parthische Kosmogonische Und Parabeltexte Der Manichäer (1973)digger257Noch keine Bewertungen
- Satzlehre Im Rahmen Der Klassischen RhetorikDokument17 SeitenSatzlehre Im Rahmen Der Klassischen RhetorikMonika TNoch keine Bewertungen
- Collection Parole de Noms de Plantes Et D'animaux Dans Taschelheyt-Berbère Du MarocDokument59 SeitenCollection Parole de Noms de Plantes Et D'animaux Dans Taschelheyt-Berbère Du MarocHammou DabouzNoch keine Bewertungen
- Herausforderungsschema Und Frauendienst Im 'Eckenlied'Dokument30 SeitenHerausforderungsschema Und Frauendienst Im 'Eckenlied'Anonymous UgqVuppNoch keine Bewertungen
- Chrestomathy of Arabic Prose-Pieces (1895)Dokument334 SeitenChrestomathy of Arabic Prose-Pieces (1895)pomegranate246Noch keine Bewertungen
- Der Stern, das Gebet, ein Narr: Zur Dialektik der Tradition bei Benjamin, Rosenzweig und KafkaVon EverandDer Stern, das Gebet, ein Narr: Zur Dialektik der Tradition bei Benjamin, Rosenzweig und KafkaNoch keine Bewertungen
- The Sambandha-SamuddesaDokument10 SeitenThe Sambandha-Samuddesa101176Noch keine Bewertungen
- Die Chinesische Schrift Und Ihre MythenDokument30 SeitenDie Chinesische Schrift Und Ihre MythenwendiliaoNoch keine Bewertungen
- Riebold Thema Rhema Geschichte OcrDokument8 SeitenRiebold Thema Rhema Geschichte OcrfrancescoscNoch keine Bewertungen
- Dalman Grammatik Des Juedisch Palaestinischen Aramaeisch 1894Dokument372 SeitenDalman Grammatik Des Juedisch Palaestinischen Aramaeisch 1894David BuyanerNoch keine Bewertungen
- Geschichte Der SprachwissenschaftDokument9 SeitenGeschichte Der SprachwissenschafttugbaNoch keine Bewertungen
- Lyrik in AfrikaDokument22 SeitenLyrik in AfrikacanschNoch keine Bewertungen
- Review GEORGI KAPCHITS, Sentence Particles in The Somali Language and Their Usage in ProverbsDokument5 SeitenReview GEORGI KAPCHITS, Sentence Particles in The Somali Language and Their Usage in ProverbsDrinkmorekaariNoch keine Bewertungen
- rlr-001 1968 32 508 DDokument25 Seitenrlr-001 1968 32 508 DViet NguyenNoch keine Bewertungen
- Mehrdeutigkeit als literarisches Thema: Strategien und Funktionen von der Romantik bis zur GegenwartVon EverandMehrdeutigkeit als literarisches Thema: Strategien und Funktionen von der Romantik bis zur GegenwartStefan DescherNoch keine Bewertungen
- Daknili, Müfit - Die Arabischlehre in Den Islamischen StudienDokument5 SeitenDaknili, Müfit - Die Arabischlehre in Den Islamischen Studiendilara20Noch keine Bewertungen
- 02 Kanon GattungDokument5 Seiten02 Kanon GattungUddipan MondalNoch keine Bewertungen
- (Studia Samaritana 1) Rudolf Macuch-Grammatik Des Samaritanischen Hebrà Isch-Walter de Gruyter (2012)Dokument618 Seiten(Studia Samaritana 1) Rudolf Macuch-Grammatik Des Samaritanischen Hebrà Isch-Walter de Gruyter (2012)JMárcio De Souza AndradeNoch keine Bewertungen
- Koranexegese als »Mix and Match«: Zur Diversität aktueller Diskurse in der tafsir-WissenschaftVon EverandKoranexegese als »Mix and Match«: Zur Diversität aktueller Diskurse in der tafsir-WissenschaftNoch keine Bewertungen
- Dialektik Und Philosophie in Platons Phaidros' (Heitsch)Dokument23 SeitenDialektik Und Philosophie in Platons Phaidros' (Heitsch)xfgcb qdljrkfgleNoch keine Bewertungen
- Gauriel - ÜbersetzungDokument68 SeitenGauriel - ÜbersetzungBoogieNoch keine Bewertungen
- Gender im Gedicht: Zur Diskursreaktivität homoerotischer LyrikVon EverandGender im Gedicht: Zur Diskursreaktivität homoerotischer LyrikNoch keine Bewertungen
- (9783111349220 - Textgrammatik) TextgrammatikDokument236 Seiten(9783111349220 - Textgrammatik) TextgrammatikEdirne GermanistikNoch keine Bewertungen
- Mamayh Im Prophetenmantel Ornat Saum UndDokument20 SeitenMamayh Im Prophetenmantel Ornat Saum Undanaya KhanNoch keine Bewertungen
- Griechische MusikDokument83 SeitenGriechische MusikMyrto VarelaNoch keine Bewertungen
- Download pdf of Praktisches Handbuch Der Neu Arabischen Sprache Teil 1 Praktische Grammatik Der Neu Arabischer Sprache Mit Zahlreichen Uebungs Beispielen Und Einer Vergleichenden Uebersicht Der Alt Und Neuarabischen full chapter ebookDokument70 SeitenDownload pdf of Praktisches Handbuch Der Neu Arabischen Sprache Teil 1 Praktische Grammatik Der Neu Arabischer Sprache Mit Zahlreichen Uebungs Beispielen Und Einer Vergleichenden Uebersicht Der Alt Und Neuarabischen full chapter ebookforyquarshpanaka108100% (1)
- Zum Verhältnis Von Geschriebener Und Gesprochener Sprache Im FrühneuhochdeutschenDokument19 SeitenZum Verhältnis Von Geschriebener Und Gesprochener Sprache Im FrühneuhochdeutschenTom GründorfNoch keine Bewertungen
- Rhetorik und Wissenspoetik: Studien zu Texten von Athanasius Kircher bis Miljenko JergovicVon EverandRhetorik und Wissenspoetik: Studien zu Texten von Athanasius Kircher bis Miljenko JergovicNoch keine Bewertungen
- Warum werden Autoren vergessen?: Mechanismen literarischer Kanonisierung am Beispiel von Paul Heyse und Wilhelm RaabeVon EverandWarum werden Autoren vergessen?: Mechanismen literarischer Kanonisierung am Beispiel von Paul Heyse und Wilhelm RaabeNoch keine Bewertungen
- Dissertation: Das Kind in Der Deutschen Und Rumänischen Phraseologie Und ParömiologieDokument16 SeitenDissertation: Das Kind in Der Deutschen Und Rumänischen Phraseologie Und ParömiologieBaloi-Mitrica DanielNoch keine Bewertungen
- Rhetorik Poetik Aesthetik HermeneutikDokument3 SeitenRhetorik Poetik Aesthetik HermeneutikFlorentino DiazNoch keine Bewertungen
- Typologie Der WörterbücherDokument25 SeitenTypologie Der WörterbücherКатя ИвановаNoch keine Bewertungen
- Ruttkowski - Gattungs Poetik Im LiteraturunterrichtDokument15 SeitenRuttkowski - Gattungs Poetik Im LiteraturunterrichtBorisNoch keine Bewertungen
- Griechisch Kommentar 2022-09-1Dokument81 SeitenGriechisch Kommentar 2022-09-1inder3Noch keine Bewertungen
- Auer Konversationelle Standard Dialekt Code ShiftingDokument29 SeitenAuer Konversationelle Standard Dialekt Code ShiftingNatalia HarnaNoch keine Bewertungen
- Saalfeld - Tensaurus Italograecus - 1884 PDFDokument604 SeitenSaalfeld - Tensaurus Italograecus - 1884 PDFClaviusNoch keine Bewertungen
- Bub GB Us8-AaaaiaajDokument72 SeitenBub GB Us8-Aaaaiaajfernandes soaresNoch keine Bewertungen
- 8400 TopLine C v8-0 de HandbuchDokument1.810 Seiten8400 TopLine C v8-0 de Handbuch123456789Noch keine Bewertungen
- Die Landschaft BeschreibenDokument2 SeitenDie Landschaft Beschreibenpierre.collas72Noch keine Bewertungen
- Lf 1.4Dokument20 SeitenLf 1.4jojo08022006Noch keine Bewertungen
- 7 TEST 1 Wersja ADokument4 Seiten7 TEST 1 Wersja AKlaudia AdamczykNoch keine Bewertungen
- Checkliste Zum Verhalten Von Kindern (CBCL) PDFDokument3 SeitenCheckliste Zum Verhalten Von Kindern (CBCL) PDFScribdTranslationsNoch keine Bewertungen
- Gram Indir PDFDokument4 SeitenGram Indir PDFEdd R. MellaNoch keine Bewertungen