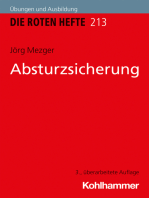Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Infoblaetter HGA TuS
Infoblaetter HGA TuS
Hochgeladen von
pemaisan1234Copyright:
Verfügbare Formate
Das könnte Ihnen auch gefallen
- ABE Drehsitz Für Vito 639Dokument41 SeitenABE Drehsitz Für Vito 639sgiesenschlagNoch keine Bewertungen
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) : Hinweise Für Die Feuerwehren in Baden-WürttembergDokument19 SeitenPersönliche Schutzausrüstung (PSA) : Hinweise Für Die Feuerwehren in Baden-WürttembergUrtaNoch keine Bewertungen
- f260 Umgang Mit Starkregenreignissen Im Kanalbetrieb Anlage 2 Arbeitssicherheit Und GefaehrdungsbeurteilungenDokument40 Seitenf260 Umgang Mit Starkregenreignissen Im Kanalbetrieb Anlage 2 Arbeitssicherheit Und GefaehrdungsbeurteilungenfelixmuNoch keine Bewertungen
- Fronius TP 2000Dokument65 SeitenFronius TP 2000EDRantwerp100% (1)
- LPG Premier LPG Premier Midflow LPG Premier HiflowDokument13 SeitenLPG Premier LPG Premier Midflow LPG Premier HiflowBerk bı BilgiçNoch keine Bewertungen
- Manuel Variosynergic 5000Dokument178 SeitenManuel Variosynergic 5000Uroš Vučković100% (1)
- TransTig 1700Dokument98 SeitenTransTig 1700Milan DuvnjakNoch keine Bewertungen
- Magicwave 2600Dokument121 SeitenMagicwave 2600Mariusz NocuńNoch keine Bewertungen
- BA Drumlifter LD-SK 002 INT LowDokument44 SeitenBA Drumlifter LD-SK 002 INT LowAllyson RincónNoch keine Bewertungen
- 0mnmhtm30rudeua 00 (Man MHT 300-500 De) (Cogi, 150411, Cogi)Dokument58 Seiten0mnmhtm30rudeua 00 (Man MHT 300-500 De) (Cogi, 150411, Cogi)Nelutu BreazuNoch keine Bewertungen
- 0020277018-03-2166330 Valiant atmoSTOR VGH 130Dokument40 Seiten0020277018-03-2166330 Valiant atmoSTOR VGH 1308bvvn5yvphNoch keine Bewertungen
- XuperMAX 2500 Manual Esqma Desp (TP2500) PDFDokument167 SeitenXuperMAX 2500 Manual Esqma Desp (TP2500) PDFNicholas WalkerNoch keine Bewertungen
- Vaillant electronicVED Pro Durchlauferhitzer InstallationsanleitungDokument18 SeitenVaillant electronicVED Pro Durchlauferhitzer InstallationsanleitungGerda StimmelNoch keine Bewertungen
- 0mnmhtm25rudeua 01 (Man MHT 100-250 De) (Cogi, 250711, Cogi)Dokument57 Seiten0mnmhtm25rudeua 01 (Man MHT 100-250 De) (Cogi, 250711, Cogi)Nelutu BreazuNoch keine Bewertungen
- 7XV5662-0AA00 Oper Inst A7 V042001 en deDokument58 Seiten7XV5662-0AA00 Oper Inst A7 V042001 en deDelvani Da SilvaNoch keine Bewertungen
- 42,0426,0001, deDokument142 Seiten42,0426,0001, deRobert MeglicNoch keine Bewertungen
- 42,0410,1096.pdf Coling PDFDokument136 Seiten42,0410,1096.pdf Coling PDFex-2156Noch keine Bewertungen
- Transpocket 2000Dokument84 SeitenTranspocket 2000裴兆奇Noch keine Bewertungen
- BetriebsanleitungDokument12 SeitenBetriebsanleitungArndt NeumannNoch keine Bewertungen
- Transgretr 2Dokument3 SeitenTransgretr 2WillNoch keine Bewertungen
- POWERmax BAET Defis PDFDokument57 SeitenPOWERmax BAET Defis PDFex-2156100% (1)
- Dados Tecnicos Motores LDWDokument63 SeitenDados Tecnicos Motores LDWEmerson Batista100% (1)
- Manual Totalarc 3000 4000 5000 DefisDokument151 SeitenManual Totalarc 3000 4000 5000 DefisLaurent GROSNoch keine Bewertungen
- Elektroinstallation Stromversorgung Schutzmaßnahmen: Arbeitsmaterial Ausbildung ITSDokument50 SeitenElektroinstallation Stromversorgung Schutzmaßnahmen: Arbeitsmaterial Ausbildung ITSMaher Dehni100% (1)
- Safety Booklet Portables Version 1.0 September22Dokument44 SeitenSafety Booklet Portables Version 1.0 September22henryjuebermannreoNoch keine Bewertungen
- Bedienungsanleitung Testomat 808 - Gebr. Heyl Analysentechnik GMBH Co - KGDokument30 SeitenBedienungsanleitung Testomat 808 - Gebr. Heyl Analysentechnik GMBH Co - KGDNoch keine Bewertungen
- AbsPumpe Operating and Installation InstructionsDokument8 SeitenAbsPumpe Operating and Installation InstructionsOl WebNoch keine Bewertungen
- Fronius Smart Meter 63A-1Dokument20 SeitenFronius Smart Meter 63A-1Bruno TerraNoch keine Bewertungen
- Airfryer HandbuchDokument44 SeitenAirfryer Handbuchmax-hudeleNoch keine Bewertungen
- 2 SIEMENS SIPROTEC 7SJ62xxDokument72 Seiten2 SIEMENS SIPROTEC 7SJ62xxpudank7jNoch keine Bewertungen
- Betrieb San Lei TungDokument16 SeitenBetrieb San Lei TungRobert HemetsbergerNoch keine Bewertungen
- MicromasterDokument44 SeitenMicromasterRicardo PinheiroNoch keine Bewertungen
- MM4 Getting Started Guide 0620 A5E02779537A AG 300620 v3Dokument52 SeitenMM4 Getting Started Guide 0620 A5E02779537A AG 300620 v3Johan AriasNoch keine Bewertungen
- BA 2874091 enDokument30 SeitenBA 2874091 enFelipe BritoNoch keine Bewertungen
- 7XV5662-0AA01 IecDokument48 Seiten7XV5662-0AA01 Iectien taiNoch keine Bewertungen
- UnterweisungDokument7 SeitenUnterweisungeximneNoch keine Bewertungen
- Deutsch 3 English 18 Magyar 33 Čeština 48 Slovenščina 63 Româneşte 78 Slovenčina 93 Hrvatski 108 Srpski 123 Български 138Dokument156 SeitenDeutsch 3 English 18 Magyar 33 Čeština 48 Slovenščina 63 Româneşte 78 Slovenčina 93 Hrvatski 108 Srpski 123 Български 138Michael LajfNoch keine Bewertungen
- 203 077Dokument56 Seiten203 077Senad SakicNoch keine Bewertungen
- MM420 GSG 19105348 0204Dokument20 SeitenMM420 GSG 19105348 0204MarcosNoch keine Bewertungen
- 7SJ62-64 Manual ATEX100 de enDokument44 Seiten7SJ62-64 Manual ATEX100 de enAbdelkadr NurhisenNoch keine Bewertungen
- GEZE Installation Instructions en 742180Dokument16 SeitenGEZE Installation Instructions en 742180PiotrNoch keine Bewertungen
- BetriebsanleitungDokument16 SeitenBetriebsanleitungumermkNoch keine Bewertungen
- De en FR Es It NL SV Fi Da NB PT Ru Cs PL: Festool GMBH Wertstraße 20 73240 Wendlingen Germany +49 (0) 7024/804-0Dokument38 SeitenDe en FR Es It NL SV Fi Da NB PT Ru Cs PL: Festool GMBH Wertstraße 20 73240 Wendlingen Germany +49 (0) 7024/804-0hermelindoangolano0Noch keine Bewertungen
- BN5930 48 203 DBDokument28 SeitenBN5930 48 203 DBMateyus EriksonNoch keine Bewertungen
- 7XV5662-0AC02 de UsDokument92 Seiten7XV5662-0AC02 de UsRafael MontagnerNoch keine Bewertungen
- Wilo TOPDokument96 SeitenWilo TOPAlexandru BocosNoch keine Bewertungen
- Sichere KläranlagenDokument30 SeitenSichere KläranlagenBorislav VulicNoch keine Bewertungen
- 09-MM-Guía Rápida y Manual MicroMaster 440Dokument121 Seiten09-MM-Guía Rápida y Manual MicroMaster 440Jhezy Andron Andron100% (1)
- Deenesfr v1.0 LP8049748 MPS-D Storage Station ManualDokument108 SeitenDeenesfr v1.0 LP8049748 MPS-D Storage Station ManualAlejo MartinezNoch keine Bewertungen
- Betriebsanleitung KT-20 De-En PDFDokument51 SeitenBetriebsanleitung KT-20 De-En PDFMatthias FedesejofNoch keine Bewertungen
- Discos de Freno WABCO MaxxxDokument79 SeitenDiscos de Freno WABCO MaxxxRusonegroNoch keine Bewertungen
- Dema 25086 DKB 2880Dokument13 SeitenDema 25086 DKB 2880Cristian SabauNoch keine Bewertungen
- Systemhandbuch B4 Siprotec4 Digsi4 deDokument522 SeitenSystemhandbuch B4 Siprotec4 Digsi4 deMGRenJcNoch keine Bewertungen
- Installations Und Wartungsanleitung Warmwasserspeicher Unistor 120 200 1859315Dokument28 SeitenInstallations Und Wartungsanleitung Warmwasserspeicher Unistor 120 200 1859315resistancex8Noch keine Bewertungen
- 7XV5654 Handbuch ManualDokument68 Seiten7XV5654 Handbuch ManualJoaquim AlvesNoch keine Bewertungen
- Application Manual Sirius Safety Integrated De-DeDokument220 SeitenApplication Manual Sirius Safety Integrated De-Demichael.schieder.123Noch keine Bewertungen
- Eine kleine Geschichte der Gerätesicherung: Bedeutung und Entwicklung von Sicherungen bei ElektrogerätenVon EverandEine kleine Geschichte der Gerätesicherung: Bedeutung und Entwicklung von Sicherungen bei ElektrogerätenNoch keine Bewertungen
- Flucht- und Rettungswege: Anforderungen behinderter Menschen an die Bewältigung von NotfällenVon EverandFlucht- und Rettungswege: Anforderungen behinderter Menschen an die Bewältigung von NotfällenNoch keine Bewertungen
- Selbstschutz - Handbuch der Vorsorge für den KatastrophenfallVon EverandSelbstschutz - Handbuch der Vorsorge für den KatastrophenfallNoch keine Bewertungen
- Pocpsa Full 052824Dokument18 SeitenPocpsa Full 052824pemaisan1234Noch keine Bewertungen
- Gemeinsame Erklärung Bündnis Für Demokratie Und MenschenrechteDokument1 SeiteGemeinsame Erklärung Bündnis Für Demokratie Und Menschenrechtepemaisan1234Noch keine Bewertungen
- Eh DigitalDokument1 SeiteEh Digitalpemaisan1234Noch keine Bewertungen
- Ansicht Diabetes Und NierenerkrankungenDokument2 SeitenAnsicht Diabetes Und Nierenerkrankungenpemaisan1234Noch keine Bewertungen
- KV-MOS Jahresplan 2024Dokument3 SeitenKV-MOS Jahresplan 2024pemaisan1234Noch keine Bewertungen
- TiefseeDokument588 SeitenTiefseeherkeuNoch keine Bewertungen
- Referat Baubec Ener IMDMP 51Dokument5 SeitenReferat Baubec Ener IMDMP 51Ener AbyNoch keine Bewertungen
- Tronsole Typ B PDFDokument18 SeitenTronsole Typ B PDFAlexanderGosnitzNoch keine Bewertungen
- SR 140 Bearbeitet Von Staatsanwalt UlbrichDokument14 SeitenSR 140 Bearbeitet Von Staatsanwalt UlbrichLarsNoch keine Bewertungen
- Betriebsanweisung-Nr.-elektrohubwagen Ameise Stapler AushangDokument2 SeitenBetriebsanweisung-Nr.-elektrohubwagen Ameise Stapler Aushangsusann.fleischmannNoch keine Bewertungen
- DGUV Routenzüge Usw.Dokument36 SeitenDGUV Routenzüge Usw.Lukas HartschNoch keine Bewertungen
- Staatenliste Umschreibung Ausl FSDokument17 SeitenStaatenliste Umschreibung Ausl FSNoel CoriaNoch keine Bewertungen
- Lernhilfe EinsatztechnikprüfungDokument13 SeitenLernhilfe EinsatztechnikprüfungAndré WagnerNoch keine Bewertungen
- Der Bremskraftverstärker: FahrwerkkundeDokument4 SeitenDer Bremskraftverstärker: Fahrwerkkundekonrad.kirchhoeferNoch keine Bewertungen
- Volvo V90 D4 Momentum AWD AutomatikDokument12 SeitenVolvo V90 D4 Momentum AWD AutomatikSaša SavićNoch keine Bewertungen
- Свет VIGNAL2013Dokument304 SeitenСвет VIGNAL2013Unisnab LtdNoch keine Bewertungen
Infoblaetter HGA TuS
Infoblaetter HGA TuS
Hochgeladen von
pemaisan1234Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Infoblaetter HGA TuS
Infoblaetter HGA TuS
Hochgeladen von
pemaisan1234Copyright:
Verfügbare Formate
Der Fachdienst Technik und Sicherheit
Verantwortung der Helfer
Für das eigene Verhalten ist grundsätzlich jede Person selbst verantwortlich. Die ein-
fachen Maßnahmen zum Arbeitsschutz und zur eigenen Sicherheit müssen von jedem
Helfer selbst durchgeführt werden.
Zum Beispiel stellt das DRK zwar die persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung, aber
benutzen muss sie der Helfer selbst.
Die Gruppe Technik und Sicherheit in der Einsatzeinheit
Stärke: -/1/3/4
Aufgaben in der Einsatzeinheit
• Unterstützen der anderen Fachdienste bei der Erfüllung ihres Auftrags
• Beraten der Einsatzleitung in Fragen der Arbeitssicherheit
• Zeltbau (Unterstützung der anderen Fachbereiche)
• Stromversorgung an der Einsatzstelle
• Wasserversorgung und -entsorgung
• Absperren von besonderen Gefahrenstellen
• Mitwirken bei der Logistik der Einsatzeinheit
• Mitwirken bei Wartungsarbeiten innerhalb der anderen Fachdienste
• Unterstützen der Zugführung in technischen Fragen
Die Fachgruppe Technik und Sicherheit im Kreisverband
Stärke: -/3/7/10
Der Trupp „Technik und Logistik“ Der Trupp „Stromversorgung/Gas/Wasser“
Stärke: -/1/5/6 Stärke: -/1/2/3
Aufgaben der Fachgruppe Technik und Sicherheit
• Ergänzen der Gruppe Technik und Sicherheit in der Einsatzeinheit
• Bereitstellen elektrischer Energie für ganze Einsatzstellen
• Ausleuchten der Einsatzstelle
• Wasserversorgung und -entsorgung
• Entsorgungsmaßnahmen
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 1-1
Die Berater des Fachdienstes
Titelzeile
Technik und Sicherheit
Der Fachdienstbeauftragte
Er steht als ständiger Berater der Kreisbereitschaftsleitung in allen Einsatzlagen zur Seite.
Der Sicherheitsbeauftragte
Er ist bei Einsätzen, im täglichen Dienst und in der Unterkunft als Berater der Gemein-
schaftsleitung tätig und berät diese bei der Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien.
Die Elektrofachkraft
Sie berät bei der Beschaffung von elektrischen Betriebsmitteln und bei der Planung von
Elektroanlagen in der Unterkunft und im Einsatz.
Die Gasfachkraft
Sie berät bei der Beschaffung von Gasverbrauchsanlagen, zur Einhaltung der Sicherheits-
vorschriften und zur Sicherung des Einsatzes.
Weitere Fachberater
Je nach Einsatzlage können weitere Fachberater erforderlich sein. Diese werden nach
Bedarf von der Einsatzleitung oder der Kreisbereitschaftsleitung berufen.
Es sind in einem Kreisverband nicht alle Fachkräfte und Fachberater erforderlich. Je nach
Aufgabenfeld und Größe des Kreisverband können einzelne Fachberater entfallen. Der
Fachdienstbeauftragte „Technik und Sicherheit“ ist als einziger unbedingt erforderlich.
Aufgrund der zahlreichen elektrischen Betriebsmittel ist auch die Elektrofachkraft erfor-
derlich.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 1-2
Gefahren von außen – Die ABCE-Regel
Mit der 5A-1B-1C-5E-Regel kann die Gefährdung am Einsatzort schnell erfasst werden.
Absturz:
Bei Arbeiten an ungesicherten Gruben, Autobahnabhängen oder Böschungen besteht
Absturzgefahr. Diese Bereiche müssen abgesperrt oder die Helfer zusätzlich gesichert
werden.
Angstreaktionen:
Das Schadensereignis stellt für die Betroffenen oft eine Ausnahmesituation dar. Fehlver-
halten oder sogar Panik können bei Betroffenen und bei den Einsatzkräften auftreten.
Atemgifte:
Der bei Bränden entstehende Rauch ist sehr giftig. Er wirkt dabei überwiegend über das
Atemsystem. Auch freigesetzte Gase, Nebel und Stäube können eine Gefahr darstellen.
Atomare Gefahren:
Unfälle mit Freisetzung von radioaktiven Stoffen sind relativ selten. Der Mensch besitzt
keine sensorische Wahrnehmung für Radioaktivität, kann daher unter Umständen die Ge-
fahr zu spät bemerken.
Ausbreitung:
In manchen Situationen ist der Schadensverlauf noch nicht abgeschlossen:
• Brände entstehen oder weiten sich aus (Funkenflug beachten)
• Hinter einem Verkehrsunfall auf der Autobahn können sich weitere Auffahrunfälle ereig-
nen.
Biologische Gefahren:
Krankmachende Keime können in Labormaterialien oder militärische Kampfstoffe in einer
Ladung eines Fahrzeuges enthalten sein. Aufgrund der hohen Gefährdung müssen be-
sondere Maßnahmen getroffen werden.
Chemische Gefahren:
Gefährliche chemische Stoffe können explosiv, leicht entzündlich, brandfördernd, giftig
oder ätzend sein, heftig reagieren oder unter Druck stehen. Neben diesen akuten Wir-
kungen können aber auch Spätfolgen (z. B. Krebs, Allergien, Genschäden) auftreten.
Einsturz:
Die Statik eines Gebäudes kann durch ein Schadensereignis verringert werden. Die Mög-
lichkeiten sind vielfältig (Brand, Explosion, Erdbeben).
Elektrizität:
Oft führen durch Brände, Unfälle oder Erdbeben beschädigte elektrische Anlagen noch
Spannung. Gefahr droht z. B. von herabhängenden Leitungen und durch die Leit-fähigkeit
von Materialien wie Metall oder Wasser.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 2-1 (1/2)
Erkrankung/Verletzung:
• Infektion durch ungeschützten Kontakt mit Blut
• Erkältung oder gar Unterkühlung durch nicht ausreichende Einsatzkleidung
• Schnittverletzungen durch Glassplitter
• Umknicken im unebenen Gelände
• Jegliche Verletzungen von Betroffenen
Ertrinken:
In Gewässern besteht die Gefahr des Ertrinkens. Wenn der Betroffene sein Gesicht nicht
selbstständig über Wasser halten kann, ertrinkt er. Bei starken Regenfällen oder Hoch-
wasser besteht die Gefahr, durch die Strömung mitgerissen zu werden.
Explosion:
Neben Explosivstoffen (z. B. Sprengstoff) können auch Mischungen von brennbaren
Stoffen in Verbindung mit Luft explodieren.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 2-1 (2/2)
Selbstverursachte Gefahren
Selbstverursachte Gefahren werden von den Einsatzkräften selbst mit in den Einsatz ge-
bracht.
Beispiele sind:
• Schnitt-, Quetsch-, Schürfwunden beim Umgang mit Werkzeugen
• Verkehrsunfälle
• Unfälle aufgrund ungesicherter Einsatz- oder Arbeitsstellen
• Unfälle durch Stolperstellen, z.B. Zeltabspannung
• Unfälle mit technischen Geräten
Die meisten Unfälle im Einsatz entstehen durch Hektik und Unruhe. Um diese Risiken zu
reduzieren, müssen alle Geräte den anerkannten Regeln der Technik entsprechen und
regelmäßig überprüft werden. Außerdem müssen die Helfer den Umgang mit den Gerät-
schaften erlernen und regelmäßig üben.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 2-2
Die Berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften BGV
Die Klassifizierungen
BGV A: Allgemeine Vorschriften
Allgemeine Vorschriften zur Arbeitsplatzgestaltung, zum Umgang mit Geräten und zu ärzt-
lichen Untersuchungen
BGV B: Einwirkungen
Definition der Einwirkung von Stoffen und anderen Immissionen
BGV C: Betriebsart/Tätigkeiten
Bestimmungen zu besonderen Tätigkeiten und Maßnahmen
BGV D: Arbeitsplatz/Arbeitsverfahren
Umgang mit besonderen Gefahren durch Werkstoffe oder Tätigkeiten
Einige Beispiele:
BGV A1 „Allgemeine Vorschriften“
BGV A3 „Elektrotechnik“
BGV B1 „Umgang mit Gefahrstoffen“
BGV D34 „Verwendung Flüssiggas“
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 2-3
Die gesetzliche Unfallversicherung
Die Unfallkasse des Bundes ist die Berufsgenossenschaft für das Technische Hilfswerk
und das Deutsche Rote Kreuz. Außerdem sind automatisch alle Personen dort versichert,
die bei Unfällen oder allgemeiner Gefahr oder Not Hilfe leisten. Dadurch sind auch Per-
sonen, die zur Hilfe der Einsatzkräfte hinzugezogen werden, dort mitversichert.
Kontakt:
Unfallkasse des Bundes
Weserstraße 47
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421/407-407
Telefax: 04421/407-400
E-Mail: info@uk-bund.de
Für Arbeiten und Einsätze, welche mit der Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes als Spit-
zenverband der freien Wohlfahrtspflege zusammenhängen, ist die Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege zuständig.
Bei falscher Angabe der Versicherung im Schadensfall werden die Kosten zwischen bei-
den Berufsgenossenschaften verrechnet.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 2-4
Die persönliche Schutzausrüstung
Schutzhelm
Gehörschutz
Schutzbrille
Einsatzjacke
Arbeits- oder
Infektionsschutzhandschuhe
Einsatzhose
Sicherheitsschuhe
Schutzhelm Nach DIN 14940 für Feuerwehrhelme, aus Aluminium oder Dura-
plast. Lebenslang haltbar. Muss bei Beschädigung umgehend
ausgetauscht werden.
Schutzbrille Nach Bedarf wird entweder ein Visier in ausreichender Größe oder
eine Schutzbrille mit geschlossenen Rändern verwendet.
Gehörschutz Gehörschutzstöpsel werden für den Einsatzfall mitgeführt. Gehör-
schutzkapseln werden in besonderen Einsatzbereichen bereitge-
stellt.
Einsatzjacke Einsatzjacke Bonn 2000 zum Schutz gegen mechanische Gefähr-
dungen und als Wetterschutz.
Arbeits- Nach EN 388-Kategorie 2 für mechanische Beanspruchung und
handschuhe EN 420 für allgemeine Anforderungen.
Infektionsschutz- Aus Latex oder bei längerer Lagerung aus Vinyl.
handschuhe
Einsatzhose Einsatzhose Bonn 2000 zum Schutz gegen normal anfallende Ein-
satzgefahren.
Sicherheits- Nach EN 345-S3. Mit Stahlkappen, durchtrittsicherer Sohle, an-
schuhe tistatisch, öl- und benzinresistent, wasserdicht, rutschhemmend,
(knöchelhoch) nicht elektrisch leitfähig.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 2-5
Verhalten nach Dienstunfällen
Bagatellverletzungen
Bagatellverletzungen sind Verletzungen, die neben der Erste-Hilfe-Leistung offensichtlich
keine weitergehende ärztliche Versorgung erforderlich machen.
Vorgehensweise:
• Unfall sofort melden und Erstversorgung durchführen
• Dokumentation des Unfalls im Verbandbuch der Unterkunft oder im Einsatztagebuch
Die Dokumentation hilft dem Betroffenen bei Spätkomplikationen, z.B. Wundentzün-
dungen, seinen Anspruch gegenüber der Unfallversicherung nachzuweisen und sollte
daher schon im eigenen Interesse vorgenommen werden.
Ernste Verletzungen
Zu den ernsteren Verletzungen zählen alle Verletzungen, die ärztlich versorgt werden
müssen.
Vorgehensweise:
• Unfall sofort melden und Erstversorgung durchführen
• Dokumentation des Unfalls im Verbandbuch der Unterkunft oder im Einsatztagebuch
• Sofort Unfallarzt (auch Durchgangsarzt oder D-Arzt) oder Krankenhaus aufsuchen, ggf.
Rettungsdienst anfordern
• Bei Augen- oder Zahnverletzungen direkt die entsprechenden Fachärzte aufsuchen
• Als Krankenkasse die Unfallkasse des Bundes (UK-Bund) nennen
• Alle Unfälle, die eine ärztliche Behandlung erforderlich machen, unverzüglich dem
Kreisverband melden
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 2-6
Kennzeichnen und Absichern
von Einsatzstellen
In ausreichender Entfernung
vor Kurven und Bergkuppen,
mindestens 100 m.
Absichern der Unfallstelle
In den meisten Fällen werden die Feuerwehr und die Polizei die Absicherung bereits
gemacht haben. Andernfalls muss der Halteplatz ggf. selbst abgesichert werden.
Die gleichen Regeln gelten auch für das Absichern eines technischen Halts während eines
Kfz-Marsches.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 2-7
Gefahrenstellen im Einsatz
Gefahrenstellen im Einsatz
Innerhalb des Einsatzgebietes kann es viele besondere Gefahrenstellen geben. Diese sind
durch das Schadensereignis entstanden oder waren bereits vorhanden.
Dazu gehören z.B.:
• Steile Abhänge
• Pfützen und sumpfiges Gelände
• Treibsand
• Ausgelaufene Chemikalien
• Wrackteile oder Trümmer
Diese Auflistung ist nicht vollständig und kann beliebig erweitert werden. Jeder Helfer soll
bei Erkennen von Gefahrenstellen diese melden, damit die Gruppe TuS diese absperren
kann.
Sichern der Gefahrenstellen
Zum Absperren dieser Gefahrenstellen steht das Material des Technik-Anhängers zur
Verfügung. Mit Absperrband und Absperrstangen können die verschiedenen Gefahren
abgesperrt werden. Eine weitere wichtige Maßnahme zur Vermeidung von Gefahren ist die
ausreichende Beleuchtung der Einsatzstelle. Nur so können Hindernisse erkannt werden.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 2-8
Schädliche Einflüsse auf die Umwelt
Generell hat jede Tätigkeit einen Einfluss auf die Umwelt. Ob dieser Einfluss schädlich für
die Umwelt ist oder nicht, hängt von der Art und Stärke des Einflusses ab.
„Die Menge macht das Gift“
In einigen Fällen wird die Umweltbeeinflussung praktisch auf null reduziert, wenn die
Einwirkung auf eine größere Fläche verteilt wird. In anderen Fällen sind die Gifte so stark,
dass eine Verteilung in jedem Fall vermieden werden muss (z.B. bei Mineralöl).
Um einen nachhaltigen Umweltschutz zu erreichen, ist es erforderlich, auch geringe
Verunreinigungen zu vermeiden.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 3-1
Gefahren für die Umwelt durch
Einsätze des DRK
Luftverschmutzungen
Luftverschmutzungen können unmittelbare Folgen für den Menschen haben, z.B. Atem-
schwierigkeiten, Hustenreiz, Lungenödeme oder Ersticken. Es entstehen aber auch lang-
fristige Auswirkungen auf die Umwelt, wie etwa saurer Regen oder das Ozonloch.
Luftverschmutzungen können im Einsatz entstehen durch
• Abgase von
–– Einsatzfahrzeugen,
–– Feldkochherden,
–– Feldheizgeräten,
–– Netzersatzanlagen,
–– Verbrennungsmotoren anderer Geräte,
• Ausdünstungen von Reinigungs- und Lösungsmitteln
Bodenverunreinigungen
Abfälle auf und im Boden können Tiere verletzen oder nachhaltig ihren Lebensraum zer-
stören. Giftige Stoffe werden aus den Abfällen ausgewaschen, können auf diesem Weg
ins Grundwasser gelangen und so eine Gewässerverunreinigung verursachen.
Bodenverunreinigungen können entstehen durch
• Abwässer
• Küchenabfälle
• Sanitäre Anlagen, tierische und menschliche Ausscheidungen
• Reinigungsmittel (z.B. Seifenlauge)
• Dekontamination von Personen, Fahrzeugen, Gegenständen
• Kraftstoffe und (Motor-)Öle
Gewässerverschmutzungen/Trinkwasserschädigung
Abwässer und andere umweltschädigende Flüssigkeiten (z.B. Öl) können unmittelbar in
Bäche und Flüsse und von dort ins Grundwasser gelangen. Gewässerverschmutzung
entsteht durch ähnliche Faktoren wie Bodenverunreinigung.
Lärmbelästigung
Für Einsatzkräfte und unbeteiligte Dritte kann Lärm, wie er z.B. durch den dauerhaften
Einsatz von Netzersatzanlagen, Motoren oder Pumpen entsteht, schädlich sein. Dies geht
von einfacher Belästigung bis hin zu psycho-motorischen Störungen, die auch nach dem
Einsatz noch längere Zeit anhalten können. Mögliche Lärmbelastungen entstehen durch
• Motoren,
• Werkzeuge,
• Einsatzfahrzeuge (z.B. Sondersignalanlagen),
• allgemeinen Einsatzlärm (Geschrei, Lautsprechersysteme).
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 3-2 (1/2)
Gefahren für die Tierwelt
Abfälle und Lärm stellen Beeinträchtigungen für die Tierwelt dar. Abfälle können die Zu-
gänge zu Wohnbauten von Tieren versperren. Tiere können sich an den verschiedensten
Abfällen schwer verletzen und sogar daran sterben. Lärm vertreibt Tiere aus ihren be-
kannten Lebensräumen. Der ausgelöste Stress kann die Gesundheit der Tiere stark beein-
trächtigen.
Mögliche Gefahren für die Tierwelt sind
• Strangulation durch die Griffe von Plastiktüten,
• Schnittverletzungen an scharfkantigen Abfällen, wie z. B. Konservendosen und Alu-
folie,
• Fressen von Giftstoffen.
• Lärm an der Einsatzstelle,
• bodennahe Abgase (z. B. von Netzersatzanlagen, Motoren),
• Einsatzfahrzeuge.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 3-2 (2/2)
Rechtliche Grundlagen von
Umweltschutz und Abfallwirtschaft
Allgemeingültige Vorschriften
• Abfallverzeichnisverordnung (AVV)
• Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImschG)
• Bundesnaturschutzgesetz
• Gewerbeabfallverordnung
• Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (Krw-/AbfG)
• Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)
• Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von
Siedlungsabfällen (TA Siedlungsabfall) Trinkwasserverordnung
• Trinkwasserverordnung
• Unfallverhütungsvorschriften
• Verpackungsverordnung (VerpackV)
• Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
• Landesspezifische Katastrophenschutz-(KatS-)Gesetze
• Landesabfallgesetz
• Landeswassergesetz
Umweltschutz in den DRK-Einheiten
In einigen Ordnungen wird der Umweltschutz als Aufgabe definiert:
• Ordnung der Bereitschaften
• Ordnung der Bergwacht
• Ordnung der Wasserwacht
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 3-3
Grundsätze der Abfallwirtschaft
• Vermeidung unnötiger Abfälle
• Berücksichtigung der Entsorgung bei der Beschaffung, d.h.
–– Verwendung von Mehrwegsystemen
–– Vermeidung von Einwegverpackungen, -geschirr etc.
• Sortierung anfallender Reststoffe, z.B.
–– Speisereste
–– Glas
–– Papier, Pappe, Kartonagen
–– Sonderabfall (sortenrein erfassen)
• Planung geeigneter Rückhalte- und Sortiermittel, z.B.
–– Fettabscheider
–– Verschiedene Müllgefäße, angepasst an die Vorgaben des jeweiligen Entsorgers
• Erstellung eines Abfallwirtschaftsplanes
Bei wenig Abfall werden die getrennten Abfälle nach Einsatzende zur Unterkunft mitge-
nommen und der üblichen Müllentsorgung zugeführt (Abfallwirtschaftsplan).
Wenn bei größeren Einsätzen höhere Abfallmengen vorhanden sind, lässt die Einsatzein-
heit über ihren Leiter die bereits getrennten Abfälle an der Einsatzstelle durch die zustän-
dige Behörde entsorgen. Bei mehrtägigen Einsätzen sind die Abfälle regelmäßig zu ent-
sorgen.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 3-4
Praktischer Umgang mit Abfällen
Zur Entsorgung von Abfällen sollten beschriftete Behälter bereitgehalten und unterschied-
liche Abfälle in Behältnissen oder Säcken getrennt gesammelt werden.
Abwässer/Flüssige Abfälle
• Abwasser aus dem Küchenbereich (z.B. Spülwasser, Seifenwasser und Reinigungs-
mittel) müssen gesondert entsorgt werden.
• Fettiges Spülwasser nicht in Bäche oder Gräben leiten. Fettabscheider verwenden
(mobil).
• Abwässer in großen Mengen z.B. aus dem Sanitärbereich (persönliche Notdurft) sowie
kontaminierte Abwässer müssen durch ein anerkanntes Unternehmen fachgerecht
entsorgt werden.
Immissionsschutz/Vermeidung gasförmiger Abfälle
• Lärm vermeiden
• NEA-Stellplatz mit dem Wind errichten/Geruchsbelästigung vermeiden
• Abgase vermeiden (Gerätewartung)
• Einsatzfahrzeuge und Standheizungen nicht unnötig laufen lassen
Naturschutz
• Umweltfreundliches und vorsichtiges Verhalten in der Natur und im Einsatz
• Wasserschutzgebiete beachten
• Beim Tanken und Ölauffüllen Einfüllstützen und öldichte Unterlagen verwenden
• Mobile Toiletten nutzen
• Lagerplatz sauber halten (nach dem Einsatz gemeinschaftlich absuchen)
Generell ist jeder Fachdienst für den in seinem Bereich anfallenden Müll selbst
verantwortlich.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 3-5
Vorbeugender Brandschutz
Im vorbeugenden Brandschutz sind alle Maßnahmen zusammengefasst, die vor der
Entstehung eines Brandes ergriffen werden können.
Diese werden nochmals unterteilt in:
• Baulichen Brandschutz
• Technischen Brandschutz
• Organisatorischen Brandschutz
Baulicher Brandschutz
Im baulichen Brandschutz werden alle Maßnahmen beschrieben, die beim Bau eines
Gebäudes oder eines Zeltlagers durchgeführt werden können.
Bei Gebäuden:
• Brandabschnitte einteilen
• Feuerhemmende Wände zwischen Brandabschnitten errichten
• Fest montierte Feuerlöschanlagen errichten
• Fluchtwege feuerhemmend einrichten
• Einbau von feuerhemmenden Türen oder Toren
• Einbau von Rauchabzugsanlagen und Entlüftungsfenstern
• Verwendung von feuerhemmendem Mauerwerk
Alle Einrichtungen können nur während des Baus hergestellt werden.
Bei Zeltlagern:
• Sicherheitsabstände einhalten
• Fluchtwege breit genug auslegen
Diese Maßnahmen müssen beim Errichten des Zeltlagers beachtet werden. Später ist das
nicht mehr möglich.
Technischer Brandschutz
Der technische Brandschutz umfasst folgende Maßnahmen:
Beispiele:
• Einbau von Brandmeldern
• Aufstellen von Feuerlöschern
• Bereitstellen von Rettungsgeräten
• Bereitstellen von Meldemitteln
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 4-1 (1/2)
Organisatorischer Brandschutz
Im organisatorischen Brandschutz sind alle Planungen und ständig wiederkehrenden
Maßnahmen zum Brandschutz zusammengefasst.
• Aufstellen eines Brandschutzdienstes
• Unterweisung des Personals
• Rettungsübungen abhalten
• Unnötige Anhäufung von leicht brennbaren Stoffen vermeiden
• Vorräte in Arbeitsräumen auf den Tagesbedarf begrenzen
• Kennzeichnung von Fluchtwegen und Feuerlöschgeräten
• Aschenbecher nicht in Papierkörbe oder brennbare Behälter entleeren
• Auf Gefahren durch den Einsatz bestimmter Geräte achten und diese so weit wie
möglich ausschließen
• Defekte elektrische Betriebsmittel austauschen
• Sicherheitsabstände bei Leuchten und Strahlern einhalten
• Sicherheitsabstände bei Koch- und Heizgeräten einhalten
•
Die Kennzeichnung von Fluchtwegen und Feuerlöschgeräten erfolgt durch Piktogramme.
Der technische und der organisatorische Brandschutz können von den Helfern
unmittelbar durchgeführt werden und liegt in ihrer Verantwortung.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 4-1 (2/2)
Rettungszeichen
Rettungsweg/ Rettungsweg/ Rettungsweg/ Erste Hilfe:
Notausgang Notausgang Notausgang für Verbandmittel und
nach links/ nach rechts Rollstuhlfahrer Verbandbuch
nach unten
Krankentrage: Notdusche Augenspüleinrich- Notruftelefon:
Krankentrage und tung: Telefon oder andere
meist auch Ver- Nur dort wo Säuren Sprechverbindung
bandkasten o. ä. Stoffe sind
Arzt: Rettungsweg/ Sammelstelle: Automatisierter
Sanitätsraum mit Notausgang Treffpunkt nach Externer Defibrillator
Arzt meist nur zu durch Türe Evakuierung (AED)
Sprechzeiten
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 4-2
Brandschutzzeichen
Richtungsangabe: Löschschlauch: Leiter: Feuerlöscher:
Richtungspfeil in Festmontierter Rettungsmittel für Tragbares oder
Verbindung mit Schlauch in die Evakuierung rollbares Feuer-
einem anderen Wandhalterung löschgerät
Zeichen
Brandmeldetelefon: Mittel und Geräte Brandmelder
Telefon oder andere zur Brandbekämp- (manuell)
Sprecheinrichtung fung:
Brandschutzhauben
und andere Ret-
tungsgeräte
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 4-3
Bekämpfender Brandschutz:
Die Brandklassen
Die Brandklassen
Die verschiedenen brennbaren Stoffe sind in Brandklassen unterteilt.
Alle brennbaren Stoffe einer Brandklasse können auf dieselbe Weise
gelöscht werden.
Brandklasse A:
Alle festen brennbaren Stoffe. Diese verbrennen üblicherweise mit
Flamme und Glut und können durch Abkühlen oder durch Ersticken
gelöscht werden.
Brandklasse B:
Alle flüssigen und flüssig werdenden brennbaren Stoffe. Diese ver-
brennen üblicherweise mit Flamme, aber ohne Glut. Dabei brennen die
Gase, die aus der Flüssigkeit verdampfen. Hier wird beim Löschvorgang
die Flamme erstickt.
Brandklasse C:
Alle gasförmigen brennbaren Stoffe. Diese verbrennen üblicherweise
nur mit Flamme, aber ohne Glut. Dabei verbrennen die Gase unmittel-
bar ab der Austrittstelle. Dort kommt Sauerstoff an das Gas. Hier wird
durch den Stoß mit Löschmittel das Gas von der Hitze der Flamme
getrennt und dadurch gelöscht.
Brandklasse D:
Alle brennbaren Metalle. Diese verbrennen überwiegend mit Glut und
nur geringer Flammenbildung. Brennende Metalle können nur mit
speziellem Löschmittel erstickt werden. Eine Abkühlung ist wegen der
extrem hohen Hitze, die sogar Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff
spalten kann, nicht möglich.
Brandklasse F:
Alle Fett- und Ölbrände im Küchenbereich. Der wesentliche Unterschied
zu anderen Fett- und Ölbränden ist, dass die Fette und Öle selbst so
erhitzt sind, dass sie sich jederzeit wieder selbst entzünden können,
nachdem der Löschvorgang abgeschlossen ist.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 4-4
Geeignete Feuerlöscher für die
Brandklassen
Arten von Feuerlöschern A B C D F
Pulverlöscher mit ABC-Löschpulver x x x o o
Pulverlöscher mit BC-Löschpulver o x x o o
Pulverlöscher mit Metallbrandpulver o o o x o
Kohlendioxidlöscher o x o o o
Wasserlöscher mit Zusätzen x x o o o
Wasserlöscher x o o o o
Schaumlöscher x x o o o
Löscher, geeignet für Brandklasse F o o o o x
Generelle Behandlung von Feuerlöschern
Feuerlöscher sind Druckbehälter und stehen in vielen Fällen ständig unter hohem Druck.
Um die Feuerlöscher intakt und einsatzbereit zu halten, müssen sie in regelmäßigen
Abständen von einem Service-Dienst geprüft werden.
Bei den meisten Feuerlöschern beträgt die Prüffrist 2 Jahre.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 4-5
Richtiger Umgang mit Feuerlöschern
Verhalten im Brandfall
• In jedem Fall Ruhe bewahren. Nur dann kann richtig gehandelt werden.
• Andere Personen im Gefahrenbereich warnen. Ggf. Behinderten oder Verletzten bei
der Flucht aus dem Gefahrenbereich helfen.
• Auf keinen Fall nochmals umkehren.
• Den Löschvorgang schnellstmöglich beginnen, aber ohne sich selbst in Gefahr zu
bringen.
• In jedem Fall sofort die Feuerwehr alarmieren: Notrufnummer 112 oder über die Ein-
satzleitung.
Der Löschvorgang Richtig Falsch
Brand in Windrichtung
angreifen.
Flächenbrände vorn
beginnend ablöschen.
Tropf- und Fließbrände von
oben nach unten löschen.
Wandbrände von unten
nach oben löschen.
Ausreichend Feuerlöscher
gleichzeitig einsetzen, nicht
nacheinander.
Rückzündung beachten.
Nach Gebrauch Feuer-
löscher nicht wieder an
den Halter hängen.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 4-6
© hugolacasse - Fotolia.com
© Claudia Ebel, DRK-Service GmbH
Kennzeichnungen
für die Gerätesicherheit
Um die Sicherheit von Werkzeugen zu gewährleisten, werden allgemein anerkannte Kenn-
zeichen vergeben.
GS-Zeichen
Das GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) wird in Deutschland
von zertifizierten Prüfstellen wie z. B. dem TÜV und der
DEKRA vergeben. Es bescheinigt, dass ein Produkt den
Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)
entspricht, die z.B. in Unfallvorschriften der Berufsgenos-
senschaften, DIN- und EN-Normen oder anderen allgemein
anerkannten Regeln der Technik konkretisiert sind.
Die Zertifizierung soll den Benutzer und Dritte bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung, aber auch bei vorhersehbarer
Fehlanwendung vor Schaden schützen.
CE-Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung wird verwendet, wenn ein Produkt
unter eine EU-Richtlinie fällt, die die CE-Kennzeichnung for-
dert. Die Kennzeichnung ist eine Erklärung des Produkther-
stellers, dass die Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
der entsprechenden EU-Rechtsvorschriften erfüllt sind. Diese
Erklärung ermöglicht es, das Produkt überall und ohne Aufla-
gen im europäischen Binnenmarkt einzuführen und zu vertrei-
ben.
DIN/EN-Normen
Das DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) ist die nationale Normungsorganisation, die
auch für die europäischen und internationalen Normungsaktivitäten anerkannt ist. DIN-
Normen sind Empfehlungen, ihre Anwendung ist freiwillig. EN-Normen sind europäische
Normen.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 5-1
Allgemeine Grundsätze zum Umgang
mit Handwerkzeugen
Allgemeine Grundsätze zur Benutzung
• Werkzeug nur bestimmungsgemäß gebrauchen
• Unsachgemäße Bastelei kann tödlich sein
• Werkzeugreinigung und Wartung dienen der Sicherheit, nicht der Optik
• Werkzeuge müssen sachgerecht aufbewahrt werden
Was ist gutes Werkzeug?
• Eignung
• Körpergerechte Gestaltung
• Sicherheitsgerechte Ausführung
Hochwertiges Material = lange Lebensdauer + sicheres Arbeiten
Vorteile ergonomischen Werkzeugs
• Geringere Ermüdung bei gleicher Leistung
• Entlastung von Gelenken und Muskeln
• Verminderung von Fehlreaktionen und Unfallrisiken
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 5-2
Handwerkzeuge und Arbeitsmittel:
Titelzeile
Sicherheits- und Bedienhinweise
Hammer
Hammerstiel
• Darf nicht rissig oder gesplittert sein
• Muss griffig sein
• Sollte lang genug sein
• Material mit guter Festigkeit und Elastizität
• Frei von Ölen oder Fetten (Vorsicht Handschweiß!)
Hammerkopf
• Muss mit Keilen sicher befestigt sein
• Muss nach DIN 1041 gehärtet sein
Zange
• Bei nicht ergonomisch geformten Zangengriffen oder ausgeleierten Scharnieren
Gefahr von Quetschungen und anderen Handverletzungen
• Griffe dürfen beim Zudrücken keine Klemmstellen bieten und sollten eine isolierende
Ummantelung haben (Plastikgriffe sind nicht für elektrische Arbeiten geeignet!)
Schraubendreher
Ein Schraubendreher muss perfekt in den Schraubenkopf passen, sonst besteht die Ge-
fahr von Stichverletzungen durch Abrutschen.
Griff
• Sollte ergonomisch geformt sein
Klinge
• Parallel geschliffen
• Spitze plan
• Klingenbreite und -dicke der Schraube angepasst
Handsäge
• Drei Arten: Metall-, Holz- und Kunststoffsägen
• Säge dem Material anpassen (Holz/Metall)
• Hände beim Sägen möglichst weit vom Sägeblatt weg ablegen
• Handschuhe tragen
• Werkstück so befestigen, dass es nicht federn kann
• Sägen vom Körper weg führen
• Nicht genutzte Sägen mit Blattschutz versehen und wenn möglich entspannen
(Bügelsäge)
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 5-3 (1/2)
Leitern
• Im DRK Verwendung von Stufenleitern, Stehleitern, Mehrgelenkleitern u. a.
• Vor Gebrauch auf Defekte untersuchen
• Leitern mit Schäden an Sprossen oder Holmen aussondern
• Leiter gegen Abrutschen absichern
• Richtigen Winkel beim Anlegen beachten
• Leiter nicht bewegen, wenn jemand daraufsteht
• Eine Leiter = eine Person
• Festgelegte Fristen für komplette Funktionsprüfung
Leinen
• Nach DIN-Norm werden zwei Arten von Leinen unterschieden: Feuerwehrleine und
Mehrzweckleine
• Vor und nach Gebrauch Sichtprüfung durchführen
• Einmal jährlich Funktionsfähigkeit prüfen
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 5-3 (2/2)
Fahrzeugüberprüfung
Für die Funktionsprüfung und Kontrolle der Einsatzfahrzeuge kann man sich an der
WOLKE orientieren:
W asser (Kühlwasser, Scheibenwaschwasser, Batteriewasser)
O el (Motoröl, Getriebeöl bei Automatikgetriebe und Bremsflüssigkeit)
L uft (Luftdruck, Reifenprofil, Reifenzustand und Ladung)
K raftstoff / Karosserie (Kraftstoffart, Tankfüllung, Reservekanister und Karosserie)
E lektrik (Beleuchtung, Sondersignalanlage, Scheibenwischer)
Wasser:
• Kühlwasser: Die Füllmenge muss immer im gekennzeichneten Bereich zwischen Mini-
mum und Maximum liegen. Im Winter ist auf geeigneten Frostschutz zu achten.
Öl:
• Motoröl: Die Füllmenge muss immer im gekennzeichneten Bereich zwischen Minimum
und Maximum liegen. Es dürfen nur die in der Bedienungsanleitung genannten Öle
nachgefüllt werden. Der Stand ist vor dem Starten des Fahrzeugs zu prüfen.
• Bremsflüssigkeit: Die Bremsflüssigkeit darf niemals nachgefüllt werden, da ein Defekt
der Bremsanlage die Ursache für das Absinken sein kann. Sofort Werkstatt aufsuchen.
Luft:
• Luftdruck: Bei falschem Luftdruck ist die Verkehrssicherheit beeinträchtigt, zudem
wird der Spritverbrauch erhöht. Druck bei kalten Reifen prüfen.
• Reifenprofil: Bei zu geringem Reifenprofil kann das Bremsen gefährlich werden und
Aqua-Planing entstehen. Ist kein Profiltiefenmesser vorhanden, kann die Randhöhe
einer 1-Euro-Münze als Maßstab angesetzt werden.
• Reifenzustand: Der Reifen darf keine sichtbaren Schäden aufweisen (z. B. eingefahrene
Nägel).
• Ladung: Ladung ist sachgerecht zu sichern. Zulässiges Gesamtgewicht, zulässige
Fahrzeugabmessung und GGVSEB beachten.
Kraftstoff:
• Kraftstoff: Vor dem Tanken überprüfen, welcher Kraftstoff getankt werden muss.
• Tankfüllung: Vor Fahrtantritt Füllstand des Tanks überprüfen.
• Karosserie: Das Fahrzeug auf Schäden überprüfen, diese ggf. dokumentieren.
Elektrik:
• Beleuchtungsmittel: Vor Austausch des Mittels in der Bedienungsanleitung nachsehen,
ob dies nicht von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden muss.
• Sicherungen: Sicherungen immer 1:1 austauschen, niemals eine höherwertige oder
niedrigere einsetzen.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 6-1
Checkliste Fahrzeug
Kurzprüfung der Betriebs- und Verkehrssicherheit
Fahrzeug: ______________________________________________________________________
1.) Allgemein
Fahrzeugpapiere O ¨ Fahrtenbuch O ¨
Aufbau _______________________ O ¨ Keilriemen O ¨
Reifenprofiltiefe v re: ______ v li: ______ h re: ______ h li: ______
Reifenschäden v re: ______ v li: ______ h re: ______ h li: ______
2.) Elektronik
Standlicht O ¨ Fahrlicht O ¨
Nebelscheinwerfer O ¨ Instrumentenbeleuchtung O ¨
Blinker vorn rechts O ¨ Blinker vorn links O ¨
Warnblinker O ¨ Scheibenwischer O ¨
Blaulicht O ¨ Frontblitzer O ¨
Horn O ¨ Hupe O ¨
Rücklicht O ¨ Bremslicht O ¨
Blinker hinten rechts O ¨ Blinker hinten links O ¨
Rückfahrscheinwerfer O ¨ Nebelschlußlicht O ¨
3.) Flüssigkeiten
Tankinhalt ¼ ½ ¾ O Motoröl O ¨
Bremsflüssigkeit O ¨ Kühlflüssigkeit O ¨
Scheibenwaschanlage O ¨ Batteriewasser O ¨
Prüfung durchgeführt
Bemerkungen: __________________________________________________________________
Datum ______________________ Unterschrift _______________________________
O in Ordnung ¨ nicht in Ordnung
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 6-2
Sicheres Verhalten im Straßenverkehr
Sicherheitsprüfung vor der Fahrt
Vor der Fahrt sollte das Fahrzeug anhand einer Checkliste auf Sicherheit geprüft werden.
Checkliste vorhandener Gegenstände:
• Warndreieck
• Verbandkasten
• Warnwesten
Bei größeren Fahrzeugen wird die Liste der geforderten sicherheitsrelevanten Gegenstän-
de noch erweitert.
Kfz über 3,5 t:
• Eine Warnblinkleuchte
• Ein zusätzliches Warndreieck
Kfz über 4 t:
• Zusätzlich ein Unterlegkeil
Anhänger über 750 kg:
• Zwei Unterlegkeile
Ein- und Aussteigen
Beim Einsteigen und beim Verlassen des Fahrzeugs ist immer auf den fließenden Verkehr
zu achten, besonders auf Radfahrer und Fußgänger. Das Auf- und Abspringen während
der Fahrt ist untersagt. Aus verletzungstechnischen Gründen ist auch das Heruntersprin-
gen von höher gelegenen Fahrzeugen untersagt (Trittstufen nutzen).
Sicherheitsgurte
Während der Fahrt muss jede Person im Fahrzeug durchgehend angeschnallt sein. Dies
sollte der Fahrer vor Antritt der Fahrt überprüfen.
Nutzen von Sonderrechten
Die Benutzung des blauen Blinklichts ist nur nach ausdrücklicher Anweisung erlaubt. Aus-
nahme ist das Absichern einer Unfallstelle. Bei Fahrten mit Blaulicht muss der Fahrer ganz
besonders auf die anderen Verkehrsteilnehmer achten.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 6-3
TitelzeileLadung befördern
Sichere
Be- und Entladen
• Ladung gleichmäßig verteilen
• Gegen Rutschen sichern
• Kennzeichnung von herausragender Ladung
–– Überstehende Ladung nach vorn:
Bei Fahrzeughöhe unter 2,5 m: nicht erlaubt
Bei Fahrzeughöhe über 2,5 m: max 50 cm
–– Überstehende Ladung nach hinten:
Grundsätzlich: 1,5 m
Transportstrecke bis 100 km: 3 m
–– Kennzeichnung ab 1 m Überstand über Rückstrahler:
Hellrote Fahne 30 x 30 cm, durch Querstange auseinandergehalten
Hellrotes Schild 30 x 30 cm, quer zur Fahrtrichtung pendelnd
Hellroten zylindrischen Körper, 30 cm hoch, Durchmesser 35 cm
Sicherungsmittel nicht höher als 1,5 m
–– Seitlich überstehende Ladung: max. 40 cm
Sichern der Ladung
Sämtliche im Fahrzeug transportierten Gegenstände müssen fixiert und so gegen Herum-
rutschen gesichert werden (insbesondere Gegenstände in der Fahrerkabine wie Helme).
Vor der Nutzung ist immer die Bedienungsanleitung des Sicherungsgerätes zu lesen.
Insbesondere die zugelassene maximale Gewichtslast, die gehalten werden kann, muss
ermittelt und beachtet werden. Vor jedem Gebrauch sind die Hilfsmittel auf äußerliche
Beschädigungen zu prüfen und ggf. sofort auszusortieren. Als Hilfsmittel können folgende
geprüfte Sicherheitsvorrichtungen genutzt werden:
• Sicherheitsnetze
Diese trennen oftmals den Kofferraum von der Fahrerkabine und sollten immer ge-
spannt sein. Andere Arten von Netzen können im Kofferraum über die Ladung ge-
spannt und dort an den entsprechenden Ösen befestigt werden.
• Spanngurte
Spanngurte sind vor jedem Gebrauch auf äußerliche Schäden am Band zu kontrol-
lieren und bei Defekten auszusortieren. Es ist auf die Zugkraft zu achten, die auf den
Fähnchen an den Gurten aufgedruckt sind. Diese Gurte sind nur zum Festzurren, nicht
zum Heben von Lasten geeignet.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 6-4
Verhalten bei Unfällen
Verhaltensgrundsätze
• Ruhe bewahren
• An der Unfallstelle bleiben
• Unfallstelle absichern
• Ggf. Erste Hilfe leisten/Rettungsdienst alarmieren
• Polizei anrufen
• Nicht zur Schuldfrage äußern
• Ggf. Zeugen feststellen und bitten, auf die Polizei zu warten
• Meldung an den Kreisverband, Führer vom Dienst, Bereitschaftsleiter, Zugführer ...
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 6-5
Einweisen von Fahrzeugen
Grundsätzliche Hinweise
• Der Einweiser steht immer im Sichtfeld des Fahrers.
• Kann der Einweiser den Bereich hinter dem Fahrzeug nicht einsehen, muss ein
Sicherungsposten eingesetzt werden.
• Bei Rückwärtsfahrten befinden sich Einweiser und/oder Sicherungsposten niemals
zwischen Fahrzeug und Hindernis.
Zur Einweisung gelten die Übermittlungszeichen für den Katastrophenschutz.
„Rückwärts fahren“ „Vorwärts fahren“
„Fahrzeug fährt in die angezeigte Richtung“
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 6-6 (1/2)
„Halt“
„Abstand anzeigen mit anschließendem Halt“
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 6-6 (2/2)
Anhänger sachgerecht ankuppeln
und sichern
Folgende Punkte sind beim Ankuppeln zu beachten:
• Die Verbindung zwischen Zugfahrzeug und Anhänger ist ordnungsgemäß hergestellt
(Kupplung geschlossen und gesichert, elektrische Verbindung hergestellt).
• Verbindungsleitungen scheuern nicht und hängen nicht bis zum Boden durch.
• Die Dichtungsringe der Kupplungsköpfe sind in einwandfreiem Zustand.
• Bei Fahrten ohne Anhänger: Die Schutzkappen der Kupplungsköpfe sind aufgesetzt.
• Die Zuggabel des Anhängers ist unbeschädigt und bodenfrei (mindestens 200 mm).
Kugelkopfkupplung
Vor dem Anhängen muss ggf. die Schutzkappe vom Kugelkopf am Zugfahrzeug entfernt
werden. Der Anhänger wird so weit in Richtung des Zugfahrzeugs geschoben, dass die
vertikalen Achsen der Anhängerkupplung und des Kugelkopf eine Linie bilden. Das Stütz-
rad wird so weit heruntergedreht, dass die Kupplung auf dem Kugelkopf einrastet. Hierbei
ist zu kontrollieren, ob die Kupplung wirklich eingerastet ist. Danach wird das Stützrad
vollständig hochgestellt und eingerastet. Die elektrischen Leitungen müssen verbunden
und ihr sicherer Sitz überprüft werden. Anschließend ist eine Funktionsprüfung durchzu-
führen. Die Fang- bzw. Abrissleine wird mit dem Fahrzeug verbunden. Feststellbremse
lösen, Unterlegkeile entfernen und in der Halterung sicher verstauen.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 6-7
Zelttypen und ihre Verwendung
Zelttypen
Es gibt drei Zelttypen:
• Gelenkbinderzelte
• Gerüstzelte
• Aufblasbare Zelte
Die Bezeichnung SG ist eine Typenbezeichnung der Herstellerfirma Lanco und kann mit
Stangengerüstzelt oder Sanitätsgerüstzelt übersetzt werden. Die zweistellige Zahl hinter
„SG“ gibt die ungefähre Grundfläche des Zeltes an.
Zeltgrundflächen:
SG 12: 3,34 m x 4,08 m = 13,60 m²
SG 18: 4,34 m x 4,08 m = 17,70 m²
SG 20: 5,00 m x 4,74 m = 23,70 m²
SG 30: 6,00 m x 5,64 m = 33,80 m²
SG 40: 8,00 m x 5,64 m = 45,00 m²
SG 50: 10,00 m x 5,64 m = 56,40 m²
Im Gegensatz zu normalen Zelten hat ein Küchenzelt eine andere Zelthaut. Diese muss
aus einem schwer entflammbaren Kunststoffgewebe sein, das leicht zu reinigen ist und
keinen Nährboden für Bakterien bietet. In beiden Seiten des Daches muss eine ausstell-
bare Dachentlüftung vorhanden sein. Auch muss es einen Durchlass für den Schornstein
des Feldkochherdes geben.
Bei einem Gelenkbinderzelt sind die Fuß- und Dachstangen durch Gelenke verbunden
und bilden ein Teil. Das Zeltgerüst wird durch einzelne Trauf- und Firststangen vervollstän-
digt. Die Zelthaut besteht aus vielen Einzelteilen und wird miteinander verbunden.
Ein aufblasbares Zelt wird mittels Druckluft aufgebaut. Das Zelt ist so gefaltet, dass sich
die Zelthaut durch die einströmende Druckluft eigenständig entfaltet und aufrichtet. Es
sind keine weiteren Gelenkstangen zur Stabilisierung nötig. Es ist während des Betriebs
darauf zu achten, dass die Luft nicht entweicht, da das Zelt sich sonst zusammenfalten
kann. Es gibt Zelte, die mit Druckluft aufgeblasen werden und dann eigenständig stehen-
bleiben, aber auch Zelte, die dauerhaft mit einem Gebläse aufgepustet werden müssen.
Verwendungszwecke von Zelten
Zelte werden genutzt als:
• Sanitätszelt für Verletzte
• Betreuungszelt für Betroffene
• Küchenzelt für Verpflegung
• Aufenthaltszelte für die Führung und Einsatzleitung
• Aufenthalts- und Schlafzelte für Einsatzkräfte und Betroffene
• Lager- und Materialzelt
• Dusch- und Sanitärzelt
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 8-1
Titelzeile
Zelte systematisch auf- und abbauen
Zeltaufbau
• Vor dem Aufbau strategisch günstigen Standort suchen (ebener, trockener Untergrund)
• Zelthaut innen durch Schnallen am Zeltgestänge befestigen (Dach- und Fußstangen)
• Zelt mit Heringen und Zeltnägeln im Boden verankern
• Bei starkem Wind und längerer Standzeit Sturmabspannung anbringen
Zeltstangen auslegen
• Vor dem Auslegen des Gestänges den Standort des Zelteingangs bestimmen
• Anzahl der Helfer richtet sich nach der Anzahl der Fußstangen
• Vor dem Aufbau alle Zeltteile auspacken und auf Vollständigkeit prüfen
• Gestänge auslegen (Füße nur auf einer Seite auslegen, die restlichen außerhalb des
Aufbaufelds)
Gerüst zusammenstecken
• Traufstangen mit den Knotenstücken verbinden
• Fußstangen in die Knotenstücke einstecken, dann Dachstangen in die Knotenstücke
an der Traufe einstecken
• Firststangen mit den Knotenstücken verbinden
• Die anderen Dachstangen in die Knotenstücke am Dachfirst stecken
• Die Traufstangen wieder am Boden liegend mit den Knotenstücken verbinden, dann
dies in die Knotenstücke an den Dachstangen einstecken.
Zeltplane ausbreiten
• Zeltplane ausrollen und mit dem Faulstreifen zum Zelt hin legen
Folie über das Gerüst ziehen
• Plane über das Gestänge ziehen, bis sie passend auf Trauf- und Firststangen aufliegt
• Im Zeltinnern die Schnallen der Plane an den Stangen befestigen
• Fußschnallen handfest anziehen
• Plane und Faulstreifen auf der Seite ohne Füße aufs Dach klappen und Füße ansetzen
• Dann alle Schnallen der Plane festzurren
• Zelt final ausrichten und mit Zeltnägeln im Boden verankern
• Fußschnallen vollständig festzurren, mit Heringen die Plane befestigen
Zeltabbau
• Vor dem Abbau kontrollieren, ob die Zeltplane innen und außen trocken ist
• Alle Schnallen von den Stangen lösen, die Plane vom Gestänge ziehen
• Plane reinigen
• Giebel einklappen und faltenfrei auf der Plane auflegen
• Plane vom Dachfirst ausgehend bis zur gegenüberliegenden Seite mit dem Faulstrei-
fen einklappen, Plane nochmals um die Hälfte falten
• Gestänge in umgekehrter Reihenfolge zum Aufbau zurückbauen
• Beim Verpacken des Zeltes alle Teile wieder einsammeln (auch Zeltheringe und -nägel)
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 8-2
Gefahrstoffe im DRK
Gefahrstoffe im Rotkreuz-Alltag
Viele Arbeiten im Haushalt und auch im Roten Kreuz sind mit diversen Chemikalien
verbunden. Diese umfassen verschiedenste Stoffe, die unterschiedlich gefährlich sind.
Dazu gehören zum Beispiel:
• Haushaltsreiniger
• Seife
• Lösungsmittel
• Desinfektionsmittel
• Klebstoffe
• Spraydosen mit allen Inhalten
• Benzin und Diesel
Gefahrstoffe im Einsatz
Im Einsatz sind neben den üblichen Haushaltschemikalien noch einige andere Gefahr-
stoffe zu beachten. Diese unterteilen sich in vier Gruppen:
1. Flüssiggas
2. Brennbare Flüssigkeiten
3. Druckgasflaschen mit Sauerstoff
4. Diverse Kleinverpackungen mit Reinigungsmitteln, Desinfektionsmitteln und Schmier-
mitteln oder anderen Stoffen.
Die Lagerung und die Verwendung dieser Gefahrstoffe werden in den BGV reglementiert.
Die Gefahrstoffe in diesen vier Gruppen können innerhalb der Gruppe gleich behandelt
werden. Der Transport dieser Gefahrstoffe im PKW oder LKW fällt unter die „Gefahrgüter-
verordnung Straße und Eisenbahn und Binnenschifffahrt“ (GGVSEB).
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 9-1
Symbole zur Gefahrenkennzeichnung
Globally Harmonised System
Gegenüberstellung der alten und neuen Gefahrensymbole
Stoff- und Zubereitungsrichtlinie CLP-/GHS-Verordung
Gefahrenbezeichnung Kenn- Symbol Bezeichnung Kodierung Pikto-
buchstabe gramm
Explosionsgefährlich E Explodierende Bombe GHS01
Hochentzündlich F+ Flamme GHS02
Leichtentzündlich F
Brandfördernd O Flamme über einem Kreis GHS03
Keine Entsprechung Gasflasche GHS04
Ätzend C Ätzwirkung GHS05
Sehr giftig T+ Totenkopf mit gekreuzten GHS06
Giftig T Knochen
Gesundheitsschädlich Xn Keine Entsprechung
Reizend Xi
Keine Entsprechung Ausrufezeichen GHS07
Keine Entsprechung Gesundheitsgefahr GHS08
Umweltgefährlich N Umwelt GHS09
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 9-2 (1/2)
Einige Unterschiede bei der Vergabe von Gefahrensymbolen und
Gefahrenpiktogrammen (nicht vollständig)
Stoff- und Zubereitungsrichtlinie CLP-/GHS-Verordung
Brandfördernd: Organische Peroxide Organische Peroxide* Typ C, D, E oder F
Entzündlich ohne Entzündbare Flüssigkeiten: Kategorie 3
Symbol
Keine Entsprechung Gase unter Druck
Keine Entsprechung Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische
Keine Entsprechung Korrosiv gegenüber Metallen
Akut letale Wirkung: Xn Akute Toxizität: Kategorie 4
Irreversible nicht letale Wirkungen: T+ und T STOT** (einmalige Exposition): Kategorie 1
Schwerwiegende chronische Wirkungen: T STOT** (wiederholte Exposition): Kategorie 1
Irreversible nicht letale Wirkungen: Xn STOT** (einmalige Exposition): Kategorie 2
Schwerwiegende chronische Wirkungen: Xn STOT** (wiederholte Exposition): Kategorie 2
Aspirationsgefahr Aspirationsgefahr: Kategorie 1
CMR-Eigenschaften: Kategorien 1 und 2 CMR-Eigenschaften: Kategorien 1A und 1B
CMR-Verdachtskategorie: Kategorie 3 CMR-Verdachtskategorie: Kategorie 2
Sensibilisierung der Atemwege Sensibilisierung der Atemwege
Sensibilisierung der Haut Sensibilisierung der Haut
Gefahr ernster Augenschäden Schwere Augenschädigung
hautreizend hautreizend
augenreizend augenreizend
Reizung der Atemwege Reizung der Atemwege***
Narkotisierende Wirkung ohne Narkotisierende Wirkung***
Symbol
Gefährlich für die Ozonschicht Die Ozonschicht schädigend ohne
Piktogramm
* Organische Peroxide Typ B sind sowohl mit der explodierenden Bombe als auch mit der Flamme zu kennzeichnen.
** STOT = Spezifische Zielorgan-Toxizität
*** Diese Wirkung ist eine Differenzierung von STOT (einmalige Exposition) – Kategorie 3.
Das Andreaskreuz (nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie das Symbol mit dem Kenn-
buchstaben Xn oder Xi) wird von der CLP-Verordnung nicht verwendet. An entspre-
chender Stelle stehen im GHS-System die Gefahrenpiktogramme „Ätzwirkung“,
„Gesundheitsgefahr“ oder „Ausrufezeichen“.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 9-2 (2/2)
Titelzeile
Kennzeichnung von Gefahrstoffen
Warntafel, Gefahrnummer und UN-Nummer
Um im Straßenverkehr Fahrzeuge schnell zu erkennen, von denen eine besondere Ge-
fahr ausgeht, ist eine besondere Kennzeichnung mit Warntafeln erforderlich.
Warntafel ohne Ziffern
Allgemeine Warnung vor besonderer Gefahr durch Gefahrgut.
Warntafeln mit Ziffern
Gefahrnummer
Die Nummer in der oberen Zeile gibt die Art der Gefahr an (doppelte Nummer bedeutet:
stärkere Gefahr derselben Art). Eine weitere Zahl gibt eine Zusatzgefahr an.
1 Explosiv
2 Entweichen von Gas
3 Entzündbarkeit flüssiger Stoffe
4 Entzündbarkeit fester Stoffe
5 Oxydierende Wirkung
6 Giftigkeit
7 Radioaktivität
8 Ätzwirkung
9 Gefahr einer spontanen, heftigen Reaktion
X Reagiert auf gefährliche Weise mit Wasser
22 Tiefgekühltes verflüssigtes Gas, erstickend
44 Entzündbarer fester Stoff, der sich bei erhöhter Temperatur in geschmolzenem
Zustand befindet.
539 Entzündbares organisches Peroxid
UN-Nummer
In der unteren Reihe ist der Gefahrstoff näher bezeichnet (UN-Nummer). Diese Be-
zeichnung ist international festgelegt und fasst vielfach mehrere, sehr ähnliche Stoffe
zusammen.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 9-3
Lagerung und Transport
von Gefahrstoffen
Lagerung und Transport von Flüssiggas
Lagerung
Die Lagerung muss im Freien oder in einem belüfteten Lagerraum erfolgen, der spezi-
ell für die Lagerung von Flüssiggasflaschen ausgelegt ist. In diesem Raum dürfen keine
anderen leicht brennbaren Stoffe oder Zündquellen vorhanden sein. Für die Lagereinrich-
tungen sind spezielle Sicherheitsanforderungen zu beachten.
Unzulässig ist die Lagerung in Garagen und Arbeitsräumen, Treppenräumen, Fluren, en-
gen Höfen und Bereichen mit Fluchtwegen.
Eine preiswerte Lösung für die Lagerung ist eine für Flüssiggasflaschen geeignete Gitter-
box, die draußen aufgestellt wird.
Bei dem Transport müssen die Flaschen:
• aufrecht stehen
• gegen Rutschen oder Umfallen gesichert sein
• mit Flaschenventilen, Verschlussmuttern und Schutzkappen gesichert sein
• in geschlossenen Fahrzeugen ausreichend belüftet werden
• nach GGVSEB bzw. ADR-Regelung gekennzeichnet sein
Das Flaschenlager muss abgesperrt und ebenfalls gekennzeichnet werden. Rauchen
oder der Umgang mit offenem Feuer ist in oder in der Nähe von mit Flüssiggasflaschen
beladenen Fahrzeugen verboten. Im Fahrerhaus muss ein Feuerlöscher vorhanden sein.
Während des Be- und Entladens ist der Motor abzustellen.
Lagerung und Transport von brennbaren Flüssigkeiten
Lagerung
Brennbare Flüssigkeiten (z. B. Kraftstoffe) dürfen in begrenzten Mengen in der Garage
gelagert werden. Der Raum muss belüftet sein. Im Umkreis von 2 m darf nicht geraucht
werden. Brennbare Flüssigkeiten und Flüssiggas dürfen nicht zusammen gelagert werden.
Für evtl. Schäden an den Kanistern muss eine Gefahrstoffwanne vorgesehen werden,
die mind. 50 % der gelagerten Kraftstoffe aufnehmen kann. Zu Kraftfahrzeugen muss ein
Sicherheitsabstand von zwei Metern gehalten werden.
Die Kanister müssen
• aufrecht stehen,
• eine intakte Gummidichtung am Ausguss haben,
• dichtschließend sein,
• eine Prüfnummer an der Unterkante besitzen und
• nach Gefahrstoffverordnung oder nach GGVSEB gekennzeichnet sein.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 9-4 (1/2)
Transport
Für Transportsicherung der Ladung und Belüftung gelten dieselben Bedingungen wie für
den Transport von Flüssiggas, ebenso für das Verhalten der Besatzung. Zudem muss eine
Liste der transportierten Gefahrstoffe mitgeführt werden. Die Ladung muss so gesichert
sein, dass die Kanister nicht angestoßen oder beschädigt werden.
Lagerung und Transport von Sauerstoff
Lagerung
Im (beschilderten) Lagerregal müssen die Flaschen gegen Wegrollen und Verrutschen
gesichert sein.
Für die Lagerung der Flaschen gelten die gleichen Regeln wie bei Flüssiggasen. Zu be-
achten ist: Die Verschlüsse dürfen unter keinen Umständen gefettet werden. Der Benutzer
darf in der Nähe (2 m) nicht rauchen und keine brennbaren Flüssigkeiten oder Flüssiggas
mit einlagern. Er muss entleerte Flaschen wie volle Flaschen behandeln.
Transport
Die Flaschen
• müssen mit Verschlussmuttern gesichert sein
• müssen gegen Rutschen und Rollen gesichert sein, Ventile müssen gegen Stöße und
Schäden besonders geschützt werden (am besten in Sauerstoffvorratskästen oder
selbstgebauten vergleichbaren Kästen mit Halterungen für die Sauerstoffflasche)
• müssen eine Kennzeichnung nach GGVSEB besitzen.
Für das Verhalten der Besatzung gelten die gleichen Regeln wie oben.
Lagerung und Transport von Kleinmengen
Kleinmengen unterliegen den Bestimmungen des GGVSEB und der ADR. Für sie gelten
die Regelungen wegen der Gefahr bei Austreten von Chemikalien.
Alle haushaltsüblichen Verpackungen für Sprays und andere Chemikalien fallen hierunter.
Lagerung
• Flaschen und Spraydosen werden ausschließlich stehend gelagert
• Die Bedienungsanleitung des Herstellers gibt Auskunft über die Lagerung der jewei-
ligen Packung, diese ist unbedingt zu beachten
• Flüchtige Stoffe sind grundsätzlich an gut belüfteten Orten zu lagern
Transport
• Flaschen und Spraydosen werden ausschließlich stehend transportiert.
• Eine Kennzeichnung der Umverpackung nach GGVSEB bzw. ADR-Regelung ist Pflicht
(auch für Staukiste oder Staufach).
• Bei Transport ist ein Feuerlöscher mit 2 kg ABC-Pulver o. Ä. im Fahrerraum vorzu-
sehen. Dieser ist unabhängig von weiteren Feuerlöschern, welche nach ADR und
GGVSEB erforderlich sind.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 9-4 (2/2)
Berechnung der Transportfreigrenze
Richtlinien
Um bei den DRK-Kraftfahrzeugen ohne Gefahrgut-Führerschein (ADR-Führerschein) aus-
zukommen, transportieren die Helfer nach der Ausnahme für Kleinmengen (1000 Punkte-
Regelung). Bei Mindermengen kann ohne Sonderführerschein, ohne zusätzliche Kenn-
zeichnung und ohne die Ausrüstung für Gefahrguttransporte gefahren werden.
Lediglich ein 2 kg-Pulverlöscher der Brandklassen ABC oder ein vergleichbarer Löscher
muss im Fahrerraum vorhanden sein.
1000 Punkte-Regelung
Für jede Verpackung mit Gefahrstoffen ist eine Beförderungskategorie festgelegt. Diese
Beförderungskategorie richtet sich nach Gefahrstoff und Verpackungsart. Sie ist im
Sicherheitsdatenblatt des Herstellers angegeben.
Beförderungskategorien:
Beförderungskategorie 0: Diese Stoffe dürfen nicht transportiert werden und sind im DRK
nicht vorhanden.
Beförderungskategorie 1: Von diesen Stoffen dürfen max. 20 kg/l transportiert werden.
Für die Punkterechnung wird die Menge der Stoffe mit 50 multipliziert (Multiplikator: 50).
Beförderungskategorie 2: Von diesen Stoffen dürfen max. 333 kg/l transportiert werden.
Für die Punkterechnung wird die Menge dieser Stoffe mit 3 multipliziert.
Beförderungskategorie 3: Von diesen Stoffen dürfen max. 1000 kg/l transportiert werden.
Für die Punkterechnung wird die Menge dieser Stoffe mit 1 multipliziert.
Beförderungskategorie 4: Die Ladung dieser Stoffe ist unbegrenzt erlaubt. Diese Stoffe
sind keine Gefahrstoffe und werden in der Punkterechnung nicht eingerechnet.
Es wird nach Bestimmung aller Kategorien und Mengen gerechnet:
• Multiplikation: Stoffmenge x GGVSEB-Faktor
• Addition: Summe aller Punkte bilden
• Vergleich der Summe mit „1000“:
Summe > 1000: kein Transport
Summe < 1000: Transport nach Kleinmengen-Ausnahme
Beispiel:
Ladung Name Menge Multiplikator Summe
Flasche Propan 22 kg 3 66
1 Kanister Benzin 20 l 3 60
1 Kanister Petroleum 5l 1 5
Spraydose Rostlöser 0,4 l 3 1,2
Summe: 132,2
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 9-5
Kennzeichnung der DRK-Gefahrstoffe
Kraftstoffkanister
• Kanisterfarbe: frei wählbar, weiß kann aber mit Trink-
wasser verwechselt werden.
• Gefahrenzettel: „flüssiger, brennbarer Stoff“
• UN-Nummer: UN 1203
• Sicherheitshinweise
Flüssiggasflaschen
• Flaschenfarbe: rot, 11kg Flaschen grau
• Kragenfarbe: rot
• Kragenaufkleber für Propan/Butan
Sauerstoffflaschen
• Flaschenfarbe: weiß (früher blau)
• Kragenfarbe: weiß
• Kragenaufkleber für medizinischen
Sauerstoff
Kleinmengen
• Unabhängig von der Kennzeichnung nach GGVSEB
werden auf Chemikalienverpackungen die Gefahren
durch Symbole bezeichnet (vom Hersteller aufge-
bracht).
• Auf der Kiste muss eine Raute mit dem Buchstaben LQ
(Limited Quantity) oder/und mit den UN-Nummern der
transportierten Stoffe abgebildet sein.
Druckgasbehälter
• Gemäß der Norm (EN 1089-2) müssen Druckgasbehäl-
ter mit Gefahrgutaufkleber und Farbcodierung gekenn-
zeichnet sein.
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 9-6
Maßnahmen bei Gefahrgutunfällen
Schutzmaßnahmen bei Einsätzen aufgrund von Gefahrgutunfällen
Arbeiten im unmittelbaren Gefahrenbereich sind Sache der Feuerwehr oder anderer
Organisationen. Der DRK-Einsatz beginnt je nach Gefahrenlage im sekundären Gefahren-
bereich oder – in den meisten Fällen – in einem abgesperrten Einsatzgebiet außerhalb des
Gefahrenbereichs. Die Gruppe Technik und Sicherheit hat hier die Aufgabe, den Einsatz-
bereich abzusperren und so die Gefahren von den Einsatzkräften fernzuhalten. Weiter soll
sie entstehende Gefahren während des Einsatzes erkennen und die Einsatzkräfte warnen.
Erstmaßnahmen
Die Erstmaßnahmen sollen nach dem GAMS-Schema ablaufen:
G = Gefahr erkennen
Erkundung, Befragung und Kennzeichnung des Gefahrenbereichs
A = Absichern
Absperren, weitere Maßnahmen anderer Organisationen unterstützen
M = Menschenrettung
Unter Beachtung des Eigenschutzes Personen retten oder von der Feuerwehr (oder
anderen Organisationen) übernehmen
S = Spezialkräfte nachfordern
Wo das Wissen der Helfer nicht ausreicht, werden Berater und Fachkräfte dazugeholt
Die Feuerwehr als erste Einheit vor Ort macht die Arbeit im unmittelbaren Gefahrenbe-
reich. Wenn die Einsatzeinheit des DRK vor Ort eingetroffen ist, beschränkt sich ihre
Arbeit auf das Absichern ihres Einsatzbereichs und Unterstützung der Feuerwehr bei
Maßnahmen im Grenzbereich.
Einsatzbereich Windrichtung
Sanität und Betreuung
Unmittelbare Mittelbare
Gefahrenzone Gefahrenzone
Einsatzbereich
Technische Rettung
Schadenslage
Leitfaden Helfergrundausbildung Technik und Sicherheit
Infoblatt 9-7
Das könnte Ihnen auch gefallen
- ABE Drehsitz Für Vito 639Dokument41 SeitenABE Drehsitz Für Vito 639sgiesenschlagNoch keine Bewertungen
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) : Hinweise Für Die Feuerwehren in Baden-WürttembergDokument19 SeitenPersönliche Schutzausrüstung (PSA) : Hinweise Für Die Feuerwehren in Baden-WürttembergUrtaNoch keine Bewertungen
- f260 Umgang Mit Starkregenreignissen Im Kanalbetrieb Anlage 2 Arbeitssicherheit Und GefaehrdungsbeurteilungenDokument40 Seitenf260 Umgang Mit Starkregenreignissen Im Kanalbetrieb Anlage 2 Arbeitssicherheit Und GefaehrdungsbeurteilungenfelixmuNoch keine Bewertungen
- Fronius TP 2000Dokument65 SeitenFronius TP 2000EDRantwerp100% (1)
- LPG Premier LPG Premier Midflow LPG Premier HiflowDokument13 SeitenLPG Premier LPG Premier Midflow LPG Premier HiflowBerk bı BilgiçNoch keine Bewertungen
- Manuel Variosynergic 5000Dokument178 SeitenManuel Variosynergic 5000Uroš Vučković100% (1)
- TransTig 1700Dokument98 SeitenTransTig 1700Milan DuvnjakNoch keine Bewertungen
- Magicwave 2600Dokument121 SeitenMagicwave 2600Mariusz NocuńNoch keine Bewertungen
- BA Drumlifter LD-SK 002 INT LowDokument44 SeitenBA Drumlifter LD-SK 002 INT LowAllyson RincónNoch keine Bewertungen
- 0mnmhtm30rudeua 00 (Man MHT 300-500 De) (Cogi, 150411, Cogi)Dokument58 Seiten0mnmhtm30rudeua 00 (Man MHT 300-500 De) (Cogi, 150411, Cogi)Nelutu BreazuNoch keine Bewertungen
- 0020277018-03-2166330 Valiant atmoSTOR VGH 130Dokument40 Seiten0020277018-03-2166330 Valiant atmoSTOR VGH 1308bvvn5yvphNoch keine Bewertungen
- XuperMAX 2500 Manual Esqma Desp (TP2500) PDFDokument167 SeitenXuperMAX 2500 Manual Esqma Desp (TP2500) PDFNicholas WalkerNoch keine Bewertungen
- Vaillant electronicVED Pro Durchlauferhitzer InstallationsanleitungDokument18 SeitenVaillant electronicVED Pro Durchlauferhitzer InstallationsanleitungGerda StimmelNoch keine Bewertungen
- 0mnmhtm25rudeua 01 (Man MHT 100-250 De) (Cogi, 250711, Cogi)Dokument57 Seiten0mnmhtm25rudeua 01 (Man MHT 100-250 De) (Cogi, 250711, Cogi)Nelutu BreazuNoch keine Bewertungen
- 7XV5662-0AA00 Oper Inst A7 V042001 en deDokument58 Seiten7XV5662-0AA00 Oper Inst A7 V042001 en deDelvani Da SilvaNoch keine Bewertungen
- 42,0426,0001, deDokument142 Seiten42,0426,0001, deRobert MeglicNoch keine Bewertungen
- 42,0410,1096.pdf Coling PDFDokument136 Seiten42,0410,1096.pdf Coling PDFex-2156Noch keine Bewertungen
- Transpocket 2000Dokument84 SeitenTranspocket 2000裴兆奇Noch keine Bewertungen
- BetriebsanleitungDokument12 SeitenBetriebsanleitungArndt NeumannNoch keine Bewertungen
- Transgretr 2Dokument3 SeitenTransgretr 2WillNoch keine Bewertungen
- POWERmax BAET Defis PDFDokument57 SeitenPOWERmax BAET Defis PDFex-2156100% (1)
- Dados Tecnicos Motores LDWDokument63 SeitenDados Tecnicos Motores LDWEmerson Batista100% (1)
- Manual Totalarc 3000 4000 5000 DefisDokument151 SeitenManual Totalarc 3000 4000 5000 DefisLaurent GROSNoch keine Bewertungen
- Elektroinstallation Stromversorgung Schutzmaßnahmen: Arbeitsmaterial Ausbildung ITSDokument50 SeitenElektroinstallation Stromversorgung Schutzmaßnahmen: Arbeitsmaterial Ausbildung ITSMaher Dehni100% (1)
- Safety Booklet Portables Version 1.0 September22Dokument44 SeitenSafety Booklet Portables Version 1.0 September22henryjuebermannreoNoch keine Bewertungen
- Bedienungsanleitung Testomat 808 - Gebr. Heyl Analysentechnik GMBH Co - KGDokument30 SeitenBedienungsanleitung Testomat 808 - Gebr. Heyl Analysentechnik GMBH Co - KGDNoch keine Bewertungen
- AbsPumpe Operating and Installation InstructionsDokument8 SeitenAbsPumpe Operating and Installation InstructionsOl WebNoch keine Bewertungen
- Fronius Smart Meter 63A-1Dokument20 SeitenFronius Smart Meter 63A-1Bruno TerraNoch keine Bewertungen
- Airfryer HandbuchDokument44 SeitenAirfryer Handbuchmax-hudeleNoch keine Bewertungen
- 2 SIEMENS SIPROTEC 7SJ62xxDokument72 Seiten2 SIEMENS SIPROTEC 7SJ62xxpudank7jNoch keine Bewertungen
- Betrieb San Lei TungDokument16 SeitenBetrieb San Lei TungRobert HemetsbergerNoch keine Bewertungen
- MicromasterDokument44 SeitenMicromasterRicardo PinheiroNoch keine Bewertungen
- MM4 Getting Started Guide 0620 A5E02779537A AG 300620 v3Dokument52 SeitenMM4 Getting Started Guide 0620 A5E02779537A AG 300620 v3Johan AriasNoch keine Bewertungen
- BA 2874091 enDokument30 SeitenBA 2874091 enFelipe BritoNoch keine Bewertungen
- 7XV5662-0AA01 IecDokument48 Seiten7XV5662-0AA01 Iectien taiNoch keine Bewertungen
- UnterweisungDokument7 SeitenUnterweisungeximneNoch keine Bewertungen
- Deutsch 3 English 18 Magyar 33 Čeština 48 Slovenščina 63 Româneşte 78 Slovenčina 93 Hrvatski 108 Srpski 123 Български 138Dokument156 SeitenDeutsch 3 English 18 Magyar 33 Čeština 48 Slovenščina 63 Româneşte 78 Slovenčina 93 Hrvatski 108 Srpski 123 Български 138Michael LajfNoch keine Bewertungen
- 203 077Dokument56 Seiten203 077Senad SakicNoch keine Bewertungen
- MM420 GSG 19105348 0204Dokument20 SeitenMM420 GSG 19105348 0204MarcosNoch keine Bewertungen
- 7SJ62-64 Manual ATEX100 de enDokument44 Seiten7SJ62-64 Manual ATEX100 de enAbdelkadr NurhisenNoch keine Bewertungen
- GEZE Installation Instructions en 742180Dokument16 SeitenGEZE Installation Instructions en 742180PiotrNoch keine Bewertungen
- BetriebsanleitungDokument16 SeitenBetriebsanleitungumermkNoch keine Bewertungen
- De en FR Es It NL SV Fi Da NB PT Ru Cs PL: Festool GMBH Wertstraße 20 73240 Wendlingen Germany +49 (0) 7024/804-0Dokument38 SeitenDe en FR Es It NL SV Fi Da NB PT Ru Cs PL: Festool GMBH Wertstraße 20 73240 Wendlingen Germany +49 (0) 7024/804-0hermelindoangolano0Noch keine Bewertungen
- BN5930 48 203 DBDokument28 SeitenBN5930 48 203 DBMateyus EriksonNoch keine Bewertungen
- 7XV5662-0AC02 de UsDokument92 Seiten7XV5662-0AC02 de UsRafael MontagnerNoch keine Bewertungen
- Wilo TOPDokument96 SeitenWilo TOPAlexandru BocosNoch keine Bewertungen
- Sichere KläranlagenDokument30 SeitenSichere KläranlagenBorislav VulicNoch keine Bewertungen
- 09-MM-Guía Rápida y Manual MicroMaster 440Dokument121 Seiten09-MM-Guía Rápida y Manual MicroMaster 440Jhezy Andron Andron100% (1)
- Deenesfr v1.0 LP8049748 MPS-D Storage Station ManualDokument108 SeitenDeenesfr v1.0 LP8049748 MPS-D Storage Station ManualAlejo MartinezNoch keine Bewertungen
- Betriebsanleitung KT-20 De-En PDFDokument51 SeitenBetriebsanleitung KT-20 De-En PDFMatthias FedesejofNoch keine Bewertungen
- Discos de Freno WABCO MaxxxDokument79 SeitenDiscos de Freno WABCO MaxxxRusonegroNoch keine Bewertungen
- Dema 25086 DKB 2880Dokument13 SeitenDema 25086 DKB 2880Cristian SabauNoch keine Bewertungen
- Systemhandbuch B4 Siprotec4 Digsi4 deDokument522 SeitenSystemhandbuch B4 Siprotec4 Digsi4 deMGRenJcNoch keine Bewertungen
- Installations Und Wartungsanleitung Warmwasserspeicher Unistor 120 200 1859315Dokument28 SeitenInstallations Und Wartungsanleitung Warmwasserspeicher Unistor 120 200 1859315resistancex8Noch keine Bewertungen
- 7XV5654 Handbuch ManualDokument68 Seiten7XV5654 Handbuch ManualJoaquim AlvesNoch keine Bewertungen
- Application Manual Sirius Safety Integrated De-DeDokument220 SeitenApplication Manual Sirius Safety Integrated De-Demichael.schieder.123Noch keine Bewertungen
- Eine kleine Geschichte der Gerätesicherung: Bedeutung und Entwicklung von Sicherungen bei ElektrogerätenVon EverandEine kleine Geschichte der Gerätesicherung: Bedeutung und Entwicklung von Sicherungen bei ElektrogerätenNoch keine Bewertungen
- Flucht- und Rettungswege: Anforderungen behinderter Menschen an die Bewältigung von NotfällenVon EverandFlucht- und Rettungswege: Anforderungen behinderter Menschen an die Bewältigung von NotfällenNoch keine Bewertungen
- Selbstschutz - Handbuch der Vorsorge für den KatastrophenfallVon EverandSelbstschutz - Handbuch der Vorsorge für den KatastrophenfallNoch keine Bewertungen
- Pocpsa Full 052824Dokument18 SeitenPocpsa Full 052824pemaisan1234Noch keine Bewertungen
- Gemeinsame Erklärung Bündnis Für Demokratie Und MenschenrechteDokument1 SeiteGemeinsame Erklärung Bündnis Für Demokratie Und Menschenrechtepemaisan1234Noch keine Bewertungen
- Eh DigitalDokument1 SeiteEh Digitalpemaisan1234Noch keine Bewertungen
- Ansicht Diabetes Und NierenerkrankungenDokument2 SeitenAnsicht Diabetes Und Nierenerkrankungenpemaisan1234Noch keine Bewertungen
- KV-MOS Jahresplan 2024Dokument3 SeitenKV-MOS Jahresplan 2024pemaisan1234Noch keine Bewertungen
- TiefseeDokument588 SeitenTiefseeherkeuNoch keine Bewertungen
- Referat Baubec Ener IMDMP 51Dokument5 SeitenReferat Baubec Ener IMDMP 51Ener AbyNoch keine Bewertungen
- Tronsole Typ B PDFDokument18 SeitenTronsole Typ B PDFAlexanderGosnitzNoch keine Bewertungen
- SR 140 Bearbeitet Von Staatsanwalt UlbrichDokument14 SeitenSR 140 Bearbeitet Von Staatsanwalt UlbrichLarsNoch keine Bewertungen
- Betriebsanweisung-Nr.-elektrohubwagen Ameise Stapler AushangDokument2 SeitenBetriebsanweisung-Nr.-elektrohubwagen Ameise Stapler Aushangsusann.fleischmannNoch keine Bewertungen
- DGUV Routenzüge Usw.Dokument36 SeitenDGUV Routenzüge Usw.Lukas HartschNoch keine Bewertungen
- Staatenliste Umschreibung Ausl FSDokument17 SeitenStaatenliste Umschreibung Ausl FSNoel CoriaNoch keine Bewertungen
- Lernhilfe EinsatztechnikprüfungDokument13 SeitenLernhilfe EinsatztechnikprüfungAndré WagnerNoch keine Bewertungen
- Der Bremskraftverstärker: FahrwerkkundeDokument4 SeitenDer Bremskraftverstärker: Fahrwerkkundekonrad.kirchhoeferNoch keine Bewertungen
- Volvo V90 D4 Momentum AWD AutomatikDokument12 SeitenVolvo V90 D4 Momentum AWD AutomatikSaša SavićNoch keine Bewertungen
- Свет VIGNAL2013Dokument304 SeitenСвет VIGNAL2013Unisnab LtdNoch keine Bewertungen