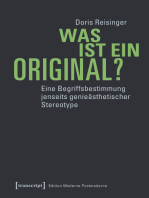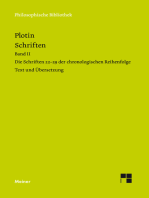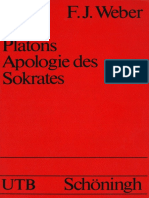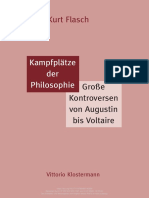Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Aby Warburg, Gesammelte Schriften. Die Erneuerung Der Heidnischen Antike
Hochgeladen von
Vlad AlexandrescuOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Aby Warburg, Gesammelte Schriften. Die Erneuerung Der Heidnischen Antike
Hochgeladen von
Vlad AlexandrescuCopyright:
Verfügbare Formate
A.
WARBURG 1 GESAMMELTE SCHRIFTEN
HERAUSGEGEBEN VON DER BIBLIOTHEK WARBURG
BAND II
UNTER MITARBEIT VON FRITZ ROUGEMONT
HERAUSGEGEBEN VON GERTRUD BING
B. G. T E U B N E R 1 LEI P Z I G 1 B E R L I N I 9 3 2
I
DIE ERNEUERUNG
DER HEIDNISCHEN ANTIKE
KULTURWISSENSCHAFfLICHE BEITRAGE ZUR GESCHICHTE
EUROPAISCHEN RENAISSANCE -, .. '"'
J: . ) ( :3 .. )
't..:>. . . / /
\,'II 'I
""'
MIT EINEM ANHANG
UNVEROFFENTLICHTER ZUSATZE
B. G. T E U B N E R 1 L E I P Z I G 1 B E R L I N I 9 3 2
v
INHALTSVERZEICHNIS
Die italienische Antike in Deutschland. Tezt Anhang
Durer und die italienische Antike (1905) . . . . . . . . .
Die antike Gotterwelt und die Friihrenaissance im Siiden
und im Norden (1908) . . . . . . . . . . .
Kirchliche und hofische Kunst in Landshut {1909) . . . . .
Seite
443
451
455
Die olympischen Gotter als Sterndamonen.
ltalienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo
Selte
623
626
626
Schifanoja zu Ferrara (1912). . . . . . . . . . . . . . 459 627
'Ober Planetengotterbilder im niederdeutschen Kalender von
1519 (1908). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 483 645
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers
Zeiten (1920) . . . . . . . . . 487 647
Orientalisierende Astrologie (1926) . . . . . . . . . . . . 559 657
Kulturpolitische Gelegenheitsschriften.
Amerikanische Chap-books (1897) . . . . . . . . . . 56g 658
Die Wandbilder im hamburgischen Rathaussaale (1910). 579 658
Die Bilderausstellungen des Volksheims (1907). . . . . . 589 658
Eine heraldische Fachbibliothek (1913) . . . . . . . . 593 658
Ein neuentdecktes Fresko des Andrea del Castagno (1899). 597 659
Begrii.Bungsworte zur Eroffnung des kunsthistorischen Insti-
tuts im Palazzo Guadagni zu Florenz am 15. Oktober 1927
(1927) . . . . . . . . . . . . . . 6or 659
Zum Gedachtnis Robert Miinzels (1918) 6os 66o
Das Problem liegt in der Mitte (1918) 6rr 66o
Verzeichnis der Abbildungen
Register . . . . . . ,
661
. 66g
443
DORER
UND DIE ITALIENISCHE ANTIKE
Warburg, Gesammelte Schriften Bd.2
29
445
: .,
l' .\
! ' \
\, ' \ Kunsthalle bewahrt in ihrem Schatze alter Hand-
,'-..,,$.e'i2fl'llcingen und Kupferstiche zwei beriihmte Darstellungen vom ,Tod
des Orpheus'' : eine Handzeichnung Albrecht Diirers a us dem Jahre I494 t
(Abb. 97) und dazu den bisher nur in diesem einzigen Exemplare bekann-
ten, a us dem Kreise Mantegnas stammenden anonym en Kupferstich, wel-
cher Durer als Vorlage gedient hat (Abb. g8). Die zufallige Tatsache dieses
hamburgischen Besitzes allein wiirde mich indessen nicht veranlaBt haben,
diese Blatter, die ich auch im Auftrage des Ortskomitees in Nachbildungen
iiberreichen darfl}, hier zum Ausgangspunkte eines Vortrages zu machen;
zu diesem bestimmt mich vielmehr die 'Oberzeugung, daB diese heiden
Blatter als Aktenstiicke zur Geschichte des Wiedereintritts der Antike
in die modeme Kultur noch nicht erschopfend interpretiert sind, inso-
weit sie einen bisher unbeachteten doppelseitigen EinfluB der Antike
auf die Stilentwicklung der Friihrenaissance offenbaren.
Durch die immer noch nach\virkende einseitig klassizistische Doktrin
von der ,stillen GroBe" des Altertums von einer griindlicheren Betrach-
tung des Materials abgelenkt, hat man nii.mlich bisher nicht geniigend
hervorgehoben, wie deut1ich der Kupferstich und die Zeichnung darauf
hinweisen, daB schon in der zweiten Hii.lfte des rs. Jahrhunderts die
italienischen Kiinstler in dem wiederentdeckten Formenschatz der Antike
ebenso eifrig nach Vorbildem fiir pathetisch gesteigerte Mimik wie fiir
klassisch idealisierende Ruhe such ten. U m dieses erweiternden Ausblicks
willen schien mir ein kunsthistorischer Kommentar zum ,Tod des Or-
pheus" der Mitteilung wert, vor einer Versammlung vcn Philologen und
Schulmii.nnem, fiir die ja die Frage nach dem ,EinfluB der Antike" seit
den Tagen der Renaissance nichts von ihrer besonderen schwerwiegenden
Bedeutung verloren hat.
Zur Veranschaulichung dieser pathetischen Stromung im EinfluB
der wiedererwachenden Antike gibt nun der ,Tod des Orpheus" nach
verschiedenen Richtungen hin einen iesten Ausgangspunkt. Zunii.chst
1) Der .,Tod des Orpheus". Bilder zu dem Vortrag fiber Diirer und die italienische
Antike. Den Mitgliedem der archl!.ologischen Sektion ...... 1iberreicht von A. Warburg.
3 Tafeln in GroBfolio.
Der Vortrag soU erweitert einem spl!.ter erscheinenden Buche fiber die Anfl!.nge selb-
stll.ndiger weltlicher Malerei im Quattrocento angehOren.
Durer und die italienische Antike
Hi.Bt sich, was bisher iibersehen wurde, nachweisen, daB der Tod des
Orpheus, wie er auf dem italienischen Kupferstiche erscheint, in der Tat
als von echt antikem Geiste erfiillt anzusehen ist, denn die Komposition
geht, wie der Vergleich mit griechischen Vasenbildern (vgl. Abb. gg,
100. Roscher, M. L., Orpheus, Abb. IO, n) lehrt, unzweifelhaft auf
ein verloren gegangenes antikes Werk zuriick, das den Tod des Or-
pheus oder etwa den Tod des Pentheus darstellte. Die typische pathe-
tische Gebardensprache der antiken Kunst, wie sie Griechenland fiir
t dieselbe tragische Szene ausgepragt hatte, greift mithin hier unmittelbar
stilbildend ein.
t Derselbe Vorgang laBt sich auf einer Zeichnung aus dem Kreise der
Pollajuoli in Turin beobachten (Abb. 102), worauf mich Prof. Robert hin-
wies: EinMann, der dem hingesunkenen Feind den FuB auf die Schulter
setzt undihnamArme packt, ist offenbar der Agave nachgebildet, wiesie
auf dem Sarkophag in Pisa in dionysischem Wahnsinn Pentheus, ihren
Sohn, zerreiBt. Auch andere, ganz verschiedenartige Kunstwerke mit Bil-
dern vom Tode des Orpheus, wie z. B. das oberitalienische Skizzenbuch
(im Besitz von Lord Rosebery), die Orpheus-Teller der Sammlung Correr,
eine Plakette im Berliner Museum und eine Zeichnung (Giulio Ro-
mano [ ?]) im Louvre zeigen fast vollig iibereinstimmend, wie lebens-
kriiftig sich dieselbe archaologisch getreue Pathosformel, auf eine Or-
pheus- oder Pentheusdarstellung zuriickgehend, in Kiinstlerkreisen ein-
gebiirgert hatte; vor allem beweist dies aber der Hoizschnitt zur Vene-
t zianischenOvidausgabe von 1497 (Abb. 1o1),der Ovids dramatische Erzah-
lung vom tragischen Ende des Sangers begleitet, da diese Illustration
gleichfalls, vielleicht in unmittelbarem AnschluB an den oberitalienischen
Kupferstich, auf dasselbe antike Original zuriickgeht, das sogar in seiner
vollstandigeren Fassung- vgl. die von vorn gesehene Maenade- vor-
gelegen zu haben scheint. Hier ertont zum Bild die echt antike, der
Renaissance vertraute Stimme, denn daB der Tod des Orpheus nicht
nur ein rein formal interessantes Ateliermotiv, sondern ein wirklich im
Geiste und nach den Worten der heidnischen Vorzeit leidenschaftlich
und verstandnisvoll nachgefiihltes Erlebnis aus dem dunkeln Mysterien-
spiel der Dionysischen Sage war, beweist das friiheste italienische Drama
Polizians, sein in ovidianischen Weisen sprechender ,Orfeo", der 1471 in
Mantua zuerst aufgefiihrt wurde. Dadurch empfiingt der ,Tod des
Orpheus" seinen nachdriicklichen Akzent, denn in diesem tragischen
Tanzspiel, dem Erstlingswerk des beriihmten florentinischen Gelehrten,
trat das Leiden des Orpheus unmittelbar dramatisch verkorpert und
im Wohlklang der eigenen italienischen Sprache eindringlich redend vor
die Sinne der Renaissancegesellschaft in Mantua, der eben jener anonyme
Ahb. 97. Diirer, Tod des Orpheus,
Zeichnung, Hamburg, Kunsthalle (zu Seite 445).
Abb. 98. Tod des Orpheus, oberitalienischer
Kupferstich. Hamburg, Kunsthalle (zu Seite -145).
Tafel LV
Abb. 99- Tod des Orpheus, Vase aus Nola,
Paris, Louvre (Ausschnitt) (zu Seite -H6).
Abb. roo. Tod des Orpheus, Vase aus Chiusi,
Cmril3zeichnung nach .-\nnali 187 r (zu Sl'ite +f(>).
Tafel LVI
Abb. 101. Tod des Orpheus, a us: ( lvi I :\l t . .
(
, . ( . L .111101 phoS('n, \'('ncdio 1
zu Se1te .j.t(>). ,_, 4<J7
Abb. 102. Antonio J>ollaiuolo J\tm >f .
Turin p-, " . , ; ' .. I SZ('!ll', Ze1chnung
' dl. 1\L'dl(' \ZII :":>C'Jtc 1-i(J). '
Pathossteigerung durch antike Vorbilder
447
Kupferstecher den ,Tod des Orpheus" im Bilde vor Augen gefiihrt hatte.
Mantua und Florenz treffen hier in ihrem Versuche zusammen, die echt
antiken Formeln gesteigerten korperlichen oder seelischen Ausdrucks in
den Renaissancestil bewegter Lebensschilderung einzugliedern. Die Flo-
rentiner unter Polizians EinfluJ3 gelangen hierbei, wie Botticellis Werke
und vor allem einige Hochzeitstruhen des Jacopo del Sellaio (Abb. I03) t
die Legende von Orpheus nach Polizian schildernd beweisen, zu
einem unausgeglichenen Mischstil zwischen realistischer Naturbeobach-
tung und idealisierender Anlehnung an beriihmte antike Muster in
Kunst und Dichtung. Antonio Pollajuolo dagegen schafft sich im Geiste
Donatellos einen einheitlicheren antikisierenden Stil durch seine uber-
lebendige Muskelrhetorik, die im bewegten nackten Korper sich ver-
kiindet. Zwischen Polizians zierlichen Beweglichkeiten und Pollajuolos
vehementem Manierismus steht das heroische theatralische Pathos, mit
dem sich Mantegnas antike Gestalten vortragen.
Mantegna und Pollajuolo sind aber nun zu gleicher Zeit wie der
,Tod des Orpheus" ebenfalls vorbildlich an Diirer herangetreten: er
kopierte 1494 Mantegnas Bacchanal mit dem Silen und den sog. Tritonen-
kampf, und zeichnete 1495 auch zwei frauenraubende nackte Manner,
die ohne Zweifel auf eine verlorene Vorlage Antonio Pollajuolos zuriick-
gehen. Fiir Diirers Auffassung vom heidnischen Altertum gewinnen diese
vier Pathosblatter aus den Jahren 1494 und 1495 deshalb eine prinzipielle
Bedeutung, weil Diirer nach diesen Vorlagen jene Figuren bis ins einzelne
ausfiihrte, die auf einem seiner friihesten mythologischen Kupferstiche t
(B. 73), den man falschlich Herkules nennt, erscheinen. Wahrscheinlich
liegt eine humanistische Version der Legende von Zeus und Antiope zu-
grunde; am zutreffendsten aber ist die alte Bezeichnung von Bartsch:
,Die Eifersucht", denn Diirer wollte eben vor allem ein antikisches
Temperamentsbild geben und hierbei in Ubereinstimmung mit den Ita-
lienern der Antike das gebiihrende stilbiidende Privilegium in der Dar-
stellung mimisch gesteigerten Lebens einraumen. Daher kam auch jene
affektierte Lebendigkeit in einem der friihesten mythologischen Holz-
schnitte Diirers, der den Zorn des ,Ercules" darstellt (B. 127). Seitdem
1460 die Pollajuoli die Taten des Herkules auf groJ3en Leinwandbildern
in den Palast der Mediceer als Wandschmuck eingefiigt hatten, war
Herkules zum idealisierenden Symbol entfesselter Ubermenschlichkeit
geworden, und deshalb findet auch 1500 ein Herkules des Pollajuolo
als Vorbild seinen Weg in Diirers Leinwandbild ,Herkules und die
Harpyien" in Niirnberg.
Obgleich also auf dem Kupferstich ,Die Eifersucht" keine Figur
die Originalerfindung Diirers ist, bleibt der Stich in einem hoheren Sinne
Durer und die italienische Antiks
doch Eigentum Diirers; denn wenn auch Durer die mod erne Astheten-
angst urn die SelbsHindigkeit des eigenen Individuums fern lag und ihn
kein Artistendiinkel hinderte, das Erbe der Vergangenheit durch Neu-
erwerb zu seinem eigensten Besitz zu machen, so setzte er doch der
paganen siidlichen Lebhaftigkeit den instinktiven Widerstand seiner
bodenstandigen Niirnbergischen Gelassenheit entgegen, die sich seinen
antikisch gestikulierenden Figuren wie ein Oberton ruhiger Widerstands-
kraft mitteilt.
Aber das Altertum kam ihm ja auch durch Italiens Vermittlung
nicht nur dionysisch anstachelnd, sondern auch apollinisch abklarend
t zu Hilfe: Der Apollo von Belvedere schwebte ihm vor Augen, als er nach
dem IdealmaB des mannlichen Korpers suchte, und an Vitruvs Propor-
tionen verglich er die wirkliche Natur. Dieses faustische Griibeln tiber
das MaB hat Durer mit steigender Intensitat zeit seines Lebens in Bann
gehalten; dagegen hater bald an jenem barocken antikischen Bewegungs-
manierismus keinen Gefallen mehr gefunden. Die Italiener fanden 1506,
als er in Venedig war, sein Werk nicht ,antikisch Art, und darum sei
es nit gut"; daB den jiingeren Venezianern in demselben Jahre, wo Lio-
nardo und Michelangelo in ihren Reiterschlachten das heroische Kampfer-
pathos kanonisierten, etwa eine Figur wie Diirers ,GroBes Gluck" als
niichterner Versuch, dem Geiste ihrer Antike wesensfremd, vorkommen
muBte, erscheint uns selbstverstandlicher, als es Durer erscheinen mu.Bte,
der gerade diese Figur nicht nur nach Vitruvischem MaB konstruiert
hatte, sondern auch - eine erstaunliche durch Giehlow
1
) entdeckte
Tatsache - durch die Gestalt der Nemesis ein lateinisches Gedicht
Polizians bis in alle Einzelheiten illustrierte.
Was aber die Italiener vermiBten, das dekorative Pathos, das wollte
t Durer selbst damals ganz bewuBt nicht mehr; so erklart sich wohl auch
jene Stelle in demselben Briefe Diirers: ,Und das Ding, das mir vor eilf
Johren so wol hat gefallen, das gefiillt mir itz niit mehr. Und wenn ichs
nit selbs sach, so hatteichs keimAnderengeglaubt." Das Dingvor II Jah-
ren war eben, meiner Meinung nach, die ich spater noch ausfiihrlicher
begri.inden werde, jene Reihe gestochener italienischer Pathosblatter, die
er 1494-95 in dem Glauben kopieren mochte, daB dies die echte antiki-
sche Manier der graBen heidnischen Kunst sei.
Durer gehorte fiiglich zu den Kampf ern gegen jene barocke Gebarden-
sprache, zu der die italienische Kunst schon seit der Mitte des 15. Jahr-
hunderts hindrangte; denn ganz falschlich sieht man in der Ausgrabung
des Laokoon im Jahre IS06 eine Ursache des beginnenden romischen
1) [Polizian und Durer, in:] Mitteilungen d. Gesellschaft f. vervielfalt. Kunst (1902),
S. 25.ff.
.\IJIJ. 10_1. Jacopo dd S,Jiaio, CisSOill', \\i,n, Slg. L111ckoronsky (zu SL'it(' H/).
Tafel LVIII
Polaritiit der Antike
449
Barockstils der grof3en Geste. Die Entdeckung des Laokoon ist gleichsam t
nur das auf3ere Symptom eines innerlich bedingten stilgeschichtlichen
Prozesses und steht im Zenit, nicht am Anfang der ,barocken Entartung".
Man fand nur, was man lii.ngst in der Antike gesucht und deshalb gefun-
den hatte: die in erhabener Tragik stilisierte Form fiir Grenzwerte
mimischen und physiognomischen Ausdrucks. So hatte z. B. - urn nur
ein unbekanntes iiberraschendes Beispiel herauszugreifen - Antonio
Pollajuolo fiir die erregte Gestalt eines David (bemalter Lederschild in
Locko Park [ Abb. I04]) ein echt antikes Bildwerk, den Pii.dagogen der Nio- t
biden, bis auf Einzelheiten des bewegten Beiwerks zum Vorbild genommen,
und als 1488 eine kleine Nachbildung der Laokoongruppe bei nii.chtlichen
Ausgrabungen in Rom gefunden wurde
1
), da bewunderten die Entdecker,
ohne vom mythologischen Inhalt Notiz zu nehmen, in heller kiinstle-
rischer Begeisterung den packenden Ausdruck der leidenden Gestalten
und ,gewisse wunderbare Gesten" (certi gesti mirabili); es war das
Volkslatein der pathetischen Gebii.rdensprache, das man international
und iiberall da mit dem Herzen verstand, wo es galt, mittelalterliche
Ausdrucksfesseln zu sprengen.
Die ,Bilder zum Tode des Orpheus" sind somit wie ein vorlii.ufiger
Fundbericht tiber die ersten aus!!e!!rabenen Stationen iener Etannen-
o-o--- ------ ------------ ~ - .a. .l.
straf3e anzusehen, auf der die wandernden antiken Superlative der
Gebii.rdensprache von Athen tiber Rom, Mantua und Florenz nach Niirn-
berg kamen, wo sie in Albrecht Diirers Seele EinlaB fanden; Diirer hat
diesen eingewanderten antikischen Rhetorikern zu verschiedenen Zeiten
verschiedenes Recht zugestanden. Keinesfalls dad man im Geiste der
ii.lteren kriegspolitischen Geschichtsauffassung diese stilpsychologische
Frage mit einem: ,entweder Sieger oder Besiegter" bedrangen. Durch
eine derartige groblich befriedigende ScPJuBformel mag sich immerhin
heroenverehrender Dilettantismus lastigen Einzelstudien tiber Abhangig-
keiten der grof3en Individuen entziehen; es entgeht ihm freilich damit
das weittragende stilgeschichtliche, bisher allerdings kaum formulierte,
Problem vom Austausch kiinstlerischer Kultur zwischen Vergangenheit
und Gegenwart, zwischen Norden und Suden im rs. Jahrhundert; dieser
Vorgang Hif3t nicht nur die Friihrenaissance als Gesamtgebiet euro-
paischer Kulturgeschichte klarer begreifen, er enthullt auch bisher un-
gewiirdigte Erscheinungen zu allgemeinerer Erklii.rung der Kreislauf-
vorgange im Wechsel kiinstlerischer Ausdrucksformen.
I) Vgl. Jak. Burckhardt, Beitrtige S. 351. [Gesamtausg. XII, S. 349f.].
45I
DIE ANTIKE GOTTERWELT
UND DIE FROHRENAISSANCE IM SODEN
UND IM NORDEN
(1908)
453
Der Vortragende begriindete seinen Versuch, Norden und Siiden zu-
sammen in der Verarbeitung antiker Einfliisse zu betrachten, damit, daB
man Stellung nehmen miisse gegen die allgemein iibliche asthetisierende
Auffassung der Renaissance, deren neue Formenwelt nicht als Geschenk
einer elementaren Revolution des zum Gefiihl seiner Personlichkeit er-
wachten befreiten kiinstlerischen Genies zu feiern sei und auch nicht
einseitig als Geschenk der italienischen Kunstentwicklung dieser Epoche.
Die Renaissance beruhe vielmehr auf einer bewuBten und schwierigen
Auseinandersetzung mit der spatantik-mittelalterlichen Tradition, und
ferner seien die Machte, mit denen diese Auseinandersetzung stattfindet,
im Norden und im Siiden die gleichen gewesen.
Da diese Betrachtungsweise der Wissenschaft neu ist, konnte der
Vortragende keinen allgemeinen Uberblick geben, sondern muBte, durch
Lichtbilder unterstiitzt, auf einzelne von ihm seibst freigeiegte Etappen
hinweisen. Er hatte dazu die antiken Gottertypen gewahlt und veran-
schaulichte die stilistische Wanderung speziell an den Planetengottern
Saturn und Venus. Das Fortleben der antiken Gottervorstellungen lieB
sich erstens in den Gotterbeschreibungen nachweisen, die, auf spatantike
Schriftsteller zuriickgehend, sich wahrend des Mittelalters in dem gravi-
tatischen Gewande moralischer Allegorien erhalten haben, besonders a1s
Einleitung zu der allegorischen Interpretation des Ovid. Eine zweite,
ganz konstante ikonographische Tradition zeigt sich sodann auf dem
Gebiete der Astrologie. Denn die Gotterdarstellungen der italienischen
Friihrenaissance hangen samtlich mehr oder weniger von solchen Gotter-
katalogen der Spatantike ab: selbst Botticellis Geburt der Venus ist
eine durch die wiedererweckte antike Kunst bewirkte Umformung mittel-
alterlicher Illustrationen. Und jenen heraldisch erstarrten Sternsymboien
der Tradition verlieh man ebenfalls durch Entlehnungen aus der antiken
Plastik neues Leben. Das beweisen z. B. die Sternfiguren der Sakraments-
kapelle in Rimini, die durch das spatantike Pathos der Sarkophagplastik
belebt sind; auf ebensolche Pathosformeln geht auch ein den Tod Orpheus'
darstellender oberitalienischer Kupferstich zuriick, dessen einziges Exem-
plar bekanntlich die Hamburger Kunsthalle aufbewahrt. Charakteristisch
fiir diese "Obergangsepoche ist endlich, daB auch "Obergangsstufen zwi-
454
Die antike Gotterwelt und die Fruhrenaissance im Suden und im Norden
schen mittelalterlich-wortlicher Illustration und antikisierender Ideal-
form existieren; zu ihnen gehort ein oberitalienisches Kartenspiel - die
Kunsthalle besitzt ein besonders gutes Exemplar-, wo z. B. die Venus
noch nach mittelalterlicher Darstellungsweise erscheint, wahrend der
Merkur [Abb. n6] schon die Formen antiker Plastik angenommen hat.
Den erwahnten Stich vom Tode des Orpheus hat bekanntlich Durer
neben anderen Vorbildern zu dem bekannten Blatte ,Die Eifersucht"
benutzt; seine Zeichnung besitzt gleichfalls die hiesige Kunsthalle. "Ober-
aus merkwiirdig ist in diesem Zusammenhange die von Giehlow gefundene
Tatsache, daB auch noch jener Kupferstich, den man als das bedeutendste
Monument von Durers deutscher, von italienischer Muskelrhetorik be-
freiter Art feiert, die Melencolia I, im engsten Zusammenhang steht
mit der horoskopischen Praktik der Spatantike.
Mittelbar auf die Antike, direkt auf das oben erwahnte Tarockspiel,
gehen ebenfalls die Planetenfiguren eines plattdeutschen Kalenders zu-
riick, der von einem Hamburger, Stephan Arndes, in Lubeck 1519 ge-
druckt wurde. Arndes ist in Perugia 1482 als Drucker italienischer
Bucher nachweisbar, woraus sich schon seine Bekanntschaft mit italieni-
schen Kunstwerken erkHirt. Ferner hat ein Theodor Arndes, vielleicht
ein Verwandter des Stephan, Ende des 15. Jahrhunderts in Perugia und
Rom gelebt; er war spater Dechant in Braunschweig und wurde 1492
Bischof von Lubeck. Diese nach Niedersachsen fiihrende Spur der Familie
Arndes ist wertvoll, da rlie Figuren des Kalenders von 1519 an dem
Demmertschen Hause in Braunschweig und an dem bekannten ,Brust-
tuch" in Goslar wiederkehren; sogar auf den Wandmalereien eines
Hauses in Eggenburg in Nieder-Osterreich finden sich diese Kalender-
holzschnitte kopiert. So gewinnen der Kalender von 1519 und sein ham-
burgischer Drucker eine tiber das lokalgeschichtliche Interesse hinaus-
gehende Bedeutung fiir den Kreislauf der Formen im Austausche kiinst-
lerischer Kultur zwischen Norden und Siiden in jener Epoche inter-
nationaler Bilderwanderung.
KIRCHLICHE UND HOFISCHE KUNST
IN LANDSHUT
455
457
Beim Gang durch die Residenz gab Prof. Warburg (Hamburg) inter-
essante Mitteilungen tiber den Kamin in dem italienischen Saal. Das Relief
(von 1542 [ Abb. I05]) stellt die sieben Planeten dar, und zwar in einer Form,
die vollkommen der mittelalterlichen Dberlieferung entspricht. Die Dar-
stellungen sind wortliche Illustrationen eines Malertraktates aus dem
13. Jahrhundert, welcher unter dem Namen des Albricus geht. Er enthalt
die Anweisungen zu 23 Gotterdarstellungen, die einen sehr groBen Ein-
fluB auf die Gottervorstellungen des ausgehenden Mittelalters der Frtih-
renaissance gehabt haben. So schlieBen sich zumBeispiel die Illustrationen
der moralisierten Ovidausgaben eng an diese Beschreibungen an; ebenso
einige Figuren des auch von Durer kopierten oberitalienischen Karten-
spieles. Von da aus ist zum Beispiel der Merkur in eine Holzschnittfolge
Burgkmairs [B. 41-47] iibergegangen, die im 16. Jahrhundert sehr ver-
breitet war und in einem Liibecker Kalender von 1519 und an Hiiuser-
fassaden in ganz Deutschland kopiert worden ist. Zu allen diesen in-
direkten Auslii.ufern der Albricus-Illustrationen kommt der Landshuter
Kamin als Beispiel des unmittelbaren Zuriickgreifens auf mittelalter-
liche Vorstellungen in der Renaissance.
I
'
r
ITALIENISCHE KUNST
UND INTERNATIONALE ASTROLOGIE
IM PALAZZO SCHIFANOJA ZU FERRARA
459
Der folgende Vortrag gibt nur die vorlaufige Skizze einer ausfiihrlichen Abhand-
lung wieder, die demnachst erscheinen und eine ikonologische Quellenuntersuchung des
Freskenzyklus im Palazzo Schifanoja enthalten soli.
Warburg, Gesammelte Scbrilten. Bd. 2.
30
Die romische Formenwelt der italienischen Hochrenaissance ver-
kiindet uns Kunsthistorikern den endlich gegliickten Befreiungsversuch
des kiinstlerischen Genies von mittelalterlicher illustrativer Dienstbar-
keit; daher bedarf es eigentlich einer Rechtfertigung, wenn ich jetzt hier
in Rom an dieser Stelle und vor diesem kunstverstandigen Publikum
von Astrologie, der gefahrlichen Feindin freien Kunstschaffens und
von ihrer Bedeutung fiir die Stilentwicklung der italienischen Malerei
zu sprechen unternehme.
Ich hoffe, daB eine solche Rechtfertigung im Laufe des Vortrages
von dem Probleme selbst iibernommen werden wird, das mich durch
seine eigentiimlich komplizierte Natur- zunachst durchaus gegen meine,
anfanglich auf schonere Dinge gerichtete Neigung- in die halbdunkeln
Regionen des Gestirnaberglaubens abkommandierte.
Dieses Problem heiBt: Was bedeutet der EinfluB der Antike fiir die
kiinstlerische Kultur der Friihrenaissance?
Vor etwa 24 Jahren war es mir in Florenz aufgegangen, daB der
EinfluB der Antike auf die weltliche Malerei des Quattrocento - beson-
ders bei Botticelli und Filippino Lippi - heraustrat in einer Umstili-
sierung der Menschenerscheinung durch gesteigerte Beweglichkeit des
Korpers und der Gewandung nach Vorbildern der antiken bildenden
Kunst und der Poesie. Spater sah ich, daB echt antike Superlative der
Gebardensprache ebenso Pollaiuolos Muskelrhetorik stilisierten, und vor
allem, daB selbst die heidnische Fabelwelt des jungen Diirer (vom ,Tod
des Orpheus" bis zur ,groBen Eifersucht") die dramatische Wucht ihres
Ausdrucks solchen nachlebenden, im Grunde echt griechischen ,Pathos-
formeln" verdankt, die ihm Oberitalien vermittelte.l)
Das Eindringen dieses italienischen antikisierenden Bewegungsstiles
in die nordliche Kunst war nun nicht etwa die Folge ihrer mangelnden
eigenen Erfahrungen auf heidnisch-antikem Stoffgebiet; im Gegenteil:
es wurde mir durch Inventarstudien tiber die weltliche Kunst urn die
Mitte des rs. Jahrhunderts klar, daB z. B. auf flandrischen Teppichen
I) Cfr. Botticcllis Gcburt dcr Venus und Friihling (1893) [s. S. 19 ff., 33 ff.] und
Diircr und die italicnische Antike in Verhandl. der 48. Versammlung deutschcr Philo!. in
Hamburg (1905) [s. S. 445 ff.]; vgl. auch Jahrbuch der preu13. Kunstslgn. (1902) [s. S. r88].
30*
462 ltalienische /(unst urzd internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferrara
und Tuchbildem Figuren im zeitgenossischen Trachtenrealismus <calla
franzese selbst in den italienischen PaHisten die Gestalten des heid-
nischen Altertums verkorpem durften.
Bei genauerem Studium des paganen Bilderkreises im Gebiete der
nordischen Buchkunst lieJ3 skh weiterhin durch Vergleich von Text und
Bild erkennen, daJ3 die uns so irritierende unklassische auJ3ere Erschei-
nung den Blick der Zeitgenossen nicht von der Hauptsache ablenken
konnte: dem emsten, nur allzu stofflich getreuen Willen zu echter Ver-
anschaulichung des Altertums.
So tie wurzelte im nordischen Mittelalter dieses eigentiimliche
Interesse fiir klassische Bildung, daB wir schon im friihesten Mittelalter
eine Art illustrierter Handbiicher der Mythologie fiir jene heiden Gruppen
des Publikums, die ihrer am meisten bedurlten, vorlinden: fiir Maler
und fiir Astrologen.
Im Norden entstanden ist z. B. jener lateinische Haupt-Traktat fiir
Gottermaler, der , de deorum imaginibus libellus" der einem englischen
Mi:inche, Albericus
1
), welcher schon im 12. Jahrhundert gelebt haben
muB, zugeschrieben wird. Seine illustrierte Mythologie mit Bildbeschrei-
bungen von 23 beriihmten Heidengi:ittern hat auf die spatere mytho-
graphische Literatur einen bisher ganzlich iibersehenen EinfluB ausgeiibt,
besonders in Frankreich, wo poetische franzosische Ovid-Bearbeitungen
und lateinische moralisierende Kommentare zu Ovid schon urn die
t Wende des 13. und 14. Jahrhunderts den heidnischen Emigranten eine
Freistatte gewahrten.
In Siiddeutschland taucht sogar schon im 12. Jahrhundert eine
Olympier-Versammlung im Stile des Albericus au2), dessen Mythen-
lehre - wie ich 1909 vor dem Kamin in Landshut zeigte - noch 1541
die illustrative Auffassung von sieben Heidengottem bestimmte.
Es sind natiirlich die sieben Planeten, die in Landshut iiberleben,
d. h. jene Griechengotter, die unter orientalischem EinfluB spater die
Regentschaft der nach ihnen genannten Wandelsterne iibernehmen. Diese
sieben besaBen deswegen die gri:iBte VitalWit unter den Olympiern, weil
sie ihre Auslese keiner Gelehrtenerinnerung, sondern ihrer eigenen, noch
ungest6rt fortdauernden, astral-religii:isen Anziehungskraft verdankten.
Man glaubte ja, daB die sieben Planeten zu allen Zeitabschnitten
des Sonnenjahres Monate, Tage, Stunden des Menschenschicksals nach
pseudomathematischen Gesetzen beherrschten. Die handlichste dieser
Doktrinen, die Lehre von der Monatsregentschaft, eri:iffnete nun den
Gi:ittern im Exil eine sichere ZufluchtssUitte in der mittelalterlichen
r) Cfr. jetzt R. Raschke, De Alberico Mythologo, (Breslau 1913).
2) Cfr. S. 335
Olympische und astrale Gotterlehre
Buchkunst der Kalendarien, die im Anfang des rs. Jahrhunderts von
stiddeutschen Ktinstlern ausgemalt worden sind.
Sie bringen, der hellenistisch-arabischen Auffassung folgend, typisch
sieben Planetenbilder, die, obwohl sie die Lebensgeschichte der heid-
nischen Gotterwelt wie eine harmlose Zusammenstellung zeitgen6ssischer
Genreszenen priisentieren, dennoch auf den astrologisch GHi.ubigen wie
Schicksalshieroglyphen eines Orakelbuches wirkten.
Es ist klar, daB von dieser Art der Gottertiberlieferung, in der die
griechischen Sagenfiguren zugleich die unheimliche Macht astraler Dii-
monen gewonnen hatten, ein Hauptstrom ausgehen muBte, mit dem
die nordisch kosttimierten Heiden sich im rs. Jahrhundert urn so Ieichter
international verbreiteten, als ihnen die neuen beweglicheren Bilderfahr-
zeuge der im Norden entdeckten Druckkunst zur Verftigung standen.
Daher bringen gleich die allerfrtihesten Erzeugnisse des Bilddruckes, die
Blockbticher, in Wort und Bild die sieben Planeten und ihre Kinder,
die durch ihre tiberlieferungsgetreue Stofflichkeit auf ihre Weise zur
italienischen Renaissance der Antike beitrugen.
Schon seit liingerer Zeit wares mir klar, daB eine eingehende ikono-
logische Analyse der Fresken im Palazzo Schifanoja diese zweifache mittel-
alterliche Uberlieferung der antiken Gotterbilderwelt aufdecken mtiBte.
Hier konnen wir sowohl die Einwirkung der systematischen olym-
pischen Gotterlehre, wie sie jene gelehrten mittelalterlichen Mytho-
graphen von Westeuropa tiberlieferten, als auch den EinfluB astraler
Gotterlehre, wie sie sich in Wort und Bild der astrologischen Praktik
ungest6rt erhielt, bis ins einzelne quellenmiiBig klarlegen.
Die Wandbilderreihe im Palazzo Schifanoja zu Ferrara stellte die
zwolf Monatsbilder dar, von denen uns seit ihrer Wiederaufdeckung
unter der Ttinche (r84o) sieben zurtickgewonnen sind. Jedes Monatsbild
besteht aus drei parallel tibereinander angeordneten Bildfliichen mit
selbstiindigem Bildraum und etwa halblebensgroBen Figuren. Auf deren
obersten Fliiche ziehen die olympischen Gotter auf Triumphwagen ein-
her, unten wird das irdische Treiben am Hofe des Herzogs Borso erziihlt;
man erblickt ihn, wie er sich in Staatsgeschiiften betatigt oder zu froh-
licher Jagd auszieht; der mittlere Streifen gehort der astralen Gotter-
welt; darauf deutet schon das Tierkreiszeichen, das von je drei ratsel-
haften Gestalten umgeben, in der Mitte der FHiche erscheint. Die kom-
plizierte und phantastische Symbolik dieser Figuren hat bisher jedem
Erkliirungsversuch widerstanden; ich werde sie durch Erweiterung des
Beobachtungsfeldes nach dem Orient als Bestandteile nachlebender
astraler Vorstellungen der griechischen Gotterwelt nachweisen. Sie sind
tatsachlich nichts anderes als Fixsternsymbole, die allerdings die Klar-
464 Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferram
heit ihres griechischen Umrisses auf jahrhundertelanger Wanderung von
Griechenland durch Kleinasien, Agypten, Mesopotamien, Arabien und
Spanien grtindlich eingebtiJ3t haben.
Da es unmoglich ist, in dem mir hier zugemessenen Zeitraum die
ganze Freskenreihe durchzuinterpretieren, werde ich mich auf drei
Monatsbilder beschranken und auch hier im wesentlichen nur die heiden
oberen Gotterregionen ikonologisch analysieren.
Ich will mit dem ersten Monatsbilde, dem Marz (der den Jahres-
zyklus nach italienischer Chronologie eroffnet), den von den Gottern die
Pallas und von den Tierkreiszeichen der Widder beherrscht, beginnen, mich
darauf dem zweiten Monatsbilde, dem des April, zuwenden, der von der
Venus und dem Stier regiert wird, und schlieJ3lich die Darstellung des J uli-
monats herausgreifen, weil dort eine wenigcr widerstandsfahige Kiinstler-
personlichkei t das gelehrte Programm am greifbarsten durchscheinen laJ3t.
Danach soil versucht werden, durch einen Ausblick auf Botticelli die antike
Gotterwelt in Ferrara stilgeschichtlich als Dbergangstypus vom inter-
nationalen Mittelalter zur italienischen Renaissance zu begreifen. Aber ehe
ich zur Analyse des Erinnerungsvermogens an die heidnische Gotterwelt
im Palazzo Schifanoja schreite, muJ3 ich noch versuchen, im groben UmriJ3
Instrumentarium und Technik der antiken Astrologie zu skizzieren.
DasHauptwerkzeug der Sterndeuterei sind die Sternbildernamen,
die sich auf die heiden durch ihre scheinbare Bewegung verschiedenen
Gruppen von Stemen beziehen: auf die Wandelsterne mit ihrem ungleich-
maJ3igen Lauf und die zueinander stets gleich gelagert erscheinenden
Fixsterne, deren Bilder je nach dem Sonnenstande beim Aufgang oder
Untergang sichtbar werden.
Von diesen Sichtbarkeitsverhiiltnissen und von der Stellung der
Gestirne zueinander machte die wirklich beobachtende Astrologie den
EinfluJ3 der Sternenwelt auf das Menschenleben abhangig. Im spateren
Mittelalter wich die reale Beobachtung jedoch zurtick zugunsten cines
primitiven Sternnamenkultes.
Astrologie ist im Grunde eben nichts anderes als auf die Zukunft
* projizierter Namensfetischismus: Wen z. B. bei seiner Geburt im April
Venus beschien, der werde, den Venusqualitiiten der Gottermythe ent-
sprechend, der Liebe und den leichten Freuden des Daseins Ieben; und
wer etwa unter dem Zodiakalzeichen des Widders zur Welt kam, dem
stiinde bevor - das sagenbertihmte wollige Fell des Widders verbtirge
* es - ein Weber zu werden. Dieser Monat ware denn auch besonders
gtinstig zum AbschluJ3 von Wollgeschaften.
Durch solche pseudomathematische Trugschliissigkeit wurden die
Menschen jahrhundertelang im Banne gehalten bis auf den heutigen Tag.
Planeten und Fixsterne in der wahrsagenden Astrologie
Mit der fortschreitenden Mechanisierung der zukunftsforschenden
Astrologie entwickelte sich nun - den praktischen Bediirfnissen ent-
sprechend - ein illustriertes Handbuch der Astrologie fiir jeden Tag.
Die Planeten, die fiir 360 Tage- so rechnete man das Jahr - nicht
geniigend Abwechslung boten, traten dabei schlieBlich ganz zuriick zu-
gunsten einer erweiterten Fixsternastrologie.
Arats (urn 300 v. Chr.) Fixsternhimmel ist auch heute noch das primare
Hilfsmittel der Astronomie, nachdem es strenger griechischer Natur-
wissenschaft gelungen ist, die aufgeregten Geschopfe religioser Phantasie
zu diensttuenden mathematischen Punkten zu vergeistigen. Der helle-
nistischen Astrologie freilich bot dieses uns schon iiberreich erscheinende
Gewimmel von Menschen, Tieren und Fabelwesen nicht genug Vorrat
an Schicksalshieroglyphen fiir ihre Tagesweissagungen; dadurch entstand *
eine riicldaufige Tendenz zu eigentlich polytheistischen Neubildungen,
die schon in den ersten J ahrhunderten unserer Zeitrechnung zu einer
wahrscheinlich in Kleinasien von einem gewissen Teukros verfaBten
<<Sphaera barbarica1> fiihrte; sie ist nichts anderes als eine durch agyp-
tische, babylonische und kleinasiatische Gestirnnamen bereicherte Fix-
sternhimmelbeschreibung, die den Gestirnkatalog des Arat fast urn das
Dreifache iibertrifft. Franz Boll hat sie in seiner Sphaera (1903) mit
genialem Scharfsinn rekonstruiert, und -was fiir die moderne Kunst-
wissenschaft von gr6Bter Bedeutung ist - die Hauptetappen ihrer
marchenhaft anmutenden Wanderung nach dem Orient und zuriick nach
Europa nachgewiesen, z. B. bis in ein kleines mit Holzschnitten illustrier-
tes Buch hinein, das uns tatsachlich noch einen solchen kleinasiatischen
astrologischen Tageskalender bewahrt hat: das von dem deutschen Ge-
lehrten Engel herausgegebene und zuerst von Ratdolt in Augsburg 1488
gedruckte Ast rola bi urn Magn u m
1
): derVerfasser aber ist ein weltbe-
kannter Italiener, Pietro d' Abano, der paduanische Faust des Trecento,
der Zeitgenosse Dantes und Giottos.
Die Sphaera barbarica des Teukros lebte noch in dner anderen, dem
erhaltenen griechischen Text entsprechenden, Einteilung nach Dekanen
fort, d. h. nach Monatsdritteln, die je ro Grade des Tierkreiszeichens
umfassen, und dieser Typus wurde dem abendlandischen Mittelalter
durch die Sternkataloge und Steinbiicher der Araber iiberliefert. So
enthalt die ,groBe Einleitung" des Abu Ma'schar (gest. 886), der die
Hauptautoritat der mittelalterlichen Astrologie war, eine dreifache Syn-
opsis von anscheinend ganz eigenartigen, verschiedenen Nationalitaten
angehorigen Fixsternhimmelsbildern, die aber genauerer wissenschaft-
licher Betrachtung verraten, daB sie sich nur aus dem Bestande jener
1) Andere Ausgaben 1494 und 1502 (Venedig).
466 Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanofa zu Ferrara
barbarisch erweiterten griechischen Sphaera des Teukros zusammensetzen
und ihre Reiseabenteuer lassen sich gerade bei diesem Werke des Abu
Ma'schar wiederum bis zu Pietro d'Abano verfolgen: von Kleinasien tiber
Agypten nach Indien gelangt, geriet die Sphaera, wahrscheinlich tiber
Persien, in jenes Introductorium majus des Abu Ma'schar, das dann in
Spanien ein spanischer Jude Aben Esra (gest. n67) ins Hebdiische tiber-
setzte. Diese hebraische Ubersetzung wurde dann 1273 von dem jtidischen
Gelehrten Hagins in Mecheln fiir den Englander Henry Bates ins Fran-
zosische tibersetzt, und diese franzosische Ubersetzung lag endlich einer
1293 angefertigten lateinischen Version unseres Pietro d' Abano zugrunde;
sie ist mehrfach, z. B. 1507 in Venedig gedruckt [r. Aufl. Erhard Rat-
dolt, Venedig 1485]. Auch die Stein bticher, die den magischen EinfluB
der Dekangestirngruppen auf bestimmte Steinsorten lehren, sind auf
derselben WanderstraBe: Indien-Arabien nach Spanien gekommen.
Am Hofe des Konigs Alfonso el Sabio zu Toledo erlebte ja urn 1260 die
hellenistische Naturphilosophie eine eigenartige \Viedergeburt: in spa-
nischen Bilderhandschriften erstanden aus arabischer Ubersetzung die
griechischen Autoren wieder, die die hermetisch-heilende oder orakelnde
Astrologie Alexandriens zum fatalen Gemeingut Europas machen soil ten.
Pietro d' A banos Astrolabium ist allerdings in seiner monumentalsten
Ausgabe noch nicht von Boll in den Kreis seiner Studien einbezogen
worden. Die Wande des Salone in Padua sind gleichsam GroBfolio-
seiten aus einem astrologischen Wahrsagekalender fiir jeden Tag, von
t Abano im Geiste der Sphaera barbarica inspiriert. Die kunstwissenschaft-
liche Erklarung dieses einzigartigen Monumentes
1
) einer spateren Ab-
handlung vorbehaltend, will ich hier nur auf eine Seite aus dem Astra-
labium hinweisen, die uns endlich zu den Fresken von Ferrara selbst
ftihrt (Abb. ro6).
Man erblickt auf der unteren Hii.lfte unten zwei kleine Figuren ein-
gepaBt in ein horoskopisches Schema: ein Mann mit einer Sichel und einer
Armbrust; er soU erscheinen beim erst en Grade des Widders; es ist
niemand anderes als der tatsachlich zugleich mit dem Widder auf-
gehende Perseus, dessen Harpe sich in die Sichel verwandelt hat. Dariiber
steht lateinisch zu lesen: ,Im ersten Grade des Widders steigt ein Mann
auf, der in der rechten Hand eine Sichel halt und in der linken eine
Armbrust." Und darunter als Weissagung ftir den unter diesem Zeichen
Geborenen: ,Er arbeitet manchmal, und manchmal zieht er in den
1) Bei dem vorbildlich regen Eifer der italienischen Photographen ist es unverstandlich,
da.l3 erst n ur ganz wcnige Wand bilder des Salone photogra phiert sind ; ein u nfl berwindliches
Hindernis fUr das bisher verabsaumte vergleichende Studium I (vgl. jetzt Barzon. I cieli e la
lora influenza negli affreschi del Salone in Padova, Padova 1924).
Takl LIX
1> lima facies ariett e mar
lis 7 i facies aubade:fout..-
ttcbinis :altitubinis:t inuc"'
recunbie.
Secunba raciee ell folie t l::ercia facies ell "tntris et
ell nobilitart :altirubinis: ell fubtilitatio in OL!C:t man
regni t magni bominij. fuetubinis:lubo;t:gaubio
't limpibationum.
)n pzimo grabu arieris ,omo cum capite canino bq,
ll.fcebit \'ir benera renee fa lei: tent fila enenfs:t in finitlra ba.-
't ftnifira manu balillam. culum l)abentem.
([,omoaliQuabo titigiofiw erit etinui"'
quanbo\'ero beUse.rercet. bunt canis.
llries
1-2
Ahb. 101>. Die .\ries-Dekane aus: :\strolal>ium ed. En!.!el,
qXS (zu S<itc 4(,(, f.).
Tafel L.\
.\hh. 107. SynoptisL'hl' Sph<ll'l'il mit den :'llonatsrl'gl'nll'll nach
:'llanilius und d<n gril'ch. AstrologL'Il (zu Sl'ik -lin und 4/IJ) .
. \hh. 1oi\. l'l'rs<us, C,nnanicus-1-landschrift, Ll'idl'n,
t:ni\.-Bihl., \'oss.lat. I" 7'!. fol. .Jo
1
(zu Slitc .Jil;-).
Tafel LXI
, .. ; ' 'ti
Abh. 1 O<J. J'lanisphaerium Paris, Louvre (zu Seitc 467).
Nachleben der ,.Sphaera barbari.::a"
Krieg." Also nichts als platter auf die Zukunft bezogener Namens-
fetischismus! Dariiber stehen drei Figuren, die in der Astrologensprache
,Dekane"
1
) heiOen; sie verteilen sich zu je drei, im ganzen also 36, auf
die Tierkreiszeichen. Diese Einteilung ist dem System nach uragyptisch,
wenn auch die auBere Form der Dekansymbole deutlich verrat, daB
hinter dem Mann mit der Miitze und dem Krummschwert eben wieder
der Perseus steckt, der hier als prima facies nicht nur den ersten Grad,
sondern die ganzen ersten zehn Grade des Widders beherrscht. *
Ein Blick auf den echt antiken Perseus in der Germanicus-Hand-
schrift in Leiden (Abb. ro8) beweist ohne weiteres, daB Krummschwert
und Turban des ersten Dekans die Harpe und die phrygische Miitze des
Perseus getreulich konserviert haben.
2
) Auf einer astrologischen Marmor-
tafel der romischen Kaiserzeit, dem bekannten Planisphaerium Bianchini, *
das 1705 auf dem Aventin in Rom gefunden und der franzosischen
Akademie von Francesco Bianchini (r66z-1729) geschenkt wurde (heute
im Louvre. 58 em im Geviert, genau zwei romische FuB), treten aber die
agyptischen Dekane noch in echt agyptischer Stilisierung auf: der erste
Dekan tragt ein Doppelbeil (Abb. 109).
Mittelalterliche Loyalitat hat uns sogar diese Version des Dekans
mit dem Doppelbeil getreulich bewahrt; das Steinbuch fiir Alfonso el
Sabio von Castilien zeigt als erstes Dekansymbol des Widders einen
dunkelfarbigen Mann im gegiirteten Opferschurz, der wirklich ein Doppel- *
beil tragt.s)
Aber erst eine dritte Version der Dekanreihen, und zwar die jenes
Arabers Abu Ma'schar fiihrt uns endlich unmittelbar zu den ratselhaften
Figuren der mittleren Reihe im Palazzo Schifanoja.
Abu Ma'schar gibt in dem fiir uns in Betracht kommenden Kapitel
seiner ,GraBen Einleitung" eine Synopsis von drei verschiedenen Fix-
sternsystemen: dem landlaufigen arabischen, dem ptolomaischen und
schlieBlich dem indischen.
In dieser Reihe der indischen Dekane glaubt man sich zunachst von
Ausgeburten echtester orientalischer Phantasie umgeben (wie denn iiber-
haupt die Entschalung des griechischen Urbildes bei dieser kritischen
lkonologie ein fortwahrendes Wegraumen unberechenbarer Schichten
nicht verstandlicher Zutaten verlangt). So ergibt eine Nachpriifung der
,indischen" Dekane das nicht mehr iiberraschende Resultat, daB wirk-
I) Cfr. auBer Boll. I. c. das grundlegende Buch von Bouche-Leclercq, L' Astrologie
grecque (1899).
2) Dieselben Nachweise werde ich fiir die anderen Dekane erbringen; so z. B. ist *
die sitzende lautenspiclende Frau die Kassiopeia, vgl. Abb. bei Thiele, Antike Himmels-
bilder (1898), S. 104.
3) Cfr. die Abb. im Lapidario del Rey Alfonso X (1879) und bei Boll, p. 433
468 Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanofa zu Ferrara
lich indisches Beiwerk urspriinglich echt griechische Gestimsymbole
iiberwuchert hat.
* Denn der Inder Varaha Mihira (6. Jahrhundert), Abu Ma'schars
ungenannter Gewiihrsmann, verzeichnet in seinem Brhajjataka als ersten
Dekan des Widders ganz richtig einen Mann, der ein Doppelbeil tragt.
Er sagt: ,Zum erst en Dekan des Widders erscheint ein urn die Lend en
mit einem weifien Tuche gegiirteter, schwarzer gleichsam zum Be-
schiitzen tahiger furchtbarer rotii.ugiger Mann, er halt ein Beil aufrecht.
Dies ist ein Mann-Dreskana (Dekan) bewaffnet und von Mars (Bhauma)
abhangig."
1
)
Und bei Abu Ma'schar heiBt es (Boll, Sphaera S. 497): ,Die Inder
sagen, daB in diesem Dekan ein schwarzer Mann aufsteigt mit roten
Augen, von grol3er Statur, starkem Mute und grol3er Gesinnung; er tragt
ein grol3es weil3es Kleid, das er in der Mitte mit einem Strick zusammen-
gebunden hat; er ist zomig, steht aufrecht da und bewacht und be-
obachtet." Die Figuren stimmen also iiberein mit der Dberlieferung bis
auf eine Nuance: beim Araber hat der Dekan sein Beil verloren und nur
* das mit einem Strick gegiirtete Gewand behalten.
Als ich vor vier Jahren den arabischen Text des Abu Ma'schar in
der deutschen Dbersetzung las, die Dyroff dem Buche von Boll in iiber-
aus dankenswerter Weise beigegeben hat2), fielen roir plotzlich die so
oft und seit vielen Jahren vergeblich befragten Riitselfiguren von Ferrara
ein, und siehe da: eine nach der anderen
3
) enthiillte sich als indischer
Dekan des Abu Ma'schar. Die erste Figur der mittleren Region auf dem
Mii.rzfresko mul3te sich demaskieren: hier steht der schwarze zornige
beobachtende aufrechte Mann in seinem gegiirteten Gewand, dessen
Strickgiirtel er demonstrativ erfaBt hat (Abb. no u. rn). Damit lii.J3t sich
nun das ganze astrale System des mittleren Streifens eindeutig analy-
sieren: Dber die unterste Schicht des griechischen Fixsternhimmels hatte
sich zunii.chst das iigyptisierende Schema des Dekankultes gelagert. Auf
dieses setzte sich die Schicht indischer mythologischer Umformung ab,
die sodann - wahrscheinlich durch persische Vermittlung- das ara-
bische Milieu zu passieren hatte. Nachdem weiter durch die hebriiische
Dbersetzung eine abermalige triibende Ablagerung stattgefunden hatte,
miindete, durch franzosische Vermittlung in Pietro d'Abanos lateinische
1) Ich kam durch Thibaut, GrundriB dcr Indo-Arischen Philologie III, 9, S. 66
auf die englische "Obersetzung des Chidambaram Jycr (Madras x885), die sich dann im
NachlaB Opperts an die Hamburger Stadtbibliothek fand; die deutsche Dbersetzung ver-
danke ich Dr. Wilhelm Printz.
2) S. 482-539. Eine vollstandige Textausgabe der Werke AbO. Ma'schars mit
"Obersetzung gehort zu den dringlichsten Erfordernisscn der Kulturgeschichte.
3) Darliber eingehenderes in der spateren Abhandlung [s. Zusatz S. 63off.).
lndische Dekane f Manilius
Ubersetzung des Abu Ma'schar, der griechische Fixsternhimmel schlieB-
lich in die monumentale Kosmologie der italienischen Friihrenaissance
ein, in der Gestalt eben jener 36 ratselhaften Figuren des mittleren *
Streifens aus den Fresken von Ferrara.
Wenden wir uns jetzt der oberen Region zu, wo die Gotterprozession
stattfindet.
Mehrere und sehr ungleichmaBige Kiinstler haben an der ganzen *
Freskenfolge mitgearbeitet. Fritz Harck
1
) und Adolfo Venturi
2
) haben
die schwierige stilkritische Pionierarbeit geleistet, und Venturi verdanken
wir auch die einzige Urkunde, die Francesco Cossa als Schopfer der
ersten drei Monatsbilder (Marz, April, Mai) festlegt, namlich einen eigen-
handigen inhaltsreichen und fesselnden Brief Francesco Cossas vom
25. Marz 1470. Oben (Abb. no) erblicken wir auf einem von Einhornen
gezogenen Festwagen, dessen Behang im Winde flattert - zwar zerstort,
aber deutlich erkennbar ~ Pallas mit der Gorgo auf der Brust und der
Lauze in der Hand.
Links sieht man die Gruppe der Junger der Athena, A.rzte, Dichter,
Juristen (die eindringendere Forschung vielleicht einmal mit Personen
der damaligen Universitat zu Ferrara identifizieren konnte), rechts da-
gegen sehen wir in ein ferraresisches Handarbeitskranzchen hinein: im
Vordergrunde drei stickende Frauen, dahinter drei Weberinnen am Web-
stuhl, von einer Schar eleganter Zuschauerinnen umgeben. Diese an-
scheinend so harmlos dasitzende Damengesellschaft gab den astrologisch
Glaubigen die antike Weissagung fiir die Widder-Kinder: Wer im Marz
unter dem Zeichen des Widders geboren ist, der wird eben ein besonderes
Geschick fiir kunstreiche Hantierung mit Wolle entwickeln.
So besingt Manitius in seinem astrologischen Lehrgedicht - dem
einzigen groB durchdachten Denkmal astrognostischer Poesie, das die
lateinische Dichtkunst des kaiserlichen Rom hervorbrachte - den psy-
chischen und beruflichen Charakter der unter dem Widder Geborenen
folgendermaBen:
<< et mille per artes
uellera diuersos ex se parientia quaestus:
nunc glomerare rudis, nunc rursus soluere lanas,
nunc tenuare leui filo, nunc ducere telas,
nunc emere et uarias in quaestum uendere uestes.
3
)
Die 'Obereinstimmung mit der Dichtung des Manitius ist, was der
bisherigen Forschung vollig entgangen, keine zufillige: Manilius' Stern-
I) Jahrb. d. Preu!3. Kstsmlgn. V (1884), 99ff.
2) Attie Mem. Stor. Patr. d. Romagna (1885), p. 381 ff.
3) Ed. Breiter {1908) IV, 128-136.
470 Italietzische Kunst nnd internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferrara
gedicht geh6rte seit 1417 zu den von gelehrten italienischen Humanisten
neu entdeckten und mit liebevollem Enthusiasmus wiedererweckten
Klassikern
1
); er fiihrt ja an einer beriihmten Stelle die Schutzg6tter der
Monate in folgender Weise auf:
lanigerum Pallas, taurum Cytherea tuetur,
formosos Phoebus geminos; Cyllenie, cancrum,
Iupiter et cum matre deum regis ipse leonem,
spicifera est uirgo Cereris, fabricataque libra
Vulcani, pugnax Mauorti scorpios haeret;
uenantem Diana uirum, sed partis equinae,
atque angusta fouet capricorni sidera Uesta,
et louis aduerso Iunonis aquarius astrum est,
agnoscitque suos Neptunus in aequore pisces)>.
2
)
A bsol u t w6rtlich entsprechen nun die sieben vorhandenen Gotter-
trionfi - wie wir noch an einem anderen Beispiel genauer sehen werden -
dieser Reihenfolge, die ja sonst auch durch keinen anderen Schriftsteller
bezeugt ist. Pallas beschiitzt Marz, den Widdermonat, Venus den Stier
und April, Apollo die Zwillinge und den Mai, Mercur den Krebs und seinen
Junimonat; Jupiter und Kybele zusammen- eine ganz charakteristische
und sonst nicht nachweisbare Allianz - das Zeichen des Lowen und den
Monat Juli, Ceres die Jungfrau und den Monat August und der Vulcan
die Waage, die zum September geh6rt. Es kann also nicht mehr fraglich
sein, welche literarischen Quellen fiir den gedanklichen Grundrif3 des
ganzen Bilderzyklus in Betracht kommen. Unten im halbdunkeln Zwi-
schenreich herrschen in internationaler mittelalterlicher Verkleidung helle-
nistische Stern damon en; oben hilft der lateinische Dichter den Heiden-
* g6ttern bei dem Versuche, die angestammte h6here Atmosphare des
griechischen Olympos wieder zu gewinnen.
Wenden wir uns jetzt dem April zu, den der Stier und die Venus
regieren (Abb. no). Frau Venus, die in ihrem von Schwanen gezogenen
Fahrzeug, dessen Behang so Iustig im Winde flattert, durch den Strom
gleitet, verrat auf3erlich keinen griechischen Stil. Sie scheint sich zu-
nachst nur durch ihr Kostiim, die offenen Haare und den Rosenkranz
von der Bev6lkerung der heiden Liebesgarten zu unterscheiden, die recht
weltlich rechts und links ihr Wesen treibt.
Ja wenn man die Gruppe von Mars und Venus auf ihrem Wagen
allein betrachtet, so erweckt der von Schwanen gezogene kettenum-
r) Sabbadini, Le scoperte dei codici Iatini e greci ne' sccoli XIV e XV (1905), p. So
u. B. Soldati, La poesia astrologica nel Quattrocento (rgo6).
2) L. c. II, 439-447.
J 'I"' I J. \,. J J J
\ I ~ J ~ . I I I i.J-..it 1 ]It 1,,1)1 dt-.. \\ Jllit-J-., \LtJ"/ f.'rt..,),,l ftJJ,II.I, j',il.l//1 :--, l.il,ill<l.!
I /II .'lt '] t I. I II, .....
Tafel LXIV
it.m69,.ntit ""'"" 11\{plrmtnr u,.,;. .a!' 4,'li 9.""'
)1111" ,.: l 1'1<\>\ nA!lif 'f i n\<\1111 fitA '1"'\11\A}
At't\1 ,tll%1\i t'Ofif 'f ml"1ffeuit
'f 11a_
t::mr "lr'<P1'ltl\ '}lln 7 n>mHfll
bt,.:l><ntEi< s,b:> .. fc
"" ""''"'''"" I<WV.l>ar, t,u.c fih'fiu\r "'""'S "=.1 ,rl\$1tl' :, mw
2\l'f'.UII f"5'"'-"''0)t" ,1:1' ll:cf 'ffc. .,. lll<lt\1f
fiunl<l>"r <111 7 liutl'lt"l\q>>U51<li"r \ _ ,_ ---. __
.\bh. 112. \,nus, Lihdlus dl' dl'ornm imaginibns, Hom, Cod. \'at. HL"g.lat. I:!<JO,
fol. 2 r (zu Sl'ilc .J7l) .
.\hh. 11 ]. \'l'nus, <hic!P moral is(, Paris,
Bib!. 1'\ationalt, :\b. fran<;._)/.), fol.
(zu Scih
Venusfresko
47
1
schniirte Troubadour, der so schmachtend vor seiner Herrin kniet, eine
nordische Lohengrinstimmung, wie sie etwa aus der niederHindischen
Miniatur spricht, die die sagenhafte Geschichte desHauses Cleve illustriert
(vgl. den Chevalier au Cygne in der Hs. Gall. 19 der Hof- und Staats- t
bibliothek zu Miinchen); bei dem ausgesprochenen Interesse des ferrari-
schen Hofes fiir franzosisierende ritterliche Kultur ware ein Verstandnis
fiir solche aus dem N arden importierte Seelenmode durchaus voraus-
zusetzen.
Trotzdem hat Francesco Cossa die Venus nach dem strengen Pro-
gramm gelehrter lateinischer Mythographie dargestellt:
Der vorhin genannte Albericus schreibt in seinem Gottermalerbuch
folgende Gestaltung der Venus vor, die ich Ihnen als aus einer illustrierten
italienischen Handschrift zeigen kann.
1
) Der lateinische Text lautet in
der ubersetzung etwa so: ,Die Venus hat unter den Planeten den
5 Platz. Darum wurde sie an fiinfter Stelle dargestellt. Die Venus wurde
gemalt als allerschonste Jungfrau, nackt und im Meere schwimmend,
[in der rechten Hand hielt sie eine Muschel,] mit einem Kranz aus weiBen
und roten Rosen war ihr Kopf geschmiickt, und von Tauben, die sie
umflatterten, war sie begleitet. Vulcan, der Feuergott, roh und scheuB-
lich, war ihr angetraut und stand zu ihrer Rechten. Vor ihr aber
stan den drei kleine nackte J ungfraulein, die die drei Grazien genannt t
wurden, und von denen zwei ihr Gesicht uns zugewandt hatten, die
dritte aber sich vom Riicken zeigte; auch ihr Sohn Cupido, gefliigelt und
blind, stand dabei, der mit Pfeil und Bogen auf Apollo schoB, worauf
er sich [den Zorn der Gotter fiirchtend] in den SchoB der Mutter
fliichtete, die ihm ihre Linke hinreichte." (Abb. II2).
Sehen wir uns nun wieder Cossas Aphrodite an: Der Kranz von roten
und weiBen Rosen, die Tauben, welche die auf dem Wasser fahrende
Gottin umflattern, Amor, der auf dem Gurtel seiner Mutter dargestellt ist,
wie er mit Pfeil und Bogen ein Liebespaar bedroht, unJ vor allem die drei
Grazien, die sogar sicher nach antikem kiinstlerischem Vorbild geschaffen
sind, beweisen, daB hier der Wille zu echt antiker Rekonstruktion hestand.
Es gehort nur etwas Abstraktionsfahigkeit dazu, urn in dieser fran-
zosischen Miniatur vom Ende des 14. Jahrhunderts (Abb. II3) die Ana-
dyomene des Albericus auf ihrer Reise durch das mittelalterliche Frank-
reich wiederzuerkennen. So steigt sie in dem <<Ovide moralise>> aus dem
Meere auf.
2
) Die Situation und die Attribute sind klar: Am or hat sich
1) Rom Vat. Reg. lat. 1290, in Oberitalien urn 1420 geschrieben.
2) Das Gedicht wurde von einem unbekannten franzosischen Geistlichen (vor 1307)
verfallt; cf. Gaston Paris, La litterature au moyen-age. 4 Auf!. (1909), p. 84.
Die Abb. entstammt der Hs. 373, anc. 6g86, der Bib!. Nat. zu Paris (fol. 207 V).
472 Jtalienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferrara
zwar zu einem gefliigelten thronenden Konig entwickelt, und die Schaum-
t geborene scheint in ihrem Teiche eine Ente statt der Muschel erfaBt zu
haben; aber sonst sind ganz eindeutige mythische Rudimente auWillig:
weiBe und rote Rosen schwimmen im Wasser, drei Tauben flattern, und
eine von den drei Grazien versucht sogar die vorschriftsmaBige Stellung
von riickwarts einzunehmen.
Bis in die franzosische Buchillustration des 15. und 16. Jahrhunderts
halt sich dieser Albericus-Olymp und ebenso in dem sag. Mantegna-
Tarockkarten-Spiel, das urn 1465 in Oberitalien in Kupfer gestochen
wurde.
Wenden wir uns jetzt zu den Olympiern als Astral-Damonen, wie
sie in jenen Planetenkalendarien fortdauern. Man betrachte z. B. das
Schicksalsblatt der ,Venuskinder" auf einer burgundischen (aber wahl
auf deutsche Vorbilder zuriickgehenden) Blockbuchseite von ca. 1460.
1
)
Sehr unheimlich damonisch geht es hier nicht zu; die schaumgeborene
Herrin von Cypern ist zur Besitzerin einer vergniigten Gartenwirtschaft
umgewertet: Liebesparchen baden und scherzen bei Musik auf blumiger
Au; schwebte nicht eine nackte Frauengestalt auf Wolken, einen Spiegel
in der Rechten und Blumen in der Linken, zwischen ihren Tierkreis-
zeichen oben in der Luft, man wiirde die unten auf der Erde nicht fiir
das hal ten, was sie sind: astrologisch brauchbare Bilderscholien zu den
mythischen Eigenschaften der kosmischen Venus, die in Natur und
Menschen alljahrlich die Lebensfreude wiedererweckt.
Die Planetenastrologie tritt in Ferrara, da die Zwolfgotter des
Manitius die Wandelsternregion einnehmen, zugunsten der Dekan-Astro-
logie zuriick. Trotzdem wird man sich der Einsicht nicht verschlieBen
konnen, daB der Liebesgarten und die Musizierenden auf dem Fresko
Cossas angeregt sind von den traditionellen ,Venuskindern". Freilich
Cossas packender Wirklichkeitssinn (von dem die Galleria Vaticana ein
so unvergleichliches Zeugnis bewahrt in der Fredella mit Szenen aus dem
Leben des hi. VincenzoFerrer) iiberwindet das unkiinstlerischeElement des
literarischen Einschlags, der hingegen urn so klarer bei den Monatsbildern
im Palazzo Schifanoja hervortritt, wo die schwachere kiinstlerische Per-
sonlichkeit das trockene Programm nicht durch Belebung zu iiberwinden
vermag.
Eine solche Personlichkeit ist der Maier des Juli-Freskos. Nach
*Manitius gehort der Monat dem Gotterpaar Jupiter-Kybele. Nach
der spatantiken Planetentheorie dagegen ware Sol-Apollo der Regent
des Juli und des Tierkreiszeichens des Lowen.
I) Cf. Lippmann, Die sieben Planeten (1895), Taf. C. V.
T.ti.l !..\. V
!
--"'
f
TafC'l LXVI
.\l>b. 115. Schema dl'r Freskenanonlnung im Palazzo Schifannja zu F(rrara (zu Seitc .J76).
Planetenkinder- und M ythogl'aphentradition
473
Nun sieht man auf dem Fresko (Abb. II4} oben in der Ecke rechts
betende Monche, die in einer Kapelle vor einem Altarbilde knien; diese
Vorstellung ist aus dem Planetenkinder-Zyklus des Sol-Apollo in die hier
sonst maBgebende Zwolfgotterreihe des Manilius hineingeraten. Schon
seit 1445 sind in Stiddeutschland diese frommen Beter als typischer
Bestandteil der ,Sonnenkinder" nachgewiesen.
1
} Der deutsche Vers aus
einem Planetenblockbuch lautet dazu: <<Vor mitten tag sie dynen gote
vii, dornoch sy leben wie man wil.
Abgesehen von diesem Einsprengsel aus dem Sol-Planetenkreise
regieren aber nach Manitius das Gotterpaar Jupiter und Kybele mit der
Mauerkrone den Lowenmonat Juli; sie teilen sich friedlich in den Thron-
sitz auf ihrem Triumphwagen.
Wie ernst es mit der getreuen Wiederbelebung der antiken Sage
gemeint ist, zeigen die Gruppen rechts: im Hintergrunde liegt, der barba-
rischen Sage entsprechend, Attis. Und daB die in christliche Priester-
gewandung gehilllten, mit Becken, Cymbeln und Trommeln beschi:if-
tigten Geistlichen tatsachlich als ,Galli" gedacht sind, und ferner die
gewappneten Jtinglinge im Hintergrunde als schwertschwingende Kory-
banten, das beweisen, in diesem Zusammenhang, die drei leeren Stiihle,
die wir im Vordergrunde sehen: ein leerer Armstuhl steht links, zwei
dreibeinige Hocker rechts. Es kann kein Zweifel sein, daB diese Sitz-
gelegenheiten im zeitgenossischen Stil als echt urantike kultische Ge-
heimsymbole so auffi:illig in den Vordergrund plaziert sind: es sollen diet
leeren Gotterthrone der Kybele sein, die ja noch Augustinus unter aus-
drticklicher Berufung auf Varro erwahnt.
2
}
Die Kybele-Sage, wenn auch ohne diese hypergelehrte gemalte
Anmerkung iiber Gotterthrone, findet sich mit all ihren barbarischen
Einzelheiten nicht allein bei Albericus; sie wird uns bereits auf jenem
vereinzelten Blatt aus einer Regensburger Handschrift des 12. Jahrhun-
derts zusammen mit sehr merkwtirdigen anderen paganen Figuren vor-
gestellt. Hinter der Kybele auf ihrem Wagen, der von Lowen gezogen
wird, bemerkt man zwei Korybanten mit geziickten Schwertern.
3
) Dem
sogenannten Mittelalter fehlte es hier wahrlich nicht an dem Willen zu
stofflich getreuer Archaologie.
I) Kautzsch, Planetendarstellungen aus dem Jahre 1445, im Repertorium fiir Kunst-
wissenschaft (1897), S. 32 [ff. bes. S. 37].
2) De Civ. Dei VII, 24 ~ q u o d sedes fingantnr circa earn, cum omnia moveantur,
ipsam non movere.
3) Swarzenski, Die Regensburger Buchmalerei des X. und XI. Jahrhunderts (1901}.
S. 172 beschrieb das hochst interessante Blatt der Hs. Mon. Lat. 14271 (fol. II v;
s. unsere S. 414), worauf mich Dr. Fritz Saxl hinwies; ich denke das Blatt in der Ab-
handlung abzubilden und zu besprechen.
474 ltalienische Kunst 1md inlernationale Astrologie im Palazzo Schifanofa zu Ferrara
Der Maler des Julifreskos, dessen Gestaltungskraft nicht wie Cossas
lebensvolle Figurenwelt den illustrativen Hintergrund vergessen Hi.Bt,
ist ein Ausliiufer mittelalterlicher Kunstanschauung, die zum Absterben
reif ist. Die Hochzeitsszene links soil die Heirat der Bianca d'Este,
* einer Tochter Borsos, mit Galeotto della Mirandola vorstellen. Ein
Bruder dieses Galeotto war Pico della Mirandola, der tapfere Vor-
kiimpfer gegen astrologischen Aberglauben, der sich iiberdies in einem
besonderen Kapitel gegen die unsinnige arabische Doktrin von den
Dekanen ereiferte. Man begreift, daB ein Renaissance-Mensch, in dessen
engsten Kreis hinein diese astrologischen Diimone spukten - auch der
astrologiefeindliche Savonarola war in Ferrara geboren - sich gegen
solche barbarische Schicksalsgotzen zur Wehr setzte. Wie stark muBte
aber die antike Gotterwelt am Hofe der Este noch mit spiitantik-mittel-
alterlichen Vorstellungen und Praktiken verflochten sein, daB noch 1470
von einer durchgreifenden kiinstlerischen Restitution des Olymps sich
nur die ersten Symptome finden, die wir eben in dem Ersatz der Planeten-
gotter durch die Zwolfgotterreihe des Manitius erblicken.
Wer konnte nun der gelehrte Inspirator gewesen sein? Am Hofe
der Este spielte die Astrologie eine groBe Rolle: von Leonello d'Este
wird z. B. berichtet, daB er, wie die alten ssabischen Magier, an den
sieben Wochentagen Gewander in den betreffenden Planetenfarben
* trug
1
); Pietro Bono Avogaro, einer der Hoiastroiogen, schrieb Pro-
gnostica fiir jedes J ahr und ein gewisser Carlo da Sangiorgio befragte
sogar durch Punktierkunst, der letzten entarteten Ausliiuferin antik-
astrologischer Divination, die Zukunft.
2
) Nicht jener Avogaro, wohl aber
der andere Professor der Astronomie an der Universitiit Ferrara ist der'
iibergelehrte Inspirator der Monatsbilder im Palazzo Schifanoja gewesen:
Pellegrino Prisciani, der Bibliothekar und zugleich Hofhistoriograph der
Este war. Wir konnen dies durch einen quellenkritischen Indizienbeweis
feststellen. GewiB, auch Avogaro zitiert wiederholt in seinen Prognostiken
Abu Ma'schar. Jener Pellegrino Prisciani
8
) aber (dessen Portriit uns das
Titelblatt seiner Orthopasca in der Bibliothek zu Modena bewahrt),
zitiert in einer astrologischen Auskunft gerade denjenigen eigentiim-
I) Gardner, Dukes and Poets in Ferrara (1904), p. 46 verweist auf Decembrio,
Politiae Litterariae (1540) fol. I: Nam in veste non decorem et opulentiam sol urn, qua
caeteri principes honestari solent, sed mirum dixeris pro ratione planetarum, et dierum
ordine, colorum quoque coaptationem excogitauit.t
2) Cf. seinen Bericht vom Jahre 1469 bei A. Cappelli, Congiura contro il duca
Borso d'Este, in Atti e Memorie d. RR. Dep. Stor. Patr. p. I. provincie Modenesi e Par-
mensi&, 2 (1864), p. 377 ss.
3) "Ober ihn Bertoni, La Biblioteca Estense {1903) [bes. p. 194 sq.] und Massl!ra,
Archivio Muratoriano {I9II).
Pellegrino Prisciani als Urheber des Programms
475
lichen Gelehrtendreibund als seine Autoritaten, die wir eben als die
Haupt-Vorstellungsquellen unserer Fresken nachwiesen: Manilius, Abu
Ma'schar und Pietro d'Abano. Ich verdanke die Abschrift dieses bisher
unbekannten, flir mich so bedeutsamen Dokuments der Gtite des Archi-
vars von Modena, Herrn Dallari.I)
Leonora von Aragon, die Gemahlin des Herzogs Ercole, hatte ihn,
den astrologischen Vertrauensmann der Familie, urn Angabe der besten
Stern-Konstellation gebeten, bei der unbedingt in Erftillung gehe, was
man sich wtinsche. Er stellt mit Freude fest, daB diese Konstellation
gerade jetzt vorhanden sei: Jupiter mit dem Drachenkopf in Konjunk- *
tion bei gtinstigem Stand des Mondes unter demZeichen des Wassermanns,
under beruft sich bei seinem gelehrten Gutachten, das ich im Anhange
[S. 479] publiziere, aufAbuMa'schar'sAphorismen und auf denKonziliator
des Pietro d' Abano. Den autoritativen SchluBakkord aber lii.Bt er Manilius
singen: (IV. 570-571) <<quod si quem sanctumque velis castumque
probumque, Hie tibi nascetur, cum primus aquarius exib>. Dieser Indizien-
beweis dad, wie mir scheint, durch ein zweites urkundliches Zeugnis
als endgilltig abgeschlossen gelten; der vorhin erwahnte Brief des Fran-
cesco Cossa
2
} ist eine Beschwerde tiber schlechte Behandlung abseiten
des herzoglichen Kunstintendanten, tiber dessen Kopf weg er seine Klage
tiber schlechte Behandlung und Bezahlung an den Herzog Borso person-
lich richtet. Der Kunstinspektor im Palazzo Schifanoja war aber unser
Pellegrino Prisciani. Francesco sagt zwar nur, daB er sich an den Ftirsten
selbst wende, weil er Pellegrino Prisciani nicht belii.stigen wolle: << non
voglio esser quello il quale et a pellegrino de prisciano et a altri vegna a
fastidio>>, doch geht aus dem Zusammenhange deutlich hervor, da.l3 er
den gelehrten Mann vermied, weil dieser ihn auf dieselbe Stufe der Be-
zahlung stellen wollte, wie die anderen Monatsbildermaler, die Francesco
Cossa- wir begreifen heute seine berechtigte vergebliche Emporung-
als <<i piu tristi garzoni di Ferrara>> bezeichnet.
Ich glaube dem Andenken des Pellegrino nicht zu nahe zu treten
mit der Annahme, daB er die anderen Maler schon deshalb mindestens
so hoch schatzte wie Francesco Cossa, weil jene die Finessen des Ge-
lehrtenprogramms so schon deutlich verkorperten.
Wir dtirfen jedoch nicht vergessen, daB das Programm des Pris-
ciani- mochte es immerhin in der malerischen Ausftihrung durch Ober-
ladung mit Einzelheiten zu unktinstlerischer Zersplitterung ftihren - in
der Grundanlage einen Gedankenarchitekten verrii.t, der mit den tief-
r) R. Archivio di Stato in Modena-Cancellaria Ducale-Archivi per materie; Letterati
Prisciani Pellegrino.
2) Venturi, I. c., p. 384-385.
Warburg, Gesammelte Schriften Bd. 2
31
476 ltalienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Scliifanofa zu Ferrara
sinnig harmonischen Elementen griechischer Kosmologie taktvoll um-
zugehen weiB. Sehen wir uns daraufhin vermittelst einer fliichtigen
Skizze die Riickiibersetzung des ganzen Bilderzyklus von Ferrara ins
Spharische an, so springt es in die Augen, daB der dreifache Bilderstreifen
im Palazzo Schifanoja eigentlich ein auf die Ebene iibertragenes Spharen-
system ist, in dessen Anlage sich der Spharentypus des Manitius mit
dem der Bianchinitafel vermischt (Abb. ns).
Den innersten Kern der Erdsphare symbolisiert der illustrierte Hof-
.und Staatskalender des Duca Borsa; in der obersten Reihe schweben
dann - dem Glauben des Manilius entsprechend - die zwolf olympischen
Gotter als Beschiitzer der Monate; von ihnen sind in Ferrara noch vor-
handen: Pallas, Venus, Apollo, Mercur, Jupiter-Kybele, Ceres und
Vulcan.
Manitius hat die 12 Gotter an Stelle der Planeten zu Regenten der
rz Monate eingesetzt und verehrt. In Ferrara ist diese kosmologische
Theorie in der Grundidee beibehalten; es lieBen sich nur an einzelnen
Stellen versprengte Stiicke aus der alteren mittelalterlichen Planeten-
Astrologie aufzeigen, wahrend die gelehrt beschreibende Mythographie-
vor allem Albericus - iiberreichlich zu kleinlicher Ausmalung des
Hintergrundes beisteuerte.
Die Tierkreissphare ist dem Manitius, dem Planispharium Bianchini
und dem Monatszyklus im Palazzo Schifanoja gemeinsam. Du:rch die
Ausgestaltung des Dekansystems aber, das auf der Bianchinitafel sich
als besondere Region zwischen Fixsterne und Planeten einschiebt, ist
die Sphara des Prisciani dem Kosmos auf der Bianchinitafel blutsver-
wandt; denn die indischen Dekane des Abu Ma'schar, die die mittlere
Region im Palazzo Schifanoja beherrschen, verrieten - allerdings erst
bei exakter Auskultation - daB unter dem siebenfachen Reisemantel
der vielgepriiften Wanderer durch Zeiten, Volker und Menschen ein
griechisches Herz schlagt.
* *
*
Turas Gemalde in der Bibliothek des Pica della Mirandola sind uns
Ieider nur noch in Beschreibungen erhalten; sie wiirden uns vielleicht
schon in der gleichzeitigen ferraresischen Malerei selbst zeigen, wie sich
das stilistische Hauptereignis, das die Wende der Friihrenaissance zur
Hochrenaissance symbolisiert, anbahnt: die Restitution eines hoheren
* antikisierenden Idealstils fiir die graBen Gestalten der alten Sage und
Geschichte.
Zu diesem antikisierenden ldealstil hoherer Humanitat scheint aller-
dings vom Palazzo Schifanoja keine Briicke zu fiihren. Wir sahen, daB
Restitution der olympischen Antike
477
1470 die Kybelesage in der Prosa eines StraBenaufzuges die Pflicht
mittelalterlich-illustrativer Dienstbarkeit erfi.illt - denn noch hatte Man-
tegna nicht gelehrt, wie man die Gottermutter im Triumphalschritt des
romischen Triumphbogens festlich einhertragt - und auch die Venus *
Cossas schickt sich noch nicht an, aus der niederen Region des Trachten-
realismus <<alla franzese>> zum lichten Ather der <<Venere aviatica>> in der
Villa Farnesina aufzufahren.
Trotzdem besteht eine Dbergangssphare zwischen Cossa und Raffael:
Botticelli. Denn auch Alessandro Botticelli hat seine SchOnheitsgottin
erst befreien mi.issen aus mittelalterlichem Realismus banaler Genre-
kunst <<alla franzese>>, illustrativer Horigkeit und astrologischer Praktik.
Ich babe vor Jahrenl) schon den Nachweis zu fi.ihren versucht, daB
die Kupferstiche des sogenannten Baldini-Kalenders ein Jugendwerk
Botticellis sind und jedenfalls charakterisieren sie seine Vorstellungs-
welt von der Antike. Der Kalender hat in unserem Zusammenhang ein
doppeltes Interesse: durch seinen Text und durch die Darstellung. Der
Text ist eine direkte Gebrauchsanweisung fi.ir Planetenglaubige; eine *
eingehendere Betrachtung wird ibn als ein richtiges Kompendium helle-
nistischer angewandter Kosmologie - und zwar ebenfalls durch Abu
Ma'schar vermittelt- nachweisen.
An die Darstellung kni.ipft sich nun durch den scheinbar nebensach-
lichen Umstand, daB wir auch eine spatere Auflage desselben Kalenders
besitzen, eine stilgeschichtlich wertvolle Einsicht; wir konnen durch
eine Nuance der auBeren Gestaltung das neue Stilprinzip antikisch
idealisierender Beweglichkeit in statu nascendi beobachten. Die erste,
etwa 1465 anzusetzende Auflage (Abb. 22) dieses Kalenders, schlieBt
sich im Typus genau an jene nordischen Planetenblatter an. In der
Mitte der Venusgesellschaft steht ein steifes weibliches Tanzfigiirchen:
eine Frau in burgundischer Tracht, die den unverkennbaren franzosischen
Rennin mit der Guimpe auf dem Kopfe tragt; sie beweist dadurch schon *
auBerlich, daB Baldini-Botticelli sich an eine burgundische Version des
nordischen Vorbilds gehalten haben muB. Tendenz und Wesen der Stil-
umformung der florentinischen Fri.ihrenaissance enthi.illt nun die zweite,
wenige Jahre spater anzusetzende, Auflage dieses Stiches (Abb. 23).
Aus der engumsponnenen burgundischen Raupe entpuppt sich der
florentinische Schmetterling, die ,Nynfa" mit dem Fli.igelkopfputz und
der flatternden Gewandung der griechischen Manacle oder romischen *
Victoria.
In unserem Zusammenhange wird es jetzt deutlich, daB Botticellis
1) Delle imprese amorose nelle piu antiche incisioni fiorentine in Rivista d'Arte
(1905) Luglio. [S. S. 86.].
478 Italienische Kunst und intemationale Astrologie im Palazzo Schifanofa zu Fer1:ara
Venusbilder, ,Die Geburt der Venus" und der sogenannte ,Friihling",
der vom Mittelalter zweifach, mythographisch und astrologisch, gefes-
selten Gottin die olympische Freiheit wiedererringen wollen. Rosen-
umflattert erscheint Venus, eine entschalte Anadyomene, auf dem Wasser
in der Muschel; ihre Begleiterinnen, die drei Grazien, verbleiben in ihrem
Gefolge auf dem anderen Venusbilde, das ich vor Jahren das ,Reich
der Venus" nannte. Heute mochte ich wohl eine etwas andere Nuance
derselben Erklarung vorschlagen, die das Wesen der Schonheitsgottin
und der Herrin der wiedererwachenden N atur zugleich dem astrologisch
gebildeten Beschauer des Quattrocento ohne wei teres erschloB: << V enere
Pianeta>>, die Planetengottin Venus in dem von ihr regierten Aprilmonat
erscheinend.
* Simonetta Vespucci, zu deren Erinnerungskult beide Bilder m. E.
gehOren, - starb ja auch am 26. April 1476.
Bottice!li empfing also von der bisherigen 'Oberlieferung die stoff-
lichen Elemente, aber zu eigenster idealJscher Menschenschopfung, deren
neuen Stil ihm die wiedererweckte griechische und lateinische Antike,
der homerische Hymnus, Lucrez und Ovid (den ihm Polizian, kein morali-
sierender Monch, deutete), pragen half, und, vor allem, weil die antike
Plastik selbst ihn schauen lieB, wie die griechische Gotterwelt nach Pia-
tons Weise in hoheren Spharen ihren Reigen tanzt.
* ' *
*
Kommilitonen! Die Auflosung cines Bilderratsels - noch dazu wenn
man nicht einmal ruhig beleuchten, sondern nur kinematographisch
scheinwerfen kann - war selbstverstandlich nicht Selbstzweck meines
Vortrages.
Mit diesem hier gewagten vorlaufigen Einzelversuch wollte ich mir
ein Plaidoyer erlauben zugunsten einer methodischen Grenzerweiterung
unserer Kunstwissenschaft in stofflicher und raumlicher Beziehung.
Die Kunstgeschichte wird durch unzuHingliche allgemeine Entwick-
lungs-Kategorien bisher daran gehindert, ihr Material der allerdings
noch ungeschriebenen ,historischen Psychologic des menschlichen Aus-
drucks" zur Verfiigung zu stellen. Unsere junge Disziplin versperrt sich
durch allzu materialistische oder allzu mystische Grundstimmung den
weltgeschichtlichen Rundblick. Tastend sucht sie zwischen den Schema-
tismen der politischen Geschichte und den Doktrinen vom Genie ihre
eigene Entwicklungslehre zu finden. Ich hoffe, durch die Methode meines
Erklarungsversuches der Fresken im Palazzo Schifanoja zu Ferrara ge-
zeigt zu haben, daB eine ikonologische Analyse, die sich durch grenz-
polizeiliche Befangenheit weder davon abschrecken laBt, Antike, Mittel-
Grenzerweitevung der Kunstgesclnchte
479
alter und Neuzeit als zusammenhangende Epoche anzusehen, noch davon,
die Werke freiester und angewandtester Kunst als gleichberechtigte
Dokumente des Ausdrucks zu befragen, daB diese Methode, indem sie
sorgfa.Itig sich urn die Aufhellung einer einzelnen Dunkelheit bemiiht,
die groBen allgemeinen Entwicklungsvorgange in ihrem Zusammenhange
beleuchtet. Mir war es weniger zu tun urn die glatte Losung, als urn die
Heraushebung eines neuen Problems, das ich so formulieren mochte:
,Inwieweit ist der Eintritt des stilistischen Umschwunges in der Dar-
stellung menschlicher Erscheinung in der italienischen Kunst als inter-
national bedingter Auseinandersetzungs-ProzeB mit den nachlebenden
bildlichen Vorstellungen der heidnischen Kultur der ostlichen Mittel-
meervolker anzusehen ? "
Das enthusiastische Staunen vor dem unbegreiflichen Ereignis kiinst-
lerischer Genialitat kann nur an Gefiihlsstarke zunehmen, wenn wirer-
kennen, daB das Genie Gnade ist und zugleich bewuBte Auseinander-
setzungsenergie. Der neue groBe Stil, den uns das kiinstlerische Genie
Italiens beschert hat, wurzelte in dem sozialen Willen zur Entscha.Iung
griechischer Humanitat aus mittelalterlicher, orientalisch-lateinischer
,Praktik". Mit diesem Willen zur Restitution der Antike begann ,der
gute Europaer" seinen Kampf urn Aufklarung in jenem Zeitalter inter-
nationaler Bilderwanderung, das wir - etwas allzu mystisch - die
Epoche der Renaissance nennen.
ANHANG
Briefl) des Pellegrino de'Prisciani aus Mantua vom 26. Oktober 1487
an die Herzogin [Leonora] von Ferrara.
Illustrissima Madama Mia I Racordandomi spesse fiate del ragiona-
mento hebbi adi passati cum vostra Excellentia per quello debbo fare
ala mia ritornata a casa: etc. Et mettendossi hora a puncta: cossa mol to
notabile et maravelgiosa: et grandemente al proposito de V. S
1
a se bene
mi renda certo da qualche altro lato: sij stato porta a quella non dimeno
per ogni mia debita demonstratione: non ho dubitato hora per mio messo
a posta scriverli: et aprirli il tuto: non tacendo che forsi la oltra an cora:
poteria per qualch uno esser preso qualche pocho di errore come anche
si faceva in questa terra dale brigate.
Nel tempo qua di sopto annotato: corre quella constellatione de
cui non tanto 1i doctori moderni: rna li anti qui an cora: fano festa: et la
I) R. Archivio di Stato in Modena - Cancelleria Ducale- Archivi per materia
Letterati. Ich wurde durch Bertoni, 1. c., p. 172 auf die Spur des Briefes gefiihrt.
Pellegrino Prisciani erteilte eine ganz llhnliche Weissagung noch 1509 der Isabella
Este-Gonzaga; cf. Luzio-Renier, Coltura e relazioni letterarie d'lsabella d'Este, 222ff.
480 Italienisclie I<unst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferrara
qual da mi da molti anni in qua: come credo an cora da molti altri: e stato
cum grandissimo desiderio expectata. Et e quella de la qual scrive uno
notabilissimo doctore chiamato Almansore
1
) neli soi aphorismi al rro:
et dice.
Si quis postulaverit aliquid a Deo: Capite existente in medio C!(li cum
Jove: et luna eunte ad eum non praeteribit qum adipiscatur breviter
Et quella ancora di cui parla il Conciliatore
2
) et prima a la
dif.a II3 dove scrive queste parole.
Quo etiam modo quis potest fortunari aut infortunari ad bona
honores: Scientiam: etc. unde invocation em ad Deum per me
factam: percepi ad Scientiam conferre: capite cum Jove in medio celi
existente: et luna eunte ad ipsum: Quod et Reges grecorum cum volebant
suis petitionibus exaudiri observabant : albu. in Sadan. Et ancora ala
dif.a 154 dicendo in questo modo.
Praeterea similiter et oratione placantur: et in subsidium
concitantur nostrum ut orationum epilogus insinuat planetarum: unde
albumasar in Sadam: Reges graecorum cum volebant obsecrare deum
propter aliquod negotium: ponebant caput Draconis in medio cum
Jove aut aspectum ab eo figura amicabili. et lunam conjunctam Jovi:
aut recedentem ab ipso et conjunctionem cum domino ascendentis
petentem: adhuc autem et cum capite amicabili figura: Tunc qui dicebant
ipsorum petitionem audiri unde almansor in aphorismis: Si quid (sic)
postulaverit aliquod a deo etc. Et ego quidem in huius Orbis revolutione
quandoque configuratione scientiam petens apprime visus sum in illa
proficere.
3
)
Et perche JUma Madama mia alcuni qualche volte soleno in questo
tempo fare sculpire in argento on alcuno metallo la situatione del cielo
in quello tempo: per non mi parere necessario: piu presto ho ordinato
certe parole molto al proposito previe ala Oratione: le quale pari modo
mando ad V. Excelta la qual se dignara narrare il tuto allo mio IUmo
Sigre suo consorte: et monstrarli ogni cossa dicendoli: che non mi ha
parso scrivere a Sua Celsitudine: a cio le lett ere non vadano per li banchi
dela Cancellaria: et la Cossa transcora per bocha de molti quali come
homini grossi de tal mira bile facto lo biasemariano piu presto:
Vostra Jllma Sigla adonche: a dui di de novembre proxhuo futuro che
sera de Venere di: la sira sonate le vintiquatro hore et tri quarti posta
I) Almansoris Propositio zo8 (Ausg. Basil. 1533), p. 98).
2) Conciliator Petri Aponensis medici ac philosophi celeberrimi Liber Conciliator
differentiarum philosophorum precipueque medicorum appellatus etc. In der Ausg. von
1509 tl'agen die betr. Differentiae die Nrn. IIJ und 156, S. 158 v.o und 201 v.o
3) "Ober Sadan cf. Boll, S. 421; die Stelle geht auf den Conciliator I. c. zurll.ck.
Brief des Pellegrino Prisciani
in sua bona devotione et loco apto: ingenochiata incomenciara la Ora-
tione sua dicendo:
Omnipotens et Eterne Deus qui de nihilo cuncta visibilia et invisi-
bilia creasti: et celos ipsos tam miro ordine collocatis: errantibus et
fixis stellis sic mirabiliter decorasti: radios insuper: lumina: motus:
potestatem: et vim earn illis tribuens: quam tibi libuit: et quos intelli-
gentijs separatis et angelis sanctis tuis animasti: Quique nos homines
ad imaginem tuam (licet de limo terrae) plasmasti: ut et ex celis ipsis
plurimos etiam fructus: commoditates et beneficia (pietate tua inter-
cedente) consequeremur: Te supplex adeo: devoteque sempiternam
maiestatem tuam deprecor: et si non ea qua debeo: saltern qua possum
animi contritione ad immensam misericordiam et miram benignitatem
tuam humiliter confugiens: Ut postpositis delictis inscipientiyet pravitatis
m ~ : pietate tua exaudire me digneris: Et sicut mirabili stella ilia praevia
et ductrice: Guaspar: Melchior: et Baldasar: ab oriente discedentes
ad optatum praesepe Domini nostri Jhesu christi filij tui pervenerunt:
Ita nunc Stella Jovis cum capite draconis in medio celi existente et luna
ad eum accedente: ministris quidem tuis cum sanctis angelis suis mihi
auxiliantibus et ducibus. Oratio haec mea ad te pervenire possit: Et
mihi concedere: et largiri digneris etc. et qui vi dica la V. S. la gratia che
la desidera da ipso aeterno Dio: Et stagi cusi reiterando la Oratione insino
chel sonera una hora di nocte: Et tenga per fermo che non passaran
troppo giorni vedera per effecto haver consequito la adimandata gratia.
Et habbi certo che questa Constellatione non venira in tanta bontate
ad grandissimo tempo: perche si fa in lo signo de aquario; El quale e
proprio signo de tal sanctitate: et in tanto che quando uno homo nasce
et vene in questo mondo ascendendo ipso signo de aquario quellui e
homo sancto et tuto da bene: Dove Marco Manilio non dubito scrivere
in questo modo: Quod si quem sanctum essevelis: castumque probumque.
Hie tibi nascetur: cum primus Aquarius exit. Et sic valeat et exaudiatur
JUma D. tua ali pedi di la quale per mille volte me racomando- Mantue
die 26 octobris 1487.
Eiusdem Ducalis Dominationis Vestrae
Fidelis et devotus Servitor: Peregrinus Priscianus.
Ala Mia Illustrissima Madama
Madam a la Ducessa de Ferrara
Ferrarie
Subito
OBER PLANETENGOT1 tRBILDER
IM NIEDERDEUTSCHEN KALENDER
VON 1519
;\bb. 11b. :\Jcrkur aus <len Tarocchi,
oheritalienischer 1\upferslich. Serie E
(zu Site 154 und l1l5).
ffitrturiuo
J'Vurrc{) naturr '
Tafel LXVII
Abh. I ril. Merkur,
llolzschnitt von Hans Burgkmair
(zu Seite 4H6).
flcr toglm m'!'nr figurt
.l)!nc fyn'tlrr tinriJoucf(F vn'tlt (ubtllt
l!:Jn'tlt 1\'atf( 11111 fitrlltr'l'l(
f.mtrcuriuG (o lll'l'n namr
"]cf bl'n {imrrhct t>nbc: btqnamt
bttl)m'bttb.yn 'tier n.;tllt"fll
J
Ahh. 117. :\1<-rlwr aus: .:\ygc Kahnder, Lubeck l.)llJ (zu Scite .fil.)).
Die Holzschnitte, Planetengotter darstellend, im niederdeutschen
,Nyge-Kalender", den Steffen Arndes 1519 in Lubeck gedruckt hat,
verraten grundlicherer Betrachtung italienische Vorbilder; zwei Planeten-
- Merkur und Saturn -lassen sich sogar auf ganz bestimmte Vorlagen t
zuriickfiihren, auf die Planetengotter des beriihmten Tarock-Karten-
spiels, einer Kupferstichfolge, die urn 1465 in Oberitalien entstand (vgl.
Abb. n6, II7und 127, 128). Schon urn 1490 waren diese Planetengotter in
Nurnberger Holzschnitten nachweis bar verwertet worden; auch Durer hat
sie kopiert.
1
) Im niirnbergischen Humanistenkreise der Schedel und Celtes *
sind wohl deren Vermittler zu suchen, fiir die ja Padua Sammelplatz
und Ausfuhrstelle humanistischer Bildung war. Fur den hamburgischen
Drucker Steffen Arndes kommt jedoch eine andere Humanistenstatte,
Perugia, zunachst in Betracht. Er hat dart, wenn er nach Langes
2
)
einleuchtender Vermutung mit Stefano Aquila identisch ist, schon seit
1476 seine bei Gutenberg erlernte Kunst ausgeiibt. Ein mit prachtvollen
Holzschnitten geschmiicktes, bisher unbeachtetes Meisterstiick seiner
Presse, die gluckliche Zusammenwirkung von nordischer und italienischer
Druckkunst veranschaulichend, ist Lorenzo Spiritos ,libro delle sorti",
das er 1482 zusammen mit Paul Mechter und Gerhard von Buren in
Perugia druckte.
3
) In Perugia wirkte auch urn diese Zeit als Rechts-
professor der Hamburger Jacob Langenbeck, ein Bruder unseres bekann-
ten hamburgischen Biirgermeisters Heinrich Langenbeck. Er hat dort
jene erste Ausgabe der ,Digesten" herausgegeben, di2 der Kompagnon t
von Arndes, Wydenast, 1476 druckte. Perugia war eben fiir hamburgische
Studenten, die tiber Erfurt nach Italien zogen, die hohe Schule der neuen
humanistischen Bildung. Auch die Familie Arndes besaB in Italien
weilende rechtsgelehrte Familienmitglieder: Theodor Arndes vertrat urn
r) Vgl. Loga im Jahrb. d. PreuB. Kstslgn. (1895) S. 236ft. t
2) Vgl. H. 0. Lange, Les plus anciens imprimeurs a Perouse in Kgl. Danske Vidensk.
Selsk. Forhandl. (1907). Die Vermutung Langes unterstO.tzt die auf gefl. Auskunft des
Hamburgischen Staatsarchivs zurilckgehende Feststellung, daB die Familie Arndes den
Adler im Wappen ffthrte. Eine direkte Verwandtschaft zwischen Steffen und Theodor
Arndes ist jedoch bis jetzt nicht nachweisbar.
3) Der Vortragende berichtete ausfll.hrlich tiber dieses Druckwerk in einer Sitzung
1910. S. Abb. 119 und 120; Expl. in Ulm, Seite ca. 27 X 19 em.
Vber Planetengotterbilder im Niederdeulschen Kalender von ISI9
1475 Hamburg in Rom bei einern Prozesse und wurde dann, nachdern
er Dechant in Hildesheirn und Braunschweig gewesen war, Bischof in
Lubeck (1492), wo ja auch Steffen Arndes spater seine Hauptwirksarn-
keit entfaltete. Die Annahrne niiherer Beziehungen zwischen diesen heiden
Arndes schien so die merkwtirdige Tatsache zu erkliiren, daB sich, bisher
unbeachtet, die Planetengotter genau im Stile des Kalenders an nieder-
* siichsischen Hiiuserfassaden in Braunschweig (1536) und an dem ,Brust-
tuch" in Goslar (1526) vorfinden. Ebenso liiBt sich nachweisen, daB Mars
und Venus, Saturn und Luna, die lebensgroB gemalt an den Wiinden der
Rathauslaube in Liineburg auftauchen (urn 1529), auf dieselben Gotter-
typen zuriickgehen. Und doch haben wir an einen anderen Planeten-
* Vermittler zu denken, an Hans Burgkrnair
1
) in Augsburg, dessen Holz-
schnittfolge der Planeten das gemeinsame Vorbild (vgl. Abb. n8) nicht
nur dieser nordischen Planetengotter gewesen ist, sondern auch, der
Lage Augsburgs entsprechend, die in Italien wiedererweckte Gotterwelt
nach Ostdeutschland vorbildlich verbreitete, wie die Fassade am bunten
* Haus in Eggenburg (1547) in Niederosterreich beweist. Es ist sogar
* wahrscheinlich, daB Burgkmair solche Planeten wirklich an einer Haus-
fassade am Markt in Augsburg selbst gemalt hat. Das wiirde die nach-
driickliche Einwirkung dieser Figuren im allgemeinen und zugleich ihre
Erscheinung an Hiiuserfronten erkHi:ren. Die Planeh::ngotter Burgkmairs
konnten ihrerseits wiederum auf ein verloren gegangenes monumentales
italienisches Werk zuriickgehen, von dem dann die heiden Planeten des
oberitalienischen Tarockspiels nur seitliche Ausliiufer wiiren.
2
) Mogen
sich nun immerhin Einzelheiten bei genauerer Nachforschung spiiter
anders darstellen, so ergibt sich doch fiir die wissenschaftliche Bibliophilie
als sicheres Ergebnis, daB dieser Kalender von 1519, der nur ein naives
Erzeugnis volkstiimlicher Literatur zu sein scheint, vielmehr ein entwick-
lungsgeschichtlich sehr bemerkenswertes Kunsterzeugnis ist, dem eine
tiber das lokalgeschichtliche Interesse weit hinausgehende kulturgeschicht-
liche Bedeutung zufiillt. Denn durch ihn liiBt sich die verschollene
EtappenstraBe nachweisen, auf der jene Bilder hin und her wandern
konnten, die, durch die Druckkunst befreit und mobil gemacht, eine
neue Epoche des Austausches kiinstlerischer Kultur zwischen Norden
und Siiden anbahnten und vermitteln.
1) Cand. phil. Hubner wies den Vortragenden zuerst auf Burgkmair hin.
2) Der Vortragende sprach eingehend iiber diese Beziehungen auf dem Intern.
kunsthistor. KongreLl 1909 in Milnchen.
..-I, uli:>.A?ml t'lerc ala filnnot11
Jt. pa illitruiono fcbtfllrc
, It alquanto tl mio adfanno aUcuierc
troppodlftolantmafcnrc
,
!
Tafel LXVIII
.
..
...... , ..
Ahh. 1 Iq. LotTnw Spirito, Lil>ro ddlt Sorti, qH2 (zu Stit<- .f/:)5)
Tafel LXIX
Ahb. 1 !o. S;t!urn a us Lorl'nzo Spirito, Lihr" tklk Sorti, Ptruo_:i;t 1
(Zti S"itt
HEIDNISCH-ANTIKE
WEISSAGUNG IN WORT UND BILD
ZU LUTHERS ZEITEN
VORBEMERKUNG
Auf Veranlassung seines Freundes Boll hat der seit Ende Oktober
1918 schwer erkrankte Verfasser in die Drucklegung des vorliegenden
Fragmentes eingewilligt, obgleich es ihm nicht moglich war, notige Ver-
besserungen, geschweige- wie er es sich vorgenommen hatte- wesent-
liche Erweiterungen aus einer unbekannten Fiille friiher durchgearbei-
teten und vorbereiteten Materials beizubringen. Er lieB aber dieses
Bruchstiick doch hinausgehen, weil er sich einerseits vorhielt, daB dieser
Versuch einem Spurenfolger spater doch helfen konne, und daB anderer-
seits die Moglichkeit, auslandisch lagernde Faden einzuspinnen- mochte
der bisherige Weber gut oder schlecht sein -, technisch unserem forschen-
den Deutschland fiir lange geraubt ist. Er bittet deshalb die Freunde
und Kollegen, die ihm jahrelang unermi.idlich halfen, allen voran Franz
Boll, diese Zustimmung zur Veroffentlichung einer UnzuHinglichkeit als
DankesauBerung aufzufassen. Ohne die weitgehende jahrelange Hilfe der
Bibliotheken und Archive- sie alle zu nennen, ist dem Verfasser zurzeit
unmoglich -, erwahnt seien nur vor allem Berlin, Dresden, Gottingen,
Hamburg, Konigsberg, Leipzig, Miinchen, Wolfenbiittel, Zwickau und
Madrid, Oxford, Paris, Rom - waren seine Studien unausfiihrbar ge-
blieben. Weit iiber die nachste Amtspflicht hinaus halfen dem Verfasser
auBer seinem verstorbenen Freund Robert Miinzei, Prof. Paul Flemming
in Pforta, Prof. Ernst Kroker in Leipzig, Dr. Georg Leidinger in Miin-
chen, P. Franz Ehrle (friiher in Rom), Prof. Richard Solomon in Hamburg
und Prof. Gustav Milchsack t in Wolfenblittel. Wilhelm Printz und
Fritz Saxl, die ihm jahrelang bis zuletzt treulich beigestanden haben,
gebiihrt an dieser Stelle sein herzlicher Dank. Den Mitgliedern der
H.eligionswissenschaftlichen Vereinigung zu Berlin konnte er !eider das
Referat in der versprochenen Form nicht mehr liefern. Sie mogen den-
noch diese Schrift als Zeichen seines aufrichtigen und steten Dankes fiir
die Sitzung vom 23. April 1918 ansehen.
Meiner lieben Frau sei diese Schrift zur Erinnerung an den Winter
1888 in Florenz zugeeignet.
Hamburg, 26. Januar 1920.
I. REFORMATION, MAGIE UND ASTH.OLOGIE
Es ist ein altes Buch zu blat tern:
Vom Harz bis Hellas immer Vettern
Faust I I.
Dem fehlenden Handbuch ,.Von der Unfreiheit des aberglaubigen
modernen Menschen" mtil3te cine gleichfails noch ungcschriebene wissen-
schaftliche Untersuchung vorausgehen tiber: ,.Die Renaissance der damo-
nischen Antike im Zeitalter der deutschen Reformation". Als ganz vor-
laufiger Beitrag zu diesen Fragen sollte ein Vortrag dienen, den der Ver-
fasser in der Religionswissenschaftlichen Vereinigung in Berlin tiber
.,Heidnisch-antike Weissagung zu Luthers Zeiten in Wort und Bild"
gehalten hat.l) Dieser Vortrag liegt dem vorliegenden Versuch zugrunde.
Die dabei untersuchtcn Bilder gch6ren 1m weitesten Sinne wohl zum
Beobachtungsgebiet der Kunstgeschichte (soweit namlich alles Bild-
schaffen in ihr Studiengebiet einbegriffcn ist), aber sie entstammen (bis
auf das Bildnis Carions
2
), Abb. rzr) dem Kreise der Buchkunst oder der
druckenden Kunst und sind deshalb ohne das zugehorige \Vort - es
mag nun dabeistehen oder nicht- fUr die rein formale Betrachtung der
heutigen Kunsthistorie um so weniger ein naheliegendes Objekt, als sie
neben ihrer seltsamcn inhaltlich illustrativen Gebundenheit asthetisch
nicht anziehend sind. Aus dem Kuriosum den geistesgeschichtlichen Er-
kenntniswert herauszuholen, liegt aber Religionswissenschaftlcrn von
vornherein naher als den Kunsthistorikcrn. Und doch geh6rt die Ein-
beziehung dieser Gebildc aus der halbdunklen Region geistespolitischer
Tendenzlitcratur in gri.indliche historische Betrachtung zu den eigent-
lichen Aufgaben der Kunstgeschichte; denn cine der Hauptfragen der
stilerforschenden Kulturwissenschaft - die Frage nach dem Einflul3 der
Antike auf die europaischc Gesamtkultur der Renaissancezeit - kann
nur so in ihrem ganzen Umfange begriffen und zu beantworten versucht
werden. Erst wenn wir uns entschlie13en, die Gestalten der heidnischcn
Gotterwelt, wie sic in der Frtihrenaissance im Norden und Stiden wieder-
auferstehen, nicht nur als ktinstlerische Erscheinungen, sondern auch
als religiose Wesen aufzufassen und zu untersuchcn, lernen v .. -ir allmii.hlich
begreifen, welche Schicksalsmacht der Fatalismus der hellenistischen
Kosmologie auch fUr Deutschland war, selbst noch im Zeitalter der
Reformation; der heidni.:.che Augur, der noch dazu unter dem Deck-
I) Vgl. Prof. Paul Hildebrandt in der Voss. Ztg. 306 vom r8. Juni 1918.
2) Siebe unten S. 53z, Anm. 3
Olympische und diimonische Anltke
mantel der naturwissenschaftlichen Gelehrsamkeit auftrat, war schwer
zu bekii.mpfen, geschweige zu besiegen.
Die klassisch-veredelte, antike Gotterwelt ist uns seit Winckelmann
freilich so sehr als Symbol der Antike iiberhaupt eingepriigt, daB wir
ganz vergessen, daB sie eine Neuschopfung der gelehrten humanistischen
Kultur ist; diese ,olympische" Seite der Antike muBte ja erst der alt-
hergebrachten ,diimonischen" abgerungen werden; denn als kosmisch.::
Diimonen gehorten die antiken Gotter ununterbrochen seit dem Ausgange
des Altertums zu den religiOsen Miichten des christlichen Europa und
bedingten dessen praktische Lebensgestaltung so einschneidend, daB
man ein von der christlichen Kirche stillschweigend geduldetes Neben-
regiment der heidnischen Kosmologie, insbesondere der Astrologie, nicht
leugnen kann. Durch getreue Oberliefcrung auf der WanderstraBe vom
Helienismus he1 iiber Arabien, Spanien und Italien nach Deutschland
hinein (wo sie schon von 1470 ab in der neuen Druckkunst in Augsburg,
Niirnberg und Leipzig in Wort und Bild eine wanderlustige Renaissance
vollfiihren) waren die Gestirngotter in Bild und Sprache lebendige Zeit-
gottheiten geblieben, die jeden Zeitabschnitt im Jahreslauf, das ganze
Jahr, den Monat, die Woche, den Tag, die Stunde, Minute und Sekunde,
mathematisch bezeichneten, zugleich aber mythisch-personlich beherrsch-
ten. Sie waren diimonische \Vesen von unheimlich entgegengesetzter Dop-
pelmacht: als Sternzeichen waren sie Raumerweiterer, Richtpunkte
beim Fluge der Seele durch das Weltall, als Sternbilder Gotzen zugleich,
mit denen sich die arme Kreatur nach Kindermenschenart durch ehr-
fi.irchtige Handlungen mystisch zu vereinigen strebte. Der Sternkundige
der Reformationszeit durchmiBt eben diese dem heutigen Naturwissen-
schaftler unvcreinbar erscheinenden Gegenpole zwischen mathematischer
Abstraktion und kultlich verehrender Verkni.ipfung wie Umkehrpunkte
einer einheitlichen weitschvv1.ngenden urtiimlichen Seelenverfassung. Lo-
gik, die den Denkraum- zwischen Mensch und Objekt- durch be-
grifflich sondernde Bezeichnung schafft, und Magie, die eben
diesen Den kr au m durch abergliiubisch z us am men zi ehen de- ideelle
oder praktische- Verkniipfung von Mensch und Objekt wieder zer-
stort, beobachten wir im weissagenden Denken der Astrologie noch als
einheitlich primitives Geriit, mit dem der Astrologe messen und zugleich
zaubern kann. Die Epoche, wo Logik und Magie wie Tropus und Metapher
(nach den Worten Jean Pauls
1
) ,auf einem Stamme geimpfet bliihten",
1) .,Doppelzweig des bildlichcn Witzcs.
Der bildliche Witz kann entweder den Korper beseelen, oder den Geist verkorpern.
UrsprUnglich, wo der Mensch noch mit dcr Welt auf eincm Stamme geimpfet bliihte,
war dieser Doppel-Tropus noch keiner; jener verglich nicht Uniihnlichkeitcn, sondern
Warburg, GesammoJte Schriften. Bd. 2
32
492
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
ist eigentlich zeitlos, und in der kulturwissenschaftlichen Darstellung
solcher Polaritat liegen bisher ungehobene Erkenntniswerte zu einer ver-
tieften positiven Kritik einer Geschichtsschreibung, deren Entwicklungs-
lehre rein zeitbegrifflich bedingt ist.
Die Astrologen des Mittelalters trugen das hellenistische Erbe von
Bagdad tiber Toledo und Padua nach Norden; so gehOrten in Augsburg
die Werke der arabischen und italienischen Astrologen zu den ersten
illustrierten Erzeugnissen der Buchdruckerpresse.
Daher stehen sich urn die Wende des 15. Jahrhunderts sowohl in
Italien wie in Deutschland zwei Auffassungen der Antike gegeniiber:
die uralte praktisch-religiose und die neue kiinstlerisch-asthetische. Wah-
rend die letztere in I tali en zunachst zu siegen scheint und auch in Deutsch-
land Anhanger findet, erfahrt die astrologische Antike eine hochst eigen-
tiimliche, bisher noch gar nicht geniigend beachtete Renaissance in
Deutschland dadurch, daB die in der Weissagungsiiteratur fortlebenden
Gestirnsymbole- vor allem die menschengestaltigen sieben Planeten-
aus der kampfdurchtobten sozialen und politischen Gegenwart eine Blut-
erneuerung erfahren, die sie gewissermaBen zu politischen Augenblicks-
gottern macht. Neben diesen menschenfOrmigen Schicksalslenkern, die
als Gestirnsymbole der methodischen Sterndeutekunst der ,kiinstlichen"
(d. h. wissenschaftlichen) Weissagung unterliegen, muB man auch die
irdischen Monstra als Schicksalskiinder der ,wunderlichen" Weissagung
in die Betrachtung einbeziehen. Diese Scheidung zwischen ,ktinst-
licher" und ,wunderlicher" Weissagung
1
) miissen wir begreifen und
uns deshalb besonders vor Augen halten, weil sich hier - wie gezeigt
werden wird - die Wege von Luther und Melanchthon trennen. Als
Ausgangspunkt soil hierbei ein bisher unbekannter Brief Melanchthons
an den Astrologen und Historiker Johann Carion a us Bietigheim dienen,
der am kurbrandenburgischen Hofe eine einfluBreiche Stellung einnahm.
verkiindigte Gleichheit; die Metaphern waren. wie bei Kindern. nur abgedrungene Syno-
nymen des Lcibes und Geistes. Wie im Schreiben Bilderscbrift friiher war als Buchstaben-
scbrift, so war im Sprechen die Metapher. sofcm sie Verbll.ltnisse und nicht Gegenstande
bezeichnet, das friihere Wort, welches sich erst allmahlich zum eil!entlichen Ausdruck
entfll.rben mu13te. Das tropische Beseelen und Beleiben fie! noch in Eins zusammen, wei!
noch Ich und Welt verscbmolz. Daher ist jede Sprache in Riicksicbt geistiger Bezeichmmgen
ein Wtlrterbuch erblasseter Metaphern." (Vorschule der Asthetik 50.)
I) Die Kernfrage, inwieweit im Kreis der reformatorischen Humanisten eine un-
mittelbare Kenntnis oder bewuBte Abwandlung der antiken, stoischen Theorie von den
zwei Arten der Mantik (artificialis und naturalis; -re'X_vtxfj und ftTEXvoc; bei den gricchischen
Stoikern) vorliegt. kann bier nicht eingehend behandelt werden. Vgl. dazu Caspar Peucer
(Melanchthons Schwiegersohn), Comm. de praecip. generibus divinationum (Ausg. \Vitten-
berg 158o), Bl. 6.
Kunstliche und wunderliche Weissagung
493
II. HEIDNISCH-ANTIKE ELEMENTE IN DER
KOSMOLOGISCHEN UND POLITISCHEN WELTAUFFASSUNG
DER REFORMATIONSZEIT: ASTROLOGIE UND TERATOLOGIE
IM UMKREISE LUTHERS
I. DER BRIEF MELANCHTHONS AN CARlON OBER DEN KOMETEN VON 1531
der Suche nach Car ions Brief en verv.ries mich die Sammlung
von Johannes Voigt!) auf das Staatsarchiv zu Konigsberg und diesem
verdankte ich die Moglichkeit, eine Reihe von seinen Briefen in der Ham-
burgischen Stadtbibliothek studieren zu konnen. Dabei fand sich als Bei-
lage ein lateinisches Schreiben, das Me Ian c h tho n am 17. August 1531
an ihn richtete. Dank der Freundlichkeit von Prof. Flemming in Pforta
konnte ich den lateinischen Text (s. Beilage A. I.) unter Benutzung der
Textverbesserungen von Nikolaus Muller t sicherstellen. Ich gebe hier
den ganzen Inhalt in freier 'Obersetzung wieder, weil uns jede Einzelheit
Melanchthon iiberaus anschaulich in seinem fiir Deutschland so schick-
salbestimmenden Zwiespalt zwischen humanistischer Intellektualitiit und
theologisch-politischem Reformationswillen zeigt.
Aufschrift: Dem hochgelehrten Herrn Johann Carion, dem Philo-
sophen, seinem Freund und lieben T ,zu eigen handen".
, ... Ich habe versucht, (den Text) mit den angesehensten Zitaten
auszustatten. Was ich erreicht habe, mogen andere beurteilen. Der Spruch
des Elias kommt nicht in der Bibel vor, sondern bei den Rabbinen und
ist sehr beriihmt. Burge n sis (Paulus)
2
) zitiert ihn und verficht unter
Berufung auf ihn gegen die Juden (die Ansicht), daB der Messias schon
erschienen sei. Den Hebriiern ist dieser Ausspruch sehr geliiufig und von
mir an den Anfang Deiner Historia (Car ions Chronic a) gesetzt, urn
allgemeiner bekannt zu werden und Deinem \Verke Empfehlung zu ver-
schaffen. Solche Zitate werde ich spiiter noch viele hi:l.zusetzen. Du siehst
(aber), wie die prophetische Stimme vorausweist; so zutreffend (con-
cinna; harmonisch ?) ist die Verteilung der Zeitalter.
Die Historia werden wir diesen Winter, wie ich hoffe, vollenden,
denn bis jetzt wurde ich durch die 'Oberarbeitung meiner Apologie, die
ich an einzelnen Stellen verbesserte, daran verhindert. Du glaubst kaum,
wie schwach meine Gesundheit ist; ich werde auch durch Sorge und
Arbeit aufgerieben.
Meine Frau genas mit Gottes Hilfe einer Tochter, deren Geburtszeit
1) Briefwechsel der beriihmtesten Gelehrten des Zeitalters der Reformation mit
Herzog Albrecht von PreuBen. (K<inigsberg 1841.)
2) Scrutinium scripturarum. Vgl. Beil. A. I. Anm. S. 536.
494
/leidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
(Thema) ich Dir schicke, nicht etwa, urn Dir Miihe zu machen. Ich sehe
niimlich, daB sie Nonne werden wird.l)
Seit mehr als acht Tagen sehen wir einen Kometen. W1e urteilst
Du dariiber? Er scheint tiber dem Krebs zu stehen, da er gleich nach der
Sonne untergeht und kurz vor Sonnenaufgang aufgeht. Wenn er eine
rote Farbe hiitte, wiirde er mich mehr erschrecken. Ohne Zweifel bedeutet
er den Tod von Fiirsten, er scheint aber den Schweif nach Polen zu
wenden. Aber ich erwarte Dein Urteil. Ich wiire Dir von ganzem Herzen
dankbar, wenn Du mir mitteiltest, was Du meinst.
Nun komme ich zu den heutigen Mitteilungen. Wenn ich etwas tiber
die Versuche unserer Gegner wiiBte, so wiirde ich Dir alles schreiben,
was daran ware, denn wir brauchen die Plane unserer Gegner nicht zu
verbergen; fiir uns ist im Gegenteil niitzlicher, sie zu enthiillen.
Ich babe namlich schon lange nichts Sicheres tiber irgend welche
Vorbereitungen gehOrt, au13er Beftirchtungen, die die Unsrigen hegen
wegen jener (nicht ?) kleinen Anzahl von FuBsoldaten, die in Friesland
sind. Vielleicht denken sie daran, unter dem Vorwand des diinischen
Krieges auch tiber uns herzufallen. Aber der PfaJzer und der Mainzer
verhandeln mit den Unsrigen schon tiber friedliche Beilegung, obwohl ich
keine Friedenshoffnung habe. Ich werde namlich nicht allein durch
astrologische Vora ussagen beeindruckt, sondern auch durch Weis-
sagungen. HaBfurt sagte dern Konig Christian eine ehrenvolle Riick-
kehr voraus. Schepperus leugnet, daB er zuriickkommen wiirde. Auf
mich macht Schepperus keinen Eindruck. Er tauscht sich oft. HaBfurt
sagte auch dem Landgrafen die groBten Siege voraus, und ein Burger in
Schmalkalden, der mir bekannt ist, hatte ein Wundergesicht tiber diese
(politischen) Unruhen, cine Weissagung, auf die ich den groBten Wert lege.
Sie enthalt die Voraussage auf eine glimpflich verlaufende Katastrophe,
deutet dabei aber doch an, daB unsere Gegner, von Schrecken gepackt,
jenem Lowen (dem hessischen Landgrafen) weichen. Ein Weib in
Kitzingen hat Schreckliches tiber Ferdinand vorausgesagt. Er werde
Krieg gegen uns fiihren, der fur ihn aber ungliicklich verlaufen werde.
In Bclgien hat eine J ungfrau dem Kaiser auch geweissagt, was ich aber
noch nicht geniigend nachgepriift habe. Im ganzen meine ich, daB irgend-
eine Bewegung auftreten wird, und ich flehe zu Gott, daB er sie zu gutem
Ende lenkt und ihr einen der Kirche und dem Staate giinstigen Ausgang
verleiht. Ich arbeitete schon vor Jahresfrist cifrig daran, daB sie mit uns
Frieden machten. Hatten sie es getan, dann wiirde es weniger Aufruhr
1) Vgl. 1\Ielanchthon an Camerarius 26. Juii 1531 (Corpus Reformatorum = CK II,
516). Pcucer, der diese Tochter (Margarethe) heiratcte, hat die Weissagung ad absurdum
gefiihrt.
Melanchthons Brief an Carion
495
in Schwaben geben, das (jetzt) zum grol3en Teil der Schweizer Theologie
und Vermessenheit (licentia) anhangt. Aber Campeggi will den Kaiser
in einen deutschen Krieg hineinreil3en und verstricken, urn seine Macht
zu erschtittern, und die Ratschlage des Camp egg i bill1gen einige a us
personlichem HaB gcgen die Unsrigen. Gottes Auge aber ist gerecht.
Wir haben sicherlich nichts Schlechtes gelehrt und befreiten viele fromme
Seelen von vielen verderblichen Irrlehren. Sabin us schickt dir meine
Vorrede iiber das Lob der Astronomie und Astrologic, tiber die ich Dein
Urteil erwarte. Lebe wohl. Am Donnerstag nach Mariae Himmelfahrt
1531. Ich schicke Dir die Briefe zuriick ... <ll(l.m7toc;."
In diesem Briefe sieht man Melanchthon in einem kritischen Augen-
blick seines Lebens tiber die Schulter; wir finden ihn dreifach schrift-
stellerisch beschaftigt, als Humanisten, Theologen und astropolitischen
Journalisten. Zunachst bestimmt er durch den sogenannten Spruch aus
dem Hause des Elias, durch den der weltgeschichtliche Verlauf in drei
Perioden zu 2000 Jahren eingeteilt wird, den Aufbau des erst durch
seine Mitwirkung ftir die deutsche Geschichtsauffassung so einfluBreichen,
frtihesten deutschen weltgeschichtlichen Handbuches, Carions Chronica.
1
)
Das muB er in einer Zeit tun, wo ihn die Oberarbeitung der Augsburgischen
Konfession mit der schwerstcn Verantwortung belastet; denn seit dem
30. April ist das kaiserliche Ultimatum an die Protestanten abgelaufen,
und nun droht, was Melanchthon mit aller Macht zu verhindern bestrebt
war, bewaffneter ZusammenstoB zwischen schmalkaldischem Bund und
Karl V. Hiertiber wiinscht offenbar Carion, der ja der diplomatische
Agent der Brandenburger war, genauer unterrichtet zu werden, und Me-
lanchthon behandelt ihn dabei schon - das ist bemerkenswert- durch-
aus als Parteigiinger der schmalkaldischen Seite. Aber Melanchthon ist
bier nicht ein trockener politischer Chronist; die quiilende Sorge urn die
Erhaltung des Friedens ruft bei ibm einen akuten Anfall seiner kosmolo-
gischen Wundergliiubigkeit hervor: hierbei ist er Carion gegentiber nicht
mehr der tiberlegene, raterteilende Gelehrte; er naht sich dem biederen
2
)
Carion wie ein trostsuchender Patient, und konsultiert ihn als sachver-
sHindigen Magus in astrologisch-prophetischen Dingen. So schickt er
ihm die Genesis seiner eben geborenen Tochter doch gewi13 nicht ohne
den Wunsch, daB er sie begutachten moge, und verlangt, wie er ausdri.ick-
lich in seinem Brief sagt, ein Urteil iiber seine (M:elanchthons) Gedanken
i.iber Astronomic und Astrologie, wie er sie z. B. soeben in der Einleitung
zu Sacrobosco
3
) veroffentlicht hatte. Vor allem aber soll er ihn tiber den
1) Siebe Beil. A. I. Anm. S. 536.
2) 24. (?) Juni 1531: candid us et Suevicae simplicitatis plurimum refercns (CR. II. 505).
3) en. II, 5JOff., geschrieben im August ISJI.
Heidnisch-antike Weissagung in Wol't und Bild ztt Luthers Zeiten
Kometen beruhigen, der im August erschien- es warder Halleysche -,
der ganz Deutschland und Melanchthon noch ganz besonders erschreckte,
weil es der erste war, den er je gesehen hatte. Dafiir teilte er ihm auch
mit, was andere beriihmte Astrologen seiner Zeit zur allgemeinen Lage
prophezeiten. Johann Virdung aus HaBfurt, den er nennt, iiberschattet
Melanchthons Leben ja schon seit seiner Geburt mit seinen Warnungen;
denn er hatte ihm damals auf Wunsch des Vaters gleich die NativWit
gestellt, die z. B. die Warnung vor dem Norden und der Ostsee enthielt,
die Melanchthon tatsachiich verhinderte, wie er 1560 gestand, nach Dane-
mark zu reisen.l) Es sind aber nicht allein die wissenschaftlichen Voraus-
sagen, sondern, wie Melanchthon ja ausdriicklich hervorhebt, die Vati-
cinia, die unmittelbar inspirierten, 'unwissenschaftlichen' Weissagungen,
die ihn am meisten erregten. Da ist der Mann von Schmalkalden und
das Weib von Kitzingen. Von diesen horen wir schon sehr viel friiher.
Schon Ende Marz hatte Melanchthon sowohl an Corda tus wie an Ba um-
gartner iiber letztere geschrieben, sie weissage innerhalb von sechs
Monaten einen graBen Krieg gegen die Evangelischen mit Unterstiitzung
Frankreichs.
2
) tiber den Kaiser wuBte sie weniger Schlechtes als iiber
den Konig Ferdinand. Auch das furchtbare Gesicht des Burgers von
Schmalkalden erwahnt Melanchthon schon am II. April in einem Briefe
an Camerarius.
3
) So steht der geistliche Fuhrer des evangelischen Deutsch-
lands gerade in einem Augenblick, wo nur ein unerschiitterlicher Wiiie
zur inneren Abkehr von den gewissenbedriickenden Machten dieser Zeit-
lichkeit die Lage retten konnte, wie ein heidnischer Zeichendeuter da,
der durch Himmelszeichen und Menschenstimmen von unbedingt wehr-
hafter EntschluBfreudigkeit abgelenkt wird. Wenigstens lieBen ihm die
Prophetenstimmen noch einige Siegeshoffnung auf den Leo, den hessi-
schen Lowen.
Melanchthon konnte freilich den inneren Widerspruch seines kritisch-
phi1ologischen Tatsachensinnes dadurch beschwichtigen, daB fiir ihn in
der astrologischen Methode jene harmonisierende Weltanschauung der
Alten praktisch fortlebte, die eben die wesentliche Grundlage seines
kosmologisch gerichteten Humanism us war.
4
)
1) 30. Juli 1557 an Joh. Matthesius (CR. IX, 189), dazu Brevis narratio ed. Nikolaus
Mliller (in: Ph. Melanchthons letzte Lebenstage usw. (Leipzig 1910), S. 2.
2) CR. II, 490 und 491.
3) CR. II, 495
4) Vgl. z. B. CR. XI, 263, dazu Karl Hartfelder, Der Aberglaube Ph. Melanchthon's
(Histor. Taschenbuch, 6. Folge, 8. Jahrg., 1889), S. 237f.
Luthers und Melanchthons Stellung zur Astrologie
497
!!. GESTIRNBEOBACHTENDE WEISSAGUNG. - LUTHERS UND MELAN-
CHTHONS GEGENSATZLICHE STELLUNG ZUR ANTIKEN ASTROLOGIE
Die italienische Kultur der Renaissance hatte im Siiden und Norden
Typen der heidnisch-antiken Weissagung bewahrt und wiederbelebt,
deren Wesen in einer so lebenskraftigen Mischung heterogener Elemente,
von Rationalismus und Mythologik, von rechnendem Mathematiker und
prophezeiendem Augur hestand, daB sich selbst die Hochburg des mit
Rom urn die innere Befreiung ringenden christiichen Deutschland, der
Wittenberger Kulturkreis, mit ihnen auseinandersetzen muBte. Selbst
hier, wo man christliches Heidentum zu Rom so leidenschaftlich be-
kampfte, fanden dennoch der babylonisch-hellenistische Sterndeuter wie
der romische Augur EinlaB und eigentiimlich bedingte Zustimmung.
Luther und Melanchthon enthiillen hierbei den Grund dieser fiir gerad-
linig denkende Geschichtsauffassung so paradoxen Anteilnahme an den
fortlebenden mysteriosen Praktiken heidnischer Religiositat, weil sie
sich mit diesem zukunfterforschenden Aberglauben auf ganz verschiedene
Weise auseinanderzusetzen versuchten.
Luther beschrankte sich durchaus auf die Billigung des mystisch-
transzendentalen Kernes des naturwunderlichen kosmologischen Ereig-
nisses, das die Allmacht des christlichen Gottes souveran und unberechen-
bar als vorbedeutende Mahnung aussendet, wahrend Melanchthon die
antike Astrologie als intellektuelle SchutzmaBnahme gegen das kosmisch
bedingte irdische Fatum handhabte und von seinem Sternglauben so *
erfiillt war, daB er hier den sonst so gern vermiedenen Widerspruch seines
machtigeren Freundes andauernd herausforderte; denn selbst als ein
italienischer Astrologe - Lucas G auric us - personlich und sachlich
bis in das eigenste Gebiet des Reformators vorstieB, indem er willkiirlich
dessen Nativitat durch erfundene Geburtstagsdaten ,rektifizierte", fand
er hierbei Verstandnis und Riickhalt bei Melanchthon, Carion und anderen
sternkundigen Wittenberger Gelehrten, obwohl die zugrundeliegende
astrologische Politik sich ohne Zweifel gegen Luther wendete und dieser
sich auf das scharfste zur Wehr setzte gegen jenen zweiten, mythisch-
astrologischen Geburtstag: den 22. Oktober 1484.
Luther im Kampf mit italienischen und deutschen Nativitats-
politikern. - Melanchthons Stellung zu Lucas Gauricus.
Von Italien her, besonders von Padua, wo in dem Riesensaal des
Salone sich die Sterndeuter noch bis auf den heutigen Tag einen Kult-
platz fiir Sternfiirchtige erhalten haben, stromte durch das studierende
Deutschland immer von neuem astrologische Praktik und Lehre nach
Heidnisch-antike Weissagung in Woyt und Bild zu Luthef'S Z e i t e 1 ~
dem Norden. Und die Italiener kamen gelegentlich wohl selbst iiber die
Alpen. So wurde gerade 1531, im Jahre des Melanchthon-Briefes an
Carlon, der beriihmte siiditalienische Astrologe Lucas Gaur i c us vom
Kurfiirsten Joachim I. nach Berlin berufen
1
) und reiste von da a us nach
Wittenberg, wo er vier Tage verweilte und von Melanchthon, wie aus
dessen Brief en an Camera r ius hervorgeht, freudig begriiBt und verehrt
wurde. Das wird im April 1532 gewesen sein, denn im Mai fertigte Me-
Ianchthon bereits ein Empfehlungsschreiben fiir den abgereisten Gauricus
an Camerarius in Niirnberg aus.
2
) Schon Anfang Miirz hatte er der
,Norica" seines Freundes Camerarius
3
) (einer Schrift iiber die Bedeutung
der Wunderzeichen) einen Widmungsbrief an Lucas Gauricus mitgegeben,
in dem er ihm in ganz iiberschwenglicher Weise, als dem ,Fiirsten der
gesamten Philosophie", seine Verehrung bezeugt und sich dabei besonders
dafiir bedankt, daB er seinen Briefen Horoskope beigegeben habe, die
ihm, Melanchthon, fiir seine Studien unbedingt erforderlich gewesen
seien.
4
) Welche unmittelbare Bedeutung diese Horoskope fiir die Politik
batten, erkennt man aus einem Brief Melanchthons aus demselben Jahre
1532 vom 29. Juni
5
) an Camerarius, dem er auf seinen Wunsch die Nati-
vitiiten Kaiser Karls und Konig Ferdinands iibersendet. Dabei erfiihrt
man, daB er NativiHitensammlungen des Gauricus mit denen Carions
und de Scheppers zum Vergleich heranzog. Solche Sanunlungen haben
sich z. B. in Miinchen und Leipzig
6
) erhalten. Beide Sammlungen zeigen,
wenn man sie genauer durcharbeitet, wie Gauricus durch Horoskope,
die nur z. T. in der Ausgabe Venedig 1552 abgedruckt sind, den Grund-
stock lieferte. Das ist bedeutsam, da die Leipziger Handschrift, die Rein-
hold, Professor der Mathematik an der Universitat Wittenberg etwa 1540
bis 1550 anlegte, wie E. Kroker sehr einleuchtend im einzelnen nach-
gewiesen haF), mitten in den Kreis der Reformatoren hineinfiihrt, und
I) Hierzu vgl. Georg Schuster und Friedrich Wagner, Die Jugend und Erziehnng
der Knrfilrsten von Brandenburg und Konige von PreuBen, I (Monnm. Germ. Paedag. 34,
Berlin 1906), S. 496. Seine handschriftlichen Horoskope brandenbnrgischer Filrstlichkeiten
bewahrtdas prenBische Staatsarchiv. Nach LntherlieLJ Joachim Ganricus kommen, umihnals
Tenfelsbanner zu konsultieren. Vgl. Tischreden (Weim. Ausg.) III. S. 515 und Anm. ebda.
2) CR. II, 585 (2. Mai) nnd 587f. (18. Mai).
3) Eine Monographic Uber diesen flihrenden Geist nnter den iriihen deutschen
Philologen steht Ieider noch aus.
4) CR. II, 570 (Anfang Mi!.rz 1532): Extat enim carmen quoddam tuum, in quo
insunt vaticinia de futuris Europae motibus, quae ita comprobavit eventus, ut non solum
7tpoyv(l)anx.6v, sed etiam historiam harum rerum multo ante scripsisse viclearis ..... quod-
que literis aclcliclisti themata, quorum mihi cognitio pernecessaria est ...
5) Vgl. Beil. A. II.
6) Cod. Monac. lat. 27003 unci Leipzig, Stadtbibl. Cod. DCCCCXXXV.
7) Nativitl!.ten unci Konstellationen a us der Reformationszeit (in: Schriften des
Vereins fiir die Geschichte Leipzigs, 6. Bd., Igoo).
Ahb. 121. Schute des Lucas Cranach, Johann Carion.
Berlin, Preuf3. Staatsbibliothek (zu Seite 490 unci 532).
M. 0
J
"
'U'..,.
..
J "
0
IL- j. :;- .... , ..,_, "'v :._.., 0 d.( '1. _:... 'f
t- 0 ...,.., -J:.:.
l'.:.. ":l:J:' 1 .. J.., f ;IJA t-p .....
Tafel LXX
6 ......
"\J,.,.A .... .J.r:.
-1::. c-.t..
.2.,, .;(;...,.
1 . .'t..f". '.!.:.
Abb. 122. Nativitilt Lntlwrs \'Oil l:rasmus l{l'inhold, Leipzig, Stadthibliothek,
Cod. 935, Blatt 15/l (zu Scite 4'J'J und 502).
Tafel LXXI
TRACTATVS
Mardnus lulnrrus Monachus fane! I Augurtini.
!1 41
A N N 0
I 4 8 4
OCTOBR.IS
D.
10
p, M
M arrlnus fuir imprimis Monad us per mulros annos ,demum expoliauk
hablrum monialcm,duxirq: in vxorcm Abbariffam alrzllarurs Vittim-
brrgmfrm.& ab iii a fufct>pir duos iihtros. Hfc mira fatlftJ horrenda.J.
Planrtarii coilio fitb Scorpij afiwfmo in nona cadi ltationt qu3 Arabcs
rrligfoni iplitm facrilrgum hcrcrlcum,Chrillianr rtli*
J!ionis hoficm accrrimum, arq; prophanum. Ex horofcopi dircdionc ad
Marris coirum irreligiofifsimus obijt. Eius Anima fCfldlifsima ad Jnfc*
ros nauigauir; ab Aile do, Tcfiphonc,& Mcgera ftagclli& igntis cruciata
percnnitcr.
Ahb. I 23. :\'ativiti\t ! .uthcrs von Lucas Gauricus, Tractatus
Astrfllogicus, \'ened ig 1 55 2. Blatt hq "
(zit Sl'ite l'i'J und 51/).
L11ther-Nativitiit des Gauricus
499
zwar zu Luther selbst. Denn hier griindet sich die einzige Nativitat
Luthers, die Reinhold mitteilP) (vgl. Abb. 122), nicht auf denIO. November
1483, sondern auf jenen 22. Oktober 1484, wie Gauricus wollte. Der heid-
nisch-astrologische Geburtstag darf also, trotz vollen BewuBtseins seiner
nur vermutungsweisen Berechtigung - wie Reinholds Unterschrift
,Coniecturalis" beweist -, das kalendarisch-wirkliche Datum verdrangen *
und ersetzen.
In der Ausgabe der Gauricus-Nativitat von 1552 (Abb. 123) ist das
Horoskop Luthers noch dazu von einem maBlos-haBerfiillten gegenrefor-
matorischen Text begleitet.2) Und wenn wir auch anzunehmen haben,
daB Gauricus bei seinem Wittenbergischen Besuche diese Tonart der
spaten, fanatischen, kirchenpolitischen Stimmung - auch abgesehen
vom bosartigen Hinweis auf Luthers Sterben- nicht anwenden konnte,
so wird man doch nicht daran zweifeln, daB seine Astrologie Luther auch
zu jener Zeit als ein jedenfalls gefahrliches Element auffaBte. Denn 1525
hat er- worauf man bisher kaum geachtet hat- dem Papst Clemens VII.
den Untergang Luthers als Ketzer prophezeit
3
) und darum wendet sich
sicher die AuBerung Luthers vom 23. Marz 1524 in seiner Auskunft tiber
seine Nativitat an Spalatin schon gegen Gauricus
4
): Genesin istam meam
jam ante videram ex Italia hue missam, sed cum sic sint hoc anno hallu-
cinati astrologi (in bezug auf die gefiirchtete Siindflnt s. n.), nihil
mirum, si sit, qui et hoc nugari ausus sit. Und wahrscheinlich auch jene
andere in einem Brief Luthers an Veit Dietrich vom 27. Februar 1532
5
):
Sed ... astr ... quam ominoso Mathem(atico) quem toties falsum con- t
vici, convincam adhuc saepius falsum.
Diese Stellungnahme gegen Gauricus beruht auf der in Luthers
Religiositat tief begriindeten Ablehnung der gesamten Astrologie, die
ihn notwendig ganz besonders zu scharfem Widerspruch gegen seinen
Freund Melanchthon fiihren mu.Bte. Im August 1540 sagt er: ,Nemo
mihi persuadebit nee Paulus nee Angelus de coelo nedum Philippus, ut
r) Leipzig, Stadtbibl. Cod. DCCCCXXXV, Bl. 158. Vgl. E. Kroker, a. a. 0. S. 31.
2) Gauricus, Tractatus astrologicus, Venetiis 1552, B. 69v: ,Martinus fuit imprimis
Monachus per multos annos, demum expoliauit habitum monialem, duxitque in vxorem
Abbatissam altae staturae Vittimbergensem, et ab illa suscepit duos liberos. Haec mira
satisque horrenda. 5 Planetarum coitio sub Scorpij asterismo in nona coeli statione quam
Arabes religioni deputabant, effecit ipsum sacrilegum hereticum, Christianae religionis
hostem acerrimum, atque prophanum. Ex horoscopi directione ad Martis coitum irre-
ligiosissimus obijt. Eius Anima scelestissima ad Inferos nauigauit, ab Allecto, Tesiphone,
ct Megera flagellis igneis cruciata perenniter."
3) Vgl. Carlo Piancastelli, Pronostici ed almanacchi (Roma 1913), S. 43 Gauricus
an Papst Clemens VII: , Lutheri perfidiam pessumdabis."
4) Briefwechsel (Enders) IV. 309.
5) Briefwechsel (Enders) IX. 155. Die lftckenhafte Stelle ist etwa so zu ergll.nzen:
sed (non admodum mihi terrorem mouet ista coniunctio) astr(orum).
soo Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu L11thers Zeiten
credam astrologiae divinationibus, quae toties fallunt, ut nihil sit incer-
tius. Nam si etiam bis aut ter recte divinant, ea notant; si fallunt, ea
dissimulant."
1
) Im selben Jahre sagt er, daB Melanchthon ihm hatte zu-
geben miissen, daB es eine sichere Sterndeutekunst nicht gabe; deshalb
HiBt er ihn ruhig damit spielen. ,Es ist ein dreck mit irer kunst."
2
) -
Versuchte Magister Philippus .aber doch einmal, z. B. wenn ihm das
Reisen bei Neumond allzugefiihrlich schien, den Doktor Martinus astro-
logisch zu betreuen (1537), so gedenkt Luther noch spiiter iirgerlich eines
solchen Einmischungsversuches, der ,heilosen und schebichten astro-
logia" .
3
)
Wie wares unter diesen Umstanden moglich, daB sich die Freunde
Luthers iiberhaupt mit dieser iibergrifflichen Datumsverschiebung ab-
finden, geschweige denn fiir sie eintreten konnten?
Denn aus einer Mitteilung Luthers bei Heydenreich geht hervor,
daB selbst Melanchthon zur Partei der Geburtstags-Mythologiker ge-
horte, sie enthiillt aber auch zugleich den Grund, warum die astrologisch
GHi.ubigen mit gutem Gewissen so verfahren konnten. Heydenreich be-
richtet von einem Gespriich folgendermaBen'): ,Domine Doctor, multi
astrologi in vestra genitura consentiunt, constellationes vestrae nativi-
tatis ostendere, vos mutationem magnam allaturum." Tum Doctor:
'Nullus est certus de nativitatis tempore, clenn Philippus et ego sein der
sachen umb ein jar nicht eins. Pro secundo, putatis hanc causam et meum
negotium positum esse sub vestra arte incerta? 0 nein, es ist ein ander
ding I Das ist allein Gottes werck. Dazu solt ir mich niemer mer bereden I'
Hier sieht man, daB die Astrologie von einem Jahr, tiber das sich
Luther und Melanchthon uneins sind, die kirchlich-revolutionare Sen-
dung abhiingig machen wollte, was Luther aufs scharfste bestreitet.
Diese Differenz 'umb ein jar' aber gilt eben dem Jahre 1484, fiir das
Melanchthon- an Stelle von 1483- nach Gauricus' Vorgang eintritt.
Denn dieses war ein J ahr des groBen Zusammentreffens der Planeten,
von dem seit Generationen im voraus berechnet, eine neue Epoche in der
abendHi.ndischen religiosen Entwicklung eintreten sollte.5)
Die Reinholdsche Gestirnstellung aber steht, was bisher der For-
schung entgangen ist, in en!istem Zusammenhang mit astrologi..schen
KompromiBversuchen Melanclithons aus jener Periode, wo er, nach dem
Heydenreichschen Bericht, noch im Kampf mit Luther urn das Geburts-
1) Tischreden (Weimar) IV. 668.
2) Ebda. S. 613.
3) Luthers Tischreden i. d. Math. Sammlung, herausg. von E. Kroker (Leipzig 1903),
S. 177 Mathesius Nr. 292.
4) Ebda. S. 320. Heydenreich 1543, Nr. 625.
5) Nllheres dariiber im folgenden Abschnitt.
Tafel LXXII
Melanchthon iiber Luthers Nativitiit
501
jahr stand. Spater hat Melanchthon freilich in der Biographie und im
Dekanatsbuch der UniversWit Wittenberg das Jahr 1483 als das offizielle
Geburtsdatum Luthers festgelegtl), trotzdem sehen wir ihn noch im
Jahre 1539 in einem Briefe an Osiander im Schwanken. Er schreibt:
, Ober Luther s Geburtszeit sind wir im Zweifel. Der Tag ist zwar sicher,
auch beinahe die Stunde, Mitternacht, wie ich selbst aus dem Munde
seiner Mutter gehOrt habe. 1484 meine ich, war das J a hr. Aber wir
haben mehrere Horoskope gestellt. Gauricus billigte das Thema von
1484."
2
) Er hatte also die Mutter Luthers selbst befragt. Dadurch stand
der Tag fiir ihn fest, auch die Stunde- urn Mitternacht, wenn auch mit
der Einschrankung: beinahe-; er entscheidet sich a her damals noch fiir
das Jahr 1484, ganz unwiderleglich unter dem EinfluB des Gauricus.
Das Bruchstiick der Abschrift eines bisher unbekannten Briefes
Melanchthons an Schoner in jener Miinchner Handschrift (Cod. lat.
27003, vgl. Abb. 124)
3
)-der Brief wird wahl ungefiihr in die Zeit des Be-
suches von Gauricus in Wittenberg zu datieren sein - zeigt Melanchthon
nur noch viel deutlicher zu einschneidendem astrologischen Eingriff in
der Geburtstagsfrage geneigt, und zwar unter dem EinfluB Carions. Die
Briefstelle lautet: Philippus ad Schonerum Genesim Lutheri quam Philo
4
)
inquisiuit transtulit Carion in horam 9 Mater enim dicit Lutherum
natum esse ante dimidium noctis (sed puto earn fefelli {i)). Ego aHeram
figuram praefero et praefert ipse Carion. Etsi quoque haec est mirrifica
(/)est propter locum 0+ (Martis) eta- (coniunctionem) in domos (/)5
quae habet coniunctionem magnam cum ascendente Caeterum quacunque
hora natus est hac (/) mira o- (coniunctio) in nt (scorpione) non potuit
non efficere uirum acerrimum. DaB Carion bei Auspragung dieser ver-
mittelnden, aber im Grunde heidnisch-italienischen Willkiir die Ver-
mittlerrolle spielte, stimmt damit iiberein, daB er urspriinglich Luther
gegeniiber eine abweisend-nichtglaubige Stellung eingenommen hat.
Luther selbst bezeugt ja, daB er ihm einmal friiher, als er noch sein Feind
war, Tag und Stunde seiner Verbrennung als Ketzer prophezeite.
6
)
Carion dachte also iiber Luther zu einer friiheren Zeit im Sinne des Gau-
ricus. Wie der Brief zeigt, war Carion der Hauptgewahrsmann Melan-
chthons fiir die Geburtstagsverschiebung und Carion stiitzte sich dabei
r) Dariiber vgl. J. K. F. Knaake, Stoffsichtung z. krit. Behandlung des Lebens
Luthers. r. Luthers Geburtsjahr (Ztschr. f. d. ges. luth. Theol. und Kirche XXXIII,
(1872), s. g6 ff.).
2) CR. IV, 1053.
3) Fol. r6.
4) Philo ist der Arzt Joh. Pfeyl (1496-1541) - ein Nachweis, den ich der steten
Hilfsbereitschaft Prof. Flemmings verdanke.
5) Tischreden (Weimar) II, 445, Anfang Januar 1532.
502 Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
seinerseits wiederum auf den Arzt Johann PfeyP), der lange in Italien
war- beide in deutlichstem AnschluB an Lucas Gauricus.
Carlon und Pfeyl schlagen Abweichungen nur in bezug auf die Geburts-
stunde vor- Carion ist fur 9 Uhr, Pfeyl fur 3 Uhr 22 entgegen Gaurlcus,
der I Uhr IO vorschlagt -, lassen aber im Horoskop den 22. Oktober
1484 als Tagesdatum bestehen.
Philo behalt noch die Planeten-Konjunktion des Gauricus im wesent-
lichen bei (im neunten Haus), Carlon kommt dagegen durch seine Ver-
schiebung auf die neunte Stunde zu wesentlich einschneidenderer Ande-
rung. Die fatale Planeten-Konjunktion kommt aus dem neunten Haus
in das funfte, und der Mars ist nicht mehr im ersten Haus, sondern im
zehnten. So wurde Luthers Geburt das Odium der damonischen Sendung
genommen, ohne dem Hinweis auf seine Eigenschaft als religioser Um-
gestalter etwas an Nachdruck zu nehmen.
Melanchthon billigte also Carlons Nativitatsstellung, so daB wir
anzunehmen haben, daB er eine Zeitlang geneigt war, auch dieses zweite
hypothetische, astrologische Geburts- Tages-Datum durchaus in ernst-
hafte Erwagung zu ziehen.
Stand Melanchthon dieser Geburtstagsverschiebung schlieBlich, wohl
wegen Luthers Gegnerschaft, ablehnend gegenuber, so offenbart uns die
Stellungnahme Reinholds, des offizie!!en Wittenberger Mathematikers,
die ganze Starke einer noch andauernden Parteinahme fiir jenes falsche
Gaurlcusdatum im Horoskop des Carlon, das, wie ein genauer Vergleich
mit der Munchener Handschrift ergibt- washier nur angedeutet werden
kann -, Reinhold einfach bis ins Kleinste in der Redaktion von Carion
und Pfeyl ubernahm (Abb. 127).
2
) Das Wesentliche dieser verbesserten
Willkur, das wir oben bei Carlon schon angedeutet haben, geht nun aus
den Zusatzen bei Reinhold am deutlichsten hervor: Er weiB zwar, wie
die Unterschrift ,Coniecturalis" beweist, daB dieses Horoskop nur ver-
mutungsweise besteht, aber er fiihrt es ein, weil darln die groBe Planeten-
Konjunktion, an die er glaubt, fiir Luther giinstiger erscheint als bei
Gauricus. Jupiter und Saturn stehen so im Skorpion zusammen, daB sie
,heroische Manner hervorbringen" und der abgesonderte Mars ruft un-
schii.dlich im gunstigen elften Haus der Zwillinge die Beredsarnkeit
hervor.
3
)
Der augenscheinlichste Beweis fiir die nachdriickliche, selbstver-
1) Vgl. Pfeyls Nativitll.t Luthers im Monac. lat. 27003 fol. 17, die bis auf die Stunde
(3 Uhr 22 statt I Uhr zo) mit der des Gauricus identisch ist.
2) Bl. 158 der Leipziger Handschrift.
3) :4 (Jupiter) et b (Saturnus) facit heroicos Viros. et bonum e s t ~ . (Martem) non
esse coniunctum. ~ . (Mars) in):( (geminis). Jnde est ilia Eloquentia.
Freundliche und jeindliche Auslegung der Luther-Nativitiit
503
sUindliche Lebenskraft dieses urspriinglich italienischen Horoskopes ist,
daB noch Garcaeus
1
), der endlich den richtigen Geburtstag Luthers
bringt, den 10. November 1483, doch als Gestirnstellungs-Thema einfach
das von Reinhold-Carion umstilisierte Gauricus-Horoskop beibehalt.
2
)
Dafiir, daB von der Gauricus-Nativitat zur Zeit seines Wittenberger
Besuches und spater eine mildere Redaktion in Umlauf war, entweder
von Gauricus selbst oder - was wahrscheinlicher ist - in der hier nach-
gewiesenen reformierten Fassung von Carion-Reinhold, spricht auch der
Text der Luther-Nativitat des italienischen Astrologen Cardanus, der
das auf Gauricus zuriickgehende Datum in bezug auf das Jahr- 1483 *
anstatt 1484 - abandert und in dem Text zum Horoskop, das nun er
Luther stellt, ausdriicklich den Mangel an auBerster gegenreformatorischer
Schade in der gelaufigen Nativitat des Jahres 1484 feststellt.
3
) Deshalb
verteilt er die Planeten-Konjunktion aus dem Hause des Skorpions auf
andere Hauser, unter anderem das der religionbeherrschenden Jungfrau.
Jedenfalls ist also anzunehmen, daB der haBerfiillte Text des Gauricus
in der Ausgabe von 1552 eine spatere, unter dem Druck der Gegenrefor-
mation erfolgte Redaktion ist.
Auch diese kirchenpolitisch so feindselige Nativitat des Cardanus
war Luther personlich bekannt, er verurteilte sie natiirlich unbedingt.
1543 legt ihm ein Tischgenosse seine Nativitat, zugleich mit der Ciceros
und anderer zu Niirnberg gedruckt (vgl. Bell. B III. 3; es muB die von
Cardanus) gewesen sein) vor: ,lch halte nichts davon, eigene ihnen gar
nichts zu, aber gerne wollt ich, daB sie mir diess Argument solvireten:
Esau und Jacob sind von einem Vater und einer Mutter, auf eine Zeit,
und unter gleichem Gestirn geborn, und doch gar widerwartiger Natur,
Art und Sinn. Summa, was von Gott geschicht, und sein Werk ist, das
r) Johannis Garcaei Astrologiae methodus, (Basileae I5i4).
2) Wissenschaftlich erledigt wurde von protestantischer Seite bei der ersten Centenar-
feier r6r7 die Angelegenheit durch eine gelehrte Abhandlung des IFaac Malleolus, Professors
in Stra!lburg, der unter Benutzung des ganzen Apparats astrologischer Gelehrsamkeit
mit dem falschen italienischen Datum aufraumte. Seine Abhandlung wurde wieder ab-
gedruckt in der 200 jahrigen J ubilaumsschrift von Ern. Sal. Cyprian, Hilaria Evangelica
(Gotha 1719) p. 932-936. (So lebhaft war der Streit damals noch .,aktuell"; vgl. auch *
Bayle, Diet. crit., Art . .,Luther".) tiber die ganze Frage unterrichtet immer noch sehr
gut J. K. F. Knaake a. a. 0. - Eine Synopsis der Luther-Nativitaten hatte der Verf.
vorbereitet.
3) Liber de exemplis geniturarum (in: Hieronymi Cardani medici Mediolanensis
libelli dvo. Vnus, de Supplemento Almanach. Alter, de Restitutione temporum & motuum
coelestium. Item Geniturae LXVII. insignes casibus & fortuna, cum expositione. Norim-
bergae 1543). Der Begleittext zur Nativitll.t ist in Beil. B. III. 3 abgedruckt.
4) Die Luther vorgelegte Nativitat kann deshalb nur aus jenem Werk des Cardanus
von den 67 Geniturae gewesen sein, da dieses im Gesprachsjahr 1543 in Nurnberg erschien
und gerade neben der Nativitat Ciceros (fol. N III V) diejenige Luthers (fol. N IVr)
abdruckt.
504
Heidnisch-antike Weissagung in Wot't und Bild zu Luthet'S Zeiten
soil man dem Gestirn nicht zuschreiben. Ah, der Himmel fraget nach dem
nicht, wie auch unser Herr Gott nach dem Himmel nicht fraget. Die
rechte christliche Religion confutirt und wider1egt solche Mahrlin und
Fabelwerk allzumal."
Wir stehen also vor der Tatsache, daB italienische Astrologen, Gau-
ricus und Cardanus, das Geburtstagsdatum willkiirlich verandern, urn
damit mehr oder weniger feindselige Politik zu betreiben; daB also bei
Lebzeiten Luthers zwei Geburtsdaten nebeneinander herliefen und es
fiir Luthers Biographen gleichsam zwei kalendarische ,Wahrheiten" -
eine historische und eine mythische - gab und ebenso zwei Arten von
Geburtstagsschirmherrn: einen deutsch-christlichen Heiligen, den hl. Mar-
* tin, und ein Paar heidnischer Planetendamonen, Saturn und Jupiter.
1
)
*
Und fast noch merkwiirdiger ist die Tatsache, daB sogar Melanchthon
und seine Freunde sich fiir diese Datumverschiebung auf das Konstella-
tionsjahr 1484, gegen das sich Luther selbst mit solcher Entschiedenheit
wendet, eingesetzt haben.
Das Phanomen dieses zahen Festhaltens heidnisch-astrologischer
Praktik im nachsten Umkreis der Freunde des sterndeuterfeindlichen
Reformators verliert etwas an Unbegreiflichkeit, wenn man- auf den
hier gefiihrten Nachweis der Carion-Reinhold-Nativitat als reformie-
renden astrologischen Vermittlungsversuches gestiitzt- auch
alle jene ahnlichen Bemiihungen der Luther befreundeten Gelehrten als
personliche, sehr ernsthafte Bestrebungen ansieht, die durch die Italiener
feindselig stilisierte, nach Wittenberg getragene Geburtskonstellation da-
durch zu entkraften, daB man durch willkiirliche Geburtszeitenverschie-
bung eine Milderung des kosmologischen Dekretes, das ja auch jenen
deutschen Astrologen durch cine grol3e Planeten-Konjunktion verhangt
erschien, zu erzielen trachtete. Als Wahrzeichen des unbestreitbaren
Vberlebens und Eingreifens paganer Kultur bleibt dabei urn so unwider-
leglicher bestehen, daB diese Wittenberger Astrologen- vollig in dem
spatmittelalterlichen Sternglauben cines Gauricus wurzelnd - durch
solche Zeitenverschiebung mehr oder weniger radikaler Art einen Willkiir-
akt begehen, bei dem sie die objektive Feststellungspflicht historischer
Forschung der mythologisierenden Verursachung als relatives Element
I) Krankheit verhinderte den Verfasser, diese Januskopfigkeit historischen Empfin-
dens als erstaunliche Selbstverstlindlichkeit tragischer Polaritll.t in der Entwicklung des
modernen Homo non-sapiens& darzustellen; Luthers korrigierter Geburtstag zeigt
uns nur einen unwiderleglich sprechenden Fall: den Durchbruch urtfimlichen totemisti-
schen Verknfipfungszwanges (in der Form heidnischen Geburtstagskultes) bei den Fil.hrern
im Ringen urn den Denkraum klaren historischen BewuBtseins, noch dazu zur selben Zeit
und am selben Ort, wo gerade der Entscheidungskampf urn das freie deutsche Denk-
Gewissen entfacht war und loderte.
M ythologisicrende Geschichtsaujjassung
sos
unterordnen miissen. Die kosmologisch bedingte, echt hellenistische,
spatmittelalterliche Geschichtsauffassung war eben in ihrer Epochenlehre
so entscheidend an das Auftreten von gewissen Planeten-Konjunktionen
in bestimmten Zeitraumen gekniipftl), daB ein neuer Prophet erst durch
das Zusammentreffen von oberen Planeten, vor allem von Saturn und
Jupiter, seine kosmologische Weihe erhielt: wie plastisch-glaubig solche
Saturnkindschaft gefiihlt war, wie aber Luther sich diesen Saturn auch
nicht als patronisierende Einzelgottheit aufdrangen lieB, zeigt eine
AuBerung zwischen dem 26. und 31. Mai 1532, also gerade aus jenen
Tagen, die sich an die Gegenwart des Gauricus in Wittenberg anschlossen.
Luther sagt: ,Ego Martin us Luther sum infelicissimis astris natus,
fortassis sub Saturno. Was man mir thun vnd machen soil, kan nimermehr
fertig werden; schneider, schuster, buchpinder, mein weib verzihen mich
auffs lengste."
2
) A us diesem Spott tiber saturninische Einfliisse durch
seine Geburtskonstellation erfahrt man, wie Luther sich damals auch
im guten Humor gegen jenen Versuch zu wehren hatte, den er so grund-
satzlich und leidenschaftlich zuriickwies, ihn zu einem Planetenkinde
zu machen. Um zu verstehen, was ein Widerspruch gegen den damaligen
Planetenglauben und besonders gegen die Saturnfiirchtigkeit be-
deutet, muB man, von Bildern unterstiitzt, sich zunachst zu vergegen-
wartigen suchen, worauf die Machtstellung der Planetengotter im System
der spatmittelalterlichen Weltvorstellung beruhte, die bis zu jener Lehre
fiihrte, die - noch im Zeitalter der Reformation __:__ dem historischen
Gewissen und Wahrheitssinn durch das ,Als ob" der astrologischen Fik-
tion eine doppelte Wahrheit chronologischer Feststellung entgegensetzen
durfte.
Die Lehre von den Planeten-Konjunktionen als Kernstiick
astrologischer Weissagung im Spiegel der illustrativen deut-
schen Kunst.- Saturnfiirchtigkeit in Wort 11nd Bild.- Aus-
blick auf Italien.
In der Astrologie haben sich in unwiderleglicher Tatsachlichkeit
zwei ganz heterogene Geistesmachte, die logischerweise einander nur
befehden miiBten, zu einer ,Methode" zusammengetan (vgl. Abb. 129}:
Mathematik, das feinste Werkzeug abstrahierender Denkkraft, mit
Damonenfurch t, der primitivsten Form religioser Verursachung. Wah-
rend der Astrologe das Weltall einerseits im niichternen Liniensystem
klar und harmonisch erfaJ3t und die Stellungen der Fixsterne und Planeten
I) S. U. S. 508ff.
2) Tischreden III (Weimar 1914), S. 193.
so6
Heidnisch-antike Weissagung in WoYt und Bild zu Luthers Zeiten
zur Erde und zueinander genau und im voraus zu berechnen versteht,
beseelt ihn vor seinen mathematischen Tafeln doch eine atavistische
abergliiubische Scheu vor diesen Sternnamen, mit denen er zwar wie mit
Zahlzeichen umgeht, und die doch eigentlich Di.imonen sind, die er zu
ftirchten hat.
Man muB versuchen, sich durch einige Abbildungen jene mathe-
matisch-linearen und mythisch-bildhaften Elemente der Weltanschauung
im Kopfe eines mittelalterlichen Astrologen klar zu machen: Nach wel-
cher Verfassung regieren sie die Welt und wie sehen sie aus? Planeten
k6nnen einzeln oder zusammen regieren; als Einzelbeherrscher be-
schtitzen sie nach einem von den antiken Sterndeutern wohl ausgeklti-
gelten Teilungsprinzip wechselweise die einzelnen Monate mit den in
diesen erscheinenden Tierkreiszeichen. Aile diese Planeten, bis auf Sonne
und Mond, erhalten die Schirmherrschaft tiber zwei Monate; der Saturn
z. B. den Dezember mit dem Steinbock und den Januar mit dem Wasser-
mann - und den Saturn wollen wir uns bei dieser Wanderung durch
das Labyrinth der astrischen Di.imonen zum Leitstern wi.ihlen, weil eben
die Saturnftirchtigkeit auch im Reformationszeitalter im Mittelpunkte
des Sternglaubens steht. Jeder Planet beherrscht weiterhin, tabellarisch
wohl verzeichnet, bestimmte Tage und Stunden- und die Woche und
ihre Tage tragen ja heute noch das antike Sk!avenhalsband: Saterdag,
Saturday - untersteht, wie der Name zeigt, dem Einflusse des Sa-
turn. -Von diesem nicht mathematischen, dem mythisch-bildlichen
Wesen der Planeten, wie sie die Astrologen anfochten, geben uns nun
die mittelalterlichen illustrierten Planetenkalender ein deutliches Bild.
Unser zu frtih verstorbener Freund Hauber
1
) hat in seinem Buch
tiber Planetenkinderbilder vortrefflich dargestellt, wie sich in Wort und
Bild im Mittelalter die alte antike Kalenderillustration erhiclt und cnt-
wickelte. Eine Seite (Abb. 125) aus einer deutschen Ttibinger Handschrift
zeigt den Saturn als Monatsbeherrscher; der griechische Zeitgott und der
romische Saatendiimon haben sich hier zu einem Bauernunhold ver-
dichtet, der mit Karst, Schaufel und Sichel hantiert; seine irdischen
Schtitzlinge mtissen, seiner erdigen Natur entsprechend, aile mtihselige
Arbeit verrichten, die mit der Erde zusammenhi.ingt: pfliigen, hacken,
graben und das Brotkorn verarbeiten. Diese schwabische, etwas ruppige
Bauernfamilie scheint zunachst weder mit klassischem noch mit damoni-
schem Altertum etwas zu tun zu haben. Indessen ist die Sternherrscher-
1) A. Hauber (t g. Juni 1917), Planetenkindcrbilder und Sternbilder. Zur Geschichtc
des menschlichen Glaubens und Irrens. (Studien zur dcutschen Kunstgcschichtc 194,
StraBburg 1916.) Vgl. dazu Fritz Sax!, Probleme der Planetenkinderbilder, in: Kunst-
chronik LIV., 1919 (N. F. XXX), S. IOIJ-Io2r.
Abb. rzs. Saturnkinder, Ttibingen, Cod. i\1. d. 2,
fol. 2bC> v (zu Seite so0 f.).
Tafc>l LXXI I I
Tafel LXXIV
Abb. 126.
Chronograph von 35-t. Dezember,
SaturnalienspidPr (zu S<'ite 507).
:\bh. I .!X.
Saturn aus d<'n Tarocchi.
olwritali('nischer Kupkrstich,
Serie E (zu Slite 4-"5 und 507).
e'Oivfolv""b' "nrtint
I'Jrtrfc'f.-n'fl<(cf' od mrint
:lllfo (ynt mint Pynt
i)r lmtc<IIIY SfbRrm (ynr.
!1'64turm111b1n pcP4utul bd'mtl
.l'l'nc nallll' y& fohmyr M<d1<itt101Womt
Abb. I 27. Saturn
aus: Nyge 1\.alender, Liibeck 1519
(zu Seite 41\5 unci 507).
XI IX
... r --- . . ......
Yl
Ul
A hh. I 2<). Astrolog.
1\osmos und l'\ativitii.tssdwma,
nach: Ad. llnchsler, :\strolog.
I lns<kn 1<"55
(zu Sl'itc 505 f. und soX).
Planeten und Planetenkinder
qualitiit des Saturn doch echt antik schon dadurch angegeben, daB er
sich zwischen seinen heiden Tierkreiszeichen, dem Steinbock und dem
Wassermann, befindet. Den Steinbock erblicken wir deutlich rechts; der
Wassermann verbirgt allerdings sein allegorisches Wesen etwas unter
praktischer Hilfeleistung: er gieBt dem Backer das notige Wasser in
seinen Zuber. In der linken Hand halt er aber drei Wiirfel: es ist iiber-
raschenderweise, ganz wie es das altromische Saturnalienfest verlangt,
der Wiirfelspieler der Saturnalienfeier, wenn auch in etwas epigonaler
Entartung. Das wird dadurch bewiesen, daB uns ein echter Saturnalien-
spieler zufillig in dem antiken Kalender von 354 (Abb. rz6) als Symbol *
des Dezember erhalten ist; er steht vor dem Tisch mit den Wiirfeln. Mit
dieser Einzelheit laBt sich an einem anschaulichen Beispiel dartun, mit
welcher Bestandigkeit der antiken Uberlieferung wir auch im bildlich
anscheinend so ,naiven" mittelalterlichen Volkskalender zu rechnen haben.
In einem Kalender, den der Hamburger Arndes ZU Lubeck rsrg,
also in der Zeit von Luthers erstem Wirken, druckte, hat der Saturn
(Abb. r27) schon ein etwas echteres Aussehen. Er halt die Zeitdrachen-
schlange im Arm in Erinnerung seiner Eigenschaft als griechischer
Chronos, und ist damit beschaftigt, wie es die Sage von dem Urvater der
Heidengotter verlangt, sein Kind zu verschlingen. Der plattdeutsche
Vers darunter faBt zusammen, welch unfreudiges Leben und widerwar-
tiges Temperament die Dezember- und Januarkinder zu erwarten haben.
Seine antikischeren Manieren verdankt dieser Saturn iibrigens
Italien: ein oberitalienischer Kupferstich (Abb. rz8) war das Vorbild, das
(tiber Burgkmair in Augsburg) nicht nur diesen niederdeutschen Ka-
lender, sondern auch die monumentalere Kunst der deutschen Renais-
sance weitgehend beeinfluBte. So finden wir diese italienischen Planeten-
damonen etwa I529 lebensgroB an den Wanden der Rathaushalle in
Liineburg, rsz6 am Brusttuch-Haus in Goslar, in Hildesheim, in Braun-
schweig, am Junkerhause in Gottingen.
1
) Das allzu deutsche oder allzu
italienische Auftreten dar uns eben nicht dariiber hinwegtauschen, daB
die wesentlichen Ziige des unheimlichen alten Damons im Bilde lebendig
fortdauern, und daB sie dadurch verstarkt worden waren, daB sein Name
auf jenen Planeten iibertragen worden war, der durch seine groBte Erd-
ferne, das matte Licht und die langsame Bewegung den Menschen am
ratselhaftesten erschien. Von diesem Stern erhielt er riickwirkend noch
einen Zusatz von schwerer Tragheit; die christliche Todsiinde der Acedia
verkniipft sich deshalb mit ihm. Hamlet ist auch Saturnkind.
2
) Zu Luthers
1) Vgl. Jahresbericht der Gescllschaft der Biichcrfreunde zu Hamburg (1908 bis
1909), S. 48 [unsere S. 486].
2) Vgl. Rochus von Liliencron, Die siebente Todsiinde (1903), S. 158.
Warburg, Gesammelte Schriften Bd. 2 33
508 Heidnisch-anlike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
spottischer Bemerkung vom Jahre 1532 erhalten wir so den bildlichen
* Hintergrund ,volkstiimlich" gewordener hellenistischer Anttke.
Hatten die Planeten schon in regelmaBiger, gemeinschaftlicher
Jahresregentschaft, aber gleichsam mit wechselndem Prasidium einen
starken EinfluB, so wurden sie geradezu zu ,aktuellen" Weltbeherrschern
und Augenblicksgottern, wenn sie als gleichzeitig und zusammenwirkend
beobachtet oder verrechnet wurden, d. h. wenn sie in Konjunktion
standen. Nur in graBen Zeitumlaufen, die man Revolutionen nannte,
waren solche Konjunktionen zu erwarten. Man unterschied in sorgfa.Itig
ausgekliigeltem System groBe und groBte Konjunktionen; die letzteren
waren durch das Zusammentreffen der oberen Planeten Saturn, Jupiter
und Mars die gefahrlichsten, ereigneten sich aber auch nur in langen
Zwischenraumen. J e mehr Planetenkonj unktionen dann zusammentrafen,
desto erschrecklicher war es, wenn auch der Planet vom besseren Charak-
ter den schlechteren giinstig beeinflussen konnte. Diese segensreiche Ein-
wirkung fiel z. B. dem Jupiter, den man sich ungefahr wie einen giitigen
gelehrten geistlichen Herrn dachte, dem Saturn gegeniiber zu. Entschei-
dend fiir die Wirkung der Konjunktion war ferner der Himmelsort. Man
zerschnitt die gauze Himmelskugel mathematisch in 12 Abteilungen, die
man als Hauser bezeichnete. Diesen 12 Bezirken entspricht auf dem
iiblichen Nativitatssc.hema je ein Dreieck
1
) (vgl. Abb. 129).
Diese Ha userwurden, wie man auf einem N ativiUitskalender des Leon-
hard Reymann (Abb. 130) von 1515
2
) am deutlichsten sieht, aufgeteilt
unter die verschiedenen Bezirke des Menschenschicksals: das erste Haus
gehOrte z. B. dem Leben, das zweite dem Geschaft, das dritte den Brii-
dern, die folgenden den Eltern, den Kindem, der Gesundheit, dem Ehe-
stand, dem Tod, der Religion, der Regierung, der WohWitigkeit, dem
Gefangnis.
3
) Die Aufteilung des Weltalls unter die Sternenhierarchie ist
zugleich veranschaulicht.
*
*
In der deutschen Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft (VIII. 1892)
hat Friedrich von Bezold in einem Aufsatz iiber ,Astrologische
Geschichtskonstruktion im Mittelalter" ') uns in mustergiiltiger Wissen-
1) Wer sich fiber Grundbegriff und Wesen der Astrologie genau unterrichten will,
dem kommt das BUchlein von F. Boll, Sterngtaube und Sterndeutung (Aus Natur und
Geisteswelt, Nr. 638, 2. Aufl. 1919) meisterhaft zu Hilfe (3. u. 4 Aufi. besorgt von Gundel,
Leipzig 1926 und 1930].
2) Reymann, Leonh., Natiuitet-Kalender, Nnrnberg, Friedr. Peypus (1515).
3) Vita lucrum fratres genitor nati valetudo
Uxor mors pietas regnum benefactaque career.
4) Jetzt wieder abgedruckt in: Aus Mittelalter und Renaissance. Kulturgeschicht-
liche Studien von Friedrich von Bezold (Mftnchen 1918) S. 165 ff.
Tafel LXXV
Abb. 130. Titelholzschnitt von
Erhard Schein, zn Leonhard
Reymanns NativiUH-Kalendcr,
Niirnberg (zn Stitl 5oR).
Abb. 131. Titd zu Leonhard l'ractica fiir 1524,
Stuttgart, L. B., !Is. :\lath. <.). 3 (zu Sl'itc so<J).
Tafel LXXVI
unll tr-
flcrh bee groff(n wefferung ;2luc{> anberee
wiircf!ungett.So fi'b 6cgc6en n4d)(CI):ifli lielim l}nn
gctJurt/
tl34giftrii Jol}anem ([:arion
fiirfllicber gnaben S3U l,;:anbenlfurg 2l(trono
arieit13Ufame
QJanJJ er6ermlicl) 13ulefht1in \?ii
l\1"mnng aller G:l)dffgl4uLJi-.
sen
Ahl>. lj.!. Titd z11 Johalln Carion, l'rognosticatio, Leipzig 1521
(zu Slitl' 510).
Sundflutpanik von I524 509
schaftlichkeit belehrt, wie ernsthaft und durch die christliche Kirche
unterstiitzt, der Glaube an die Wirksamkeit solcher Planetenkonstellation
die internationale europaische Geschichtsauffassung im Mittelalter be-
stimmte. Schon vorher hatte Joh. Friedrich in einer Schrift ,Astrologie
und Reformation"
1
) zum erstenmal den schwierigen aber hochst dan-
kenswerten Versuch gemacht, sich durch die unendlich weit verstreute
und schwerverstandliche lateinische und deutsche Wahrsagungsliteratur
durchzuarbeiten, in der er geradezu die Ursachen der sozialen und kirch-
lichen Unruhen zu finden glaubte, die zur Reformation und zum Bauern-
krieg fiihrten. Erganzt werden diese Studien neuerdings in willkommener
Weise durch G. Hellmann, der uns in seinem Aufsatz ,Aus der Bliitezeit
der Astrometeorologie"
2
) einen scharfen und genauen Einblick in jene
Massenliteratur schenkt, die die Siindflutpanik von 1524 hervorrief. *
Sie wurzelte eben in krasser Planetenfiirchtigkeit, denn man glaubte
schon Jahre vorher, daB 20 Konjunktionen, davon r6 im wasserigen
Zeichen der Fische, im Februar 1524 eine Weltiiberschwemmungskata-
strophe bewirken miiBten. Die gelehrtesten astrologischen Naturwissen-
schaftler der Zeit stimmten mit pathetischer GewiBheit zu oder wider-
sprachen ebenso nachdrucksvoll, urn im Auftrage der hochsten weltlichen
und geistlichen Obrigkeiten die aufgeregte Menschheit zu besanftigen.
indem sie offiziose Beruhigungsschriften erlieBen.
Derselbe Reymann, der den NativWitskalender von rsrs verfaBte,
gehort zu den Weherufern auf das Jahr 1524.
3
) Die Illustration zu seiner
Practica {Abb. r3r) zeigt einen Riesenfisch mit einem bestirnten Bauch
(das sind die in Konjunktion befindlichen Planeten) und aus diesem
Bauch stromt der vernichtende Orkan hernieder auf eine durch Bau-
werke angedeutete Stadt. Unter dem Eindruck des elementaren Ereig-
nisses haben sich rechts der Kaiser und der Papst versammelt; von links
kommen die Bauern, Hans mit der Karst, gefiihrt von einem Fahnen-
trager mit Stelzbein und Sense: der alte Saatengott war wie geschaffen *
zum Sinnbild seiner aufriihrerischen Kinder.
1) Johann Friedrich, Astrologie und Reformation Oder Die Astrologen als Prediger
der Ref. und Urheber des Bauernkrieges (Milnchen 1864).
2) In seinen ,.Beitragen zur Geschichte der Meteorologic", Nr. 1-5 (VerC>ffentl. d.
Kgl. Preul3. Meteorol. Instituts, Nr. 273), (Berlin 1914). Nach einem kurzen, aber aus-
gezeichneten Dberblick Uber die griechisch-arabische Herkunft der planetarischen Ge-
schichtsphilosophie gibt er ein Verzeichnis der ihm bekannt gewordenen Unmenge von
illustrierten Druckschriften (56 Autoren in 133 Druckschriften), die schon seit dem An-
fange des 16. Jahrhunderts, von Stoefflers Kalender ausgehend, Grauen und Furcht vor
dieser Slindflut durch ganz Europa trugen.
3) Vgl. Georg Stuhlfauth, Neues zum Werke des Pseudo-Beham (Erhard SchC>n ?),
Amtl. Berichte aus den preull. Kunstsammlungen, 40. Jg., Nr. II (Aug. 1919), Sp. 251 bis
z6o, Abb. 131.
33*
sro Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
Zur offiziellen Beschwichtigungsliteratur dagegen gehOrt die dem
Erzherzog Ferdinand gewidmete Widerlegung des kaiser lichen Astrologen
Georg Tannstetter.
1
) Die sieben Planeten, die aus der Regenwolke
wie aus einer Theaterloge auf die Bauern unten herabsehen, werden
durch die gottliche Hand, die oben aus den Wolken kommt, im Zaume
gehalten (Abb. 133).
Auch unser Johann Carion, der Hofmathematikus der Branden-
burger, trat schon I52I in seiner ,Prognosticatio vnd erklerung der
groBen wesserung", obwohl er allerhand Unheil zu prophezeien hatte,
doch als Beruhiger auf.2) Auf dem Titelblatt der ersten Ausgabe dieser
Schrifts), die zu den Schatzen der Berliner Bibliothek gehort, befindet
sich ein Holzschnitt, der drei getrennte Darstellungen zeigt (Abb. 132):
links sehen wir das drohende Unwetter, rechts einen Kometen, der eine
Stadt bescheint mit der Jahreszahl rszr, darunter fiinf Figuren in Zeit-
tracht in anscheinend kriegerischem Konflikt, ein in die Knie gesunkener
Papst wird von einem Ritter mit geziicktem Schwert bedroht, dem sich
ein anderer barhauptiger Mann mit erhobenem Schwert zugesellt; ein
Kardinal erhebt wehklagend die Arme, der Kaiser mit Zepter und Krone
bedeckt bestiirzt das Gesicht mit der Hand. Ohne den Text im Buche
wiirde man etwa denken, daB hier bereits die Pliinderung Roms durch
die deutschen Landsknechte dargestellt sei; sieht man aber genauer zu,
so entdeckt man neben dem Kaiser das Planetenzeichen fiir die Sonne,
auf dem Mantel des Papstes das Jupiterzeichen und hinter dem Ritter
das Symbol des Mars. Tatsachlich sind diese Figuren, wie aus dem im
Text abgedruckten allegorischen Gedicht: ,Reymen der Planeten" un-
widerleglich hervorgeht, Illustrationen der Planetenkonstellation, unter
der I52I jener Komet erschien. Dabei werden - hierin liegt augenfallig
beweisende Deutlichkeit- die Planetenfiguren in bezug auf die politische
Weissagung tatsachlich mit den Typen der gleichzeitigen politischen und
einander bekampfenden Miichte identifiziert: Sol ist der Kaiser, Jupiter
* der Papst, Mars der Ritterstand und in dem Mann mit dem Schwert
haben wir einen miBverstandenen Saturn, den Bauem, zu erkennen.
Carion gibt uns in dieser Schrift auch eine pressegeschichtlich hOchst
bemerkenswerte Notiz: er wendet sich gegen die illustrierte Sensations-
presse, wie sie auf dem Reichstage zu Worms durch die Siindflut-Stim-
1) Libellus consolatorius (Wien 1523). Vgl. Hellmann a. a. 0. S. 55 f.
2) ,.wirt es (Regen und Wasser) doch Iangsam sich begeben". Wie sich das mit der
Notiz bei Haftiz und Gronau (vgl. Hellmann a. a. 0. S. 20) zusammenreimt, daB er im
* Juli 1525 den Kurfiirsten Joachim zur Flucht auf den Tempelhofer Berg veranlal3te, ist
mir noch unklar.
3) Leipzig (Wolfgang Stoeckel?) Diese erste Ausgabe wurde durch Dr. Rudolf
Hoecker unter den Dubletten der Preull. Staatsbibliothek wieder ausfindig gemacht.
A nthropomorphismus der Gestirndiimonen 5II
mungsmache eines Seytz
1
) zu wirken suchte. Man fiihlt, wie die Holz-
schnittillustration als machtiges neues Agitationsmittel fiir die Bearbei-
tung der Ungelehrten eingriff.
Wi.irde der Historiker nicht durch unwiderlegliche Zengnisse ge-
zwungen, solche Ansammlungen banaler Trachtentypen religionswissen-
schaftlich ernst zu nehmen, so wi.irde er eine derartige Illustration iiber-
legen Hichelnd bald aus der Hand legen - urn sich damit, wie so haufig,
das Kuriosum als tiefreichendste Quelle volkerpsychologischer Einsicht
zu verschi.itten. Denn diese Sterndamonen wurden als wirkliche Gewalten
empfunden und offenbarten sich eben deswegen anthropomorph. Es
klingt eben nur paradox, wenn man sagt, daB dieser Gotterversammlung
eine starkere gottliche Augenblicksgewalt innewohnte, als den Olympiern
an der Decke der Villa Farnesina, die ungefiihr urn diese Zeit Rap h a e 1
erscheinen lieB. Freilich stellt die italienische Renaissance die Gotter-
figuren ihres Altertums in so freier selbstverstandlicher Schonheit vor
unsere Augen hin, daB jeder Kunsthistoriker dem leisesten Versuch, in den
Gestalten Raphaels nurnoch eine Spur real wirkender heidnischer Gottlich-
keit zu suchen, wohl als einer antiquarischen philologischen Abwegigkeit
verstandnislos gegeni.iberstehen wiirde; er sollte sich aber erinnern, daB
ihn ein Schritt in jenen Nebensaal der Farnesina fiihrt, wo Agostino
Chigi zu gleicher Zeit als Gegenstiick die ganze Decke von Peruzzi mit
heidnischen Gestirngottheiten bemalen lieB, Planeten und Fixsternen, in*
verschiedenen Stellungen zueinander, die nicht etwa ki.instlerisch bedingt
sind; sie sollen den Stand der Gestirne am Geburtstage Chigis verkiinden,
der sich unter dem Schutze seines giinstigen Horoskopes, das ihm -
betri.igerisch - ein langes Leben verhieB, auch in den Stunden seiner t
landlichen Erholung wissen wollte. Und noch tiber seinen Tod hinaus
ist Agostino ein Mazenas astrologischer Kunst geblieben; aus der lichten
Kuppel, die sein Grab in S. Maria del Popolo i.iberwolbt, schauen ja, nach
einem Entwurf Raphaels, heute noch die sieben antiken Planetengotter
herab, deren heidnisches Temperament freilich gebandigt wird durch
christliche Engel, die ihnen unter der Oberleitung Gottvaters zur Seite *
gestellt sind.
Die formale Schonheit der Gottergestalten und der geschmackvolle
Ausgleich zwischen christlichem und heidnischem Glauben darf uns eben
doch nicht dariiber hinwegtauschen, daB selbst in ltalien etwa 1520, also
zur Zeit des freiesten, schopferischsten Ki.instlertums die Antike gleichsam
I) ,Alexander Seytz von Marpach der loblichen Fursten von Beyrn Phisic." In den
neueren Biographien (Pagel und Bolte ADB. 33 653/55 und G. Linder, Zs. f. allg. Gesch.
(r886), 224/32) dieses vielseitigen Arztes klafft fur die Jahre 1516--25 eine Lucke, die
durch Carions bislang ubersehene Erw!lhnung teilweise ausgeftillt wird.
512 Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
in einer Doppelherme verehrt wurde, die ein diimonisch-finsteres Antlitz
trug, das abergliiubischen Kult erheischte, und ein olympisch-heiteres,
das iisthetische Verehrung forderte.
Luther und die Lehre von den Konjunktionen: Die Siindflut-
panik von 1524.- Luther und Johann Lichtenbergers Weis-
sagung auf den ,kleinen Propheten" fiir die Konjunktion von
!484.
Luther hat diese Siindflutpanik seelisch mit durchlebt. Seine Stel-
lung war unbedingt ablehnend, soweit wissenschaftliche Astrologie in
Betracht kam. Aus spiiteren Jahren besitzen wir dariiber eine humor-
voile, sehr abfiillige AuBerung
1
): ,D. M. L. sagte von der Narrheit der
Mathematicorum und Astrologorum, der Sternkiicker, die von einer
Siindfluth oder groBem Gewiisser hiitten gesagt, so Anno 1524 kommen
sollte, das doch nicht geschach; sondern das .folgende 25. J ahr stunden die
Bauren auf, und wurden aufriihrerisch. Davon sagte kein Astrologus
nicht ein Wort. Er redete aber vom Biirgermeister Hohndorf: derselbe
lieB ihm ein Viertel Bier in sein Hans hinauf ziehen, wollte da warten
auf die Sindfluth, gleich als wiirde er nicht zu trinken haben, wenn sie
kame. Aber zur Zeit des Zorns war ein Conjunctio, die hieB Siinde und
Gottes Zorn, das war ein ander Conjunction, denn die im 24. Jahre."
Zur Zeit der Siindflutpanik selbst war er daher nicht geneigt, an eine
astrologisch bedingte Siindflut zu glauben, wohl aber meinte er doch,
daB das Zusammentreffen der vielen Gestirne das Eintreten des jiingsten
Tages bedeuten konnte, und wenn Luther auch nie die Sternkunde als
Wissenschaft hat gelten lassen, so richtete sich sein Widerstand grund-
satzlich eben gegen das intellektuelle, nicht so sehr eigentlich gegen das
* mystische Element der Astrologie (vgl. Tischreden, Erl. Ausg., a. a. 0.,
S. 320): , ... Denn die Heiden waren nicht so narrisch, daB sie sich vor
Sonn und Monden gefurcht batten, sondern fur den Wunderzeichen und
ungeheuren Gesichten, Portenten und Monstris, dafur furchten sie sich,
und ehreten sie. Zudem, so ist Astrologia keine Kunst2), denn sie hat
keine principia und demonstrationes, darauf man gewiB, unwankend
fuBen und griinden konnte ... " a)
I) Erlanger Ausg. Bd. 62, S. 327.
z) Wir wfirden sagen: ,.kcine sichere Technik". Dazu vgl. Widman, Georg Rudolff,
Warhafftige Historien ... So D. Johannes Faustus ... hat getrieben (Hamburg 1599):
Streit zwischen Henr. Moller und Joh. Gartz (Garcaeus), ob Astrologie cine Ars oder nur
Scientia sci, gewissc Kunst oder blo13e Wissenschaft; Melanchthon dazu: sive sitars,
sive scientia; est certe pulchra Phantasia. I. Cap. 28, S. 222f.
3) Vgl. Beil. B. I und V. Man muB diese AuBerung im Gedi!.chtnis behalten, wenn
man Luthers VerM.ltnis zu den kosmischen Wundern richtig verstehen will.
Luther und die Prognostica-Literatur 513
Die Furcht vor den wahrsagenden Naturwundern am Himmel und
auf Erden, die ganz Europa teilte, wurde durch die Tagespresse in ihren
Dienst genommen: War schon durch den Druck mit beweglichen Lettern
der gelehrte Gedanke aviatisch geworden, so gewann jetzt durch die
Bilderdruckkunst auch die bildliche Vorstellung, deren Sprache noch
dazu international verstiindlich war, Schwingen, und zwischen Norden
und Siiden jagten nun diese aufregenden ominosen Sturmvogel hin und
her, wiihrend jede Partei versuchte, diese ,Schlagbilder" (wie man sagen
konnte) der kosmologischen Sensation in den Dienst ihrer Sache zu
stellen.
Es scheint nun, als ob auf protestantischer Seite Spa 1 at in, der Ver-
trauensmann Luthers und des Kurftirsten Friedrich des Weisen, diese
Pressepolitik durch astrologische oder monstrologische Warnungsbilder
ausdrticklich forderte als ,ktinstliche" oder ,wunderliche" Weis-
sagung. Schon daB er sich bereits 1519 ein Gutachten tiber die groBe
. Konstellation von 1484 kommen lieB
1
), sowie ferner, daB er von Luther
selbst jene Auskunft tiber seine italienische Nativitiit verlangte
2
), weist
darauf hin, daB Spalatin sich in dem Ideenkreise bewegte, dem jene Weis-
sagungsflugschrift von Johann Lichtenberger angehort, die Luther
mit einer eigenen Vorrede herausgegeben hat. Sie erschien, von Stephan
Roth aus dem Lateinischen iibersetzt, mit Holzschnitten von Lemberger
bei Hans Lufft zu Wittenberg I527.
3
)
In dieser Vorrede
4
) wird der unzweifelhaft astrologische Charakter
ausdrticklich in den Hintergrund geschoben. Die 43 Bilder sollen eigent-
lich nur als selbstiindiges Warnungszeichen ftir schlechte Christen gelten,
urn vor allem die Pfaffen aufzurtitteln, die, seitdem nun auch der Bauern-
krieg 1525 an ihnen gliicklich vorbeigegangen sei, sich vor den Straf-
androhungen nicht mehr iingstigen. - Die Geistlichen und ebenso die
Fiirsten, aile die ,groBen Hansen", hatten allerdings Grund, dieses Buch
zu ftirchten, da es die Ideen der Reformation in Kirche und Staat in
einem wunderlichen Gemisch von dunklen Riitselbildern und klar aus-
gesprochenen Drohungen und Forderungen vortrug. Seit etwa 1490 ist
diese Schrift, die zuerst lateinisch erschien, unziihlige Male, auch in Uber-
setzungen, wieder aufgelegt und ernsthaft als Orakel in schwierigen Zeit-
r) Joh. Erh. Kapp, Kleine Nachlese einiger ... zur Erll!.uterung der Reformations-
Geschichte nfttzlicher Urkunden (Leipzig 1727), II. 5II.
2) Vgl. S. 499 und Anm. 4
3) Die weissagunge J ohannis Lichtenbergers deudschfzugericht mit vleys. Sampt einer
nutzlichen vorrede vnd vnterricht D. Martini Luthers f Wie man die selbige vnd der
gleichen weissagunge vernemen sol. Wittemberg, Hans Lufft (1527).
4) Siehe den vollstl!.ndigen Textabdruck in Beil. C. Die Vorrede ist in der Weimarer
Ausg. Bd. 23, S. 1-12 enthalten.
Heidnisch-antihe Weissagung in Wort und Bild zu LutheYs Zeiten
liiuften befragt worden. Noch 1806 nach der Schlacht bei Jena hat man
dieses sibyllinische Buch befragt.I)
Diese Prophezeiung wurzelt tief in astrologischem Erdreich; fanati-
scher Sternglaube kniipft an eine ganz bestimmte Planetenkonjunktion
von Jupiter und Saturn im Zeichen des Skorpions, die fiir den 23. Novem-
ber 1484 vorausgesagt war, die Erwartung des Auftretens eines Geist-
lichen an, der eine kirchliche Revolution hervorrufen wiirde. Im 15. Jahr-
hundert hatte nach dem Zeugnis Pico della Mirandolas
2
) in Italien diese
Prophezeiung jahrzehntelang vorher iihnlich die Gemiiter bedriickt und
aufgeregt, wie die Siindflutprophezeiung von 1524- Als dieser geistliche
Prophet nun dama.ls ebensowenig erschien wie die Siindflut, trat, wie Pico
bezeugt, zunachst eine Entspannung ein, aber Astrologen sind unblamier-
bar; es fand sich in Padua ein Professor der Astrologie, P a u 1 us v o n
* Middel burg ein (vgl. Abb. 134), von Herkunft ein holliindischer Geist-
lieber, der den EinfluB der Konstellation von 1484 einfach auf 20 Jahre
,streckte" und sie auf aile Bezirke des menschlichen Lebens, nicht etwa
nur auf den erscheinenden Monch, ausdehnte.
3
) Die Erscheinung dieses
revolutionaren ,kleinen Propheten" wird unter stellenweiser sklavischer
Benutzung des Arabers Abu M a sa r') (gest. 886) deutlich vorausgesagt.
So soli er z. B. 19 Jahre nach 1484, d. h. 1503 geboren werden, 19 Jahre
lang wirken und sein Vaterland - weil doch die Bibel sagt, daB ein
Prophet in seinem Vaterlande nichts gelte- verlassen miissen.
Fur die Geschichte der Weissagungsliteratur ist es psychologisch
und philologisch gleichermaBen aufkliirend, daB Lichtenberger, worauf
man bisher nie geachtet hat, wiederum seine Prophezeiung dem Paulus
von Middelburg wortlich entlehnt hat. Sein geheimnisvoller Bau ruht also
auf einem gestohlenen Grundstein. Paulus von Middelburg hat dies selbst
1492 in der Invectiva
5
), die wohl eine der friihesten gedruckten Streit-
schriften wegen Plagiats ist, zornig festgestellt und Lichtenberger, von
dessen Personlichkeit man iiberhaupt wenig Sicheres weiB
6
), scheint
nicht geantwortet zu haben. Das Schreckgespenst der groBen Konjunk-
I) Vgl. Ebert, Allg. bibliogr. Lexikon, I. Bemerkung zu Nr. II972 (einer hoi!.
Lichtenberger-Ausg. von x8xo).
2) De astrologia disputationum I. V. cap. I. Op. omnia, Basil. (1572) I. 551.
3) Paulus von Middelburg, Prognostica ad viginti annos duratura. Hain I I 141 f.
4) "Ober Abii-Ma' sars Bedeutung vgl. F. Boll, Sphaera (1903) und Sternglaube (1919),
ebendort meinen Nachweis zu den Fresken in Ferrara S. 77 [ unsere S. 468 f.]. V gl. Albumasar,
de magnis coniunctionibus, Aug. Vind., Ratdolt (1489) Tract. I. Speziell: Differentia tercia
in scientia coniunctionum significantium natiuitates prophetarum ... et signa prophetie
eorum et quando apparebunt et vbi et quantitates annorum eorum- und diff. IV.
5) Ausg. Lubeck 1492. Antwerpert 1492. Invectiva in superstitiosum quendam
astrologum.
6) J. Franck, ADB. 18, 538-42.
,ngrana rermiffimiacporeclffimi 1btin1
cipis&dni,diiiFERDINANDI Principis Hifpaniaru,
Ardtidods Auflrlf,duciBurgiidts,&f.Crf.& catholic< Ma.locii
gilalis f!Zc.& ad cl5folationi' populolJt fua-.S. ac po.do.dltion! fubic,'lol)l.
Grorgij T ANNSTETTER Collimitij Lycorip<ftt Mrdtci &. Mathrma
Ut11ibcllua cOfolatonus,quo,oplnlonf li dudu ani rx quo
runda Aflrolo,anrol}l diluulo &. mulcts
alijs pcricuhs. X XIIII. annl a fund.uni'tis cxtirparc conarur.
Tafel LXX\'II
uo .LU"'''-k
Cum a & priuilcgio.
Abh. 133. Titel zu Georg Tannstett('r,
Libellus consolatorius, \\'ien 1523 (zn Scitc 510).
lnani!fti_pauli be mibbelburgo pnnollicw
abornuutaruw.ebarawra.:.
.,
'
rua;z particulam amplecti Nil em : fcio ,pfec:o q>
oeftcem insenni.cti ror ranrecn fmr q> anschcam poriueq>
ma111iozarionc requiranr ;lticcnoa erso 'l ftlemio pon
9
pmen
oa arbirroz.cu ampliwomi rue paz( ozatioi'i pzellare no poff!
mue.oubuoetil nc ranrli auolcnnb 11ia; viocri facia: quanra
ipfe verbis referee qneli.cti in verirare louse fir maioz.o.ccula
muecrso 1: filemto pmam. :.llo reersoreocooUJ:umicrif
lime ome.aF.>a:rmiliaueoi ut omniureluccaruem
plar:perseu ccptni era bono,ppofiro:oefifiere noli.oocris
fane.fiuoiofoeaomua. oebtlca rnnenra.afirolosoeobferua.
foli ttnumr uncr mozralee:qui re fianiqltuti incolume pzefer
uare nanqlbenisni!Tim
9
er io_em oprim
9
acfap1en
riff1n1
9
oeue:bomrariaerfapientiefue otfpofirionc in rcb
9
: R
fecunOt>J! cat1fa moruaarql ittfln;r
9
ira ollenoere:_vr folie ip
peafirolo!liB oe"' oelicria innorefcerer \D.ue cii 1m finr ou;:
clari!Tuncquia intuo pwoze ipfe hberaleeanee:lpfa fa
jlienria:iJ1fl1 te l>ncipe 1\lUnificcn
nffimotOIJil'li!Orntmo pero fuautffi
mti:l7l mequan'iin :]ralia refioenrc:intuojlnumcro fioelif
fimop feruitO!l collocare oisnerie.t: mee;rcdlenrie tue oeoitl
fftmu: meacu rnoua oz incullll ::>hbcnti ammo fu
fcipiae.ID.noo fia re mun l!OC!lflltifftmti imperraffe me fen
fero:ruam increoibilem
pzeoicarenonoefizzam:'I)Gie.
JEoirum per plum oc6'3iooelburso
Z:danoie bonarum arri11m 'l meoimtt oocro
rem illufiriffimi oucie :]n mar
curialioppiooanrwerpienfiimpzdTum.lPcr
me leeu :Bnno feluris.ta@,""'
.lmtilj.quanokalcnoae\Dctobz19.
Abb. 13-1 Titd und l<'lztc Seite aus: l'aulus von ;\liddelhurg, l'rognostica,
.\nt\\'l'l'(lt'll qll.J (zu Scitc 514). -
Tafel LXXVIII
f4flwol 31f
\lfll> ;Ill
Saturm\lflb Jupiter&t
(oniunction tmb 3uf.mmen lauflimg 1
fd}lrcd'lid} bing brenntttmb 'mf-.lnbiget 3neunflii!j5
'\:)nO ifholt!omen Sefenmacl) ("rift gtpart '9'lf
im-et m. am tioji'l
uembriet bee \."tlcinmonbf&tl!ltlb l>ie tm>L" filmbtt \!ier .t1W
1111t 114d) mitt4gtlwie 1\?0lber trW& ein>ab& bod)4WtfflelP
!Je'Pberbm l,ori3ontem.
Lmflimg gcfd}id')t llfd)t..,benn l14d) l!trllil
lfiUngnnrr l.mgm3dt:t tmblt'tnnt!id Sef!im
men wb mn!l fie lllld) etnm flmfem eiuP
flut;,
.\hb. 13.'i
Jupiter und Saturn. aus: Johann Lichtenlll"rger,
v\'l'issagung<'ll, \\'itt(Jl})(rg I 527 (zu SPitl' .'i !_";).
wao. ;r;r;riij. apirel.
finb l!nb bie ;eid)en feint ba (,ey mmt
l\1irb rrtcnnmt tl!r "'irb fd)ll.'ame fled'id)en
amlcil,>eltlnb "'irb cinm leib
bralt'nfled'id)tcn mand)fl-rbid)ten macfclrt
ynn berredlttn fc'!'telfl bf'\'m f'1)os bcr tfr
am tcil bes gli'acl's/ 311r rrd)tcll bee 1 \?nb ym
bM bcr afccnbmt ber beiber
btfle weibifd)er feyttmb ll.'trbrn fid) aufr bas t>inbtrflc tcil bro
am mtiftcn nevgrn.f.fr roirl> aud) nod) ein anbtr 3eid7cn
411 ber brufl t>abCII! aUG brm tttl bf6 ;eid)CIUl/ ll.'ifd)s )'111 fcd7"
flcn gMl>e Jtnvene crjllnbm ift. iDieftr < tvie
bas fclbige jimticus be;cu'!Jctl roirb rr(d)rcd'lid) fcin be
ten ben i:tufiHnr tr wirb \1itl 3eid)en vnb rountll'n\1Crd'
t9111116Citlt 11Ud} geifte fiic9cnt \1llb
p bic
.\hh. I.)f>. I lit heiden .\liinclw a us rler gleichPil
:\usgalw Lichlt'nl)('rgers (zu Seite 515\.
Abb. 137. Die beiden .\liinchc aus dcr Ausgahe Lichtenbergers,
.l\Iainz l.J()2 (Expl. der S1aats- und {'niversiUUsbibl. Hamburg)
(zu Slitc 515 f.).
Paulus von Middelburg und Lichtenberger SIS
tion zwischen Saturn und Jupiter (Abb. I35), ebenso wie die Figur des*
,kleinen Propheten", gehorten also zum ganz alten Bestande der vor-
reformatorischen Zeit. Trotzdem muBten sie zu Luthers Zeiten aus den
verschiedensten Grunden mit erneuter Kraft wirken. In der Zeit des Kon-
fliktes zwischen Obrigkeit und Bauern wirkte der Saturn und der Jupiter,
wenn sie nebeneinander auftraten, wie Augenblicksaufnahmen aus der *
Zeit des Bauernkrieges, und der astrologische Text klang auch seltsam
menschlich mit, wenn er von den Bewegungen der gH.i.nzenden kosmischen
Korper wie von streitenden Menschen erzahlte. Die damonische Antike
empfing hier von dem leidenschaftlich pulsierenden Leben der Refor-
mation selbst eine ganz spontane, unheimlich wirkliche Wiederbelebung,
die in den Zeiten der eigentlichen kirchlichen Revolution vor allem auch
das Lichtenbergerische Bild vom Monchspropheten erfuhr (Abb. I36).
Mochte immerhin weder die Geburtsstunde noch das Auswandern
aus der Heimat stimmen, noch die Male und Flecken an bestimmten
Korperteilen, die schon im Handbuch des Abu Ma' sar zu lesen sind, die
Hauptsache stimmte doch mit Luthers Erscheinung: ein Monch war
aufgestanden und den Geistlichen zuleibe gegangen. Luther selbst kannte
sehr wohl die Gefahr, daB die Abbildungen des Weissagungsbuches auf
ihn bezogen werden konnten; dem ist wenigstens an einer Stelle dadurch
vorgebeugt, daB dem Bilde eines falschen Propheten bei Lichtenberger
ausdriicklich die Unterschrift verliehen wird: ,Dieser Prophet sihet dem
Thomas Muntzer gleich".
1
) Urn so weniger haben sich Freund und Feind
die Beziehung der Monchsbilder auf Luther und Melanchthon entgehen
lassen.
2
)
Die Hamburger Stadtbibliothek besitzt die alte lateinische Mainzer
Ausgabe von I492 (Abb. I37). Den heiden Figuren -einem groBen Monch,
dessen Kapuzenzipfel bis auf den Erdboden reicht, sitzt ein Teufel auf
der Schulter
3
), neben ihm steht ein kleiner Monch, von vorn gesehen-
r) Holzschnitt zu Cap. XXIX.
2) Holzschnitt zu Cap. XXXIII.
3) Ich mi>chte nicht daran zweifeln, daB hinter dem Mi>nch mit dem Teufel im Nacken
und dem schlangenartig bis auf den Boden verlll.ngerten Kapuzenzipfel zwei Sternbilder-
erinnerungen stecken: der Asklepios-Schlangentrll.ger und der Skorpion, die ja beide im
Oktober-November paranatellontisch zueinander gehi>ren. Das fiktive Geburtsdatum
Luthers fll.llt also in eine Zeit, wo die Fixsterne fiir eine Heilbringerkonstellation der
Planeten wie geschaffen sind. Wie weit hier hellenistisch-arabische Tradition einwirkt,
bleibt zu untersuchen; Picatrix (vgl. Sax!, Beitrll.ge usw. Islam III (1912), S. 172
1
) schreibt
z. B. dem Jupiter-Verehrer ein weiBes Mi>nchsgewand mit Kapuze vor. Fiir die unmittel-
bare, eigentliche, antikisierende Fixsternbild-"Oberlieferung sei hier nur darauf hinge-
wiesen, daB Lichtenberger von dem Propheten sagt: Vnd wie ein Scorpion I der des
Martis haus ist ynn dieser Coniunction vnd finsternis I wird er die gifft I so er ym schwantz
hat/ offt ausgieBen" (Wittemberg 1527, fol. PV). In der Ausgabe von Modena (Maufer 1492,
Berlin, Staats bib!.) hat der Kapuzenzipfel ein auffallig stachelartiges Ende. Erganzend sei
516
Heidnisch-antike Weissagung in Wol't und Bild zu Luthers Zeiten
ist von alter Hand, die wohl noch aus dem 16. Jahrhundert stammt,
plattdeutsch hinzugefiigt: ,Dyth is Martin us Luther" und .,Philippus
Melanton". Ohne kulturwissenschaftliche Zusammenhangskunde wiirde
man in diesen Beischriften zu einem vom Teufel besessenen Monch nichts
als die haBerfiillte .AuBerung eines abgesagten Gegners Luthers sehen.
Das stimmt nicht ganz. Auch die Freunde konnten, auf Luther selbst
gestiitztl), das Bild zugunsten des Reformators interpretieren, wenn es
auch bekannt ist, daB die papistischen Streiter wider Luther zu allen
Zeiten den Teufel bis zum Ekel mit Luther in hochst personliche Verbin-
dung gebracht haben; er sollte ja sogar als Incubus sein leiblicher Vater
gewesen sein. So besitzen wir von dem streitbarsten Antilutheraner
Cochlaeus eine giftige Verquickung von Luther mit diesem Lichten-
bergischen Monch. Schon 1534 flucht er in seinen neuen ,Schwarme-
reien" folgendermaBen: ,Hoff auch I er ((Luther)) sols auf XX. Jahr
nicht bringen f Sander im XIX. jar (wie Liechtenberger von jm schreybt)
sol er zu baden gehen I der vnselig M&nch I der den Teuffel auf der
achseln tregt I in Liechtenbergers Practica".
2
) Cochlaeus wendet also
Bild und Inhalt auf Luther an wie in einer ganz gelaufigen Anspielung,
die sich sogar anhort, als ob er einer anderen, Luther giinstigen Auslegung
entgegenwirken wolle.
darauf hingewiesen, dall eine astrologische Bilderhandschrift aus dem Kreise des Konigs
Alfonso, deren Entdeckung im Jahr 19II in der Vaticana zu Rom (Reg. 1283) der Verf.
der steten Hilfsbereitschaft von Pater Ehrle und Bartolomeo Nogara verdankt, die Briicke
zwischen deutschen spi!.tmittelalterlichen Vorstellungen und dem arabisierenden, antiki-
schcn Gelebrtenkreis zu Toledo scblligt. In dieser Handschrift ist unter anderem ein wahr-
sagender Monatskalender (vgl. Abb. 138) enthaltcn, der in Kreisform, auf 30 Grade radial
verteilt, Figuren mit Wahrsagespriichen enthlilt, die, obgleich bis zur Unkenntlichkeit
realistisch mittelalterlich auftretend, Nachlliufer der Sphaera des Teukros sind, also aus
echt antiker, astraler oder kultlicher Glltterverehrung stammen. So ist, was ich our
streiflichtweise im Zusammenhang mit dem Asklepios-Luther erwl!.hnen will, auf Bl. 7
der Scorpio als Beherrscher seiner 30 Grade aufgefallt. Hier finden sich in den einzelnen
Abteilungen, aus dem Asklepioskult unbewullt iiberlebend, aber deutlich erkennbar, die
Schlange, die Kuchen, der Brunnen, der Tempelschlaf und der Kopf des Asklepios selbst.
Diese Schicksalshieroglyphen fiir jeden Tag des Monats mUnden nun iiber Pietro d'Abano,
den Inspirator des Salone zu Padua, in das Astrolabium planum, das Johann Engel zuerst
bei Ratdolt in Augsburg 1488, spliter in Venedig herausgab, ein (Job. Angelus: Astra-
labium planum in tabulis ascendens, Augsburg, Erhard Ratdolt (1488); Venedig, Johann
Emerich de Spira (1494); vgl. dazu die Bilderhandschrift des Leovitius fur Ottheinrich
in der Bibliothek von Heidelberg Palat. germ. 833 Bl. 65V). Der Mann mit dem Scorpion
in der Hand findet sich z. B. (vgl. Abb. 139) beim II. Grad, der mit der Schlange beim
13. identisch im Astrolabium unter Grad II und 12. Es darf also die Wanderstralle solcher
heidnischer, kosmologischer Orakel als ganz gesichert gelten fiir den, der das Problem der
,.dlimonologischen Bilderwanderung von Osten nach Westen und vom Siiden nach Nor-
den" in den Grundziigen- was der Verf. bier nur noch fliichtig zu skizzieren vermag-
erfassen will. r) Siebe weiter unten S. 518f.
2) Johafi Cocleus, Von newen Schwermereyen sechs Capite!. Leiptzig, Michael Blum
(1534). Bl. dij.V.
Tafel LXXIX
:\bb. r 38. Skorpion. ]{om, Cod. VaL
. lat. 1283, fol. 7v (zu Seite 516).
Tafel LXXX
Uirjfco:pioni tenis cii colo.
(['bomo inuibus erit.
Xurrie ac foms.
tiioztislabozatoz ait.
eerpente megmi mufcepusentett.
(Ibomopmbis erit feb tn41us.
quo manat aqua.
Scor.pio
11-14
(I 'bomo inflabilis erit feu111.
Abb. 139. Skorpio-\Vahrsagcbilckr 11 u -14", aus: Astrolabium :\lagnum, ed. Engel,
Augsburg q88 (zu Scitc 51Ci).
Lichtenberger und Gauricus
5!7
Ein Jahr spiiter hat der Kardinal Vergerio den gefiihrlichen und
gebannten Monch in Wittenberg aufgesucht und seinen Eindruck mit
folgenden Worten beschrieben. Er schreibt an Ricalcati am 13. November
1535: , ... et veramente che quanto piu penso a quel che ho veduto et
sentito in quel monstro et alia gran forza delle sue maladette operationi,
et coniungendo quello che io so della sua nativita et di tutta la p ~ s s a t a
vita da persone che li erano intimi amici sino a quel tempo che se fece
frate, tanto piu mi lascio vincere a credere che egli habbia qualche de-
monio adosso I" 1)
Die Beschreibung Vergerios wirkt schon rein iiuBerlich wie eine
verbliiffend getreue Unterschrift zum Monchspropheten bei Lichten-
berger; Vergerio selbst aber gibt noch einen weiteren Beweis dafiir, daB
er auch den Text Lichtenbergers gleichzeitig im Kopfe hatte. Er hat,
wie er schreibt, iiber die ,nativita" allerlei Verdiichtiges gehort. Mit
,Geburt" ist das m. E. nicht richtig iibersetzt; es bedeutet hier vielmehr
die Nativitiit, d. h. die Geburtskonstellation Luthers. Diese aber wurde
ja gerade damals in Wittenberg, noch dazu von einem italienischen
Astrologen, in Verbindung gebracht mit jener Lichtenbergerschen Monchs-
prophezeiung, und eben desbalb setzte wohl Lucas G auric us, als er 1532
Wittenberg besuchte, das Geburtsdatum auf den 22. Oktober I484 an (vgl.
Abb.I23).VergeriowirdbeiUmfragenumsoleichterdavongehorthaben,als
hinter dieser Datierung (s. o. S. 499f.) von vornherein antireformatorische
Tendenzpolitik steckte, die sich bei Gauricus freilich erst in der Ausgabe
von 1552 zu jenem haBerfiillten Begleittext zur Luther-Nativitiit steigerte.
Dieser Zusammenhang zwischen Lichtenberger und Gauricus liiBt
sich auch im einzelnen feststellen. Denn wenn man, was hier nur ange-
deutet werden kann, das Wesentliche des Gauricus-Horoskopes genauer
untersucht, so erkennt man, daB hier eine unzweifelliafte tibereinstim-
mung mit den astrologischen Angaben vorliegt, die sich in der Prophe-
zeiung des Lichtenberger finden. Diese "Obereinstimmung ist moglicher-
weise so :zu erkliiren, daB hier ein Zuriickgehen auf eine gemeinsame Quelle
vorliegt, die gleichfalls nordischen Ursprungs ist. Denn jener Paulus
von Middelburg, die verheimlichte Vorlage des Lichtenberger (s. o.),lebte
in Italien und stand in personlichster Beziehung zu Lucas Gauricus, da
er ebenso wie dieser von Papst Leo X. beauftragt war, den julianischen
Kalender zu reformieren.
2
) Wir wissen auch, daB Gauricus die Werke
I) Nuntiaturberichte ans Deutschland ... herausgeg. durch d. k. preull. hist. Inst.
in Rom, I. Abt., I. Bd. Walter Friedensburg, Nuntiaturen des Vergerio 1533-I536
(Gotha 1892), S. 541.
2) Ben. Soldati, La poesia astrologica nel Quattrocento (Bibl. stor. del rin. III).
(Firenze I9o6), p. II5.
SI8
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu L u t h e ~ s Zeiten
des Paul von Middelburg gekannt und hochgeschatzt hat. Denn er
zitiert ihn in seinem Encomion astrologiae als eine der Leuchten dieser
Wissenschaft.l)
Die Grundidee der Prophezeiung ist bei Gauricus einfach umge-
bogen zuungunsten Luthers, indem bei ihm nicht nur zwei Planeten,
wie bei Lichtenberger, sondern aile Planeten mit Ausnahme des Mars
im Hause des Skorpions zusammentreffen. Auch darin wirken die Vor-
stellungen von der Prophetenkonstellation bei Gauricus nach, als Jupiter
und Saturn sich im neunten Haus - der Religion - versammeln und
der schadliche Mars in seinem ,koniglichen Hause" steht, dem Widder,
wie Lichtenberger es ausdriicklich verlangt. Hinzu kommt bei Gauricus
die Ansammlung der iibrigen Planeten im neunten Hause. Ob die Er-
zielung dieser Anhaufung oder eine besondere astronomische Berechnung
der Grund dafiir gewesen ist, daB er das Datum Lichtenbergers vom
25. (oder 20.) November nicht iibernimmt, sondern statt dessen den
22. Oktober einsetzt, bedarf weiterer Untersuchung.
2
)
Luther tiber Weissagen des ,bosen Feindes" bei
Johann Lichtenberger.
Urn der Astrologie willen hatte also Luther gewiB eine Beziehung
zwischen sich und dem Monchsbilde abgelehnt, wie er denn ja auch in
der Vorrede ganz ausdriicklich die Unzulanglichkeit der Sternwissen-
schaft betont, und, das sollte man denken, erst recht wegen des Teufel-
chens, das er im Nacken tragt (Abb. 136, 140). Eine Nachricht, die Her-
berger3) zwar erst am Anfang des 17. Jahrhunderts mitgeteilt hat, die
aber offenbar auf gute Quellen, die er ausdriicklich nennt, zuriickgeht,
besagt etwas ganz anderes:
1) E. Percopo, Pomp. Gaurico (Estr. Atti dell'Accad. di archeol. lett. e belle arti
di Napoli). (Napoli 1894), p. 136.
2) Die Konstellation von Jupiter und Saturn im Skorpion wird von Lichtenberger
in der von Luther mit einer Vorrede versehenen deutschen Ausgabe von 1527 gesetzt
auf den 25. Tag Novembris .,des Weinmondes" 1484; damit sind hier zwei Monatsdaten
gegeben, da der Weinmonat der Oktober ist. Eine weitere Verschiedenheit findet sich
in der Ausgabe von 1549, BI. 28, wo statt des 25. November vielmehr der 20. genannt
wird. Fur Gauricus wird man indessen (wenn ihm fiberhaupt Lichtenberger und nicht
etwa Paul von Middelburg als QueUe gedient hat) sicher nicht die Benutzung eines deut-
schen Textes anzunehmen haben - es sei denn, durch Vermittlung seiner deutschen
Freunde- sondern vielmehr eines lateinischen oder italienischen; in diesen steht, so viele
uns bisher zuganglich waren, iiberall das Datum des 25. November. Aus Lichtenberger
wird sich also die Verschiebung des Datums auf den 22. Oktober, die Gauricus hat, schwer-
lich erkHl.ren lassen, wenn nicht noch eine uns unbekannte Ausgabe existiert, die dieses
Datum bringt.
3) Valerius Herberger, Gloria Lutheri (Leipzig 1612), S. 41-45.
Luthers Teufelsglaube 519
Von S. Martini vnd D. Martini Feinden.
S. Martino haben die b ~ s e n Geister viel schalckheit angeleget I wenn
sie jhm in mancherley form vnd gestalt sind erschienen. Vornemlich
hater geklaget I daB Mercurius vnter dem hauffen der schlimmeste sey.
Jedermann hat seine plage 1 wie es Christus selbst muB erfahren IMatth. 4
Zur zeit kam S. Martino der Teufel entgegen Ida er wolte sein Ampt ver-
richten I vnd sprach: Aile Welt wird dir gram werden: Da antwortet
Martin us eben wie Ritter Gordius: Dominus mecum, non timebo mala,
ist Gott mit vns I wer wil wider vns: Also hat der Teufel auch D. Martino
viel schalckheit durch seine Werckzeug angeleget I Vornemlich die
Mercurialischen geschwinden Kopffe vnd Sophisten haben jhn greulich
geplaget.
Hier muB ich etwas denckwirdiges erzehlen. Herr Johan Lichten-
berger hat geweissagt I es wurde ein Munch kommen I der wurde die
Religion scheuren vnd pantzerfegen 1 demselben Munch hat er einen
Teufel auff den nacken gemalt I nu macht sich Lutherus ein mal vber
Lichtenbergers Buch I vnd wiles verdeutschen I D. Iustus Ionas kompt
dazu 1 vnd fragt was er vorhabe: D. Luther sagets. Da spricht D. Ionas:
Warumb wolt jhr jhn deutschen I ist er doch wider euch. Lutherus
fraget vrsach. D. Ionas sagt: Lichtenberger sagt I jhr habt den Teuffel I nu
habt jhr ja keinen Teuffel. Da lachelt der Herr Lutherus, vnnd spricht:
Ey Herr Doctor I sehet nur das Bild ein wenig besser an 1 wo sitzt der
Teuffel? Er sitzt nicht dem Munche im hertzen I sondern auff dem
nacken I ey wie fein haters troffen I Jm hertzen da wohnet mein HErr
JESVS I da sol mir der Teufel nu vnnd nimmermehr hinein kommen I
aber ich meyne er sitzt mir auff dem nacken I durch Bapst I Keyser
vnd grosse Potentaten I vnd alles was in der Weit wil klug seyn. Kan
er nicht mehr f so macht er mir im Kopff ein abschewlichs sausen. Wie
Gott wil I er mag mich eusserlich plagen I es ist I Gott lob vnnd danck I
nur ein auBgestossener auBgeworffener Teuffel I wie Christus redet I der
Furst dieser Welt werde jetzt auBgestoBen I Ioh. 12. .
Diese wort hat D. Iusti Ionae Diener I welcher hernach ein be-
nilimbter Prediger worden I ad notam genommen vnd offt erzehlet. Es
ist war I der Teufel gehet herumb von aussen I I. Pet. 5 LaB jhn prUuen
wie er wil I im hertzen gleubiger Christen hat er nichts zu schaffen I
vnser Hertz ist Christi Koniglicher eigner Sitz f da wil er Regent vnd
Platzmeister bleiben.
Diese Oberlieferung klingt sehr echt. Wir haben von Luther ganz
a.hnliche AuBerungen iiber den Kampf mit dem Kopfwehteufel, der fiir
520
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
ihn ein hochst personliches Wesen war.l) Die humorvolle Tonung bei
Herberger kann das nicht verschleiem; denn so scharf Luther auch die
menschenartigen Stemdamonen ablehnte, so bildhaft fest umrissen und
unanzweifelbar lebte fiir ihn der bose Feind. Er gestand ihm sogar in
der Vorrede zu Lichtenberger
2
) gelegentliche Treffsicherheit in Weis-
sagungen zu, wenn auch nur soweit, als weltliche Zustande in Betracht
kamen. Gerade iiber Lichtenbergers Verhaltnis zum Teufel besitzen wir
noch eine sehr willkommen erganzende AuBerung Luthers. Er wurde
gefragt, ob Lichtenberger einen guten oder bOsen Geist gehabt hatte.
,Fuit spiritus fanaticus et tam en multa praedixit; denn das kan der
Teufel woll thun, quod novit corda eorum quos possidet. Praeterea
novit condition em mundi, er siehet wie es gehe."
3
) Er hielt also den
besessenen, verteufelten Charakter Lichtenbergers fiir durchaus verein-
bar mit zutreffender Wahrsagergabe in irdischen Dingen. Ganz ent-
sprechend heiBt es in der Vorrede: ,Denn Gotts zeichen vnd der Engel
wamunge I sind gemenget mit des Satans eingeben vnd zeichen I wie
die wellt denn werd ist / das es wust vntemander gehe vnd nichts vnter-
schiedlich erkennen kan." So konnte das Teufelsbild von den Freunden
Luthers in dem Bilderpressefeldzug ruhig verwertet werden, da Luther
den Lichtenberger in jener Zeit leidenschaftlicher Scl>Jagbilderpolitik-
freilich nur als Kiinder naturwunderlicher Vorzeichen- gelten IieB.
III. WUNDERDEUTENDE WEISSAGUNG: ANTIK-TERATOLOGISCHES IN DER
LUTHERISCHEN PRESSEPOLITIK
Das Bildnis Luthers in der ,Wunderlichen Weissagung" des
Joachim von Hans Sachs unddasleoninischeOrakel. -Luthers
und Melanchthons politische Monstra: Papstesel und Monchskalb.
Auf diesem Gebiete arbeiteten allerdings Luther und seine Freunde
mit noch ganz anderen Darstellungen, deren parteimaBige Leidenschaft
nur die N otwendigkeit der literarischen Gegenoffensive entschuldigt.
1) Goethe schenkt uns in der Geschichte der Farbenlehre eine eigentlimliche Polari-
tl!.tspsychologie dieser Teufelsflirchtigkeit Luthers: ,.Wie viel falsche Formeln zur Er-
kll!.rung wahrer und unleugbarer Phl!.nomene finden sich nicht durch aile Jahrhunderte
bis zu uns herauf. Die Schriften Luthers enthalten, wenn man will, viel mehr Aberglauben
als die unser's englischen MOnchs (Bacon). Wie bequem macht sich's nicht Luther durch
seinen Teufel, den er iiberall bei der Hand hat, die wichtigsten Phl!.nomene der allgemeinen
und besonders der menschlichen Natur auf eine oberfll!.chliche und barbarische Weise zu
erkll!.ren und zu beseitigen; und doch ist und bleibt er, der er war, au13erordentlich fiir
seine und fiir klinftige Zeiten. Bei ihm kames auf Tat an; er flihlte den Konflikt, in dem
er sich befand, nur allzu ll!.stig, und indem er sich das ihm Widerstrebende recht h11.01ich,
mit HOrnern, Schwanz und Klauen dachte, so wurde sein heroisches Gemiit nur desto
lebhafter aufgeregt, dem Feindseligen zu begegnen und das GehaOte zu vertilgen." Werke,
Cotta Jub.-Ausg., Bd. 40, S. 165-66. 2) Vgl. unten S. 550.
3) Gg. Loesche, Analecta Lutherana et Melanthoniana (Gotha x8gz), S. 301, Nr. 493
A hh. 140. Die heiden Illiinche a us: l'rophcnien unci
\\"cissagen ... Doctoris l'aracelsi, J oh. Lichtenbcrgers,
\1. Joseph Griinpcck, Joan. Carionis, Der Sihyllen
und andcrcr, Augsburg 151<1 (zu Seite .)IR).
--------------------
-------
mntt:.1 q:n:utuor erit.f.Principatus 3Ut que pfum1
pfofli cu gladro 111 Temp lis dolorum poll paululum refufcirabis:trcs o.mos in .
mmJo uiues:fc11ex uaJde in i11fimum dwbus tnbulatiouiblls in mcdio cou
rues.
:\hb. r.p. l>icsellll' l>arstellung aus:
\'aticinia Joachimi, Bononiae I.')f,'j, \Volfcnbtith>l,
Hihliothek (zu Seite 521).
Tafel LXXXI
Abb. 141. Luther mit Sichel unci H.osc, aus:
Osiander und Hans Sachs, \\'undcrliche
'vVeissagung, Niirnberg 1527 (zu Seite 52r).
:r
Srt co!Jarenlis qn:trtus ab vrra:rorrns gladiis:rt holtlo ltlouens incifB
ucm"ro(T:umrn ficcabunrur rieur rofa:etincidens rofilm :tunis montts
tribus:ttcnim Jirtr.[:t terria:f't rlrmenrum illud uidtt:recipiens en 1m
principiu:ur intidcret Aorem nonnufrrebirur rui:quis in principoru maneJS
Vide enim iflr mctpir colligere roram:ailferens in hominibus habem finem
in quo !ewe mu1tun1 fiuftra,
0 ii
Abb. '43 Jupiter, Satum, Sol ( ()
a us dem glcichcn Buch (zu Seitt" 521 ).
Tafel LX X X II
Abb. 144 Oraculum Vaus: Leonis Oracula,
ed. Lambecius, Paris 1655 (zu Seite 521).
Abb. 145a, b. l'apstesd und :\liinchskalb. nach Johann \Volf, Lcctiones mPmorabiles,
Lauingen 1hoS (zu Seite 522 f.).
,Wunderliche Weissagung" des Hans Sachs S2I
Spalatin ist auch hier im Hintergrunde als Forderer bemerkbar.
So interessiert er sich IS2I
1
) besonders fiir das ,Passional Christi und
Antichristi", das damals, mit Illustrationen von Lucas Cranach, erschien
und den Papst als Antichrist anzugreifen wagte. Und im nachsten Jahre
hort er auch schon
2
) von dem italienischen Vorbild der ,wunderlichen
Weissagung", die.. Osiander und Hans Sachs erst IS27 zu Niirnberg
herausgaben, unter Benutzung eines italienischen Druckes, der auf einen
zu Wahrsagungszwecken erfundenen pseudo-joachimitischen Papstkata- t
log zuriickging. Die Erscheinung Luthers bei Hans Sachs mit der Sichel
in der Rechten und der Rose in der Linken (Abb. 141) hat Luther selbst
sehr gefallen. Er schreibt am rg. Mai IS27 an Wenceslaus Link in Niirn-
berg: , ... libellus vester imaginarius de Papatu, in quo imaginem meam
cum falce valde probo, ut qui mordax et acerbus tot annis ante praedictus
sum futurus, sed rosam pro meo signo interpretari dubito, magis ad
officium etiam pertinere putarim."
8
)
Das italienische Buch mit Holzschnitten (Bologna ISIS), das als
Vorlage gedient hat (Abb. 142), befindet sich noch mit den Versen des
Hans Sachs, von Osianders Hand geschrieben, in der Bibliothek zu
Wolfenbiittel.') Auf Einzelheiten einzugehen, muB Ieider unterbleiben.
Es sei nur auf das Menschenbein hingewiesen, das ja auch bei Luther
erscheint. Hier ist in unserem historischen Papstkatalog das sprechende
Wappen fiir den Papst Johann XXIII. (Coscia), der Schenkel, iibrig-
geblieben. Man hat bisher noch nicht bemerkt, daB dieses Bild wiederum
einem byzantinischen Kaiserbildnis a us den bekannten Leoni n is chen
Orakeln desrz.Jahrhunderts nachgebildetist (Abb. 144).
5
) Bei dem astro-
logischen Charakter dieser Weissagungen ist es nicht ausgeschlossen,
daB eine Saturnvorstellung irgendwie noch dahintersteckt.
6
) *
Luthers und Melanchthons Weissagungspolitik hat bekanntlich im
Jahre IS23 einen gemeinsamen Ausdruck geiunden in den Flugschriften
vom Papstesel von Melanchthon und dem Monchskalb von Luther.
Der Fundbericht tiber eine scheusilige Chimare, die der Tiber I495 ans
I) Luthers Briefwechsel (Enders) III, 107. Brief Luthers an Spalatin vom 7 Marz
1521.
2) Vgl. Melanchthon an Spalatin und Michael Hummelberger 4 bzw. 12. Marz 1522
(CR. I, 565).
3) Briefwechsel (Enders) VI, 52.
4) Sign. 127-19 Th. 4 Vgl. Rud. Genee, Hans Sachs u. s. Zeit. (Leipzig 1894),
s. 485.
5) ed. Lambecius, Paris 1655 in: Georgii Codini ... excerpta de antiquitatibus
Constantinopolitanis p. 251 (vgl. Krumbacher, Geschichte d. byz. Lit.s, S. 628). Die an-
deren Orakelbilder ben1itzt die Bologneser Ausgabe ebenfalls.
6) Ob nicht die mit der Beischrift .,Lutherus" versehene GOtzenstatuette mit Sichel
(Abb. 143) Saturn (zwischen Jupiter und Sol?) ist?
522
Heidnisch-antike Weissagung in Wort u11d Bild zu Luthers Zeiten
Ufer geworfen haben soil (Abb. 145 a) und iiber die Mil3geburt einer deut-
* schen Kuh 1523 in Sachsen (Abb. 145 h) wird durch politische Ausdeutung
zu einer Angriffswaffe von ungehemmter Derbheit.I)
III. DIE WEISSAGUNG DURCH ANGEWANDTE HELLENI-
STISCHE KOSMOLOGIE IM ZEITALTER LUTHERS IM ZUSAM-
MENHANG MIT DER WIEDERBELEBUNG DER ANTIKE IM
DEUTSCHEN HUMANISMUS: ORIENTALISCHE VERMITTLER
UND QUELLEN
Luther im teratologischen und astrologischen Ideenkreise
der Gelehrten und Kiinstler a us der Umgebung Maximilians I.:
Weissagende Monstra von Sebastian Brant bis Diirer. -
Babylonische Praktiken.
Solche fliegende Blatter oder Einzelschriften iiber Monstra sind
gleichsam herausgerissene Blatter aus der groBen, im Geiste echt antiken,
annalistischen Prodigien-Sammlung
2
), wie sie im 16. Jahrhundert der ge-
lehrte Lycosthenes
3
), der ja auch der Herausgeber des illustrierten
Julius Obsequens') war, gesammelt hat. Hier finden sich wirklich sowohl
der Papstesel wie auch das Monchskalb
6
) wieder; aber neben dem
Papstesel - das ist quellengeschichtlich weithin aufkliirend - noch
andere Monstra zur Epoche Maximilians, wie sie dementsprechend tat-
siichlich in zeitgenossischen Bildern und Texten aus dem niichsten geisti-
gen Umkreise des Kaisers z. B. durch Brant, Mennel
6
), Griinpeck und
Diirer erhalten sind. DaB aber Luther eben diese Monstra, und zwar in
ihrer historischen Zusammengehorigkeit unter dem EinfluB der deu t-
I) Vgl. Jul. Kostlin, Martin Luther, 5 Auf!. ed. Gust. Kawerau (Berlin I903).I.,
s. 646.
2) So bewertet Luther auch das Erscheinen eines gestrandeten Wals zu Haarlem
im Brief an Speratus vom 13. Juni 1522 (Enders III, 397): oHoc monstrum habent ex
antiquis exemplis (also ausdriickliche Berufung auf die Antike) pro certo irae
signo>>) vgl. Grisar, Luther II, 120).- Vgl. weiter den Brief vom 23. Mai 1525 an Job. Rii-
hel (Erlanger Ausg. 53 Bd., S. 304, vgl. Enders V, 178): .. Das Zeichen seines (des Kur-
fiirsten Friedrichs des Weisen) Todes war ein Regenbogen, den wir, Philips und ich,
sahen ... und ein Kind allhie zu Wittemberg ohne H!l.upt geboren, und noch eins mit
umbgekehrten FiiBen."
3) Lycosthenes, Conrad (eig. Wolffhardt aus Ruiiach im OberelsaB, 1518-1561),
Prodigiorum ac ostentorum chronicon (Basileae 1557).
4) Julius Obsequens, Prodigiorum Liber, nunc demum per Conr. Lycosthenem
restitutus (Basileae 1552).
5) a. a. 0. S. CCCCLX bzw. CCCCLXXIIJ.
6) Der Hofhistoriker Jakob Menne I (vgl. Cod. Vind. Palat. 4417 *) stellte eine
derartige Wundersammlung als Begleiterscheinung des weltgeschichtlichen Ablaufs schon
im Jahre 1503 fiir den Kaiser zusammen. Hier offnet sich der Weg, der zu Wolfs Lectiones
memorabiles fi.ihrt (s. u.).
Prodigienglaubs 523
schen Fr iihrenaissance der damonischen An tike wohl als anti-
kischer Augur auffaBt, sie zugleich jedoch christlich-eschatologisch um-
deutet im AnschluB an jenen Spruch des Hauses Elia, zeigt uns iiber-
raschend deutlich eine Stelle aus seiner ,Chronica deudsch".
1
) Zur
Periode I500-I5IO (5460-5470 ,von anfang der welt") heiBt es: ,Eine
newe kranckheit f die Frantzosen I von etlichen aber I die Hispanische
seuche genant I komet auff I Vnd wie man sagt I sie ist aus den newge-
fundenen Jnsulen in Occidente I in Europam gebracht. Ist eins von den
groBen Zeichen vor dem Jiingsten tage. Vnd vnter diesem Maximiliano
sind im himel wunderbarliche zeichen I vnd derselben viel I geschehen I
dazu auch auff erden I vnd in wassern I von welchen Christus sagt I Es
werden grosse zeichen sein etc. Also I das von keiner zeit gelesen wird I
darin mehr vnd groBere zugleich geschehen weren I Die vns gewisse
hoffnung geben I das der selige tag hart fur der t h ~ r sey."
Ein Blatt wie das von Griinpeck
2
), auf dem sich eine Gruppe von
Monstrositaten aus der Zeit Maximilians (der- bildnisgetreu dargestellt
- als Zuschauer dabeisteht) vereinigt vorfinden, konnte Luther dabei
unmittelbar als Grundlage gedient haben.
Freilich blieben die auf die Welt gerichteten Divinationskiinste der
Menschen bei Luther trotz allem doch nur ein untergeordnetes Hilfs-
mittel, der hochsten Weissagungsform gegeniiber, dem von innen beru-
fenen und religios erlebten Prophetentum, wie er es seinen Feinden in
Augenblicken hochster Gefahr entgegensetzte: ,weil jch der Deudschen
Prophet bin (Denn solchen hoffertigen namen mus jch mir hinfurt selbs
zu messen, meinen Papisten und Eseln zur lust und gefallen)." So sprach
er 1531 in der ,Warnung an seine lieben Deutschen", als er den Zag-
haften Mut zum Widerstand gegen die kaiserliche Dbergrifflichkeit ein-
floBen muBte.
Die spatere protestantische Geschichtschreibung war in denLectiones
memorabiles des Johannes Wolf3) freilich doch noch so tief und heidnisch
in die aberglaubisch verehrende Bewertung der Monstra versunken, daB
sie die Weltgeschichte gleichsam auf Schienen ablaufen laBt, an denen
die Weltmirakel wie Warterhauschen stehen.
Im Zeitalter des deutschen Humanismus fiihrte nun von dieser weis-
sagenden Bilderpraktik, die man hochstens als ein religionswissenschaft-
I) Zit. nach der Ausgabe Wittenberg. Hans Lufft (1.559).
z) In einem Codex von 1502 der Innsbrucker Univ.-Bibl. Vgl. Beschr. Verz. d. ill.
Handschr. in Osterr., herausgeg. von Fr. Wickhoff. I. Bd.: Herm. Jul. Hermann, Die ill.
Handschr. in Tirol (Leipzig 1905), Nr. 314. Abb. ebda. S. 194.
3) Lectiones memorabiles, (Lauingen 16oo). I. Bd. 1012 Seiten; II. Bd., der sich auf
das 16. Jahrh. bezieht, 1074 Seiten- die umfangreichste und kirchengeschichtlich wert-
vollste Universalhistorie dieser Art.
Warburg, Gesammelte Schriften Bd.2
34
1-Ieidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild ztt Luthers Zeiten
lich oder volkskundlich bemerkenswertes 'Oberlebsel anzusehen gewohnt
ist, das zwar mit Bildern hantiert, aber mit Kunst nichts zu tun hat,
doch ein Weg zum Kunstwerk und zur graBen Kunst eines Albrecht
Diirer. Seine Sch6pfungen wurzeln teilweise so tief in diesem Urmutter-
boden heidnisch-kosmologischer GHiubigkeit, daB uns ohne deren Kennt-
nis z. B. der innere Zugang zum Kupferstich der ,Melencolia. I", die
man als die reifste, geheimnisvolle Frucht der maximilianeischen kosmo-
logischen Kultur bezeichnen kann, verschlossen bleibt.
Daher ftihren uns auch die Maximilians-Wunder, wie sie Luther
geschichtlich spater verwertet hat, schon zu den Friihwerken Diirers,
die zugleich einen Beitrag fiir seine Vertrautheit mit der ,modernen",
* wiedererweckten antiken Weissagungspraktik liefern.
Der Typus eines Mannes, der an der Franzosen-Krankheit litt, von
Durer zu einer medizinischen Weissagung des Uisenius aus dem Jahre
1496 fiir den Holzschnitt gezeichnet, geh6rt ganz in den Bannkreis
ebensosehr monstrologisch wie astrologisch-fiirchtender Weissagung: Wir
sind zugleich in der Sphaere der groBen Konjunktion Lichtenbergers
vom Jahre 1484 (Abb. 146).
Das obere Drittel des Raumes nimmt eine Himmelssphare ein, in
der man die Zahl 1484 erblickt. Sieht man sich nun den Skorpion im
Zodiakus genauer an, so sind auf ihm die gefa.hrlichen Planeten ver-
sammelt: wir sind wieder in der unheimlichen Sphare der groBen Kon-
junktion von 1484, wie sie Paul von Middelburg sternwissenschaftlich
in der Prognostica bearbeitete, denn der lnhalt des Buches deckt sich -
ich verweise auf Sudhoffl), der dies zuerst festgestellt hat- mit dem
Kapitel der Prognostica, das sich mit den medizinischen Folgen der
graBen Konjunktion befaBt.
Auch die zunachst sehr wenig poiitisch oder ominos aussehende
MiBgeburt einer Sau (Abb. 147) zeigt, wie Diirer zur selben Zeit auch
in der Region der wahrsagenden Monstra zu Hause war. Der Kupferstich
stellt die Wunder-Sau von Landser dar, die 1496 im Sundgau geworfen
wurde.
2
) Nur einen Kopf hatte das Scheusal, aber zwei Leiber und acht
FiiBe. Man hat nachgewiesen, daB Diirer als Vorlage ein fliegendes Blatt
benutzte (Abb. 148), das Sebastian Brants), der gelehrte Friihhumanist,
1496 lateinisch, und deutsch veroffentlichte. Es ist, wie noch andere
1) Stud. z. Gesch. d. Med. Heft 9 (Leipzig 1912) und: Graphische und typogra-
phische Erstlinge (Alte Meister der Med. u. Naturkunde 4, Miinchen 1912).
2) E. Major, Diirers Kupferstich .,Die wunderbare Sau von Landser" im ElsaB,
Monatshefte fiir Kunstwissenschaft VI. (1913), S. 327-330, Taf. Sr. Sie ist auch auf
Griinpecks Sammelblatt zu sehen. Siehe o. S. 523.
3) Flugbl!itter des Sebastian Brant, hrsgeg. v. Paul Heitz (Jahresgaben d. Ges.
f. els11B. Lit. III), (StraBburg 1915). Blatt 10 und rr.
AI> b. r 46. \Vcissagung des lJisenius mit Holz.,;cltnitt von I Hirer,
Einblattdruck, Niirnlwrg 149f' ( zu Seite 52-f)
Tafel LXXXIII
Tafel LXXXIV
Abb. q;. Diirer, Sau von Landser, Kupfcrstich B. <J.'i (zu Seite 524).
M onslra bei Duret'
ahnliche Blatter, Kaiser Maximilian I. gewidmet und unterstiitzt dessen
Politik durch Weissagungen. Im Texte tritt Brant - das ist fiir den hier
entwickelten Ideengang bedeutsam - ganz bewuBt als antiker Augur
auf, er stellt seine politische Ausdeutung unter den Schutz der vergili-
schen, dem Aeneas geweissagten Wundersau:
Was wil diB suw vns bringen doch
Gdacht in mir eygentlich das noch
Das man durch Suw in der geschicht
LiBt / kunfftiger ding syn bericht
Als die Su die Eneas fandt
Mit jungen an des Tybers sandt ...
Es ist wirklich ein ,Naturgreuel-Extrablatt" im Dienste der Tages-
politik. Sebastian Brant hatte sich fiir seine Kiinste auf noch viel altere
und ehrwiirdigere Ahnen berufen konnen; sein ,aktuelles" Greuel-
blatt war ebenso in Keilschrift auf assyrischen Tontafeln zu lesen. Wir
wissen, daB etwa urn die Mitte des 7 Jahrhunderts v. Chr. dem Konig
Asarhaddon der Wahrsagepriester Nergal-etir von der MiBgeburt eines
Schweines mit acht FiiBen und zwei Schwanzen berkhtet; er prophe-
zeite daraus, daB der Furst das Konigtum und die Herrschaftsmacht
ergreifen wird und fiigt hinzu, der Schlachter Uddanu habe das Tier
eingesalzen, wohl urn es fiir das Archiv des koniglichen Hauses auf-
zubewahren.1)
Es ist wissenschaftlich Hingst festgestellt, daB die romischen Wahr-
sagekiinste durch Etrurien unmittelbar mit der babylonischen Wahr-
sagetechnik zusammenhangen. DaB a her die Verbindung von Asarhaddon
zu Kaiser Maximilian tiber 2000 Jahre sich so lebendig hielt, liegt neben
der Sorgfalt der gelehrten Antiquare vor allem an dem inneren urmensch-
lichen Zwang zu mythologischer Verursachung. lndessen ist die "Ober- *
windung . des babylonischen Geisteszustandes auf Diirers Stich doch
eigentlich schon vollzogen: Die Inschrift fehlt, Nergal-etir =Brant fin-
den keinen Raum mehr fiir ihre Weissagungsdeutung. Das naturwissen-
schaftliche Interesse an der Erscheinung fiihrt den Stichel.
l} Bruno Meillner, Babylonische ProdigienbUcher (in: Festschrift zur Jahrhundert-
feier der Univ. zu Breslau, Mitt. d. Schl. Ges. f. Volkskunde, hrsg. von Th. Siebs,
Bd. XIII/XIV, Breslau 19ll}, S. 256. -Morris Jastrow jr., Babylonian-Assyrian Birth-
Omens and their cultural significance (Religionsgesch. Versuche und Vorarbeiten XIV, 5.
Giellen 1914}, S. 10; ebendort S. 73ff. 'iiber Lycosthenes.
Heidnisch-antil1e Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
Das arabische astrologische Handbuch ,Picatrix" und der
Planetenglauben bei Albrecht Durer: Saturn und Jupiter in
der ,Melencolia. I", in Lichtenbergers Prophezeiung und bei
Luther.
Wir verdanken es der entsagenden Gelehrsamkeit meines zu friih
verstorbenen Freundes Carl Giehlow
1
), wenn wir eine hellenistisch-astro-
logische, durch die Araber vermittelte Idee als einen gemeinsamen
Grundgedanken zwischen Diirers Melancholie (Abb. 149) und Lichten-
bergers Practica aufdecken konnen. Saturn und Jupiter in ihrer Gegen-
wirkung geben das verbindende Glied.
Zunachst ein nur auBerer Anhaltspunkt der ZusammengehOrigkeit:
Maximilian war IDit dem Geist Lichtenbergers schon dadurch vertraut,
daB dessen Quelle, jene Prognostica des Paul von Middelburg ihm ge-
widmet war. Und zu der Frage der Heilung der saturninischen Melan-
cholie Stellung zu nehmen, gab ihm auch rein auBerlich die Frage nach dem
Wesen seines mythischen Vorfahren, des agyptischen Hercules, iiber den
Peutinger ihm ein Gutachten im AnschluB an die Problemata des Aristote-
les erstattete, Veranlassung; in spateren Jahren
2
) aber muBte ihn eine be-
drohliche, ungiinstige Saturnstellung
3
), an der er, wie Tannstetter, der
behandelnde Arzt meint, auch wirklich starb
4
), beschaftigen. Aber ganz ab-
gesehen von diesen Voraussetzungen unmittelbarer, personlichster Bezie-
hungen, hat Giehlow den Nachweis gefiihrt, worauf denn zur Zeit Maxi-
milians sich die Heilmedizin gegen die saturninische Melancholie griindete.
Es gab nach der Lehre der antiken Arzte zwei Formen, eine schwere
und eine leichte Form der Melancholie; die schwere war auf die schwarze
Galle zuriickzufiihren, sie erzeugte maniakalische Zustande - das aber
war der Fall des rasenden Hercules. Der florentinische Philosoph und
Arzt Marsiglia Ficino schlug gegen sie ein gemischtes Verfahren von
seelischer, wissenschaftlich-medizinischer und von magischer Behandlung
vor
5
): Seine Mittel sind innere geistige Konzentra tion auf der einen
I) Dtirers Stich ,.Melencolia. I" und der maximilianische Humanistenkreis, in:
Mitteilungen d. Ges. f. vervielHl.lt. Kunst I903, S. 29{4I; I904, S. 6{18, 57{78. Der Neudruck
dieser Studie wird hoffentlich- wie versprochen- erfolgen [vgl. statt dessen Panofsky-
Saxl, Durers Melencolia I, Leipzig 1923).
2) Sieber seit ISIS, wahrscheinlich schon frtiher. Vgl. Edmund Weill, AlbrechtDtirers
geogr . astron. und astral. Tafeln (Jahrb. d. allerh. Kaiserhauses VII, I888, S. 220) und
dazu Giehlow a. a. 0, V, S. 59.
3) "Ober die feindliche Rolle des Saturn im Horoskop Maximilians vgl. Melanchthons
Brief an Camerarius, I3. Jan. I532 (CR. II, 563): *Meus frater amisit suum filium, puerum
elegantissimum ... Habet pater in quinto loco Saturnum, quem eadem loco habuit Maxi-
milianus, cuius quae fnerit domestica fortuna, non ignoras.t
4) Vgl. Giehlow a. a. 0. V, S. 59
5
5) ZusammengefaBt in oDe vita triplich, (Florenz 1489) u. o.
Abb. L ~ 8 . Wmici'ersau von Lant!ser,
Flugblatt des Sebastian Brant, q96 (zu Seite 524 f.).
Tafel LXXXV
Tafvl LXXX\' I
\I >I>, l.i'J, I ltJrt r, ",.J,n "il" i. i,;IIJ'I' r't" h !l 1
,fll .)..!(J, 52S Ulld
Saturn und jupiter auf Darers ,Melancholie"
Seite; durch diese kann der Melancholische seinen unfruchtbaren Trub-
sinn umgestalten zum menschlichen Genie. Andererseits ist, abgesehen
von rein medizinischen MaBregeln gegen die Verschleimung, den ,Pfnu-
sell", zu dieser Gallenumwandlung erforderlich, daB der giitige Planet
Jupiter dem gefahrlichen Saturn entgegenwirkt. Fehlt dieser in der wirk-
lichen Konstellation, so kann man sich doch diese gunstigere Kon-
junktion durch das magische Bild des Jupiter aneignen, fiirdas
nach der Lehre Agrippas auch dessen Zahlenquadrat eintreten kann.
Deshalb erblicken wir bei Durer in die Wand eingelassen das Zahlen-
quadrat des Jupiter (s. u.).
Giehlow, der auf so scharfsichtige und einfache Weise den Gedanken
der planetarischen Konjunktions-Heilmethode wider die Melancholie bei
den abendlandischen Okkultisten der Renaissance aufwies, scheute
schlieBlich doch davor zuruck, die letzte Folgerung a us seiner Entdeckung
zu ziehen. Er will die Zahlentafel des Jupiter bei Durer trotz Ficino und
Agrippa weniger als antisaturninisches Amulett, sondern ,in erster Linie"
als Symbol der genialen Erfindungskraft des saturninischen Menschen
gelten lassen.
Giehlow konnte die letzte, recht eigentlich aufklarende Folgerung
aus seiner eigenen Entdeckung nicht ziehen, weil ihm ein wesentlichstes
Dokument der Vorgeschichte dieser Ideen, das gleich zu besprechende
Buch ,Picatrix" als typischer Vertreter der arabischen "'Oberlieferung
spatantiker, astrologisch-magischer Praktik in seiner uberwaltigenden
Bedeutung fur die gesamte europaische Geheimwissenschaft, wie sie
Ficino und Agrippa betrieben, unbekannt war. In Erganzung von Gieh-
lows Forschungen konnte der Verfasser, unterstutzt von Printz, Grafe t
und Saxl
1
) den Nachweis fuhren, daB dieses Jateinisch geschriebene
Hauptwerk spatmittelalterlichen, kosmologischen Okkultismus, das unter
dem Namen ,Picatrix" geht, die "'Obersetzung eines Werkes ist, das ein'
Araber in Spanien im ro. Jahrhundert schriel:> und dem nur dieser
pseud-epigraphische Titel (rniBverstanden aus Hippokrates) vorgesetzt
wurde: Es ist die Gayat-al-hakim des Abu' 1-Kasim Maslarna b. Ahmad
ai-M agrrp.2)
Von dem Werke besaB auch Maximilian in seiner Bibliothek zwei
Handschriften, darunter eine illustrierte Prachthandschrift, von deren
1} Vgl. F. Sax!, Beitrll.ge zu einer Geschichte der Planetendarstellungen im Orient
und im Okzident, in: Der Islam, 3 Jg. (1912}, S. 151-177, und ders.: Verz. astrol. ...
Handschr. [Rom] (Sitzungsber. d. Heidelb. Akad. d. W., Philos.-hist. Kl. 1915, Abhdlg.
6-7}. (Heidelberg 1915), S. XIII.
2} Aus Cordova, gest. 398 A. H. (1007{8 n. C.) Vgl. Heinr. Suter, Die Mathematiker
und Astronomen der Araber und ihre Werke, Abhdlgn. z. Gesch. d. math. Wiss. X. Heft
(Leipzig 1900), S. 76.
528
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
Wesen uns eine Handschrift in Krakau
1
) eine Vorstellung zu machen
gestattet. Ficino verweist selbst in seinem Kapitel iiber die magischen
Bilder auf jene arabischen Vermittler hellenistisch-hermetischer Heil-
magie durch astrologische Amulette, wie sie die Steinbiicher das ganze
Mittelalter hindurch als ganz wesentlichen Teil der Iatro-Astrologie
lebendig erhielten. Zu diesen gehort aber vor allem der ,Picatrix"
2
},
der Ficino die Bildbeschreibungen der heilkraftigen Planetenfiguren ge-
liefert hat. In einer Handschrift in Rom, erganzt durch die Manuskripte
in Wien, Wolfenbiittel und Krakau
3
}, die auf ,Picatrix" zuriickgehen,
finden sich nun neben diesen entarteten, im Kern jedoch deutlich antiken
Figuren-Bildern eben jene Zahlentafeln mit genauer Anweisung des
Gebrauchs als direkt zusammengehOrig. Ficinos Bildermagie und Agrip-
pas Zahlenquadrate gehOren also als spate Auslaufer uralter, heidnischer
Praktik wesentlich zusammen, da sie eben in der durch die Araber
vermittelten hermetischen Heilmagie einheitlich wurzeln.
Weiterhin ware gegen Giehlows Zurlickhaltung einzuwenden, daB,
wenn der saturninische Mensch diese Zahlentafel mit ihren eigentiim-
lichen mathematischen Rhythmen gleichsam nur als Symbol seines Er-
finder-Genies zur Schau stellen sollte, er doch die Zahlentafel des Saturn
zeigen miiBte und nicht die des Jupiter. Denn diese erhalt jedenfalls
erst durch den Gedankenkreis der Iatro-Astrologie ihren eigentlichen Sinn
an dieser Stelle.
Der recht eigentlich schOpferische Akt, der Diirers ,Melencolia. I"
zum humanistischen Trostblatt wider Saturnfiirchtigkeit macht, kann
erst begriffen werden, wenn man diese magische Mythologik als
eigentliches Objekt der kiinstlerisch-vergeistigenden U mformung erkennt.
Aus dem kinderfressenden, finsteren Planetendamon, von dessen Kampf
im Kosmos mit einem anderen Planetenregenten das Schicksal der be-
schienenen Kreatur abhangt, wird bei Diirer durch humanisierende Meta-
morphose die plastische Verkorperung des denkenden Arbeitsmenschen.
DaB wir mit dieser Analyse der ,Melencolia. I" aus dem Geist der
Zeitgenossen heraus sprechen, dafiir findet der Verfasser nachtraglich
1) Cod. 793 DD III. 36. Eine Abb. daraus bei Saxl, Verz. [Rom] S. XIII [Edition
in Vorbereitung, vgl. S. 630 ff., 640, 657; Abb. I6o, r6r).
2) Ihn und den sogenannten 'Utarid (s. Ruska, Griechische Planetendarstellungen
in arabischen Steinbiichern, S. 24f. und Steinschneider, Arabische Lapidarien, Zeitschr.
d. D. M. G., Bd. 49, S. 267f., und ders., Zur Pseudepigraphischen Literatur, Nr. 3 der
ersten Sammlung der Wissenschaftlichen Bll!.tter aus dcr Vcitel Heine Ephraimschen Lehr-
anstalt (Berlin 1862), S. 31, 47, 83) zitiert Alfonso ausdriicklich als Gewlihrsmann in dem
oben (S. 515, Anm. 3) genannten Libro de los Ymagines (Reg. 1283) und im Lapidario.
3) Reg. 1283, Codex Vind. 5239 und Codex Guelferbit. 17. 8. Aug. 4. Im Text
zum Jupiterquadrat heil3t es im Vind. Bl. 147V: Et si quis portauerit earn qui sit infortu-
natus fortunabitur de bono in melius Eficiet.
Humanistische Umwandlung_d_er_S_at_u_rn..::.f_u_rc_h_tig"-k_e_it ___________ _____.:5::_2__::;9
eine BesHitigung bei Melanchthon, der Durer s Genie als erhabenste Form
der durch gunstige Gestirnstellung vergeistigten, eigentlich trubsinnigen
Melancholie auffaBt. Melanchthon sagt: De Melancholicis ante dictum
est, horum est mirifica uarietas. Primum ilia heroica Scipionis, uel
Augusti, uel Pomponij Attici, aut Dureri generosissima est, et uirtuti-
bus excellit omnis generis, regitur enim crasi temperata, et oritur a
fausto positu syderum.
1
) Diese Auffassung von Durers kunstlerischem
Genie konnte schlechthin als Unterschrift unter die ,Melencolia. I"
gesetzt werden. Denn wir erfahren aus einer zweiten Stelle von Melanch-
thon selbst, welchen Gestirnkraften er jene umwandelnde Macht zu-
schrieb. Als Ursache der erhabeneren Melancholie des Augustus bezeich-
net er dort das Zusammentreffen von Saturn und Jupiter in der
Waage: Multo generosior est melancholia, si coniunctione Saturni et
louis in libra temperetur, qualis uidetur Augusti melancholia fuisse.
2
}
Wir blicken jetzt in das Wesen des Erneuerungsprozesses, den wir
Renaissance nennen, hinein. Die klassische Antike beginnt sich wieder
gegen die hellenistisch-arabische aufzurichten. Die mumifizierte Acedia
des Mittelalters wird wiederbelebt durch die erneuerte Kenntnis der
antiken Schriftsteller. Denn des Aristoteles Problemata waren die
Grundlage des Gedankenganges bei Ficino ebensowohl vv-ie bei Melan-
chthon.
* *
Die Geschichte des Einflusses der Antike, betrachtet in dem Wandel
ihrer uberlieferten, verschollenen und wiederentdeckten Gotterbilder,
enthalt unaufgeschlossene Erkenntniswerte zu einer Geschichte der Be-
deutung der anthropomorphistischen Denkweise. In dem Dbergangs-
zeitalter der Friihrenaissance empfing die kosmologisch-heidnische Kau-
salitat ihre Auspragung in antikisierenden Gottersymbolen, von deren
Sattigung mit Menschenhaftigkeit die Art der Auseinandersetzung ab-
hangt, die vom religiosen Damonenenkult zur rein kunstlerisch-vergeistig-
ten Umgestaltung fuhrte.
Lichtenberger, Durer und Luther zeigen drei Phasen des Deutschen
im Kampf wider heidnisch-kosmologischen Fatalismus. Bei Lichte n-
berger (Abb. 150) erblicken wir zwei entartete, haJ3liche Sterndamonen
im Kampf urn die Oberherrschaft der menschlichen Schicksalslenkung;
ihr Objekt aber, der Mensch selbst, fehlt. Bei Durer dagegen werden
r) De anima fol. 82 rO. Die Stelle findet sich nur in den Ausgaben vor 1553, in den
spll.teren Ausgaben - die dem Verf. waren - fehlt sie. Das obige Zitat nach
der Ausg. Vitebergae (1548).
2) Ebda. fol. 76 vo.
530
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Lutkers Zeiten
sie umgeformt durch Wiedergeburt im Sinne einer klassischen Formen-
sprache1}, behalten jedoch aus ihrer hellenistisch-arabischen Wander-
schaft die Zeichen der schicksalhaften Gebundenheit.
Der kosmische Konflikt klingt als Vorgang im Innern des Menschen
selbst wieder. Die fratzenhaften Damon en sind verschwunden, der finstere
Triibsinn des Saturn ist humanistisch vergeistigt in menschliche Nach-
denklichkeit. Die tief in sich versunkene gefliigelte Melancholia sitzt, den
Kopf auf die Linke gestiitzt, einen Zirkel in der Rechten, inmitten tech-
nischer und mathematischer Gerate und Symbole; vor ihr liegt eine
Kugel. Zirkel und Kreis (und also auch die Kugel) sind nach der alten
O'bersetzung des Ficino
2
) das Denksymbol der Melancholie: ,Aber die
natiirlich ursach ist, das zu erfolgung und erlangung der weiBheit und
der lere, besunder der schweren Kunst, ist not das das gemiit gezogen
werd von den aussern dingen zu dem innern zu gleicher weiB als von dem
umblauff des zirkels hinzu zu dem mittelpuncten, centrum genannt, und
sich selbs dar zu fiigen und schicken." Sinnt sie auf ein Mittel gegen das
Unheil, das der Komet im Hintergrunde tiber dem Wasser droht? a) Oder
spielt schon die Sintflutangst hinein?
Bei Durer wird also der Saturndamon unschadlich gemacht durch
denkende Eigentatigkeit der angestra:bJten Kreatur; das Planetenkind
versucht sich durch eigene kontemplierende Tatigkeit dem mit der
'unedelst complex'") drohenden Fluch des damonischen Gestirns zu ent-
ziehen. Der Zirkel des Genies, kein niedriges Grabscheit (siehe Abb. I25:
die Saturnkinder), ist in der Hand der Melancholie. Der magisch ange-
rufene Jupiter kommt durch seine giitige und besanftigende Wirkung
auf den Saturn zu Hilfe. Die Errettung des Menschen durch diesen
I) Es sei hervorgehoben, dal3 in der ,.Melencolia. I" auch rein ,.formal" antike "Ober-
lieferung nachklingt. Das zeigt das Sternsymbol cines Dekans zu den Fischen im Stein-
buch des Alfonso (Lapidario del rey D. Alfonso X., (Madrid 1883), B. qqv). Dieses Dekan-
gestirnbild ist in Form und lnhalt die transponierte Figur cines liegenden FluLlgottes mit
aufgestOtztem Kopf, der eben als ,.Eridanos" (vgl. Abu Ma 'sar bei Boll, Sphaera S. 537)
als mitaufgehender Stern zum Zeichen der saturnbeherrschten, wasserigen Fische gehort.
Eine ganz :!.hnliche Stellung weist nun die mlinnliche antikc Zwickelfigur auf, die - mit
einer weiblichen zusammen - DOrer auf einem frlihen Holzschn_itt in einem Torbogen
angebracht hat (Die heil. Familie, Holzschnitt B. xoo. Abb. bei Val. Scherer, DUrer. Klass.
d. Kunst, Bd. IV, S. 189 [4. Aufl. 1928, S. 238]).
So darf man die ,.Melencolia" in Stoff und Form als Symbol der humanistischen
Renaissance ansprechen. Sie wiederbeseelt eine antike FluLlgott-Pose in hellenistischem
Geiste, hinter dem aber das neue Ideal der befreienden, bewu13ten Energie des modernen
* Arbeitsmenschen aufdlimmert.
2) Von MOlich, abgedruckt bei Giehlow a .. a. 0. (1903), S. 36.
3) Ein sonst unbekannter Komet wird bei der Geburt Maximilians als ausnahmsweise
gllickbringend erkHirt. Vgl. Giehlow a. a. 0. V., S. 6o.
4) Nach der Bezeichnung im regimen sanitatis Cod. Vind. 5486. Vgl. Giehlow
a. a. 0. I., S. 33
tf!lttd!ett red'ld) ntcin gefalccn f1enb SU bir1111le f'o1d)e f>(tl
cenOcbu !lilllf tleincr jlcrn
"'fllnfdlaffc l)il \llttyltjr be inc AJ
to!Cdlt Rue!Jtfe&nvcrnunlfc mlttlrmglanollemer
flarf1cytcrleudltcntllil in !len lllcgllcr warl}eyc,er
ll'td' me in vcrnuntfr vnb t>erflenllt11Uf llcr
nunlfcllnnbverf!cnlltnuf!,bewegemeUic
111ir Ole rc4n ftllll
Abb. 150. Jupiter und Saturn, aus derselben Ausgah_
Johann Lichtenbergers wic ;\bb. qo (zu Seitl' 52'J).
Abb. 151.
Schwl'rtformigl'r Komd aus l'inl'r franzibischl'n ll.tnds.-hrift
urn r 587, Hamburg, Bibliothek War burg (zu Seitl' 5.Bl
Tafel LXXXVII
Tafel LXXXVIII
Allb. 152. Aries, aus:
Zebclis Libc1 de inter-
pretatione diversorum
evcntuum secundum
Abb. 153.
Kurfiirst,
CS"
r!tntr n:mcr
tlllt f-llmoz
tllll nmmrodum
wcwnram wl
Ur/1 mrrrrt Ulll
aut b.mwm
illlt II!IIICiUnllllllll
JAudrrftwm nwtntr Wlltioo
td l1s rn ptlntt pzopr
4NNw (IUbtOJfllorr.hmn
n:i .\:'drno HIJ).)pHioTp.woz
.d:vllilll' ;wb iiu m
oomi llllllflil "Noiiit
1.d rona uri iocum\t
I
J\ll1rfll
lunam in 1 2 signis
zoriiaci, Berlin,-
Staatsbibl. Lat. 4 322
(zu Seite 532).
aus <hrselben
Handschrift
(zu Seite 532).
Bejreiung vom astrologischen Fatalismus
Gegenschein des Jupiter ist auf dem Bilde gewissermaBen schon erfolgt,
der Akt des damonischen Zweikampfes, wie er bei Lichtenberger vor
Augen steht, ist voriiber und die magische Zahlentafel hangt an der
Wand wie ein Ex-Voto zum Dank fiir Dienste des giitigen, siegreichen
Sterngenius.
Demgegeniiber ist Luther in seiner Ablehnung dieses mythologischen
Fatalismus ebenso ein Befreier wie er gegen die feindliche Nativitats-
stellerei vorgeht, und die Anerkennung des Anspruches auf die damo-
nische Dbermenschlichkeit der Gestirne wird von ihm als siindhafter
heidnischer Gotzendienst zuriickgewiesen.
Luther und D ii r e r treffen also his zu einem gewissen Punkte in
ihrem Kampfe gegen die Mythologik der groBen Konjunktion zusammen.
Wir stehen mit ihnen schon im Streite um die innere intellektuelle und
religiose Befreiung des modernen Menschen, freilich erst am Anfang:
denn wie Luther noch die kosmischen Monstra fiirchtet (und die antiken
Lamien dazu), so weiB sich auch die ,Melencolia" noch nicht vollig frei
von antiker Damonenfurcht. Ihr Haupt ziert nicht der Lorbeer, sondern
das Teukrion, die klassische Heilpflanze gegen die Melancholie
1
) und
sie schiitzt sich im Sinne Ficinos durch jenes magische Zahlenquadrat
vor dem bosartigen EinfluB des Saturn.
Wie eine spate Bilderscholie zur Ode des Horaz an Maecenas
2
) mutet
uns diese echt antike astrologische Idee an
te J ovis impio
tutela Saturno refulgens
eripuit volucrisque Fati
tardavit alas ..
Carion und Zebel.- Melanchthon und Alkindi.
Bei unserem Versuch, die verschollene WanderstraBe der antiken
astralen Gotterwelt freizulegen, fanden wir ein weiteres Kapitel aus
jenen Handbiichern angewandter Kosmologie, deren enzyklopadischer
Zusammenhalt in der Kultur des Hellenismus zu suchen ist. Wie der
,Picatrix" zu Maximilian und Durer fiihrt, so leitet das Weissagungsbuch
des Arabers Z e be I zu Carlon und Joachim I. Eine deutsche Dbersetzung
ist uns in einer Prachthandschrift erhalten (Berlin, PreuB. Staatsbibl.,
Lat. 4. 322). In richtiger Wiirdigung ihrer kiinstlerischen Kostbarkeit
1) Bitters!iBer Nachtschatten (Solanum dulcamara). Vgl. Paul Weber, Beitr. zu
Dfirers Weltanschauung (Stud. z. deutsch. Kunstgesch., Heft 23) (StraBburg xgoo), S. 83
und Ferd. Cohn, Die Pflanzen in der bild. Kunst (Deutsche Rundschau 25 [1898), I, 64).
2) II. 17. 22ff. Zuletzt behandelt von F. Boll, Sternenfreundschaft. Ein Horatianum
in .,Sokrates" V (tg17), S. I-Io u. 458.
532
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
gab 1914 der Verein der Freunde der Berliner Bibliothek eine Seite davon
in Farbendruck heraus.
1
) Es ist ein Vorzeichenbuch, zuriickgehend auf Abu
'Otman Sahl b. Bisr b. Habib b. Hani
2
), der urn die Mitte des 9 Jahr-
in Bagdad lebtei latinisiert wird er Ze bel der Araber genannt.
Die Bilder (vgl. Abb. 152) sind Illustrationen zu 42 Omina, die fiir jeden
Monat anders ausgelegt werden, z. B.: ,Wenn ein Hahn kraht, so be-
deutet das keine gut en neuen N achrichten, Aufstand im Volk und Furcht"
oder: ,Wenn das Auge zwizzert und vipert, dann gibt es gute und an-
genehme Nachrichten". - Diese Prachthandschrift war nun fiir den
brandenburgischen K u rf ii r s ten Joachim I. geschrieben, wie die
Wappen beweisen. Er ist auch wohl als Kurfiirst, wenn auch nicht portriit-
ahnlich, auf einer Seite abgebildet (Abb. 153). Das Buch erschien mehrfach
mit Kupferstichen En de des 16. J ahrhunderts. In einer Ausgabe (Prag 1592)
wird ausdriicklich gesagt, daB unser C arion eigenhiindig ein Exemplar
fiir den Kurfiirsten geschrieben habe, das nachher weiter verschenkt
worden sei. Das ist bei seiner vielseitigen Stellung als Magier und Hof-
astrolog Joachims- seit 1521, wie aus der Prognosticacio ersichtlich-
durchaus wahrscheinlich.
Johann Car ion ist bisher durchaus nicht nach Gebiihr gewiirdigt.
Nicht einmal sein Bildnis aus der Cranachschule war beachtet, obgleich
es sich in der PreuB. Staatsbibliothek befindet
3
) (Abb. 121). Der Verfasser
verdankt den Hinweis darauf schon seit langem Prof. Emil Jacobs (jetzt
in Freiburg i. Br.), der ihn auch zuerst auf den Zebel aufmerksam machte.
So sah also der biedere Schwabe aus, dessen Leibesfiille Luther ja in
einem Briefe sehr humorvoll als ,'Oberfracht fiir den Nachen Charons"
bespottelte. Prof. Otto Tschirch') hat 1906 die Vermutung ausgespro-
chen, daB Carlon ein griizisierter Joh. Niigelin gewesen ware, der 1514
an der Universitiit von Tiibingen immatrikuliert war. Diese Vermutung
findet ihre unzweideutige Bestiitigung durch das Wappen, auf dem drei
Nelken (Niigelein = Caryophyllon) ,sprechend" angegeben sind.- Aus
dem ernsthaften miinnlichen Gesicht und besonders aus dem Auge
Carions spricht kluge Beobachtungskraft; und man begreift, daB die
Hohenzollern und die Reformatoren ihn gleichermaBen als diplomatischen
V ermi ttler schii tzten.
I) Jahresgabe f. d. Ver. d. Freunde d. Kgl. Bibl., (1914). Das Rankenwerk und die
Figuren, die den Text einrahmen, sind wahrscheinlich von Schll.uffelein.
2) Vgl. Suter a. a. 0. S. 15 [s. unsere S. 632].
3) Vgl. jetzt fiber ein anderes Carion-Bild Max Friedeberg, Das Bildnis des Philo-
sophen Johannes Carion von Crispin Herranth, Hofmaler des Herzogs Albrecht von
PreuBen; Zs. f. bild. Kunst, 54 Jahrg., Heft 12 (Sept. 1919), S. 309-316.
4) Johannes Carion, Kurbrandenburgischer Hofastrolog, in: 36.(37 Jahresbericht
des Histor. Vereins zu Brandenburg a. d. H. (rgo6), S. 54--62.
johann Carion / Kometenfurcht 533
Luther hat ihn nach seinem Tode als Magier bezeichnetl) und auch
Reinhold
2
) nennt ihn ausdrticklich ,insignis necromanticus". Aber dieser
Verdacht der Magie hatte ja auch Melanchthon, wie aus seinem erwahnten
Briefe an Camerarius
3
) hervorgeht, nicht verhindert, ihn astrologisch
zu befragen, wie denn auch Camerarius 1536 das Urteil des historischen
Dr. Faustus tiber die politischeLagewissenwill, obgleichdieserin Witten-
berg bei Luther und Melanchthon als nekromantischer Schwindler in
Verruf war. Camerarius muBte ja sogar in Konkurrenz mit Dr. Faustus
den Welsem ein Horoskop ftir die Expedition nach Venezuela stellen,
was Dr. Faust besser gemacht zu haben scheint als Camerarius.
4
) In
unserem Zusammenhange gewinnt auch die von Kilian Leib
5
) bezeugte
A.uBerung des Dr. Faust aus dem Jahre 1528 besondere Bedeutung, daB
eine bestimmte Planetenkonjunktion (in diesem Faile Sonne und Ju-
piter) mit dem Auftreten von Propheten im engsten Zusammenhange
stande.
Melanchthon, Carion, Camerarius, Gauricus, Faust und Sebastian
Brant konnten zu einem geheimen Augurenbund ,Nergal-etir" gehort
haben. Denn auch in der Kometenlehre sind die Araber, die in dem
hellenistischen Erbe doch sicher babylonisches Ureigentum tiberliefem,
die Vermittler. Melanchthon fragt bei seinem Camerarius angstvoll an
6
),
ob der Komet auch nicht zur schwertformigen Klasse gehore, wie Plinius
sie aufstellte. Ftir das VerhaJ.tnis der Araber zur Antike und zum Abend-
land ist es charakteristisch, daB noch im Text zu einer franzosischen
Schwertkometen-Illustration (nach Plinius) von 1587 (vgl. Abb. 151) der
Araber Alkindi ausdriicklich als Quelle genannt wird.
Den Brief an Camerarius schrieb Melanchthon am 18. August, einen
Tag spater als den an Carlon, und am selben Tage teilte auch Luther dem
Wenceslaus Link die Erscheinung des Kometen mit. Er schreibt ihm
Naheres tiber die Richtung des Schweifes und zweifelt auch nicht daran,
daB er Ungliick bedeutet.?) - So versuchte Melanchthon durch eine
I) Brief an Jonas u. andere vom 26. Februar I540. Briefwechsel (Enders) XIII, 4
2) In der S. 498, Anm. 6 zit. Leipziger Handschr., fol. I09.
3) Vgl. Beil. A. II.
4) Vgl. Friedrich Kluge, Bunte Bl!l.tter (Freiburg I908), S. 7-10.
5) Vgl. Karl Schottenloher in der Riezler-Festschrift (Gotha 1913), S. 92f., und
Leybs ,.Griindliche Anzeygung" (I557), Bl. 140 selbst, die tiber Lichtenbergers Person-
lichkeit und astrologische Weltanschauung hochst Bemerkenswertes enth!l.lt.
6) Brief an Camerarius vom IS. 8. I53I (CR. II, 5I8f.): Vidimus cometen, qui per
dies amplius decem iam se ostendit in occasu Solstitiali ... Mihi quidem videtur minari his
nostris regionibus ... Quidam affirmant esse ex illo genere, quos vocat Plinius
Quaeso te ut mihi scribas, an apud vos etiam conspectus sit .. si tamen conspectus est,
describe diligenter, et quid iudicet Schonerus, significato.
7) Briefwechsel (Enders) IX, 61: Apud nos cometa ad occidentem in angulo apparet
(ut mea fert astronomia) tropici cancri et coluri aequinoctiorum, cujus cauda pertingit ad
534
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild z11 Luthe1's Zeiten
zweifache Vermenschlichung die Himmelserscheinung in Umfang und
Richtung zu erfassen. Der drohende Umfang lOst die Erinnerung an ein
geHihrliches Menschengerat, an das Schwert, aus und dem Schweif gibt
er als Zielrichtung das irdische Landgebiet seiner Partei. So kommt es,
daB Melanchthon durch seine mythenbildende Furchtsamkeit das Schwert
am Himmel fiirchtet, gerade als er dem Schwert der Reformation, dem
Landgrafen, hatte vertrauen sollen.
Apia n, der Astronom, hat freilich schon urn diese Zeit dem Kometen-
umfang das Diimonische genommen, indem er den Schweif in Beziehung
zur Sonne setzte. Aber erst Halley, indem er die GesetzmaBigkeit der
Kometenerscheinung feststellte, entzog sie anthropozentrischer Be-
schranktheit.
SCHLUSSWORT
Damit fiihrt die exegetische Rundreise wieder an den Ausgangspunkt,
den Kometenbrief Melanchthons, zuriick und zugleich zu einem Kuriosum
des heidnisch-antiken Aberglaubens, aus dem der Erkenntniswert fiir
die Geschichtsauffassung der Reformationszeit herauszuholen versucht
wurde. Wie die Himmelserscheinungen mensdJich umfal3t vv-urden, urn
ihre diimonische Macht wenigstens bildhaft zu begrenzen, so wurde ein
damonischer Mensch wie Luther verstirnt (und zwar, wie wir sahen,
schon bei Lebzeiten durch eine fast totemistische Verkniipfung seiner
Geburt mit einem Planetenpaar), urn fiir seine sonst unbegreifliche, iiber-
menschlich erscheinende Macht eine hohere, kosmische, gotterhaft be-
nannte GroBe als Ursache bildhaft zu verstehen.
Die Wiederbelebung der damonischen Antike vollzieht sich dabei,
wie wir sahen, durch eine Art polarer Funktion des einfiihlenden Bild-
gedachtnisses. Wir sind im Zeitalter des Faust, wo sich der moderne
Wissenschaftler- zwischen magischer Praktik und kosmologischer Mathe-
matik- den Denkraum der Besonnenheit zwischen sich und dem
Objekt zu erringen versuchte. Athen will eben immer wieder neu aus
Alexandrien zuriickerobert sein.
Unter diesem Gesichtspunkte sind die hier behandelten Bilder und
Worte - nur ein Bruchteil von dem, was zur Verfiigung hatte stehen
konnen - etwa als bisher ungelesene Urkunden zur tragischen Geschichte
der Denkfreiheit des modern en Europaers aufzufassen; es sollte zugleich
medium usque inter tropicum et ursae caudam. Nihil boni significat.- Noch viel deut-
licher in einem Brief an Spalatin vom 10. Okt. 1531 (a. a. 0. IX, ro8): Cometa mihi
cogitationes facit, tam Caesari, quam Ferdinando impendere mala, eo quod primo caudam
torsit ad aquilonem, deinde ad meridiem mutavit, quasi utrinque fratrem (?) significans.t
K ulturwissenschajtliche Bildergeschichte
535
an einer positiven Untersuchung aufgezeigt werden, wie sich bei einer
Verkniipfung von Kunstgeschichte und Religionswissenschaft die kul-
turwissenschaftliche Methode verbessern HiBt.
Die Unzuliinglichkeiten dieses Vorversuches kannte der Verfasser
selbst nur zu genau. Aber er meinte, daB das Andenken Useners und
Dieterichs von uns fordert, dem Problem, das uns kommandiert (wie
den Verfasser die Frage nach dem EinfluB der Antike) auch dann zu
gehorchen, wenn es uns in Gebiete schickt, die noch nicht urbar gemacht
sind. Mogen sich Kunstgeschichte und Religionswissenschaft, zwischen
denen noch phraseologisch iiberwuchertes Odland liegt, in klaren und
gelehrten Kopfen, denen mehr zu leisten vergonnt sein moge, als dem
Verfasser, im Laboratorium kulturwissenschaftlicher Bildge-
schich te an einem gemeinsamen Arbeitstisch zusammenfinden.
,Ein groBer Tell dessen, was man gewohnlich Aberglauben nennt,
ist aus einer falschen Anwendung der Mathematik entstanden; deswegen
ja auch der Name eines Mathematikers mit dem eines Wahnkiinstlers
und Astrologen gleich galt. Man erinnere sich der Signatur der Dinge,
der Chiromantie, der Punktierkunst, selbst des Hollenzwan_gs; aile
dieses Unwesen nimmt seinen wiisten Schein von der klarsten aller Wis-
senschaften, seine Verworrenheit von der exaktesten. Man hat daher
nichts fiir verderblicher zu halten, als daB man, wie in der neuern Zeit
abermals geschieht, die Mathematik aus der Vernunft- und Verstandes-
region, wo ihr Sitz ist, in die Region der Phantasie und Sinnlichkeit
freventlich heriiberzieht.
Dunklen Zeiten sind solche MiBgriffe nachzusehen; sie gehOren mit
zum Charakter. Denn eigentlich ergreift der Aberg!aube nur falsche
Mittel, urn ein wahres Bediirfnis zu befriedigen, und ist deswegen weder
so scheltenswert, als er gehalten wird, noch so s e l t ~ n in den sogenannten
aufgekliirten J ahrhunderten und bei aufgekliirten Menschen.
Denn wer kann sagen, daB er seine unerliiBlichen Bediirfnisse immer
auf eine reine, richtige, wahre, untadelhafte und vollstiindige Weise be-
friedige; daB er sich nicht neben dem ernstesten Tun und Leisten, wie mit
Glauben und Hoffnung, so auch mit Aberglauben und Wahn, Leichtsinn
und Vorurteil hinhalte." (Goethe, Materialien zur Geschichte der Far-
benlehre, Roger Bacon. Cottasche Jub.-Ausg. Bd. 40. S. I65).
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
BEILAGEA.
MELANCHTHON UND DIE ASTROLOGIE
I. DER BRIEF MELANCHTHONS AN CARlON "OBER DEN KOMETEN VON 1531
Adresse auf der AuBenseite, fol. zvo: Viro doctissimo D. I Johann,
Carioni 1 philosopho, amico J et conterraneo suo I Carissimo. I Zu eigen
handen I
fol. 1ro a ornare honestissimis laudibus conatus sum. Quid I assecutus
sim aliorum sit iudicium. I
Dictum Heliae extat non in Biblijs. sed apud / Rabinos, et est cele-
berrimum. Burgensis
1
} allegat, et disputat ex eo contra Judeos I quod
z} Die Stelle findet sich bei Paulus de. S. Maria gen. Burgensis in seinem 1434 voll-
endeten Scrutinium Scripturarum (Hain Io 762 ff.) in dcr Dist. III Cap. IIII. Die Distinctio
trligt die "Oberschrift: Distinctio tertia de scrutinio scripturarum circa tempus aduentus
christi an sitpraeteritum vel futurum et continet quatuor capitula.-Das Kapitel: Capitu-
lum. iiij. in quo ostenditur quod secundum omnes magistros seu doctores et expositores
famosiores iudeorum qui de tempore primi aduentus Christi determinando locuti sunt
idem aduentus iam transijt in praeteritum.
Der Text selbst lautet: ... Fuit alius vt ibidem habetur qui dicitur de domo helie
prophete qui posuit ibidem expresse scilicet in libro de ordine mundi quod per sex milia anno-
rum debebat mundus durare. quiquidem anni erant per tres partes diuidendi isto modo .
quia per duo milia annorum prima mundus erat quasi sub vacuo . per hoc designans
tempus ante legisdationem quod vocat vacuum. quia non erat aliquis populus sub lege
diuina . duo milia vero annorum sequencia vocat tempus legis. asserens quod hoc tempus
debebat fluere a datione legis usque ad messiam . duo vero milia tercia sen vltima asserit
esse sub messia. quia secundum cum ab aduentu messie vsque ad finem mundi debebant
fluere duo milia annorum . Constat autem quod iuxta computationem hebreorum que
in hijs regionibus hyspanie et vbique terrarum communiter tenetur a creatione mundi
vsque ad presentem annum domini . M.cccc.xxxij . fluxerunt quinque milia et centum et
nonaginta et duo anni. Vnde secundum predictum doctorem tempus aduentus Christi
a mille .c.xcij.annis transijt in praeteritum. Et sic babes tres principales de numero eorum
qui dicuntur thanayn.
Dem entsprechend heil3t es in der ,Chronica" Carious (zit. nach der Ausg. von
Wittenberg, Georg Ehaw s. a. Bl. B vo. f.): Der spruch des hauses Elia. Secbs tausent jar
ist die welt I vnd darnach wird sic zubrechen. Zwey tausent oed. Zwey tausent I das
gesetz. Zwey tausent I die zeit Christi. Vnd so die zeit nicht gantz erfullet wird I wird es
feilen vmb vnser sunde willen I wilche gros sind.
Das ist I zwey tausent jar sol die welt stehen oed I das ist one ein gefasset regiment
durch Gottes wort I Dar nach sol die beschneidung vnd das gesetz komen I vnd ein regi-
ment vnd Gottes dienst I durch Gottes wort von new geordnet werden I das sol auch
zwey tausend jar weren I Darnach sol Christus komen 1 vnd die zeit des Euangelij sol
auch bey zwey tausent jaren haben I doch werden etliche jar daran abgehen I Denn Gott
wird eilen zum ende I wie Christus spricht I Matthei .xxiiij., Wo diese zeit nicht verkurtzet
wti'rde 1 wurde nicmands selig.
In der lateinischen Ausgabe der Chronica, die durch Melanchthon erfolgte
(s. u.), heil3t es dann ausfti.hrlicher (zit. nach der Ausgabe: Chronicon Absolvtissimum ...
Jn quo non Carionis solum opus continetur, verum etiam alia multa ... Philippo Mc-
lanthone Avtore s. 1. 1560, p. 24sq.): TRADITIO DOMVS ELIAE. SEx millia annorum
Brief M elanchtkons an Carion 537
Messias apparuerit. Receptissima apud I Ebreos sentiencia est, et a me
posita 1 in principia tuae historiae [Carions Chronica), vtb omnibus I
fieret notissima et afferret commendationem I tuo operi. Tales locos
multosc dein I ceps admiscebo. vides autem prorsus esse I propheticam
vocem. Tam concinna temporum / distributio est. I
Historiam, vt spero, hac hyeme absoluemus I Nam hactenus fui
impeditus recognitione 1 meae Apologiae
1
), quam in certis locis I feci
meliorem. Sed vix credas quam I tenui valetudine vtar, consumor enim I
curls, et laboribus. I
Mea vxor, dei beneficia filiam enixa est, I cuius Thema tibi mitto,
non vt faciam I tibi negocium, video enim monacham fore I
a Cometen vidimus die bus plus octod. Tu 1 quid iudicas. videtur fol. 1vo
supra cancrum I constitisse occidit enim statim post solem, I et paulo
ante solem exoritur.e I Quod si ruberet, magis I me terreret. Haud dubie
principum I rmortem significat. Sed videtur I caudam vertere versusg
mundus, et deinde conflagratio. Duo millia inane. Duo millia Lex. Duo millia dies
Et propter peccata nostra, quae multa et magna sunt, deerunt anni, qui deerunt.
Hoc modo Elias de duratione generis humani vaticinatus est, et praecipuas muta-
tiones distinxit. Duos primos millenaries nominat Inane, quod simplicissime sic interpreter:
nondum homines procul dissitas regiones occupasse ante conditam Babyionem. Aiij dicunt,
nominari Inane, quia nondum certa politia constituta fuit, et nondum segregata
fuit Ecclesia a caeteris gentibus. Nondum etiam erant Imperia, qualia postea in Monarchiis
fuerunt. Sed quaecunque causa est, quare sic dixerit Elias, hoc non dubium est, primam
aetatem fuisse florentissimam, quia natura hominum minus languida fuit, quod ostendit
longaeuitas. Et fuit excellens decus, quod sapientissimi Senes, pleni diuinae lucis, simul
vixerunt, et de Deo, de creatione, de edita promissione testes fuerunt, et multi artes
inuenerunt et illustrarunt. Secundum tempus a Circumcisione numeratur, vsque ad natum
Messiam ex virgine, quod non multo minus duo bus millenariis continet. De tertia tempore
significat fore, vt non compleantur duo millenarij, quia nimium crescet impietas, propter
quam citius delebitur totum genus humanum: et Christus se palam ostendet in iudicio,
vt inquit: Propter electos dies illi breuiores erunt.
Distribuemus igitur Historiam in tres libros, iuxta dictum Eliae.
Uber QueUe und Herkunft des Spruches des Elias aus cer talmudischen Literatur
und dessen grundlegenden EinfluB auf die eschatologische Periodenlehre auch bei Luther
(in der Supputatio annorum mundi, wo er den Burgensis ausdriicklich zitiert) siehe
KOstlin-Kawerau, Martin Luther II. S. 589 und S. 690; ferner J. Kostlin, Ein Beitrag
zur Eschatalogie derReformationenin: Theol. Studien und Krit. Bd. LI (1878), S. 125-135.
- DaB Melanchthon sogar die hebrl!.ische QueUe des Spruches eigenhl!.ndig aufzeichnete,
entdeckte 0. Albrecht ebda. Bd. LXXX (1907), S. 567f., der ferner nachweist (ebda.
Bd. LXX (1897), S. 797.), daB Melanchthon- den Spruch des Elias mit der Weissagung
des Monches Johannes Hilten verkniipfend- diesen in unmittelbare Verkniipfung bringt
mit dem Versuch, die neue Zeit der Reformation als prophezeite Periode festzustellen.
Zur allgemeinen, bedeutsamen Frage der Mitarbeit Melanchthons an Carions Chro-
nica, die er ja auch spll.ter lateinisch als .,Chronicon Carionis" (s. o.) ausgestaltete, siehe
aufler H. Bretschneider, Melanchthon als Historiker (Progr. Insterburg 188o), S. 12ff.
auch E. Menke-Gliickert, Die Geschichtschreibung der Reformation und Gegenreformation
(Leipzig 1912), S. 23ff.
r) CR. z8, S. 39
Heidnisch-antike Weissagung in Woyt und Bild zu Luthef's Zeiten
poloniam. 1 Sed expecto tuum indicium. Amabo te I significa mihi
quid sencias. I
Nunc venia ad hodiernas lit eras. Si I scirem ali quid de nostrorum
aduersariorum 1 conatibus,h tatum tibi scriberem, I quidquid illud esset.
Nihil enim opus I est nost celare aduersariorum
1
) consilia, I magis pro-
dest nobis ea traducere. I
Nihil itaque certi audiui diu iam de I vllo apparatu, preter suspi-
ciones quas I concipiunt nostri propter ilium exiguum numerum I pedi-
tum qui sunt in Frisia. Fortasse I pretextu belli Danici, nos quoque
fol. zro adoriri lk cogitant. At Palatinus et Moguntinus I iam agunt de pacifica-
tione cumi nostris, etsi I ego spem pacis nullam habeo, moueor enim
non I solum astrologicis predictionibus sed etiam vaticiniism. 1 Hasfurd
predixit Regi christierno
2
) reditum hone I stum, Schepperus negat redi-
turum esse. Sed I me non mouet Schepperus. Sepe enim fallitur. I pre-
dixit item Hasfurd Landgrauio maximas vi I ctorias. Et quidam ciuis
Smalcaldensis I mihi notus habuit mirabile visum, den I his motibus
quod vaticinium plurimi I facio. Catastrophen satis mollem habet. I Sed
tamen significat perculsos terrore I aduersarios nostros illi Leoni cedere.
Quaedam I mulier in Kizingen de Ferdinanda f horribilia predixit,o quo-
modoP bellum I contra nos moturus sit, sed ipsi infoelix I In Belgico quae-
damq virgo Caesari I edam vaticinata est, quae tamen non satis I habeo
explorata. Omnino puto motum I aliquem fore. Et deum oro, vt ipse
guber I net, et det bonum exitum vtilem Ecclesiae I et reipublicae. Ego
ante annum laborabam I diligenter vt nobiscum pacem facerent. Quod. I
si fecissent, minus esset turbarum in Sue I uia, quae magna ex parte
iam amplectitur I Helueticam theologiam et licentiam. Ses Campegius I
cupit inuoluere et implicare Caesarem germanico 1 bello, vt vires eius
labefactent, et Campegij I consilium probant nonnulli odio nostri priuato. 1
Sed deus habet iustum oculum. Nos enim certe I nihil mali docuimus.
etr Iibera I uimus multas bonas mentes a multis I perniciosis erroribus.
Sabinus mittit tibi prefaci I onem
3
) meam de laudibus astronomiae et
Astra I logiae. de qua expecto quid sencias. Bene vale 1 donerstag post
Assumptionem b. 1531 I Remitto tibi literas (hierauf folgen
zwei his drei ausgestrichene Worter:). 1
Die mit* versehenen Noten enthalten von Melanchthons
Hand gestrichene Worte und Wortanfange des Textes. a Der
obere Blattrand ist beschnitten, daher fehlt der Anfang b ai* c su*
I) Carion wird eben zur Partei der Reformatoren gerechnet.
2) HaJ3furt wurde nach GUnther (vgl. ADB. XL. 9) zu Konig Christian berufen.
3) Zu Joh. de Sacro Busto? vgl. CR. II, 530; geschr. Aug. 1531.
Melanchthon an Carion und Camerarius
539
d 'plus octo' beschnitten, daher in der Lesung nicht ganz sicher e zuerst
Hoc I mihi, dann Na* f inte* g orien* h plan ices* k no*
1 nostri* m dazu setzte eine andere Hand ,tuis" n victotia* o sed*
p nos q mulier* r multos per* s Vielleicht bezogen sich diese
Worte auf Sabinus, da eine andere Hand fast darunter schrieb: Sabini
tuas.
Original, 2 FoliobHitter mit erhaltener Siegelabdruckstelle.t) Bei
dem ersten Blatt fehlt das oberste Stuck mit etwa 4-5 Zeilen auf
jeder Seite.
Konigsberg, Herzogliches Briefarchiv A. Z. 3. 35 I25 (II).
II. MELANCHTHON "OBER GAURICUS UND CARlON AN CAMERARIUS
Melanchthon, Opera. Vol. II. Sp. 6oo--6o2.
Nr. 1064. Ioach. Camerario. Epist. ad Camerar. p. 190. 29. Iun. 1532.
Viro optimo Ioachimo Camerario Bambergensi, amico suo summo,
S. D. Tuas literas accepi hodie, in quibus Genesin Regiam petis. Quod
autem de Gaurico significas, quale sit, non plane potui intelligere.
Aberat enim epistola illa, nescio cuius amici tui, quam te mittere ais
de illius sermonibus.ll) Id eo scribo, ut scias earn periisse, nisi consulto
retinuisti. Quicquid autem est, non valde moror, novimus enim totius
illius gentis ingenia et voluntates erga nos ....
Mitto tibi geneses eorum, quorum petiisti, ac alterius quidem
8
)
et altera circumfertur, sed Gauricus affirmabat hanc veram esse, si
recte memini. Mars erat in fovea, in eo catalogo, quem Cornelius Scep-
perus hifbebat. Neque hie multo aliter se habet.
Cation habet 't'ou xpo\l(wvoc;
4
), quae paululum ab hac differt, in qua
Saturn us et Mars sunt in Quinta, sed exemplum non habeo; misissem
enim alioqui. Postremo, ut etiam laeti aliquid scribam, vidi carmen
cuiusdam Itali, quem Gauricus dicebat fuisse Pontani praeceptorem
6
), t
in quo planetarum motus mirifice describuntur. In fine addit vati-
cinium de coniunctione quadam magna, in qua de his ecclesiasticis
discordiis satis clementer vaticinator, caetera quo pertineant, (.LIXV't'Lxrjc;
U.pyo\1
I} Siegel selbst nicht mehr vorhanden.
2) Gesprii.che in Niirnberg, wo Gauricus war?
3) Ferdinandi C. W. Nach glitiger Mitteilung von Prof. Flemming lautet jedoch die
Stelle im Original des Briefes (nach der Kollation von Nik. MUller) folgendermaBen:
Mitto tibi geneses Caroli et Fernandi ac Fernandi quidem et altera circumfertur, sed ...
4) TI)v Caroli (Flemming).
5) Bonincontri, De rebus coelestibus ed. Lucas Gauricus Ven. (1526).
Warburg, Gesammelte Schrlften Bd. 2 35
540
Heidnisch-antike Weissagung in Wot't und Bild zu Luthers Zeiten
Pontani praeceptor Laurentius Miniatensis.
Ast quoque quae nostris iam iam ventura sub annis
Est melior, nostrae legis vix pauca refringet.
Aspera quae nimium sacris et dura ferendis,
Et genus omne mali toilet, pompasque sacrorum,
Ac regem dabit innocuum, qui terminet orbem.
Hie reget Imperio populos, gentemque rebellem
Imperio subdet, toti et dominabitur orbi.
Philipp us.
BEILAGEB
LUTHER UND DIE KONSTLICHE UND NATORLICHE
WEISSAGUNG
* I. LUTHER GEGEN DIE ,.WISSENSCHAFT" DER ASTROLOGIE
Dr. Martin Luthers s!tmtliche Werke; E. A. Bd. 62, S. 322.
Da einer D. M. L. eine Nativitiit (wie mans nennet), zeigete, sprach
er: ,Es ist eine feine lustige Phantasei, und gefiillt der Vernunft wohl,
denn man gehet immer fein ordentlich von einer Linien zu andern.
Darumb ist die Art und Weise, NativWiten zu machen und auszurechnen
und dergleichen, dem Papstthum gleich, da die ausserlichen Ceremonien,
Gepriinge und Ordnung, der Vernunft wohl gefiillt, als, das geweihete
Wasser, Kerzen, Orgeln, Zimbeln, Singen, Lauten und Deuten. Es ist
aber gar keine rechte Wissenschaft und gewisse Erkenntniss, und die-
jenigen irren gar sehr, die a us diesem Dinge eine gewisse Kunst
1
) und
Erkenntnis mach en wollen, da doch keine nicht ist; denn es gehet nicht
aus der Natur der Astronomei, die eine Kunst ist; diess ist Menschen-
satzung.
Luthers Tischreden in der Mathesischen Sammlung. Hrsg. Ernst Kraker. S. 164, Nr. 259.
Ut sint in signa. 2. bis 7 August 154a.
'Deus intelligit certa signa, ut sunt eclipses solis et lunae, non ilia
incerta. Praeterea, signa heist nicht, ut ex iis divinemus. Hoc est huma-
num inventum.'
II. LUTHER GEGEN MELANCHTHONS STERNGLAUBEN
Luthers Tischreden in der Mathesischen Sammlung. Hrsg. Ernst Kraker. S. 164, Nr. 258.
De astralagia. 2. bis 7 August 154a.
'Nemo mihi persuadebit nee Paulus nee Angelus de caelo nedum
Philippus, ut credam astrologiae divinationibus quae toties fallunt, ut
1) Siehe aben S. 512 und Beil. B. V.
LutheY gegen die Astyologie 54 I
nihil sit incertius. Nam si etiam bis aut ter recte divinant, ea notant;
si fallunt, ea dissimulant.
Tum qui dam: ,Domine Doctor, quomodo est solvendum hoc argu-
mentum: Divinatio est in medicina, ergo etiam est in astrologia ?"
,Medici, inquit, habent certa signa ex elementis et experientia et saepe
tangunt rem, etiamsi aliquando fallunt; sed astrologi saepissime fallunt,
raro veri sunt."
Ebda. S. 124, Nr. 156. 21. Mai bis u. Juni 1540.
Ego dixi: ,Foris nihil habent argumenti pro astrologia nisi autori-
tatem Philippi." - Tum Doctor: ,Ego saepe confutavi Philippum ita
evidenter, ut diceret: ,Haec quidem vis est I" Et confessit, esse scientiam,
sed quam ipsi non teneant. Quare ego sum contentus, si non tenent
earn artem; so la.B ich in damit spilen. Y..ihi nemo persuadebit, nam
ego facile possum evertere ipsorum experientiam incertissimam. Saltern
observant, quae consentiunt; quae fallunt, praetereunt. Es mag einer
so lang werffen, er wirfft auch ein Venerem
1
), sed casu fit. Es ist ein
dreck mit irer kunst. Seine
2
) kinder haben aile lunam combustam l'
8
)
Ebda. S. 177. Nr. 292. Astrologia. 7 bis 24. August 1540.
'Dominus Philippus, inquit Doctor, der hielt mich zu Schmalkalden')
ein tag auf mit seiner heilosen und schebichten astroiogia, quia erat
novilunium.
5
) Sic etiam wolt er ein mahl nicht uber die Elb faren in
novilunio. Et tamen nos sum us domini stellarum.'
III. LUTHERS NATIVITAT
I. Seine Geburtstagsplaneten.
Sol.
Luthers Tischreden in der Mathesischen Sammlung. Hrsg. Ernst Kroker. S. 303, Nr. 599
Magna molestia regere. \X/inter von 1542 auf 43
'Im haus ist nur ein knecht der herr . . . . . . . . . . So hats das an-
sehen mit den regenten auch. Es scheint, als wer es was kostlichs;
wenn mans aber ansehet, so sihet man, was es ist. Ich regire nicht gem.
Es giebts meine natur nicht.'
I) Venus, im Wurfelspiel der gliicklichste Wurf, bei dem aile Wiirfel verschiedne
Zahlen zeigen.
2) Melanchthons.
3) Combustus dicitur planeta, cum a sole plus minutis 16. distat, minus vero me-
dietate sui orbis. J. Garcaeus, Astrologiae method us 399
4) 1537, als Luther wegen seiner schweren Krankheit abreisen wollte.
5) Irrt sich Luther bier? Es war wohl eine andere Konstellation, die Melanchthons
Bedenken erregte. Luther reiste am 26. Februar 1537 von Schmalkalden ab, der Neumond
aber war auf den 14. Februar gefallen. Doch scheinen auch Bugenhagen und Myconius
vom Neumond = 25. Februar gesprochen zu haben. Vgl. Keil, Luthers merkwiirdige
Lebens-Umsti!.nde (Leipzig 1764), 3, 101.
35*
542
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
Tum Dominus Philippus: ,Ir habt [solem in nativitate]".
1
) Doctor:
'Ei, ich frag nicht nach euer astrologia! Ich kenne mein natur und erfar
es. Staupitzius sole bat hanc sententiam cant. 8: , Vinea mea coram
me est", sic interpretari: ,Gott hats regiment zu sich genumen, das
nicht iderman stoltzirn mocht." .. .'
Saturn.
D. Martin Luthers Werke. W. A. Tischreden, Bd. III, S. 193.
Nr. 3148. 26. bis 31. Mai 1532.
Ego Martinus Luther sum infelicissimis astris natus, fortassis sub
Saturno. Was man mir thun vnd machen soU, kan nimermehr fertig
werden; schneider, schuster, buchpinder, mein weib verzihen mich auffs
lengste.
2. Luther und die Nativitatspolitik im AnschluB an Johann
Lich ten bergers Prophezei ung.
Luthers Tischreden in der Mathesischen Sammlung. Hrsg. Ernst Kroker. S. 320, Nr. 625.
Heydenreich, Frfihjahr 1543.
Tum quidam: ,Domine Doctor, multi astrologi in vestra genitura
consentiunt, constellationes vestrae nativitatis ostendere, vos mutatio-
nem magnam allaturum." Tum Doctor: 'Nullus est certus de nativitatis
tempore, denn Philippus et ego sein der sachen umb ein jar nicht eins.
Pro secundo, putatis bane causam et meum negotium positum esse sub
vestra arte incerta ? 0 nein, es ist ein ander ding! Das ist allein Gottes
werck. Dazu solt ir mich niemer mer bereden !'
Valerius Herberger, Gloria Lutheri, Leipzig 1612 (S. 94).
Vmbs Jahr Christi 1483. hat Johan Hilden zu seinen Munchen
gesaget: Mercket das Jahr 1516. da wird einer kommen I der mich
vnd aile die I welchen jhr habt vnrecht gethan I wird rechnen. Eben
vmb dieselbe zeit hat auch gelebet Johan Lichtenberger 1 welcher den
Herrn Lutherum vnnd ein klein Mannlein hinter jhm 1 welchs jhm zu
seinem vorhaben sehr dienstlich seyn solte (das ist Philippus Melanchthon
gewesen) gemahlet hat f wie droben condone prima gedacht worden.
r) Text: solemnitatem; Math. N.: solennitatem, was :USsche in solennium korrigiert,
mir nicht recht verstll.ndlich; FB.: .,solem inne". Die Oberlieferung scheint mir auf ein
solem in nativitate der Vorlage hinzuweisen (Kroker).- Diese Konjektur Krokers wird
aufs einleuchtendste besta.tigt durch die Lehre von der Planeten-Kindschaft, da eben die
Sonne die Regenten hervorbringt und beherrscht. Vgl. Hauber a. a. 0. S. 131ff.
Luther uber seine Nativitiit
3 Luther und Cardanus.
Der Begleittext der Cardanus-NativiHi.t.
Cardanus, Hieronymus. Libelli dvo ... item geniturae LXVII. (Niirnberg 1543).
fol. N 1vvo.
543
HAnc ueram genituram Lutheri, non earn quae sub anno r484
publice circumfertur
1
), esse scito. Nee tanto negotio minor genitura
debetur, aut tali geniturae minor euentus. Existimo autem non intern-
gentes huius artis fundamenta, earn corrupisse: nam nee ilia robore huic
aequalis est, nee si damnare uelis, deest hie quod possis accusare. Nam
Mars, Venus, Iupiterque, iuxta uirginis spicam coeunt ad coeli imum
ad unguem, ut ex horum conspiratione regia quaedam potestas decer-
natur, sine sceptro: sunt enim erraticae sub terra. Porro quod ad religio-
nem pertineat, iam saepius adeo dictum est, propter spicam uirginis
2
), *
ut repetere pigeat. Incredibile igitur quantum augmenti breui tempore
habuerit hoc dogma: nam Germaniae maximam partem adegit, Angliam
totam, multasque alias regiones, cum adhuc uiuat, nee ulla est prouincia
ab huius sectatoribus immunis, praeter Hispanias. Feruet mundus huius
schismate, quod, quia Martem admixtum habet & caudam, soluitur
in seipso, infinitaque reddit capita, ut si nihil aliud errorem conuincat,
multitude ipsa opinionum ostendere tum possit, cum ueritas una tantum
sit, plurimos necessario aberrare. Porro firmitatem dogmatis Sol & Sa-
turnus cum lance meridionali
3
), in loco futurae coniunctionis magnae
ostendunt, cum diu trigonus ille iam dominaretur. At Luna iuxta ascen-
dens, longitudinem decernit uitae: uerum cum Soli Saturnus adiungatur,
pro tanto rerum motu, nullam dignitatem decernit.
Luther gegen Cardanus.
Dr. Martin Luthers sl\mtliche Werke (1543); E. A. Bd. 62, S. 321.
D. M. L. ward seine Nativitat, Ciceronis und vieler Andern zu
Niirnberg gedruckt bracht
4
); da sagt er: ,Ich halte nichts davon, eigene
ihnen gar nichts zu, aber gerne wollt ich, daB sie mir dieB Argument
solvireten: Esau und Jacob sind von einem Vater und einer Mutter,
auf eine Zeit, und unter gleichem Gestirn geborn, und doch gar wider-
wartiger Natur, Art und Sinn. Summa, was von Gott geschJcht, und
sein Werk ist, das soli man dem Gestirn nicht zuschreiben. Ah, der
1) Handschriftlich verbreitete des Gauricns, dessen Tractatus erst 1552 gedruckt
wurde.
2) Nach Abii Ma'sar.
3) Lanx meridionalis, d. h. die sudliche Krone ('Bettlerschussel', bei den Arabern),
zunl!.chst dem Skorpion.
4) Vgl. Anm. 4 S. 503.
544
Heidnisch-antike Weissagung in Wot't und Bild zu Luthefs Zeitlin
Himmel fraget nach dem nicht, wie auch UilSer Herr Gott nach dem
Himmel nicht fraget. Die rechte christliche Religion confutirt und wider-
legt solche Mahrlin und Fabelwerk allzumal.
IV. DIE SONDFLUT-PANIK VON 1524
Dr. Martin Luthers Wcrke E. A. Bd. 62, S. 327f.:
D. M. L. sagte von der Narrheit der Mathematicorum und Astro-
logorum, der Sternkiicker, ,die von einer Siindfluth oder grossem Ge-
wasser batten gesagt, so Anno 1524 kommen sollte, das doch nicht ge-
schach; sondern das folgende 25. Jahr stunden die Bauren auf, und
wurden aufriihrrisch. Davon sagte kein Astrologus nicht ein Wort."
Er redete a her vom Biirgermeister Hohndorf: ,derselbe liess ibm ein
Viertel Bier in sein Haus hinauf ziehen, wollte da warten auf die Sind-
fluth, gleich als wtirde er nicht zu trinken haben, wenn sie kame. Aber
zur Zeit des Zorns war ein Conjunctio, die hie3 Sunde und Gottes Zorn,
das war ein ander Conjunction, denn die im 24. Jahre."
V. LUTHER 0BER DIE WEISSAGUNG AUS NATURWUNDERN
Dr. Martin Luthers Werke E. A. Bd. 62, S. 327:
.... denn Gott hat sie geschaffen und an das Firmament gesetzet
und geheftet, daB sie das Erdreich erleuchten, das ist, frohlich sollen
machen, und gute Zeichen sein der Jahre und Zeiten ..... Sie aber,
die Sternkiicker, und die a us dem Gestirn wollen wahrsagen und ver-
kiindigen, wie es einem gehen soU, erdichten, dass sie die Erde ver-
finstern und betriiben und schadlich sein. Denn aile Creaturen Gottes
sind gut, und von Gott geschaffen, nur zum guten Brauch. Aber der
Mensch machet sie bose mit seinem MiBbrauchen. Und es sind Zeichen,
nicht Monstra, Ungeheuer. Die Finsternisse sind Ungeheuer und Monstra,
gleichwie MiBgeburten."
Dr. Martin Luthers Werke E. A. Bd. 62, S. 319f.:
Am 8. Decembris 1542 hatte einer von Minkwitz eine Declamation
offentlich in der Schule, darinnen er lobete die Astronomiam und Stern-
kunst. Da nun Doctor Martin Luthern solches angezeiget ward, wie
er diesen Spruch Jeremia am zehenten widerlegt hatte: lhr sollt euch
nicht fiirchten fiir den Zeichen des Himmels tc., gleich als ware dieser
Spruch nicht wider die Astrologiam, sondern redte nur von den Bildern
der Heiden; sprach der D.: ,Spriiche kann man wohl confutiren, wider-
legen, aber nicht erlegen und niederlegen. Dieser Spruch redet von allen
Zeichen am Himmel, auf Erden und im Meer, wie auch Moses thut. Denn
die Heiden waren nicht so narrisch, daB sie sich vor Sonn und Monden
gefurcht batten, sondern fur den Wunderzeichen und ungeheuren Ge-
Luther iiber Wunderzeichen
54 5
sichten, Portenten und Monstris, dafur furchten sie sich, und ehreten
sie. Zudem, so ist Astrologia keine Kunst, denn sie hat keine principia
und demonstrationes, darauf man gewiB, unwankend fuBen und griin-
den konnte; ...
BEILAGEC
VORREDEN UND TEXTPROBEN AUS: DIE WEISSAGUNGE
JOHANNIS LICHTENBERGERS
deudsch I zugericht mit vleys. Sampt einer nutzlichen vorrede vnd
vnterricht D. Martini Luthers I Wie man die selbige vnd der gleichen
weissagunge vernemen sol. Wittemberg. M.D.xxvij.
AmEnde: Verdeutscht durch Stephanum Rodt. Getruckt zu Wittem-
berg durch Hans Lufft. M.D.xxvij.-
VORRHEDE MARTINI LUTHERS. AUFF DIE WEISSAGUNG DES JOHANNIS
LICHTENBERGERS
WEil dis buch des Johannis Lichtenbergers mit seinen weissagun-
gen I nicht alleine ist weit auskomen I beyde ynn latinischer vnd deudscher
sprache I sondern auch bey vielen gros gehalten I bey etlichen auch ver-
acht ist I Sonderlich aber die geistlichen sich itzt des hoch trosten vnd
frewen. Nach dem aus diesem buch ein fast gemeine rede ist entstanden
gewest I Es wurde ein mal vber die pfaffen gehen I vnd darnach widder
gut werden I Vnd meinen I es seynu geschehen I sie seyen hindurch I das
yhr verfolgung durch der bauren auffrur vnd des Luthers lere sey von
diesem Lichtenberger gemeinet. Vmb des alles willen bin ich bewogen I
mit dieser vorrhede den selbigen Lichtenberger noch eins aus zu lassen 1
mein vrteil druber zu geben I zu vnterricht aller I die des begeren f Aus-
genomen die geistlichen I wilchen sey verboten I sampt yhrem anhang I
das sie mir ia nichts gleuben I Denn die mir gleuben sollen I werden sich
doch on sie wol finden.
Erstlich sind etliche Propheten I wilche alleine aus dem heiligen
geiste weissagen I wie Zacharia. 7 spricht. die wort die der HERR Ze-
baoth durch seinen geist sandte ynn den Propheten 1 Wie auch Petrus
zeuget. 2. Pet. r. Die weissagung der schrifft I kumpt nicht aus eigener
auslegunge I denn es ist noch nie keine weissagung aus menschen willen
erfurbracht I Sondern I die heiligen menschen Gottes haben geredt I
getrieben vom heiligen geist. Diese weissagung ist gericht vnd gehet
darauff I das die gottlosen gestrafft I die rumen erloset werden I vnd
[A ij] treibt ymer dar I auff den glauben an Gott vnd die gewissen zu
sichern vnd auffzurichten I Vnd wenn not vnd trubsal da ist odder
komen sol I trostet sie die frumen 1 Vnd gehet auch die frumen alleine
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
an 1 mit den gottlosen hat sie nichts zu thun I denn das sie yhn drewet
vnd sie straffet I Nicht aber trostet noch verheist. Widder diese weis-
sagung hat der Satan auch seine weissagunge I das sind die falschen
Propheten 1 rotten I secten vnd ketzer I durch wilche er den glauben
an Gott verderbet I die gewissen zustoret vnd verfuret I mit lugen tro-
stet f mit falscheit drewet I Vnd ficht also on vnterlas widder die reyne
weissagunge vnd lere Gottes.
Dieser art ist der Lichtenberger keiner I denn er berumbt noch
berufft sich nicht auf den heiligen geist I wie die rechten vnd falschen
Propheten thun I sondern grundet seine weissagung ynn des hymels
lauff vnd naturliche kunst der gestirne mit yhren einflussen vnd wir-
ckunge. Auch so nympt er sich widder des glaubens noch der gewissen
an I widder leret noch verfuret I widder trostet noch straffet 1 Redet
aber schlecht daher von zukunfftigen dingen I es treffe gottlosen odder
frumen I wie es yhm seine kunst ym gestirne gibt. Er redet wol auch
von der Christlichen kirchen I aber nicht anders I denn wie sie eusserlich
stehet ynn leiblichen geberden vnd gutern vnd hirschafften I Gar nichts 1
wie sie ym glauben vnd trost des heiligen geistes stehet I Das ist I er
redet nichts von der rechten Christlichen kirchen I Sondern gleich wie
die selbige Sternkunst von allen andern heidnischen hirschafften vnd
konigreichen pflegt zu reden. Darumb er auch der Hussiten 1 als feinde
der kirchen gedenckt I Vnd des geschlechts Dan I daraus der Endechrist
komen solle. Vnd stehet seine reformation darynn 1 das man die Iangen
har verschneyte I die schnebel an den schuchen abthut vnd bretspiel
verbrennet I das sind seine Christen 1 Also das gar eine leibliche weis-
sagung ist I von eitelleiblichen dingen.
Summa f seine weissagung ist nicht eine geistliche offinba- [A ij vo]
runge I denn die selbige geschicht on die sternkunst 1 vnd ist auch der
sternkunst nicht vnterworffen I Sondern es ist eine heidnische alte kunst f
die bey den Romern vnd auch zuuor bey den Chaldeern fast herlich vnd
gemein war I Aber sie kundten dem konige zu Babilon seine trewme
nicht sagen noch deuten I Daniel muste es thun durch den geist 1 So
feileten die Romer auch gar offte. Darumb ist zu sehen 1 ob die selbige
kunst auch etwas vermuge vnd konne zutreffen 1 denn ich selbs diesen
Lichtenberger nicht weis an allen orten zuuerachten 1 Hat auch etliche
ding eben troffen I sonderlich mit den bilden vnd figuren nahe hin zu
geschossen I schier mehr denn mit den worten.
Hie ist zu mercken I das Gott der alleine alles gemacht hat 1 auch
selbs alles regiret I auch alleine zukunfftigs weis vnd sagen kan 1 Hat er
doch zu sich genomen I beyde seine Engel vnd vns menschen I durch
wilche er wil regiren I das wir mit yhm I vnd er mit vns wircke I Denn
Li4lhers Vorrede zu Liclttenbergers Weissagung
547
wie wol er kundte J weib vnd kind J haus vnd hof I on vns regiren I neeren
vnd beschirmen J so wil ers doch durch vns thun I vnd setzet ein den
vater odder hausherrn vnd spricht J Sey vater vnd mutter gehorsam.
Vnd zum vater J Zeuch vnd lere deine kinder. Jtem also kundt er auch
wol on konige f fursten J herrn vnd richter J weltlich regiren J fride halten
vnd die bosen straffen f Er wil aber nicht J sondern teilet das schwerd
aus vnd spricht J straffe die bOsen J schutze die frumen vnd handthabe
den friden. Wie wol ers doch selbs durch vns thut I vnd wir nur seine
laruen sind J vnter wilcher er sich verbirget vnd alles ynn allen wirckt f
wie wir Christen das wol \vissen. Gleich wie er auch ym geistlichen
regiment seiner Christen J selbs alles thut fleret I trostet I straffet I vnd
doch den Aposteln das wort I ampt vnd dienst eusserlich befilhet das
sie es thun sollen. Also braucht er vns mensch en J beyde ynn leiblichem
vnd geistlichem regiment J die wellt vnd alles was drynnen ist I zu regiren.
Eben so braucht er auch der Engel/ wie wol wir nicht wissen [A iij]
wie dasselbige zugehet J denn er befilhet yhn nicht das schwerd I wie
der weltlichen obirkeit f noch das eusserliche wort I wie den predigern I
noch das brod vnd kleid I vihe vnd haus J wie den haushaltern vnd
eltern. Denn wir sehen noch horen der keines von den Engeln J wie wirs
von den menschen sehen vnd horen. Dennoch sagt die schrifft an viel
orten I das er die wellt durch die Engel regire I Eym yglichen keyser I
konige I fursten I herrn I ia eym yglichen menschen seinen Engel zuuer-
ordent I der sein bestes bey yhm thu I vnd fodder yhn ynn seim regiment
vnd hirschafft I Wie Danielis .x. der Juden Engel klagt I das der Persen
engel yhm widderstanden habe 1 Aber der Kriechen Engel kome yhm zu
hulffe. Wie aber die lieben Engel hieruber eins bleyben fur Gott I vnd
doch widdernander sind fur den menschen J gleich wie die konige yhn
befolhen I widdernander sind I las ich hie dis mal anstehen vmb der
satsamen geister willen 1 wilche ynn einem augenblick konnen lernen 1
alles was Christus vnd aile notige artikel des glaubens foddern I vnd
damach auff fragen fallen 1 sich bekiimmem I was Gott fur der wellt
gemacht habe I vnd der gleichen 1 auff das sie hie auch yhren furwitz
zu bussen haben mit den lie ben Engeln I Sondem wollen das fur nemen I
das aller leichteste I wilchs sie auch so bald sie es Mren I kostlich wol
verstehen.
Nemlich das I Weil Gott die gottlosen ynn welltlicher obirkeit durch
sich vnd seine Engel regirt (wie gesagt ist) allermeist vmb seines worts
willen I das es muge gepredigt werden I wilchs nicht kondte geschehen I
wo nicht fride ynn landen were f So nympt er sich auch desselbigen mit
ernst an I Vnd lest sie zu weylen durch seine Engele furen vnd gluck
haben I zu weylen auch wunderbarlich dem vngluck entgehen I wie denn
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
aile Heiden selbs bekennen I das streit vnd sieg stehe schlechts nicht ynn
menschen krafft noch witze I sondern ym gluck I Wilchs also zu gehet 1
das die lieben Engel da sind vnd durch ynnwendige anregen plotzlich
einen rad odder synn eingeben I odder eusser- [A iijvo]Jich ein zeichen vnd
anstos ynn weg legen I damit der mensch gewarnet odder gewendet wird
dieses zu thun I das zu lassen I diesen weg zu zihen I diesen zu meyden I
auch offt widder den ersten fursatz. Denn I weil sie mit worten nicht
reden zu vns f thun sie das mit synn eingeben I odder eusserliche vrsache
plotzlichen furlegen I gleich wie wir pferde vnd ochsen anschreyen 1
odder holtz vnd steyn ynn weg legen I das sie nicht ynn graben fallen.
Solche eusserliche zeichen odder vrsache I nennen die Heiden Omina I
das ist I bose anzeigung odder warnunge I Dauon yhr bucher vol sind 1
denn sie sehen wolf das es geschicht f sie wissen aber nicht I wer es thut I
Dauon were wol viel zu schreiben vnd exempel anzuzeigen.
Solchs thun die Engel auff erden i Vber das thut Gott ym hymel
auch seine zeichen I wenn sie ein vngluck treffen sol I vnd lest schwantz-
sterne entstehen I odder Sonn vnd Mond schein verlieren I odder sonst
ein vngewonliche gestalt erscheinen. Jtem auff erden grewliche wunder
geborn werden I beyde an menschen vnd thieren I Wilchs alles die Engel
nicht machen I sondern Gott selbs alleine f Mit solchen zeichen drewet
er den gottlosen I vnd zeigt an zukunfftig vnfal vber herrn vnd Iande I
sie zu warnen. Vmb der frumen willen geschicht solchs nichts I denn
sie durffens nicht I drumb wird yhn auch gesagt. Sie sollen sich fur des
hymels zeichen nicht furchten I als Jeremias spricht f denn es gilt yhn
nicht I sondern den gottlosen.
Hiraus ist nu komen die sternkunst I vnd warsager kunst I denn weil
es war ist I das solchs geschicht I vnd die erfarung beweiset I das vngluck
odder gluck bedeut I Sind sie zu gefaren I vnd habens wollen fassen
vnd ein gewisse kunst draus machen i da sind sie gen hymel gefaren
vnd habens ynn die sterne geschrieben I Vnd weil sie feine gedancken
gehabt I das sichs mit der sternen art reymet I mussens nu die sterne
vnd natur thun I das Gott vnd die Engel thun I Gleich wie die ketzer zu
[A IV] erst yhre gedancken finden I darnach die selbigen ynn die schrifft
tragen I vnd mus denn schrifft heissen I was yhn trewmet. Da ist denn
der teuffel zu geschlagen I hat sich drein gemenget I vnd wie er ein herr
der wellt ist widder Gotts herschafft I hat er auch des gleichen zeichen
viel angericht auff erden I die sie Omina heissen I Vnd hat an manchen
orten warsager erweckt I als zu Delphis vnd Hammon I die solche zeichen
gedeutet 1 vnd kunfftige ding haben gesagt. Nu er denn der wellt furst
ist vnd aller gottlosen konig vnd herrn sampt yhren lendern 1 synn vnd
wesen fur yhm hat I dazu alle erfarung von anfang der wellt gesehen I hat
Luthers Vorrede zu Lichtenbergers Weissagung
549
er leichtlich konnen sehen I wo er mit yhn hinaus wolle. Aber weil er
nicht gewis ist (denn Gott bricht yhm offt die schantz vnd lest yhn
nicht ymer treffen) gibt er seine weissagunge mit solchen wanckenden
worten eraus I das I so es geschehe odder nicht I er dennoch war habe I
Als da der konig Pyrrhus fragt I ob er die Romer schlahen wurde I
Antwort er 1 Dico Pyrrhum Romanos vincere posse I als wenn ich auf
deudsch spreche 1 Jch sage Hansen Petern schlahen muge I Es schlahe
nu Hans odder Peter 1 so ists beydes durch die wort verstanden. Vnd
der gleichen hat er viel gethan durch Gotts verhengnis vnd thuts auch
noch 1 Vnd triffts offt I das geschicht I aber Gott lessts nicht allewege
treffen 1 darumb ist die kunst vngewis I vnd behelffen sich damit I fey-
lets an einem ort 1 so triffts doch am andern I Widderferets nicht diesem I
so widderferets doch yhenem.
Was sagen wir denn zum Lichtenberger vnd des gieichen? das sage
ich. Erstlich I Den grund seiner sternkunst halt ich fur recht I aber
die kunst vngewis 1 das ist 1 Die zeichen am hymel vnd auff erden feylen
gewislich nicht 1 Es sind Gotts vnd der Engel werck I warnen vnd drewen
den gottlosen herren vnd lendern I bedeuten auch ettwas I Aber kunst
darauff zu machen ist nichts I vnd ynn die sterne solchs zu fassen. Zum
andern 1 es mag dennoch wol daneben sein I das yhn Gott odder sein
En- [A IVvo]gel bewegt habe I viel stucke I wilche gleich zutreffen I
zu schreiben I wie wol yhn dunckt I die sterne gebens yhm I Aber nichts
deste weniger I auff das Gott sehen IieBe I das die kunst vngewisse sey I
hatt er yhn lassen feylen etliche mal.
Vnd ist das summa summarum dauon I Christen sollen nichts nach
solcher weissagunge fragen I denn sie haben sich Gott ergeben I durffen
solchs drewens vnd warnens nicht. Well aber der Lichtenberger die
zeichen des hymels anzeucht I so sollen sich die gottlosen herren vnd
lender fur allen solchen weissagungen furchten I vnd nicht anders den-
cken I denn es gelte yhn 1 Nicht vmb yhrer kunst willen I die offt feylen
kan vnd mus I sondern vmb der zeichen vnd warnunge willen I so von
Gott vnd Engeln geschicht I darauff sie yhre kunst wollen grunden I
denn die selbigen feylen nicht I des sollen sie gewis sein I Als zu vnsern
zeiten haben wir viel sonnen I regenbogen vnd der gleichen am hymel
gesehen. Hie ist kein sternkundiger 1 der gewis hette konnen odder
noch konnen sagen f es gellte diesem odder dem konige 1 dennoch sehen
wir I was dem konige zu Franckreich I Denemarck I Hungern gewislich
widderfahren ist 1 Vnd wird noch andern konigen vnd fursten auch gehen
gewislich.
Derhalben schencke ich den Lichtenberger vnd des gleichen 1 den
grossen hansen vnd lendern 1 das sie wissen sollen f es gellte yhn 1 vnd
550
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
wo er trifft 1 das solchs geschicht aus den zeichen vnd warnunge Gotts I
darauff er sich grundet I als die da gewislich den grossen hansen gelten 1
odder durch verhengnis Gottes aus des Satans eingeben. Wo er aber
feylet 1 das solchs aus seiner kunst vnd anfechtung des Satans geschicht 1
Denn Gotts zeichen vnd der Engel warnunge I sind gemenget mit des
Satans eingeben vnd zeichen I wie die wellt denn werd ist I das es wust
vnternander gehe vnd nichts vnterschiedlich erkennen kan. Das sey
mein vrteil vnd vnterricht I die Christen verstehen wol I das [B] so recht
ist I Was die andern gleuben Ida liegt mir nichts an I Denn sie mussens
erfaren I wie man den narren die kolben lauset.
Das nu meine vngnedige herrn die geistlichen sich frewen I als seyen
sie hinuber 1 vnd solle yhn nu hinfurt wol gehen 1 da wiindsch ich yhn
gluck zu 1 sie durffens wol I Aber weil sie yhr gottlose lere vnd Ieben
nicht bessern i sondern auch stercken vnd mehren I wil ich auch geweis-
sagt haben I das I wo es kumpt vber ein kleine zeit I das solch yhr freude
zu schanden wird I wil ich gar freundlich bitten I sie wolten mein ge-
dencken I vnd bekennen I das der Luther hab es besser troffen I denn
beide der Lichtenberger vnd yhre selbs gedancken: Wo nicht I so wil ich
yhn hie mit ernstlich gepotten haben 1 das sie es bekennen mussen on
yhren danck I vnd all vnghick dazu haben I da fur sie doch Gott behuete I
so ferne sie sich bekeren IDa gebe Gott seine gnade zu j AMEN.
[LICHTENBERGERS]
VORREDE VBER DAS FOLGEND BUCHLIN
WJe wol Gott der Herr zeit vnd stunde yhm allein ynn seiner gewalt
furbehalten hat I Wie Christus die ewige warheit selbs bezeuget 1 Er
auch alleine zukunfftige ding weis i Vnd niemand ist ynn dieser welt 1
der den morgenden tag 1 odder was daran geschehen sol 1 wuste vorhin
zu verktindigen 1 Nichts deste weniger I hat der selbige gutige Gott 1
aus seiner milden vberfllissigen guete vnd barmhertzickeit 1 mancherley
gaben yn seine Creaturen gegossen I damit er yhnen etliche ding 1 die
noch ferne vnd zukunfftig sind I zuuerstehen vnd zu wissen vergunnet
hat I doch nicht gantz klar I [Bvo] sondern aus etlichen gleichnissen 1 vmb-
stenden I zeichen vnd abnemung der geschehen ding I gegen die I so noch
zukunfftig ergehen sollen. Also verkundigen die Vogel ym gesange vnd
mit yhrem fliegen I des gleichen auch andere thiere 1 ynn mancherley
weise I die zeit vnd verenderung odder geschicklickeit der zeit 1 auch der
gleichen mehr dings f wie es damit zukunfftig sol ergehen. Also bedeut
abendrote I das der zukunfftige morgen werde schOn werden 1 vnd morgP.n-
Luthsrs Vorrede zu Lichtenbergets Weissagung
55 I
rote bedeut I das es auff den abend regenen werde. Solche ding sehen wir
aile so naturlich geschehen I durch schickung vnd ordenung der natur I yhr
von Gott eingegeben I Wie solchs die naturlichen meister die man Philo-
sophos 1 Mathematicos vnd Astrologos nennet) volkomlich beschrieben
haben.
Es lasse sich hierynne niemand yrren I diesen spruch Aristotelis da
er also sagt I Von den zukunfftigen I zufelligen dingen I hat man keine
gewisse warheit. Denn der selbige Aristoteles spricht auch I Alles was da
zukunfftig ergehen sol I das mus von not wegen komen I Kompt es nu
not halben odder sonst anderswo her 1 so mus es yhe eine vorgehende
vrsache haben I wie Plato gesagt hat I Solche vorgehende sache I eigent-
lich vnd volkomlich 1 weis alleine Gott I der schepffer aller dinge. Er
hat aber dem menschen gegeben 1 vernunfft 1 verstentnis vnd krafft
allerley hyn vnd widder zu betrachten I damit er aus den vorgangnen
dingen zukunfftige abnemen vnd ermessen kunde I Der selbige Gott hat
dem menschen auch verliehen kunst vnd erkentnis der sterne am hymel I
daraus man mancherley geschicht I dazu einen das gestirn zeucht I
zukiinfftig vorhyn sagen mag.
Auff das man aber den grund dieser dinge eigentlich abnemen mage I
ist zu mercken 1 das Gott ynn dreyerley weise dem menschen geben
hat zukunfftige ding zu wissen I die ein iglicher der vleis ankeren wil 1
aile I odder yhe etliche erforschen vnd begreiffen mag. Zum ersten
(wilchs auch vnter allen die [Bij] gemeinste weise ist) So der mensch
lange zeit lebet Imager durch lange erfarunge sehen vnd horen I vnd also
viel dinge durch gleichnis vnd vernunfftliche priifung zukunfftig sagen 1
wie denn alte leute das zeugen vnd beweisen.
Die ander weise ist aus den sternen vnd aus der kunst der Astro-
nomey I wie Ptolemeus spricht I Wer die vrsachen der yrdischen dinge
erfaren wil I der mus erstlich vnd vor allen dingen acht haben auf die
hymelischen carper I Denn I als Aristoteles sagt 1 so nlret vnd henget i e s ~
vnterste welt an der obersten I so genaw vnd eben I das auch aile yhre
krafft von den hymlischen vnd obersten corpern regirt werde. Auch
spricht Ptolomeus I das die menschen yn sitten vnd tugenden durch die
sterne vnterweiset vnd geendert werden I Denn die sterne geben etliche
neygung den menschlichen corpern 1 aber sie notigen doch gantz vnd
gar niemand.
Zum dritten I wird dem menschen gegeben I zukunfftige ding zu
wissen I durch offenbarung I Denn I wie wol der Vater ynn ewickeit yhm
alleine ynn seine gewalt gesatzt hat I zukunfftige ding zu wissen f hat
er doch etlichen sonderlichen menschen solche ding offenbaret I ent-
weder ym geiste I odder ynn einem gesichte 1 vnd als in einem tunckeln
552
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthen Zeite"
vnd verborgenem retzlein 1 odder auch durch offentliche gesandte Engel/
vnd vormittelst mehr andern heimlichen weisen I das sie kunnen zu-
kunfftige ding warhafftiglich sagen I vnd zuuor I ehe sie geschehen I ver-
kundigen 1 Wie wir das eigentlich vnd klerlich bey den Heiden von der
Sibylla lesen 1 wilche den Romern viel zukunfftiges dinges I on liigen
vnd betrueg 1 warhafftig geweissaget vnd verkundiget hat. Vnd gleich
die selbige Sibylla I hat auch den Romern llangest zuuor ehe es geschach I
gesagt I Das der Tempel der ewickeit I nicht ehe zerfallen solt I bis das
eine iungfraw einen son gepure. Vnd viel ander ding mehr I hat sie
yhnen gesagt I das sich mit der zeit alles hat begeben I Wilchs sie doch
nicht hette thun konnen I wenn sie nicht ein geist 1 yhr von Got [Bijvo]
gegeben 1 gehabt hette. Also haben auch die Propheten ym alten Testa-
ment zukunfftig ding geweissaget I Des sind nu viel exempel. Vnd zu
letzt auch zu vnsern zeiten I ym neWP-'1 Testament sind dem heiligen
Johanne Ida er dem Herrn auff der brust lag I die heimlickeiten Gottes I
so am ende der welt erfur kummen solten I offenbart worden. Der andern
wil ich schweigen I alleine der einigen Brigiden wil ich gedencken I
wilcher offinbarung hie ynn diesem buchlein werden vnterweilen zum
marckte komen. Zu der selbigen wollen wir auch einen rechnen I der
heist Reinhard Lolhard 1 wie es sich alies hernach iinden wird an seinen
orten.
Die itzt ertzelten drey wege vnd weise I zukunfftige dinge zu wissen I
wird der Meister dis buchleins f der sich wil vngenant haben I fur sich
nemen I vnd wird viel dinges I das da ynn kunfftigen iaren geschehen
sol I mit glaubwirdigen vrsachen vnd bewegnissen anzeigen I warlich
nicht freuelich vnd vnbesunnen 1 auch nicht mit einem stoltzen vnd
auffgeblasenem mut I sondern als eine trewliche warnung vnd ver-
manung I damit er warnet vnd ermanet hochlich vnd mit ernst aile
menschen I vnd sonderlich Fursten vnd Oberkeit I das sie hiilffe vnd rad
suchen wolten I damit man dem zukunfftigen vngluck begegnen I vnd
'viel arges verhtiten kimde. Denn versehen geschutz thut wenigern
schaden. Derhalben mugen sie sich hiiten vnd fursehen I so viel sie
miigen I vnd wolten yhe nicht einem iglichen geiste glewben i Denn
glaub vnd trew ist nu zur zeit ein seltzamer vogel ynn der welt. Wo
aber nu kein glaub noch trew ist I da kan kein guter rad sein I vnd
wir keinen rad auff erden finden kiinnen I so ist keine andere zuflucht I
denn das wir 1 bey Gott dem aller hochsten 1 rad hiilff vnd beystand
such en.
Derwegen so last vns aile anruffen vnd andechtiglich bitten I den
selbigen gtitigen vnd barmhertzigen Gott 1 vnd vnsern Herrn Jhesum
Christum I das er vns durch seine gnade [B iij] wolle verzeihen vnsere
Luihers Vorrede zu Lichtetzbergers Weissagung
553
missethat I wolle vns bekeren zum guten I vns ynn einem rugigen fride
erhalten 1 vnd seinen zorn von vns abwenden I Er wolle fur vns stehen I
so wird vns niemand kimnen schaden. Jtzt wollen wir nu zu diesem
buchlein greiffen 1 vnd horet mit vleis zu.
* *
*
[DAS ERSTE CAPITEL]
[Bl. D] Hie stebet ein alter gebuckter bertichter I hinckender man I
der belt sich an einen stab mit der lincken hand I vnd hat eine sichel in
der rechten 1 vnd ligt auff einem manne der hat einen ochsen bey den
hornern ynn der rechten hand f gleich als er yhn erwurgen wolt I Vnd
zwischen den zweyen stehet das zeichen Scorpion. Dar auf f o 1 g t [Bl. Dvo]
der in Abb. 135 wiedergegebene Holzschnittl) mit nachstehen-
dem Text:
DAs ist eine namhafftige Constellation fast wol zu mercken vrid zu
betrachten 1 der schwerwichtigen grossen Planeten des Saturni vnd
J upiters I wilcher Coni unction vnd zusammen lauffung I erschrecklich
ding drewet 1 vnd verkundiget vns viel zukunfftigs vnglucke I Vnd ist
volkomen gewesen I nach Christ gepurt ym iare I M.cccc.lxxxiiij. am
funff vnd zwentzigsten tage Nouembris I des Weinmondes I vmb die
sechste stunde 1 vier Minut nach mittage I wie wol der krebs eins grads
hoch auffsteyge vber den Horizontem.
Der selbigen zweyen planeten Coniunction vnd zusamme lauffung
geschicht seer selten I vnd nicht ehe I denn nach verlauffung einer
Iangen zeit I vnd wenn viel gestirn herumb komen sind I vnd derhalben
bringet sie auch einen sterckern ein- [D ij] flus. Zu wilcher erschreck-
!ichen Coniunction I ist das greBliche vnd scheuBliche haus des aller
vngluckbafftigen zeichens des Scorpion 1 geeigent vnd verordenet 1 ynn
dem .23. grad vnd 43 minut I darynne sich frewet der stern des falschen
Martis I Vnd das am aller ergsten ist I vnd ein vrsach werden wird alles
vnghicks I der storrige vnd boshafftiger Saturn us hat mit seiner erhOhung
gegen mitternacht den gutigen vnd freuntlichen Jupiter vntergedruckt I
Auch ist Mars ein herr dieser Coniunction I vnd der mitten vom hymel
gresslich vnd vol drewens herunter sihet 1 yn seinem eigen koniglichem
haus auch koniglichem zeichen sitzend vnd erhaben I Derhalben er yhm
auch alle ordenung vnd regierung dieser Coniunction zuschreibet vnd
zueignet. Vnd darumb die weil der freundliche Jupiter also von Saturno
vnd Marte gefasset I vnd von yhrem bosen glentzen vntergedruckt ist 1
1) Vgl. die Illustration bei Paulus von Middelburg (Abb. 134).
554
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
kan er yhrer macht vnd gewalt nicht widderstehen I mag auch derhalben
seine heilsame vnd gewonliche ht'Hffe durch seine freuntlickeit den
menschen nicht mit teilen.
Dieweil aber solcher grausamer I wie wol langsamer Coniunction
bedeutung sich auff viel iare erstrecket I dimcket mich nicht vnmitze
sein I etliche andere Constellation I so zwischen dieser zeit mit einfallen I
alhie auch mit anzuzeigen I auff das man von den selbigen I so sie allent-
halben wol bewogen vnd billiche vrsachen yhrer vereinigung furgebracht
wurden I aus allen I wie wol vngleichen vrsachen I doch eine gleiche
form vnd werck herausser ziehe.
Es hat sich auch begeben ym iare I M.cccc.lxxxv. ein erschreckliche
vnd fast ein gresslich Eclypsis vnd finsternis der Sonne I wilchs wird
der grossen Coniunction obgemelt I yhre bedeutung I yhre krafft vnd
bOse wercke I die sie pflegt zu bringen i noch viel boser machen I des
gleichen auch die Coniunction der zweyer bosen stern Saturni vnd
Martis I die da gewesen ist I am letzten tage Nouembris f ym neunden
grad des Scorpions 1 zu der vuuolkomenen [ !] stunde I der verbrennung
des [D ijvo] Mondes
1
) I Jn wilcher coniunction I der boshafftige Satur-
nus I mit seiner erhebung den Martem yn seinem eigen hause vnter-
dnicket I vnd viel zeugnis zukunfftiges vnglucks bringet I auch mech-
tiglich seer die grausamkeit obverzelten Constellation mehret vnd be-
stetiget. Aber die andere freuntliche Coniunction des gutigen Jupiters
vnd des grausamen odder zornigen Martis 1 wilche newlich ym .18. grad
des Scorpions 1 zusammen gelauffen sind I mit Jupiters ghick I ynn dem
das er sich vber den Martem erhaben hat I wird ein wenig messigen das
vnghick I obenangezeigter boser Constellationen. Drumb duncket michs
auch gut sein 1 alhie zu erzelen I etliche grosse Coniunctiones I vnd zu-
sammen lauffung der Planeten I so sich ynn vergangener zeit begeben
haben I wilcher bedeutung nach etlicher meinung I bis auf diese zeit
sol wehren.
Der grosse vmblauff des hymels I der den namen hat von derConiunc-
tion die fur der sindflut war 1 ist von grad zu grad I vnd fuss fur fuss zu
dem .rs. grad des lewens des .rz. minuts I Iangsam vnd fewlichen komen I
Des selbigen vmblauffts Regiment vnd gubernation ist von recht zuerteilt
dem Mond vnd hat seine macht angenomen I vnd der grad der direction
ist gefurt vnd komen zu dem funfften teil der Wage I vnd besitzet die
selbige 1 vnd der selbigen teil zeucht yhm der Monde zu. Aber vmb die
grossen Coniunctiones 1 die da bedeut haben I als man sagt I die zukunfft
vnseres heilandes vnd seligmachers Christi 1 ist es also gethan gewesen I
1) S. o. S. 541 Anm. 3
Luthers Vorrede zur Weissagung Lichtenbergers
555
das der fortgang odder folgung des auffsteigenden zeichens des selbigen
iares gekomen sey I his zu dem .13. grad der Wage I Aher die folgung
des orts I da die Coniunction ynne gewesen ist I ist gebracht ynn den
.Ig. grad des Widders f vnd wird aida auffgenommen I Vnd der grad
der direction ist von dem Ascendente his zu dem .12. grad I des Scorpions
gekomen I wilchen Venus zurteilet.
* *
*
[Bl. Oiij] Bald hernach odder schier vmh die selhige zeit I wird ein
ander Prophet erstehen 1 nemlich I als ein geistlich man I der grosse
wunderliche heilickeit wird furgehen. (Dazu Holzschnitt: Prophet
mit Rosenkranz.)
DAS EIN VND DRElSSIGSTE CAPITEL
DJese wunderliche Constellation vnd zusammenlauffung der sterne
zeiget an I das da sol geporn werden noch ein ander kleiner Prophet I der
sol trefflich sein mit wunderlicher auslegung der schrifft I vnd sol auch
antwort von sich gehen mit einem grossen ansehen der gotheit I der da
wird die seelen der menschen I so zur erden gefallen sind I seinem gepiet
vnd herrschafft vnterwerffen. Denn die Sternseher pflegen kleine Pro-
pheten die zu nennen I die da yrgend eine verenderung yn den gesetzen
machen I oder hringen newe Ceremonien auff I die auch die Gotlicben
kunste vnd [Oiijvo] spruche I mit vleissiger deutung auslegen 1 wilcher
meinung vnd worter I die leute als fur GOtliche vrteil vnd lere I annemen I
Aher es geschicht I das vnter den selhigen etliche falsch sind I als der
Mahumet I Etliche reden auch war I als da sind gewesen der heilige Fran-
ciscus vnd der heilige Dominicus. Was aher das wird fur einer sein I wird
hernach kund vnd offenbar werden. Vnd wiewol ich diesen beschlus halte
fur warhafftig zu bekennen von allen Sternsehern ,' vnd die dieser kunst
erfaren sind I Doch das es muge deste klerer angesehen werden I so wil
ich zu einer erhaltung vnd warmachung des selhigen ein wenig ein aus-
lauff machen I vnd ertzelen etliche nambafftige Coniunctiones vnd
zusammelauffunge der verwandelten triplicitet I so ynn Iangen vnd viel
iaren daher sind geschehen. Vnter wilchen eine ynn der wesserichten
triplicitet I ym iare M.ccc.lxv. ym achten grad des Scorpions I ist vollen-
komen worden I Aher die zwo so vor der sind geschehen I vnd aber zwo
die der selhigen nachfolgen ynn der lufftigen triplicitet 1 sind ynn den
Zwillingen vnd ym Wasserman geschehen. Die dritte aber nach der
selhigen I wilche ist gewesen ym iare M.cccc.xxv. ist widderumh komen
zu der wesserichten triplicitet ym. xiij. grad des Scorpions 1 vnd ist his
Warburg, Gesammelte Schriften Bd. 2
556
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
auff den heutigen tag ynn der selbigen triplicitet geblieben. Also halt
ichs nu da fur I das es offenbar genug sey I das man warten sol I auff
eine gepurt eines newen Propheten.
[Bl. 0 IV] Die gepurt eines newen Propheten. Folgt ein Holz-
schnitt, die Geburt darstellend. Dazu:
DAS ZWEY VND DREISSIGST CAPITEL
ICh sage I das ym Iande dem Scorpion unterworffen I ein Prophet
wird geporn werden I so das man zuuor etliche wunderzeichen vnd selt-
zame ding wird am hymel sehen I Aber an wilchem ende der welt I ob
es gegen Mitternacht odder Mittag geschehen sol I sind so viel vnd
mancherley meinung der gelarten leute I vnd so widdersynnische vrteil
vnd anzeigungen 1 das sie gerad widdereinander stimmen. Albumazar
helts dafur I das die wasserichten zeichen I die landart gegen Mittag
bedeuten. Doch der gemeine hauff der Sternseher will das sie die landart
gen Mitternacht anzeigen. Es sej gleichwol was es wolle I so sagt Messa-
hala I das er sol geporn werden ynn eim Iande I das da mittelmessig ist I
der hitze vnd feuchtickeit halben I Jnn wilchem Iande die [OIVvo]
subtile mittelmas der lufft I mit vermischter temperierung der hitz vnd
kelde I aile einwoner mit heilsamer zunemung enthelt. Der selbige Prophet
wird aus seinem eigen vaterlande gehen I vnd wird zeichen thun yn den
Ianden I so dem Lewen vnd Wasserman sind vnterworffen. Denn wie
Albumazar sagt I so wird er seine wunderzeichen offenbaren ynn den
Ianden I die durch den vierden Aspect bedeutet sind 1 Wilchs auch mit
aller Stern seher bewilligung ist bestetiget. Das bezeuget auch diser
spruch vnsers Seligmachers 1 Kein Prophet ist angenem ynn seinem
vaterlande. Aber die weil diese Coniunction ym ascendent des iares I vnd
ynn eim stetten fest en zeichen erst wird volkomen sein I so wird man auff
diese namhafftige gepurt nicht ehe warten durffen I denn nach erfullung
der reuolution der einigen proiection. Darumb so sage ich I das vmb das
neunzehende iar von der Coniunction I dieser Prophet erstlich wird auff
diese welt komen. Aber die zeit seines predigens wird wehren neunzehen
iar I nach den kleinen iaren der Sonne. Wollen wir aber seiner kleidung
vnd tracht halben dem Albumazar folgen 1 so werden sie rotlich sein vnd
glintzern I so das man des eine anzeigung neme von dem Marte ym zehen-
den I vnd von der Sonne seines herrns. Aber denen nach zu folgen I die
da wollen haben I man sol die gestalt vnd figur der Coniunction ansehen I
sodas man die anzeigung hernemc von dem Jupiter/ Mond 1 vnd vom
heubte des Drachens I so werden seine kleder weisferbicht sein 1 wie
der Munche kleidung 1 vnd er wird eine newe geistlikeit anrichten.
Luthefs Voffede zur Weissagung Lichtenbe,gers
557
Da stehet ein Munch ynn einer weissen kappen I vnd der Teuffel
sitzt yhm auff sein achseln 1 hat ein Iangen zepplier his auff die erden I
mit weitten ermeln I vnd hat ein iungen Munchen bey yhm stehend.
Folgt Bl. P der hier beschriebene Holzschnitt. Vgl.Abb. I36.
DAS XXXII J CAPITEL
Djs sind vnd werden die zeichen sein I da bey man yhn wird er-
kennen I Er wird schwartze fleckichen haben am leibe I vnd wird einen
heslichen leib haben von brawnfleckichten manchferbichten mackeln ynn
der rechten seyten I beym schos vnd an der huffe I Er stehet am tell des
ghicks I zur rechten hand des hymels 1 vnd ym zehenden vom Horoscopo I
doch I das der ascendent der beider deste weibischer sey 1 vnd werden sich
auff das hinderste teil des leibes am meisten neygen. Er wird auch noch
ein ander zeichen an der brust haben I aus dem tell des zeichens I wilchs
ym sechsten grade des Lewens erfunden ist. Dieser Prophet (wie das
selbige Firmicusl) bezeuget) wird erschrecklich sein den GOtten vnd den
Teuffeln 1 er wird viel zeichen vnd wunderwerck thun I Seine zukunfft
werden auch die bosen geiste fliehen I vnd [pvo] die menschen I so mit
dem Teuffel besessen sind I wird er nicht aus krafft der worter I sondern
allein das er sich sehen lesst erretten. Aber aus dem tell des reichs yn
dem eilfften dieser Coni unction I wie da sagt Antonius de monte Vlmo
11
) I
wird er nicht allzeit thun was er andern zu thun wird radten. Denn er
wird ein trefflichen verstand haben 1 vnd vieler dinge kunst I vnd eine
seer grosse weisheit 1 doch wird er ynn heucheley offt lugen reden I vnd
er wird ein gebrand gewissen haben I Vnd wie ein Scorpion I der des
Martis haus ist ynn dieser Coniunction vnd finsternis I wird er die gifft I
so er ym schwantz hat 1 offt ausgiessen. Vnd er wird auch ein vrsach sein
grosses blutuergiessens. Vnd die well Mars sein anzeiger ist I so lest sichs
ansehen I das wolle der Chaldeer glauben bestetigen I wie es Messahala
bezeuget.
Wiewol nu dieser Prophet viel zeichen vnd wunderwerck geben
wird I doch nach der hellsamen lere Christi I sol man yhm mit nichte
1) Die lat. Drucke haben: Formico. Gemeint ist schwerlich Firmicus Maternus (die
Stellen im Wortregister der neuen Ausgabe s. v. propheta ergeben nichts) vielleicht Fir-
minus Bellovallensis. Vgl. Cod. Amplon. fol. 386, Bl.59v-6or Pronosticatio Firmini *
super magna coniunctione Saturni et Jovis (et Martis, a. 1345 facta). Dasselbe Werk nach
Houzeau-Lancaster, Bibl. gen. de l'astron. (Br1issel 1887), Nr. 418o in einem MS. der
Bibl. nat. in Paris.
2) Nach Mazzetti, Seraf., Repert. di tutti i prof. ant. della ... univ .... di Bologna
(Bol. 1847), S. 185 von 1384-90 in Bologna. Von seinen Werken gedruckt ein libellus
de astrol. iudic. als Anhang zu Lucas Gauricus, Tract. astrol. iudiciariae de nativit. viror.
et mul. (N1iroberg 1540).
sss
Heidnisch-antiks Wsissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
anhangen f J a er wird fur der einer angesehen werden I von wilchen
Christus verkundiget I das sie zukunfftig sein worden I wie man das
findet yn der heiligen schrifft von Christo vnserm seligmacher selbs
angezeiget Matthei .xxiiij. da er also saget I So denn yemand zu euch
wird sagen I Sihe I hie ist Christ us I odder da I so solt yhrs nicht glewben I
Denn es werden falsche Christi vnd falsche Propheten auffstehen I vnd
grosse zeichen vnd wunder thun I das verfuret werden yn den yrthum I
wo es muglich were 1 auch die auserwelten 1 Sihe ich habs euch zuuor
gesagt. Darumb wenn sie zu euch sagen werden 1 Sihe I er ist ynn der
wusten I so gehet nicht hynaus 1 Sihe 1 er ist ynn der kamer f so gleubet
nicht. Das ist vnser Herr Jhesus Christus.
559
ORIENTALISIERENDE ASTROLOGIE
Die Bibliothek Warburg ist der Anregung, sich an dem 4 Deutschen
Orientalistentag zu beteiligen, deshalb gerne gefolgt, weil das gleichzeitige
Erscheinen der durch Gundel besorgten 3 Auflage von ,Sternglaube und
Sterndeutung" von Franz Boll (t 1924) willkommene Gelegenheit gab,
die Orientalisten auf dessen Bedeutung fiir die Einbeziehung der Orien-
talistik in den Versuch einer auf solider philologisch-historischer Grund-
lage ruhenden Geschichte der europaischen Mentalitat aufmerksam zu
machen. Durch Bolls ,Sphaera" (1903), diesem den Gelehrten noch
immer viel zu wenig vertrauten Meisterwerke, war es ja schon vor
Jahren moglich gewesen, anscheinend durch Jahrhunderte getrennte
kosmologische Symbole als Funktionen des identischen, weite Epochen
und Raumgebiete umspannenden kosmischen Orientierungswillens zu
begreifen.
Bolls Beobachtungsfeld lieB sich spater erweitern, weil Dyroff sich
der miihevollen Arbeit unterzogen hatte, im Anhang der ,Sphaera"
die groBe Einleitung des Abu Ma 'sar (t 886) nicht nur arabisch, sondern
auch von einer deutschen "Obersetzung begleitet, zu veroffentlichen.
Nur so war die Feststellung moglich (vgl. Warburg, ,Italienische Kunst
lind internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferrara", Atti
del X. Congresso internat. di Storia dell' Arte in Roma, Rom 1922),
daB die als ,indische Dekane" bezeichneten hybriden Stemsyrnbole wie
sie Abu Ma 'sar aufzahlt, unmittelbar die Gestaltung der bisher ratsel-
haften drei Figuren bestimmten, die im mittleren Streifen der kosmolo-
gischen Fresken im Palazzo Schifanoja zu Ferrara (etwa 1470) er-
schienen. Weiterhin wares ebenfalls nur durch eine "Obersetzung eines
indischen Textes moglich, die Sphaera barbarica, wie sie nach Bolls
Nachweis von Teukros, dem Babylonier, der in Kyzikos geboren war,
zusammengestellt wurde, auf ihrem friihesten Wanderzug von Kiein-
asien iiber Indien noch vor ihrer Einmiindung nach Bagdad nicht nur
als authentisches Werk eines ganz bestimmten Inders: Varaha-Mihira fest-
zustellen, sondern auch zugleich den Nachweis zu fiihren, daB dessen
Dekanvorstellungen aus besserer Teukrosiiberlieferung herstammen als
bei Abu Ma'sar. Im NachlaB von Oppert an die Hamburger Stadtbiblio-
thek fand sichnamlichdie "Obersetzung von
Orientalisierende A strologie
durch Chidambaram Iyer (1884), bei dem der erste Dekan folgender-
maBen beschrieben wird: ,Zum ersten Dekan des Widders erscheint
ein urn die Lenden mit einem weiBen Tuche gegiirteter, schwarzer,
gleichsam zum Beschiitzen fahiger furchtbarer rotiiugiger Mann, er hiilt
ein Beil aufrecht. Dies ist ein Mann-Dreskiina (Dekan) bewaffnet und
von Mars (Bhauma) abhangig." An Stelle cines Strickendes, das er bei
Abu Ma'sar in der Hand fiihrt, tdigt also der Dekan des Varaha Mihira
ein Doppelbeil. Dieses Geriit aber ist ausdriicklich bezeugt als Abzeichen
des ersten Dekans in dem verlorengegangenen Werk iiber die magischen
Steine, das Teukros (nach Psellos) geschrieben hat (Sphaera, S. 7).
Da nun auf dem Planisphaerium Bianchini, einer antiken rornischen
Marmortafel (wahrscheinlich einem Wiirfelbrett fiir astrologische Weis-
sagungen) der erste Dekan ebenfalls das Doppelbeil tragt, diirfen wir
diese Gestalt als Leitmuschel fiir die Schichtung der 'Oberlieferung
astrischer Symbole ansehen. Der Doppelbeil-Dekan ist, wie sich durch Be-
trachtung des antiken Himmelsglobus und der griechischen 'Oberliefe-
rung der Himmelsbilder (Germanicus-Handschrift in Leiden) nachweisen
lieB, nichts anderes als ein maskierter Perseus, dem es zu Anfang des
16. Jahrhunderts endlich gelingt, seine echt antike Gestalt als Hirnmels-
bild wiederzugewinnen (auf der Decke im Peruzzi=Zimmer der Farnesina) ..
Mit den Abbildungen der Fresken aus Ferrara im Mittelpunkt waren
auf sechs Bilderwanden im Saale der K. B. W. weitere Bildmaterialien
zur Geschichte und Psychologic der ,Sphaera barbarica" ausgebreitet,
die die teilweise bisher unbekannten oder nicht verstandenen Zwischen-
glieder bilden, welche von der orientalisch-damonischen zur italienisch-
olympischen Auffassung der Antike flihrten.
AuBer auf bisher unbekannte Bilderreihen in arabischen und spa-
nischen Bilderhandschriften a us dem Zeitalter des Alfonso el Sabio konnte
vor allem auf den Riesensaal, den Salone in Padua hingewiesen werden,
wo auf einem Netzwerk von Einzelillustrationen, in dem Planeten- und
Fixsternastrologie in noch unerkannter Systematik zusammenflieBen, das
mechanisch zerstiickelte astrische Bildererbe als orakelerteilende Zu-
kunftshieroglyphik der Wahrsagepraktik eingeliefert wird.
In einem deutschen, zuerst im Jahre 1488 in Deutschland von Engel
in Augsburg bei Ratdolt gedruckten und illustrierten Buch erlebte der
Teukros-Kalender seine wirksamste Umformung zum mobilen Weis-
sagungsgerat fiir aberglaubische Seelen, wie sie sich noch heute in Europa,
eben auch unter dem weitreichenden EinfluB dieses Buches, in nichtiger,
billiger Pseudo-Mystik gefallen.
Padua laBt sich als Umschlageplatz der orientalisch-damonischen
Antike noch von einer anderen Seite her fassen; wie einerseits die Fix-
Wanderung dsr astYischen Diimonen
sternsphaera von Padua aus mit ihren astrischen Symbolen Europa iiber-
flutet, begannen eben von Padua aus andererseits die sieben Planeten,
die Wandelsterne, ihren Zug von Siiden nach Norden. Die Planeten-
symbole, wie sie in dem sogenannten Mantegna-Kartenspiel ge-
schaffen waren, lieBen sich mit iiberraschender Klarheit auf ihrem Wan-
derzuge in deutschen Nachbildungen entdecken - urn nur Augsburg,
Niirnberg, Gottingen, Erfurt, Goslar, Hildesheim, Braunschweig und
Liineburg als Stationen der Wanderschaft zu nennen -,urn schlieBlich
auch in einem plattdeutschen Kalender, den der Hamburger Arndes 1519
zu Lubeck gedruckt hat, in greifbarer kiinstlerischer Gestaltung vor die
Augen zu treten.
Wie radikal und entscheidend die Planeten als damonisch geglaubte
Zeitenherrscher in das personliche Leben der italienischen und deutschen
Europaer noch im Zeitalter der Renaissance eingreifen, konnte an zwei
ganz heterogenen Bilderreihen aufgezeigt werden. In der Farnesina
hat Agostino Chigi- worauf man bisher nie geachtet hat- in dem von
Peruzzi ausgemalten Saal seine Nativitat symbolisieren lassen: die
antiken Gotterfiguren, die einander scheinbar so harmlos gegeniiber
stehen, bedeuten Konjunktionen, und die Zusammenstellung erlaubt
sogar, wie der Observator der Hamburger Stemwarte, Herr Prof. Graff,
freundlichst nachwies, das Jahr 1465 als Zeitpunkt seiner Geburt fest-
zustellen, ein Jahr, das auch sonst (was Prof. Graff nicht bekannt war)-
eine urkundliche Bestatigung fehlt bisher - als Geburtsjahr des Chigi
angenommen wird. Die antiken astrischen Symbole in der Kuppel der
Grabkapelle desselben Agostino Chigi werden aber in Sta. Maria del
Popolo gleichsam archaologisch-asthetisch christianisiert: die Arme der
Planeten werden von Engeln, die dem Befehl Gottvaters, der im Zenit
der Kuppel erscheint, gehorchen, regiert.
Im Norden weiB man in dieser Zeit von asthetischer Entgiftung
nichts; in den Jahreska1endern erscheinen die Planetenkonjunktionen in
der Gestalt von zeitgenossischen sozialen Typen, die in ihrem Ansehen
und in ihrer Gruppierung so wenig Olympisches haben, daB, wenn sie
nicht die astrologischen Abzeichen triigen, man des ofteren glauben konnte,
etwa Szenen a us dem Bauernkriege vor sich zu haben. Den Hohepunkt
solcher leidenschaftlicher Verflechtung bildet die Konjunktion Jupiter-
Saturn im Zeichen des Skorpions, die die Grundlage zu dem viel gefiirchte-
ten Weissagungsbuch des Lichtenberger bildet. Unter dieser Konjunktion
sollte nach Abu Ma 'sars auf eine alte pagane Tradition zuriickgehender
Lehre von den groBen Perioden im Jahre 1484 der kleine Prophet ge-
boren werden, von dem die Neuordnung der geistlichen Welt ausgehen
sollte. Fiir die Virulenz solches damonischen Kultes kann es wohl kein
Orientalisierende Astrologie
iiberzeugenderes Beispiel geben als die Tatsache, daB Luther die Lichten-
bergerschen Weissagungen, deren Kernstiick eben jene fatale Planeten-
konjunktion bildet, herausgab (Wittenberg 1527), freilich mit der aus-
gesprochenen Tendenz, die wissenschaftliche Grundlage dieses astro-
logischen Glaubens ausdriicklich zu verneinen, der ja so weit gegangen
war, trotz Luthers kraftigen Widerspruchs, sein Geburtsdatum vom
10. November 1483 auf eben jenes Prophetendatum vom 22. Oktober
1484 zu verschieben, um sein Erscheinen als kosmisch vorgesehenes
Elementarereignis- sei es im guten oder im schlechten Sinne- aus-
zudeuten (vgl. A. Warburg, Heidnisch-antike Weissagung in Wort und
Bild zu Luthers Zeiten. Sitzungsber. d. Heid. Akad. d. Wiss., phil.-histor.
Klasse, Jahrg. 1920, 26. Abhandl.).
Dem gleichen Ideenkreise des ,Babyloniers" Teukros, der einerseits
die Sphaera barbarica ausgestaltete, andererseits in einem verlorenge-
gangenen Handbuch hellenistische Steinmagie betrieben haben muB,
entsprach nachlebend ein bisher unbekanntes arabisches Werk, das sich
unter dem Namen Picatrix lateinisch maskierte. Ein Zitat in einer der
neuentdeckten Bilderhandschriften aus dem Kreise des Alfonso el Sabio
(dem Vatic. Reg. 1283) hatte die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt, und
nach langwierigen Untersuchungen gliickte es, hinter dem lateinischen
M:anuskript den arabischenAutor herauszuholen, dessen Werk dank den
Bemiihungen von Ritter, Bergstrii.Ber, PleBner und Printz im beinahe
fertig gedruckten arabischen Text vorgelegt werden konnte und wahr-
scheinlich bis Ostern 1927 mit der lateinischen und deutschen Ober-
setzung veroffentlicht werden kann.
Die Kulturwissenschaft wird dann ein ,missing link" vor Augen
haben, das zeigt, wie die griechische Weisheit zur Oden hellenisierenden
Praktik entartet, die sich letzten Endes als eigentliches Substrat der
,modernen faustischen Weltanschauung" verriit. So hangt die Einsicht
in die Psychologie des inneren Zusammenhangs der Kulturbewegungen,
die vom Rande des Mittelmeerbeckens ausstrahlten, davon ab, ob sich
klassische Philologie und moderne Kunstgeschichte mit der Orientalistik
dadurch zusammenfinden, daB die Texte des alten und mittleren Orients
auch denNicht-Orientalisten in Obersetzungen zugiinglich gemacht werden.
Aus der gezeigten Bilderreihe sollte somit, unter geistesgeschicht-
lichem Gesichtspunkt, die orientalisierende Astrologie als eine dem Erbe
der Antike gegeniiber jeweilig auswahlbestimmende Macht nachgewiesen
werden, die die europaische Unfii.higkeit, die pagane Kultur in der Totali-
tiit ihrer polaren Spannung zu begreifen, als typische Funktion des ten-
denziosen ,sozialen Gedachtnisses" im Geschafte der kosmologischen
Orientierung verstiindlich macht .
Praktik und Kontemplation
Die Hoffnung der K. B. W. ist, daB noch zahlreiche weitere Meilen-
steine auf der vorerst nur trassierten WanderstraBe Kyzikos-Alexan-
drien-Oxene-Bagdad-Toledo-Rom-Ferrara-Padua-Augsburg-
Erfurt-Wittenberg-Goslar-Liineburg-Hamburg ausgegraben werden,
damit in steigender Unanfechtbarkeit die europaische Kultur als Ausein-
andersetzungserzeugnis heraustritt, ein ProzeB, bei dem wir, soweit die
astrologischen Orientierungsversuche in Betracht kommen, weder nach
Freund noch Feind zu suchen haben, sondern vielmehr nach Symptomen
einer zwischen weitgespannten Gegenpolen pendelnden, aber in sich ein-
heitlichen Seelenschwingung: von kultischer Praktik zur mathematischen
Kontemplation - und zuriick.
566
GELEGENHEITSSCHRIFTEN
AMERIKANISCHE CHAP-BOOKS
570
57 I
Seit etwa drei Jahren erscheinen in den groBeren Stadten Nord-
amerikas billige Halbmonatsschriften kleinen Formates, in denen junge
Schriftsteller und Kiinstler einen neuen Ton anzuschlagen sich bemiihen.
Von dieser Bewegung Kenntnis zu nehmen verlohnt sich schon des-
halb, weil die amerikanische Spielart der Modernitat zur allgemeinen
Naturgeschichte ,Neuester" und ,Jiingster" eine eigenartige Ergan-
zung bildet.
Man konnte diese Taschen-Magazine ihrer Tendenz nach als 'perio-
dicals of protest' bezeichnen- wie sich das eine von ihnen 'The Phi-
listine' selbst benennt -, denn die best en unter ihnen werden von dem
ernsthaften Wunsche geleitet, der gedankenlosen vulgaren Sensations-
lust durch Kritik und selbstandige Beitrage entgegenzuwirken.
Das 'Chap-Book' eroffnete den Reigen der ,Kobold-Literatur" im
Mai 1894. Zwei junge Harvard-graduates Herbert S. Stone und H. J. Kim-
ball waren die Herausgeber, denen sich Bliss Carman, ein moderner
amerikanischer Romantiker, als Redakteur zugesellte, bis Stone und
Kimball im August 1894 von Boston nach Chicago iibersiedelten. Seit
April 1896 ist Mr. Stone, welcher der Zeitschrift eine etwas veranderte
Richtung gegeben hat und deren Umfang und den Preis auf das Doppelte
erhohte (m Cents die Nummer oder 2 Dollar jahrlich), der alleinige
Leiter.
Das 'Chap-Book' markierte bei seinem Erscheinen auBerlich das
billige Volksbuch der guten alten Zeit, wie es der fahrende englische
Kaufmann den biederen Lenten auf dem Lande als neueste Lektiire
mitbrachte.
1
} Indessen will diese Naivitat des Auftretens nicht recht zu
dem Inhalt des Chap-Book von Chicago passen; von derber Hausmanns-
kost ist wenig zu finden: man rechnet im Gegenteil auf Feinschmecker,
die die besten Kiichen von Paris und London gewohnt sind, und solange
Kaviar noch nicht als selbstverstandlicher Bestandteil amerikanischer
Volksernahrung gilt, wird man den Inhalt des Chap-Book nur zum ge-
ringsten Teil als volkstiimlich bezeichnen konnen. Das Chap-Book will
I) Vgl. John Ashton's Essai iiber Chap-Books im Ch. B. III.
Warburg, Gesammelte Schriften Bd.
37
572
Atmrikanische Chap-Books
sogar nur in begrenztem Sinne amerikanisch sein, da sein Hauptaugen-
merk darauf gerichtet ist, seinen Leserkreis mit dem Modernsten in
Kosmopolis in Bertihrung zu bringen.
Eine Reihe bekannter englischer und franzosischer Schriftsteller -
von neuer deutscher Kunst weiB das Chap-Book noch nicht viel-- geben
feinsinnige Analysen oder dichterische Beitriige. Anatole France z. B.
referiert tiber Paul Verlaine, und neben den poetischen Schopfungen der
Jungen Amerikas Kenneth Grahame, Gilbert Parker, Bliss Carman finden
wir Dichtungen von R. L. Stevenson, Henry James und W. Sharp, der
auch gelegentlich die Schriftsteller der Belgischen Renaissance' ' be-
spricht.
Das ganze Pantheon fin de siecle wird kritisch durchleuchtet:
Trilby, die buntschillernde Eintagsfliege, Beardsley, Wilde neben Maeter-
linck, R. L. Stevenson und Ibsen.
Wiihrend die typographische Ausstattung sehr geschmackvoll ist,
sind die kiinstlerischen Beitriige, soweit sie von Amerikanern herriihren,
abgesehen von den Anzeigeplakaten Bradley's, der schwiichste Teil;
von ausli.i.ndischen Kiinstlern triigt Valloton Portriits von Zola und Mal-
larme bei.
Die Gefahr, ein weichlich anempfindendes Taschenmagazin der lite-
rarischen Mode zu werden, vermeidet das Chap-Book dadurch, daB es
gelegentlich den Modernen das Wort zu scharfer Selbstkritik gibt: so
eifern Hamilton W. Mable (one word more) und Norman Hapgood (the
intellectual Parvenu) schonungslos und treffend gegen dekadenten Ma-
nierismus. Ein anderes starkes Gegengewicht gegen gesuchte Modernitat
gibt das echt amerikanische Kunstwerk der 'short story', von denen eine
Reihe von Frauen geschrieben ist.
Man gewinnt dabei den Eindruck, daB die amerikanische Frau,
welche durch das scharfe Tempo des Milieus davor bewahrt wird, seelische
Feinfiihligkeit in breite Sentimentalitiit ausflieBen zu lassen, fiir die Er-
fassung und Wiedergabe des psychologischen Augenblicksbildes besondere
Begabung besitzt.
So zum Beispiel geben Katherine Bates, Alice Brown, und Maria
Louise Pool solche Bilder aus dem Kleinleben in der Stadt und auf dem
Lande, die dem europiiischen Leser durch die kiinstlerisch abgewogene
Mischung von Ernst und Heiterkeit, verbunden mit scharfern Blick fiir
das Einzelne und Wirkliche, eine besonders anziehende Gattung der
Erzahlungsliteratur erschlieBen.
Das 'Chap-Book' fiihrt jetzt den Untertitel: 'A miscellany and
Review of Belles Lettres' ; es hat die leichtsinnigen Manieren des Bohe-
mien abgestreift und ersetzt, was es dabei an anspruchsloser Grazie ver-
Abb. I 54 Ernest Peixotto, LeRetour
de l' Impressioniste, a us: The Lark,
S.Francisco 1896,No.6(zu Scite 577).
Tafel LXXXIX
. '
Remarkable .
truly, is .drt!
See-Elliptical ;eM
Wheels on a Cart I
It looks .very fair .;... .. .
In the Picture up there;
But imagine th;
Ride when you start I .
. 1'
Abb. 155.
Gelett Burgess, Remarkable is Art,
ebcla. No. 8 (zu Seite 573).
Abb. 156. Bruce Porter, The Piping Faun, ebda. No. II (zu Seite 577).
Abb. 157. Gelett Burgess, Schlu/3vignette, t'bcla. Anhang zum 1. Jahrgang
(zu Seite 573).
Chaf'akterisierung
573
loren hat, durch ernsthafte Bedeutsamkeit als nervoses kritisches Organ,
das die Sensationen des Augenblicks einerseits lebhaft empfindet und
andererseits die Fiihigkeit zur Analyse und Kritik derselben von sich
und seinen Lesern verlangt.
Nachdem das Chap-Book Mode geworden war, schossen die kleinen
Zeitschriften wie Pilze aus dem Boden, meistens, wie diese, sehr bunt,
aber ungenieBbar. Sie sind, wenn man von einzelnen, wie z. B. 'The
Philistine', absieht, TJ.Ur affektierte Nachahmung des Chap-Books.
1
)
Nur eines diesel Magazine kann auf selbsHindige Bedeutung An-
spruch erheben, 'The Lark' (Die Lerche). Sie erschien gerade ein Jahr
spater als das Chap-Book (Mai 1895) im Verlage von W. Doxey in
San Franzisco.
Die Begriinder und Leiter sind zwei junge kalifornische Kiinstler,
Gelett Burgess und Bruce Porter, die sich beide als echte Humoristen
in dem Gefiihl zusammenfanden, daB die kleinlichen Interessen des
Augenblicks selbst im goldsuchenden Kalifornien nicht das Recht haben,
die menschliche Seele in dumpfem Bann zu halten.
Gelett Burgess birgt unter der Maske des pointierten Spotters und
Karikaturisten die natiirliche Empfanglichkeit eines Studenten auf
Ferien, der bald ,Stumpfsinnslieder" zum besten gibt, oder mit ,Vi-
vette", seiner zierlichen Muse aus dem Quartier latin, im amiisanten
Zwiegesprache kiinstlerische Taten plant, bald auch, wenn der Himmel
bewolkt ist, fiir die kleinen Freuden und Leiden des Menschenherzens
zartlichen poetischen Ausdruck findet.
Von Gelett Burgess' originellen Karikaturen, die uns zunachst frei-
lich seltsam beriihren, geben die Elliptical Wheels' [Abb. I55] eine Probe;
von ihm stammt auch das Titelblatt zur ersten Nummer und die kleine
Vignette, in der sich Schnellzug, Telegraphenstangen und Rauchwolken
zu einem launigen Ornament zusammenfiigen [Abb. 157].
Von der ernsten Seite gibt er sich in den Gedichten 'Why not, my
soul' und 'Christmas in Town'.
1) Um den deskriptiven Teil der Flora nicht zu vernachUI.ssigen, fuhre ich einige
Titel an:
Boston: Miss Blue Stocking; Paragraphs; The Truth in Boston; The Black Cat;
The Shadow.
Cincinnati: The New Bohemian; The Blue Book.
New York: Chips; The Philistine; Whims.
Kansas: The Lotus. - Fast aile in Oktavformat.
574
Amerikanische Chap-Books
Why not, my soul.
Why not, my Soul ?-why not fare forth and fly
Free as thy dreams were free !-with them to vie:
There thou wert bold-thou knew'st not doubt nor fear,
Thy will was there thy deed-ah, why not here?
Thou need'st but faith to carry thee on high!
A thousand things that others dare not try,
A thousand hopes thy heart doth prophesy,
Thou knowest the Master Word, Oh speak it clear!
Why not, my soul?
Let not this world of little things deny;
Break thy frail bonds and in those dreams rely.
Trust to the counsels of that other sphere;
Let that night's vision in the day appear.
Walk forth upon the water,-wing the sky!
Why not, my soul?
CHRISTMAS IN TOWN
This is the magic month of all the year,
Holding the children's golden precious Day;
Of which, with eager eyes, we hear them say
''In three weeks,-two weeks,-one week 't will be here!''
The sparkling windows of the shops appear
In fascinating wonder-bright array;
With holly and with greens the streets are gay;
The bustling town begins its Christmas cheer.
Now secret plots are whispered in the hall,
Mysterious parcels to the door are brought,
And busy hands are half-done gifts concealing.
The Eve is here; with lighted tree and all!
And Santa Claus, with merry marvels fraught,
Before the dawn, across the roofs comes stealing.
Ein vorziigliches Stuck seines echten und amerikanischen Humors
ist die Eisenbahnhumoreske, Nr. 17 (r. Sept. r8g6):
Beispiele
575
'THE PITFALLS OF MYSTICISM'
Monotony, C.P.R. R.,-a station and two small wooden buildings;
a blank waste of prairie, a line of track, straight to the level horizon, a
cloudless sky. The Ogden Express, (East-bound) is waiting upon a siding.
A distant whistle, a faint hum, a vibrant roar,-a pounding, rattling
rush of noises, and the West-bound Chicago Limited throws itself alongside
the station, panting and throbbing. The air-brakes settle back with a
long hiss, the escape-valve roars hoarsely, a cloud of vapour rising like
the Genie emerging from the Bottle, while the locomotive drinks eagerly
from the tank. Dusty travellers crawl from the coaches, and pace stiffly
up and down the board walk, in the sunshine.
A young man with golf cap and cigarette, walks leisurely down the
alley between the trains, and seats himself upon the steps of a vestibule
of the Ogden Express. Directly opposite him is the platform of the last
Pullman of the Chicago Limited. Through the door of this coach, enters
to him, a young woman,- a lady, by every proof of face, dress and
bearing. She holds in one hand a note-book of the Lectures of Vivekananda
and stands by the iron rail of the platform after glancing frankly at the
young man. After a minute she speaks,-always in a low, dreamy,
almost impersonal tone and manner. He is keenly sensitive, yet obviously
restrained, as if uncertain of the niceties of his replies.
She: Are you,-what is called conventional?
He: I beg your pardon,-are you speaking to me?
She: To you-yes, in a way. To the individual You, not to the
personal You, though. Do you know what I mean?
He: Why, yes, I think so;-yet if I do know what you mean, there
is no need of asking such a question, is there?
She: That 's very true. Still, it was such an effort to speak at all.
You might so easily have misunderstood me.
He: Yon can trust me,-we are of the same caste, I assure you,-and
there are some things that even a man knows by intuition.
She: You think so? Then you think we can say what we really
think, without disguise, in these three minutes? The porter said we were
to stay here only three minutes.
He: But why for only three minutes?
She: Ah, that's the mystery of it all! Why is it? Yet if it were for
longer, I would never dare speak to you at all. But it has seemed so
strange to me,-these flying glimpses of people ;-like images seen in
a flash-light picture, and then fading away into nothing. I could n't
Amerikanische Chap-Books
stand it. It seemed as if I must speak to some one, and say something
real, and then be swept apart. What does it all mean? Do you think we
have ever met before?
He: Why, yes,-I know it.
She: You feel it too? Oh, I wonder when! Perhaps thousands of
years ago ;-who knows?
He: But we shall meet again, shan't we?
She: Ah, yes,-perhaps;-thousands of years hence, may be. I wish
I could feel sure of it!
He: I feel sure of it.
She: Do you? I wonder how we shall know each other! If I could
only give you some word to know me by! Some message for you to keep!
I feel as if you were on some passing star, and I trying to speak to you,
before you were swept into space again. It 's all like a dream I I wonder
if you understand why I am talking to you like this!
He: I think I understand you better than you understand me.
She: Why? But there is the bell, and I shall never know-till the
next time. Good-bye! See, your train is moving, you must hurry! Good-
bye! Oh, ohl get on your train, please! Oh, you will be left! Why don't
you go? You must goi-There, the train has gone! 'What do you mean?
You mustn't follow me, you will spoil everything. Oh, why did I begin
this I What are you going to do ?
He: I am going to Ogden. I hope you will forgive mel
She: But you were on the other train!
He: For three minutes only. I have been in this car, four seats behind
you, ever since we left Chicago I
Bruce Porter, als europaisch geschulter trefflicher Maler in groBem
dekorativen Stil bekannt, offenbart auch in seiner ethischen und dichte-
rischen Anschauung eine groBangelegte idealistische Natur, die gegen
das gemeine und unwahre Banausentum eine tie ironische Abneigung hat.
Besser, als eine Umschreibung es vermag, charakterisieren ihn seine
Sachen selbst, wie z. B. nachfolgender Prolog zur Lark:
,"Hark! hark! The Lark at heaven's gate sings!"
A new note-some of the joy of the morning- set here for the
refreshment of our souls in the heat of mid-day.
With no more serious intention than to be gay-to sing a song, to
tell a story ;-and when this is no longer to our liking,-when the spring
calls, or the road invites,-then this little house of pleasure will close
its doors; and if you have cared for our singing, and would have more
of it, then you must follow us a-field.
For, after all, there's your place and ours-there you may hear
Bedeutung
577
the birds calling, and see trees blowing, and know the great content of
the earth. Meantime, shut in the town, we shall blow our nickel pipe,
to make you believe it is a reed, and that you dance, garlanded, to its
piping."
Von seinen Zeichnungen ist der (erheblich verkleinerte) ,flotende
Faun" [Abb. 156] reproduziert.
Als illustrierende Gehilfen geben der Lark Willis Polk, Ernest
Peixotto und Florence Lundborg Beitrage. Peixotto variierte in sinn-
reicher Weise das Thema der Lerche, die auf dem Titelblatt der Zeit-
schrift nach verschiedenen Zitaten bekannter Dichter dargestellt wird,
und von ihm stammt auch der witzige Einfall des 'Retour de l'impres-
sioniste' [Abb. 154].
Die auBere Ausstattung der Lark ist gesucht einfach; das Papier
ist gelb und so diinn, daB es nur einseitig bedruckt werden kann. Aber
trotz dieser scheinbar gesuchten Naivitat und auch trotz der groBen
literarischen Vorbildung, die die Lark voraussetzt, ist eine echte kiinst-
lerische Unbefangenheit vorhanden. Mogen uns Burgess' SpaBe auch
manchmal zugespitzt und fremdartig vorkommen, ein starker Humor,
der dem Leben wirklich iiberlegen ist, kampft einen frischen, frohlichen
Kampf gegen die fin de siecle Pose selbstgefalliger Miidigkeit; wir schul-
den, denke ich, den tapferen Streitern im fernen Westen fiir ihren alt-
modischen Idealismus einen freundlichen Zuruf.
Wenn es der eigentliche Sinn und die - beinahe ethisch zu nen-
nende- Aufgabe eines amerikanischen Chap-Books ist, die unbefangene
kiinstlerische Auffassung des Lebens dem humorlosen, hastigen Tages-
getriebe entgegenzustellen, dann ist die 'Lark' unter den vorhandenen
Zeitschriften dieser Art die beste.
DIE WANDBILDER IM
HAMBURGISCHEN RATHAUSSAALE
579
s8o
581
Die Wandbilderreihe im groBen Saale des hamburgischen Rathauses
malte Professor Hugo Vogel in einer kritischen Obergangszeit des histo-
rischen Monumentalstils.
Die malende Geschichtsdarstellung begann jene Stilwandlung, die
sich in der schreibenden Historie anbahnte, mitzumachen: hier wie dort
suchte man, von der antiquarisch-politischen Einzelerzahl.ung zu ,groB-
ziigig" typenpdi.gender Oberschau ganzer Kulturepochen fortzuschreiten.
Der Kiinstler und seine Auftraggeber wurden sich im Laufe der Jahre
dieser problematischen Situation mit steigender Deutlichkeit bewuBt und
bemiihten sich nach Kraften, einen Ausgleich zwischen alten und neuen
Stilelementen zu finden. Die hierbei heraustretende stoffliche und formale
Gegenslitzlichkeit lliBt den Sinn dieses Kampfes urn den Stil deutlicher
erkennen, wenn man die technologischen und inhalilichen Kontrast-
erscheinungen als organisch zusammengehOrige Symptome derselben Ge-
schmackskrisis ansieht: die historische Figurenwelt verlangte noch den
umreiBenden Stift, das Instrument der alten expressionistischen Nah-
kunst, die erzahlen will; der landschaftliche Hintergrund dagegen er-
forderte bereits das der impressionistischen Fernkunst eigene Werkzeug:
den die Farbenwerte flachenhaft auftragenden Breitpinsel, der Milieu-
stimmung schafft.
Durch gewandte Handhabung beider Ausdrucksmittel gelang nun
dem Maler ein stilistisches Ausgleichserzeugnis, das den bestechenden
Eindruck symphonischer Zusammenwirkung zwischen Mensch und Land-
schaft hervorruft. Die UnzuHinglichkeit dieses KompromiBversuches fest-
zustellen, konnte selbstverstlindlich nicht die Aufgabe jener offiziellen
AuBerungen sein, die die Enthiillung im J uni unmittelbar begleiteten.
Der Ritus offentlicher Siegerkronung wurde damals wie iiblich mit
Staatspreismedaille und ,Eroffnung eines neuen Geschichtsblattes" voll-
zogen, begleitet von einer wohlorganisierten journalistischen Ruhmes-
kanonade; so festlich erhohte Temperatur erzeugte dann noch zu Weih-
nachten einen weniger ephemeren Niederschlag, der wissenschaftlich
ernst zu nehmen ist; Richard Graul kommt in seinem Prachtwerke
1
)
x) Richard Graul, die Wandgemll.lde des gro13en Saales im Hamburger Rathaus.
(Leipzig xgog).
Die Wandbildet' im hambut'gischen Rathaussaale
der laudatorischen Tendenz mit den Mitteln entwicklungsgeschichtlicher
Beobachtung so geschickt zu Hilfe, daB die allzu besanftigenden Tone,
die er der Trompete der Fama entlockt, die GegenauBerung der trockenen
Analyse eines problematischen Versuches zur kunstwissenschaftlichen
Pflicht machen. Allein schon deshalb, damit nicht durch den auBeren
Nachdruck des hamburgischen Erfolges der Verzicht auf psychische
Spannungssteigerung programma tisch werde fiir einen neuen historischen
Monumentalstil.
Worin haben wir nun, den Bilderzyklus der fiinf Kulturphasen
Hamburgs betrachtend, im Sinne der Bewunderer des Meisters dennoch
die Symptome fortschreitender monumentaler Stilbildung zu erkennen?
Doch wohl vor allem in der Beseitigung der vom Theater her in die
Malerei eingedrungenen Untugenden in Mimik, Beiwerk und Hintergrund.
An Stelle iiberlauter Mitteilsamkeit im wesensfremden Stile romanisie-
renden Pathos soli stille zusammengefaBte Menschlichkeit treten, deren
hohere von innen heraus deutliche Charaktere des antiquarisch getreuen
oder sinnbildlich erklarenden Aufputzes entraten konnen. Sie bediirfen
auch nicht mehr zur Wesensbezeichnung der wechselnden, echtes Lokal-
kolorit vortauschenden Kulisse; heimatliche Landschaftsmotive um-
spannen mit einheitlichem Horizont die fiinfiache Symboiisierung boden-
standigen Geschehens. In der Idee und Ausfiihrung dieser Hintergrunds-
behandlung liegt ohne Zweifel an sich eine positive kiinstlerische Errun-
genschaft; sie entspricht durch einen gefallig pasteurisierten Impressionis-
m us den dekorativen Forderungen groBraumiger Wandkunst und erfilllt
zugleich den Rathaussaal mit einer blaugrauen Luftstimmung, die die
seelische Ausdruckslosigkeit der Milieubewohner als stilgemaBe Folge
niedersachsischer Nebelatmosphare dem Auge plausibel macht. Man
genoB die Ruhe des Ganzen um so dankbarer, als man die unruhige
Didaktik Diisseldorfer Historien nicht mit Unrecht befiirchtet hatte.
Landschaft und Figuren aber batten sich jetzt, nachdem der Maler sich
von ,Diisseldorfer Velleitaten" in Paris ,gereinigt" hatte, die besten
Monumentalmanieren angeeignet.
Das erste Bild, eine unbevolkerte Urlandschaft, versprach noch -
was nachher nicht erfiillt wurde - eine umstilisierende Durchgeistigung
des dekorativ Landschaftlichen. Man mochte auch die graue Herbststim-
mung - nach dem erklarenden Programm des Kiinstlers selbst - sich
gefallen lassen als eben nicht gerade tiefsinniges Symbol der grauen Vorzeit.
Im zweiten Bilde der Vorzeit muBte dann zuerst die Grenze dekora-
tiven Begabungsgebietes iiberschritten ~ e r d e n . Die seelische Neutralitat
des Figiirlichen auf dem ,vorgeschichtlichen Zeitalter" wirkte zunachst
nicht gerade verletzend; Puvis de Chavannes hatte nicht umsonst den
Vogel und die Historienmalerei
Sprachschatz offizieller Monumentalitat urn die Wirkungsakzente stillen
in sich gesammelten Menschentums bereichert; von seiner Errungenschaft
profitieren die Gestalten Vogels zunachst negativ, insofern sie lebhaftes
Gestikulieren unterlassen; aber wahrend bei dem Franzosen die auBer-
liche Ruhe sich mitteilt wie gebildete Selbstbeherrschung mitfiihlender
Menschen, beruhigt die Fischersleute auf dem Vorzeitgemalde die Passivi-
tat seelisch unbeteiligter Madelle; selbst die Bootschieber, auch wenn
man sie nicht gerade an Feuerbach miBt, scheinen dem Stilleben ihrer
routiniert gezeichneten Muskelpartien keine aktive Energie einzufloBen.
Immerhin kann man sich mit dem gefallig angeordneten und akademisch
gut durchgebildeten Gruppenbild noch dadurch abfinden, daB man den
gedriickten Charakter der Bevolkerung als typischen Gemiitszustand
primitiver Menschen nachempfindet, wie sie dem Erwachen der Kultur
entgegendammern.
Leere und Schweigen sind jedoch bei dem Mitteibilde - den An-
fangen der christlichen Kultur - nicht mehr als stimmungsbildende
Faktoren zu gebrauchen; hier muBte einmallapidar gesprochen werden.
Die Komposition war urspriinglich durch die obere Halfte des Portals
in zwei Szenen zerlegt; links ein Gaugraf mit Reitergefolge, rechts der
Bischof, die Heidenbekehrung durch die Taufe vollziehend. Dem Wunsch
des Kiinstlers nach einer einheitlichen Flache entsprach man spater
verstandigerweise durch Entfernung der trennenden und driickenden
oberen Portalhillte. Die dadurch entstandene Liicke fiillte der Maler
aus durch eine Prozession weiBgekleideter Trager des ,goldenen Schreins
mit den Reliquien des heiligen Petrus" (Graul). Im letzten Augenblick
anderte sich der Hauptakt wesentlich: der Taufling wurde dem Bischof
entrissen, so daB dessen im wesentlichen beibehaltene Taufhandlungs-
mimik zu einer inhaltsleeren rhetorischen Geste verkiimmert; er soll
jetzt predigen tiber den freigewordenen Raum hinweg zu einer im Sumpfe
stehenden Ansammlung von Frauen und Mannern. Diese t.ochst auffallige
Verflachung der Hauptaktion begriindet Graul damit, daB die Taufe
ein ,allgemach etwas banaler Vorwurf volkstiimlicher Historienmalerei
geworden sei, dem die haufige Wiederholung viel von seiner Weihe ge-
nommen habe". Verbrauchte Stoffe mag der Dekorateur fiirchten, nicht
ein bildender Kiinstler, vorausgesetzt, daB fiir ihn die Umschopfung
eines iiberlieferten Stoffes nur der auBere AnlaB innersten Gestaltungs-
triebes ist, der nach gesteigertem Ausdruck ringt. Das eklektische Tem-
perament Vogels bewahrt ihn freilich vor solchem Wettkampf urn den
hoheren und intensiveren Ausdruck; es neigt im Gegenteil dazu, Wasser
in den Wein der Lehrmeister zu gieBen und die Art dieses Verdiinnungs-
prozesses laBt sich gerade hier deutlich beobachten, wo ein bestimmtes
Die Wandbilder im hamburgischen Rathaussaale
Bild von Puvis de Chavannes vorbildlich eingewirkt hat: die Begegnung
der kleinen Genoveva mit dem heiligen Germain im Pantheon in Paris;
beide Wandbilder behandeln das Motiv eines Bischofsheiligen, wie er
zwischen andachtigen Menschengruppen eine feierliche Einzelhandlung
vollzieht; durch des Heiligen Handauflegung scheint bei dem franzosi-
schen Meister das religiose Fluidum auf das Kind und seine Gemeinschaft
iiberzugehen, die in starker Ergriffenheit verstummen. Die Stille, die sie
umfangt, ist eben nur das auBere Symptom eines konkreten religiosen
Erlebnisses, und auf dem Willen und der Fahigkeit zur Nacherfahrung
so selbstvergessener Andacht beruht die dauernd packende Eindrucks-
kraft jener ,stimmungsvollen Harmonie"; sie aber allein urn ihres
auBeren asthetischen Reizes willen verwerten und dabei zugleich vor
sinnfalliger Verkorperung zuriickweichen, weil man sich der Grund-
bedingung personlichen Nacherlebens nicht gewachsen fiihlt, bewirkt
eben, daB die ergreifenden Audsruckswerte innerlicher Kultur zu leeren
Anstandsregeln fiir diensttuende Kunstwerke verblassen. Fiir die AuJ3er-
lichkeit des Schaffensprozesses ist ferner die unfreiwillige Akzentver-
schiebung symptomatisch, die jene Ausdrucksscheu bewirkte: da der
Bischof nicht mehr durch seine Taufhandlung die Aufmerksamkeit nach
rechts lenkt, wird der auBere Bildmittelpunkt mit der Prozession, als
deren Fiihrer nunmehr der Bischof erscheint, auch fiir den Haupteindruck
bestimmend, und der unbefangeneZuschauer erblickt jetzt als Symbolum
des Eintritts christlicher Kultur, des ,wichtigsten Wendepunktes in der
Geschichte der heimatlichen Scholle": die Einfiihrung des Reliquien-
kultes unter dem Schutze der weltlichen Macht.
Der goldene Schimmer des Reliquienschreines, der iiber dem Ham-
burgischen Staatswappen des Portales im architektonischen und illustra-
tiven Zentralpunkte des Ganzen aufsteigt, verrat dem nachdenklicheren
Geschichtsfreund, daJ3 es nur eine Scheinemanzipation vom antiqua-
rischen Historienstil bedeutet, wenn man die sinnvollen Realien der
Geschichte artistischen Zwecken unterwirft; liturgische Gewandung und
Geratschaften sind eben ihrer wesentlicheren Qualitat nach nicht Farben-
valeurs und Linienkadenzen. Wer sich weiter vergegenwartigt, daJ3 an
dieser Stelle einst Carl Gehrts den Sieg der Reformation schildern
sollte, dem wird die 'Oberwindung der ,unruhigen Redseligkeit" des
Religionsgespraches ein teuer erkaufter Sieg der Atelierfeinheit iiber das
historisch Charaktervolle erscheinen.
Die entscheidende Wendung der Stilkrisis muBte, wie die Abbil-
dungen bei Graul verfolgen lassen, beim dritten Wandgemiilde eintreten.
Im ,alten Hamburg" muBten jetzt entweder Kostiimfigur oder Volks-
seele zum herrschenden Stilprinzip der Typenbildung werden. Der wohl-
,Atelierfeinheit" und , Volksseele"
feile Versuch, hanseatisches Milieu durchein Nebeneinandervonmodernen
Fischerdorfrealismen und mittelalterlicher Trachtenkunde zu versinn-
bildlichen, fiihrte - freilich erst nachdem das KompromiBprodukt an
der Riesenwand ausgefiihrt, seine Lebensunfahigkeit eingestanden -
zur Peripetie. Die Volksseele siegte; mit starken Verlusten, die jedoch
nicht zu beklagen sind: nur vergroBerungsunwiirdige Skizzenbuchplati-
ttiden fielen. Ihr Wegfall kann indes den Uberlebenden noch nicht zu der
erforderlichen inneren GroBe verhelfen. Zwei Mannergruppen in der Ecke
links markieren den Wagemut hanseatischer Kaufmannsenergie: ein
alter langberockter Herr sucht sich, von ein paar gleichgilltigen Water-
kantlern umgeben, mit einer Seemannstype tiber den Inhalt eines Blattes
zu verstandigen, wahrend ftinf andere Leute hinter ihnen durch zwei
Kisten und drei Sacke die Ladefahigkeit eines unmoglichen Segelfahr-
zeuges gefahrden. Andere Schiffe, im Baustile zwischen Mittelalter und
N euzeit unsicher schwankend, dekorieren einen Strandhafen, den eine grau-
blau schimmernde Stadtvedute umrahmt. Es ist klar, warum Personal-
verminderung hier nicht wie organische Auslese der Passenderen fiir
monumentale Existenz wirkte; den Ktinstler drangte es nicht a us inner-
ster Schaffensnot zur Typenvereinfachung. Keine qualende Uberftille
seelischer Einzelerlebnisse zwang ihn aus elementarer Notwendigkeit zu
genialer Synthese, die allein den Geschopfen der Phantasie die ungewollt
tiberzeugende Symbolik idealer Humanitat einzuhauchen vermag. Da-
her muBte jenes auf dem vierten Bilde vorgenommene Experiment, eine
kulturgeschichtliche Epoche ohne die konventionellen Belebungsmittel
der Tracht und der Gebarde zu schildern, nur eine Art lebensgroB ge-
mimter Heimatkunde hervorbringen, deren Gehalt im Rahmen an-
spruchsloser Buchillustration sein kongenialeres Format fande. Und trotz-
dem bedurfte es erst noch - auf dem heute versch"'".mdenen fiinften
Bilde - jenes Massenversuchs, die in hoheren Monumentalkreisen lib-
lichen Formen abzustreifen, ehe man bodenstandlerischer Ntichternheit
das Privilegium monumentalen Auftretens aberkannte zugunsten eines
menschenfreien Panoramas; denn unter diesem ruht eine bereits vollig
ausgefiihrte Apotheose modernen Volkslebens: Stidwestermanner, flag-
genhissende Matrosen, mit einer erschtitternd monumentalinfreien Vier-
landerin im Mittelpunkt und Vordergrunde, kurz, das ganze Schlu.Bbild-
gewimmel eines Lokalsttickes in St. Pauli durfte erst das vom Ktinstler
kritiklos verliehene Privilegium monumentalen Auftretens offentlich miB-
brauchen, ehe es im heimatlichen Strome den siihnenden Opfertod fand.
Diese ganze fatale Stilkrisis, die der Maler durchmachte, war sub-
jektiv heilsam und objektiv respektabel, soweit der Ktinstler und seine
Freunde jene Zeugen dafiir diskret verschwinden lassen, daB der Ktinstler
586 Die Wat1dbilder im hambu1gischen Rathaussaale
selbst am Ende einer Iangen Schaffensperiode einer so genrehaften Bana-
lWit den unverantwortlichen Versuch gestattet, sich zu monumentaler
GroBe aufzublasen. Graul prasentiert dagegen jene verflossenen Beweis-
stiicke mangelnder kiinstlerischer Selbstkritik im groBtmoglichen For-
mate, ohne diese Leistungen gebiihrend zu distanzieren. Der Kiinstler
selbst verdeckte ja seinen Riickzug als charakterbildender Epiker durch
einen VorstoB des landschaftlichen Stimmungsdekorateurs; das flott
hingesetzte Hafenstiick, das die menschen- und bewegungerzeugende
Schopferkraft auf gar keine Probe mehr stellte, interessiert stofflich, und
indem es die inhaltliche Leere des Ganzen durch einen breiten Strom
schillernden Elbwassers ausgleicht, tauscht es dariiber weg, daB die Ein-
zelbestandteile des kiinstlerischen Erlebnisses den LauterungsprozeB
stilisierender Umschmelzung zu hoherer Einheit nicht erfahren haben.
Vogels historischer Monumentalstil spricht also das entscheidend
zusammenfassende SchluBwort unter Verzicht auf das eigentlichste und
hochste Ausdrucksmittel der Historie, des beseelten Menschentums.
Landschaftliche Stimmungswerte lenken zugleich von der energetischen
Unzulanglichkeit der noch vorhandenen Figurenwelt der Hauptbilder-
wand so erfolgreich ab, daB der visuell einschmeichelnd beruhigte Be-
schauer sich nicht erst durch die Frage stort, ob denn diese Gemaldesuite
das ihrem pomposen Format entsprechende Minimalquantum sinnfalliger
Aufklarungsenergie mitteilt.
Wer das Amt reprasentativer Geschichtsverkiindung offentlich iiber-
nimmt, verpflichtet sich dazu, als soziales Erinnerungsorgan zu funk-
tionieren, das zuriickschauender Selbsterkenntnis zur Besinnung auf die
wesentlichen Entwicklungsmomente verhelfen soil; wenn nun aber jenes
Riesentryptichon von Strandidyll, religiosem Zeremonialakt und Lan-
dungsplatz die Quintessenz Hamburgischer Kuiturbewegung ausreichend
versinnbildlicht, so ist eben den Hamburgern und ihrem berufenen Organ
im Augenblick hOchster Gedachtnisanspannung nichts aufregend GroBes,
nicbt einmal menschlicb Wesentliches eingefallen, das zu so monumen-
talem Vortrage berechtigte. Diese Unbedeutsamkeit verspiirt Graul offen-
bar nicht; er preist den Wandschmuck als ,gewaltiges Epos", als ein
,bohes Lied auf die Kultur im Elbstromlande", das eine ,enthusiastische
Empfindung fiir die GroBe Hamburgs" erweckt.
Hamburg scheint die festlich optimistiscbe Beurteilung dieses proble-
matischen Ausgleicbsversuches zu teilen; Heliograviiren, die ohne die
dekorativ verdienstliche Farbenwirkung nur auf den fragwiirdigen panto-
mimiscben Aufklarungswert der Staffage reduziert sind, schmiicken be-
reits Hamburgs Gymnasien; hoffentlich verhindert es die Finanzlage,
den Rubm der Rathausbilder derartig in staatlicbe Regie zu nehmen,
Monumentalmalerei und Geschichtsverkundung
daB man noch andere weitere Kreise der werdenden J ugend mit pseudo-
monumentalen Surrogaten wirklich groBgesinnter Vergangenheitskunde
versorgt. Die Scheu vor falschem Enthusiasmus ist ja als Reaktion gegen
die friihere Geschichtsrhetorik eine verstandliche Zeiterscheinung; aber
solche Dyspepsien gehen voriiber; Goethes Zeit erwartete noch, daB
Kunstwerke: ,aufregen und nutzen". Solche Zeiten diirften wieder-
kommen. ,Von der Aufregung zur Anregung" miiBte dann in dem un-
geschriebenen Buche von den Seelenmoden im 20. Jahrhundert jenes
Kapitel Iauten, das den EinfluB des ermiideten Arbeitsmenschen auf
die kiinstlerische Kultur behandelt. Hamburgs Rathauswandschmuck
wiirde dann ein belehrendes Objekt abgeben fiir die Sozialpsychologie
einer Epoche, die schon froh war, ,Schlimmeres zu verhiiten", wo sie
kategorisch das Hochste hatte fordern miissen.
Warburg, Gesammelte Schriften Bd. 2
DIE BILDERAUSSTELLUNGEN
DES VOLKSHEIMS
590
591
Die Jugendbilderausstellung - die emz1ge, die in diesem Jahre
stattfand - bestatigte den Erfolg friiherer Veranstaltungen dieser Art.
Es wurden in etwa fiinf Wochen 667 Bilder verkauft. Als dann der Plan
einer Rembrandt-Ausstellung auftauchte, meldeten sich jedoch Hinder-
nisse und Zweifel, die trotz eingehender Besprechung nicht beseitigt
werden konnten.
Ich will in ein paar kurzen Worten die Bedenken, die mich person-
lich in dem zweiten Stadium unserer Kunstbestrebungen verhindem,
durch Surrogate die Volksseele asthetisch anzuregen, zusammenfassen:
Das erste Stadium der negativen Verdienstlichkeit, den Feldzug
gegen den spieBigen Ungeschmack, dem das Volksheim mit den Jugend-
blattem frisch zuleibe ging, konnte ich ohne kunsthistorische Gewissens-
bisse mitmachen. Frische Luft in stickige Wohnungen hineinlassen,
bleibt immer verdienstlich. - Im jetzigen zweiten Stadium mit dem
Ziele: ,Heranbringen an die groBe Kunst durch Surrogate" babe ich
dann ja selbst in der Diirer-Ausstellung zuerst mitgemacht, und ich
bleibe dabei, daB die bunten Reproduktionen Diirerscher Handzeich-
nungen der Art nach das Beste sind, was wir haben konnen, und wenn
sie nicht wirkten, so lag das eben daran, daB ein standiger Interpret
fehlte, der die Aufmerksamkeit von der fremdartig harten historischen
Schale ablenkend, das allgemein Menschliche den Zuschauern fiihlbar
machte. Dieselbe Schwierigkeit besteht bei Rembrandt. DaB er 150 Jahre
spater als Durer lebte, bringt ihn uns noch nicht ohne weiteres so sehr
viel naber; uns trennen immer noch 250 Jahre von ibm. Aber ganz ab-
gesehen von der historischen Obersponnenheit verbieten sich zwei Arten
der von uns fi.ir eine Ausstellung geplanten Surrogate durch deren Stil:
die Photographic und das Lichtbild. Gerade indem Rembrandt im
Dunkel das Farbige sah, hat er ein neues Instrument des farbigen Aus-
drucks durch Mitteltone gefunden, die die Photographic eben auffriBt,
und ebenso sind seine Radierungen dazu bestimmt und geschaffen, in
der Hand als Kleinbildwerke des schwarz-weiBen Ausdrucks ein innerlich
groBes Bild wiederzugeben - ein ProzeB, der durch die plumpe mecha-
nische VergroBerung also geradezu in sein Gegenteil verkehrt wird: das
Publikum soli gewissermaBen aus einem Wasserkopf die monumentalste
592
Die BilderaussteUungen des Volksheims
Kleinskulptur menschlicher Bildniskunst herausfiihlen. Der einzige mora-
lisch zu verantwortende Weg, die Bildungsdurstigen vom Miihlenweg an
Rembrandt heranzubringen, ware vielleicht, daB man sich mit einer
Gruppe (bis zehn) urn einen Tisch herumsetzte und die wirklichen Origi-
nalradierungen Rembrandts mit ihr betrachtete; denn selbst die besten
Heliogravu.ren sind doch eigentlich Triibungen. DaB diese schlieBlich
doch mit einem gewissen Behagen aufgenommen wiirden, darf fiir uns
nicht maBgebend sein; wir diirfen das befriedigende Gefiihl der besei-
tigten Leere durch verfalschte Nahrungsmittel nicht als Symptom einer
wirklich gesunden geistigen Erniihrung ansehen. Durch solche Schein-
erfolge im Massenbetrieb wird nur erdriickt, was sich selbstandig als
Wunsch regen miiBte: die Originale in der Kunsthalle aufzusuchen. Ein
Verfahren, durch das wir eben mittels des Surrogatwesens eine Arbeits-
leistung, den Weg zum GlockengieBerwall, ersparen, ware eigentlich
als planmaBige Unterbindung der selbsttatigen folgehaften, kiinstle-
rischen Interessenbildung zu bezeichnen. So wenigstens muB ich als
beeideter Makler der kiinstlerischen Kultur unsere Kunstbestrebungen
ansehen.
Mit der Fiihrung zu Meunier scheint mir dagegen die natiirlichere
und fruchtbarere Methode zum ersten Male versucht. Weiter nach dieser
Rich tung!
593
EINE HERALDISCHE FACHBIBLIOTHEK
594
595
Der Abend des II. Januar [1912] brachte denMitgliedern derHam-
burgischen Gesellschaft der Biicherfreunde die nur zu seltene Erfiillung
einer ihrer Bestimmungen: den Eindruck einer privaten Hauslichkeit, zu
der die liebevoll gepflegte Biicherei wirklich organisch gehort. Dabei tragt
Herrn Paul Trummers Bibliothek in Wandsbek einen streng wissen-
schaftlichen Charakter und ist, wenn man will, ein niichternes Hilfsmittel
auf dem an sich trockenen Gebiet der Siegelkunde, die ihr Besitzer
ebenso als opferwilliger und geschickter Sammler wie als wissenschaft-
licher, stets hilfsbereiter Kenner beherrscht. So geht von dem Besitzer,
der gleichsam nicht nur Eigentiimer eines Rennstalles, sondern selbst
ein Hindernisherrenreiter ersten Ranges ist, ein frohlicher Enthusiasmus
aus, der seinen Tausenden von Siegeln und Hunderten kostbarer Fo-
lianten natiirliche Lebendigkeit verleiht. Etwa 40-5oooo Siegel (mit
etwa 4000 Originalen) vom 8. bis 19. Jahrhundert sind vorhanden, dar-
unter an goo Nummern deutscher Kaisersiegel und Siegel von fast allen
deutschen Fiirstenfamilien, des hohen und niederen Adels, der Stadte
und des deutschen Episkopats vom II. Jahrhundert an; eine eigene
Abteilung bilden englische Siegel des Mittelalters und der Neuzeit. Die
Urkundensammlung umfaBt etwa rooo Nummern, vom 12. bis r6. Jahr-
hundert; eine besonders schone erzbischofliche-kolnische Urkunde stammt
aus dem Jahre II90. Dazu kommen 35 prachtig verzierte Wappenbriefe
deutscher Kaiser und Fiirsten, denen sich Sammelbande (40) mit Einzel-
blattern und Photographien mittelalterlicher Kunstwerke anreihen. Die
Bibliothek (ungefiihr r8oo Nummern mit ca. 2500 Banden) umfaBt alle
Zweige der historischen Hilfswissenschaften. Die meisten bekannten
Wappenbiicher: spanische, portugiesische, hollandische, danische, bel-
gische, italienische, schweizerische, die man nur in den groBten Biblio-
theken vielleicht findet, sind vorhanden, darunter solche Seltenheiten,
wie das Ziiricher Wappenbuch von Meyer von r6o5 und das groBe zehn-
bandige russische Wappenbuch. Handschriftliches Material tritt ergan-
zend hinzu, so z. B. ein Foliant aus dem Ende des 17. Jahrhunderts,
Grabdenkmiiler von Briigge mit farbigen Wappen enthaltend, die sich
durch ihre Schonheit auszeichnen. Von den brauchbaren Siegelpubli-
kationen wird man kaum eine neuere Arbeit von Bedeutung vermissen;
Eine heraldische Fachbibliothek
von den alteren sind nur solche gesammelt (wie z. B. die Werke des
Oliver Vredius 1639 tiber die Siegel des Grafen von Flandern), die durch
zuverliissige Abbildungen wissenschaftlichen Wert besitzen; auch fehlt
nicht eine kleine Sammlung von Miinzen (Brakteaten) und Medaillen-
abgiissen. Die Zeitschriften von allen deutschen heraldischen Gesell-
schaften werden gehalten.
Als wir spat a bends nach Hause gingen, da dachte so mancher, wie
viel das angenehm dilettierende Hamburg, das es so haufig bei verhei-
Bungsvoll einsetzender ,groBziigiger Anregung" bewenden laBt, von
unserem Hamburger in Wandsbek lernen kann, der den Typus desalt-
modischen, feinsinnigen Liebhaber-Gelehrten gliicklich bewahrt hat, fiir
den, in aller Schlichtheit, die tiichtige Teilnahme am wissenschaftlichen
Werk Erholung von kaufmannischer Berufsarbeit und zugleich opfer-
willige Treue im einzelnen bedeutet.
EIN NEUENTDECKTES FRESKO
DES ANDREA DEL CASTAGNO
(1899)
597
598
599
In der dritten Kapelle des linken Seitenschiffs der Santissima Annun-
ziata in Florenz stand bis vor kurzem tiber dem Altar eine riesengroBe
Leinwand von Bronzino [Alessandro Allori], mit den Schrecken des
jiingsten Gerichts bemalt. Hinter diesem Bilde verbarg sich ein Fresko
des Andrea del Castagno, eines der groBen VorHi.ufer der Friihrenais-
sance (urn 1410 bis 1457). Vasari hatte es vor 1550 noch gesehen, denn
erst in der zweiten Ausgabe seiner Vite 1568 [ed. Milanesi, II, p. 671]
sagt er: ,Ma questa pittura, essendovi stata posta sopra dalla famiglia
dei Montaguti una tavola, non si puo piu vedere." Das Verdienst,
diese Stelle des Vasari in ihrer praktischen Bedeutung richtig erfaBt
und die Kapelle der Montaguti herausgefunden zu haben, gebtihrt Herrn
Prof. Dr. Heinrich Brockhaus, dem Leiter des seit I! Jahren eroff-
neten kunsthistorischen Instituts in Florenz. Durch das verstandnis-
volle und bereitwillige Entgegenkommen der weltlichen und kirchlichen
Behorden gelang es sodann Herrn v. Marcuard, dem florentinischen Mit-
glied der Kommission ftir das Institut, die Erlaubnis zur Entfernung des
Bronzino zu erwirken.
Am 3 Juni 18gg, 2! Uhr nachmittags gliickte es, nach angestrengter
Arbeit das Bild von der Stelle zu riicken und abzunehmen und richtig:
aus dreihundertjahrigem Schlummer war Castagnos Fresko wieder er-
wacht, zur freudigen Oberraschung einer kleinen Zahl anwesender Kunst-
freunde.
Das Fresko stimmt vollig mit Vasaris Beschreibung tiberein: in der
Mitte unten steht der hl. Hieronymus, den Kopf mit den gelblichen
asketischen Ztigen voll Ergriffenheit emporgerichtet und die Iinke Hand
staunend erhoben tiber das Wunder der Dreieinigkeit hoch oben in den
Wolken. Rechts und links stehen zwei weibliche Gestalten, massige
Mantelfiguren, deren Gesichter nur in scharftiberschnittenem Profil sicht-
bar werden, das Motiv des Staunens gleichsam in dumpfem Echo wieder-
holend. Die Dreieinigkeit ist, wie Vasari mit seinem unvergleichlichen
kiinstlerischen Verstandnis richtig hervorhebt, ein Meisterstiick der Per-
spektive: Gott Vater, von einem roten Mantel umflutet, halt mit aus-
gebreiteten Armen, halb auferlegend, halb stiitzend Christus am Kreuz;
die Taube des heiligen Geistes schwebt iiber dem Haupt des Erlosers,
6oo Ein neuentdecktes Fresko des Andrea del Castagno
der, aus einem Kranze roter Engelskopfe aus der Tiefe auftauchend, in
starker Verkiirzung mit vorwarts geneigtem Oberkorper und Kopf sicht-
bar wird. Massaccios Trinita in Santa Maria Novella ist Castagnos un-
verkennbares Vorbild; aber die plastisch reliefmaBige Komposition hat
Andrea in ein malerisches Raumbild weiter zu entwickeln versucht. Man
muB bewundern, wie es dabei Castagno durch seine urspriingliche monu-
mentale Kraft gelingt, neben der virtuosen Bewa.Itigung eines perspek-
tivischen Problems dem Ganzen die Stimmung tiefer religioser Ernst-
haftigkeit mitzuteilen.
Die Farben haben sich relativ gut erhalten, nur das Blau ist erheb-
lich nachgedunkelt. Die monumentale GroBe des Abendmahls in Sant'
Appollonia, dem beriihmten Werke des Castagno, erreicht das Fresko
in der Annunziata nicht, wohl aber gibt es von der spateren Entwick-
lungsperiode des Meisters ein vortreffliches Beispiel. Das kunsthistorische
Institut dad man zu dieser Entdeckung (im eigentlichen Sinn des
Wortes) begliickwiinschen; moge es sich noch ofters mit den Florentinern
in der Erfiillung ihrer schOnsten Pflicht zusammenfinden, die groBe
Vergangenheit zu neuem Leben zu erwecken.
6oi
BEGROSSUNGSWORTE ZUR EROFFNUNG
DES KUNSTHISTORISCHEN INSTITUTS
IM PALAZZO GUADAGNI ZU FLORENZ
AM 15. OKTOBER 1927
Meine Damen und Herren!
Ihnen, hochverehrte Anwesende, im Namen des Ausschusses des
Vereins zur Erhaltung des Kunsthistorischen Institutes zu Florenz fiir
Ihr Erscheinen herzlich danken zu diirfen, ist mir eine hohe Ehre und
eine noch groBere personliche Freude.
Es ist ja so viel menschenwiirdiger, auf eine arbeitsfrohe Zukunft
blicken zu diirfen, als mit Zeiten hartbegrenzter Verstandigungsmoglich-
keiten rechnen zu miissen, wie vor zwolfeinhalb Jahren. Keiner von uns
wird diese Zeiten vergessen konnen, noch mogen, keiner aber auch-
dem an Europa etwas liegt - nicht mit uns den heutigen Tag jetzt
freudig begriiBen, der das Signal zur Weiterarbeit gibt an diesem Institut,
das wir unversehrt zuriickempfangen haben. Wieviel Dank in diesen
kurzen Worten sich verbirgt, wissen die Wissenden; die, die uns geholfen
haben, die Kollegen-Galantuomini, werden am wenigsten dariiber viele
Worte horen mogen. Es soli der italienischen Regierung unvergessen
bleiben, daB sie an unserem Institut, das ja stets nur der Wissenschaft
an sich- wenn auch ohne das Deutschtum der Fiihrung je zu verleug-
nen - gewidmet war, das Privilegium der Exterritorialitiit einer bei
der Zeitlosigkeit der Wissenschaft akkreditierten Gesandtschaft respek-
tiert hat.
Wir sind ja in unseren Wurzeln einer iiberperso:nlichen Macht ver-
schrieben, die weder Sieger noch Besiegte kennt, nur ewig Dienende;
deshalb auch ist fiir uns das Institut nicht ein Instrument des Besitzes,
sondem der Musikalitat. Jeder, der es sich zutraut, mag darauf spielen,
nur muB er, in der ununterbrochenen Abschiedssymphonie des Lebens,
dafiir sorgen, daB er dieses Instrument seinem Nachfolger in bestem
Zustande hinterlii.Bt. Das war die Gesinnung der Schmarsow, Bayers-
doner, Marquardt, der Brockhaus, Gabelentz und vor allem unseres
Bode; wie wir denn auch iiberzeugt sind, daB diesel be Gesinnung eines
selbstvergessenen Idealismus ebenso in der heutigen Leitung, in dem
trefflichen Direktor wie in seinen helfenden Mitarbeitern waltet.
Fiir den AusschuB kann es eben nur eine Direktive geben: der er-
freulichen Wachstumstendenz des Institutes alles aus dem Wege zu
riiumen, was sich an iiberwindlichen Hemmnissen und Schwierigkeiten
Warburg Gesammelte Schrifteo Bd.2
39
604 BegYiiPungswol'te z. ErtiOnung des Kunsth,st. Instituts im PalazzoGuadagni zuFlorenz
entgegenstellt. Darurn ist es fiir das Institut eine Lebensfrage, ob die
deutsche Kolonie in Florenz - wie wir hoffen - das Institut zu seiner
Herzensangelegenheit rnacht. Wir wollen, daB sich hier fiir jederrnann,
der sucht, eine seelische Zentralheizung entwickelt, und bitten urn Ihre
Unterstiitzung, sowohl was die realen auBeren Feuerungsrnittel als auch
was die flarnrnende innere Begeisterung angeht.
Urn schlieBlich a us dern Ather auf das reale Pilaster herabzukornrnen:
Die spannende Zeitungsgeschichte vorn ,Florentinischen Deutschen", in
der wir bis I9ISlasen, erlitt eine unliebsarne Verzogerung, die jetzt gliick-
lich behoben ist. Heute beginnt ein neues Kapitel: ,Fortsetzung folgt''-
si continua - coraggio ! - ricorninciarno la lettura!
6os
ZUM GEDACHTNIS ROBERT MDNZELS
6o6
Die Stadtbibliothek, die Gesellschaft der Biicherfreunde und die
Wissenschaftliche Stiftung vereinigt die gleiche Trauer urn Robert Miin-
zel: alle drei verloren mit ihm die Verkorperung und das Sinnbild be-
seelender Kraft, die durch das GleichmaB ihrer Begeisterung den tag-
lichen Lauf von kleinster Pflicht bis zur groBen Idee zum vorbildlich an-
feuernden Ideal fiir jeden machte, der mit ifuu zusammen arbeiten durfte.
So entstand im Kreise seiner dankbaren Freunde und Mitarbeiter der
Wunsch, seine Gestalt iiber den Tod hinaus in der Erinnerung festzu-
halten.
Fast sofort nach seiner Beisetzung hatte Herr Biirgermeister
Dr. v. Melle den Gedanken ausgesprochen, zu Ehren Miinzels eine Ge-
denkschrift verfassen zu lassen; die Gesellschaft der Biicherfreunde, der
ich diesen Wunsch vortrug, stimmte freudig zu und so durfte unsere
Gesellschaft, von der Wissenschaftlichen Stiftung auch materiell unter-
stiitzt, diese Ehrenpflicht iibernehmen und erfiillen. Ich bin sicher, daB
Sie die vorliegende Gedachtnisschrift, die ich Ihnen zu iiberreichen heute
die Ehre habe, wehmiitig lmd doch freudig entgegennehmen, weil wir
durch sie unserem lieben Vorsitzenden die letzte literarische Ehre er-
weisen konnen.
Fritz Burg, Albert Koster, Karl Meinhof, B. A. Miiller, Karl Rathgen
und ich haben uns vereinigt, urn Miinzel als Mensch und Gelehrten im
Streiflichte verehrungsvoller Freundschaft kurz darzustellen. Zu dieser
Erinnerungsschrift tritt als sachliches Denkmal seine Hand-Bibliothek
hinzu, die wir der Offentlichkeit erhalten haben. Die Gefahr der Zersplitte-
rung lag durch die letztwillige Verfiigung vor, die Hauptmann Miinzel
am dritten Mobilmachungstage I9I4 seinen Verfiigungen vom 7 Mai Igo8
hinzugesetzt hatte: ,Meine Bibliothek, die ich sehr geliebt habe, wird
verkauft, der Erlos meinem eigenen Vermogen hinzugeschlagen." Diese
letzte WillensauBerung lieB den Freunden immerhin einen Weg offen,
urn Miinzels feines Forscherwerkzeug doch vor Zersplitterung zu be-
wahren: Die Wissenschaftliche Stiftung rechnete es sich zur Ehre an,
ihrem verehrten Mitglied ein bescheidenes, aber lebendig sprechendes
Gelehrtendenkmal in Hamburg zu errichten, indem sie den klassisch-
6o8 Zum Gediichtnis Robert Munzels
pr.ilologischen Teil seiner Bibliothek kauflich erwarb und geschenkweise
dem Staate iiberwies.
Eine hochst erfreuliche Bereicherung wurde dadurch den Bildungs-
mitteln Hamburgs zuteil, denn von den etwa 1000 erworbenen klassisch-
philologischen Werken fehlten unserer so reichen Stadtbibliothek doch
ungefahr 250 Stucke, wahrend die anderen 750 Druckwerke einen idealen
Grundstock einer Handbibliothek zur Erforschung der Kultur Altgrie-
chenlands bilden; das Osteuropaische Seminar des Hamburgischen Kolo-
nialinstituts hat diesen Teil zunachst in Obhut und Gebrauch genommen.
Die Hoffnung der Stifter ist, daB von dem Tag ab, an dem sich in Ham-
burg eine Universitat erschlief3t- die er, wie so viele andere, vergeblich
ersehnte - die jungen Studenten im klassisch-philologischen Seminar
seine Handbibliothek als die ihrige vorfinden, urn in seiner hohen, reinen
Gesinnung die Wissenschaft von der Antike zu pflegen. Vorzeitig er-
schopft muf3te Robert Miinzel im Fackellauf des Lebens die Leuchte
dem Niichsten reichen: wir aber wissen, daB er bis zum letzten Atem-
zuge dem heiligen Feuer der Begeisterung, mochte es ihn immerhin im
Dienste der Wissenschaft und des Vaterlandes verzehren, in vorbild-
licher Treue geweiht war.
So will auch das Buchzeichen verstanden sein, das Fritz Schumacher
auf meinen Wunsch - Miinzel besaB keins - geschaffen hat und das
beute jedes Buch a us seinem Nachla13 tragt: eine brennende antike Hand-
fackel, der wir die lateinische Umschrift hinzugefiigt haben ,serviendo
consumor", ,dienend verzehre ich mich". Als Vorbild fiir die Handfackel
hat ein antikes Meisterwerk nordgriechischer Miinzkunst aus dem 4 Jahr-
hundert, eine Tetradrachme aus Amphipolis, gedient: sie erinnert daran,
wie griechische Jiinglinge WettHiufe zu Ehren des Apoll vollfiihrten,
bei denen die Fackel noch brennend ans Ziel gebracht werden muBte.
Miinzel hat den Prometheusfunken griechischer Kultur solange er
lebte in heller Begeisterung gehiitet und weitergetragen; die Antike tar
ihm ja kein Fremdland, sondern eine zweite Heimat, an deren anders-
artiger Schonheit und Fiille sein kernfestes Deutschtum sich selbst nur
urn so deutlicher erkannte und wuchs: auch ibn trug der Glaube, daB
Deutsch Sein sich erst im Deutschen Werden erfiillt. Durch dieses
tiefe humane Verstiindnis fiir das GroBe fremder Kulturen war er fiir
seinen Beruf wie geschaffen, die geistigen Schatze der ganzen Welt
getreu zu verwalten.
Auch die antike Forderung der hochgespanntesten Harmonie von
Geist und Korper lag ihm in Blut und Erziehung, und er stellte, wie wir
erleben muBten, diese Forderung bis zu tragischer Unerbittlichkeit an
sich selbst: der Trauersalut iiber dem offenen Grabe des Hauptmann-
At1tike und Deutschtum
Bibliothekars schloB sein tapferes Leben im ergreifend wahren Sinn-
hilde ab.
Wer so- nach 58 Jahren- in der Erfiillung seiner Aufgabe dahin-
gehen durfte, und wem noch dazu die Liebe und das Vertrauen der
Menschen jederzeit iiberreichlich zustromten, dessen Menschenlos ge-
hort - trotz allem Leid, das ihm wahrlich nicht erspart blieb - zu dem
der irdisch Vollendeten.
Ehren wir sein Andenken, indem wir, seine Gesinnung durch die Tat
bewahrend, im Umkreis seines Wirkens einfach die Pflichten, die zu-
nachst liegen, nach bestem Konnen weiter treu erfiillen.
610
6n
DAS PROBLEM LIEGT IN DER MITTE
(r gr 8)
612
Die Entwicklung des UniversiHitsgedankens in Hamburg kann das
erfreuliche Schauspiel einer gerade aufsteigenden Linie nicht bieten;
neben dem ,Kolonialinstitut" und der ,Wissenschaftlichen Stiftung",
durch deren Errichtung Hamburg schon 1907 die deutsche Bildung auf
neue Bahnen brachte, wurde von manchem die hergebrachte deutsche
Universitat zunachst wie ein alterndes Erziehungsorgan empfunden, das,
bedriickt durch die krafteverzehrende Lehrpflicht im akademischen
GroBbetrieb, in steigender Weltfremdheit die auffrischende Beriihrung
mit dem wirklichen Leben mehr und mehr zu verlieren verurteilt schien.
Kolonialinstitut, Wissenschaftliche Stiftung und Vorlesungen hatte man
ja gerade deswegen geschaffen, urn dem Gelehrten die bedrohte rein
wissenschaftliche Forscherkraft freier zu halten und ihn in unmittelbar
belebende Fiihlung zu bringen mit den aus der Praxis des Tages hervor-
tretenden Fragen des gebildeten Publikums. - Trotzdem gestehen jetzt
nach einem J ahrzehnt miihevoller unablassiger Arbeit die sachverstan-
digen und verantwortlichen Trager der neuen Gestaltung, daB diese den
berechtigten Erwartungen nicht entspricht. Sie schlagen deshalb vor,
die Beratung dariiber wieder aufzunehmen, wie weit man in den Rahmen
und Aufbau der Universitat einzutreten doch verpflichtet sei. Die Kern-
frage ist, ob sich ein Hochschultypus erfinden laBt, der auf einer neuen
Gleichgewichtslage zwischen Lehrpflicht und Forschungsbetrieb, zwi-
schen Abfragerecht des Lehrenden und Anfragerecht des Laien beruht.
Es ist begreiflich, daB diese Riickkehr in das Beratungszimmer nicht den
allgemeinen Beifall des Publikums findet; urn so dankbarer sollte man
dem Senat, der Biirgerschaft und den beteiligten Lehrkraften dafiir sein,
daB sie sich dieser theoretisch und praktisch gleich dornigen Aufgabe
von neuem zu unterziehen entschlossen sind. Leider ist zu befiirchten,
daB in dieser Zwischenzeit miihevoller Nachpriifung eine nervose Un-
geduld im Zuschauerraum jenen Iauten Stimmen das Ohr leiht, die mit
der schonen Geste klarer Entschlossenheit die Pistole des ,Entweder-
Oder" den gewissenhaft Beratenden auf die Brust setzen.
Die Nachdenklichen mag in solcher Lage der Gedanke trosten, daB
sie im Goetheschen Sinne die dem Problematischen gebiihrende vor-
schriftsmaBige Haltung einnehmen. In den ,Wanderjahren" lesen wir,
Das Problem liegt in der Mitte
zum Tagesstreit zwischen Neptunismus und Vulkanismus: , ,Hier aber',
versetzte Wilhelm, ,sind so viele widersprechende Meinungen, und man
sagt ja, die Wahrheit liege in der Mitte.' ,Keineswegs !' erwiderte Montan,
,in der Mitte bleibt das Problem liegen, unerforschlich vielleicht, vielleicht
auch zuganglich, wenn man es darnach anfangt !'" Wie die Gegnerschaft
des Universitatsgedankens es nun ,darnach anfangt", diesen Zugang
zur Grundfrage nicht zu finden, eben weil sie die erforderliche Achtung
vor dem ,Problem in der Mitte" weder sachlich noch formal aufbringt,
soil in diesem Sonderheft der Literarischen Gesellschaft beleuchtet
werden.
62I
AN HANG
DORER UND DIE ITALIENISCHE ANTIKE
Seite 443
Erschienen in: Verkandlungen der acktundvierzigsten Versammlung deutscker
Pkilologen und Sckulmanner in Hamburg vom 3 bis 6. Oktober I905, Leipzig
rgo6, S. 55-60.
Seite 445
Albrecht Durers Zeicknung .,Tod des Orpheus", Lippmann I59; H. Tietze-
E. Tietze-Conrat, Der junge Durer, Augsburg I928, Nr. 50 (S. r3).
Oberitalieniscker Kupjerstick ,Tod des Orpheus" Pass. V, p. 47, Nr. I20,
abgebildet bereits bei Eugene Muntz, Histoire de l'Art pendant la Renaissance I,
r889, p. 252.
Vber diesen Stick als direkte oder indirekte Vorlage Durers vgl. Joseph Meder,
Neue Beitrage fur Durerforsckung, in: ]akrbuch der Kunstsammlungen des
A. H. Kaiserkauses XXX, I9II/I2, p. 2I3; Tietze, a. a. 0., S. IJ u. 306j.
Seite 446.
Weitere antike Vorbilder zum ,Tod des Orpheus" bei Meder, a. a. 0. S. 2I9ff.,
Fig. 25-33: und Erwin Panofsky, Durers Stellung zur Antike, in: ]akrbuch
fur Kunstgesckickte I (XV) I92rja2, Wien I923, S. 46, Anm. ro; Carl Robert,
Sarkopkag-Reliefs II, S. 96j., dazu Tafel XXXIII. Vgl. den Zusatz zur
,K onstantinsscklackt", S. 39I.
Seite 446.
Die Zeicknung Pollaiuolos in Turin besprocken von Luigi Dami, Due Nuove
Opere Pollaiuolescke, in: Dedalo IV, I924, p. 706.
Pentkeus-Sarkopkagin Pisa: s. Roscher, M. L., Pentheus, Jiig. s: Hans Dutsckke,
Die antiken Bildwerke des Campo Santo in Pisa, Leipzig r874, Nr. 52, S. 40j.
Die Orpkeus-Haltung im Stick ,Herkules und die Giganten", Schute des Ant.
Pollaiuolo, Abbildung bei van Marte XJ, p. 354, Fig. 225.
Campbell Dodgson, A Book of Drawings formerly ascribed to Mantegna, [Earl
of Rosebery} I923, Pl. XXI sowie (Hinweis bei Meder, a. a. 0. S. 22I,
Fig. 32) Pl. VIII. Orpheus-Teller der Sammlung Correr, Venedig, Schute des
Francia, Phot. Anderson I4057
Plakette, Kaiser Friedrich-Museum, von Bode (Bertoldo und Lorenzo dei Me-
dici, Freiburg I925, S. 40, Abb. S. 39) dem Bertoldo zugesckrieben.
Giulio Romanos Zeicknung im Louvre, Pkot. Braun 293, s. Handzeichnungen
italieniscker Meister in photograph. Aufnahmen von Braun & Co., kritisch ge-
sichtet von Gio. Morelli; mitgeteilt von E. Habich in: Kunstchronik, N. F. III,
I89rJ92, S. 374; auch erwahnt von Meder, a. a. 0., S. 22I.
Anhang
Seite 446.
Ovidausgabe von I497: ital. Vbersetzung der M etamorphosen (mit Altegoresen)
von Giov. da Buonsignori (ca. IJJ0/8o), Venetia, Zoane Rosso I497, lib.
XI, cap. I, Hotzschnitt Jol. 9 2 t ~ . Ober Nachdrucke und Kopien dieser Ausgabe
s. M.D. Henkel, Illustrierte Ausgaben von Ovids Metamorphosen, in: Vortriige
der Bibl. Warburg I926/2J, S. 6sff.
Dasselbe Motiv: XIII, 23, jot. IIO" ( Polymestor von Hecuba ttnd ihren Frauen
erschlagen) und XI, I3, jot. 94f) (Peleus und die Schlange).
Weitere Beispiele bei Meder, a. a. 0., und Panofsky, a. a. 0., S. 77 Anm. I32.
Seite 447
Hochzeitstruhen des ]ac. del Sellaio bei Paul Schubring, Cassani, Leipzig I9IS,
Textband S. 304j., Tafelband Tafel LXXXV. Zur Beziehung zwischen dem
Cassone und der M antuaner A uffuhrung von Polizians ,Orfeo" vgl. Zusatz
zur Geburt der Venus, S. JI7, sowie d'Ancona, Origini del teatro
2
, II, p. 363,
wo der Brief mit der Erwiihnung der fur die A uffuhrung I49I geplanten Ken-
lauren abgedruckt ist.
Seite 447
M antegna-Kopien: Bacchanal L. 455, 454, Tietze Nr. 63, 64. Frauenraub
L. 347, Tietze 85.
Der Kupjerstich B. 73 gedeutet von Panofsky, Herkules am Scheidewege, Leipzig
I9JO, S. z68fj.; der Holzschnitt B. I27 ebd., S. z8rff.
Vber die Bedeutung von Poltaiuolos Herkutes-Bildern im Palazzo Me.dici, s.
Lt!.igi Dami, a.a.O.; Maud Cruttwell, Antonio Pollaiuolo, Londoni907, p. 66sqq.;
van Marte, XI, p. 364sqq. Pollaiuotos ,Herkules und Nessus", fruher farves
Collection, New Haven, fetzt Fogg-Museum, Harvard, wurde aufJer von Warburg
zuerst mit Durers ,Herkules und die stymphalischen Vogel" (Nurnberg, Gerc
manisches Museum) in Verbindung gebracht von Werner Weisbach, Der funge
Durer I9o6, S. so: vgl. Tietze, a. a. 0., S. sz (Nr. I65) u. 327.
Seite 448.
Zu Durers Proportionsstudien nach dem belvederischen Apollo vgl. Panojsky,
Durers Darstellungen des Apollo und ihr Verhiiltnis zu Barbari, in: ]ahrbuch
der preufJ. Kunstsammlungen, XLI, I920, S. 359/f.; und Panofsky, Durers
Steltung zur Antike, S. 53/f.
Dazu Tietze, a. a. 0. S. 68f., Nr. 229-232.
Seite 448.
Brief Durers an Pirckheimer, 7 Februar rso6 bei K. Lange-F. Fuhse, Durers
schrijtlicker NachlafJ, Halle r893, S. 22; vgl. Hans Rupprich, Willibald Pirck-
heimer und die erste Reise Durers nach Italien, Wien I930, S. 6zfj.
Seite 449
Zur Aujfindung der Laokoongruppe rso6 s. A. Michaelis, Geschickte des Sta-
tuenhofes im vatikanischen Belvedere, in: Jakrb. des kais. deutscken archlio-
logischen Instituts V, r89o, S. rsf.
Zum Antikenfund I488 s. Zusatz zu dem Aufsatz ,Eintritt des antikisierenden
Idealstils" S. 367.
Durer und die italienische A ntike 625
Seite 449
Der Lederschild mit der Gestalt des David, fetzt in Philadelphia, Sammlung
Widener, ist von Friedrich Antal (Studien zur Gotik im Quattrocento, in:
]ahrb. der preu{J. Kunstsammlungen 46, I925, S. 6) Andrea Castagno zu-
geschrieben worden.
I583 ist die Florentiner Niobidengruppe gefunden und der ( auclt erst seit dem
XVI. ]ahrhundert bekannte?) Piidagoge hinzugefugt worden. Da die Arme des
Piidagogen spatere Ergiinzung sind (vgl. K. B. Stark, Niobe und die Niobiden,
Leipzig r863, S. rojj., 2I7ff., 2J6ff.), kann dieFigur keinesfalls direktes Vorbild
fur den David gewesen sein. Da{J aber eine ahnliche Figur bekannt gewesen ist,
dafur spricht au{Jer einem urbinatischen Mafolikatelter im Victoria and Albert
Museum (Nr. 3578, Tod der Niobidentochter, XVI. fahrhundert) die Ergiinzung
zur Piidagogenhaltung, die der Zeichner des Codex Escurialensis einer Figur auf
dem jetzt in Wilton House befindlichen Amazonen-Sarkophag hinzugefugt hat
(H. Egger, C. E., ein Skizzenbuch aus der Werkstatt Domenico Ghirlandaios,
Wien I905/6, fol. 6,5", Textband, S. ISSJ.). Der Sarkophag ist abgebildet bei
Robert, Sarkophag-Reliefs,III, J, Tafel CI, C II, wo die getreuere Zeichnung des
Cod. Pighianus mit der des Escurialensis verglichen werden kann (besprochen
S. ]8Jf.).
Eine echt antike Formulierung derselben Ausdrucksgebiirde ist in der Nicander-
H andschrift der Bibliotheque N ationale aus dem XI.] ahrhundert (Ms. Supple-
ment grec 247) erhalten, deren M iniaturen Kopien antiker Vorbilder sind. Der
Schreckgestus des jugendlichen Mannes (fol. 6) ist dort eine Illustration zu den
V ersen II S-I27 der Theriaka des N icander, in de'n<m V erhaltungsma{Jregeln
gegen den gefiihrlichen Schlangenbi{J gegeben werden. Die Handschrift befand
sich im I4. ]ahrh. in Italien. Vgl. H. Omont, Miniatures des plus anciens
Manuscrits Grecs de la Bibliotheque Nationale,
2
Paris r929, p. 35sq. und
38, Abb. Planche LXV, 4
626
DIE ANTIKE GOTTERWELT UND DIE
FRUHRENAISSANCE IM SUDEN UND IM NORDEN
Seite 451.
Erschienen in: Verein fur Hamburgische Geschichte I908. Zu dieser Zusammen-
fassung jinden sich die niiheren A usjilhrungen an jolgenden Stellen:
Gotterbeschreibungen ( Albricus, Berchorius, Ovide moraUse) s. Palazzo Schi-
janoja S. 46I ff. und Zusatz S. 627 f.
Planeten in Rimini s. Geburt der Venus, S. I2.
Tod des Orpheus s. Durer S. 445/f.
Tarocchi s. Costumi Teatrali S. 27I und Zusatz S. 4I2.
Merkur s. Lubecker Kalender S. 485 und Zusatz 645.
Dilrers ,Eijersucht" s. Durer S. 447
Durers ,Melencolia I" s. S. 526j., 528Q. sowie Panofsky-Saxl, Dilrers Melen-
colia I, Studien der Bibl. Warburg II, Leipzig I923.
Stephan Arndes s. Lubecker Kalender S. 485.
KIRCHLICHE UND HOFISCHE KUNST IN LANDSHUT
Seite 455
Erschienen in: Miinchner Neueste Nachrichten, 2I. September I909, Nr. 44I.
Burgkmair s. Liibecker Kalender S. 486 Zusatz S. 646.
Die direkte Berchorius-Tradition ist u. a. bezeugt durch das Erscheinen des
,,Signum Triceps" beim Apollo, vgl. S. 4IJ.
ITALIENISCHE KUNST UND INTERNATIONALE ASTRO-
LOGIE IM PALAZZO SCHIFANOJA ZU FERRARA
Seite 459
Erschienen in: Italia e l'Arte Straniera, Atti del X. Congresso internazionale
di Storia dell' Arte, Roma I922, p. I79sqq.
Seite 462.
Das Verhaltnis der von dem sogenannten ,Albericus" abhiingigen Gotterbeschrei-
bungen zum Text und zu den Illustrationen der moralisierenden Ovidkommen-
tare liiflt sich seit Liebeschutz' Untersuchungen (Fulgentius Metaforalis, Studien
der Bibl. W arburg, 4, r926) genauer bestimmen. Liebeschutz stellte fest, dafl der an-
gebliche A utor eines der mittelalterlichenGottertraktate, des sog. M ythographus II I,
Albericus, hOchst wahrscheinlich der Englander Alexander N eckam ist, dafl also
der Traktat tatsiichlich um die Wende des XII. zum XIII. fahrhundert ent-
standen sein mufl. Der ,De deorum imaginibus Libellus" dagegen ( um I400
entstanden, cod. Vat. Reg. lat. r290, um I420 in Oberitalien geschrieben, s. Saxl,
Verzeichnis Rom, Heidelberg I9I5, S.67j.; unsere Abb.rr2) ist in der Haupt-
sache ein Auszug aus den Gotterbildbeschreibtmgen des Petrus Berchorius. Dieser
Freund Petrarcas, der trotz seiner ,mittelalterlichen" Attributjreudigkeit als Erbe
von dessen humanistischer Gotterlehre gelten mufl, verfaflte die zwei Fassungen
seiner Mythographie in Avignonvor I340 undin Paris I342 und zwar, wieHau-
reau ( M emoire sur un Commentaire des Metamorphoses d'Ovide, M em. del' A cad.
des Inscript. XXIX, r883, p. 45 sqq.) feststellte, als Proiog zu den lateinischen
Ovidmoralisationen, die das rs. Buch seines Reductorium Morale bilden. Erst
zwischen der ersten und der zweiten Fassung seines Traktates lernte Berchorius
den Text t"enes gereimten Ovide moralist! kennen, der zuAnfang des XIV. fahr-
hunderts von einem unbekannten franzosischen A utor verfaflt wurde (die ersten
6 Bucher herausgegeben von f. de Boer, Amsterdam I905 und I920, das 7 von
f. Th. M. van't Sant, Le Commentaire de Copenhague de l',Ovide moralist!",
Amsterdam I929), von dem er nur wenig in seinen Traktat ubernahm. Berchori1-ts'
Text war es, der die Gestalt der Heidengotter in freier und angewandter Kunst
fur die Folgezeit bestimmte, also eine Auffassung der Antike, die zwar aus alter
Oberlieferung stammte, aber zugleich die Gelehrsamkeit des XIV. J ahrhunderts
reprasentierte: die Bilder der Heidengotter, die in Hss. des Ovide moralist! aus
der I. Halfte des XIV. fahrhunderts als zeitgenossische Ritter, Monche und
Damen meist ohne attributive Kennzeichnung ihres gottlichen C harakters erscheinen,
dringen nun in wortgetreuer Ilhtstration des Berchoriustextes mit allen gelehrten
Attributen, durch die Berchorius sie bereichert hatte, zuniichst in die Handschriften
6z8 Anhang
eben dieses Ovide moralise ein, a us dessen Text sick ihre Darstellung garnicht
erkliiren lii{Jt (so z. B. Paris, Bibl. nat., cod. Jr. 373, vgl. S. 47I, Abb. IIJ), und
erscheinen in der Folgezeit uberall dart, wo heidnische Gotter im Bilde aufzutreten
hatten: so au{Jer in den Tarocchi (5. 4I2, 472 und 640), in den Chroniques de
Hainaut (Briissel, Bibl. Royale, cod. 9242/4) und im Kommentar zzt den Echecs
Amoureux (Paris, Bibl. nat., cod. Jr. I43).
Unter Warburgs Bezeichnung ,Albericus" soll also ietzt uberatl nicht der Autor
des XII. ]ahrhunderts, sondern fene modernere Bearbeitung des Berchorius, der
Libellus, verstanden werden.
Seite 464.
Als positivere Deutung der wahrsagenden Astrologie Utlter Berucksichtigung der
Rolle, die das Bild dabei spielt, ergiinzt Warburg zu ,Namensfetischismus":
einfi.ihlende Verwandlung in den Bildcharakter (Identifikation mit dem Kunst-
bild) unter volliger Verdrangung des eigenen Ichs; Metamorphose der eigen-
willig zielstrebenden Personlichkeit durch organfremde Bildwesen.
Seite 464.
Nach Manilius werden die Weber nicht nur mit dem Widder in Verbindung ge-
bracht (IV, I24sq.), sondern auch direkt mit der Minerva (IV, I34sqq.). Ober
das Verhiiltnis von Firmicus Maternus zu Manitius, s. Boll in der Realenzyklo-
piidie VI, col. 2372.
Seite465.
Katharsis der monstrosen Weltanschauung durch astrische ,Kontemplation"
( = Umzirkung) , die Metamorphose vom Kampf mit dem opferheischenden
Monstrum (Placatio) zur Kontemplation zukunftsoffenbarender Schicksals-
hieroglyphen; vom Monstrum zur Idee.
Den monstrosen Charakter des astrologischen Programms unterstreicht W arburg
durch zwei stilistische Anderungen; S. 465 statt: die aufgeregten GeschOpfe ...
zu ... mathematischen Punkten zu vergeistigen, soll es hei{Jen: zu erniich-
tern; 5. 472 statt. das trockene Programm: das unheimliche Programm.
Seite 466.
Zur hebriiischen Obersetzung des Abu Ma'schar: Raphael Levy, The astrological
works of Abraham ibn Ezra, Baltimore-Paris I927. Ober Pietro d'Abano ibid.
p. 32sqq. und Leo Norpoth, Z11,r Bio-, Bibliographie und Wissenschaftslehre des
Pietro d'Abano, in: Kyklos, Bd. 3, Leipzig I930, S. 292jj.
Zum Salone in Padua vgl. Gundel, Dekane und Dekanbilder, Leipzig I9J3,
und die dort angezeigte altere Literatur.
Seite 467.
Auch der orientalische Planet Mars, dem im Astrolabium Planum die erste
Widder-,facies" untersteht, hat das Schwert und den abgeschlagenen Kopf,
wie der Perseus (vgl. etwa Liber Bolhan, cod. Bodl. Or. I33). Die Harpe des
Perseus ist multivalent.
Die 36 Planetenfacies des Astrolabium Planum mussen auf ihre Herkunft und
in ihrer Zusammensetzung noch untersucht werden. Fest steht, da{J sie keine
Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanofa zu Ferrara 629
reinen Planetenprosopa sind, wie aus den Beischriften hervorzugehen scheint,
smtdern da/3 auch hier, wie bei den Dekanen in Ferrara (siehe weiter unten
S. 632), Kontaminationen mt Paranatellonta und anderen Sternbildern statt-
gefunden haben. Die zwei verschiedenen Drittel-Einteilungen der Tierkreiszeichen,
Facies und Dekane, gehen, wie aus der Tabula Bianchini ersichtlich, manchmal
nebeneinander her, werden einander aber auch hiiufig gleichgesetzt, und unter dem
A usdruck ,Dekane" werden nicht nur die rechnerischen Einkeiten in der Ein-
teilung der Ekliptik, sondern auch bildmii/3ig angeseltene Sterngruppen ver-
standen (Boll, Sphaera, S. Br; Bouche-Leclercq, L'Astrologie Grecque, Paris
1899, p. 2ISsqq., p. 22Isqq., p. 229sq.)
Seite 467.
Der Aventin, Fundort der Tabula Bianchini, ist das Gebiet des Tempels des
Jupiter Dolichenus (Boll, Sternglaube und Sterndeutung', Leipzig I93I, S. 6o),
zu dessen K ultattributen das Doppelbeil gehort.
Ist die Tafel ein Loosbrett zur Ermittlung von (fiktiver) Nativitat durch
Wiirfel, die man sick etwa wie das Ikosaeder bei Boll, Sphaera, S. 470 vorzu-
stellen hat? Ein iihnliches Instrument hat der Zauberer Nectanebus in der Alexan-
dersage des Ps. Kaltisthenes (vgl. Boll, Sphaera, S. 303 Anm.). Belege fur den
Loosbrettcharakter der Tabula Bianchini bei Gundel, Wozu diente die Tabula
Bianchini? (Boll, Sternglaube
4
, Zusatz D) p. I9I}f., besonders S. I96f.
Seite 467.
Im Picatrix (Krakau Ms. XI, I, 793) tragt der Dekan eine Sichel. Das strick-
gegiirtete Gewand der Abu Ma'schar-Tradition ist ein Rudiment des Opfer-
schurzes, den der Dekan mit dem Doppelbeil auf der Tabula Bianchini und
im Steinbuch des Alfonso el Sabio triigt.
Der ferraresische Athiopier ( Abb. III} ist gleich dem schwarzen Henker des
Steinbuchs.
Seite 467
Durch Unkenntnis der Sternsage fallen die Personen im Eriosungsdrama
ganzlich auseinander; der Befreier Perseus scheint im Gegenteil als Geister-
schreck den Familienvater mit Gattin zu bedrohen. Die Sternsage ist in
Hieroglyphen zerfallen.
Seite 468.
Noch heute in Indien gedruckt; Exemplar in der Bibliothek Warburg, durch
St. Xavier's College in Bombay erhalten.
The j(itaka of Varaha Mihira, engl. Obersetzung von N. Chidambaram
A iyar, 3 A ufl. Madras I926. Deutsche Bearbeitung fur die moderne Astrologie
Wilh. Wulff, Das grofJe der Nativitiitslehre ( ]ataka) des Variiha
Mihira nach der engl. Obersetzung ins Deutsche ubertragen und bearbeitet,
Hamburg I925.
Seite 468.
Also ein Opferpriester wie bei Bianchini.
Anhang
Seite 469.
Durch Arbeiten, die an Bolls und Warburgs Forschungen uber die Wanderung
und Metamorphose der Astralbilder ankniipjten (Saxis Kataloge der astrologischen
und mythologischen illustrierten H andschriften des lateinischen M ittelaUers in den
Bibliotheken von I. Rom und II. Wien, die umfangreiche und fur die Zukunft
grundlegende Arbeit von Gundel uber Dekane und Dekanbilder und die Bearbeitung
des lateinischen Picatrixtextes durch Elsbeth J afje) lassen W arburgs Ergebnisse
sich fetzt in einigen Punkten differenzieren. W arburg hatte die Dekangeschichte
und -Verwandlung mit der lateinischen AbU Ma'schar-Obersetzung abschlie{Jen
lassen. Seitdem sind 1.ms eine Reihe fiingerer T exte bekannt geworden, die
die AbU Ma'schar-Tradition weiterbilden, darunter auch solche, die nicht mehr
die drei Sphaeren des AbU Ma'schar getrennt anfuhren, sondern (wie in
Ferrara) nur noch eine einzige Figurenreihe zeigen. Weder geniigt es, zur Ana-
lyse aller 2I in Ferrara noch vorhandenen Dekanfiguren lediglich die direkte
AbU Maschar-Tradition heranzuziehen, noch lassen sich die Eigentumlichkeiten
der Gestalten aus der ,indischen" Sphaera allein erkliiren. Die folgenden Tabellen
versuchen nun, die einzelnen Elemente jeder Gestalt auf den iknen iihnlich-
sten Text, sei es der persischen (bei W arburg als ,arabisch" bezeichneten), sei
es der indischen Sphaera, zuriickzufuh.ren, um dadurch die Oberlagerung der
Traditionsschichten, deren monumentales Endprodukt uns in den riitselhajten
ferraresischen Gestalten vorliegt, deutlich zu machen, und, wo es anging, das
Gesetz ihrer F ormung hervortreten zu lassen. Die T exte sollen also mehr als Par-
aile/en denn als direkte Quellen fur Ferrara verstanden werden, und wenn auch
einige von ihnen (wie vor allem der Picatrix, dessen eigeniumliche Dekanliste
nur im Steinbuch des Alfonso eine Parallele hat [s. Abb. I58-I6I und
Tabelle Libra Anm. I]) wie direkte Que/len fur gewisse Details erscheinen,
so reichen unsere Kenntnisse der kosmologischen Traktate des IS. Jahrhunderts
noch nicht aus, ttm eindeutig die Frage zu entscheiden, ob die ganze Konzeption
etwa von einem der Hofastrologen Borsos als Programm fur die Fresken ad hoc
gemacht wurde, oder ob W erke cines iihnlichen kompilatorischen Charakters,
die in der Auswahl aus der Oberlieferung mit Ferrara iibereinstimmen, bereits
vorlagen. Die Existenz solcher Werlle, wie die Tractate des Ludovicus de
Angulo {I450) und des Giovanni Fontana {I. Halfte des zs. fahrhunderts)
es sind, beweist fedenfalls zur Geniige, dafJ eine mehr oder minder selbstiindige
W eiterbildung auch dieses theoretisch-kosmologischen T eiles der arabischen astro-
logischen Lehre dt"eser Zeit nicht fremd war.
I m V erhiiltnis der fen aresischen Dekane zu den T exten lassen sich allerdings
Auswahlprinzipien nachweisen, die auf eine gewisse Abstufung in der Verbind-
lichkeit der Texte schlie{Jen lassen. So sind in Ferrara alle monstrosen Bildungen
auch dart vermieden (Aries II, Cancer I und III, Libra II und III), wo -die
M ehrzahl der T exte tierisch-menschliche M ischF?.estalten beschreiben: mtr Z ahels
und Leopold von Osterreichs Gestalten sind ebenfalls rein menschlich gebildet.
Dagegen sind die dunkelhiiutigen Typen, der Oberlieferung gemii{J, vollziihlig bei-
behalten ( Anes I, Leo III, Virgo II). Baulichkeiten und Landschaftsandeu-
tungen sind fortgelassen, und die Beziehungen der Gestalten zu sokhen Requi-
siten sind in Ferrara mehrfach zu entsprechenden Aktionsmotiven der Gestalten
selbst umgewandelt worden; so etwa bei der mit erhobenen Hiinden kniendenFrau
in Virgo I II, die nach den T exten zum Gebet in den neb en ihr abgebildeten Tempel
gehen soll [ Abb. I70-I7J}, oder bei dem Fliegenden in Libra II [ Abb. I62
I ihra-lltkan, , S1 I ''I I;\ ZZ<) .\
!J!J, lj:-\, l, , -t ' h)O, i>.)<l)
(ZII S '\ l -
Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferrara 631
und I63], dessen Aktion in allen Textillustrationen dadurch angedeutet wird,
da/3 man ihm eine V ogelgestalt gibt. Ein iihnlicher Proze/3 liegt auch bei der
Figur des Mannes in Leo II vor, der in der Textuberlieferung nur den Bogen
halt, wiihrend in den Illustrationen die Pfeile neben ihm dargestellt werden
[ Abb. I67-I6g].
Zu Warburgs Riickfiihrung des I. Widderdekans durch seine Verwandlungen
hindurch lassen sich fetzt mit diesen Mitteln drei Paralleifalle feststellen. Wie
sich der iigyptische Priester mit dem Doppelbeil auf seinen W anderungen in
den Mann mit dem strickgegurteten Gewand transformiert hat, so geht der kniende
Page und der vor ihm stehende Stabtrager in Gemini I auf das Sternbild der bei-
den Fuhrleute zuruck [s. Boll, Sphaera, S. Io8ff., 223jj., 505]: der eine, der
bei Abu Maschar-Johannes Hispalensis nur seinen Wagen lenkt [Abb. r64],
ist durch doppelt mi/lverstandene Deutungen, die sich in den Texten nachweisen
lassen [Abb. I65 und Tabelle Gemini Anm. I), erst in einen Herrschenden
unddann in einen Dienenden verwandelt worden [Abb.I66). In ahnlicher Weise
geht bei dem Knienden in Gemini II [ Abb. I74], der urspriinglich dem Sternbild
des Herkules entspricht, die Erinnerung an die antike Gestalt verloren, so da{J
seine charakteristische Haltung ,genuflexus" neu illustriert wurde. Auch bei
Leopold, der ihn als ,curvus" bezeichnet, ist er als Herkules nicht mehr zu er-
kennen [vgl. Tab. Gemini, Anm. 2]. Die interessanteste Verwandlung end-
lick macht die Gestalt durch, die nach Boll [Sphaera, S. 275/f. und 5I9]
der mi!Jverstandenen und falsch ptazierten Ariadne mit dem bekanten Schlaf-
gestus der antiken Plastik entspricht. Bei Johannes Hispalensis erscheint
an der entsprechenden Stelle (Libra III) ein Mann, der eine Hand an den
Kopf legt, die andere ,ad laudem" ausstreckt: dieser Gestus wird in den
Illustrationen des Zotori Zapari durch einen im Text nicht gewiihrleisteten
Pfeil zu einer Verzweiflungsgebiirde [Abb.r77], und daraus entsteht (Zwischen
formen bei Ludovicus de Angulo [Abb.r76 und I78]) in Ferrara der ,nudus"
[ Abb. I75l mit seinen verzweiflungsvoll gerungenen Hiinden, deren Ausdruck
dadurch motiviert wird, da/3 ihm der urspriinglich aus der indischen Sphaera
stammende Schiitze beigesellt und mit ihm zu einer einheitlich deutbaren Gruppe
verbunden wird.
Texte zur A nat yse der Dekanfiguren
Von Elsbeth Jaffe.
Der AbU Ma'schar-Text in der Obersetzung des Johannes Hispalensis, ent-
standenii33 {?) (Albumasar, Introductorius, Clm. 374/ol. 45v-47v) istder Ta-
belle zugrunde gelegt ( Spalte I I der vertikalen Einteilung). A bweichungen zwischen
Bild und Wort sowie die Textstiicke, die nicht zu bildlicher Darstellung kamen, sind
durch Kursivdruck hervorgehoben. Die Anmerkungen versuchen Widerspruche
zwischen Ferrara und dem Hispalensis durch Heranziehung weiterer Texte so
weit als moglich zu erkliiren. Nttr wo an diesen von Johannes Hispalensis ab-
weichenden Stellen sich auffallende Parallelen zwischen Ferrara und den anderen
Dekantexten finden, sind diese in der Tabelle selbst (Spalteiii) herangezogen.
Die hier und in den Anmerkungen benutzten Dekanlisten entstammen folgen-
den Werken:
I) Hermannus Dalmata, Introductorium in Astronomiam Albumasaris Aba-
lachi (Venetiis I5o6) pp. e 3 sqq.; zwischen II40 und II43 entstanden.
Anhang
2) Gcorgius Zotori Zapari Fenduli,_,Liberastrologie (Sl.3983, Par.lat. 7J3I. 7344):
Auszug aus Herm. Dalmata. Alteste bekannte Hs. Par. lat. 7330 um I2oo.
3) (Ibn Esra) Abrake Avenaris ... Liber introductionis ... qui dicitur princi-
pium sapientie (Opera Venetiis I507) cap. II. Die lat. Obersetzung durch
Pietro d'Abano aus dem Jahre I293
4) (Zahel) Imagines secundum Zaelem (Vat. lat. 4085, saec. XV.); derselbe,
De interrogationibus, Venetiis I493 undr5r9. Zahel Israelita (AbuUthman
Sahl ibn Bischr) lebte in der I. Hiilfte des 9 fahrh. Eine lat. Obersetzung
mu{J nach der weitgehenden Obereinstimmung Leopold v. Oesterre1:ch bereits
vorgelegen haben. Die Zahel-Zitate wurden liebenswurdigerweise von Prof.
Gundel zttr Verfugung gestellt.
5) C ompilatio Leupoldi ducatus A ustrie filii de astrorum scientia . . . (A ttgs-
burg I489) pp. a [7'}-[8]; entstanden um I200.
6) Pompilius Azalus Placentinus (Pseudonym fur Giovanni Fontana), De om-
nibt-es rebus naturalibus (Venet. I544) fol. 32 sqq., eine vor I455 gearbeitete
Kosmologie.
7) Ludovicus de Angulo, Liber de figztra seu imagine mundi, (Sang. Vad. 427.
Par. lat. 655r. Paris. F r a n ~ . 6r2), verfa{Jt um r450.
8) Das Zauberbuch Picatrix (nach der in Vorbereitung befindlichen Edition der
nach I256 verfa{Jten lateinischen Obersetzztng).
Zur Gruppierung dieser Quellen ist zu bemerken: Hermannus Dalmata und mit
ihm, fur die Dekanreihe fast identisch, daher nicht speziell zitiert, Zotori Zapari
bieten die zweite lateinische Obersetzung des AbU Ma'schar. Ibn Esras Dekan-
text ist eine stilistische Oberarbeitung der gleichen arabischen Quelle. Mit der des
Johannes Hispalensis zz<sammen stellen also diese Dekanlisten die direkte abend-
liindische Oberlieferung der AbU Ma'schar-Dekane dar. - Zahel und Leopold
repriisentieren in beinahe identischer Fassung einen tituliarttgen Auszug, dessen
Elemente mit denen des Abu Ma'schar ubereinstimmen. Wir zitieren Zahel nur,
wo er sich von Leopold unterscheidet. -Giovanni Fontana und Ludovicus de
Angulo geben uberarbeitete A uszuge aus den persischen und indischen Dekanen
des H ermannus Dalmata, werden daher auch nur bei V arianten zitiert. Giovanni
Fontana fugt ihnen als sogenannte griechische Sphare noch cine Reihe hinzu, die
Zahel und Leopold nahesteht.- Picatrix nimmi in einem Teil seiner Dekane, von
denen fur Ferrara Libra I in Betracht kommt, eine Sonderstellung ein. Er schil-
dert hier Dekanjiguren einer bisher noch unbekannten Sphaera. Das mit ihm im
ganzen ubereinstimmende Lapidarium des Konigs Alfons X. von Castilien wurde
ubergangen, da die Verbreitung des Picatrix im r5. Jahrh. und sein Einflu{J auf
das Programm des oberen Freskenstreifens in Ferrara erwiesen sind (vgl. S. 640).
Die horizontale Einteilung der Tabelle zerlegt die Dekane in ihre den verschiedenen
Sphaeren entlehnten Bestandteile: Sp. I Persisch, Sp. II Indisch, Sp. III (nur
bei Libra I) Unbekannte Sphiire. Es fiillt auf, da{J in der Zusammensetzung der
Dekanfiguren von Ferrara die dritte, d. h. die griechische Sphiire des Abu M a' schar
uberhaupt fehlt. Diese Eigenheit teilt der Bilderzyklus mit Zahel, Leopold, Ludo-
vicus de Angttlo, Giovanni Fontana und Picatrix, der au[Jer den erwiihnten De-
kanen fremder H erkunjt nur indische Dekane beschreibt. Die V erschmelzung von
Dekanelementen der persischen tmd indischen Sphiire ztt einer einheitlichen Reihe
hat Ferrara gememsam mit Zahel, Leopold und Giovanni Fontanas pseudo-
griechischer Lisle. Bei Ludovicus de Angulo ist sie nahezu durchgefuhrt.
ltalienische Kunst und internationals Astrologie im Palazzo Schifanoja zu FeYrara 633
Ma'schar-foh. Hisp. I Andere Quellen
Persisch
l Indisch Mann, dunkle Haut- Vir niger, rubeis oculis et ma-
farbe, stll.mmig, Rock gni corporis, fortis et magnani-
und Hose zerlumpt, urn mus indutus lintheo laneo albo,
die Taille Strick, des- precinctus in suo medio fune,
sen Ende er in der et est iratus, stans super pedes
Hand hiilt, finster aus- suos.
'Persisch
III Indisch
l
sehend, stehend.
I
I
Frau, Kleid, an den
Achseln flatternde
I TuohMdw, -<
I
Mulier induta laneo lineo et
vestimentis rubeis habens unum
pedem, et eius imago assimila-
tuy imagini eqltil), habens in
I animo iYe ...
I
III Indisch Jiingling, belles lok- Vir albi coloris et rubei, ruffus
kiges Haar, gut ge- I capillis et iratus et inquietus
kleidet, r. Hand Pfeil
2
) habens in manu sua armillam
I. Hand Reifen. ligneam et virgam, indutus ve-
stimentis rubeis.
1) Die monstrosen Ziige fehlen nur bei Leopold (vgl. Einleitung). Bei Hermannus
Dalmata und Ludovkus de Angulo ist der Dekan auch pferdefiiBig.
2) Warum der Stab, den die direkte Abu-Ma'schar-'Oberlieferung, Ludovicus de
Angulo und Giov. Fontana vorschreiben, mit dem Pfeil vertauscht ist, kann nicht er-
klll.rt werden. Bei Picatrix fehlt der Stab, bei Leopold jegliches Attribut.
Anhang
--------
Ferrara Andere Quellen
TAURUS_j__
/ Aba Ma'schar-]oh_ Hisp.
r ====4=====
I Indisch Frau, reiches offnes
Haar, loses Gewand;
vor ihr Kind, beide
stehend.
Mulier multos capillos habens
ante capite, pulchra, crispa,
similis coloris habens filium,
induta vestimentis que per
I partes invenit ignis combustio.
i
Persisch Nackter Mann, in der I
r. Hand Schliissel, am
Boden sitzend.
II Indisch
Persisch I
r. Hand gefli.igelte
Schlange, in der l.
I Hand Pfeil,
III Indisch dahinter:
Pferd und Hund.
1
)
... et ascendit equus sinister
et canis.
I Leopold
I v. Osterreich
1
)
I Vir nudus in cui-
us manu davis
I
Leopold
v. Osterreich
I
Vir in cuius ma-
nu serpens et sa-
gitta
1) Wir geben hier Leopold von Osterreichs Text als Parallele, weil aile anderen
Quellen den Schli.isseltrager in Verbindung mit einem Schiff bringen. Nur der Titulus
zur Illustration von Taurus II in Paris. lat. 7331 und Sloane 3983 (Schliisseltrager im
Schiff) gibt die gleiche verkiirzte Form wie Leopold ,vir nudus manu clavem tenens".
Als ,sitzend" ist der Schliisseltrager nur bei Ludovicus de Angulo geschildert: ,Vir male
indutus habens clavem in manu sedens in parte navis".
2) Die Zusammenfilgung des Schlangentragers aus der persischen Sphare mit dem
n6rdlichen Pferd und Hund aus der indischen ist ohne Parallele. Ludovicus de Angulo
hat fiir den 3 Taurusdekan zwar auch eine Kombination aus heiden Sphll.ren, aber er
wahlt aus der indischen das Monstrum mit Iangen Zahnen und L6wen-Elephantenleib.
Auf ibn kann also Ferrara in diesem Dekan nicht zuriickgehen. Dagegen ist die Ver-
wandtschaft von Ferrara mit Leopolds Text fiir den ,persischen" Bestandteil des Bildes
iiberzeugend. Nur Leopold gibt dem Schlangentrager aus bisher ungeklarten Griinden
neben der Schlange den Pfeil.
Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanofa zu Ferram 635
-;;;;;;;;;;! I Ferrara I Aba Ma'schar-Joh. Hisp. \ Andere Quellen
fische Kleidung, rechte Vir manu sua
1
-Persisch I Stehender Mann, ho- / I Ludov. de Angulo
I
Hand Stab, vor ihm virgam tenens et
I ein Page, knieend.l) iuxta eum clien-
1 tulus unus
Indisch I - vel mulier benivo-
la forma erecta
1
Persisch
II
lndisch
Nackter FlOtenbH.lser,
hockend, vor ihm ein
Kniender mit vor der
Brust gekreuzten Han-
den, ebenfalls nackt.l)
Vir habens fistulam at,ream,
cum qua canit et Beruleus, et
quidam vacant eum H erculeus
et ipse est reflexus super genua
sua.
--------------+-------
I II Hand Bogen
3
) und ' dum, habens secum clipeum
3
) et
Mann, stehend, rechte I Vir petens a::a ad induen-
Pfeile, an der Seite geabah, id est faretra, et sa- .
Kocher, gut gek.leidet. gitta in manu illius et
menta atque ornamenta.
-- -I)Um die Metamorphose der heiden Fuhrleute in die Gruppe in Ferrara (cf. Einl.)
zu verdeutlichen, ist eine "Obersicht iiber die Phasen der Textgestaltung notwendig.
Johannes Hispalensis
,Vir habens in manu sua virgam ...
Leopold von Osterreich
Vir in cuius manu virga
Giovanni Fontana (pseudo-griechische Sphl.lre)
Forma hominis habentis in manu virgam,
Ludovicus de Angulo
et duoplaustra, super duos equos
sedens super illa vir regens ea.
et alteri serviens.
cui adest alter, qui ei deservit.
Vir manu sua virgam tenens et iuxta eum clientulus unus."
Das Verstl.lndnis der Beschreibung dieses Dekans im arabischen Abft Ma'schar bereitete
den Iateinischen "Obersetzern Schwierigkeiten, die zu Interpretationsversuchen fiihrten.
Die Vorstellung, die Johannes Hispalensis mit ,vir regens ea" wiedergibt, wurde auf die
Bilder des groBen und des kleinen Fuhrmanns bezogen- so bei Leopold, der hier, wie
gewohnlich, die Angaben zusammenzieht. Daher erscheint bei ihm der kleine Fuhrmann
mit dem Stab als ,serviens alteri" (nl.lmlich als Diener des ,.graBen" Wagenlenkers).
Eine leichte Fehlervariante ,.alter" statt ,.alteri" in dem Titulus des Zahel-Leopold
(cf. Zahel, de interrog.) fiihrte zu der Textgestaltung bei Giovanni Fom:ana und weiter zu
der Paraphrase des Ludovicus de Angulo, die der Darstellung in Ferrara genau entspricht.
2) Die ausdriickliche Deutung des Knienden als ,.Herculeus" bei Johannes Hispalensis
macht es unwahrscheinlich, daB die Darstellung in Ferrara auf diesen Text zuriickgeht. Die
Deutung fehlt nur in den verkiirzten Texten (Leopold, Zahel, Giovanni Fontana), doch be-
zeichnen diese, a us einer anderen "Obersetzer-Tradition herstammend, den (Hercules) genu-
flexusals ,curvus" (cf. Alkabitius-Commentardes Joh. Saxonicus, Paris 1541, fol. 36: incur-
vatus vel genuflexus) bei Fontana verlesen zu ,cervus". Zu welcher Bildauffassung ,curvus"
fiihrte, zeigtdergebiickte Dekanim Astrol.Planum; welche Bildvorstellung Fontana mit, ,cer-
vus" verband, veranschaulichtseine Glosse ,quem alii vacant Atheonem" (Actl.lon). Der Kom-
position von Ferrara muB also ein Text zugrunde gelegen haben, der il.hnlich verkiirzt wie
Leopolds: .. Vir in cui us manu fistula et alter curvus", doch das ,genuflexus" beibehielt.
3) ,Clipeum" bei Johannes Hispalensis ist falsch. Ferrara hat richtig den Bogen
m "Obereinstimmung mit dem arabischen Abu Ma'schar und der gesamten lateinischen
Tradition, soweit sie die Waffen aufzahlt. Die Darstellung ist also nicht allein aus Johannes
Hispalensis zu erkll.lren.
War burg, Gesammelte Scbriften. Bd. 2
636
Anhang
--"-----------------------
CANCER ! Ferrara AbU Ma'schar-]oh. Hisp.
I
PeYsisch
Indisch Schaner ]tingling. dcr Vir pulchre speciei, iuvenis, in-
Korper scheinbm un- vestimentis et ornamentis
' bekleidet. Ein Blatter- et in facie eius atque digit is ali-
zweig tiber dem Un-
terkiirper. Sehr uber-
', malt und zerstoYt.l)
quantUlum tortuositatis; corpus
qttaqtte eius assimilatur cor-
pori equi atque elephantis ha-
bens pedes albos, iamque sus- '
pendit super eo diversas species j
I frugum et folia arborum.
I puelfuex
stehend vor einer
II Indisch I Frau in reicher Ge- secunda puella aspectu pul- I
1
wandung mit Diadem. chra et super caput eius corona i
' Ste si<zz und haz in der : mtrtt rubei et in manu eius vir- 1
' r. Hand emen Stab.
2
) 1 ga lignea. I
------..---
Persisch I --
Indisch
1
Mann mit Schwimmfii-
Ben8) ,gefluge/teSchlange
III kriechtanihmhoch.Hat
goldeneKette urn, setzt
einen FuB auf ein mit
Silber- und Goldklum-
pen geftilltes Schiff.
Vir cuius pes -:-ssimilatur pedi I
! celhae ... a) iamque extendit
I super coypus suum amicamb)
I habens super se ornamenta
j aurea, habens animo venire ad
'I navem et navigare in mari ut
auferat aurum et argentum.
Andere Qtullen
a) Schildkriite cf. Boll p. 509.
emendieren cf. Boll. p. 509 Anm . . ru I6.
b) sic Ms.; es ist wahl amictum Obergewand zu
I) Dieser indische Dekan ist in Ferrara so schlecht erhalten und so stark iibermalt,
daB tiber die Einzelheiten der Darstellung nur mit Vorsicht geurteilt werden dar. Sicher
ist, daB der abgebildeten Figur in der urspriinglichen Fassung die von Hispalensis vor-
geschriebenen .. vestimenta et ornamenta" fehlten, ebenso sicher, daB ihre untere Halfte
niemals tierische Merkmale aufwies. Diese wie auch die ,.Verrenkung" des Gesichts und
der Finger fehlen auch bei Leopold von Osterreich: ,.vir super quem panni decoratio".
Da jedoch bei ihm der Dekan an falscber Stelle zu Cancer II erscheint, miichten wir fiir
das Fehlen der Tiergestalt auch noch Giovanni Fontana (In disc he Reihe) als Parallele heran-
ziehen: ,.pulcher adolescens, nobilibus pannis involutus et ornatus, sed facie et digitis
parumper tortis". Dagegen ist Zahels Angabe: .. puella virgo et vir super quem sunt panni
et decoratio", trotzdem sie von der Leopolds abweicht, fur Ferrara nicht zu verwerten.
2) Diesel be 1\ombination des gleichen Bestandteils des reichhaltigen persischen Dekan-
abschnitts mit der indischen Dekanfigur liegt auch bei Zahel und Ludovicus de Angulo vor.
3) Cancer III ist der einzige tiergestaltete Dekan in Ferrara. Gerade diese Aus-
nahme bestatigt die Hypothese, daB das Fehlen der menschlich-tierischen Mischgestalt
in Ferrara sonst auf Leopold zuriickgeht. Denn dessen Beschreibung des III. Dekans
.,ein Ml\dchen mit Krone" war ftir das ferraresische Programm nicht zu verwenden,
da diese Beschreibung in Ferrara schon fiir den II. Dekan (aus dem sie Leopold in den III.
versetzt hat) verwendet war. Auch Zahels Angabe, der ein Madchen und einen Mann schil-
dert, wurde in Ferrara nicht illustriert. - Fur das Bewegungsmotiv der Figur wl\re noch
Ibn Esra heranzuziehen: .. eiusque desiderium est navem intrare".
4) amicam (bzw. amictum) nur bei Joh. Hisp.; in den iibrigen Texten auBer denver-
ktirzten hat dcr Dekan am Korper oder in der Hand (Picatrix) wie in Ferrara eine Schlange
(cf. Boll p. 509 Anm. zu 16). Also auch hier nicbt reiner Johannes Hispalensis.
.\1>1>. 1i12 .. l.iiJI;,.J ltk;,n, i';il;,zz<>
(Z\1 (IJI. 11311\.
J
'
......-..... .. ..,_
.
\JJ!,. '"> 2 l.il'r" I ltk<III. 1!.11 II l.tid"' t<tl:-, <i< .\ttc_:ul",
C.ill.tl. ('lid \'<td. 12/. '"',-.;,,I ill\ ''.)1. ".l"'
.\ldt. IlrJ i'<'hh< lit <[,., \ltll \Lt'" li,ll /liiii I (;<'lltinill<k,tll,
l
1
;1rh, J{ild. :\,tt ('cHI. 1.11 73:)1. fed . ..!.)
1
(/ll llJ)l.
\Jd,, I LtJJ\1111 JJ,lt ill.IHlt)\)1 thdl \tl...:lllll
(.Ill[ \',11J !11J "ll\ 1/\J "'""tl11 lo)\.11_),11
\lrlt llrl< I Ct llliiiil ltk<tll, I '<tLt//IJ -;, J,If.l!lJ,I
/.II 1'.) I I lJl'
.\l>h. If/- - Lto-ll<'k<tn. l'<tLtzzo SthiLtnoj.t lzt1 Sill' ''.ll. ''371
-+-
\hI> If,,-;_ I lr, 1 t '!I 1 c:' S 1 >I 1"' r. 1 ' ].-, \I '11 \I" " l1, 11 -' 11111
c l.<o-ll,k.IIJ.i.llnd"n 1:111 \Itt' :---l.llt \1, .\'>"-).
j()l I;\ (/tJ ll_)J 1.):,
\1>1 ''"' S]'h"''" rl<"' \l11 :\l"'"h.11
111111 - _, . ., ll,k.lll. JJ.l< l1 ll>n 1-:,r;t. ( '"1. l..tt
:\IcnLH ,"i.!_tl 1/ll :--,tJtc f1_)I. 1137,1
Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schijanoja zu Ferrara 637
LEO Ferrara _L Aba Ma'schar-]oh. Hisp. _l Andere Quellen
Persisch
I
II
1
Jndisch
l
Persisch
Baum mit gro6erWur-
l
zel,daraufsitzenHund,
Vogel und Mann mit
Talar und Barett.
I
arbor magne radici::; super cuius
ramos est canis et rahgmahB)
et indutus vestibus sublinu-
otisb) sordidis, cupiens flere.
II Indisch Hockender Mann, nor- I Vir parvi nasus, super caput
males Gesicht, Kranz eius corona ex albo mirto, et
auf dem Kopf, r. Hand in manu illius arcus, iudicatur
Pfeil, I. Hand Bogen. pro latronibus, caUidus et ira-
Anzug mit flattemden cundus assimilatur in forti-
Tuchenden. tudine sue leoni, circumdatus
lintheo Ianeo ad colorem leonis.
i Persischl
I
111 lndisch I Mann von dunkler Vir cuius species est similis
I
Hautfarbe, ha.61ich, speciei aringeC)l) fedus et iners
mit der r. Hand steckt multi laboris ac gravis meroris
I
, er etwas Unkenntli- in cuius ore sunt fructus et
ches in den Mund, in caro, et in manu illius ib(ri)s,
I der 1. Hand Fleisch- id est urceum eneum.l)
i keule, bekleidet
~ schwertgegurtet.
I
und I
I
a) Geier cf. Boll p. $II. b) sic Ms. c) Neger cf. Boll p. 5I3.
1) Leopold, dem Ferrara gerade darin nahesteht, da6 beide die Tiergestalt der De-
kane meiden, vermeidet bei diesem Dekan auch das .,niger" und beschreibt ihn bloB als
.,fede faciei."
2) Bei Ibn Esra fehlt wie in Ferrara das Metallgefl!.6, das der Neger in der Hand
tragen soli. Nach diesem Text hat er im Munde .,deliciamenta", in der Hand ,.caro";
die Angaben entsprechen also der Darstellung besser, als die des Johannes Hispalensis.
41*
Anhang
VIRGO i Ferrara. Abu Ma'schar- ]oh. Hisp. Andere Quellen
____ J _____
1
-Persisch lschone Frau mtt losen Virgo pulchra atque honesta I
Haaren, r .Hand Ahren, et munda, prolixi capilli et I
pulchra faciei habens in manu !
sua dua.s spicas et ipsa sedet ... I
' Picatrix
1
1
lndisch in antikes Gewand ge- puella virgo habens super se pueUa virgo linteo
I
hnllt, aufrecht ste- lintheum laneum et vestimenta laneo veteri co-
bend, I. Hand Granat- vetera, in manu illius&) et ma- operta et in eius
1
apfel. nus eius suspense, et ipsa est manumalumgra-
erecta. 1 natum tenens-
____ ! i I
Persisch!
!
Indisch
----------,------ ------- --------- I
HtJfJlichet-, exotisch
aussehender Mann, in
Tflcher gehflllt. R.
Hand Schreib- oder
Rechentafel, I. Hand
Federkiel, hockend.2)
I
ni.gerl),
I aspicere in computacionibus.
pore ;am nan p;n, naoens I
super se vestimenta tria, quorum
1
unum est cot-ium et secundum
siricum, tercium vero est lintheum ;
laneum rubeum, et in manu illius :
est vas incausti, et ipse cupit I
-------
1
Pet-sisch
Indisch
III
I
AUere Frau, Nonnen- '! Mulier surda pulchra alba ma-
tracht,kniend, betend.
3
) gnanimis se b) iamb) lintheum
I lineum tinctum et ablutum ubi
I numquam accidit infirmitas in
I suo corpore et ipsa nititur venire
l domos orationis causa orandi
1 m eis.
I
&) Das Obfekt fehlt augenscheinlich. Im arabischen Text ist es ein kleines GefaLl
(cf. Boll SI4). es wurde von der lat. auf veYschiedene Weise interpretierl.
Daher kann man auch bei Johannes Hispalensis nicht etwa die vestimenta vetera, die
in der ganzen tJberlieferung zur Kleidung geh6ren, als Objekt auftassen. b) super se
habens scheint der Text zu erfordern.
r) Nur bei Picatrix nicht als Neger sondern als .,vir pulchri coloris" geschildert.
2) Die Tabelle zeigt, dal.l nur wenige Bestandteile der Hispalensisbeschreibung des
indischen Dekans beriicksichtigt sind, und einige davon, das .,vas incausti" und das als
Rechentafel dargestellte ,.cupit aspicere in computacionibus" sind so wenig charakte-
ristisch wiedergegeben, dal.l man zu der Interpretation der Figur doch wohl auch noch
Ibn Esra heranziehen m6chte, bei dem es ausdriicklich heil.lt: . ,sunt in manu eius tabule,
ubi computacionem exerceat".
3) Auch hier bietet der z. T. sehr verderbte Hispalensis-Text hochstens die Grund-
lage fiir die Vorstellung .,betende Frau", die aber bei Ibn Esra, der den Kirchgang aus-
lal.lt, prlignanter zum Ausdruck kommt: ,.ipsaque Deum precatur".
.\hh 171. _l\.Jrc.:o-J),.k.\11. ""' IJ l.l!d<<\1< Jhdt.\llc.:lll".
l'ari'. 1\ihl. :\;Jtio!lalt. Cod fra11<;. lol. 117'
(ZII il_ll. f>_l<'i)
.\hiJ. lj_l. _1. \"irgo-l)tk;l!l, l'alazzu SchiLllloja
(zu Sci!<- !>31. I>JSI,
.\1>1>. 172. \"irg<>-Ptkan, n;1ch Ludm:icu,;
dt .\ll.C.:III". l'aris. Hit.L :\ational<-. Cod.
L1l. l>jf>l, fol. 1oh ,. (zu S<'itt' 1>3r. ll]Xi.
,\hi>. Ij.;. Ccmilli-!kk;IIJ, ]';tLtzzo Schifanoj;t
(zu Sl'itc- f>JI. (>Jj).
.\l,f,_ 1;5 . . ). Lii>Li-ll,kan. :-;, hifan"j"
(Zll Scitt IJjl.
.\hi>. I;;. IJ.- 1111<1 indi" IJ,. :-;piLH'LI lLil IJ
.\1>11 \l;i''< Zlllll _l. J.ii>LI-1 l,k.ill. l.()lJd<lll. lint.
\lu,;., \b. 3'.1:-iJ, J.,J. c2
1
(Ill :-;,it ''.l' ''3'11-
... ,
, ....
(. ! .. , ;,.,... ,,.... A,, .... ,.,.. _
tf4tt> , .. ; 'd ft"(f< fo ':::.< (1:t'4' ...... ').._ ("f \_.:Ut' J'U ....
f.__ 1- , .. ,, . -:--..,. .. .,. ... ,, .... d A rro
1; ... 'h.( ,.,., ...
1
.,._,.. .,.,,.
_ f.-1 f't- f I t,oHt.L .-... r#t>"i"f
.... ff(lc".-t(u.f.u.ft' .. !.."' ,,; .... ,v .-f ",. .....
(: 'I f .,.,.,.lr t'"t., f.t .,.,,,, .....,. ri\ .
. c(f ..... , ,.,.f%rr t;.v'C..-.. ,!JU'"<to.l..nl .. f.ot.
... ....-r..:. .. <4'-..-a.6 . ...-. ... (".-n.,, ... / ... ,(ft
I.'"'"' ,_ ........ rf a.fl'>. ..... .,.,,f
... f!.":f""'-4kau
hrfl
.\hi>. Ijf>. I und indische Spha('ra
z11111 _l. J.il>ra-lltkan, nach Lurlo,icus de ,\ngulo,
ll!hl. :\at., Cod. fran<;. 1112 (zu Stitt bJI. ''3'!'
.\1>1>. 17."\. nacl!
; k .\ngulo. St. { ;;tlltn. ( '(Jd. \'ad. 427, fol. HI) r
(zu Sl'Itl' 1>31. I>J'J).
ltalienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferrara 639
LIBRA Ferrara _LAM Hisp. Andere Quellen
Persisch I Mannl) stehend, auf ei- . . - Leopold
nem Instrument bla- v. Osterreich
send, das er in der r.
Hand Mit.
I Indisch
Unbek. l. Hand Stab oder
Sphaera Lauze und hiingender
I I
Persisch I
Indisch Mann, bekleidet, mit Vir cuius species est species vul-
11 zum Himmel gekehr- turis), supera) colorem arra-
tem Gesicht und Hand him b) nudus sitibundus, mani-
flll.chen, was den Ein- bus debilis, cupiens volare ad
druck des Fliegens aera.
vorruft.
III
Persisch j Nackter Mann mit ge-l
rungenen Handen
und
lndisch Schutze, den Bogen
spannend.
8
)
a) se habens ist .cu erganzen. b) Aasgeier Boll p. JI9-
forma viri irati
in cuius manu
fistula.
Picatrix
Vir in eius dextra
lanceam tenens,
I
in sinistra vero
avem pedibus
pendentem
Leopold
v. Osterreich
Vir nudus
I vehemens, in
I CU1US manu est
I arcus
I) Hier liegt die gleicbe Kombination vor wie in virgo I: Eine Figur a us Picatrix
erhlUt au.Ber ibren eigenen Attributen ein Attribut aus der persischen Sphare. Die Ab-
leitung aus Picatrix ist zwingend, weil in diesem Fall der Dekan der unbekannten SpMre
entnommen ist, die sonst nirgends wiederkehrt; Leopold ist fiir den ,persischen" Hestand-
tell als nachste Parallele herangezogen, weil der Flotenblaser in der anderen "Oberlieferung
nocb ein zweites Instrument hat und beritten oder (bei Johannes Hispalensis) auf einem
Sattel sitzend erscbeint.
2) Die Geiergestalt feblt wie in Ferrara auch in den Texten Leopolds, Giov. Fontanas
(pseudo-griechische SphiU"e) und bei Picatrix. Leopolds ,.duo viri servientes ... "sind als
QueUe fiir Ferrara ungeeignet, auch der ,.vir niger" des Picatrix komrnt nicht in Frage,
da die Negertypen im allgemeinen gewahrt werden. Am nachsten kame Giov. Fontanas
Beschleibung einer Einzelfigur ,forma hominis servi ... ", die jedoch in den Details auch
von Ferrara abweicht.
3) Der aus der indischen Sphare iibernommenen Gestalt des Bogenschiitzen kommt
Leopolds Titulus am nachsten. Alle anderen Texte geben ihi ein Pferdegesicht (cf. Ein-
leitung). Die Reihenfolge der Figuren ist in Leopolds Text umgekehrt.
Anhang
Seite 46g.
Ober die Namen der Kiinstler s. Adolfo Venturi, Storia dell'Arte ItaUana VII,
J, Milano I9I4, p. 602 sqq, p. 750 sqq. Von Francesco Cossa sind Miirz, April,
Mai; aus der Werkstatt des Cosima Tura: I} ]uni, ]uli; z) A ~ t g u s t , September.
Seite 470.
Der epische Zug dringt durch.
Auch der ,olympische" Bereich im oberen Freskenstreifen ist in Einzelheiten
nicht ganz frei vom EinflufJ fener orientalischen Diimonologie, die die Figuren
des mittleren Bildstreifens in seiner Gesamtheit bestimmte: ein Teil der Tiere
auf den Fresken steht mit den Gottheiten, bei denen sie erscheinen, weniger
in einem mythologischen als in einem magisch-sympathetischen Zusammen-
hang; sie stammen aus den Reihen, in denen Picatrix Tiere, Pflanzen, Steine,
Metalle, Wohlgeriiche, Farben, Sprachen, GliedmafJen und Gewerbe in kos-
mischer Affinitiit den Gottern zuordnet, zu deren Beschworung seine Zauber-
gebete dienen sollen (vgl. H. Ritter, Pic-atrix, ein arabisches Hat'.dbuch helle-
nistischer Magie, in: Vortriige der Bibl. Warburg I, I92I{22, S. ro4). Picatrix
fiihrt bei Venus die Hasen und die vielen Vogel, bei Sol die Falken, bei Merkur
die Affen und die T1'olfe an (sie sind in dieser Verbindung sonst in keiner
anderen der in dieser Zeit bekannten Quellen zu bel.egen); sogar der Pfau, der
rechts auf dem Sol-Fresko halb hinter einem Felsen hervorkommt, ware durch den
Ausdruck des Picatrix ,et est particeps in pavonibus" (Hamburg, cod. mag.
r88, p. 2r2) zu erkliiren.
Seite 47L
Abgebildet bei Friedrich Winkler, Die fliimische Buchmalerei des XV. und
XVI. ]ahrhunderts, Leipzig I925, Taf. 6o: Der Meister der Maria von Burgund.
Seite 47L
Der Mythographus Ill, II, 2 (vgl. S. 627) gibt an der entspreche1Uien Stelle
die klassische Stellung der drei Grazien: zwei wenden das Gesicht, eine den
Riicken dem Beschau.er zu. Ebenso Petrarca ( Afr. Ill, zr6 sq.). Berchorius mifJ-
versteht diese Beschreibung und lii/Jt zwei Grazien der Venus zugewandt, eine von
ihr abgewandt stehen. Dementsprechend die Bilddarstellungen in den Ovide mora-
lise-Hss., in den Tarocchi und iiberraschenderweise noclt itn Gafurius-Holzsclmitt
(S. 4I2ff. und Abb. 96).
Der .,Libellus" stcllt zwar die Wenduttg der Grazien zum Beschauer wieder her,
nicht aber die Armhaltung ,connexae", die sowohl der M ythographus I II wie
Petrarca haben, und die gleichfalls erst bei Berchorius verschwindet.
Seite 472.
Die Ente statt der Muschel itt der Hand der Venus, die sick auf fast allen von
Berchorius abhiingigen Bilddarstcllungen zum Ovt:de moralise findet, scheint auf
eine1J Lesefehler etwa ,auca marina" statt ,conca marina" zuriickzugehen.
Seite 472.
Z um M onatsbild J uppiter-K ybele:
Tafel XCV
.\hh. I 7'1 I 1
Ztichnung d(':-i Jq. ll.tt h dtnl ltr:...tortcn ln-..J..:(, !Ill J',dd//t -:--; . !Jif:!!H,j:t z:u F(rr;1r;:
IZil IIIII.
Jtalienische Kunst und internationale Astl'ologie itn Palazzo Schifanoja zu Feuara 641
In Kyzikos, wo Teukros geboren ist, war der Kybele-Kultus besonders im
Schwange. Die Identitiit von Teukros dem Babylonier mit Teukros von Kyzikos
istfraglich; vgl, Christ-Schmidt' Gesch. d. gl'iech. Lit.
6
' II' I' M unchen I920, s. 4I6.
Seite 473
Die leeren Throne der Kybele ( Abb. II4) sind durch eine verderbte Textstelle in
die mythographische Tradition eingedrungen. Augustin schreibt (De Civ. Dei
VII, 24): ,Nam et ipse Varro quasi de ipsa turba verecundatus unam deam
vult esse Tellurem. Eandem, inquit, dicunt Matrem Magnam; quod tympanon
habeat, signijicari esse orbem terrae; quod turres in capite, oppida; quod sedens
fingatur, circa eam cum omnia moveantur, ipsam non moveri ... " In dieser
Form ist der Text aber erst von Zoega ( Bassirilievi I, 93) richtig wiederherge-
stellt. Bis dahin hiep der verderbte Text si.imtlicher Hss.: quod sedes fingantur.
Diese Version geht durch Isidorus (Etym. VIII, II, 64) in Hrabanus Maurus'
Werk De rerum naturis uber (Migne P. L.lll, col. 4JI), von diesem ubernimmt
die sedes vacuae vermutlich auch Boccaccio (Genealogia III, 2, Basel I5J2 p. 58),
der die durch die T extverderbnis sinnlos gewordene varronische A Uegorese durch eine
Reihe eigener ersetzt: , ... Sedes autem vacuae illi circumpositae existimo, nil
aliud velint quam ostendere, quia non solum domus, sed civitates, quae incolentium
sttnt, sedes vacuentur, persaepe peste agente vel bello; seu quia in sttperficiae terrae
vacuae sint sedes plurimae, id est loca inkabitata; seu quia ipsa terra semper sedes
servet vacuas nascituris". etc. Die leer en Sitze erscheinen in der spiitmittelalt.
mytkographiscken Literatur nur be"i Boccaccio, der dadurch als Gewi.ihrsmann fur
den gelehrten Urheber der Schifanofa-Fresken erscheint; nack Boccaccio uber-
nimmt sie V incenzo Cartari, Le vere e nove I magini degli Dei delli A ntichi, Venedig
r 556; von leer en Stiihlen umgeben ersckeint K ybele auch im F estzug des V asari
I565 (Discorso sopra la Mascherata della Genealogia degl'Iddei de' Gentili,
Firenze I565, p. II2 mit ausdrucklicher Berufung auf Boccaccio).
Ob der so seltsam veranderte Text bereits Augustin vorgelegen kat oder von ihm
stammt, ist nicht festzustellen. Es sei aber dahingestellt, ob etwa das MiPverstiind-
nis durch die Erinnerung an den antiken Kult der leeren Gotterthrone zu erklaren
ist, der durch Pausanias auch fur den Kult der Magna Mater bezeugt ist (vgl.
Wolfgang Reichel, Ober vorhellenische Gotterkulte, Wien I897, S. 2I), und der
auch die altckristliche Vorstellung der Etimasia, des leeren Thrones Christi,
mitbestimmt kat (vgl. Oskar Wulff, die Koimesiskirche in Nici.ia, StraPburg
I90], S. 2I4f.).
DaP Boccaccio bei der Ausstattung der ferraresischen Gotterbilder mit maP-
gebend war, dafur liefert ein anderes Fresko einen sicheren Beweis:
Die Affen vor und auf dem W agen des V ulkan erscheinen nack der Genealogia
Deorum (XII, 70, Basel I5J2, p. JISsq.) auf Grund einer verderbten Servius-
stelle (Comm. in Verg. Bucol. IV, 62, ed. Thilo, r887, p. 53): der vom Himmel
geschleuderte Vulkan wird von den Sintiern, den Einwohnern von Lemnos, er-
ni.ikrt. Indem Boccaccio ,a simiis" statt ,a sintiis" liest und diese merk-
wurdige Gottererziehung durck eine allegorische Erkli.irung noch unterstreickt,
bereichert er das V ulkanbild um ein sonst nirgend vorkommendes Detail.
Dem Flammenhaupt der Vesta, das, auf dem Fresko nicht mehr erkennbar, in
einer Zeichnung des XIX. ]ahrhunderts erhalten ist (Abb. I79), entspricht
Boccaccios: ,Huius praeterea numquam visam dicunt effigiem, quod dicunt eo
quod incognita sit, nam si flammam videamus, quam illi dicemus esse effigiem?"
Anhang
(Genealogia VII, 3, Basel I532, p. 20I). Diese Stelle bei Boccaccio geht alter-
dings auf Ovid: ,.ejjigiem nttllam Vesta nee ignis habet" (Fasten IV, 298; da-
nach auch Mythographus III, 2, 5, ed. Bode, p. I59) zuruck, aber dadurch, daf.J
das Flammenhaupt zugleich mit dem Zeus kind und den J ungfrauen auf dem
Fresko erscheint, wird es wahrscheinlich, da/3 hier Boccaccio, und nicht einer der
anderen Texte, die Quelle des Inspirators der Fresken war.
Boccaccios Genealogia war nachweislich in zwei Exemplaren in der Bibliothek des
Herzogs Borsa vorhanden (Bertoni, La Biblioteca Estense, Torino I903,p. 222).
Seite 474
Galeotto ist 1499 im Kirchenbann gestorben, nachdem er aus politischen Griin-
den I483 exkommuniziert worden war. r6 Jahre lang hater also nicht nur selbst
im Bann gelebt, sondern auch dem Interdikt getrotzt, das zu gleicher Zeit seiner
Stadt aujerlegt worden war. V gl. Burckhardt, Kultur der Renaissance, Ge-
samtausgabe V, S. 337 Die Mutter dieser beiden streitbaren BrUder war Giulia
di Feltrino Boiardi, selbst Dichterin und Schwester des Dichters Matteo Maria
Boiardo.
Seitc 474
Derselbe Avogaro riet Lorenzo zur (Ring-)Steinheilung und empfiehlt das
Heilmittel nach Art des Mesue ,ellescof", den ,eli tropia" und ,celidonio".
Angelus Fabronius, Laurentii Medicis Magnifici Vita. Pisis 1784, II, 394 sq.
Ober Mesue den ]ungeren und seine in Italien Mufig gedruckten und 1"ibersetzten
pharmazeutischen W erke, zum T eil Jortgesetzt und herausgegeben von Pietro
d'Abano s. Ludwig Choulant, Handbuclt der Bucherkunde fur die iiUere Medizin,
Leipzig r842, S. 35Ifj. Elitropia oder Diaspro ist der Sonnenwendstein, eine
Abart des Chalcedon; Celidonia ist der Schwalben- oder Krotenstein, Chelidonit.
Seite 475
Zu der von Pellegrino Prisciani empjoh/.enen gunstigen Konfunktion:
Nach den Katasterismen ist der \Vassermann gleich Ganymed, also zum Him-
mel strebcnd und fromm gottergeben (Boll, Sphaera, S. I56, 224 und282);
der aufsteigende Mondknoten, Schnittpunkt der Ekliptik und der Mond-
bahn, caput draconis genannt (Bouche-Leclercq, L'Astrologie Grecque, Paris
r8gg, p. I22sq.) gilt nach den arabischen Astrologen mit einem Teil der Pla-
neten als ,fruchtbar".
(Franciscus Junctinus Fiorentinus, Speculttm astrologiae, Lugdtmi rs8r, I,
p. 769 (Comment. in Ptol. de Astr. ]ttd. Lib. IV, Cap. 5): Planetae joecun-
di seu protem largientes sunt Jupiter, Ventts, Luna et caput Draconis Lunae,
zitiert von Bouche-Leclercq, p. 452
1
).
Ober die Aufnahme des Drachenkopjes gleich einem Planeten in die Horoskopie
vgl. Bou,chi-Leclercq, p. I22sq. Bouche-Leclercq zitiert auch (p. 468 in der An-
merkung) die Gunst der Verbindung von Jupiter mit dem Caput draconis
aus Abu Ma'schar in Margarita philosophica und nennt sie: moment rare, du
reste, et difficile a saisir; s. Gregor Reisch, Margarita Philosophica, Lib. VII,
Tract. II, Cap. X (Gruninger, Argentoratum ISI2, jot. T III): Albumasar
impietatem impietati acwmulans ait: Qui deo supplicaverit hora qua Luna cum
capite Draconis Iovi coniungitur, impetrat quicqttid petierit. Offenbar handelt
Italienische Kunst und inte1nationale Astrologie im Palazzo Schijanoja zu Ferrara 643
es sich hier um dieselbe Abu Maschar-Stelle (Cat. Cod. astr. gr. V, I, p. I47sq.),
die Prisciani selbst als Beleg fur seine Ratschliige nach Almansor zitiert ( s.S.480 ).
Seite 476.
In iihnlicher Verbindung mit dem hOfischen Leben lii(Jt sick die Restitution des
antikisierenden Idealstiis auch in der gleichzeitigen ferraresischen Dichtkunst
nachweisen: Cleofe Gabrielli schildert, nach einer Huldigung durch die antiken
Gotter, eine poetisch-heroische Auffahrt des Borsa d'Este zttm Parnass, wobei ihn
die sieben freien Kii1tste und eine Schar von heidnischen und modernen Dichtern
begleitet. (Anecdota litt. IV, Roma 1783 p. 449sqq. Burckhardt, Kultur der
Renaissance, Gesamtausgabe V, S. JOJ.)
DafJ die Gestalten der gelehrten M ythographie in der ferraresischen Renaissance als
olympische Gotter empfunden wurden, dafiir liefert den Beweis der Traktat des
Lodovico Lazzarelli, den er I47I dem Herzog Borsa widmete (cod. Urb. lat.
7I6): seine Verse wollen an Hand von Kopien nach den Tarocchi-Planeten
die dii gentilium aus ihrer profanen Degradation ztt Spielkarten retten und in
ihrer urspriinglichen Bedeutung als Gotter wiederherstellen (Saxl, V erzeiehnis
Rom, Heidelberg I9IS, S. rorf.). In demselben Sinne diirften also die Gotter-
gestalten im oberen Freskenstreifen, besonders in ihrer Anordnung nach Mani-
tius (S. 470) dun ferraresischen Beschauer als Olympier erschienen sein.
Die Beschreibung der Tura-Fresken in den Dialogi des Lilitts Gregorius Gy-
raldus bei H. jul. Hermann, Miniaturhandschriften aus der Bibliothek des
Herzogs Andrea A1atteo III Acqttavwa, in: ]hrb. d. Kstsmlgn. des A. H. Kaiser-
hauses, Bd. XIX (r898) S. 207ff.: Die Gemiilde des Cosima Tura in der Biblio-
thek des Fico von Mirandola. Zur Frage, wann Gyraldus die Fresken gesehen
hat, vgl. besser Gianandrea Barotti, Memorie Istoriche di Letterati Ferraresi,
2. ed. Vol. I. Ferrara I792, p. 339sqq.
Seite 477.
Eine Zwischenstufe auf dem W ege zur Olympisierung der Gotter nimmt auch
das Jlrfinerva-Fresko ein: Pallas mit der ,Meduxa" schiitzt als Jungfrau in
der Giostra (Florenz r475, auf der Turnierfahne deutet sie sinnbildlich auf die
Beziehung des tenter ihrem Schulze kiimpfenden Ritters Z1t seiner Dame; vgl. oben
s. 24f., 59 u. ]26).
Die Gruppe der Gelehrten, die der Minerva auf dem Mii,-z-Fresko kind-
schaftlich, nicht anders als die Weberinnen, zugeordnet sind (Manitius, Astro-
nomicon, lib. IV, IJ7), bildet ikonologisch eine Vorstufe zu der Schule von
A then, auf der die Gottin, Beschiitzerin der Wissenschaften, nun allerdings nur
noch metaphorisch als Statue erscheint.
Seite 477
Dem Planetengliiubigen wird der Weltwille ablesbar vom Himmel durch ener-
getische Eigenbewegung der Gestrne.
Seite477.
Das etymof,Qgisclt der ,guimpe" (im XIII. ]ahrhundert noch ,guimple", s.
Littre, Dictionnaire) verwandte mittelhochdeutsche ,wimpel" ( ahd. wimpal)
enthiilt noch nebeneinander die Bedeutungen Kopftuch, Banner (im Sinne von
Anhang
Fahnlein) und (s. Lexer, Mittelhochdeutsches Handworterbuch,
Leipzig I878, Bd. 3).
Seite 477
DerEintritt dieser antiquarisch-historischen Weltanschauung als energetischer
Wendepunkt.
Seite 478.
Im Ennnerungskult der Simonetta symbolisiert Venus die Wiederkehr im Kreis-
lauf: Persephone (s. Schluflzusatz Botticelli S. 326j.).
Aber:
Das chthonische Element wird atherisch, denn Botticellis Idealsphare durch-
weht das 7tVEUf.LCX Platons und Plotins.
Botticelli hat die Auffahrt von der Venere alia franzese bis zum Amore Divino
(Dante) in allen Stationen vollzogen. (Die ,Stationen" sind die Baldini-
Stiche I. und 2. Auflage - Geburt der Venus und Primavera - Zeichnungen
zur Gottlichen Komodie).
DBER PLANETENGOTTERBILDER IM NIEDER-
DEUTSCHEN KALENDER VON r5r9
Seite 483.
Erschienen in: Erster Bericht derGesellschajt der Biicherfreunde zu Hamburg, Igio.
Seite 485.
Fur den Merkur liiPt sick die antike Herkunft direkt nachweisen. Er geht
auf eine Zeichnung des Cyriacus von Ancona zuriick, hinter der der archaische
Typus des antiken Monuments deutlich sichtbar ist. V gl. F. Saxl, Rinascimento
dell' Antichita, in: Repert. f. Kunstwiss. LXIII, I922, S. 252j., Abb. 2I.
Seite 485.
Der verlorene ,.Archetypus Triumphantis Romae" der Sebald Schreyer und
Peter Danhauser bzw. Sebald Gallenstorfer kOnnte die Vermittlung der Ta-
rocchi na.ch Deutschland hergestellt haben. Das Buch sollte eine Chrestomathie
riimischer Dichter, Redner und Geschichtsschreiber werden, die Peter Danhauser
auf Veranlassung von Sebald Schreyer verfassen, Sebald Gallenstorfer mit Holz-
schnitten illustrieren sollte; vgl. Bernhard Hartmann, Konrad Celtis in Niirn-
berg (in: Mitteilungen des Vereins fur Geschichte der Stadt Niirnberg, 8. Heft,
I889, S. I8j., 2Jff. und 59ff.), wo die Vertriige zwischen Schreyer und Dan-
hauser abgedruckt sind. S.6Ij.: Rechnung iiber die Kosten des Archetypus: ,. ...
Item meister Sebolten, furmschneider, gegeben, das er das spit (Mantegna-
Kartenspiel ?) verreth hat, I guldin, mer fur ein mess eichen prennholz, und
davon zu haum und zu trag en 6 U 28 ~ , facit I fl. 6 l6 28 ~ ... "
tJber den Zusammenhang dieses geplanten Buches mit Italien vgl. Paul ] oachim-
sen, Geschichtsauffassung tmd Geschichtsschreibtmg in Deutschland unter dem
EinfluP des Humanismus, I. Teil, Leipzig Igio, S. I56f.
Ober Sebald Gallenstorfers angebliche Mitwirkung an der Schedelschen Welt-
chronik s. Thieme-Beeker XIII, S. II4.
Seite 485.
Zu Langenbecks Digesten s. G. Fumagalli, Dictionnaire geographique d'Italie,
pour servir a l'histoire de l'imprimerie dans ce pays, Florence I905, p. 296.
Ober Steffen Arndes s. E. Voullieme, Die deutschen Drucker des XV. ]ahr-
hunderts, Berlin I922, S. 95f.
Seite 485.
Die Kopien der Tarocchi sind nur teilweise von Durer selbst. Hieruber, sowie
uber das Verhiiltnis der Folge zu den Vorlagen und den Holzschnitten vgl.
Anhang
H. Tietze und E. Tietze-Conrat, Der funge Durer, Augsburg rg28, S. J06-JI2.
Abbildungen ebenda, S. I54f. ttnd 235.
Seite 486.
Ebenso an dem Junkernhaus in Gottingen.
Seite 486.
Die Planetenjolge von Burgkmair mu{J vor 1517 entstanden sein, weil Mars
in der ,Cronycke van Hollandt Zeelandt en Vrieslant", Leyden 1517 vorkommt
(jol. 88', II41J, I7S'). Auch andere Holzschnitte Burgkmairs sind benutzt,
so der ,Zorn" aus der Folge der jol. I251) und jol. r8s". Die Druck-
stocke sind nicht sinngemii{J eingesetzt, sondern erscheinen als ,Portriits" der
in der Chronik erwiihnten Persiinlichkeiten. Vber Burgkmairs Planeten s.
A. Burkhard, Hans Burgkmair d. A., Meister der Graphik XV, Berlin I932,
S.]6.
Seite 486.
Ausjuhrliche Beschreibung und Abbildungen des ,gemalten Hauses" zu Egge-n-
burg in Niederiisterreich in der Osterreichischett Kunsttopographie, Bd. V, Wien
I9II, Die Denkmale des politischen Bezirkes Horn in Niederiisterreich, I. Teil,
S. 57]]. Der Vers zum Saturn entspricht dem des niederdeutschen Kalenders.
Ober das Huneborstelsche Haus in Braunschweig s. P. ]. Meier und K. Stein-
acker, Die Bau- und Kunstdenkmiiler der Stadt Braunschweig, I926, S. 87j.,
Abb. ISI u. I52
Seite 486.
Die Planeten auf den Fassadenmalereien Burgkmairs am Augsburger Fugger-
hause scheinen angedeutet auf dem Stich des Raphael Custos; vgl. die Notiz
Sandrarts tiber die Hauser am Weinmarkt: Joachim von Sandrarts Academie
der Bau-, Bild- und Mahlerey-Kunste von r675 (2. Teil, J. Buck, IV. Capite!,
XXVI), hrsg. und kommentiert von A. R. Peltzer, Munchen r925, S. 76.
Stich des Jacob Custos, im Verlage des Raphael Custos, die Huldigung der Augs-
burger Biirgerschajt vor Gustav Adolf am 24. April r632 darstellend, abgebildet
bei Ad. Buff, Augsburg in der Renaissancezeit, Bamberg r893, S. 26127. Text
dazu S. JIJ.; ders., Augsburger Fassadenmalerei, in: Lutzows Zeitschrijt fur
bildende Kunst XXI (r886), S. S9ff. Abb. S. 6r; sowie ]ttlius Groeschel, Die
ersten Renaissancebauten in Deutschland, in: Repert. Kunstwiss. XI (r888)
S. 244j. Dazu die ungedruckte Berliner Dissertation ( r924) von Albert Heppner,
Deutsche Fassadenmalerei der Renaissance, wo die Fresken des Fuggerhauses
]iirg Breu zugeschrieben UtJd mit dessen Federzeichnung in Berlin, Kupjer-
stichkabinett, in Verbindung gebracht werden. Die Zeichnung ist eine Kopie
tlach Baldinis M erkurblatt, vgl. E. Bock: Die deutschen Meister ( Staatl.
Museen zu Berlin, Die Zeichnungen alter Meister im Kupjerstichkab.J, Berlin
I92I, I, S. r6, Nr. 4326 und (Saturn) 4327.
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
HEIDNISCH-ANTIKE WEISSAGUNG IN WORT UND
BILD ZU LUTHERS ZEITEN
Seite 487.
Ersckienen in: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissensckaften,
Pkilos.-kist. Klasse, J ahrgang I920, 26. Abhandlung, Heidelberg r920.
Seite 497
Statt: wahrend Melanchthon die antike Astrologie als intellektuelle SchutzmaB-
nahme handhabte und von seinem Sternglauben so erfiillt war ... , soll es heifJen:
... die antike Astrologie als Einblicksmoglichkeit in das Walten des kosmisch
gesetzmaBig bedingten Fatums handhabte und von seinem im Grunde auf-
klarerischen (rationalistischen) Sternglauben so erfiillt war ...
Seite 499
Statt verdrangen: unterdriicken.
Seite 499
Der bei Enders und bei de Wette (IV, p. 34I) als unleserlich bezeichnete Satz heiPt
(nach Lesung von Dr. Elsbeth ]afje): Sed plus sum viti Astrologo et ominoso
M atkematico quem toties falsum convici, convincam adhuc saepius falsum.
Der ganze Passus des Briefes bezieht sich auf Luthers schlecktes korperliches
Befinden, das ikm Todesgedanken nahelegt. Der letzte Satz ware also mit Bezug
auf die Gauricus-Nativitat, die ihm einen frilhen Tod geweissagt hatte (vgl. auch
Cochlaeus' A usspruch 5. sr6). etwa so ZU verstehen: ich bin aber dock mehr als
der schlechte Astrologe mir zutraut, ... den ich noch ofter Dugen strafen werde.
Seite 503.
Statt: auch der Text: auch der tendenziose Text.
Statt: - 1483 anstatt 1484 - abgeandert: I484 auf 1483 abandernd.
Statt: in der gelaufigen: in der bisher gelaufigen N ativitat.
Seite 503.
Das Sckicksal der Luther-Nativitiit des Gauricus schildern im r8.] ahrh. Friedrich
Sigemund Keil, Das Leben Hannss Luthers und seiner Ehefrauen Marga-
rethen Lindemannin, Leipzig 1752 und Laurence Sterne, The Life and Opinions
of Tristram Shandy Gentleman, Book IV, Slawkenbergius's Tale.
Keil, 5. 49f.: 69. Es hat die Mutter dieses herrlichen Kindes das Jahr seiner Ge-
burt nicht gewust. Melanch thon hat sie deswegen unterschiedlichemaigefragt,
zu welcher Zeit ihr Sohn gebohren, darauf sie zur Antwort gegeben, den Tag
und die Stunde wisse sie gewiB, wegen des Jahres aber ware sie un-
gewiB. Doch sagte sie ihm, daB er am 10. November zur Nacht urn II Uhr
gebohren, und hatte dem Kinde den Namen Martin gegeben, weil der folgende
Tag Martini gewesen, an welchem das Kind getauft worden. Ob sie nun wol
das Jahr der Geburt nicht eigentlich gewust, so hat man doch hiervon genaue
Na<;:hricht, daB es das Jahr 1483 gewesen. Denn es hat Lutherus mit eigner
Anhang
Hand aufgezeichnet, daB er An. 1483, den 10. November Abends urn 12 Uhr
gebohren, und dabey eigenhandig die Constellation des Himmels beschrieben
wie der Horoscopus IS. ~ s. in decima 28. Y Ig. locus Solis 28. l11. 6. Jovis
26. nv 24.
70. Hiervon giebt Nachricht D. Christoph Daniel Schreiter, weyland
Stifts-Superintendens zu Wurtzen in Disputatione : De discursu Astrologico,
welche er als ein Student unter dem Praesidia M. Christoph Notnagels, Prof.
Matthes. zu Wittenberg am 12. April An. 165I gehalten. Seine eigenen Worte
sind: Lutherus propria manu figuram coelestem descriptam reliquit ad
diem IO. Nov. horam XII. noctis, anni 1483. cujus picturae ocu-r6rpocql0v
Dominus, Christianus Gueinzius, olim Gymnasii Halensis Rector, in sua
Bibliotheca sancte asservabat, qui mihi, cuius fidei ac informationi concre-
ditus eram, ex singulari benevolentia, qua me semper prosequebatur, non
tantum copiam videndi, sed & describendi concede bat: Horoscopus erat
IS. ~ 5 in decima 28. y Ig. locus Solis 28. l11. 6. Jovis 26. nv 24. Der Autor
disputiret in derselben wider Cardanum, welcher Lutheri Geburtstag auf den
22. Oct. Abends urn 10 Uhr 1483 gesetzet, und aus der Constellation be-
weisen wollen, daB Lutherus zu einen Ketzer und Bosewicht geboh-
ren worden (In libro de Gent. Genituris, Genit. XI). Da nun Lucas Gauri-
cus (Part. IV. Tract. Astrologici, p. 69) den Geburtstag Lutheri auf den 22. Oct.
1484 urn I Uhr nach Mitternacht gesetzet: So hat auch Pelletier (In Tract.
de area Noae p. 443) sehr wohl die Absurditaet der pabstlichen Astrolo-
gorum bemercket, die aus der falschgesetzten Zeit seiner Geburt schlieBen
wollen, er miisse ein Ketzer seyn, und Unruhe in der Kirche atuichten (Un-
schuldige Nachrichten I702, p. S78), und werden auch billig von Petro Gassendo
(Tom. I. Philosoph. Epist. p. so5. b) und de Ia Mothe (Vayer. Tom. I. Opp. 263)
verlachet. Wir setzen diesen pabstlichen Theologis billig Isaaci Malleoli,
Prof. Matthes. zu StraBburg Disputation, de Genitura Lutheri An. 1617.
entgegen, in welcher er Lutheri Constitution des Leibes und Gemi.iths, herr-
lichen Verstand, Gottesfurcht, Religionseyfer, sanften und natiirlichen Tod
aus astrologischen Principiis gezeiget.
Sterne gibt, obwohl er sich unter uortlicher Zitierung des Gauricus-Textes von
I552 (s. S. 499) auf diesen beruft, als Datum der papistischen Nativitiit den
22. Oktober r483 an, als lutherisches den ro. November I484, irrt sich also
wieder in bezug auf das ] ahr. Er iindert auch die Stellung der Planeten, ob-
wohl ihm die Kon1'unkton im 9 Haus (der Religion) aus dem Gauricus-Text
bekannt sein mu/]te, so ab (Luna im I2. Haus, jupiter, J1ars und Venus
im ]., Sol, Saturn und Mars im 4.), dafJ sie mit keinem der uns bekannten
Horoskope zur Obereinstimmung ztt bringen ist.
Seite 504.
Ober mythische Geburtstage im Altertum, bei denen die Trager als Schutzbe-
fohlene des Gottes erscheinen sollen, auf dessen Fest der angebliche Geburtstag
fiillt, s. Wilhelm Schmidt, Geburtstag im Altertum, in: Religionsgeschichtl.
Versuche und Vorarbeiten VII, I, Gie/]cn I9o8, S. 42ff. Friedrich Pfister betont
in seiner Rezension dieses Buches (Deutsche Literaturzeitung I909, sp. I486
bis I489), da/1 bei der kalendarischen Festsetzung der Heroengeburtstage dem
Kult die Prioritiit vor der Geburtslegende zukomme.
Heidnisch-antike Weissagung itl Wort und Bild zu Luthers Zeiten
Seite 504.
Anstatt Januskopfigkeit: Doppelwesen.
Seite 507.
Zu dem turmiihnlichen Gefiifl auf dem Tisch der Dezemberabbildung des Chrono-
graphen vgl. den Artikel ,Fritillu,s" in: Daremberg-Saglio, Dictionnaire des
Antiquites Grecques et Romaines, T. II, 2, Paris I896, p. IJ4ISq. Die Wurfel
wurden in die obere Offnung des Beckers (pyrgus oder tttrricula) hineingeworfen
und fielen von selbst durch das untere Stufenloch auf den W iirfeltisch. V gl. auch:
Die Calenderbilder des Chronographen vom Jahre 354, hrsg. von ]. Strzygowski,
Berlin r888, S. I2 u. So.
Seite 508.
Der letzte Satz des Absatzes solllauten:
In Luthers spottischer Bemerkung vom Jahre I532 tragt sich der Saturn in
anscheinend naiver volkstiimlich-mythischer Greifbarkeit vor, wahrend doch
in Wirklichkeit ein Symbol von urspriinglich kosmologisch ordnender Kraft
aus dem Erbgut hellenistischer abstrakter Systematik, als Spielmarke ver-
schleppt, in der superstitiosen Mechanik der Horoskopsteller iiberlebt.
Seite 509.
Das Monstrum als Gegenstand naturwissenschaftlicher Controverse in der
Offentlichkeit wird nur moglich durch das gedruckte Flugblatt.
Seite 509.
Die Genesis des Titelblattes vom ,Baseler Hinckenden Both". Es ist auf-
fiillig, da{J fene Figttr des Bauern mit Stelzbein und Lanze als ,hinkender Bote"
gerade in den politischen Kalendern vom Ende des XVI. ]ahrhunderts {ISQO)
aujtritt, die eine Zwischenform zwischen astrologischem Kalender und politischem
Nachrichtendienst bilden. Im Gegensatz ztt dem ,Postreutter", der die Ereig-
nisse des ft'ingstvergangenen ] ahres berichtet, erziihlt der ,Hinckende Both"
von denen des vorhergehenden ] ahres. Gegeniiber den Flugbliittern der Refor-
mationszeit, in denen die wahrsagende Astrologie in den Dienst der Tages-
politik gestel/.t wurde, iiberwiegt das politische Interesse in dies en ] ahresbliittern
das astrologische; die Prophezeiung ist gleichsam riickwiirtsgewandt; die Ver-
wandtschajt dieser Kalender mit den astrologischen lii/lt immerhin ein Nachleben
des Saturnbildes als nicht unmoglich erscheinen. V gl. R. E. Prutz, Geschichte
des deutschen ]ournalismus, I, Hannover I845, S. I79ff.
Seite 510.
Die polare Funktion der realistischen Allegorie.
Seite 510.
Ober diese Flucht und tiber Joachim und Carion vgl. Wilh. Schafer, Der andere
Noah, Neue Zurcher Zeitung, Nr. I293 von Sonntag, 23. September 1923.
Seite 5n.
Im Mitteljeld: Perseus mit der Fama, die aus dem Blut der Medusa entsteht,
Quintessenz der Virtus; der triumphierende Oberwinder als Patron weltlicher
6so
Anhang
Energie; die Metamorphose des ewigen Griechen. Der verzauberte Perseus,
aus dem Ringstein entfesselt (Ober Perseus als Unheilabwender auf Steinen
s. Roscher, Mythol. Lexikon, Ill, 2, Sp. 2027j.).
Durck die von Warburg eingeleitete, kiirzlich rekttfizierte astronom-ische Berech-
nung la/lt sick aus der Planetenstellung der Decke Agostino Chigis Geburtstag
auf Anfang Dezember 1466 festlegen. Hieriiber, sowie iiber die astrologische
und mythologische Bedeutung der Deckenfresken und ikre Stellung innerhalb der
Bilddarstellungen des gestirnten Himmels erscheint binnen kurzem eine Unter-
suchung von F. Saxl, La Fede Astrologica di Agostino Chigi, Publikation der
R. Accademia d'Italia, Rom I933
Seite 5n.
Zum Horoskop des Chigi s. G. Cugnoni, Agostino Chigi il Magn.iftco, in: Ar-
chivio della Societa Romana di Storia Patria, vol. II (r878) p. 82 und Vol. IV
(r88r) p. 2I5sq.
Seite 5n.
Statt: die ihnen ... zur Seite gestellt sind: die, einen jeden bei der Hand fas-
send, sie unter die Oberleitung Gottvaters stellen, der aus der Mitte herab-
schaut; die heidnisch-christliche Sparenharmonie ist da.
Seite 512.
W. Kohler (Basler Nachrichten, 1922, Sonntagsblatt Nr. 42) verweist auf
Luthers Epistel-Predigt von 1522 (am anderen Sonntag des Advents, Lucae 2I,
25-33); Dr. M. L.'s sammtliche Werke, Erlanger Ausgabe X, Frankfurt a.M.
r868
2
, S. 53ff.: ,Ein Christlicbe vnn vast wolgegrundete beweysung von dem
Jiingsten Tag Vnnd von seinen zeichen, das er auch nit ferr mer sein mag."
Luther bringt die Naturereignisse und Himmelspkanomene seiner Zeit in Zu-
sammenhang mit den Prophezeiungen der Schrift uber den I ungsten Tag und
deutet sie, unter V erwerfung der aristotelischen naturlichen Erklarung, als die
,Zeichen", von denen die A pastel gesprochen haben: die Verfinsterung der Sonne
und des Mondes sei schon eingetreten, der Fall der Sterne bedeute die Kometen,
und die Bewegtmg des himmlisclten Heeres entspreche der gro{Jen Planetenkon-
funktion.
S. 65: ,So haben wir auch (daneben) so vielCometengesehen, und (neulich) sind
viet Kreuz vom Himmel gefallen ( und ist mit unter auck aufkommen die neue, uner-
hOrete Krankheit, die Franzosen). A uclt wie viel Zeichen und Wunder sind et-
liche Iahr daher im Himmel ersehen, als Sonnen, Mond, Sternen, Regenbogen,
und viel ander seltzame Bilde. Lieber, lafJ es Zeichen sein, und grofJe Zeichen,
die etwas Gro{Jes bedeuten, welche auch die Stermneister und Frau Hulde nicht
mag sagen, da/1 sie aus naturlichem Lauf sind kommen, d e m ~ sie haben zuvor
nichts davon erkannt noch geweissaget.
So wird auch kein Sternkiindiger thiiren sagen, dafJ des Himmels Lauf habe ver-
kiindiget das schrecklich Thier, das die Tiber zu Rom todt auswarf vor kurzen
I ahren, welchs hatte einen Eselskopf, eine Frauenbrust und Bauch, einen Ele-
phantenfu/3 an der rechten Hand, und Fischschuppen an den Beinen, und ein
Drachenkopf am Hintersten etc. Darin das Papstt-hwm bedeutet ist, der gro{Je
Zorn Gottes und Strafe. Satcher Haufen Zeichen will etwas Gro{Jers bringen,
denn alle Vernunft denket."
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten 6sr
Ober die Konjunktion von I524 sagt er (S. 69):
,Was aber die Bewegung des himntelischen Heers sei, wei(J ich noch nicht, es ware
denn die gro(Jen Constellation der Planeten (die itzt eintreten wird uber zwei
J ahr). Dmn die Planeten sind gewi(Jlich von der Himmel Kriiften und Heer
wahl das furnehmest, und ihre wiinderliche Versammlung ist ein ( gro(J) gewi(J
Zeichen uber die Welt. Nu spricht Christus nicht, da(J alles Heer oder Kriifte der
Himmel sich bewegen werden, sondern etliche (Schaaren). Denn nicht alle Sterne
werden sick bewegen, gleichwie droben gesagt ist, nicht alle M enschen Gedriing
und Furcht leiden, nicht alle Wasser allezeit brausen und rauschen, Sonne und
M ond nickt alle Tag finster werden; denn es sollen nur Zeichen sein, die mussen
nur in etlichen und im wenigern Theil geschehen, da(J sie etwas sonderlichs
Ansehens gewinnen gegen das ander Theil, das nicht Zeichen sein wird. Darumb
ich darauf stehe, da(J des himmelischen Heers Bewegung seien (gewi(Jlich die
zukunftige) Constellation der Planeten ( dariiber die Sternmeister sag en, es solle
eine Sindfluth bedeuten; Gott gebe, da(J der jungste Tag sei, wilchen sie gewi(Jlick
bedeutet).
Und hie solltu aber dick nicht irren lassen, da(J diese Constellation sick aus des
Himntels Lauft natiirlich begibt. Es ist dennoch ein Zeichen von Christo genennet.
Und es ist fast wokl sein wakrzunehmen, weil es nicht allein, sondern gleich mit
dem Haufen der andern Zeichen sick sammlet, und zu gleicker Zeit mit eintrifft.
La(J die Ungliiubigen zweifeln und verachten Gottes Zeichen, und sagen, es sei
natiirlich Geschaft; halt du dick des Evangelii .
. . . Lieber, la(J es Zeichen sein, und gro(Je Zeichen, die etwas Gro(Jes bedeuten;
aber sie sind schon vergessen und veracht."
Im zweiten Teil der Predigt gibt er eine geistliche Ausdeutung derselben Zeichen
(S. 8r), nach der unter der Sonne Christus, unter dem Mond die Kirche, unter
den Sternen die Christen und unter den Kriiftcn des Himmels ,die Priilatm oder
Planeten in der Kirchen" verstanden werden sollen.
S. 83: ,Die Kriifte der Himmel sind unser Planeten, unsere geistliche ]unkern
und Tyrannen, Papst, Bischof und ihre Gesellen, die hoken Schulen, die so tief in
das weltliche Regintent, Gut, Ehre und Lust gesessen sind mit aller Sicherheit, da(J
sie gemeinet, sie wiiren nicht Planeten, das ist Errones; dmn Planeta auf Grie-
chisch hei(Jt Irriger, der kein rechten Weg gehet, sondern nur hinter sick und zu
beiden Seiten, wie die Planeten am Himmel auch thun. Das legen die Deutschen
aus mit einem Sprichwort, und sagen: Die Gelehrten, die Verkehrten; das ist,
das geistliche Regiment ist eitel Planeten. Nu aber das Evangelium anbricht, und
zeigt ihnen {ln ihre Tugend, und farbet sie mit ihrer eigen F arbe, da(J es ungelehrte
Gotzen und Seelverfiihrer sind, wollen sie zornig werden, bewegen sick, und
machen eine Constellation, treten zusamnten, wollens mit Bullen und Papier
schUtzen, drauen ein gro(Je Sindfluth; aber es will und wird sie nichts helfen,
der Tag bricht an, den wird man nicht unter den Scheffel stiirzen, als ware es
ein Wachslicht" (vgl. auch S. 523).
Seite 514.
Mars und Saturnus aus dem Holzschnitt in Paulus von Middelburgs Prognostica
( Abb. I34) sind ohne Beziehung auf die Texte wiederverwendet zu Holzschnitten
in vierBiichern, die ohtte Angabe des ]ahres um die Wende des XV. zum
XVI. ]ahrhundert zu Zwolle in der Offizin des Peter van Os gedruckt worden
sind:
Warburg, Gesammelte Schriften. Bd.z
Anhang
I. Bartholomei Coloniensis Canones (Campbell, Annales de la Typographic
Neerlandaise, Ier supplement, Hague I878, No. 2soa; nach dem Gesamt-
katalog der Wiegendrucke III, Leipzig I928, Sp. 433 wegen des Wappens
Julius' II. als Druckermarke nicht vor I503; Hain-Copinger 2496; Proctor 9I53)
2. Sallustius, Bellum Catilinarium (Campbell, Annates, Hague r874. No. r5o2;
Hain-Copinger 5224).
3. Sallustius, De bello JugurtJtae tiber (Campbell, a. a. 0., No. I503; Hain-
Copinger 5227).
4 Ovidii Fasti nach William Martin Conway, The Woodcutters of the Nether-
lands in the Fifteenth Century, Cambridge r884, p. 272 um I5II).
Der Holzschnitt ist abgebildet bei M. J. Schretlen, Dutch and Flemish Wood-
cuts, London I92S, Pl. 6sB; besprochen bei Conway, l. c. p. ro9sq.
Seite SIS.
Ob diese umgekehrte Vater- und Sohn-Konstellation nicht direkt antichrist-
lich ist: der Sohn als Feind des Vaters, den er opfert?
Seite SIS.
Der Stier im der sick auch in den fruheren Ausgaben
(Modena I490, Mainz I492) findet, ist durch den Text nicht gerechtfertigt.
Oberhaupt ist er durch astrologische Grunde nicht zu erkliiren. Moglicherweise ist
das Dezemberblatt der deutschen Kalender ( Augsburg, Blaubirer I48I, Augs-
burg, Biimler I483, Augsburg Schiinsperger I490, Abb. r8o), in dem die Monats-
beschiijtigung, das Schlachten, dargestellt ist, als Vorbild anzunehmen (F-.inweis
von Dr. Edgar Breitenbach). (Die fruhen Lichtenberger-Illustrationen zeigen den
Stier nock nicht mit zusammengeknickten Vorderbeinen.) Aus welchen inhalt-
lichen Motiven diese ,Entleknung" erfolgte, ob vieUeicht das Erscheinen des
Stieres nur aus dieser Bildvorlage zu erklaren ist, bleibt noch fraglick. Das Ka-
lenderblatt entsprack offenbar dem volkstumlicken Charakter der Licktenberger-
Illustration. Auch eine mythologische Darstellung wie die des Herkules mit dem
Stier (Ovids Metamorpkosen, Venedig I497 Holzschnitt fol. 76') kiinnte als
Bildtypus eingewirkt haben. Diese A nnahme setzt allerdings die Verbindung des
fuppiter mit dem Stier bereits voraus.
Seite S2I.
Ein pseudo-joackimitiscker Papstkatalog (Cod. Vind. 4r2) ist ausfuhrlich be-
schrieben bei H. f. Hermann, Beschreibendes Verzeicknis der illum. Handschr.
in Osterreich. VIII. Band, VI. Teil: Die Handschriften und Inkunabeln der
italieniscken Renaissance [Nationalbibliotkek, Wien], I, Leipzig I9JO,S. I6Sff.,
Nr. IJ2. Es ist eine oberitalieniscke, vermutlich bolognesische Handsckrijt des
XV. J ahrhunderts. Der Papst mit Sichel und Rose befindet sick auf fol. 44.
das Blatt mit den drei Saulen fol. 43
Seite S2I.
Die (bei Hans Sachs auf Luther gedeutete) Figur mit Sichel und Rose mag
sehr wohl einen Saturntypus reprasentieren, da nach Bernard us Silvestris Saturn
Herr der Sichel und Schnitter der Rosen ist: De mundi universitate, ed. C. S.
Barach und f. Wrobel, Innsbruck r876, p. 42: ,Crudus adhuc nee citra vires
emeritus insumpto falcis acumine, quicquid pulcrum, quicquid florigerum, deme-
wutflm "imb mit b:cattn-
mm icb mein l)lu6 wol mutrn
Qtlfo bit ble feat ein
cf?ot ""e in fein repel)
Abb. 180. Dczember-Biltl, KalcndLr.
Augsburg- (Schonsperger) 14yo
(zu Seite 65z).
eme ...... Alrlh r wMfu
1/.ernrr.t ... WP"IIrl_.
c,,_...ul.,...,.,.lotlo .. ll.,..n
Tafel XCVI
f.tu&d(vt<,.,.ti,U<rt."-rl!'f
.. ;; ...
...
.. ,
Abb. 181. Luther als Herkulcs Gennanicus,
Flug-blatt von Hans Holbein d. J. (zu Seite 653).
Heidnisch-antike Weissa11ung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
tebat. Rosas et lilia et cetera, et olerum genera sicut nasci non sustinet, non
sustinet et florere."
Ober die Rose als Symbol des Aion: H. Junker, Uber iranische Quellen der
hellenistischen Aion-Vorstellung, in: Vortrage der Bibl. Warburg, 1921122,
Leipzig 1923, S. 153.
Seite 522.
Ober ,Luthers Kampfbilder" vgl. jetzt Hartmann Grisar S. f. und Franz Heege
5. f., Heft I-IV. Freiburg i. B. I92I-I92J; Heft III {I923), Kap. I speziell
uber Papstese.l und Miinchskalb. Ein Kampjbild, das sich satirisch sowohl gegen
Luther selbst wie gegen Luthers Gegner richtet, ist der (Holbein zugeschriebene)
Holzschnitt ,Hercules Germanicus" ( Abb. z8I), als dessen Urheber Erasmus
gilt. Vgl. Daniel Burckhardt-Werthemann, Drei wiedergefundene Werke aus
Holbeins fruher Baslerzeit, und Theophil Burckhardt-Biedermann, Uber Zeit
und Anlafl des Flugblattes: Luther als Hercules Germanicus; beide Aufsiitze
in: Basler Zeitschrift fur Geschichte und Altertum, IV, I, S. JJff. und 38jj.
Seite 524.
Eine Auf/erung Durers uber die meteorologischen W underzeichen genau in der
Form, wie sie bei Mennel und Grunpeck dargestellt sind, jind-et sich in Durers
schriftl. Nachlafl, hrsg. von K. Lange und F. Fuhse, Halle 1893, S. 14:
Das groBt Wunderwerk, das ich all mein Tag gesehen hab, ist geschehen im
1503 Johr, als auf viel Leut Kreuz gefallen sind, sunderlich mehr auf die
Kind denn ander Leut. Unter den allen hab ich eins gesehen in der Gestalt,
wie ichs hernoch gemacht hab. Und es was gefallen aufs Eyrers Magd, der ins
Pirkamers Hinterhaus saB, ins Hemd, in leinenes Tuch. Und sie was so betriibt
drum, daB sie weinet und sehr klagte. Dann sie forcht, sie miiBt dorum sterben.
Auch hab ich ein Komet am Himmel gesehen.
Seite 525.
,M ythologische V erursachung" in der Gegenwart: Erdbeben an der albanischen
Grenze (Hamburger Fremdenblatt vom 29. April 1928); Aberglaube und
Weltuntergang.
,In einem Dorf in der Nahe von Monastir ist dieser Tage ein Kalb mit zwei
Kopfen zur Welt gekommen. Zehntausende von Landbewohnern aus der
ganzen Umgebung wandern nach dem Dorfe, urn das Tier, das von seinem
Besitzer wie ein Wunder ausgestellt wird, zu sehen, weil die aberglaubische
Bevolkerung in der Geburt eines zweikopfigen Kalbes das Vorzeichen neuer
Erdbeben und des Weltunterganges erblickt."
I927 hat der Weltspiegel vom rs. Mai ein der Sau von Landser iihnliches Mon-
strum aus Siidbulgarien unter der Oberschrift ,Ein N aturwunder" abgebildet.
Seite 530.
Dieselbe Umwandlung des saturninischen Menschen, der zu muhseliger Erdarbeit
vorbestimmt ist, zum freien SchOPfer eines dem Neptun abgerungenen Erdreichs
im Faust, II. Teil, 5 Akt: ,Wie das Geklirr der Spaten mich ergetzt."
Seite 539 (s. auch S. 514 und S. 518
2
}.
Zu dem (ca. I 4 7 2 ~ 5 verfaflten) Gedicht des Bonincontri existiert ein Kom-
mentar des Dichters selbst, ca. r4fJ4-I487 geschrieben (Cod. Vat. lat. 2845, s.
42*
An hang
B. Soldati, La Poesia astrologica nel Quattrocento, Firenze rgo6, p. I4I und ISS).
Z u den von M elanchthon ( s. o. S. 540) zitierten V ersen hei {Jt es dort: Haec (con-
iunctio), meo iuditio, erit anno salutis I504, quae indicat prophetae adventum vel
alicuius sanctissimi viri, qui in melius reformabit religiosorum mores et vitam,
quae est nostro tempore omnibus bonis viris contemptui, ne dicam odiosa, propter
ipsorum fastus et turpitudinem. Soldati, l. c. p. rg6). Da es sick im Text des
Gedichtes um die Konjunktion von ]uppiter und Saturn handelt, spielt Me-
lanchthon, indem er dese Verse zitiert, zweifellos auf die Luther-Nativitiit an,
wenn auch Bonincontri selbst in dem Kommentar das Datum verschiebt, wie fa
auch Paulus v. Middelburg die Geltungsdauer der grof3en Konfunktion auf
20 ] ahre ausgedehnt hatte.
Die Erregung (S. 5I4), die das Kommen dieser gro{Jen Konjunktion in Italien
hervorgerufen hat, lii{Jt sich auch im Dante-Kommentar des Cristofaro Lan-
dino nachweisen, der die Vorhersage des , Veltro" bei Dante (Inf. I, ros) auf
den 25. November I484 datiert und auch auf eine religiose Reformation deutet: .. .
Io credo eke 'l Poeta, come ottimo mathematico, havesse veduto per astrologia, eke
per l'avenire havessero a essere certe revolution de Cieli, per la ben-ign-ita delle
quali habbi al tutto a cessar l'avaritia. Sara dunque il veltro tal influenza, la
quale nascera tra Cielo et Cielo, o veramente quel Principe, il quale da tal
influenza sara prodotto. Onde dira disotto ch'io veggio certamente, et pero il
narro. Et certo nell' anno r484 nel dz vigesimo quinto di Novembre, et a hore
tredici, et minuti 4I di tal dz sara la coniuntione di Saturno et di Giove, nel
scorpione, ne l' ascendente del quinto grado de la libra, la qual dimostra muta-
tion di religione. Et percM Giove prevale a Saturno, significa che tal muta-
tione sara itt meglio. La onde non potendo esser religione alcuna piu vera
eke la nostra, havro adunque ferma speranza eke la Republica christiana si
ridurra a ottima vita et governo; in modo che potremo veramente dire: I am
redit et virgo, redeunt saturnia regna. (Dante, con l'espositione di Cristofaro
Landino et di Alessandro Vellutello ... Venetia r564, fol. ;vsq.; vgl. Fr. v.
Bezold, Astrologiscke Geschichtskonstruktion im Mittelalter, in: Aus Mittelatter
und Renaissance, rgr8, S. rgr und 4IO, Anm. 379)
Landino bezieht sich also bereits in dem r48r erschienenen Kommentar auf
dasselbe Datum, das auch Lichtenberger (Erstausgabe gegen r488 bei Heinr.
Knoblochtzer in Heidelberg) bzw. Paulus von Middelburg (I484) angeben, s.
S. sr8, Anm. 2; uber die grofle Verbreitung der Lichtenbergerschen Weissagung
in Italien von I492 an s. Domenico Fava, La Fortuna del Pronostico di Gio-
vanni Lichtenberger ... , in: Gutenberg-]ahrbuch V, Mainz I9JO, S. I26ff.J.
Seite 540.
Eine sehr wichtige Stelle zu Lutkers ilu{Jerungen Uber die Astrologie ist die
Predigt iiber die zehn Gebote (I5I8), in der er sich gegen das ,necessitant"
der Sterne wendel. Luthers Werke Weimarer Ausgabe I, S. 404. Nachweis von
F. Blanke.
Decem Praecepta Wittenbergensi predicata populo per P. Martinum Luther
A ugustinianum.
Praeceptum Primum. Non Habebis deos alienos.
(W. A. I, S. 398ff.)
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
s. 404f.
Nono. Sequitur lauta illa Astrologia seu Mathematica, quae valde cupit esse
scientia, sed non potest stulticiam ingenitam exuere. Haec est quae nos docet,
Quis, qualis quantusve sit juturus, Quisquis natus juerit in horoscopis signa-
rum: Consiliarii scilicet divini secreti nee angelis noti. Unum ego miror, quid-
nam illis acciderit, ut non invenerint stellam quae portendat, quis iustus, quis
peccator sit nasciturus. Quandoquidem suos horoscopos maxime in hominibus
valere volunt, tum non est res tam parvi momenti iusticia, peccatum, veritas,
mendacium, sed nee tam rara quam sit Balneator, Cantator, Trapezita, pi-
scator, orator, amator, qui suos habent horoscopos. Cur ergo nullum ibi
iusticiae et veritatis signum? Aut si est, Cur nunquam sortitur ejjectum? Si-
quidem omnis homo nascitur peccator, mendax, insipiens, licet nulla stella
ad hoc jatum sit conficta, nee mutatur, nisi supercoelesti gratia visitetur. Aut
est coelum adeo infestum et incuriosum iusticiae et veritatis, ut vilissima bal-
nea influat et ludos et veneres, Iusticiam autem omnino ttesciat? Aut tam in-
vidus creator, Qui nullum signum boni, sed tantummodo mali constituit? quippe
cum nullus homo nascatur bonus sitque natura sua cum influentiis perse-
veraturus malus, hos ego inter subtiles fatuos numerassem, nisi rudibus essent
rudiores.
Sed pulcherrime solvunt obiecta, dicentes ,Influentiae non necessitant, sed in-
clinant ad peccatum" &c. quasi non sit idipsum impiissimum sentire, quod
deus foecerit creaturam ad inclinationem peccati et non potius ad erectionem
iusticiae, ut omnia cooperentur in bonum, non in malum, hominibus, Aut quasi
ullus hominum necessitate pulsus peccet, et non potius semper inclinatione.
Quis invitum dicet peccare? Omnis mala inclinatio non extra nos, sed in nobis
est, Sicut ait Christus: De corde exeunt cogitationes malae, Non quod intrat in Matth. I5,I9.
hominem &c. Et B. Jacob.: Unusquisque tentatur a concupiscentia sua abstrac- II.
tus et illectus, quae non jato sed origine peccati venit. Omnia enim, quae foecit fac. I, I4
deus, bona sunt: ideo ex natura sua non possunt nisi ad bonum inclinare. Quale I. Mos. I, JI
est unumquodque, tale et operatur. Quod autem ad malum serviunt, non est
natura, sed iniuria eorum, sicut Pauhts ait: Omnis creatura subiecta est vani- Rom. 8, :1o.
tati non volens. Illi autem naturam eorum faciunt vanitatem, Volentes ex insti-
tutione dei illa habere, ut ad peccandum inclinent. Cur ergo Adam et Hevam
ante serpentem non inclinaverunt? Cur non Christum? Cur non Virginem?
pereat ea blasphemans impietas. Vox ilia Vox patris Adam es;, qui et ipse suam
inclinationem ad mulierem transtulit, id est, creaturam dei, dicens: Mulier, I J1os. 3. I2.
quam mihi dedisti &c. Verum quam egregie mihi obstarent, si ullum sanctorum
vel martyrem his usum esse aut scripsisse aut approbasse possent ostendere.
Nunc autem non modo non approbaverunt, sed etiam reprobaverunt, presertim
B. Augustinus in multis locis, tum B. Gregoritts, Et tamen invenit ista lan-
guidula insipientia languidiores qui credant.
'A braham, inquiunt, docuit A egyptios astrologiam, ut testis est I oseppus',
quasi Ioseppus nusquam excesserit verum, praesertim tam anhelus iudaicae
gloriae appetitor. Abraham sine dubio, docuit Aegyptios deum colere et veram
dei sapientiam, Sicut et de Joseph dicitur, ps. ciiii. Ut erudiret principes eius Ps. zos, 22.
et senes eius prudmtiam doceret. Non est credendum sanctos illos viros nee astro-
nomiae, multomin.us astrologiae operam dedisse, quae iuventutis sunt studia
ociosa. Sed Ioseppus videns, huius scientiae opinionem apud Graecos extolli
et in gloria esse, Jingere visus est voluisse, quomodo etiam in hac re ludaei Graecis
Anhang
non impares sed superiores essent, quod in omnibus aliis quoque facere conatus
fuit, quae ad vanam gloriam pertinent.
Deinde mirum est, daemones non ftt-isse aliquando mutatos, qui tot saeculorum
influentiis subiecti, tum propiores quam nos, utpote in aere habitantes, sunt.
Non autem venisse stellarum influentias super eos aut easdem stellas eadem
modo eis fulsisse absurdum videtur. M anent enim obstinati in sua perversitate
nee ullo signa mutantur, cum nostrae animae brevissimo momenta influentiarum
mutari dicantur.
5 Mos. 4, 9 Ultimo. Quid ad Mosen dicemus Deut: iiii. Ne forte elevatis oculis ad caelum
videas salem et lunam et omnia astra caeli, quae creavit dominus deus tuus in
ministerium cunctis gentibus &c. Si in ministerium, quomodo in dominium?
At subtiliter evadunt dicentes authoritate sui M agistri Ptolomei 'Sapiens do-
minatur astris, ideo praevenire et impedire potest influentias stellarum'. Ergo
non sunt in dominium sapientibus, sed insipientibus tantum? Quid autem Mo-
ses? Cunctis, inquit, gentibus in ministerium. Si cunctis, ergo vel cunctae
gentes sunt sapientes et ita dominantur astris omnes, vel aliquae tantummodo
sunt sapientes et jiet, ut non cunctis gentibus sint creata in ministerizm, Vel
Moses verax et tu mendax, Ut omittam, quod, si etiam vere sapiens esset dominus
astrorum, nihilominus falsum dixisset Moses, utpote quod astra non ministrent
sapientibus etiam, sed magis impediunt, ita ut, nisi iUi sapientia praestarent,
non possint eorum jata vitare. Non ergo in ministerium, sed in bellum sapientibus
et in dominium atqzu tyrannidem insipientibus dicendae fuissent steUae creatae.
Quod est et M osen mendacii arguere et deum crudelitatis accusare, omninoque
blasphemare. Sed haec alii latius tractarunt. Sat sit indicasse vanitatem kane
fer. Io, 2. prohibitam. Hiere: x. Juxta vias gentium nolite dicere et a signis caeli nolite
RIJm. 8, 28. metuere. Salus enim deus timendus est in omnibus. Caetera omnia ut ministeria
in bonum electis cooperantia esse debemus intelligere.
Warburg beabsichtigte, einer Neu-Auflage des Luther eine genaue Analyse
dieser Predigt einzuarbeiten. Prof. Blanke-Zurich wird sie im Zusammenhang
mit Warburgs Feststellungen im ]ahrgang I933 der ,Zeitschrift fur Kirchen-
geschichte" analysieren und besprechen.
Seite 543
,.propter spicam virginis" unterstrichen.
Die christlich-theologische Deutung des Tierkreiszeichens der fungfrau nach
AbU Ma 'schar verfolgt Kurt Rathe, Ein unbeschriebener Einblattdruck und tlas
Thema der ,ifhrenmadonna" in: Mitteilungen d.er Gesellschaft fur vervielfiil-
tigende Kunst I922, S. Iff.; vgl. Boll, At4S der Offenbarung Johannis, in: Stoi-
cheia I, I9I4, S. II5.
Seite 557
Die ,Pronosticatio Firmini" wird abgedruckt von Hubert Pruckner, Studien
zu den astrologischen Schrijten des Heinrich von Langenstein (Studien der
Bibliothek W arburg I4). Leipzig-Berlin I9JJ, S. 22o{2r.
657
ORIENTALISIERENDE ASTROLOGIE
Seite 559
Erschienen in: Wissenschaftlicher Bericht uber den Deutschen Orientalistentag
Hamburg vom 28. Sept. bis 2. Okt. I926, veranstaltet von der Deutschen Morgen-
liindischen GeseUschajt, Leipzig I927; Vortrag, anlafllich einer Fuhrung durch
die Bibliothek W arburg.
Das Bildmaterial zu diesem Aujsatz ist zum gro/len Teil den Aufsatzen uber den
Palazzo Schifanoja, den Planetenkalender I5I9 und Luther beigegeben.
Das Datum von Agostino Chigis Geburtstag ist jetzt auf Dezember I466 jest-
gelegt worden; vgl. S. 650.
Als Autor des arabischen ,Picatrix" (der Ghajat al-IJ,aklm) wird nicht mehr
Madfritl angesehen; vgl. H. Ritter, Picatrix ... in: Vortrage der Bibl. War-
burg I92I/22, Leipzig I92J, S. 95! und E. I. Holmyard, Maslama al-Majn-
tl ... in: Isis, VI, I924, p. 294sqq.
AMERIKANISCHE CHAP-BOOKS
Seite 569.
Erschienett in: Pan, 2. ]ahrg., 4 Heft (April r897).
WANDBILDER IM HAMB. RATHAUSSAALE
Seite 579
Erschienen in: Kunst und Kiinstler, 8. ]ahrg., 8. Heft (Mai I9Io).
BILDERAU SSTELLUNGEN IM VOLKSHEIM
Seite 589.
Erschienett in: Das Volksheim in Hamburg. Bericht iiber das sechste Geschiifts-
fahr I906/o7.
HERALDISCHE FACHBIBLIOTHEK
Seite 593
Erschienen in: Gesellschaft der Biicherfreunde zu Hamburg. Bericht iiber die
Jahre I901)-I9I2, Hamburg I9IJ.
FRESKO DES CASTAGNO
Seite 597
Erschienen in: Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Miinchen, ]ahrgang I899,
Nr. IJ8 (20. ]uni).
Ausfiihrliche Beschreibung des Freskos und seiner Wiederentdeckung bei Heinrich
Brockhaus, Forschungen iiber Florentiner Kunstwerke, Leipzig I902, III,
Andreo del Castagnos Fresko der Dreieinigkeit in der Kirche der Annunziata;
A bbildungen ebenda.
BEGRDSSUNG FLORENT. INSTITUT
Seite 6ox.
Als Privatdruck erschienen.
66o
ROBERT MDNZEL
Seite 6os.
Erschienen als Begleitworle zur Oberreichung der Gediichtnisschrift auf Robert
M unzel an die Gesellschaft der Biicherfreunde zu Hamburg anlaPUch ihres zehn-
fi:ihrigen Bestehens am rs. September I9I8.
Robert Munzel (r859-I9I7) war von I902 an Direktor der damaligen Stadt-
bibliothek, jetzigen Staats- und Universiti:itsbibliothek in Hamburg.
DAS PROBLEM IN DER MITTE
Seite 6n.
Erschienen in: Die Literarische Gesellschaft, hrsg. von der Literarischen Gesell-
schaft zu Hamburg, Jahrgang 4. I9I8, Heft 5 (Sonderheft, enthaltend eine Reihe
von Aufsiitzen Hamb14rgischer Professoren zur Universiti:itsfrage).
Tafel I.
Tafel III.
Tafel IV.
Tafel V.
Tafel VI.
Tafel VII.
Tafel VIII.
Tafel IX.
Tafel X.
Tafel XI.
Tafel XII.
Tafel XIII.
Tafel XIV.
Tafel XV.
66r
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1. Botticelli, Geburt der Venus, Florenz, Uffizien. S. ro
Abb. 2a, b. Geburt der Venus, Florenz, Bibl. Laur. Plut. XLI, 33,
fol. 31. S. II
Abb. 3 Ag. di Duccio, Legende a us dem Leben des Hl. Sigismund,
Mailand, Brera. S. 1 I
Abb. 4 Der Friihling, Holzschnitt a us der Hypnerotomachia Poli-
phili, Venedig 1499, fol. M Ivvo. S. IS
Abb. 5 Donatello, HI. Georg, Florenz, Or San Michele. S. rS
Abb. 6. Achill auf Skyros, Sarkophag, Woburn Abbey. S. 19
Abb. 7 Botticelli ( ?}, Federzeichnung, Chantilly. S. I9
Abb. 8. Botticelli ( ?}, Zeichnung, Mailand, Ambrosiana. S. 26
Abb. g. Giuliano vor Pallas, Holzschnitt a us: Polizian, Giostra,
Florenz 1513 fol. V. S. 26
Abb. ro. Botticelli, Primavera, Florenz, Uffizien.
S. 27
Abb. I 1. Niccolo Fiorentino, Drei Grazien, Riickseite der Medaille
fiir Giovanna Tornabuoni. S. 30
Abb. 12. Niccolo Fiorentino, Venus Virgo, Riickseite der Medaille
fiir Giovanna Tornabuoni. S. 30
Abb. 13. \Vindgotter, Cassone, Hannover, Kestner-Museum, Detail.
s. 31
Abb. 14. Venus und Aeneas, Cassone, Hannover, Kestner-Museum.
Abb. 15. Pomona, Florenz, Uffizien.
Abb. 16. Pallas, Intarsia, Urbino, Palazzo Ducaie.
Abb. 17. Botticelli, Nymphe des Acheloos, Zeichnung,
Brit. Mus.
s. 31
5.66
S. 66
London,
5.66
Abb. 18. Bacchus und Ariadne, Kupferstich nach Botticelli. S. 67
Abb. 19. Raub der Helena, Florent. Federzeichnung, London, Brit.
Mus. S. 84
Abb. 20. Lorenzo Medici und Lucrezia Donati, Florent. Kupfer-
stich. S. 84
Abb. 21. Judith, Florent. Kupferstich. S. 85
Abb. 22. Planet Venus, Baldini-Kalender, erste Auflage. S. 86
Abb. 23. Planet Venus, Baldini-Kalender, zweite Auflage. S. 87
Abb. 24. Giotto, Bestatigung der franziskanischen Ordensregel,
Florenz, Sta. Croce. S. 100
Abb. 25. Domenico Ghirlandajo, Bestii.tigung der franziskanischen
Ordensregel, Florenz, Sta. Trinita. S. 100
662 Verzeichnis der Abbildungen
Tafel XVI. Abb. 26. Ghirlandajo, Poliziano und Giuliano, Detail von Abb. 25.
s. 101
Abb. 27. Ghirlandajo, Lorenzo und Francesco Sassetti, Detail von
Abb.25. s. 1or
Abb. 28a, b. Spinello, Lorenzo de'Medici, Medaille. S. 101
Tafel XVII. Abb. 29. Ghirlandajo, Piero und Giovanni de'Medici, Detail zu
Abb. 25. S. 104
Abb. 30. Leo X., Medaille, Florenz. Mus. Nazionale. S. 104
Abb. 31. Spinello, Angelo Poliziano, Medaille. S. 104
Tafel XVIII. Abb. 32. Ghirlandajo, Luigi Pulci und Matteo Franco, Detail zu
Abb. 25. S. 105
Abb. 33 Der ,compare della viola", Holzschnitt a us: Pulci, Mor-
gante, Florenz 1500. S. 105
Tafel XIX. Abb. 34 Werkstattdes Rossellino, Francesco Sassetti,Marmorbiiste,
Florenz, Museo Nazionale. S. 146
Abb. 35a, b. Domenico Ghirlandajo, Francesco Sassetti und Nera
Corsi, Florenz, Sta. Trinita, Ausschnitt. S. 146
Tafel XX. Abb. 36. Fortuna, Florent. Kupferstich, Berlin, Kupferstich-
kabinett. S. 147
Abb. 37 Exlibris des Francesco Sassetti, aus: Argyropolus, Ethik
des Aristoteles, Florenz, Laurenziana. S. 147
Abb. 38. Fortuna, Wappenrelief, Florenz, Pal. Rucellai. S. 147
Abb. 39. Adlocutio, Miinze des Gordianus. S. 147
Tafel XXI. Abb. 40. Giuliano da Sangallo, Grab des Francesco Sassetti,
Florenz, Sta. Trinita. S. 154
Tafel XXII. Abb. 41. Domenico Ghirlandajo, Anbetung der Hirten, Florenz,
Sta. Trinita. S. 155
Tafel XXIII. Abb. 42. Plan von Florenz, Cod. Vat. Urb. 277. S. 168
Tafel XXIV. Abb. 43 Himmelsdarstellung, Florenz, S. Lorenw, Sagrestia
Vecchia. S. 169
Tafel XXV. Abb. 44 Antonio Pollaiuolo, Mannerkampf, Kupferstich. S. r8o
Abb. 45 Hosenkampf, Norwegische Tine, Berlin, Kupferstich-
kabinett. S. 180
Tafel XXVI. Abb. 46. Meister mit den Bandrollen, Hosenkampf, Kupferstich.
S. 181
Abb. 47 Hosenkampf, Florent. Kupferstich. S. 181
Tafel XXVII. Abb. 48. Bestrafung Amors, Florent. Kupfersticb. S. 182
Abb. 49a, b. Kramer und Affen, Emailbecher, ehem. Sammlung
Morgan. S. 182
Tafel XXVIII. Abb. 50. Memling, Jiingstes Gericht, Danzig, Marienkirche. S. 192
Abb. 51 a, b. Memling, Angelo Tani und Catarina Tanagli, AuBen-
fliigel zumJiingsten Gericht, Danzig, !vlarienkirche. S. 192
Tafel XXIX. Abb. 53a. Memling, Tommaso Portinari, Stifterportrat aus der
Passion, Turin, Pinacoteca. S. 198
Abb. 52a. Memling, Tommaso Portinari, New York, Metropolitan
Museum. S. 198
Tafel XXX. Abb. 53 b. Memling, Maria Baroncelli, Stifterportrat aus der
Passion, Turin, Pinacoteca. S. 199
Abb. 52b. Memling, Maria Baroncelli, New York, Metropolitan
Museum. S. 199
Verzeichnis der Abbildungen
Tafel XXXI. Abb. 54 a, b. Baroncelli-Meister, Pierantonio Baroncelli undMaria
Bonciani, Florenz, Uffizien. S. 202
Abb. 55 a, b. Hugo van der Goes, Tommaso Portinari und Maria
Baroncclli, Scitenfltigel zur Anbetung, Florenz, Uffi-
zien. S. 202
Tafel XXXII. Abb. 56. Roger van der \Veyden, Grablegung, Florenz, Uffizien.
S.216
Abb. 57 Grablegung, Teppich nach Cosimo Tura. S. 216
Tafel XXXIII. Abb. 58. Benedetto Ghirlandajo, Anbetung, Aigueperse. S. 217
Tafel XXXIV. Abb. 59 Arbeitende Bauern, Flandr. Teppich, XV. Jahrh. Paris,
Musee des Arts Decoratifs. S. 224
Tafel XXXV. Abb. 6o. Arbeitende Bauern, Flandr. Teppich, XV. Jahrh. Paris,
Musee des Arts Decoratifs. S. 225
Tafel XXXVI. Abb. 61. Arbeitende Bauern, Flandr. Teppich, XVI. Jahrh. Paris.
Musee des Arts Decoratifs. S. 230
Tafel XXXVII. Abb. 62. Hausbuchmeister, Festmahl Maximilians, Federzeich-
nung, Berlin, Kupferstichkabinett. S. 231
Abb. 63. Hausbuchmeister, Friedensmesse Maximilians, Feder-
zeichnung, Berlin, Kupferstichkabinett. S. 231
Tafel XXXVIII. Aub. 64- Himmelsreise und Tauchfahrt Alexanders, Flandr.
Teppich, XV. Jahrh. Rom, Palazzo Doria. S. 244
Tafel XXXIX. Abb. 65. Piero della Francesca, Khosro-Schlacht, Arezzo, S.
Francesco. S. 252
Abb. 66. Ramboux, Aquarellkopie nach Piero della Francesca,
Dusseldorf, Akademie. S. 252
Abb. 67. Konstantinsbogen, Kampfrelief. S. 252
Tafel XL. Abb. 68. Piero della Francesca, Konstantinsschlacht, Arezzo,
S. Francesco. S. 253
Abb. 69. Ramboux, Aquarellkopie nach Piero della Francesca,
Dusseldorf, Akademie. S. 253
Abb. 70a, b. Pisanello, Bildnismedaille des Johannes Palaeo-
logus. S. 253
Tafel XLI. Abb. 71. Turnier, Fest von Bayonne 1565, Flandr. Teppich,
Florenz, Uffizien. S. 256
Tafel XLII. Abb. 72. Musenhtigel, Fest ftir die poln. Gesandten 1573,
Flandr. Teppich, Florenz, Uffizien S. 257
Abb. 73. Wasserfest, Bayonne 1565, Flandr. Teppich, Florenz,
Uffizien. S. 258
Tafel XLIV. Abb. 74 Siegel Karls II. von England. S. 259
Abb. 76. Briefmarke von Barbados. S. 259
Abb. 75 .,Faveur", Fest von Bayonne 1565, Holzschnitt.
5.259
Tafel XLV. Abb. 77 Buontalenti, Zeichnung zum 1. Intermezzo von 1585,
Florenz, Gab. delle Stampe. S. 266
Abb. 78. Agostino Caracci, Szenenbild zum 1. Intermezzo von
1589, Kupferstich. S. 266
Tafel XLVI. Abb. 79. Buontalenti, Sirene, Aquarell, Florenz, Bibl. Nazionale.
5.267
Abb. 8o. Buontalenti, Harmonia Doria, Aquareli, Fiorenz, Bibl.
Naz. S. 267
V erzeichnis der A bbildungen
Tafel XLVI. Abb. 81. Buontalenti, Drei Planeten und Astraea, Florenz, Bibl.
Naz. S. 267
Tafel XLVII. Abb. 82. Agostino Caracci, Szenenbild zum 3 Intermezzo von
1589, Kupferstich. S. 288
Abb. 83a, b. Buontalenti, Apollo und der Drache, Florenz,
Bib!. Naz. S. z88
Tafel XLVIII. Abb. 84a, b, c, d. Buontalenti, Delphier und Delphierinnen,
Tafel XLIX.
Tafel L.
Tafel LI.
Tafel LII.
Tafel LIII.
Tafel LIV.
Tafel LV.
Tafel LVI.
Tafel LVII.
Tafel LVIII.
Tafel LIX.
Florenz, Bibl. Naz. S. 289
Abb. 85. Giulio Romano, Heilmittelverkaufer, Mantua, Palazzo
del Te. s. 302
Abb. 86. Heilmittelverkaufer, Cassone, Florenz, Musco Nazio-
nale, Ausschnitt. S. 302
Abb. 87. Venus, Marmorrelief, Perugia, Musco dell' Universita.
S. 310
Abb. 88. Bacchus, Cod. Vat. Urb. lat. Sgg, fol. 77vo. S. 310
Abb. 89. Domenico Ghirlandajo, Bestatigung der Ordensregel,
Zeichnung, Berlin, Kupferstichkabinet. S. 310
Abb. goa, b, c. Giostra, Cassone, Beaulieu s;?.vf.., Sammlung Sir
Henry Samuelson. S. 374
Abb. 91. C. M. Metz, Apollokampf, Stich nach A. Caracci, Lon-
don, Brit. Mus. S. 410
Abb. 92. Buontalenti, Arion, aquarellierte Zeichnung, Florenz,
Biblioteca Nazionale. S. 410
Abb. 93. Arion, aquarellierte Zeichnung, Florenz, Casa Horne.
s. 4i0
Abb. 94 Buontalenti, Fortuna, Zeichnung, London, Sammlung
Henry Oppenheimer. S. 41 I
Abb. 95 Buontalenti, Necessita, Zeichnung, Florenz, Biblioteca
Nazionale. S. 41 I
Abb. 96. Holzschnitt a us: Gafurius, Practica Musice, Mailand
1496. S. 412
Abb. 97 Diirer, Tod des Orpheus, Zeichnung, Hamburg, Kunst-
halle. s. 446
Abb. 99 Tod des Orpheus, Vase aus Nola, Paris, Louvre (Aus-
schnitt). S. 446
Abb. 98. Tod des Orpheus, oberitalienischer Kupferstich, Ham-
burg, Kunsthalle. S. 446
Abb. 100. Tod des Orpheus, Vase aus Chiusi, UmriBzeichnung
nach Annali 1871. S. 446
Abb. 101. Tod des Orpheus, aus: Ovid, Metamorphosen, Venedig
I ~ & ~
Abb. 102. Antonio Pollaiuolo, Kampfszenc, Zeichnung, Turin,
Pal. Reale. S. 447
Abb. 103. Jacopo del Sellaio, Orpheus, Cassone, Wien, Slg.
Lanckoronsky. S.448
Abb. 104a, b. Andrea del Castagno, David, Lederschild, Phila-
delphia, Slg. Widener. S. 448
Abb. 105. Planeten auf einem Kamin, Landshut, Residenz. S. 449
Abb. ro6. Die Aries-Dekane aus: Astrolabium Magnum, ed.
Engel, Augsburg 1488. S. 466
V erzeichnis der A bbildungen 665
Tafel LX. Abb. 107. Synoptische Sphaera mit den Monatsregenten nach
Manilius und den griech. Astrologen. S. 467
Abb. 108. Perseus, Germanicus-Handschrift, Leiden, Univ.-Bibl.,
Voss. lat. 4, 79, fol. 40v. S. 467
Tafel LXI. Abb. 109. Planisphaerium Bianchini, Paris, Louvre. S. 467
Tafel LXII. Abb. uo. April-Fresko (Venus) und Marz-Fresko (Pallas), Ferrara,
Palazzo Schifanoja. S. 468
Tafel LXIII. Abb. III. Erster Dekan des Widders (Marz-Fresko), Ferrara,
Palazzo Schifanoja. S. 470
Taiei LXIV. Abb. I 12. Venus, Libellus de deorum imaginibus, Rom, Cod.
Vat. Reg. lat. 1290, fol. 2r. S. 471
Abb. 113. Venus, Ovide moralise, Paris, Bibl. Nationale, Ms.
frany. 373, fol. 207v. S. 471
Tafel LXV. Abb. 114. Juli-Fresko (Jupiter-Kybele), Ferrara, Palazzo Schi-
fanoja. S. 472
Tafel LXVI. Abb. I15. Schema der Freskenanordnung im Palazzo Schifanoja
zu Ferrara. S. 473
Tafel LXVII. Abb. 116. Merkur aus den Tarocchi, oberitalienischer Kupfer-
stich, Serie E. S. 484
Abb. II8. Merkur, Holzschnitt von Hans Burgkmair. S. 484
Abb. II7. Merkur aus: Nyge Kalender, Lubeck 1519. S. 484
Tafel LXVIII. Abb. II9. Lorenzo Spirito, Libra delle Sarti, Perugia 1482.
s.486
Tafel LXIX. Abb. 120. Saturn aus: Lorenzo Spirito, Libra delle Sarti, Peru-
gia 1482. S. 487
Tafel LXX. Abb. 121. Schule des Lucas Cranach, Johann Carion, Berlin,
PreuB. Staatsbilbiothek. S. 498
Abb. 122. Nativitat Luthers von Erasmus Reinhold, Leipzig,
Stadtbibliothek, Cod. 935, Blatt 158. S. 498
Tafel LXXI. Abb. 123. Nativitat Luthers von Lucas Gauricus, aus: Tractatus
Astrologicus, Venedig 1552, Blatt 6gV. S. 499
Tafel LXXII. Abb. 124. Nativitat Luthers, Cod. lat. Monac. 27003, fol. 16.
s. 500
Tafel LXXIII. Abb. 125. Satumkinder, Tubingen, Cod. M.d. 2, fol. 266v. S. 506
Tafel LXXIV. Abb. 126. Chronograph von 354, Dezember, Saturnalienspieler.
s. 507
Abb. 127. Saturn aus: Nyge Kalender, Lubeck 1519. S. 507
Abb. 128. Saturn aus den Tarocchi, oberitalienischer Kupferstich,
Serie E. S. 507
Abb. 129. Astrolog. Kosmos und Nativitatsschema, nach: Ad.
Drechsler, Astrolog. Vortrage, Dresden 1855. S. 507
Tafel LXXV. Abb. 130. Titelholzschnitt von Erhard Schon, zu Leonhard Rey-
manns Nativitats-Kalender, Niirnberg 1515. S. 508
Abb. 131. Titel zu Leonhard Reymann, Practica fiir 1524, Stutt-
gart, Landesbibliothek, Hs. Math. Q. 3 S. 508
Tafel LXXVI. Abb. 132. Titel zu Johann Carlon, Prognosticatio, Leipzig 1521.
S.509
Tafel LXXVII. Abb. 133. Titel zu Georg Tannstetter, Libellus consolatorius,
Wien 1523. S. 514
666 Verzeichnis der Abbildungen
Tafel LXXVII. Abb. 134. Titel und letzte Seite aus: Paulus von Middelburg,
Prognostica, Antwerpen 1484. S. 514
Tafel LXXVIII. Abb. 135. Jupiter und Saturn, aus: Johann Lichtenberger, Weis-
sagungen, Wittenberg 1527. S. 515
Abb. 136. Die heiden Monche aus der gleichen Ausgabe Lichten-
bergers. S. 515
Abb. 137. Die heiden Monche aus der Ausgabe Lichtenbergers,
Mainz 1492 (Expl. der Staats- und Universitatsbibl.
Hamburg). S. 515
Tafel LXXIX. Abb. 138. Skorpion, Rom, Cod. Vat. Reg. lat. 1283, fol. 7v.
s. 516
Tafel LXXX. Abb. 139. Skorpio-Wahrsagebilder II
0
-14, aus: Astrolabium
Magnum, ed. Engel, Augsburg 1488. S. 517
Tafel LXXXI. Abb. 140. Die beidenMonche a us: Propheceien und Weissagen ...
Doctoris Paracelsi, Joh. Lichtenbergers, M. Joseph
Griinpeck, Joan. Carionis, Der Sibyllen und anderer,
Augsburg 1549. S. 520
Abb. 141. Luther mit Sichel und Rose, a us: Osiander und Hans
Sachs,Wunderliche Weissagung, Niirnberg 1527. S. 520
Abb. 142. Dieselbe Darstellung aus: Vaticinia Joachimi, Bono-
niae 1515, Wolfenbiittel, Bibliothek. S. 520
Abb. 143. Jupiter, Saturn, Sol ( ?) aus dem gleichen Buch.
S. 520
Tafel LXXXII. Abb. 144 Oraculum V a us: Leonis Oracula, ed. Lambecius,
Paris 1655. S. 521
Abb. 145a, b. Papstesel und Monchskalb, nach Johann Wolf,
Lectiones memorabiles, Lauingen 16o8. S. 521
Tafel LXXXIII. Abb. q6. Weissagung des Ulsenius mit Holzschnitt von Durer,
Einblattdruck, Niirnberg qg6. S. 524
Tafel LXXXIV. Abb. 147. Diirer, Sau von Landser, Kupferstich B. 95. S. 525
Tafel LXXXV. Abb. 148. Wundersau von Landser, Flugblatt des Sebastian
Brant, 1486. S. 526
Tafel LXXXVI. Abb. 149 Durer, Melencolia. I, Kupferstich B. 74 S. 527
Tafel LXXXVII. Abb. 150. Jupiter und Saturn, aus derselben Ausgabe Johann
Lichtenbergers wie Abb. 140. S. 530
Abb. 151. Schwertformiger Komet aus einer franzosischen
Handschrift urn 1587, Hamburg, Bibliothek War-
burg. S. 530
Tafel LXXXVIII. Abb. 152. Aries, aus: Zebelis Liber de interpretatione diver-
sorum eventuum secundum lunam in 12 signis zo-
diaci, Berlin, Staatsbibl. Lat. 4 322. S. 531
Abb. 153. Kurfiirst, aus derselben Handschrift. S. 531
Tafel LXXXIX. Abb. 154. Ernest Peixotto, Le Retour de i'impressioniste, aus:
The Lark, S. Francisco 1896, No. 6. S. 572
Abb. 155. Gelett Burgess, Remarkable is Art, ebda. No. 8.
s. 572
Abb. 156. Bruce Porter, The Piping Faun, ebda. No. 11.
s. 572
Abb. 157. Gelett Burgess, SchluBvignette, ebda. Anhang zum
I. Jahrgang. S. 572
Verzeichnis der Abbildungen
Tafel XC.
Tafel XCI.
Tafel XCII.
Tafel XCIII.
Tafel XCIV.
Tafel XCV.
Tafel XCVI.
Abb. 158. I. Libra-Dekan, Palazzo Schifanoja. S. 630
Abb. 159. I. Virgo-Dekan, Palazzo Schifanoja. S. 630
Abb. r6o. I. Libra-Dekan, Picatrix, Krakau, Ms. XI, 1, 793.
S. 63o
Abb. 161. I. Virgo-Dekan, Picatrix, Krakau, Ms. XI, I, 793
s. 630
Abb. 162. 2. Libra-Dekan, Palazzo Schifanoja. S. 636
Abb. 163. 2. Libra-Dekan, nach Ludovicus de Angulo, St.
Gallen, Cod. Vad. 427, fol. 89r. S. 636
Abb. 164. Persische Sphaera des Abu Ma'schar zum I. Gemini-
Dekan, Paris, Bibl. Nat., Cod. lat. 7331, fol. 23r.
Abb. 165. I. Gemini-Dekan, nach Ludovicus de
Gallen, Cod. Vad. 427, fol. 86V.
Abb. 166. I. Gemini-Dekan, Palazzo Schifanoja.
S. 636
Angulo, St.
s. 636
s. 636
Abb. 167. 2. Leo-Dekan, Palazzo Schifanoja. S. 637
Abb. r68. Dreiteilige Sphaera des Abu Ma 'schar zum 2. Leo-
Dekan, London, Brit. Mus., Sloane Ms. 3983, fol. 17v.
s. 637
Abb. 169. Dreiteilige Sphaera des Abu Ma'schar zum 2. Leo-
Dekan, nach Ibn Esra, Cod. Lat. Monac. 826.
s. 637
Abb. 170. 3 Virgo-Dekan, London, Brit. Mus., Sloane Ms.
3983, fol. 2ov. S. 638
Abb. 171. 3 Virgo-Dekan, nach Ludovicus de Angulo, Paris,
Bibl. Nationale, Cod. franc;:. 612, fol. 117v. S. 638
Abb. 172. 3 Virgo-Dekan, nach Ludovicus de Angulo, Paris,
Bibl. Nationale, Cod. lat. 6561, fol. Io6v. S. 638
Abb. 173. 3 Virgo-Dekan, Palazzo Schifanoja. S. 638
Abb. 174. 2. Gemini-Dekan, Palazzo Schifanoja. S. 638
Abb. 175. 3 Libra-Dekan, Palazzo Schifanoja. S. 639
Abb. 176. Persische und indische Sphaera zum 3 Libra-Dekan,
nach Ludovicus de Angulo, Paris, Bibl. Nat., Cod.
f r a n ~ . 612. S. 639
Abb. 177. Persische und indische Sphaera nach Abu Ma'schar,
zum 3 Libra-Dekan, London, Brit. Mus., Sloane Ms.
3983, fol. 22r. S. 639
Abb. 178. 3 Libra-Dekan, nach Ludovicus de Angulo, St.
Gallen, Cod. Vad. 427, fol. 89r. S.639
Abb. 179. Dezemberfresko (Vesta), Zeichnung des 19. Jahr-
hunderts nach dem zerstorten Fresko im Palazzo
Schifanoja zu Ferrara. S. 640
Abb. 180. Dezember-Bild, Kalender, Augsburg (Schonsperger)
1490. S.65z
Abb. 181. Luther als Herkules Germanicus, Flugblatt von Hans
Holbein d. J. S. 652
Warburg, Gesammelte Scbriften. Bd. 2
43
668
Abel, Finiguerra-Zeichnung
72
Abil Ma'schar
Dekane 465. 467f. 476.
561 f. 629. 630ff.
Planeten 477 563
Sternbilder
Fuhrleute 631. 635
Virgo 543 656
Nachleben
Lichtenberger 556
Paulus von Middelburg
514f.
Prisciani 475 480
Reisch, Gregor 642 f.
'Obersetzungen und Be-
arbeitungen 465 f.
63off.
Acciajuoli, Inventar, Tracht
,alia franzese" 84
Acciajuolo, Zanobio
Bibliothekar 354
Nachbildner Horazischer
Oden 41
Acedia, Eigenschaft der Sa-
turnkinder 507
Achelous, Nymphe des, Bot-
ticellizeichnung 65f.
Achill auf Skyros
Darstellung
Fresko in Palmyra 310
Miniaturen 3II
Sarkophag 20. 310
Literatur
Boccaccio 3II
Christine de Pisan 31 I
Ligorio, Pirro 21
Ovide moralise 3 II
Statius 20
Actaeon bei Giovanni Fon-
tana 635
Ada, Finiguerra-Zeichnung
72
REGISTER
Adam, Finiguerra-Zeich-
nung 72
Adonis und Venus-Diana
314
Agypten, Herkunft der De-
kane 467
Aeneis siehe Vergil
Affen
Begleiter des Merkur 640
Begleiter des Vulkan 641
und, Emailbecher
181. 368
Kramer und, Holzschnitt
369
und, Kupfer-
stich I 8 I. 369
Tanz, Festwescn 181.318.
368.
Affrico, Hirt bei Boccaccio 35
Agave, Mutter des Pen-
theus 446
Agostino Veneziano, Nym-
pha, Kupferstich 290
Agrippa, Camillo, Medaille
365
Agrippa von Nettesheim
Kosmologische Distichen
413
Zahlenmagie 527f.
Aiguepersc, Benedetto
Ghirlandajo, Anbetung
2I9f.
Aion, Rose als Symbol des
653
Akademien
Crusca 270. 428
Florentiner platonische
367
Musique et Poesie, Paris
419
Pellegrini 270
Akropolis, Weihgeschenke
35
66g
Alamanni, Luigi, iiberFlora
19
Alaunhandel
Flandern-Italien 191.
199. 201. 210. 378
Oricnt-Italien 390
Alava, Frances de, Bericht
fiber Bildzauber 341
Albanien, Monstrum in 653
Alberti, Leone Battista
Architekt 12
Fassade von Sta. Mar.
Nov. in Florenz siehe
Florenz,
Kunsttheoretiker (be-
wegtes Beiwerk) II. 13.
27 149 292
Philosoph 358
Seneca, Entlehnung 28
V erM.ltnis zu Botticelli
II ff. 27 f. 308
Verhaltnis zu Polizian 13.
I6. 309
Albizzi
Albicra degli, Elegie Poli-
zians 47 314. 325f.
Giovanna degli, siehe Tor-
natuoni, Giovanna
Albricus siehe Berchorius,
Libellus de deorum ima-
ginibus,Mythographuslll
Aldovrandi, Grazienrelief
30
Aldus Manutius, Drucker
der Hypnerotomachia 18
Alexander der GroBe
Apotheose 247
Curtius Rufus, bei 388
als 387
Darstellung
Fresko 248
Teppiche 223. 243ff.
386
43*
Alexander der Grol3e
Mohammed II. und 248.
388
Pseudo-Kallisthenes, bei
629
Sonnenkult 247 387
Vasco da Lucena, bei 248.
388
Vorfahre der ttirkischen
Sultane 248. 388
Wauquelin, bei 244 ff. 247
386
Alexanderteppich
Auftrag 1459: 247f. 387
Verbreitung 243ft. 248.
388
Alfiano, Epifanio d'
Stich zur Mascherata dei
Fiumi 299
Stiche nach den lnterme-
dien von 1589: 266. 276.
298f. 403. 411. 424. 426
Alfonso el Sabio
Lapidarium 467. 528. 530.
629. 630. 632
Libro de los ymagines
516. 528. 564
Dbersetzungsta.tigkeit
466. 562
Alfonso von Aragon
Fortuna bei 151. 359 f. 391
Jan van Eyck, und 189
Alkabitius, Kommentar des
Johannes Saxonicus 635
Alkestis, Sarkophagplastik
I 54 f.
Alkindi, Kometen 533
Allori, Alessandro siehe
Bronzino
Almansor, bei Prisciani zi-
tiert 480. 643
Altertum siehe Antike
Altoviti, Cornelio, Schwie-
gersohn Portinaris 198
Amazone, Finiguerra-
Zeichnung 75
Ambra, Nympha bei Lo-
renzo de' Medici 35 f.
Ambrosiana siehe Mailand
Ammanati, Bartolomeo, Be-
teiligung an den Festen
1589: 398
Amman, J ost, Hasen-
kampf, Zeichnung, Er-
langen 368
Ammirato, Scipione
Geschichte der Bandini-
Baroncelli 202. 210
Impresen, tiber 342
Ammon, Orakel, bei Luther
548
Am or
Bestrafung
Ausonius 183. 369
Kupferstiche 182 f.
Petrarca 183. 369
Signorelli 183. 369
Botticelli 26. 3 21
Buontalenti 411
Festwesen 257. 393
Fresko Palazzo Schifano-
ja 471
Holzschnitt
.. Fiore e Biancifiore"
322
.,Galvano da Milano"
321 f.
Hypnerotomachia 18
Miniatur
Libellus de imaginibus
deorum 471
Ovide moralise 471 f.
Amphipolis, Tetradrachme
6o8
Amsterdam, Rijksmuseum,
Fastnachtszug 21 I
Ancona, Cyriacus von, siehe
Cyriacus
Andachtsbild
Botticelli 63 f.
Flandrisches, stilbildend
175 187. 189. 204ff.
212. 229
Ghirlandajo 155ff. 205
Roger 189. 229
Andelot, siehe Dandelot
Andrea di Angiolo di Ter-
ranova siehe Terranova
Andreini, Isabella, Schau-
spielerin 261 f. 268. 423
Andromachus, Leibarzt
Neros, Theriakiezept 440
Angelo siehe Engel, Johann
Angulo, Ludovicus de, siehe
Ludovicus de Angulo
Antichrist
Lichtenberger tiber 546.
558
M6nchsprophet als 558
Papst als 521
Register
Antike, Nachleben
Autoren
Aratus 465f.
Aristoteles 147. 153
270. 272. 344 357
429. 526f. 529. 551.
65o
Augustinus 473 64d.
Aulus Gellius 351. 415
Ausonius 183. 413f.
Boethius 147. 265. 357
414
Cicero 350. 357 413
Claudian 14 ff. 43 313 f.
Curtius Rufus 388
Grammatiker 417ff.
Historiker 388
Homer 6. 9 308. 313.
327. 478
Horaz 28 f. 4of. 42 f.
280. 313. 431
Lucan 351. 357f.
Lucrez 4If. 321. 327.
478
Lukian 277. 283 f.
417ff. 434
Macrobius 414. 418
Manilius 469f. 472.
475f. 481. 628. 643
Martianus Capella 412
Moschus 309
Obsequens 522 f.
Orpheus 327
Ovid 14ff. 16f. 32 ff.
35 f. 42. 65f. 309.313.
315f. 318. 446. 478.
642
Ovide moralise siehe
diesen
Plato 39 65. 87. 148.
257. 265. 269ff. 279f.
282. 312. 320. 327f.
339 414f. 420. 425.
429431478551.644
Plinius 2 If. 282. 3 I 1.
433 440. 533
Plutarch 270. 389. 412
Pollux 284. 286. 295.
419. 434 437
Ptolemaeus 168. 366.
551
Seneca 28. 147. 357
Servius 641
Stoiker 492
Theokrit 342
Registe1'
Antike, Nachleben
Autoren
Valerius Maximus 416
Vergil3of. 39 67f. 258.
282. 312 f. 314f. 393
525
Vitruv 53 66. 448
Bildmotive
Achill auf Skyros 2of.
31I
Bewegungsmotive 5
10. 14ff. x8f. 22.
30. 37f. 52ff. 55
66. 74f. 84f. 86. II2.
188. 229. 292. 313f.
461
Eros 183
Flu6gott 530
Fortuna 149ft. 356ff.
359f.
Grazien 26f. 28ff. 39
42. so. 271. 315. 327
414 429. 47If. 478.
640
Heroen 72. 157 212.
22J. 24Jff. 248. 274f.
276. 322. 357. 359.
370-387-416.430447
649.
Historien 74 243ff.
385. 386
Horen9. r6f. 38f. 42. 45
Legenden So. 244ff.
248. 303
Maenade 13. 21. 37.52.
84. 308.337412.446.
477
Marsyas 183
Medea 13. 75 84. 86.
338
Medusa 25. 52. 84. 86.
182. 312. 315 336.
338. 469. 477 643
Meleager 154 158. 354
,Nympha" 13. r6. 21.
34 37 40f. 47 52f.
65. 75 s
4
tt. u2.
182. 289ff. JII. 314f.
317f. 322f. 325ff.
336ff. 415. 420.
435f. 477
Orpheus 37 445ff. 623
Pallas 7 23ff. 52. 59
84. 87. 264. Jl2. 339
425 464. 469f. 628.643
Antike, Nachleben
Bildmotive
Pentheus 446
Satyrn 229
Venus siehe diese
Victoria 75 84. 337
391- 477
Kulte
Ahnenkult II9. 248.
387. 526
Apotheose 247
Asklepios 303. 440.
515.
Chorspiele 283ff. 287.
296. 418. 430. 434
Damonologie 99 roof.
149 I52f. 154 I57f.
229. 324 327. 354
387. 490. 497 504ff.
5uf. 515. 523. 528.
531. 548. 562ff.
564. 65o
Dionysos 446
Divination siehe Mon-
stra, Namen
Gestimkult sieheAstro-
logie
Gotterkulte siehe die
einzelnen Gotterna-
men
Kybele-Kult 473 641
Mantik siehe Bildzau-
ber, Magie
Orakel und Prophetie,
466. 490ff. 497 506.
525. 533 546. 562
Saturnalien 507
Sonnenkult 247 387
Tanz 277. 284. 287.
295 417ff. 434 436f.
441
Triumphritus x8. 66f.
74 r88. 258. 281 ff.
290ff. 321. 359. 391.
432ff.
Weihgeschenke 99f.
I 16. I 19. 346ff. 350
531; siehe auch Ex-
Voto
Monumente
Ariadne, schlafende
323. 631
Belvederischer Apoll
448. 624
Gemmen 48. 175 JII
Antike, Nachleben
Monumente
Graziengruppe 29f.414.
471
Konstantinsbasilika
362f.
Konstantinsbogen 67.
157 175. 253
Laokoongruppe 68.176.
367. 449 624
Lucernen 86. 338
Mediceische Venus 308.
JIO. 478
Miinzen 157. 414. 6oS
Niobidenpadagoge
448. 625
Ornamente 73.
Parthenon 155
Pomona (Florenz) 38.
JI9f.
Reliefs,
archaische 645
Hygieia 39
Kairos (Torcello) 151
neu-attische 53 308.
412
Sarkophagplastik 13.
20. JO. 154ff. 158.
183. 310. 354 361.
391. 446. 453 623
Theseion 154f.
Triumphalplastik 67.
75 84. I57f. I75f.
253 390. 477
Vase (Pisa) 12f.
Vasenmalerei 446
Uberlieferungsformen
Arabische Wissen-
465. 491 f. 516.
526ff. 531. 533. s6xf.
564
Astrologie 453. 457
462ff. 465. 468ff.
478. 4s
5
r. 491. 507.
516. 526ff. 562.
564i. 63o-639 051 f.
Druckkunst 463. 472.
486. 490f. 562. 645
Festwesen 37 48. 66.
74f. 156. 257f. 263.
28xf. 283. 289. 296.
30]. 318. 321. 322.
359f. 363. 432f. 434
436ff. 440. 446f. 64J
Antike, Nachleben
Dberliefernngsformen
Mythographie 453 f.
457 462ff. 476. 47S.
627f. 641 f.
Teppichkunst 223. 229.
247. 371. 3Ss. 46I
Theater 37 I56. 2S3ff.
2S7. 296. 363. 4ISf.
42Sf. 432f. 434 436ff.
446
,Wanderwege" 449
453 f. 463 f. 465 ff.
46Sf. 479 4S6. 491.
507. SI6. 525. 53If.
562. 565. 645. 6sd.
Zeichnungen
Bellini 29. 4I2
Botticellischule 19
Codex Pighianus I3.
2S. 625
Cyriacus von Ancona
ISS 645
Filippino-Schule 3IO
Ghirlandajo-Schule
I 57 391. 625
Giuliano da San Gal-
lo ISS I57
Hartmann Schedel
155
LucAntonio de Giun-
ta 3IO
Dberlicferungsprozell
Arch:l.ologisch-histori-
scheTendenz 74f. IIS.
rs6f. 24Sf. 279ff.
2S3ff. 295. 396. 416.
41Sf. 433 436 ff.
446
Ausgleich mit dem
Christentum 72f.roof.
us. 146. l4S. 149.
rs3f. rssf. rss. 290.
321. 323. 354 J62f.
390. 435 491. 497
504. sog. s rd. 523.
563
Auseinandersetzung
mit dem Mittelalter
72. 139144. 157f. 22S.
247ff. 257f. 310.325.
357f. 453. 457 461.
473 474 476f. 47S.
479 s6s.
Antike, Nachleben
Dberlieferungsprozell
Restitution der olym-
pischen A. 53 f. 63 f.
65 f. 74 S7. 157.
175. 1S3f. 1SS. 205.
229. 24Sf. 253f. 257f.
265. 2Soff. 2S3f. 295.
325ff. 339 363. 445
453 461. 463.470. 474
476. 47S. 479 5uf.
515. 529. 531. 534.
562. 640. 643. 644.
649.
,soziale Mneme" 5S.
258. 464. 534 564
Stilbildung durch
Bewegtes Beiwerk 5
qff. 1Sf. 22. 30. 3S.
52f. 54 f. 66. 75 86.
149. 2Sgff. 292.
JIO. 314. 336f.
436. 449 461. 477
Tracht 2Sf. 37. 65.
74. So. S4ff. 179 f.
1S2. 1S7f. 223.
24Sff. 2Sgff. 292.
311. 315. 325f.
336f. 435 f. 461. 477
Stofflich getreue Dar-
stellungstendenz siehe
Tracht alla franzese
Dbergangsstil5S74 So.
S4. S7. 157 175f. 1S2.
223. 265. 295. 333
339 436. 447 454
476ff.
Winckelmannsche Auf-
iassung JO. 55 66.
176. 445 491
Dbernahme von Bildmo-
tiven bei
Antonio da Pavia 151
Bellini, Jacopo 29. 412
Bertoldo 361
Botticelli 33 3Sf. 40.
53. 65f. 68. 74 84f.
II2. 1S3f. 290. JIO.
J25f. 337 339 453
47S. 644
Botticclli-Schulc 19ff.
Cioli, Valerio 396
Donatello 13. 84. 337
Duccio, Agostino di
12 ff. 29. 454
Register
Antike, Nachleben
Dbemahme von Bildmo-
tiven bei
Diirer 37 175. 445ff.
44S. 454 530. 62Jf.
Filarete 2rf.
Filippo Lippi 32. 66.
S4. 290. 337
Filippino 6S
Ghirlandajo Ss. 157.
175f. 212. 337 391
Leone Leoni 30
Liberale da Verona ( ?)
31
Lionardo 52 ff.
Machiavelli no
Mantegna rSS. 445ff.
Niccolo Pisano 12
Petrarca rS3
Piero della
391
Poliziano 7 13ff. 16.
3rff. 3Jff. 4rf. 52
II2. 446. 47S
Pollajuolo So f. Ss. 175.
229- 337 446. 449
Raffaelschule 175
San Gallo, Giuliano da
53 154ff.
Tarocchi 454 645
Verrocchio S5. ISS 337
Dbernahme von Bil-
dungsinhalten bei
Bajazct 24S
Baldini 31. 67. 74 Ssf.
179. ISJ. 290. 336.
3JS. 477
Bardi 263ff. 265.
26gff. 277ff. 2SO.
2S3 ff. 2S7. 295 f.
Boccaccio 35 311. 320.
346. 414. 641 f.
Botticelli 7 ro. 16. 23.
26ff. 33 3Sf. 41. 45ff.
49 51. 59 6s. s4. s7.
2go. 309 320. 321.
325f. 327. 339 477
643.
Durer 37 446. 454
524. 530.
Enea Silvio 391
Finiguerra 71 ff.
Karl der Kiihne 24Sf.
3SS
Register
Antike, Nachleben
tJbernahme von Bil-
dungsinhalten bei
Lorenzo 7 43 so. 67.
IIO. 290. 350. 391
Mohammed II. 24S
Musiktheoretiker 25S.
263ff. 277. 283ff.
294ff. 396. 414. 4I8f.
425. 430. 434ff.
Petrarca IS3. 317. 357.
369. 413. 640
Rucellai 146. 149.
357.
Sassetti I IS I34f. I46
I 52 ff.
Wirkungen
Ausdruckssteigerung
(Gebltrdensprache)
152. 154f. 157 175
!83. 447. 461
Bewegungssteigerung
5 22. 54 S4. 154
rs7f. 175. r
7
9. x83.
229. 313 ff. 316. 33s.
445ff. 44S. 461. 477
Dramatisierung 257 f.
283. 295 f. 390 419.
434 436f. 438. 446
Harmonisierung 49
53f. 66. 448. 475.
497 624
Heroisierung So. 146.
157. r88. 212. 24S.
25S. 357 359 39!. 393
447 448. 477 649f.
Humanisierung 248.
257. 295f. 395.
414. 418. 437f. 52S.
529ff.
Idealisierung 58. 65 f.
74 So. 84. S7. I57
I75 18o. 183. 229.
248. 253 257 f. 295
325. 333ff. 336. 445
447f. 454 461. 47611.
5uf. 644. 649.
Polaritltt 55 66. 176.
448. 463. 474 479
49I. 492. 5IIf. 529.
531. 534f. 564
Pathosstil So. 157.
175. IS3f. 229. 253
333 391. 445. 453.
461
Antike, Nachleben
Wirkungen
Temperamentssteige-
rung (Energiesteige-
rung) 145f. I50f. 152 ff.
157f. 175. 229. 354
447
Antoninus von Florenz
Zeit des 72. 347.
Weltperioden 72
Antonio da Bologna, Ver-
trag iiber Wachsvoti I I 7 f.
Antonio de' Medici, Mit-
glied der Briigger Filiale
380
Antonio da Pavia, Occasio,
Fresko, Mantua 151
Antonius de Monte Ulmo
bei Lichtenberger 557
Apelles, Verleumdung des
Alberti 27
Botticelli 2 7
Aphrodite siehe Venus
Apian, Peter, iiber Kame-
ten 534
Apollo
Bilddarstellung
Botticelli 33f.
Buontalenti, Zeichnung
264. 267. 284. 411.
425. 434
Caracci284.4I1.434
Duccio, Ag. di 29
Diirer 624
Epifanio d' Alfiano,
Stich 298
Miniatur zu Christine
de Pisan 316
Miniatur zu Petrarcas
Rime 317
Miinzen 4I4
Theaterfigur 264. 276.
284ff 295 298. 400.
402. 403. 411. 418f.
421. 425. 433. 437
Tibaldi, Tafelbild 41 I
Vasari, bei 295 4Io.
433 437
Charakter
Delphischer Gott 283 ff.
287. 434
Dionysos und, antike
PolariUt I76. 229. 44S
Drachentoter, siehe
Pythonkampf
Apollo
Charakter
Kosmologisch-musika-
lisch 270. 295. 4I2f.
414 429
Musenfiihrer 271. 41 I.
414. 429
Planet, siehe Sol
Signum Triceps 271.
413 430
T!l.nzer (Theater) 284.
287. 295 419. 434
437
Wettlaufe zu Ehren
des 6o8
Literatur
Bellincioni 346
Bardi 283ff. 287. 425.
434 437
Cartari 29
Chaucer 315.
Claudian 15
Gafurius 271. 413f.
429f.
Lied 31S
Macrobius 414
Manilius 470
Ovid 33 36
Ovide moralise 316
Polizian 7. 33 f.
Apollonio di Giovanni, Cas-
sonemaler rS8. 372
Apostel
Donatellos Reliefs 13
Kupferstiche 179
Apostel Paulus, Schlangen-
legende 303. 440
Apotheose der romischen
Kaiser 247
Apuleius, Eros und Psyche
327
Aquarius siehe Tierkreiszei-
chen (Wassermann)
Araber als tJberlieferer der
Antike 465. 491f. 515.
527. 561f. 564
Aragona siehe Alfonso, Ca-
milla, Ferdinanda, Isa-
bella, Leonora
Aratus, Fixsternlebre 465
Arazzo siehe Teppich
Archangelo di Giuliano di
Antonio, Bildner von
\Vachsvoti II7f.
Archilei, Vittoria, Mitwir-
kende bei den Interme-
dien von 1589: 275 277.
299 396. 40!. 403
Archive siehe Florenz,
Lubeck
Ardinghelli
Caterina, Mutter des Nic-
colo 88
Lucrezia siehe Donati,
Lucrezia
Niccolo, Mann der Lu-
crezia Donati 82 f. 87 f.
334ff. 380
Arczzo
Gentile de' Bechi, Vc-
scovo von I 20
Pieros Konstantinsfres-
kcn I75 r88. 253f. 389f.
Argyropulos, Johannes,
Ubcrsetzung des Aristo-
tclcs 153
Ariadne
Bild
AntikePlastik323. 631
Baldini-Stich 31. 85.
337
Bilderchronik 75
Botticelli, Kupferstich
67. 290
Literatur
Lorenzo 50. 67. 290
Polizian 7. 1 3
Aries siehe Tierkreiszeichen
(Widder)
Arion
Peri als, 1589: 294 405
Zeichnung Buontalentis
268. 294 411 427
Ariosto, Francesco, Isis
322
Ariosto, Lodovico, Carducci
tiber 325
Aristeo, Hirt bei Polizian
33f. 36. 317
Aristoteles
Argyropulos' Collegs
in Florenz I 53
Harmonia Doria bei 270.
272. 429
Lichtenberger, bei 551
Luther, bei 650
NicomachischeEthik 153.
344 362
Aristoteles
Problemata 526. 529
Rucellai, bei I47 357
Armenini, Giov. Battista,
Quadri da spose 320
Arndes
Stephan, Drucker 454
485. 507. 563. 645
Theodor, Geistlicher 454
485.
Arnolfini, Giovanni
Auftraggeber des Stichs
mit dem Burgunderwap-
pen( ?) 372
Portrait, Jan van Eyck
x89f.
Arras, Teppichweberei 248
Asarhaddon, Prophezeiung
525
Ascanius, Finiguerra-Zeich-
nung 75
Asklepios
Kultattribute, in der
Handschrift Reg. lat.
!283: 516
Schlange als Tier des 303.
440
Schlangentr11ger, astro-
logisches Nachleben 515
Assisi
Franziskus von siehe
Franziskus
Giotto-Fresken 362
Santa Maria degli Angeli,
Wachsvoto Lorenzos 99
341
Astraea
Bardi, bei 271. 273. 415
Buontalenti, Zeichnung
267
Frezzi, bei 271. 415
Hofische Dichtung 415
Theaterfigur 276. 398.
402. 415
Astrolabium Planum
Dekane 466. 628. 629.
635
Facies 629
Astrologie
Bilddarstellungen siehe
Dekane, Kalender, Pla-
neten (sowie ihre einzel-
nen Namen), Schifa=
noja, Tierkreiszeichen
Bildzauber 628
Register
Astrologie
Elemente siehe Dekane,
Kometen, Paranatellon-
ta, Planeten (auch die
einzelnen Namen), Tier-
kreiszeichen
Menschenformige Gestal-
ten 4 79 491 . 508 ff.
529ff. 534
Monstrose Gestalten 465.
467. 628. 630. 636
Namenzauber 464. 506.
628
Polaritat 491. 497 505.
534 565
Politisch verursachend
497504. 509.515
Praktik siehe Nativitll.-
ten, Prophezeiung
Traditionsfunktion 453.
46Iff. 464ff. 476. 491.
56! ff. 564
A then
Akropolis, Weihgeschen-
ke 350
Kanne, rotfigurige aus 40
Miinzen P4
Parthenon 155
Theseion 154.
Athena siehe Pallas
Attis, Fresko, Palazzo Schi-
fanoja 473
Attribute
Ausdrucksmittel desFest-
zuges 258. 281 ff. 292.
294417f432f.436.641
Charakterisierende Funk-
tion 257. 276f. 278.
28off. 294 396-410
passim. 416. 431. 433
436. 585. 627.
Dynamisierende Funk-
tion siehe Beiwerk, be-
wegtes
Erstarrung und Wieder-
belebung 363. 453.
463f. 470. 472f. 478.
507. 530. 627f. 631
Auftraggeber, Kiinstler und,
siehe Portrat (Bedeutung),
Sammler
Augsburg
Dmckort des Astrolabi-
um Planum 465. 516.
562
Register
Augsburg
Humanism us 4S6. 491 f.
646
Planeten an Hauserfassa-
den 4S6. 563. 565. 646
Augustin us
FreskoBotticellis 212. 3S1
Kybele, iiber 473 641
Augustus
Fresko Ghirlandajos in
Sta. Trinita I s6
Melanchthon iiber 529
Weihnachtslegende, in
der 156. 362. 363
Aumale, SammlungdesHer-
zogs von, siehe Chantilly
Ausonius
Musen und Planeten 413 f.
Occasio-Epigramm 151.
35S. 360
Vorbild Petrarcas 183.
369
Austausch
Humanistischer Bildung
454 485f. 497ff. 514.
526. 654
Internationale \Vander-
wege siehe Antike (Ober-
lieferungsformen), Me-
dici (Bankhaus)
Kiinstlerischer Kultur
85ff. 104. u6. 175.
179f. x8off. 187ff. 2oiff.
204. 209ff. 215 f. 219.
223. 229. 248f. 331. 336.
345 370{{. 373f. 376f.
38If. 445ff. 449 454
46If. 477485 f. 507.52 I.
645
Austria, Giovanna d' siehe
Johanna von Llsterreich
Auvergne, Aigueperse 219
Avenarius, Abraham siehe
Ibn Esra
Avignon
Berchorius in 627
Lorenzo Strozzi in 161
Sassetti in 130. 353
Avogaro, Pietro Bono, Hof-
astrologe der Este 474
642
Avveduto, Bartolomeo dell'
Personlichkeit II2. 125.
345 351 f.
Avveduto, Libro del Po-
vero, Vorbild fiir den Ci-
riffo Calvaneo 125f. 345
35If.
Babylon, Weissagung durch
Monstra 525. 546
Bacchus
Botticelli, Kupferstich
67. 290
Festwesen 67. 329
Lorenzo 50. 67. 290
Poliziano 7 I3
Bache, Sammlung, New
York, Ghirlandajo-Por-
trait 132
Bankelsanger, volkstiimli-
che Dichtungen der I I Iff.
124ff.
Baerdemaeker, Gillis van,
Bischof von Tournai 236.
238
Baglioni, Astorre, Bluthoch-
zeit zu Perugia 354
Baif, Antoine de
hofischer Dichter 257.392
Reform der Metrik 4I9
Bajazet, Sultan, Alexander
der GroBe und 248. 388
Baldini, Baccio
Beschreibung des Vasari-
schen Festes von I 565:
282. 433
Baldini, Baccio (Anonyme
Florentiner Kupferstiche)
Stil
Abhangigkeit von nor-
dischen Vorbildern86.
179f. 183. 2II f. 331.
338. 368. 477
Antike bei 31. 67. 75
85. 1
7
9. 183. 290.
336ff. 477 644
Bilderkreis der Stiche
72ff. 87. 150. I79
1S1 ff. 2II
Cassonimalerei So
Finiguerra und 71 f. So
Tracht 75 Soff. S4f. S6.
150. 181 f. 644
Werke
Bacchus und Ariadne
67. 290
Hosenkampf 75 So.
I50. 179f. IS2. 368
Baldini, Baccio
Werke
Judith 3 I. S4
Otto-Prints 79ff. 87.
182. 331ff. 338
Planeten S6. II3. I79f.
325f. 338. 414 477
644. 646
Propheten 179
Quaresima 2II
Rache an Amor I S2 f.
Segelfortuna 150
Sibyllen 179
Theseus und Ariadne
31. 85. 337
Trionfi 150. 1S7f.
Baldinucci, Filippo
Buontalenti, iiber 266.
Cioli, tiber 396
Intermedien von 1585:
319
Intermedien von 1589:
262
Vocabolario Toscano
(Wachsvoti) 350
Baldovinetti, Alessio, Leh-
rer Ghirlandajos 114
Baldovini, Baldovino di
Domenico, Notar, inVer-
bind. m. Sassetti I34 137
Ballett siehe Tanz
Bandini Baroncelli, Wap-
pen 202
Bandini, Bernardo, Pazzi-
verschworer 39I
Barbados, Briefmarke von
25S. 393
Barcelona
B.>tticelli-Cassone 135
Lorenzo Strozzi in 161
Bardi, Kapelle siehe Flo-
renz, Santa Croce
Bardi, Giovanni de'
Biographie
Dichter der Gesange in
den Intermedien I 589:
272. 410. 423
Schriftsteller 269
Theatralische Idee und
Auffiihrung 15S9:
261 ff. 269ff. 276 ff.
28off. 294f. 395 398
bis 409 passim 410.
424ff. 429. 430
Bardi, Giovanni de'
Biographie
"Obersiedelung nach
Rom 295.437
Vorsitzender der Cru-
sca 428
Ideen
Anteil an der Musik-
reform 263ff. 265.
26gff. znf. 283ff.
294 424. 433f.
Harmonie 27of. 414
429
Necessitas 271 ff. 429f.
Parzen 271 ff. 429f.
Planeten 273. 277
418. 430f.
Pythonkampf 283.
286ff. 294. 410. 418.
434
Sirenen 271 ff. 429
Spharenharmonie
270ff. 294 424 429.
436
Sternentanz 277. 418.
430f.
Quell en
Horaz 28o
Patrizzi 270. 412
Plato 269. 271 f.
Werke
,L' Amico Fido" 263.
4
2
4
,Discorso sopra il giuo-
co del Calcio" 394
,Discorso sopra Ia mu-
sica" 265.270.414.425
Bargagli, Girolamo, ,La
Pellegrin a'', Comodie
1589: 261. 267. 423
Bargello, siehe Florenz
(Sammlungen)
Baroncelli
Maria siehe Bonciani,
Maria
Maria nei Portinari
Heirat 197. 377.
Portraits 198. 209
Niccolo, Wachsvoto-
plastiker 350
Pierantonio, Portrait
202f. 210. 379
Fiero, Genf 379
Bartoli, Maria, Schwester
Filippo Sassettis 129
Bartolini-Salimbeni,Lionar-
do, Auftraggeber Filip-
po Lippis 319
Bartolomeo, .,Compare del-
la viola" 112. 125f. 345
351 f.
Bartholomaeus Coloniensis,
Canones, Holzschnitt 652
Basel, Papst Felix V. in
227
Basinius Parmensis, He-
speriden 327
Bate, Henricus, Auftragge-
ber der Abu Ma 'schar-
"Obersetzung 466
Bates, Katherine, im Chap-
Book, 572
Bauern
Breughel, bei 229
Teppichmotiv 206. 224ff.
227f. 229. 383. 387
Baumgartner, Hieronymus,
Brief Melanchthons an
496
Bayonne, Festlichkeiten
1565: 257f. 392 f.
Beatrice
Dante und so. 65. 326
Lionardo, Zeichnung 51
Beardsley, Aubrey, im Chap-
Book 572
Beaune, ,Jiingstes Ge-
richt" 228
Bechi, Gentile de', Lehrer
Lorenzos 120
Beiwerk, bewegtes
Bilddarstellung
Bilderchronik 7 5
Botticelli siehe Botti-
celli (Nympha)
Duccio, Agostino di
12. 308.
Ghirlandajo 152. 156f.
Holzschnitt Hypnero-
tomachia I 8 f.
Lionardo 52
Theater 36. 29off. 436
Tornabuoni-Medaillen
30
Darstellungsmittel (Haar
und Gewand) siehe
Nympha, Tracht al-
l'antica
Beiwerk, bewegtes
Funktion
Register
Ausdruck der Bewe-
gung 5 22. 54. s8.
66. 313ff. 363. 436.
461. s8s
Kennzeichen der Anti-
ke 5 14ff. 18. 2If.
30. 38. 52. 54f. 66.
75 86. 149. 289ff.
292. 310. 313ff. 336.
435. 461. 477
,,Richtungsschmuck''
292. 436
Literatur
Alberti II. 13. 27. 149
292
Bacchi 313
Bonifaccio 313f.
Claudian 14ff.
Ovid 14ff. 32f. 65
Polizian 9f. 13ff. 16.
22. 25. 33 f. II2
Pontanus 313
Vergil 3of.
Vergilkommentare 313
Belardi, Oreto, Theater-
schneider 1589: 268 ff.
277 ff. 428. 431
Bellincioni, Bernardo, Rime
324f. 326. 346
Bellini, Jacopo, Skizzen-
buch 29. 412
Beltramini, Girolamo di
Gio. da Colle, Notar Ta-
nis 194
Benacci, Vittorio, Beschrei-
bung der Feste von 1589:
261. 297 394
Benci, Amerigo, Vertreter
der Medici in Avignon
130
Benecke, Paul, Raub von
Memlings , J iingstem Ge-
richt" 192. 210
Benedikt Biscop, Abt, Reise
nach Rom 439
Benintendi (Familie, Paolo
und Orsino), Verfertiger
von Wachsvoti 99f. u8.
341. 349
Benivieni, Girolamo
Canzone d'Amore 327
Masch us-"Obersetzung 309
Sonette und Eklogen 323
Register
Bentivoglio, Hochzeit 1487:
322.
Bentivoglio, Giovanni, Ge-
vatter von Lucrezia Ar-
dinghellis Sohn 88
Berchorius, Petrus
Brief Petrarcas iiber For-
tuna 358
Gotterbeschreibungen
457 627f.
Graziengruppe 640
Miniaturen 627f.
Ovide moralise, Verhll.lt-
nis 462. 627.
Berlin
Gauricus in 498
Sammlungen
Antiquarium, rotfigu-
rige Kanne 40
Kaiser- Friedrich- Mu-
seum
Altar des Marmion
374
Botticelli, Venus 10
Simonetta-Portraits
(angebliche) 46ff.
Stuckbiiste Lorenzos
99
Kupferstichkabinett
Botticellis Dante-
zeichnungen 50. 67.
644
Breu-Zeichnung 646
Ghirlandajo- Zeich-
nung 303. 343
Handschrift mit Fest-
darstellungen 234.
384
Hausbuchmeister-
Zeichnung 233 ff.
Holzschnitt, Meister
J. B., 36
Horaz-Handschrift29
Kll.stchen mit nor-
wegischem Hasen-
kampf 180
Planeten- Blockbuch
179 (463). 472.
N ationalmuseum
Griindung 191
Staatsbibliothek
Bildnis Carious 532
Codex Pighianus 13.
28. 625
Berlin
Sammlungen
Zebel-Hs. 53If.
Berlinghieri, Hs. der Geo-
grafia, Mailand,Biblioteca
Nazionale 82. 330
Bern,Burgundertapeten188.
228
Beroaldus, Philippus, Be-
schreibungHochzeit 1487:
322.
Bersuire, Pierre siehe Ber-
chorius, Petrus
Bertoldo di Giovanni
Bildhauer des Sassetti-
Grabmals (?) 361
Medaille, Lorenzo-Por-
trait 343
Medaille, Mohammed II.
391
Relief, Kreuzigung 24
Relief, Reiterschlacht 36r
Besteller, EinfluB auf die
Stilbildung, siehe Portrait
(Bedeutung), Sammler
,Bewegtes Leben" siehe
Antike (Wirkungen) ,Fest-
wesen
Bewegung, gesteigerte
Ausdrucksmittel siehe
Antike(Wirkungen),Bei-
werk (Funktion), Nym-
pha, Tracht all'antica
Darstellung bei einzelnen
Kiinstlern siehe Beiwerk
(Bilddarstellung)
Kennzeichen der Antike
5 ro. 14ff. r8f. 22. 24.
30f. 37 52 f. 55 66. 75
84. 86. ll2. r54f. 157f.
175f. 179f. 183. 229.
292. 3r3f-326.330337f.
Kunsttheoretische Be-
deutung 58
Bianchini, Francesco, Tafel
des, siehe Tabula Bian-
chini
Bibara, Edelknabe Maxi-
milians 237
Bibbiena, Fiero, Brief Mat-
teo Frances an 106. 122
Biblia Pauperum, Typolo-
gie der Kreuzigung 440
Bicci, Neri di, Kartonzeich-
ner 187
Bigordi, Tommaso, Vater
Ghirlandajos, Goldwa-
renmakler 1 14 345
Bilderbogen
Affen und Zipfelmiitzen
369
Hosenkampf 368
Bilderchronik, Florentini-
sche 7rff. 85. r5o. 156.
337
Bilderrl!.tsel im hofischen
Leben 85. 145f. 150. 182.
326. 330. 337
Bildnis siehe Portrait
Bildzauber
Astrologischer523f.526ff.
531. 628
Dante roo
Praxis 34If.
Stifterportraits, durch
roo. r38
Voti, durch 99 100. 138.
346. 53r (siehe auch
Ex-Voto)
Biliotti, Fra Modesto, Chro-
nik, fiber Sassettis Streit
mit den Monchen 137ft
346
Bindaccio da Panzano, in
Genf 379
Bini, Fiero in Brtigge 380
Bini-Pucci, Hochzeitscas-
sone 135. 340. 354
Biringucci, Oreste Vannoc-
ci, "Obersetzung von He-
ro Alexandrinus 266.
426
Bische, Guillaume de, GHiu-
biger Portinaris 201. 379
Blvckbiicher, Planeten 179f.
463. 472.
Blucher, Requisition deut-
scher Bilder in Frank-
reich r91
Boccaccio, Giovanni
Inhalte
Achiil auf Skyros 3 I I
Kybele 64r
Verfolgungsszenen 35
316.
Voti 346
Quellen
Claudian 43
Macrobius 4r4
Ovid 35 642
Boccaccio, Giovanni
Werke
Amorosa Visione 3I I
Dekamerone 364
Genealogia Deorum
3I I. 320. 64I f.
Ninfale Fiesolano 35
289. 3I6
Bocchi, Francesco
Donatello-Traktat 313
Pomona, antike Plastik,
bei 38. JI9f.
Wachsvoti 349
Bodin, Jean, Bildzauber 342
Boethius
Musikthcorie 265. 4I4
Rucellai, bei I47 357
Boethius, Hector, Scotorum
historia, Bildzauber 342
Bologna
Antonio de Monte Ulmo
in 557
Druckort, Papstkatalog
I5I5: 521
Festzug 1490: I5I
Pinacoteca, Bild des Pel-
legrino Tibaldi 41I
Sassettis Freunde in I 3 I
Savonarola in 321
Bona von Savoyen, Po:r-
trlitmedaille 370
Bonamici, Francesco, Brief
Filippo Sassettis an 365
Bonciani, Maria, Portrl!t
202f. 2IO
Bonifaccio, Giovanni tiber
bewegtes Beiwerk 313.
Bonincontri, Lorenzo, Kon-
junktion von 1484: 539.
65Jf.
Bonsignore, Giovanni, Pro-
saversion der Metamor-
phoseD Ovids 33 446.
624 652
Borghesi, Hochzeitsgedicht
fiir Ferdinando I. 297
Borghini
Raffaello, Riposo, tiber
Valerio Cioli 396
Vincenzo, fiber Lorenzo
344
Bosco, Kloster bei Alessan
dria 377
Boston
Chap-Book 57I
Zeitschriften 573
,Boti" siehe Ex-Voto
Botticelli, Sandro
Antike gegenstl!.ndlich
Amor 26
Bacchus 67. 290
Flora 27. 33 38. 41.
65. 319. 325
Friihlingsgottin I6f.
26f. J8f. 45ff. 49
51. J26. 478. 644
Grazien 26ff. 28. 65.
327
Merkur 26. 39f. 320.
325
Pallas 7 23ff. 59 84.
87. 312 339 643
Plane ten, Kupferstiche,
siehe Baldini (Plane-
ten)
Venus 6. IO. 26. 44 so.
63ff. 184. 322. 325ff.
339 478. 644
Zephyr 10.26. 4I. 321.
325. 327
Antike vorbildlich
Friihlingsgottin 38.
Lateinische Quellen309
Lucrez 41 f. 321. 478
,Nympha" 5 22. 26ff.
3
xff.
3
8.
54
. 6
3
. 6
5
ff.
8sff. 1I2. 290. 325.
336ff. 461. 477
Ovid 33 65f. 478
Plato 65. 327. 339 471!.
644
ProportioneD 53f. 66.
68
Vitruv 66
Venus 39 184. JIO.
325f. 453 644
Biographie
Charakterisierung 53.
63
Geburtsdatum 86. 338
Goldschmied 53 86.
183. 338 ..
Stil
Landschaft 53f.
Mitteialteriiche Biid-
tradition I84. 310.
325ff. 453 464. 477f.
Botticelli, Sandro
Stil
Register
Dbergangsstil 74 84.
87. 183339447464.
477f. 644
Werke
Cassone, Nastagio degli
Onesti 135 340. 354
Fresken
Ognissanti 212. 381
Sixtinische Kapelle
63. 66 ff. 290
Villa Lemmi 28 f. 39
312
Kupferstiche
Bacchus und Ariad-
ne 67. 290
.,Otto-Prints" 86.
3 3 1 ~ 338f.
Kalender siehe Bal-
dini (Planeten)
Portrl!.ts 25. 46ff. 53
Tafelbilder
.,Magnifikat" 63.
Venusbilder, Florenz
6ff. 10. 16f. 26ff.
31i. 38if. 44ff. 65.
87. 184. 309. 310.
325ff. 478- 644
Venus, Berlin 10
Zeichnungen
Chantilly (Werk-
statt) 19
Danteillustrationen
so. 67- 317- 644
Fruchtbarkeit 65.
Giuliano vor Pallas
2Jff.
Nymphe des Ache-
lous 65.
Zeitgenossen
Alberti II ff. 27f. 308
Filippino 67
Lippi, Fra Filippo 64
Lionardo 52
Polizian und 7 10. 17.
22. 23ff. 33 35 41 ff.
45. 54 65. 87. 309.
321. 339 447 478
Urteil fiber 68
Boudins, Christophorus,
Rechtsstreit Portinari 373
.tiourbon, Herzogin von,
Geschenk Philipps des
Guten an 225
Register
Bourbons, Peintre des 220
Bradley, Anzeigen im Chap-
Book 572
Brant, Sebastian, Monstra
522. 524.
Brantome, Pierre de Bour-
deille, Seigneur de, Fest
von 1565: 392
Braunschweig, Planeten an
der Hausfassade in 454
4
86. 507. 563. 646
Brera, Galleria di siehe Mai-
land
Breslau, Stadtbibliothek,
Hs. des Thomas von Can-
timpre 439.
Breu, Jorg, Maler der Fug-
gerhaus-Fresken ( 1) 646
Breughel
Jan, Darsteller von Ban-
ern 229
Peter, Kaufmann und
Affen, Stich 369
Briefmarke als Ausdrucks-
symbol 258. 393
British Museum siehe Lon-
don
Brito, Jean, Drucker der
.,Payse" 238. 385
Bronzino-Allori, Alessandro
Portrat Giulianos di Lo-
renzo 104
Beteiligung an den Fe-
sten 1589: 408
J iingstes Gericht, Flo-
renz, SS. Annunziata
599
Brown, Alice, im Chap-Book
572
Briigge
Amolfini in 189
Baroncelli in 202 f.
Druckort von Jean Bri-
tos .. Payse" 238
Export nordischer Kunst-
erzeugnisse nach Italien
181. 189f. 204.210. 373f.
Filiale der Medici 13of.
190. 2ooff. 202f. 372.
375f. 38o
Filiale der Pazzi 202.
Florentiner Gesellschaft
189ff. 202ff.
Friedensbankett Maximi-
lians 237.
Briigge
Gefangenschaft Maximi-
lians 235 ff.
Grabdenkmaler mit Wap-
pen 595
Grande Place 235. 239
Hof Karls des Ktihnen
181. 189. 203. 2 4 8 ~ .
Kirche von Sankt Dona-
tian 236.
Lievin, Teppichweber,
aus 187
Portinari in 192f. 200.
203. 371 f. 377.
Strozzi, Lorenzo, in 161 f.
204. 346
Tani in 190. 193 375.
Teppiche, Petrarca-Dar-
stellungen 187
Transport von Memlings
.,Jtingstem Gericht"
nach Florenz 192
Wohn- und Geschafts-
haus der Medici 200
Briissel
Archiv, Fillastre-Urkun-
den 374
Bibliotheque Royale,
Chroniques de Hainaut-
Hs. 628
Festlichkeiten 1496: 234
Stadthaus, Gerechtig-
keitsbilder Rogers 228
Teppichweberei 257.
Brunellesco, Filippo
Alberti und 12
Theatermaschinen (nach
Vasari) 395
Bruni, Leonardo
Hyrnne an Venus 327.
Platon-"Obersetzung 327
Buchelius, A., Iter Italicum
(Wachsvoti) 348
Buren, Gerhard von, Druk-
ker in Perugia 485
Bugenhagen, Johann, iiber
N eumondskonstellation
541
Bulgarien, Monstrum in
653
Buondelmonti, Wappen auf
den Otto-Pdnts So. 332
Buondelmonti, Cassandra,
Giovanni de' Medici und
330
Buontalenti, Bernardo
Biographie
Schriftsteller 266f. 426
Theatermaler und In-
genieur 262ff. 265.
395. 424
Theatermaschinen 262.
267. 395 passim 398
bis 409. 423
Vielseitigkeit 266. 426
Zeichnungen
Apollo 267. 284. 411.
427. 434
Arion 268. 294. 41 r. 427
Biihnenbilder 264. 41 r.
424f.
Delphier 267. 284. 289.
427. 434.
Fortuna 411
Harmonia 267. 280 .
427 432
Necessitas 267. 279.
424. 431f.
Parzen 279. 427
Planeten 267. 280. 427.
432
Sirenen 267. z6g. 277f.
427. 429
Theaterfiguren 26rff.
265ff. 269. 277. 279.
284. 289. 4II
"Obereinstimmung mit
der Beschreibung von
1589: 268. 277. 279.
280. 289. 411
Zeichnungsband
der Bibl. Nazionale
266. 268. 277. 279.
411. 423. 426
Burckhardt, Jacob
.,Beitrage zur Kunst-
geschichte von Italien"
93. 187. 189. 209. 211
Brief tiber Botticelli 308
.,Cicerone" 93.
Festwesen, Au.6erung
tiber 37
Flandern-Florenz bei 187.
189. 209. 211
.,Kultur der Renais-
sance" 37 93f. 354
Kunstgeschichte und Kul-
turgeschichte bei 93f.
Portrat, tiber 83 f.
68o
Burgess, Gellet,,. The Lark",
Herausgeber 573ff.
Burgkmair, Hans, Planeten-
holzschnitte 457 486.
507. 646
Burgund
Antike siehe Tracht alia
franzese
Handel siehe Medici
(Bankhaus)
Herzoge siehe Johann
ohne Furcht, Karl der
Kuhne, Philipp der Gute
Hof von I8I. I89. 203.
248. 385
Kulturelle Bedeutung fur
Italien siehe Austausch
Maria von siehe Maria
Stadte siehe einzelne N a-
men
Stilvorbild fur Florenti-
ner Malerei siehe die
unter Flandern ange-
gebenen Hinweise
Bylifelt, Giaches, Assistent
Cavalieris 263. 4Io
Byzanz und das Abendland
248. 254 389. 390f.
Caccini, Giulio
Anteil an der Musik-
reform 263. 295. 395f.
424. 437
Bardis ,.Discorso" 265
Sanger 275. 299. 406
Caephalus, Niccolo da Cor-
reggio 36. 290
Caesar, Julius
Renaissancemedaille 370
Rucellai, bei 357f.
Triumphzug Alfonsos
359f.
Cajazzo, Conte de, Bellin-
donis Ekloge an 324f.
Cambridge Mass. Kupfer-
stiche, Otto-Teller 79 85.
332
Camerarius, Joachim
Briefe Melanchthons an
494 496498. 526. 533f.
539f.
Faust und 533
Horoskop fiir die Welser
533
,Norica" 498
Camerata, Florenz, Musik-
theorie der 262. 277.
283ff. 294f. 395. 414
424. 433 436f. 438
Camilla d' Aragona, Hoch-
zeit 1476: 329. 417
Campeggi, Lorenzo, politi-
sche Tatigkeit 494 538
Campion, Thomas, Sternen-
ballett bei 4 r 8
Cancer siehe Tierkreiszei-
chcn (Krebs)
Caneel, Jan, Brugger Bur-
ger 237. 239
Canigiani, Adoardo, Mit-
glied d. Brugger Filiale 380
Canigiani, Gherardo, Lei-
ter der Filiale in London
200. 374 375f.
Cappello, Bianca, Feste fiir
290. 295 421
Capponi
Francesco, Montughi im
Besitz von I34 144
Violante und Neri, Toch-
ter und Schwiegersohn
Sassettis 131. 141
Capricornus siehe Tierkreis-
zeichen (Steinbock)
Caput Draconis, astrolo-
gische Wirkung 475 480.
642f.
Caracci
Agostino, Stiche nach
den Intermedien von
1589: 266.276. 284. 4Il
424. 426. 434f.
Annibale, Pythonkampf,
Stich 411
Caradosso, Verfolgungs-
szene (Plakette) 36
Cardanus, Hieronymus, tiber
Luthers Geburtstag 503.
543 648
Cardi, Niccolo de', Hoch-
zeitsgedicht fiir Ferdi-
nanda I. 292. 297f.
Carducci, Giosue, Verse auf
ein Ariost-Portrat 325
Careggi, Villa
Botticellis .,Friihling" ge-
malt fiir ( ?) 27
Kunstinventar von 21 I f.
215. 229
Rogers Grablegung in 2I5
Register
Carion, Johann
Astrologie, Stellung zur
497 532.
Bedeutung 532f.
Bildnisse 490. 532
Brief Melanchthons 492 ff.
533f. 536.
,Chronica" 493 495 536f.
Luther tiber 501. 532f.
Melanchthon und 495f.
533
Nativitlit Luthers sod.
Nativitatensammlung
498. 539
Prophezeiung 1524: 510.
649
Wappen 532
Carlyle, Thomas, Zitat 307
Carman, Bliss, Redakteur
des Chap-Book 571f.
Carnesecchi - Filiale in
Briigge 203
Carnesecchi
Francesco, Verlust der
Galeere St. Thomas 192
Vaggia und Antonio, Toch-
ter und Schwiegersohn
Sassettis I 3 I
Caro, Annibale, 'Ober-
setzung des Longus 314f.
Carro siehe Festwesen,
Triumphzug
Cartari, Vincenzo
Apollo 29
Fortuna I49
Horen 17f.
Kybele 641
Necessitas 270. 412
Ovid als Quelle I 7 f.
Cassani
Bedeutung siehe Fest-
wesen (Zubehor)
Inhalt der Darstellung
Aeneis 31. 315
Bilderkreis im allge-
meinen 74.80. 188.333
Festwesen 81. I35 188.
303. 317. 333 340.
374 440
Legende des Nastagio
degli Onesti 135 34of.
354
Orpheus 317. 447
Theriakverkaufer 303.
440
Register
Cassoni
Stil der Darstellung
Antikisierend 31. 74
r88.315. 317. 354447
Kupferstichstil 8o. 333
Realismus 74 8o. 135.
x88. 333 34of. 354 447
Cassoni, Werkstatt-Liefer-
buch 188. 372
Castagno, Andrea del
Abendmahl in Sant' Ap-
pollonia, Florenz 6oo
Dreieinigkeitsfresko, Auf-
deckung 599f. 659
Lederschild mit David-
gestalt 449 625
Castello, Botticellis Venus-
bilder in 6 f. 26
Castiglione,
Baldassare, zensurierte
Ausgabe des .,Corte-
giano" 356
Benedetto, Gedicht tiber
die Ariadne vom Vati-
can 323
Catharina de' Medici
Bildzauber 341
Feste der 258. 392 f.
Nichte: Cristina da Lo-
rena 26Iff. 422
Portrl!.t, Teppich 257
Zusammenkunft von
Bayonne 257. 392
Cattaneo, Simonetta siehe
Simonetta
Catull, Bacchus 67
Cavalcanti, Carlo, Mitglied
der Brugger Filiale 380
Cavalcanti, Guido, und
Dante 326
Cavalieri, Emilio de'
.,Disperazione di Fileno"
296. 422
Intendant fiir die Feste
von 1589: 262ff. 268ff.
300. 395 f. passim 398
bis 409. 424. 427
Komponist 272
Cavallino, Simone, Be-
schreibung der Feste von
1589:261. 28of. 292.297.
422. 432
Ceccherelli, Beschreibung
der Feste von 1567: 265
Cecco d'Ascoli bei Rucellai
357
Celtes, Konrad
Bildung 485
Libri amorum, Diirers Il-
lustrationen 36
Planeten 417
Cennini, Piero, Bericht tiber
das S. Giovanni-Fest von
1475= 322
Cerberus
Biihnenfigur 405
Gafurius 413
Ovide moralise 413
Ceres
Cartari 17.
Manilius 470
Cerretani, Bartolomeo, tiber
Lorenzo 102. 110. 120
Cesarea, Paride da, Pro-
gramm fiir Perugino 323
Cesarone Basso, Schauspie-
ler 1589: 269. 275. 300.
406. 428f.
Cesena, Biblioteca Mala-
testiana, Plutarch-Hs.389
Chalcus, Tristanus, Bericht
tiber die Hochzeit Arago-
na-Sforza 1489: 312
Chantilly
Piero di Cosimo, Portrl!.t
der Simonetta 49
Zeichnung, Botticelli-
schule 19f.
Chap-Books
Bedeutung 571
Geschichte 571 f.
Charolais, Graf von siehe
Karl der Kuhne
Chatelvillain, Herold, Mot-
to 202
Chatsworth siehe Devon-
shire, Herzog von
Chaucer, Geoffrey, Venus
Virgo bei 315.
Chenany, Jeanne de, Frau
Arnolfinis 189
Chevalier du Cygne, Roman
Miniatur 471
Teppich 387
Chiasso Maceregli, heutige
Villa Lemmi 29
Chicago, Chap-Book 571
Chigi, Agostino, Astrologie
51 x. 563. 65o
68I
Chimenti, Maestro, Maler
von Wachsvoti II 7
Chorspiele, antike, in der
Theorie der Renaissance
283ff. 287. 296. 418.
430. 434
Christentum, Antike und,
siehe Antike (Vberliefe-
rungsprozeJ3)
Christian I. von Dl!.nemark,
Wachsvoto II8
Christian II. von Dline-
mark, Melanchthon iiber
494 538
Christine von Lothringen,
Hochzeit 261 ff. 394ff.
422ff.
Christine de Pisan, Minia-
turen zur Epttre d'Othea
36.311. 316
Chronograph von 354, De-
zemberbild 507. 649
Chrysippos bei Seneca 28
Cicero
Fortuna bei 149 357
Nativitl!.t 503. 543
Redewendungen, bei L.o-
renzo 350.
Thalia 413
Cincinnati, Zeitschriften 572
Cinelli-Bocchi tiber Antiken
38
Cinelli, Giovanni, Scrittori
Fiorentini 266
Cini, Francesco, Sternen-
ballett 418
Cintoja, Kirche S. Michele
351
Cioli, Valerio, Beteiligung
an den Festen 1589: 396.
398
Claudian
Boccaccio 43
Bonifaccio 313f.
Polizian 14f. 43
Pontanus 3 13
Reich der Venus 16. 43
Cleve, Geschichte des Hau-
ses 471
Cleves
Johann von, Wappen 386
Philipp von, Burge Maxi-
milians 236f.
Cochin, Filippo Sassetti in
129. 353
682
Cochlaeus, Johannes, Lu-
ther als Monchsprophet
bei sr6
Coligny, Admiral, Bildzau-
ber gegen 341
Colonna, Filippo di Braccio,
Bluthochzeit zu Perugia
3S4
Colonna, Francesco, Ver-
fasser der Hypnerotoma-
chia r8. 342
Comminelli, Ugo, Ptole-
maeushandschriften 366
Compare della Viola, Bl!.n-
kelsanger 112. 124ff. 34S
3srf.
Comus bei Milton 418
Conde, Louis, Prince de,
Bildzauber gegen 341
Contarini, Tommaso, Vene-
zianischer Gesandter in
Florenz 263. 428
Cordatus, Konrad, Brief
Melanchthons an 496
Cordova, Maslama el-Ma-
gritl aus S27
Corella, Fra Domenico,
Theotocon (Wachsvoti)
347.
Corrazza, Bartolomeo del,
Tracht des griechischen
Kaisers 389
Correggio, Niccolo da siehe
Niccolo
Corsi, Jacopo, Anteil an der
Musikreform 295. 437
Corsi, de'
Nera
FrauSassettisr3r. 142f.
Grabmal IS4
Portrllt Ghirlandajo r 34
Simone Besitzer von
Sassettis Haus 132
Corsini, Lena und Luca,
Tochter und Schwieger-
sohn Sassettis I 3 I
Cosimo 1., Granduca di
Toscana
Botticelli-Bilder bei 6.
26. 46
Buontalenti im Dienste
von 266. 426
Hochzeit 278
Memlings Passion bei 377
Cosimo II., Granduca di
Toscana, Hochzeit 360.
410. 4I5
Cosimo III., Granduca di
Toscana, Hochzeit 267
Cnsimo Vecchio de' Medici
Bautatigkeit r67f. 344
366
Careggi 27
Haupt der Firma IJO
Unionskonzil 367
Cossa, Francesco
Brief an Herzog Borso
47S
Maler der drei crsten
Schifanoja-Fresken 469.
477 640
Fredella, Pinacotcca Vati-
cana 472
Cousin, Jean
Liber Fortunae I 49 358
Stiche fiir die Feste IS6S:
392
Craencnburg, Maximilian I.
in der 23sf.
Cranach, Lucas
Holzschnitte zum Passio-
nal Christi und Anti-
christi S2I
Schule, Bildnis Carious
490. S32
Crasso, Leonardo, Heraus-
geber der Hypnerotoma-
chia I8
Cupido Cruciatur siehe
Amor (Bestrafung)
Curtius Rufus, Quintus,
Alexandcrgeschichtc 388
Custos, Raphael, Kupfer-
stich, Fuggcrhl!.user in
Augsburg 646
Cybo, Magdalena und Fran-
cesco, Tochter und
Schwiegersohn Lorenzos
lOS
Cyprian, Ern. Sal., tiber
Luthers Geburtstag so3
Cyriacus von Ancona
1\Iohammcd II. 388
Nachzeichnungen von
Antiken ISS 64S
Reisebeschreibung 390
Roger in Ferrara, tiber
21S. 38rf.
Register
Dame Habonde, Beziehung
zur Venus-Diana 3I6
Dandclot, Fran<;:ois de Colig-
ny, Bildzauber gegen 341
Danhauscr, Peter, .,Arche-
typus Romae triumphan-
tis" 64S
Dante Alighieri
Beatrice so. 6s. 326
Illustrationen Botticellis
so. 67. 317. 644
Kommentar des Landino
6S4
Nachleben bei
Bardi 298
Lorenzo de' 1\Iedici 49
Rucellai 147. 357
Sassetti, Filippo 364
Nympha 420
Primavera 326
Sphaeren 271
Zauberktinste, angebliche
roo
Danzig
Marienkirche,
.,Jtingstes
Memlings
Gericht"
Igoff. 203f. ::Zi:Of. 373
Daphne
Bild
Botticelli 33 f.
Miniatur zu Christine
de Pisan 26. 316
Miniatur zu Petrarcas
Rime 317
Oper 26s. 29S 318. 42S.
437f.
Rappresentazione,siehe
,.Phebe et Phetonte"
Literatur
Chaucer 3I6
Lied 318
Ovid 33 36
Ovide moralise 316
Petrarca 3 I 7
Polizian 7 33 f.
Dares
Miniaturen 3IS
David
Schleudertrager bei Sas-
setti rs2f. 158
Siegergestus bei Polla-
juolo(Castagno)449 62s
Davies, John
Astraea 41S
Tanz, tiber 418
Register
Dei, Benedetto
Florentiner Beziehungen
zu Byzanz 391
Namensliste der Brugger
Florentiner Kolonie 203
Wachsvoti 349
Dekane
Astraler Charakter 46 5 f.
629. 630ff.
AbU Ma 'schar 465. 467.
476. 56If. 629- 63off.
Fontana, Giovanni 63oft.
633.635.636.639
Fresken, Palazzo Schifa-
noja 468. 476. 56If.
629. 63off.
Holzschnitt Astrolabium
Planum 467. 629. 635
Lapidarium Alfonsos 467.
530. 629. 630
Ludovicus de Angulo
630 ff. 633 ff.
Picatrix 629. 630 ff.
Pico della Mirandola 474
Tabula Bianchini 467.
476. 629
'Oberlieferungsgeschichte
465. 63o-639
Varaha Mihira 468
Delos
Pythonkampf nach Bar-
di 288.
T!lnze bei Lukian 418.
420f.
Delphi
Orakel, bei Luther 548
Pythische Spiele 283.
287. 420f. 434
Delpbier
Bardi, bei 287.420.434
Buontalentis Zeichnun-
gen 267. 284. 289. 427.
434.
Kostume 289ff.
Delphin
Festwesen 258. 400. 405.
406
Schonheitslinie 73
Delphos Grunder von Del-
phi 288. 420
Dentice, Luigi, Musiktheo-
rie 265
Deschi da Parto
Trachtenrealismus 188
Deschi da Parto
Triumph der Fama, Lon-
don 82
Despars, Nicolas, Chronik
von Flandern 235
Deutschland, Kunst, siehe
Austausch, Durer, Kalen-
der, Planeten
Devise siehe Motto
Devonshire, Herzog von,
Sammlung, Inigo Jones-
Zeichnungen 418
Diana
Buontalenti 267
Chaucer 315f.
Festwesen 322f.
Nymphen als Begleite-
rinnen 47 66. 290. 322.
418. 435
Venus als 3of. 313ff. 316.
320 (siehe auch Venus
Virgo)
Dionysos (siehe auch
Bacchus)
Apollo und, antike Pola-
ritat 176. 229. 446
Mysterien, Nachleben446
Vase zu Pisa 12
Dioscurides,Kommentardes
Mattioli 440
Dietrich, Veit, Luther an
499
Dolce, Ludovico, .,Aretina"
IO
Dolfin, Zorzo, iiber Moham-
med II. 388
Domenico Veneziano, Trach-
tenrealismus r 88
Domenici, Johannes, For-
tuna bei 151. 361
Dominikaner und Franzis-
kanerinFlorenz1 15.134ff.
137ff. 142. 355f.
Domitian, Munze 157
Donatello,
Antikischer Stil 447
Aposteltiir von S. Lo-
renzo 13
Georgsrelief r 3
Nympha 13. 84. 337
Putten in der Art des
73
Donati, Lucrezia, Lorenzos
Geliebte 82ff. 87. 182.
325. 330. 334ff.
Warburg, Cesammelte Schriften. Bd.2
Donatus, Hieronymus, Brief
Polizians an 126
Dorat, Textbeschreibung
von 1565: 392
Doria-Pamphili, Galleria,
Alexanderteppich 243 ff.
Darius, Tonart 414
Drache Apollos (siehc auch
Pythonkampf)
Buhnenfigur 284ff. 396.
400. 402 ff. 434
Gafurius 413
Zeichnung Buontalentis
267. 284. 434
Dreikopf siehe Signum Tri-
ceps
Dresden
Kupferstichkabinett
Fede:rzeichnung des
Hausbuchmeisters 234
Stich Portrat Leos X.
343
Druckkunst
Amerikanische 571ff.
Astrologie und 462. 472.
477 490f. 507. 509ff.
513. 524f. 563. 649. 652
Beweglichkeit 182. 223.
463. 4 8 ~ 491. 511. 513.
649
Illustrationen siehe die
N amen der einzelnen
Druckwerke, Kunstler
oder Darstellungsobjekte
Politische Bedeutung
siehe Flugblatt, Presse
Traditionsbedeutung 462
472. 49!. 562ff. 645
Dryden, John, Bcschrei-
bung der Kronung Karls
II. 393
Dschelal-ed-Din Rumi,
Spharentanz bei 419f.
Duccio, Agostino di
Antike Vorbilder 12ff. 29.
308. 453
Europaraub, Relief 308f.
Mailand, Brera, Relief 13.
308f.
Perugia, San Bernar-
dino, Fassade 13
Rimini, Tempio Mala-
testiano 12. 29. 271.
453
44
Dtirer, Albrecht
Astrologie 454 526.
529ff. 653
Brief an Pirckheimer 624
Hol2schnitt zu Celtes'
Libri amorum 36
Holzschnitt, Franzosen-
krankheit 524
Holzschnitt, .,Heilige Fa-
milie" 530
Kopien der Tarocchi 457
485. 645.
Kupferstich .,Die Eifer-
sucht" 447 454 461.
624
Kupferstich , , Grol3es
Gliick" 448
Kupferstich ,Melenco-
lia I" 454 524. 526.
528.
Kupferstich, Sau von
Landser 524
Kupferstich, ,Zorn des
Hercules" 447
Mantegna und 44 7
Melanchthon iiber D.'s
Melancholic 529
Monstra bei 524. 653
Pathosstil bei I75 447.
Polizian und 448
Pollaiuolo und 447
Proportionsstudien 448.
624
Tafelbild, ,Herkules und
die Harpy en" 44 7, 624
Vitruv und 448
Volksheimausstellung 591
Zeichnung, ,Tod des Or-
pheus" 37 445ff. 461.
623
Dusseldorf, Historienmale-
rei 582
Duffus, Konig, Bildzauber
gegen 342
Duhem, Petrus, Rechts-
streit Portinari 373
Dyonisii, Johann, Notar im
Rechtsstreit Portinari373
Echecs Amoureux, Roman
Miniaturen 628
Musen 414
Eggen burg
Planeten an einer Haus-
fassade 454 486. 646
Ekkehard, Monch v. St. Gal-
len, tiber Typologie 439.
Ekphrasis
Astrologischer Texte sic-
he Abu Ma 'schar, Deka-
ne, Planeten
Mythographischer Texte
siehe Berchorius, Libel-
Ius de deorum imagini-
bus, Mythographus III
Polizian 7 13ff. 33f. 45
Chaucer 315 f.
Eleonora
von Aragon siehe Leonora
von Toledo, Hochzeit 278
Elfenbeinrelicf, antikcs, Li-
verpool (Hygieia) 39
Elisabeth
von England
Astraca, als 415
Portinari im Dienste
von 379
von Spanicn, Zusammcn-
kunft von Bayonne 257
Elyot, Thomas, tiber Tanz
418
Elysium, Venus im 327
Emailbcchcr, Affen und
Kramer 181. 368
Embleme, siehe Attribute,
Impresen, Wappen
Enea Silvio, siehe Papst
Pius II.
Engel, Johann, Herausge-
ber des Astrolabium Mag-
num 465. 516. 562
England
Feste siehe Festwesen
(geographisch)
Handelsverkehr 192. 200
Handschriften undKunst-
schatze siehe London
und Oxford
Enoch, Finiguerra- Zeich-
nung 72
Epictet beiRucellai 147.357
Epicur bei Rucellai 357
Erasmus von Rotterdam,
Luther-Flugblatt 653
Erfurt, Planeten 563
Eridanus, Sternbild im La-
pidarium des Alfonso 530
Erlangen, Universitatsbib ...
liothek, Zeichnung des
Jost Ammann 368
Register
Eros siehe Amor, Plato-
nismus
Eschatologie
Astrologische siehe Pla-
netenkonjunktionen,
Prophezeihung
Luthers 499 512. 523.
537 545ff. 65of.
Escurial, Bibliothek, Anti-
ken-Zeichnungsband 157.
39I. 625
Este
Bianca, Hochzeit, Fresko,
Schifanoja 474
Borso, KunstamHofevon
463. 474f. 476. 643
Cesare, Hochzeit I 58 5:
26Jff. 319. 424
Ercole, Leonora von Ara-
gon und 475
Ginevra, Gemahlin Sis-
mondo Malatestas 309
Lionello, Planetenfarbige
Kleider 474
Lucrezia, Hochzeit 1487:
322f.
Lucrezia, Hochzeit 1571:
318
Niccolo, Wachsvoti 350
Este-Gonzaga, Isabella,Auf-
traggeberin Peruginos
323
BerichtdesProsperianJI8
Brief Priscianis an 479
Wachsvoto uS. 349
Esther
Gedicht Lucrezia Torna-
buonis III
Teppich aus Tournai 388
Etana und Alexanderlegen-
de 387
Etrusker
Nachlebendes Heidentum
99. roof.
Volumnicrgrab 84. 336f.
Etymologicum Magnum,
Wirkung auf die Theorie
des Tanzes 418
Europa, Raub der
Duccio 3o8f.
Polizian 7 13. 33
Eurydike, Nymphe bei Po-
lizian 33 f. 36
Eva, Finiguerra-Zeichnung
72
Register
Ex-libris
Mtinzels 6oS
Sassettis 15I ff. 36I
Ex-Veto
Antike 99f. n6. II9- 346.
350
Bildzauber 99 100. I 38f.
346ff. 531
Brauch
I talienischergg ff. 204 f.
346ff. 350
Florenz 99. II4.
II6ff. 139.204. 346ff.
349f.
Mantua 349.
Naturalismus 138. 204.
Fabrikation 99. II7f.
IIg. 341. 349
London 350
Stifter, siehe einzelne Na-
men
Stifterbild und 99 Ioo.
138. 158. 194 204 f.
374
Verha.ltnis zum Portra.t,
siehe Bildzauber, Por-
trl!.t (Bedeutung)
Verzeichnisse II8. 347
Eyck, Jan van
Madonna des Kanzlers
Rolin 228.
Genter Altar 225 f.
Portrl!.t Arnolfini I89f.
Facies, Planetarische 629
Fahnen siehe Festwesen
(Zubehiir)
Falconieri (Familie), Ka-
pelle in SS. Annunziata
II6f.
Fane, Carlo da, Grazien-
relief 30
Farnesina, Villa, siehe Rom
Fastnacht siehe Quaresima
Fastnachtsspiel siehe Rap-
presentazioni
Fatum siehe Astrologie,
Fortuna, Prophezeiung
Faunus, Merlin-Roman 316
Faust, Johannes, Astrolo-
gie und Magie 5I2. 532
Fazio degl' Uberti bei
Rucellai 357
Ferdinand, romischer Ko-
nig, Prophezeiung'iiber 494
Ferdinanda I., Granduca di
Toscana
Briefe Filippo Sassettis
an 353
Briefe Serjacopis an
396f.
Buontalenti im Dienste
von 266. 426
Hochzeitsfest 261 ff.394fi.
422ff.
Ferdinanda d'Aragona, Ho-
razhandschrift fiir 29.
Ferrara
Astrologie 474. 479.
6301.
Auffiihrung des ,Cae-
phalo" von Niccolo da
Correggio 36
Flandrische Malerei 189.
215
Flandrische Teppichwe-
berei 187. 229. 383
Florentinische Wachsvo-
toplastik 350
Franzosische Literatur
471
Karneval 1506: 318
Medailleur Lodovico in
370
Palazzo Schifanoja, Fres-
ken, siehe Schifanoja
Polizians Orpheus fiir den
Hof von 113
Savonarolas Heimat 32 I
Unionskonzil von 1439:
254
Universita.t, Astronomie-
professuren 474
Festwesen
Antike im 24. 36. 48.
sr f. 59 66f. 74f. 85
IIIf. 156. I82. 257.
263ff. 26gff. 275. 281ff.
283ff. 287. 295. 303.
3I8. 321 f. 359f. 363.
396. 432 ff. 436ff. 440.
446. 643
Bedeutung, kulturwissen-
schaftliche, siehe Anti-
ke (Oberlieferungsfor-
men)
Anll!.sse I
Entrees 203. 234. 290.
322. 384
Festwesen
AnHI.sse
685
Hochzeiten 150. I8off.
203. 261 ff. 263 f. 3 I I f.
3I8f. 322f. 329. 340.
345 354 360. 369.
372- 378. 393 410.
4I5. 417- 421. 433
474 641
J ohannestag (in Flo-
renz) 48. 303. 322.
363. 440
Karneval 318. 393
Weibnachten 153. I56.
322. 362.
Bilddarstellung
Cassani Sr. 135. r88.
303- 317- 333 340-
Deschi da Parte I 88
Fresken 303. 440. 474
Handschriften 234 384
Holzschnitte 24 f. 36.
II2. 124f. 415. 446
Kupferstiche3767. 83.
85. 150. 18off. 182f.
266. 276. 284. 298.
360. 392- 394 403.
411. 424- 426. 434f.
440
Majolika und Email37
181
Teppiche 188. 257. 392
Zeichnungen 24. 36.
5If. 74f. 262ff. 267f.
282. 284. 411. 418.
424- 426. 434.
Form en
Balletts 418.
Calcic 261 f. 394 423
Edifizi 48. 156. 363
Giostren 17. 23fi.45 48.
51. 59 65. 75 s2 tf.
Ssff. II2. 188. 257f.
261. 326. 335 339
344 35rf. 374. 394
421. 423- 643
Intermedien siehe diese
,Macchine" 262. 396.
passim 398-409. 423
Mascherate 83f. 262.
281ff. 342. 392. 423.
433
Rappresentazioni siebe
diese
44*
686
Festwesen
Form en
Tanz 83. 8sff. 18off.
283. 287. 295 303.
318. 331. 337 417ff.
434 437
Theater siehe dieses
Triumphzug 66. 74
Ijl. 188. 203. 281 f.
294 321. 322f. 359f.
410. 417. 432ff. 436.
463. 641
Wasserfeste 258. 261 f.
423
Geographisch
Burgundisch 18off.203.
234 369378.384
Englisch 258. 342. 393
415 f. 417. 418
Florentinisch 83 f. 85 ff.
I II. IIj. 182 f. 203 f.
2j8. 261 f. 281 f. 322.
326. 342. 344 360.
363. 395ff. 415. 417.
418. 423ff. 426f. 440
Franzosisch 257f. 392.
Motive
Apollo (Sol) 36f. 264.
276. 282 f. 284. 287.
295 298. 400. 402.
403. 411. 419. 421.
425. 433. 437
Bacchus 66f. 290. 329
Diana 322
Fortuna 150.359. 4II
Komische 83 f. 85 ff.
18off. 318. 369
Kybele 641
Meergotter und -unge-
heuer 258. 268. 393
400. 427
Musen 48. 257. 264.
267. 292. 298. 411.
425
Nympha 36. 48. 5rf.
83 f. 85 f. 182 f. 278 ff.
289ff. 292. 317ff. 322.
418. 435f. 446{.
Orpheus 33 36. 1I3.
290. 318. 446f. 624
Pallas 24. 59. 84. 264.
312. 326. 425 643
Planeten 273. 275.
277 398. 400. 402.
405. 406. 417. 421
Festwesen
Motive
Sirenen 258. 269. 271 ff.
275 277ff. 292. 393
398. 429. 430f.
Tugenden und Heroen
257 274 276. 322f.
393 398. 416. 430
Venus 322
Verfolgungsszenen
33ff. 36f. 317.
Zubehor
GerM 24f. 59 75
79. 83. 85. 112ff.
ljO. 182. 188. 203.
257f. 3Ilf. 326. 331.
333 339 374. 392f.
507. 584. 643
Kleidung siehe Tracht
Festzug siehe Triumphzug
Fetisch und Wachsvoti 100
Feuerbach, Anselm, Nea-
pel, Fresken 583
Fichard, Johannes, Iter Ita-
licum (Wachsvoti) 348
Ficino, Marsilio
Fortuna, tiber 147. 356
Freund Sassettis 133. 139
Griindung der Florenti-
ner Akademie 367
Magie 327. 527f. 529.
531
Melancholie, tiber 526ff.
530
Werke
Brief an Rucellai 146.
356
Brief an Sassetti I 39
Brief an seine Ge-
schwister 351
De Vita Triplici 526ff.
529f. 531
Kommentar zu Platos
Ion 414
'Obersetzung der Ho-
merischen Hymnen
308. 327
Vorwort zum Platon-
Kommentar 367
Fiesole, Sassettis Kapellen-
bau 134
Figdor, Sammlung, \Vien
Liebeskll.stchen 83
Otto-Teller 79.
Filarete
Antike bei 21 f.
Voti, tiber 347
Register
Fileno, Disperazione di,
Zeichnungen 296
Filippino Lippi
Bewegungsstil 461
Botticclli und 67 f.
Laokoon, Zeichnung
67.
Portr1i.t Pulcis, Sta. Mar-
del Carmine 107
Rotte Korah, Zeichnung
67f.
Zeitgenossisches Urteil
tiber 68
Schule Antiker Nach-
zeichnung 310
Fillastre, Guillaume, Auf-
traggeber italienischer
Kiinstler 373 f.
Finiguerra, Antonio, Lehrer
Botticellis in der Gold-
schmiedekunst 86. 338.
Finiguerra, Maso
Baccio Baldini und 71.
338
Bilderchronik 71 ff. 337
Goldschmiedearbeit 72 ff.
84. 336
Intarsia, in der Florenti-
ner Domsakristei 72
Fiore und Biancifiore,
Holzschnitt zur Ausgabe
Erlangen 322
Firmicus Maternus, Ver-
haltnis zu Manilius 628
Firminus Bcllovallensis
bei Lichtenberger 557
6j6
Fischart, Johannnes, tiber
Impresen 331
Fische, symbolische Bedeu-
tung 238
FixsternesieheDekane, Par-
anatellonta, Tierkreis-
zeichen
Flandern
Antike siehe Karl der
Kuhne, Tracht alia
franzese
Handel siehe Austausch,
Medici (Bankhaus)
Kiinstler siehe einzelne
Namen
Register
Flandern
Kunst siehe Andachts-
bild, Antike (Oberliefe-
rungsprozeB) ,Austausch,
Baldini, Panno, Portrat,
Roger van der Weyden,
Sammler, Teppich,
Tracht alia franzese
Stadte siehe einzelne Na-
men
Weberei siehe Teppich,
Tracht alla franzese
Flora
Accajuoli, Zanobio 41
Alamanni, Luigi 19
Antike Plastik (Hore) 38.
319
Botticelli 26. 33 38. 41.
65. 319. 325.
Cartari 18
Lorenzo de' Medici 43.326
Lucrez 41. 321
Ovid, Fasten 32. 65
Polizian 42. 65
Pulci 326
Florenz,
Archive
Archivescovile 351
Rucellai 146ff. 326
Strozzi 88
Archivio di Stato
Bedeutung 96
Briefe, Med. av. il Prin-
cipato 85. 125. 151.
193 199 201. 210.
311. 347 352- 354
371 ff. 375f. 377f.
Geschaftskontrakte der
Medici 151. 193. 199.
200. 210. 375.
Hofpapiere Ferdi-
nands I. 263. 266.
268. 275 298. 395f.
410. 426f.
Notariatsakten 97 136.
192- 201
Sassetti-Urkunden107.
130. 131. 133 135 bis
138. 140. 144 355f.
SerjacopisMemorie und
Briefe 395 ff.
SteuererkH!.rungen 87.
88. I14. 133 149
167f. 194 196. 209f.
335
Florenz
Archivio di Stato
Totenbiicher 131. 194
Voti-Urkunden II6.
117. II8
Bibliotheken
Laurenziana
Gedichte Lorenzos,
Hs. 10. 3II
Hss. Sassettis 134.
153 f. 354 362
Marucelliana, Kupfer-
stiche d. Biihnenbilder
von 1589: 266. 298.
Nazionale
BriefeFicinos35 I .356
Buontalenti-Zeich-
nungsband 266ff.
411. 426ff.
Cassoni-Lieferbuch
188
Del Migliores Wap-
penbuch 193
Gabella dei Contrat-
ti (Del Migliore)131.
193 197 202. 210.
Hochzeitsbeschrei-
bungen 1589: 297f.
Kupferstich Rucellai
150
LokalhistorischeHss.
JI6f. 120. 167. 193
266
Rucellais Zibaldone,
Auszug 147 357
Vasari-Zeichnungs-
band 282
Riccardi ana
Dares-Hs. 313. 315
Familiengeschichte
Portinari 197
Ficino-Briefe 356
.,Imprese" des Filip-
po Sassetti, Hs. 152
Vergil-Hs. 315
Gebaude
Battistero, Wachsbil-
der 350
Dom siehe Santa Ma-
ria del Fiore
Ognissanti, Fresken
212. 381
Or San Michele
Georgsrelief 13
vVachsvoti n6
Florenz
Gebaude
Palazzo Guadagni,
Kunsthistorisches In-
stitut 6o3 f.
Palazzo Medici
Baubeginn 167.
Fresken 82. 162. 211.
229. 389
Palazzo Montalvo, Sar-
kophag 155
Palazzo Riccardi siehe
Palazzo Medici
Palazzo Rucellai, Fas-
sade 149
Palazzo Strozzi 163
Palazzo Vecchio
Dekoration 59
Fresken Ghirianda-
jos 212
Fresken Stradanos
303. 440
San Lorenzo
A posteltiir 13
Kuppel in der Sa-
kristei 171 f. 366.
San Marco, Kloster-
bibliothek 353
San Michele Berteldi,
Priorat Federigo Sas-
settis 98. 144
San Pancrazio, Capp.
del San Sepolcro 330
Santa Croce
Giotto-Fresken 96.g8
Pazzikapelle 367
Wappen 202
Santa Maria del Car-
mine
Filippino-Fresken
107
Masaccio-Fresko 390
Santa Maria del Fiore,
Sakristei, Intarsien 72
Santa Maria Novella
Cappella del Pelle-
grino 142
Capella Spagnuoli
136
Capella Tornabuoni
134
Fassade 149. 330.
363
G hirlanda jo-Fresken
103. 134 157f. 290
688
Florenz
Gebll.ude
Santa Maria Novella
Grabstatten der Sas-
setti 142. 355
Hochaltarbild von
Ugolino da Siena
136. 354
Masaccios Trinita 6oo
Santa Maria Nuova,
Flandrische Bilder in
193. 197. zoiff. zro
Santa Riparata siehe
Santa Maria del Fiore
Santa Trinita
Cappella Petriboni
138
Capella Sassetti r 52 f.
154. 156ff. 344 355
Cappella Scali 143.
355
Ghirlanda jo-Fresken
96ff. II4f. 134.
138f. 152f. 158.
303. 340. 344 36If.
Sasscttis Tlttigkeit
ftiri34I37Z05344
SantissimaAnnunziata,
Castagno-Fresko 599.
Sammlungen
Bargello
Bleimedaille Leos X.
104
Cassone mit Theriak-
verkaufer 303
Relief Bertoldos,
Kreuzigung 24
Relief Bertoldos,Rei-
terschlacht 361
Tornabuoni-Medail-
len 29ff. 39
Casa Horne, Zeichnung
zum Arion von 1589:
411
Gabinetto delle Stampe
Botticelli-Zeichnung
23
Buontalenti- Zeich-
nung 264
Filippino-Zeichnung
67f.
Kupfcrstich Quare-
sima 21 r. 381
Vasari-Zeichnungen
z8z
Florenz
Sammlungcn
Gaddi (Ende des 15.
Jahrhunderts) 39
Musco Castagno
Abendmahl 6oo
Museo Nazionale siehe
Bargello
Palazzo Pitti, Filippo
Lippis Tondo 319
Uffizien
Botticellibilder siehe
Botticelli
Bronzino-PortrM 104
Brtisseler Bildteppi-
che 257.
Hare, antike Plastik
38
Hugo van der Goes,
Anbetung der Hir-
ten 197.205. 209f.
Memling-Portrats
zoif. zro
Niobidengruppe 625
Portrats aus dem
Besitz des Giovio
10
4 344
Roger van der Wey-
den 197 211. 215.
382
Saal der Flandrer
203. 209
Tanzerinnen, antikes
Relief 28
Thebais 2II
Stadtanlage, alte
Brie Francos tiber
106. 122
Kirchsprengel Santa
Margherita 198. 209
Loggia dei Lanzi 97.
I 15. 408
Palazzo Medici und
Umgebung r67. 366
Palazzo Pitti z6r f. 366.
423
Palazzo Vecchio 97
115. 399
Piazza della Signa ria 97
Plan vom Jahre r 4 72 :
r68
San Michele Berte!di
98. 144
San Piero Scheraggio
399 408
Register
Florenz
Alte Stadtanlage
Santa Maria del Fiore
195.
Santa Maria Novella
83. 135. qzf. 336.
355
Santa Maria Nuova,
Spitalgrtindung Por-
tinari zor. 203
Santissima Annunzia-
ta 99. u6ff. 139.
204. 346ff. 350
Sassettis Hauser 132.
143
Teppiche ftir die Rin-
ghiera der Signoria
187
Uffizien, Theatersaal
267
Verini's ,.Illustratio"
134 145
Flugblatt
Hausbuchmeisterzeich-
nung 238.
Hosenkampf 368
Monstrum 522. 524. 649
Politische 522. 524. 649.
653
Fontaine, Antoine de, tiber
Maximilians Gefangen-
schaft 235
Fontainebleau, Kameval in
393
Fontana, Giovanni, Dekane
63off. 633. 635 636. 639
Fonzio, Bartolomeo
Freund Sassettis 133. 143.
155 354
.. Saxettus" 138.
Fortuna
Antike
Gottin 149. 356. 358.
Vorbild, ktinstlerisches
149
Bedeutung
Ausgleichssymbol 141.
145. 158. 356f. 36o.
364
Kaufmannssymbol 149
151. 357 364.
Machtsymbol 151. 359f.
364. 391
Windkraft 148. 151.
356. 357 360. 364.
Register
Fortuna
Bilddarstellung
Buchillustration 358.
360
Kupferstich 150
Medaille 365
Relief 146. 149
Zeichnung 4II
Literatur
Alfonso von Aragon
ISL 359.
Enea Silvio 359. 391
Ficino 147f.
Macchiavelli 364
Petrarca 357 358
Rucellai 146 ff. 356 ff.
Salutati 151. 36off.
Sassetti, Filippo 364
Sassetti, Francesco
141 ff. 145. 158. 364
Typen
Audax 149. 358
Fiillhorntrll.gerin 390.
41I
Occasio rsof. 358.
Raddrehend 357 360
Schopf, mit rsof. 358.
359 360. 364. 365.
39Qf.
Segel, mit 75 146ff.
330. 360. 364. 365
Verwendung
Festwesen 151. 359f.
411
Helmzier 146
Impresa 145. 149f.
330
France, Anatole, im Chap-
Book 572
Francesca, Fiero della, siehe
Fiero
Francesco da Hollanda tiber
Michelangelo 206
Francesco Giovanni siehe
Francione
Francesco, Maestro, Bild-
ner von \Vachsvoti 117
Francesco 1., Granduca di
Toscana
Buontalenti im Dienste
von 266. 426
Hochzeit 267. 282. 295.
421. 433
Francesco Maria d'Urbino,
Hochzeit 1571: 318
Franchi, Rosello di J acopo,
Cassone 440
Francione, Francesco Gio-
vanni, Lehrer des Pon-
telli 59
Franciosini, Musikerfamilie
274 276. 406
Franciosino, Bernardo, Mu-
siker am Hofe Ferdi-
nands I. 274f. 299
Franco, Matteo
Brief an Bibbiena 106.
122
Lorenzo und 105ff. III.
121. 345
Maddalena Cybo, bei
ros. 120. 345
Portriit, Ghirlandajo
lOS f.
Polizian tiber ros. 121
Pulci und ros. 108. 345
Sonette ro8
Frankfurt a. M.
Staedelsche Galerie, Si-
monetta-Portrll.t (angeb-
lich) 46 ff. 53
Universitll.t 6r7ff.
Frankreich
Beziehungen, verwandt-
schaftliche, zu Florenz
257 f. 261 ff.
Ghirlandajo, Benedetto,
in 219
Politik Catherina Medi-
cis 257
Reformation des Musik-
dramas 258. 392. 419
Franz, Herzog von Bre-
tagne, und Pierantonio
Baroncelli 202
Franziskaner und Domini-
kaner, Gegensll.tzlichkeit
II5. 134ff. 137ff. 142 f.
355.
Franziskus von Assisi
Giottos Fresken g6f. g8.
362
Ghirlandajos Fresken
siehe Ghirlandajo
Lichtenberger, bei 555
Patron des Sassetti 97
II5. 137. 155 362
Franzosenkrankheit, astro-
logische Verursachung
523. 524. 6so
Freiburg, Munster, Alexau-
derfries 386
Frescobaldi (Firma)
Filiale in Briigge 203
Gliiubiger Portinaris in
Briigge 201
Frescobaldi, Fortuna-Son-
nett, 150.
Fresken siehe die Stll.dte-
namen
Frezzi, Federico, Quadrire-
gio 271. 317. 415
Friedrich der Weise
Spalatin und 513
Zeichen beim Tode von
522
Friedrich III., Zusammen-
kunft mit Karl dem Kiih-
nen 248. 388
Froissart tiber Bajazet 388
Friihling
Acciajuoli, Zanobio 41
Alamanni, Luigi 19
Cartari 17f.
Festwesen 319
Hypnerotomachia Polifili
r8f.
Jonson, Ben 323.
Lucrez 41. 321
Friihlingsgottin
Botticelli r6f. 26ff. 38.
45ff. 49 51. 326. 478.
644
Polizian 16. 45 ff.
Simonetta als 45ff. 49
325
Verkorperung der Gelieb-
ten 321 f. 323 f. 325 f.
FruoxinodaPanzano, Tuch-
empfll.nger beim Tode Co-
simos 371
Fruoxino (de' Pazzi ?), Brief
an Giovanni Medici 187.
371
Fulgentius, vermeintliche
QuelleBotticellis 309
Fulgentius Metaforalis,
Illustration 3 ro
Gabrielli, Cleofe, Hofisch-
mythologisierende Dich-
tung 643
Gaci, Cosimo, Beschreibung
des Festes von 1579:
421
6go
Gaddi, Sammlung, Florenz,
antikes Elfenbeinrelief 39
Gafurius, Franchinus
Aufbau des Kosmos 271.
412 ff.
Distichen 413
Grazien 640
Holzschnitt, Sph:l.renkos-
mos 271. 412. 429f.
Gagliano, Marco da, Vor-
rede zur Daphne des Ri-
nuccini 295 421. 437
Galathea, Polizians Giostra
7
Galeere St. Thomas, Trans-
port vonMemlings,. J ling-
stem Gericht" 191 f. 200.
210. 373
Galenus, Theriakrezept 440
Galilei, Vincenzo, Anteil an
der Florentiner Musik-
reform 263. 270. 424
Gallenstorfer, Sebald, Holz-
schneider 645
Gallienq, Sticker des Fiero
di Lorenzo 3IIf.
Galliot du Pre, Holzschnitt,
Segelsymbol 360
Galvano da Milano, Holz-
schnitt zur Ausgabe von
Fossa 321
Ganymed, verst;rnt 642
Garcaeus, Johannes
Astrologiestreit 512
Luthers Geburtstag 503
Garzoni, Tommaso, tiber
Theriakverkaufer 303 .404
Gassendi, Pierre, tiber
Luthers Horoskop 648
Gauricus, Lucas
Melanchthon tiber 498.
539
Nativitat Luthers 497
499ff. 503. 51J. 517f.
543 647f.
Nativitatensammlung
498. 539
Verhaltnis zu Lichten-
berger 517 f.
Verhaltnis zu Paulus von
Middelburg 517f.
Gaye, Giovanni
, ,Laokoon' '-Fundbericht
367
Serjacopi 394
Gebardensprache, siehe An-
tike (Ausdruckssteige-
rung)
Geburtstag
Luthers 497. 499ff. 504.
515. 518. 542ff. 564.
647.
Mythos und 648
Geburtssteller, siehe Desco
da Parto
Gehrts, Carl, Fresken im
Hamburger Rathause 584
Geldern, Herzogin von, Ge-
schenk Philipps des Gu-
ten an 225
Gemini, siehe Tierkreiszei-
chen (Zwillinge)
Genf
Florentiner Kaufleute in
379
Sassettis Bautiitigkeit in
133 353
Genga, Girolamo, Bestra-
fung Amors, London 183.
369
Genoveva, Fresko von Puvis
de Chavannes 584
Gent
Altar der van Eyck 225f.
Drucker Arnold de Key-
ser 385
Entree 1582, Hs. 384
Philipp von Cleve, Bilr-
ge Maximilians 236.
Gentile de' Bechi, Lehrer
Lorenzos 120
Gentile da Fabriano, Genre-
malerei 188
Genua
Geburtsort der Simo-
netta Vespucci 45 324
Venusreich 324f.
Gerat, kulturwissenschaft-
liche Bedeutung, siehe
Cassoni, Festwesen (Zu-
behor), Goidschmiede-
kunst, Impresen (Inter-
pretation), Teppich
Germanicus
Astrologie 467. 562
Miinzc 157
Geschichtschreibung
Kulturwissenschaftliche,
siehe Methode
Register
Geschichtschreibung
Malerei als 72. 237. 238f.
581 ff. 584. 587
Mythologisch bestimmte,
sieh e Astrologie, Monstra
Ghiberti
Lorenzo, Sieneser Venus,
tiber die 308
Vittore, Kartonzeichner
187
Ghirlandajo
Benedetto
.. Anbetung" in Aigue-
perse 219f. 382
Mitarbeiter Domenicos
114. 175f.
David, Mitarbeiter Do-
menicos 114
Domenico
Stil
Antike als Vorbild 85.
155f. 157f. 175f.
212. 337 391
Flandrisierend nsf.
205 209. 345
Goldschmied 97 II4.
345
'Obergangsstil 175f.
Zeitgenossisches Ur-
teil 68
Werke
Fresken
David mit der
Schleuder 1 52 f.
361
Grisaillen 157
Heroen, romische,
im Palazzo Vec-
chio 212
Hieronymus 212.
381
Kindermord 157
Portrats s. unten
Sixtina 66f.
Sta. Maria Novella
IOJ. IJ4 157f.290
Sta. Trinita 96ff.
IOJff. 114f. 134f.
138. 152f. 154.
156f. 303. 340.
344 362
Sibylle, Tiburtini-
sche 156
Villa Lemmi (nach
Vasari) 29
Register
Ghirlandajo
Domenico
Werke
Portrats
Antonio Pucci 135.
340. 354
Franco 105 f.
Kinder Lorenzos
103. 303
Lorenzo 101 f. 303
Poliziano 103.
Pulci 107.
Sassetti 98. 10rf.
132. 134. 138f.
303
Tornabuoni, Gio-
vanna 29
Tafelbild ,Anbetung
der Hirteu" 155ft.
205. 209. 362.
Werkstatt 114. 157
Zeichnungen
Antiken, Cod. Escu-
rialensis 1 57 f.
Bestatigung der Or-
densregel, Berlin,
Kupferstichkabi-
nett 303. 343
Wunderdeshl.Franz,
Rom, Corsiniana
34
Giamboni iiber San Lorenzo
172. 367
Giambullari, Festbeschrei-
bung von 1539: 278
Gianbologna,Beteiligung an
den Festen 1589: 398
Gianfigliazzi, Bongianni,
Gevatter von Lucrezia
Ardinghellis Sohn 88
Giostra
Ausstattung siehe Fest-
wesen (Zubehiir)
Darstellung auf Cassoni
188. 374
Dichtung
Polizians siehe Polizia-
no
Pulcis siehe Pulci, Luigi
Giostren, einzelne
Bayonne 1565: 257
Florenz 1469: 82. II2.
12
4
. 126. 326. 335. 344
351 f.
Giostren, einzelne
Florenz 1475: 7 10. 23ff.
45 51 f. 59 65. 87. II2.
326. 339 643
Florenz 1589: 26rf. 269
Padua 1466: 48
Giotto, Franziskus-Fresken
Assisi 362
Santa Croce, Florenz
g6f. 98
Giovanna, Geliebte Caval-
cantis 326
Giovanna d' Austria siehe
Johanna von Osterreich
Giovanni di Bonsignore sie-
he Bonsignore, Giovanni
di
Giovanni di Cosimo de'
Medici
Sozialer Kreis des 330
Teppichsammler 187.
37If.
Giovanni di Lorenzo de'
Medici
Franco iiber 106. 122
Lorenzo iiber 120
Papst siehe Papst Leo X.
Portriit
Ghirlandajo 103.
Medaillen 104. 343
Wachsvoto u8
Giovio, Paolo
Impresen, iiber 23. 81 f.
Portrl!.tgallerie 101. 344
Girolamo, Schneider des
Piero di Lorenzo 3 II f.
Giuliano di Lorenzo de' Me-
dici
Franco iiber ro6f. 122
Impresa 330
Lorenzo iiber 120
Portrl!.t
Bronzino 104
Ghirlandajo 103. 343
Giuliano di Piero de' Medici
Ermordung 1478: 7 45
99 323
Giostra 1475: 7 10. 23ff.
45 5rf. 59 65. 87. u2.
326. 339 643
Holzschnitt zur Giostra-
Ausgabe 24. 312
Impresa 24
Polizian, bei 7 23. 45.
51 f. 65. 87. 112. 32rf.
Giuliano di Piero de' Medici
Verlust der Galeere
St. Thomas 192
Giulio di Giuliano de' Me-
dici, Franco iiber 106.
122
Giulio Romano
Mantua, Palazzo del Te,
Theriakverkaufer 303
Orpheus, Zeichnung 446.
623
Gloucester, Herzog von,
I talienischer Sammet fiir
189
Goes, Hugo van der
,.Anbetung der Hirten"
Datierung 197f. 2ogf.
Portinaris Auftrag 190.
197ff. 204. 209f.
Portrat Portinari 197ff.
zogf.
Schule, Portrat Baron-
celli 202 f. 21 o
Goethe, Joh. Wolfgang
Aberglaube und Mathe-
matik 535
Bibelstelle Jesaias 54 619
,Das Problem in der Mit-
te" 365. 613.
Fausts Erliisung 653
Holzhacker im ,Mum-
menschanz" 383
Luther, iiber 520
Giittingen, Planeten an der
Hauserfassade 507. 563.
646
Goldschmiedekunst
Bedeutung fiir die Flo-
~ e n t i n e r Kunst 73 I 13.
183. 188
Botticelli 53 86. 183.
338.
Finiguerra 72 ff. 84. 336
Ghirlandajo 97 114. 345
Gondi, Lucrezia, nicht iden-
tisch mit Lucrezia Do-
nati 82f. 334.
Gonfienti, Villa Sassettis
bei 133
Gonzaga
Frederico
Griindung von Sta. Ma-
ria de' Voti 349
Wachsvoto 349
Gonzaga
Isabella siehe Este-Gon-
zaga, Isabella
Maddalena, als Nympha
289. 323
Gordianus, Miinze 157
Gorgo siehe Medusa
Gorini, Franzesco, Provve-
ditore der Feste von I 589:
268. 279 395 405. 407.
408. 410. 431
Goslar, Planeten an einer
Hausfassade454. 486.507.
563. 565
Gotha
Handschrift des Wau-
quelin 244 ff.
Zeichnung, Hausbuch-
meister 236
Goya, Francesco, Teppich-
zeichner 383
Gozzoli, Benozzo, Fresken
im Palazzo Riccardi 82.
162. 334 389
Grahame, Kenneth, im
Chap-Book 572
Gravelingen, Portinari Zoll-
p!l.chter von 200
Grazien
Beschreibung
Acciajuoli 41
Alberti 27 f.
Berchorius 640
Filarete 29
Hesiod 27
Horaz 28. 42
Libellus dedeorumima-
ginibus 471. 640
Macrobius 414
Mythographus III 640
Petrarca 640
Pico della Mirandola
327
Polizian 42
Pulci, Bernardo 50
Seneca 28
Darstellung
Antike Freiplastik 29 f.
47
1
Antike Miinzen 414
Antikes Relief 30
Antike Sarkophagpla-
stik 30
Fresken, Palazzo Schi-
fanoja 29. 4 71
Grazien
Darstellung
Holzschnitt
Gafurius 271. 414.
429f. 640
Meister J. B. 30. 315
Kupferstiche, Tarocchi
640
Medaillen
Leone Leoni 30
Niccolo Fiorentino
29. 39 327
Miniaturen
Ovide moralise 472.
640
Remigiuskommentar
414
Reliefs
Duccio, Agostino di
29
Riccio, Andrea 327
Tafelbilder, Botticelli
26f. 28f. 63. 478
Zeichnungen
Bellini, Skizzenbuch
29
Codex Pighianus 28
Greif en
Himmelfahrt Alexanders
243ff. 249
Kuit des Maiachbel 247.
387
Grenier
Pasquier, Teppichweber
von Tournai 225f. 247.
387f.
Jean, Teppichwcber von
Tournai 226f.
Griechen in Italien siehe
Byzanz, Johannes Pal!l.o-
logus, Konzil. Tracht alla
greca
Griechentracht siehe Tracht
alia greca
Grisaillen, ikonologische
Stellung 157 6.B
GrUnewald, Matthias, lscn-
heimer Altar, Stifter 372
Griinpeck, Joseph, tiber
Monstra 522f. 653
Gualterotti (Familie) Fi-
liate in Briigge 203
Gualterotti
Antonio, Schwiegersohn
Sassettis r 3 r
Register
Gualterotti
Rafaello
Festbeschreibungen
295 421f.
Stiche, Triumphbogen
26!. 394 423
Guarini, Giov. Battista
,.Pastor Fido", 264. 291.
295f. 437
Gueinzius, Christian, Lu-
thers Horoskop in der
Bibliothek des 648
Guersi, Guido, Stifter des
Isenheimer Altars 372
Guiccardini
Lodovico, tiber Memling
215. 377
Francesco, Ricordi 93
Guidetti, Tommaso, Medici-
V ertreter in Briigge 203
Guido Carmelita, Miscella-
neen, Cod. Rice. 881:313.
315
Gyraldus, Lilius Gregorius
Beschreibung der Fresken
in Mirandola 643
Haartracht, als Ausdrucks-
mittel siehe Beiwerk,
Tracht all' antica
Halm, Peter, Radierung des
angeblichen Simonetta-
Portrats in Berlin 46
Hagins,Abi'i Ma 'schar-'Ober-
setzung 466
Hainaut, Chroniques de, Mi-
niaturen 628
Halley, Edmund, tiber Ko-
meten 534
Harnadriaden
Stich des Alfiano 299
Zeichnung Buontalentis
267
Hamburg
Beziehungen zu Italien
454 485. 563. 565
Biichersammlung Miin-
zel 6o7f.
Heraldische Sammlung
595.
Kunsthalle
Rembrandtradierungen
592
Register
Hamburg
Kunsthalle
Tod des Orpheus
Kupferstich37445 ff.
453f.
Zeichnung Diirers 37.
445ff. 454
Rathaus, Fresken von
Hugo Vogel 58rff.
Staatsbibliothek, Pica-
trix-Hs. 640
Universitat, Entwicklung
613.
Hamlet, Saturnkind 507
Hampton Court, Mantegna,
Triumph Caesars r88
Hanan-Lichtenberg, Phi-
lipp II. von (beim Haus-
buchmeister) 236
Hanau-Miinzenberg, Phi-
lipp der Jiingere von,
(beim Hausbuchmeister)
236
Handel (15. Jahrh.)
Ausbreitung siehe Medici
(Bankhaus)
Kulturelle Bedeutung sic-
he Austausch und die bei
Flandern (Kunst) ange-
gebenen Verweise
Waren siehe Alaunhan-
del, Teppich, Tuchhan-
del
Handscbriften
Berlin
Kupferstichkabinett
Ham. Ms. 78D5:234
Ham. Ms. 334: 29
Staatsbibliothek
Cod. Lat. 4. 322:531
Cod. Pighianus 13.
28. 625
Breslau, Stadtbibiiothek,
Cod. Rehdig. 174:439.
Briissei, BibiiothCque
Royale, cod. 9242/4: 628
Cesena, Bibiioteca Maia-
testiana,Codd.Plut.XV.,
r, 2, Plut. XVII, 3: 389
Escurial, Skizzenbuch
157 391. 625
Florenz
Besitz Giovanni de'
Medici 187
Handschriften
Fiorenz
Besitz Sassettis 133
I34f. I52f. 154 362
Laur. Piut. 41, 33: ro.
311
Laur. Pint. 44, 30:125
Laur. Plut. 46, 6 : 362
Laur. Plut. 49, 22: 154
Laur. Pint. so, 42: 262
Laur. Piut. 68, 14: 154
Laur. Piut. 79. I: 153f.
Laur. Plut. 79, 24:362
Magl. II, II 83; II, III
197: I50f.
Magl. Cl. VIII, 1370:
351. 356
Magi. Cl. XXV, 636:
147 357
Marucell. Fior. A 82:41
Rice. 492: 315
Rice. 88r: 313. 315
Rice. 1074 und 2544:
356
Rice. 2435: 152
Urkunden siehe Flo-
renz, Archivio di Sta-
to
Gotha, Cod. I, 107 :244ff.
386
Hamburg, Staatsbiblio-
thek, cod. mag. r88: 640
Heidelberg, Universitats-
bibliothek, Paiat. germ.
833: 516
Krakau, Jagellonische
Bibliothek, Cod. 793.
DD III, 36: 527. 629
Leipzig, Stadtbibliothek,
Cod. 935: 498. 533
Leiden, Universitatsbib-
liothek, Germanicus-Hs.
467. 562
London
Brit. Museum
Add. 38117: 316
Harl. 4431:36. 311.
316
Sloane 3983: 632.
634
Yates Thompson, jetzt
Gulbenkian 317
Liibeck, Portinari-Ur-
kunde siehe Liibeck
(Staatsarchiv)
Handschriften
Mailand, Bibl. Naz., Cod.
An. XV. 26: 82. 330
Mantua, Poiizians ,.Or-
feo" 36. 295. 421
Modena, Orthopasca des
Prisciani 474
Miinchen, Staatsbiblio-
thek
elm. 14 271: 414. 462.
473
elm. 27003: 498. sor
Gall. 19: 471
Oxford
Bodl. Can. lat. auct.
cl. 8r: 327
Bod!. or. 133: 629
Paris
Arsenal63o: 327
B. N. fr. 143: 628
B. N. fr. 373: 47rf.
628
B. N. 612: 632
B. N.lat. 48oz: 366
B. N. lat. 6551: 632
B. N. lat. 7330: 632
B. N. lat. 7331 und
7344: 632. 634
B. N. Suppl. Grec. 247:
625
Rom, Vaticana
Palat. 1066: 310
Reg. 1283: 516. 528.
564
Reg. 1290: 462. 471.
627
Urb. 277: r68
Urb. 716: 643
Urb. 899: 329
Vat. 5699: 366
Vat. 4085: 632
Vat. 2845: 653 f.
Vat. 3867: 31
Sankt Gallen, V adiana
427: 632
Tiibingen, Universitats-
bibliothek, M.d. 2: so6f.
Wien, Nationalbibliothek
Cod. Vind. 5239: 528
Wolfenbiittei, Cod. Guel-
ferbit. 17. 18. Aug. 4 :
528
Hannover, Kestnermuseum,
Cassone 31. 315
Hansa
Handelskrieg mit Eng-
land 192
Rechtsstreit urn die Ka-
perung der Galeere 19If.
373
Hapgood, Norman, imChap-
Book 572
Harmonia
Biihnengestalt 275. 398.
415f. 425
Jonson, Ben 415
Musiktheorie 265. 414
Ripa, Cesare 415
Harmonia Doria
Aristoteles 270. 272. 429
Bardi 270f. 414 425. 429
Musiktheorie 265. 270.
414. 425. 429
Patrizzi 270. 429
Plato 270ff. 429
Zeichnung Buontalentis
267. 280. 427 432
Harmonie der Sphl!.ren siehe
Sphl!.renharmonie
Harmonien, griechische
Bardi 272. 414
Gafurius 271. 414. 430
Harpyen,Biihnenfiguren 405
HaBfurt siehe Virdung, Jo-
hannes
Hausbuch der Grafen Walls-
egg 233f. 236
Hausbuchmeister
Stil 234
Zeichnungen Kaiser
Maximilian in Briigge
233ff. 384
Hauweel, Sekretl!.r Maximi-
lians 384
Heidelberg, Universitl!.ts-
bibliothek, Leovitius-Hs.
516
Heidengotter siehe einzelne
Namen
Heidentum siehe Antike
(Kulte)
Heilige
Antonius, bei Hugo van
der Goes 197. 209
Augustinus, bei Botti-
celli 212
Benedikt, Schutzpatron
201. 210
Heilige
Bernhard, bei Rucellai
147
Brigitta von Schweden,
bei Lichtenberger 552
Dominikus, bei Lichten-
berger 555
Donatian, Maximilians
Schwur 236
Dorothea, Bildtypus 320
Franziskus siehe Franzis-
kus von Assisi
Georg, bei Donatello 13
Giovanni Gualberto, Klo-
ster 138
Germain, bei Puvis de
Chavannes 584
Hieronymus, bei Ghir-
landajo 212
Johannes der Tl!.ufer
Fest 48. 303. 322. 363.
440
GedichtLucreziaTorna-
buonis III
Weihgeschenke 350
Johannes und Paulus,
Rappresentazione 109
Margarete, bei Hugo van
der Goes 198. 209. 378
Maria Magdalena, bei
Hugo van der Goes 198.
209
Martin, Schutzpatron Lu-
thers 504
Michael (Erzengel), Pa-
tron Tanis 194. 210.
Paulus (Apostel), Schlan-
genlegende 303. 440
Raphael (Erzengel), als
.,Ninfa" 84
Sigismund, Legende 308.
Thomas, b-ei Hugo van
der Goes 197
Thomas, bei Roger van
der Weyden 197
Uliva, Rappresentazione
37
Heinrich IV. von Frank-
reich, Hochzeit 393
Hein{ich VII. von England,
Portinari im Dienste von
379
Heinrich VIII. von Eng-
land, Portinari im Dienst
von 201. 379
Registn-
Helena, Darstellung in der
Bilderchronik 74
Herberger, Valerius
Lichtenbergers Weissa-
gung 542
LuthersTeufelsglaube519
Herix, Venusberg 324
Herkules
Agyptischer, Vorfahr Ma-
ximilians 526f.
Fresken der Pollaiuoli im
Palazzo Medici 229. 447
Germanischer, Luther als
653
Holzschnitt
Metamorphosen 1497:
652
Holbein 653
Kupferstich Diirers 447
Leinwandbild Diirers 447
Polizians Giostra 7
Sternbild, Tradition 631.
635
Teppichmotiv 223
Hermannus Dalmata, De-
kanliste 631. 633
Hermes siehe Merkur
Herodias, Fresko Filippo
Lippi, Prato 32
Heroen, antike
Ahnen 248. 387.
Exempla von Tugenden
274 357 416. 430
Festfiguren 273f. 276.
322. 359f. 416. 430
Fresken, Ghirlandajo,Pal.
Vecchio 212
Grisaillenfiguren 157
Medaillen 370
Teppichmotive 223. 243fi .
387
Universalhistorie, in der
72
Vorbildcharakter 248.
357 359f. 387
Herrauth, Crispin, Bildnis
Carious 532
Hesiod, von Alberti zitiert
27
Heydenreich, Kaspar, Lu-
ther tiber seine Nativitl!.t
soo
Hieronymus im Gebll.us,
flandrischer Bildvorwurf
2IIf.
Register
Hilden, Johann, Prophe-
zeiung 542
Hildesheim, Planeten an der
Hauserfassade 507. 563
Hill, Nicolaus, Philosophia
Epicurea 327
Himmelfahrt
Alexanders 243.249.387
Apotheose siehe Antike
(Kult)
Hippokrates, .. Picatrix"
miBverstanden 527
Hochzeitsfeste siehe Fest-
wesen (Anlasse)
Hochzeitslisten siehe Cas-
soni-Lieferbuch, Florenz
(Biblioteca Nazionale)
Hochzeitstruhen siehe Cas-
sani
Hohndorf, Biirgermeister,
Siindflutpanik 5I2. 544
Holbein, Hans, d. J., Lu-
ther-Flugblatt 653
Holda, Beziehung zur Ve-
nus-Diana 3I6
Hollar, Wenzel, Stiche zu
Ogilby's Vergiliiberset-
zung 393
Homer
Hymnus, Geburt der Ve-
nus 6{. 9 308. 327. 478
Ficinos 'Obersetzung der
Hymnen 308. 327
Pontanus, bei 3I3
Horaz
Grazien 28. 42
Handschrift, Berlin, Kup-
ferstichkabinett 29
Lorenzo de' Medici und 43
Nachdichtung im I5.
Jahrhundert 41
Necessitas bei 280
Ode an Maecenas, zitiert
531
Ode auf Venus 40f.
Pontanus, bei 313
Horen
Antike 319
Botticelli r6f. 38. 45ff.
Cartari 17f.
Miniatur zu den Gedich-
ten des Lorenzo 3II
Polizian 9 r6. 42. 45
Vase in Pisa rzf.
Horoskopie siehe Nativita-
ten
Hosenkampf
Fastnachtsspiel r8o
Kastchen, Norwegisches
r8o
Kupferstich
italienisch 75 8o. I50.
I79f. r82
nordisch 18of. 368
Hostanes, in der Bilder-
chronik 75
Hrabanus Maurus tiber
Kybele 64I
Hummelberger, Michael,
Melanchthon an 521
Hussiten bei Lichtenberger
546
Hygicia, Antikes Elfenbein-
relief 39
Hypnerotomachia Poliphili
Friihlingsgestalt 18
Liebeszauber 342
Malachbel-Altar 387
Nympha 290. 435
Ibn Esra, Abraham, 'Ober-
setzung des AbftMa 'schar
466. 628. 632. 636. 637
638
Ibsen, Henrik, im Chap-
Book 572
ldealkostiim siehe Tracht
all'antica
Impresa
.. Anima" siehe Motto
.. Corpo"
Auffliegender Adler 75
Eichenstumpf mit gru-
nen Zweigen 202
Fackel6o8
Fortuna 75 8o. 145ff.
149ff. 330
Holzscheite 23ff. 3II f.
Pallas 23 f. 59 643
Ring mit Federn 8I f.
149 200. 330. 334f.
337
Schiff 364
Schlender I 5 Iff. 362
Sonne 75
Sphaera 8x. 85. 182.
331. 334 337
Darstellung
Desco da parto 82
6gs
Impresa
Darstellung
Ex-libris 82. I 52 ff.
Holzschnitt 23 f. 330
Kupferstiche 75 8I f.
I 50. I 82. 334 f. 337
Wappen-Relief I49f.
330
Zeichnungen (Fini-
guerra) 75 8o. 150
Interpretation 75 So.
II2f. 145. 150. I52.
I82. 326. 337 364. 643
Literatur
Ammirato, Scipione342
Giovio 23. 8I f.
Poliziano II3
Sassetti, Filippo 152.
364
Personliche Trager
Medici
23. 8I f. 149. 200.
3Ilf. 330
Lorenzo 24. 8r. 83.
149 200. 326. 331.
334f.
Portinari 202
Rucellai 75 8o. I46f.
I49ff. 330
Sassetti 151 ff. 362.
364.
Inachus, Finiguerra-Zeich-
nung 73
Indien
Etappe der Sternbilder-
wanderung 466. 467 .
56If .
Sassetti, Filippo, in 129
lngegneri, Angelo, tiber die
Nympha 29rf. 436
Innsbruck,Hofkirche, Bron-
zefiguren n8f.
Intarsia
Finiguerras, in der Flo-
rentiner Domsakristei 72
Pallas, Urbina, Palazzo
Ducale 59 84
Intermedien
Briigge 1468: I8I
Florenz
Hochzeit 1585: 263.
265. 3I9. 424f.
Hocbzeit 1589: 261 ff.
398-409 passim.
415. 423 ff.
6g6
Interrnedien
Florenz
Hochzeit z6o8: 360.
410. 415
Hochzeit 1615: 427
Mantua 1584 und 1598:
264
Pesaro 1571: 318
Inventare
Besitzer
Accaiuoli 84
Landucci,Tagebuch345
Medici, siehe Medici
(Familie)
Rucellai, Nannina 342
Gegenstl!.nde
Panni 211. 381
Tafelbilder, flandrische
181. 211. 215
Teppiche 227f. 461
Voti 347
Iris, Vergilhandschrift des
Vaticans 31
Isabeau von Portugal, Por-
trl!.t auf einem Teppich
387.
Isabella d' Aragona, Hoch-
zeit 1489: 31I f.
Isidorus von Sevilla
Kybele 641
Weltperioden 72
Isis Pharia, Fortuna-Vor-
bild 149
Isotta von Rirnini bei Basi-
nius 327
Jacopo d' Agnolo da Scar-
peria, Ptoleml!.us-'Ober-
setzung 168
Jl!.gerin
Diana 313ff. 316
Venus siehe Venus Virgo
Jahreszeiten
Fruhling siehe diesen
Gottinnen bei Homer 9
Holzschnitt, Hypneroto-
machia I8
James, Henry, im Chap-
Book 572
}arrow, Abt Benedikt
Biscop von 439
Jason, Darstellung, Otto-
Teller 86
J can siehe Johann
Jean Paul, Tropus und Me-
tapher 205. 49I
Jenson, Nicolaus, Drucker
3II
Joachim!. vonBrandenburg
Berufung des Gauricus
498
Flucht vor der Siindflut
1524: 510. 649
Handschrift Zahels fiir
532
Joachim von Fiore, Wir-
kung, siehe Pseudo-Jo-
achim
Jorg, Mundkoch Maximi-
lians 237
Johann Connetable von
Bourbon, Auftraggeber
Benedetto Ghir!andajos
220
Johann der Gute, Konig
von Frankreich, Petrarca
bei 358
Johann ohne Furcht, Herzog
von Burgund, Gefangener
Sultan Bajazets 248. 388
Johann von Burgund, Her-
zog von Nevers, Bildzau-
ber gegen Karl den Kiih-
nen 34I
Johanna von Osterreich,
Hochzeit 267. 282. 295
433
Johannes
Hispalensis, Abu
Ma'schar-'Obersetzung
63rff. 639
PaU.\ologus, Portrat
Gozzoli 389
Piero della Francesca
25Jf. 390
Pisanello 254
Saxonicus, Alkabitius-
Kommentar 635
Joly, Johannes, Biirge im
StreitPortinari-Hansa3 7 3
Jonas, Justus
Herberger tiber 519
Luther an 533
Jones, Inigo, Sternenreigen
418
Jonson, Ben
Astraea 4I5
Bildzauber 342
Harmonia 4I5f.
Register
Jonson, Ben
Sternenreigen 324. 417
Werke
MaskofBeauty415 .417
Mask of Queens 342
The Golden Age Re-
stored 415
The Sad Shepherd 323.
Joseph, Finiguerra-Zeich-
nung 73
Jouan, Abel, Festbeschrei-
bungen Bayonnei565: 392
Jubal, Finiguerra-Zeich-
nung 72
Juden, Rolle bei der 'Ober-
lieferung der Antike 466
Judith
Baldini-Stich 31. 84
Ninfa 84. 334
J unctinus, Franciscus, Ca-
put Draconis bei 642
Jupiter
Finiguerra-Zeichnung 73
Polizian 7 I4
Dolichenus, Tempel auf
dem Aventin 629
Planet
Abu Ma'schat-Tradi-
tion 642.
Biihnenfigur 276. 432
Fresko, Schifanoja 464.
472f. 474
Gegenwirkung zum Sa-
turn so8. 526ff. 529ff.
553. 652
Horaz 53I
Horoskop Luthers
502. 504f. 5I8. 543
648. 654
Konjunktion von 1484:
502f. 505. 508. 514.
518. 563
Lichtenberger 529.
553f. 556
Magier des, bei Pica-
trix 515. 556
Manilius 470. 472.
Zeichnung Buontalen-
ti 264. 267. 425. 432
Juventas, Horaz 41
Kain, Finiguerra-Zeicbnung
72
Kairos (occasio), Relief in
Torcello I 5 I
Register
Kaleb, Finiguerra-Zeich-
nung 73
Kalender
Antiker, Dezemberbild
507 649
Alfonsinischer, Hand-
schrift Reg. 1283: 516
Arndes, Ltibeck 1519:
454 485. so7. 563. 645
Astrolabium Planum,
Augsburg 1488: 465.
466i. 562
Baldini, Kupferstiche 86.
I79f. 325. 338. 4I4.
477 644 646
, ,Basler Hinckender Both''
649
Deutscher, Dezemberbild
652
Reyrnann, Niirnberg
I5I5:5o8
Oberlieferer der Plane-
tenbilder 454 462f. 472.
477 485. 506. 563. 649
Kalenderreform unter Leo X.
5I7
Kansas, Zeitschriften 573
Karl II. von England, Siegel
258. 393
KarlV.vonSpanien,Schmal-
kaldischer Bund495
Karl VIII. von Frankreich,
Einzug in Florenz 379
Karl IX. von Frankreich,
Auftreten im Fest 1572:
393
Karl d. Kiihne von Burgund,
Antike bei 248. 388
Auffiihrung der Affen-
farce vor I 8 I
Bildzauber gegen 341.
347
Hochzeit I8I. 203. 369.
372 378
Hof von I8r. I89. 203.
379 385
Portinari und 192. 200.
203 378
Portrat auf dem Alex-
anderteppich 24 7 f.
Zusammenkunft mit
Friedrich III. 248. 378
Kartons
Vorzeichnungen fiir Me-
daillen 370
Kartons
Vorzeichnungen fiir Tep-
piche 187. 371.
Kassiopeia, Sternbild,Astro-
labium Planum 467
Keil, Sigemund, tiber
Luthers Nativitat 647.
Kensington Museum siehe
London, Victoria and Al-
bert Museum
Kentaur
Antiker, als Vorbild I55
Biihnenfigur 317. 405.624
Sassettis Impresa I 5 I.
I58. 362
Theologisch gedeutet 362
Keyser, Arnold de, Drucker,
Gent 385
Khosro
Alexander der GroBe und
387
Arezzo, Fresken vonPiero
della Francesca 390
Kimball,H.J., Herausgeber
des Chap-Book 571
Kitzingen, Weib von, Weis-
sagung 494 496. 538
Kleopatra, Bild Piero di
Cosimos 49 323
Kometen
Arabische Lehre 533
Astrologenportrat I72.
367
Diirer, bei 530. 653
Halleys Entdeckung 495 f.
534
Luther iiber 533f. 65of.
Melanchthon iiber 494 f.
496. 533. 537f.
Plinius, bei 533
Titelblatt von Carious
Prognosticatio 510
Umfang und Richtung
494. 533f. 537
Vorzeichen, als 494ff. 530.
533. 537 65o. 653
Komik
Tanz siehe Moresca
Nordischer Bilderkreis
I8r. 227. 229
Konstantin der GroBe
Johannes Palaologus als
253 399
Piero della Francesca,
Fresko 253. 390
Konstantin der GroBe
Rappresentazione 391
Konstantinopel, Fall von
248. 253f.
Konstantinsbasilika, Tern-
plum Pacis der Weih-
nachtslegende 156. 362 f.
Konstantinsbogen sieheAn-
tike (Monumente). Trium-
phalplastik
Konstantinschlacht
Piero della Francesca I 7 5.
253.
Raffael-Schule 175
Konzil, Florenz I439: 246.
253f. 367. 389.
Kosmologie sieheAstrologie,
Monstra, Planeten, Spha-
renharmonie, Tanz der
Sterne
Krakau
Jagellonische Bibliothek,
Picatrix-Hs. 527. 629
Schwanritterteppich
387.
Kreuzlegende
Bilddarstellungen 254.
390.
Rappresentazione 39I
Kreuzzugsplane 387. 390f.
Kulturwissenschaft siehe
Methode
Kupferstiche, anonyme
Deutsche siehe Meister
Italienische siehe Baldini
Tarocchi
Nordische Vorbilder siehe
Austausch
Kybele
Fresko, Schifanoja 464.
472f. 474 477 64rf.
Kultattribute 473 641 f.
Mantegna 4 77
Miniatur, Remigius-Hs.
473
mythographische Tradi-
tion 470. 472f. 64rf.
Kyzikos, Geburtsort des
Teukros ( ?) 561. 565.641
Lactanz tiber Fortuna I49
Lambecius, Herausgeber der
Leoninischen Orakel 521
Lamech, Finiguerra-Zeich-
nung 72
Lamius, Johannes, Deliciae
eruditorum (\Vachsvoti)
348
Lancinus Curtius, Gedicht
tiber die Spharen 413
Landino, Cristofaro
Dantekommentar 654
Platonismus 39 312. 320
Pliniusausgabe 22
Vergilkommentar 39.312.
320
Landucci, Lucca, Tagebuch
290. 345 347
Landschaftsmalerei, Bedeu-
tung 53. 73 581. 584.
Landser, Sau von 524. 653
Landshut, Residenz, Plane-
tenkamin 457 462
Langenbeck, Jacob, Rechts-
professor in Perugia 485.
645
Langusto, Giacomo, tiber
Mahommed II. 388
Laokoon
Antike Gruppe, Ausgra-
bung 68. 176. 448. 624
Filippino, Zeichnung 67 f.
367
Fundbericht von 1488:
176. 367. 449 624
Tod des Priesters 67
Theriakverkaufer als 303.
440
Vergil68
Lapi, Giovanni, Sirenenko-
sttim 279. 431
Lapidarien, tlberlieferungs-
bedeutung 465.467. 528.
564
Lapidarium
Alfonso el Sabio 467.
530. 629. 630. 632
Teukros 562. 564
Lastri, Marco, L'osservato-
re Fiorentino 347
Laura, Typus distanzierter
Liebe 65. 317
Laurana, Luciano, Erbauer
des Palazzo Ducale in
Urbino 59
Laurenziana, Biblioteca, sic-
he Florenz (Bibliotheken)
Lauro
Festa di, Rappresenta-
zione 36f. 295. 421
Lauro
Wortbedeutung 115. 317.
326. 330. 346
Lazzarelli, Lodovico, Resti-
tution der Tarocchi-Got-
ter 643
Legende, antike, Nachle-
ben siehe Antike (Bild-
motive)
Leib, l{ilian tiber Faustund
Lichtenberger 533
Leiden, Universitatsbib-
liothek, Germanicus-Hs.
467. 562
Leinwandbilder siehe Panni
Leipzig
Humanismus in 491
Stadtbibliothek, Nativi-
tatensammlung Rein-
holds 498 f. 533
Lemberger, Holzschnitte zu
Lichtenbergers Weissa-
gung 513
Lemmi, Villa, Botticelli-
Fresken 28. 39
Leo siehe Tierkreiszeichen
(LOwe)
Leone Ebreo, Dialoghi
d'Amore 317
Leoni, Leone, Grazien 30
Leoninische Orakel, Kaiser-
bildnis 521
Leonora d' Aragona
Brief des Prisciani 475
479ff.
Einzug in Mailand 322
Leopold von L>sterreich, De-
kanliste 631 f. 633. 634.
635 636. 637 639
Leovitius, Cyprianus, Hs.
ftir Ottheinrich 516
Lessing, Gotthold Ephraim,
Lucrez bei 321
Libellus de deorum imagi-
nibus
Gotterbeschreibungen
457 462. 47!. 627f. 640
Grazien 4 71. 640
Illustrationen 462. 4 7 I.
627f. 640
Liberale da Verona, Dar-
stellung von Windgottern
31
Libra siehe Tierkreiszeichen
(Wage)
Register
Lichtenberger, Johann
Gauricus und 517.
Monchsprophet, bei 515f.
519. 542. 556ff. 563.
654
Orakel, tiber ssof.
Propheten, tiber 555ff.
Prophezeiung, tiber 551 f.
Verhaltnis zu Paulus von
Middelburg 514f. 518.
526. 654
Weissagung 513ff. 520.
524. 526. 529. 542. Text-
proben 550-558. s63f.
652. 654
Lievin, Teppichweber 187
Ligorio, Pirro, tiber Nym-
phen 21
Link, \Venceslaus, Luther
an 52 r. 533 f.
Linus, Finiguerra-Zeich-
nung 73
Lionardo da Vinci
Antike
Bewegung 52ff.
Heroismus 448
Proportionen 53
Festentwtirfe und -zeich-
nungen 10. 51 f. 151.
417
Landschaft 53 f.
Polizian und 10. 51 f.
Lippi
Filippino siehe diesen
Fra Filippo
Fresken, Prato 32
Impresa des Lorenzo 82
Lehrer Botticellis 64
Nympha 32. 66. 84.
290. 337
Tondo, Palazzo Pitti
64. 66. 319f.
Wirklichkeitssinn 63
Litbara, Edelknabe Maxi-
milians 237
Liverpool, Antikes Elfen-
beinrelief (Hygieia) 39
Livius, Vorbild Macchiavel-
lis 110
Lodovico da Foligno, Me-
dailleur, Brief an Fiero
de' Medici 370
Lollhard, Reinhard, Pro-
phezeiung 552
Register
London
Handelsverkehr mit den
Medici 192. 2oo. 374
375f.
Sammlungen
British-Museum
Botticelli, Zeichnung
65f.
Christine de Pisan-
Hs. 36. 311. 316
Finiguerra, Bilder-
chronik 71ff.
.,Mantegna"-Skiz-
zenbuch" 446. 623
Merlinroman-Hs. 316
Otto-Teller 79 332
Stiche des Scarabelli
394
Stich von Metz nach
Carracci 411
Zotori Zapari-Hs.632
634
Grosvenor Gallery, Se-
bastiane del Piombo,
Zeichnung, Pieti1. 216
Gulbenkian, Petrarca-
Hs. 317
Historical Society, de-
sco da parto 82
National Gallery
Filippo Lippi 82
Jan van Eyck 18gf.
Signorelli( Genga) I 83.
369
Oppenheimer, Buonta-
lenti-Zeichnung 41 I
Victoria and Albert-
Museum
Lionardo Stuckrelief
52.
Majolikateller 625
Westminster Abbey,
Wachsbilder 350
Longus, Nymphen 3I4
Loosbiicher (Loosbrett)
353 485.
Lorenzetti, Ambrogio, Heil.
Dorothea 320
Lorenzo de' Medici
Charakteristik
AuBere Erscheinung
102. 1 20f. 342
Ausgleicbspsychologie
roof. nof. 344
Lorenzo de' Medici
Charakteristik
Bildung 7 43 49 no.
350.
Cerretani iiber 102. I ro.
120
Dichtung siehe unten:
Umgebung, Werke
HofischesLeben8I.82ff.
I u ff. n5. r82. 326.
330f. 334 ff. 342. 344
346
Kaufmann 130. 135 .
192. 2oo. 353 375.
391
Kunstinteresse und
Kunstbesitz 23. 2479
III.21536737039I
Machiavelli iiber I 10
.,Magnifico" 344
Politik 104. 105.109ff.
2oo. 344 375. 391
Valon iiber 102. 120.
PortrMs
Ghirlandajo 98. 101 f.
135 303
Gozzoli 82. 334
Otto-Teller 8Iff. 182.
334f.
Pollaiuolo I02
Spinelli 102
Stuckbiiste, Beriin 99
Totenmaske 343
Wachsvoti 99. u8.
341
Umgebung
Avogaro 642
Franco 105ft. III.12I f.
345
Kinder 102f. 1o8f. 120.
I23f. 351
Lehrer: Gentile de' Be-
chi 120
Liebesabenteuer 82ff.
325f. 330. 334.
Martelli, Braccio 85.
331. 337
Medailleur Lodovico
370
Mohammed II. 39I
Polizian 35 65. 103.
ro8f. 123.
Portinari 200
Pulci 107 f. II I. 326.
330. 344 345 35rf.
Warburg, Gesamruelte Scbriften. Bd. 2
Lorenzo de' Medici
Umgebung
Sassetti 130. 135. 353
375.
Simonetta 49 65. 326
Werke
Ambra 35. 43
Caccia col Falcone 344
352
Canti carnascialeschi
50. 67. 289. 290. 421
Canzone de' sette Pia-
neti 417
Gedichte, Illustration
10. 3Il
.,Rappresentazione di
S. Giovanni e Paolo"
109
Selve d'Amore 43 326
Sonette 43 49 322
Lothringen, Christine von,
siehe Christine
Lotti, Luigi, Bericht tiber
die Ausgrabung von
1488: 367
Luc Antonio de Giunta, An-
tiken-Nachzeichnung 3IO
Lucca
Heimat Arnolfinis x89
Malvezzi aus 273
Lucena, Vasco da, siche Va-
sco da Lucena
Lucifer, Biihnenfigur 298.
400. 404 405
Lucretius Carus
Botticelli 4If. 321. 478
Grazienauffassung 42
Polizian 41. 321
Pontanus 321
Venusauffassung 41. 321
Lucrezia Donati siehe Do-
nati, Lucrezia
Ludovicus de Angulo, De-
kane 63off. 633. 634. 635.
636
Ludwig XI. von Frank-
reich, Gegner Karls des
Kiihnen 379
Liibeck
Beziehungen zu Italien
454 485.
Druckort, Kalender 1519:
454 485. 507. 563
Staatsarchiv, Urkunde
iiber Portinari 373
45
700
Lilneburg, Rathaus, Plane-
tenfresken 486. 507. 563.
565
Lufft, Hans, Drucker von
Lichtenbergers Weissa-
gung 513. 545
Luigini, Federigo, tiber
Haartracht der Frauen
314
Lukian
Kultische Tl\nze 418.420.
Pythonkampf 283 f. 434
Sternentanz 277. 417ff.
430
Luna
Mythologisch siehe Diana
Planet
Auffilhrung 1589: 275
278. 292
Fresken in S. Lorenzo
zu Florenz 1 72
Lichtenberger tiber 554
556
Ltineburg, Rathaus486
Luthers Abhangigkeit
541
Sphl\rentanz 277. 418
Zeichnung Buontalen-
tis 267
Lundborg, Florence, Illu-
strationen in ,The Lark"
577
Luni, Venusberg bei 324
Luther, Martin
Astrologie492. 497 499ff.
50Jf. 512. 513ff. 518f.
531. 540ff. 543ff. 546.
564. 65of. 654ff.
Bildnis in der .,Wunder-
lichen Weissagung" 521.
652.
Cardanus, Auf3erung fiber
503f.543f.
Carion, Auf3erung fiber
501. 532 f.
Eschatologische Zeichen
512. 523. 537 546f.
65of.
Gauricus, Xu13erung tiber
498. 499.647
HI. Margarethe 198
Herkules Germanicus, als
653
Kometen 533f. 650
Luther, Martin
Konjunktion von 1484
siehe unten: Nativitat
Konjunktion von I524
siehe unten: Silndflut-
panik
Lichtenberger, tiber 520.
542 ff. 545 ff. 549 f.
Melanchthon, Aul3erung
tiber 499f. 540. 542
MBnchsprophet, als 515.
542. (556.) 564
Monstra 52 Iff. 531. 544
548. 65of.
Nativitat 497 499ff. 515.
5I7f. 54Iff. 564. 647f.
654
Saturn 505. 507f. 542.
649
Stindflutpanik 499 512f.
544 651
Teufelsglaube 516. 518ff.
Weissagung492. 497.512 f.
520. 52lf. 523. 533 f.
544 f. 545 ff. 548. 549
65of.
Werke
Briefe an
Dietrich 499. 647
Jonas 533
Link 521. 533
Rubel und Speratus
522
Spalatin 499 52 I. 534
Chronica deutsch 523
Decem Praecepta(1518)
654ff.
Epistel-Predigt von
1522: 65of.
Supputatio annorum
mundi 537
Tischreden soof. 503 f.
505. 5I2. 540ff. 543f.
Vorrede zu Lichtenber-
gers \Veissagung 513.
520.545--550.564
Warnung an seine lie-
ben Deutschen 523
Lycosthenes, Conrad, Pro-
digiensammlung 522
Lykomedes. T5chter des
Miniatur JII
Sarkophag 20
Registey
Lyon
Filiale des Bankhauses
der Medici 98. 14off. 379
Sassetti in I3of. 138. qo.
355
Mable, Hamilton W., im
Chap-Book 572
Machiavelli, Niccolo
Bankhaus Medici I30
Fortuna 364
Lorenzo uo
Macinghi, Alessandra siehe
Strozzi, Alessandra Ma-
cinghi negli
Macrobius
Cartari, bei 29
Musen und Spbaren 271.
4 L ~
Sternentanz 418
Maddalena di Lorenzo de'
Medici siehe Cybo
Madrigal, Musikstil 263. 296
Ml\nade, Nachleben, siehe
Antike (Bildmotive)
Maestro, Giovanni del,Haus-
meister am Hofe Ferdi-
nands I. 298. 403
Maeterlinck, Maurice, im
Chap-Book 572
Magdalena von Osterreich,
Hochzeit 360
Magie
Logik und 491. 504.
534f. 565. 6x8
Mittel
Abbilder 99. 100. 138.
341 f. 346. 523f. 526.
528. 531. 628
Amulette 526ff. 650
Berl\ucherung roo
Namen 131 f. 464. 467.
so6. 628
Steine siehe Lapida-
rium
Tiere 303. 440. 640
Zahlen 527. 528. 531
Nachlebende Antike, als,
siehe Antike (Damono-
logie)
Teufelsglaube 498. 516.
sx8f. 520
Magnifico, Lorenzo il, siehe
Lorenzo de' Medici
RegisteY
Mailand
Bankhaus Medici in 130.
200. 372
Flandrische Weber in 187
Galleria della Brera, Re-
lief des Ag. di Duccio
IJ. J08f.
Hochzeit Aragona-Sforza
1489: JII f. 417
Visconti in 100
Bibliotheken
Ambrosiana
Botticelli-Zeichnung
23ff.
Lionardo, Rothel-
zeichnung 53
Nazionale, Berlinghi-
eri-Codex 82. 330
Mainardi, Werkstatt Ghir-
landajos 114
Maitre de Moulins, Ver-
hl!.ltnis zu florentinischen
Meistern 220. 382
Malachbel, Kult in Syrien
247 387
Malatesta, Sismondo
Basinius, bei 327
Beziehung zum Brera-
Relief Ag. di Duccios
309
Erbauer von S. Fran-
cesco siehe Rimini
(Tempio Malatestiano)
Mallarm6, Stephane, Por-
trll.t im Chap-Book 572
Malleolus, Isaac, iiber
Luthers Geburtstag 503.
648
Malta, Heilerde ans 303. 440
Malvezzi, Cristofano
Komponist fiir die Inter-
medien von 1589: 273
275 424
Musikalischer Stil 263.
424
Musiker am Hofe Ferdi-
nandos 299
Mander, Carel van, iiber
Roger van der Weyden,
228
Manilius
Astrologisches Lehrge-
dicht 469f. 476. 643
Prisciani, zitiert bei 475
481
Manilius
Widder-Kinder 628
Mantegna, Andrea
Bacchanal und Trito-
nenkampf, Stiche 447
Diirer-Vorbild 447 624
Kybele, Fresko 477
Pathosstil 44 7
Schule
Kartenspiel siehe Ta-
rocchi
Skizzenbuch, London
446. 623
Tod des Orpheus, Kup-
ferstich 37 445ff. 623
Sebastian,Tafelbild 216
Triumphalstil 188. 477
Triumph des Caesar 188
Mantua
Feste 1584 und 1598: 264
Flandrische Weber in 187
Gebl!.ude
Castello, Fresko des
Antonio da Pavia 151
Cattedrale 349
Palazzo del Te, Fresken
des Giulio Romano
303
Sta. Maria delle Grazie
349
Sta. Maria de' Voti 349
KongreB 1459: 391
Polizians ,.Orfeo"
Auffiihrung 33 317.
446. 624
Manuskript 36. 295.
421
Wachsvoti 118. 349
Marche, Olivier de Ia
Hofzeremoniell 385
Karls des Kiihnen Hoch-
zeit 203. 369
Maximilian in Briigge 235
Marco del Buono, Cassone-
maler 188. 372
Maremma di Pisa, Herkunft
der Familie Sassetti aus
145
Marenzio, Luca
Komponist 1589: 285
Musikalischer Stil 263.
424
Sl!.nger 275. 299. 406
Margarethe von York siehe
Karl der Kiihne
Maria de' Medici, als
Astraea 415
Maria von Burgund und
Pierantonio Baroncelli
202
Maria Stuart, Portinari im
Dienst von 379
Mariotto di Salvadore, Bru-
der des ,.Compare" bei
Pulci 351
Marins Victorinus, Theorie
des Tanzes 418
Marmion, Simon, Altar des
hi. Bertin 373f.
Mars, Planet
Auffiihrung 1589: 275
Fresko, Liineburg, Rat-
Fresko, Palazzo Schi-
fanoja 470
Holzschnitt-Illustration
646. 651f.
Lichtenberger, bei 553 f.
557
Luthers Horoskop 499.
501. 502. 508. 518. 648
Miniatur, Liber Bolhan
628f.
Plastik, Ag. di Duccio
12
Zeichnung Buontalentis
267
Marsyas
Antike Gemme 48
Vorbild fiir den Typus
des hi. Sebastian 183
Martelli (Familie)
;.'iliale in Briigge 203
Wappen 319
Martelli
Antonio, Verlust der Ga-
leere St. Thomas 192
Braccio, Bief an Lorenzo
85. 331. 337
Lorenzo, Schwiegersohn
Portinaris 198
Luigi, Heirat 1487: 319
Martellini, Bernardo, an-
tike Plastik im Besitzc
des 319
Martial d' Auvergne, iiber
den Luxus am Hofe Karls
des Kiihnen 204
45*
702
Martianus Capella
,Hochzcit der Philologie"
264
Kommentar des Remi-
gius, Handschrift 414
462. 473
Masaccio
.,Schattenheilung" Fres-
ko 390
Vorbild fiir Castagno 6oo
Maslama, Abil'l-Kasim b.
Al].mad al-Mag;itl, Zau-
berbuch Gayat-al-J;!.aktm
527f. 657
Dbersctzung siehe Pica-
trix
Matarazzo, Francesco, Chro-
nik von Perugia 354
Mathesius, Johannes, Brief
Mclanchthons an 496
Mathilde in Dantes Divina
Commedia 50. 420
Matteo de' Pasti, siehe Pa-
sti, Matteo de'
Mattioli, Theriakrezept 440
Maxentius auf dem Fresko
Fiero della Francescas
253.
Rappresentazione 391
Maximilian I.
Ahnenkult u8f. 526
Beziehungen zu italie-
nischen Kaufleuten 200.
202. 379
Gefangenschaft in Briig-
ge und Friedensschwur
235ff.
Humanistcnkreis 522 f.
NativW!.t 526
Picatrixhss. im Besitz
von 527. 531
P o r t r ~ t s , Hausbuchmei-
ster 235ff.
Pressepolitik 524
Schwerttanz vor 44 I
Mecheln
Abft Maschar- Dberset-
zung in 466
Urteil im Rechtsstreit
Portinari 373
Mechter, Paul, Drucker in
Perugia 485
Medaille
Portrats siche PortrM
Technik 370
Medaille
Zweck, sozialer siehe Mo-
hammed II., Tornabu-
oni (Giovanna)
Medea
Finiguerra-Zeichnung 75
84
Otto-Teller 86. 338
Sarkophag 13
Medici
Bankhaus
Ausbreitung 13of.qo.
190f. 193f. 200. 202 f.
355 374 375.
BrUgger Filiale, Bank-
rott 2oof. 376
BrUgger Filiale, Zu-
sammensetzung 203.
380
Compagnons
Portinari 193. 199f.
209f. 375f. 377.
379
Sassetti 98. 13of.
140f. 144 353ff.
375 f.
Tani 190. 193f.210f.
374 375t.
Geschl!.ftskontrakte
151. 193f. 199. 210.
375.
GescMftspolitik 199f.
375f.
Geschl!.ftsverbindun-
gen
Curie 200
Herzoge von Bur-
gund 187f. 193 f.
199ff. 203. 210
Familie
Besitzer von Antiken
48. 354
Bibliothek 354
Biirgerliche Mitgliedcr
siehe die Vornamen
Grol3herzoge siehe die
Vornamen
Heiratspolitik 104.
149ff. 261. 422
Impresen siehe Im-
presen
Inventare 23. 79 18r.
2IIf. 215. 3Ilf. 354
381
Medici
Familie
Palast
Register
Baubeginn 167. 366
Fresken 82. 162. 229
Wappen So. 82. 332
Medizin
Hcilmittel
Amulette 526ff.
Erden 303. 440
Schlangenfleisch 303.
440
Steine 642
Teukrion 531
Theriak 303. 439f. 625
Luther tiber 541
Krankhciten
Melancholic 526ff. 529.
531
Syphilis (Franzosen-
krankheit) 523. 524.
6so
Medusa
Etruskische,vomGrabder
Volumnier 84. 336.
Fliigel als Kopfschmuck
der .,Ninia" 84. 86. 182.
315. 336ff. 477
Gorgonenhaupt
Schild der Pallas 25. 52.
84. 312. 469- 643
Waffe des Perseus 390
628f. 64gf.
Megenberg, Konrad von,
Tberiakbereitung 439.
Meister
des Hausbuches siehe
Hausbucbmeister
E. S.
Pieta, Kupferstich 216
Vorbild fiir die Bal-
dini-Stiche I 79
J.B.
Grazien 30. 315
Verfolgungsszene 36
mit den Bandrollen, Ho-
senkampfsticb x8o
Melancholic
Bild siebe Diirer
Wescn siehe Saturn
Melanchthon, Philipp
A nteil an Carions Chroni-
ca 493 495 536f.
Apologie 493- 537
Register
Melanchtbon, Philipp
Astrologie, Stellung zur
495. 497 499ff. 512.
533f. 536ff. 538. 540f.
Bonincontri, tiber 540.
654
Briefe an
Baumgartner 496
Camerarius 494 496.
498. 526. 533f. 539f.
654
Carion 492ff. 533f.
536ff.
Cordatus 496
Gauricus 498
Hummelberger 521
Mathesius 496
Osiander 501
Schaner 501 f.
Spalatin 521
Diirer, tiber 529
Gauricus, tiber 498. 539
Luthers AuBerung iiber
499f. 540.
Melancholie, tiber 529
Monchsbilder bei Lich-
tenberger 515 f. 542
Nativita.t Luthers 5oolf.
542. 647f. 654
Nativita.t seiner Tochter
494
Papstesel 521 f. 653
Weissagung. Stellung zur
492. 497 521. 533f.538
Mel eager, Sarkophagplastik
als Vorbild 154 158. 354
Melodrama siehe Oper,
Theater
Memling, Hans
,Jiingstes Gericht", Dan-
zig 19off. 196. 203 f.
210. 373
,Passion", Turin 197ff.
376f. 378
Portra.ts
Baroncelli r 98
Portinari 190. 197 ff.
2orf. 210
Memoria
Plinius 282
Vasari 282. 433
Menne!, Jacob, Wunder-
sammlung 522. 653
Mensola, Hirtin bei Boc-
caccio 35
Merkur
Charakter
Fuhrer der Grazien 39
Gotterbote 39
Planet 12. II3. 267.276.
454470485.640.645
646
Psychopompos 325
Darstellung
Antike 40. 645
Botticelli 26. 39. 320.
325
Baldini II3. 646
Breu 646
Biihnenfigur 276
Buontalenti 267
Duccio, Ag. di 12
Giostra, Padua 1466:
48
Kalender 485. 645
Medaille 39 320
Tarocchi 454 485. 645
Literatur
Boccaccio 320
Manilius 470
Martianus Capella 264
Seneca 28. 40
Vergil 320
Zugehorige Tiere nach
Picatrix 640
Merlin, Roman, Jagerin
Diana 316
Messahala beiLichtenberger
556.
Mesne, Steinmagie 642
Metamorphosen Ovids sic-
he Ovid
Methode, kulturwissen-
schaftliche, Bedingungen
5 75 So. 87. 93. 158.
262. 327. 339 353 365.
423. 445 449 453 461 ff.
464. 478f. 486. 490. 534
56r. 56
4
. 618
Methusalem, Finiguerra-
Zeichnung 72
Metz, C. M., Schabblatt,
Pythonkampf nach Car-
racci 411
Meunier, Konstantin,Volks-
heimausstellung 592
Michelangelo Buonarotti
Decke der Sixtina 68
Francesco da Hollanda
tiber 206
703
Michelangelo Buonarotti
Jiingstes Gericht, Ver-
gleich mit Memling 196
Reiterschlacht 448
kogers Grablegung und
215
Milton, John. Mask 418
Minkwitz, Disputation 544
Minnekastchen siehe Bal-
dini (Otto-Prints}
Minotaurus, Biihnenfigur
405
Mirandola
Familie siehe Pico della
Mirandola
Turas Fresken in 4 76. 643
Modena, Bibliothek, Ortho-
pasca des Prisciani 474
Mohammed II.
Antike bei 248. 388. 391
Medaille fiir 391
Molinet, Jean, Chronik235f.
384
Moller, Henricus, Astrolo-
giestreit 512
Monastir, Monstrum in 653
Monate
April, Fresko im Palazzo
Schifanoja 464. 469.
470 f. 476
Dezember, Kalenderbild
507. 649 652
Marz, Fresko im Palazzo
Schifanoja 464.469.4 76.
643
Juli, Fresko im Palazzo
Schifanoja 464.4 72 f. 476
Oktober-November,
Paranatellonta 515
Monate, Gotterherrscher,
nach Manilius 470. 476
Monatsregentenlehre siehe
Astrologie, Planeten
Mond siehe Luna
Monferrato, Marchese di,
Freund Sassettis 13r
Monstra
Fabeltiere 243. 245.246.
258
Gestirnbilder 465. 467.
628. 63of. 636
Heroenkampfe gegen, sie-
he Medusa, Perseus,
Pythonkampf
Monstra
Periodisierung der Ge-
schichte durch 513.
522ff. 649
Portenta 492. 497 512.
521 ff. 523 ff. 525. 538.
544. 548f. 649. 65o. 653
Theaterfiguren 396. 400.
404. 405
Montaguti, Capella, SS. An-
nunziata, Florenz 599
Monte, Abbate del, Freund
Ferdinands I. 428
Montughi, Villa Sassettis
133. 134. 143. 144. 355.
Maresca
Fresken, Palazzo Medi-
ci2II
Gesel!schaftstanz 85. 33 r.
337
Sphlirentanz 417. 418
Theater, auf dem 318.418
Tuchbilder, flandrische
211
Morrisdance, Tradition 303.
441
Moschus
Ovid und 14
Benivienis "Obersetzung
309
Polizians "Obersetzung309
Mathe Le Vayer,
de la, fiber Luthers Ho-
roskop 648
Matti
.. A mon pouvoir" (Sas-
setti) 152 ff. r 58. 362
.. Amor vuol fe" (Lorenzo)
81 ff. 182. 334.
.,Chi puo non vuol, chi
vuole non puo" (Loren-
zo) 330
,.De bono in melius"
(Portinari) 202. 379
.. Le temps revient" (Lo-
renzo) 326. 346
.. Pour non falir" (Ta-
nagli) 192. 194. 374.
.,Semper" (Medici) 82
Serviendo consumor''6o8
.. Spero" (Lorenzo) 85.
331. 337
.. Velis nolisve" (Alfonso
von Aragon) 359. 365.
390
Motti
,.Vera latent" 342
.,Vis maxima" (Sassetti)
364
Moulins, Maitre de 220. 382
Miinchen
Staatsbibliothek
Nativitlitensammlung,
498. 501
Remigius-Hs. 414. 462.
473
Schwanenritter-Hs.471
Mtinzen
Antike, als Vorbilder 157
414. 6o8
Sammlung
Giovanni Medicis 187
Hamburgische 596
MUnzer, Thomas. bei Lich-
tenberger 515
Mulinaccio, Villa Sassettis
133
Muschel siehe Venus (Dar-
stellung)
Musen
Darstellung
Bfihnengestalten 292.
298. 411. 425
Buontalenti,
nungen 264.
Epiianio d'
Stich 298
Zeich-
267. 425
Alfiano,
Festwesen 48. 258
Tarocchi 271. 412. 429
Teppich 258
Tibaldi, Tafelbilder 4 r I
Literatur
Ausonius 414
Gafurius 271. 413. 430
Macrobius 271. 414
Martianus Capella 412
Spharenherrscherinnen
271. 412ff. 429.
Museus, Finiguerra-Zeich-
nung 73
Musikdrama siehe Oper,
Theater
Musiker bei den Interme-
dien 1589: 299f. 396 .
398. 402. 404. 408. 430
Musikreform, florentinische
Antike in der 258. 263ft
277f. 283. 286. 294ff.
414. 424. 433 436.
Register
Musikreform
Theatermaschinen und
395f. 437.
Musiktheorie
Antike 265. 283. 286.
296. 395. 425
Begriffe der, als allego-
rische Figuren 265. 270.
294 f. 398. 412. 425
Florentinische siehe Mu-
sikreform
Kosmologische 413.
Theater und 265. 283.
396. 425. 433
Muzio Piacentini, Hoch-
zeitsgedicht fiir Ferdi-
nanda I. 297
Myconius, Frid., fiber Neu-
mondskonstellation 541
Mythographus III
Gotterbeschreibungen
des 12. Jahrh. 462. 627.
642
Graziengruppe 640
Museu 414
Vesta 642
Mythoiogie srene Aniike
sowie die Namen der
einzelnen COtter
Nligelin, Johann, deutscher
Name Carious 532
Naldi, Naldo, Planeten bei
417
Namen
Bilder 115. 152. 193. 317.
326. 330. 346. 361. 532
Omina 131. 341. 464.
506. 628
Nancy, Schlacht bei, Tod
Karls des Kfihnen 192.
203
Nannina di Piero de' Me-
dici, Heirat 15of. 342
Nativitliten
Chigi, Agostino 511. 563.
65o
Cicero 503. 543
Erwfirfelte 629
Ferdinand, Konig 498. 539
Karl V. 498. 539
Luther 497 499ff. 515.
54Iff. 564 647f. 654
Margarethe Melanchthon
494 537
Register
Nativit1iten
Maximilian I. 526
Melanchthon 496
Reymanns Kalender 508
Sammlungen 498f. 539
Schema 508
Neapel
Aquarium, Fresken 583
Aragonesen in, s1ehe Al-
fonso, Ferdinanda
Filippo Strozzi 161 ff.
Flandrische Teppiche 229
Matteo Strozzi 162. 204
TriumphzugAlfonsos359f.
Necessitas
Beschreibung
Bardi 271 ff. 429
Cartari 270. 412
Ficino 414
Horaz 28o. 431
Plato 269. 271 f. 279f.
429. 431
Darstellung
Buontalentis Zeich-
nung 267. 279 431
Caracci, Stich 276
Kostiim von 1589: 277.
279ff. 398. 402. 43If.
Neckam, Alexander, Autor
von Gotterbeschreibun-
gen des 12. Jahrhunderts
627
Nectanebus, Zauberer, Alex-
andersage 629
Nemesis, Polizian und Du-
rer 448
Nemours, Duca di, siehe
Giuliano di Lorenzo de'
Medici
Neptun
Briefmarke 258. 393
Biihnenfigur 258. 393
Delphischer Gott z88f.
420f.
Miniatur zu den Gedich-
ten des Lorenzo 3II
Polizian 7
Siegel 258. 393
Nergal-et;ir, Babylonischer
Augur 525
Nerli, Lisabetta und Gio.
Battista, Tochter und
Schwiegersohn Sassettis
131
Nero, Miinze 157
New York
Metropolitan-Museum,
Memling-Portrltts 197ff.
Sammlung Bache, Ghir-
landajo-Portr1it 132
Zei tschriften 57 3
Nicander fiber Schlangen
625
Niccolini, Lorenzo, Besitzer
von Sassettis Haus 132
Niccolo da Correggio, Fabu-
la di Caephalo 36. 290
Niccolo Fiorentino
Lorenzo,Medaille102. II5
Pi co della Mirandola, Me-
daille 39 327
Poliziano, Medaille 39
103.
Tornabuoni-Medaillen
29ff. 39 312. 320
Niderhoff, Danziger Reeder
192
Nietzsche, Friedrich, fiber
Entstehung der Oper 42 If.
Nikolaus von Wyle, Uber-
setzung von Enea Silvios
Briefen 359
Nikopolis, Schlacht bei 248
Nimrod, Finiguerra-Zeich-
nung 73
Niobidengruppe, Nachleben
448f. 625
Noah in der Bilderchronik 73
Nori, Francesco, Gevatter
von Lucrezia Ardinghellis
Sohn 88
Norwegen, Kltstchen mit
Hosenkampfdarstellung
180
Novalis, Zitat fiber Einfiih-
lung 307
Niirnberg
Diirers Herkules, Germa-
nisches Museum 447
Gauricus in 498. 539
Humanismus in 485. 491.
563. 645
Nursia, Venusreich 324
Nuvoli, Villa Sassettis 133
Nympha
Charakter
Ausdrucksbedeutung
siehe Antike (Bildmo-
tive)
Aura 21 f. 3II
Nympha
Charakter
Begleiterin der Diana
(Luna) 47 66. 290.
322. 418. 435
Gewandung siehe
Tracht all' antica
Gottin siehe Diana, Ve-
nus Virgo
HaartrachtsieheTracht
all' antica
Laufende 66. 84f. 289f.
435f.
Mltnade 13. 21. 37
szf. 84. 308. 337 412.
446. 477
Medusenfliigel 84. 86.
182. 315. 336ff. 477
Tanzende 21. 32. 84.
II2. 318. 337 420
Theologisch gedeutet
323. 420
Tragende 290.421.435.
Verfolgte und Geraub-
te 14f. 31 ff. 35f. 65.
II2. 316ff. 435
V erkorperung e ~ s t i m m
ter Personen 45 47.
50. 65. 84. II2.
325ff.
Victoria75. 84. 337 477
Darstellung
Botticelli siehe Botti-
celli (Nympha)
Cassone, J acopo del
Sellaio 317
Fest- und Theaterfigur
s. Festwesen (Motive)
Fresken
Ghirlandajo 66f. 85.
157. 175. 290
Sixtinische Kapelle
66ff. 290. 322
Holzschnitte
Boccaccios .,Ninfale"
289. 316f.
Frezzis ,. Quadrire-
gio" 415
Guarinis ,.Pastor Fi-
do" 291
H ypnerotomachia
19. 290. 435
Pulcis ,.Driadeo"289.
421
Tasso ,.Aminta"29d.
706
Nympha
Darstellung
Kupferstiche
Agostino Veneziano
290
Bacchus und Ariad-
ne 290
Baldini 86. 325 f.
338f. 477
Otto-Teller 82. 84.
182. 336ff.
Lippi, Fra Filippo 32.
66. 84. 290. 337 435
Miniatur zu Lorenzos
Gedichten 311
Plastik
Donatello 13. 84. 337
Duccio, Agostino di
12ff. 29. 308.
Lionardo 52.
Tafelbild, Fra Carne-
vale 421
Zeichnungen, Buonta-
lenti 267. 289
Zeichnung Lionardo
sxff.
Literatur
Acciajuoli, Zanobio 41
Boccaccio 35 289.316.
Dante 420
Filarete 21
Horaz 40.
Ingegneri, Angelo 291 f.
436
Leone de' Sommi 291.
436
Ligorio, Pirro 21
Longus 314.
Lorenzo de' Medici 35.
289.
Niccolo daCorreggio 290
Ovid 32. 34 65.
Pastoralen 290ff. 435.
Polizian 7 16. 34 45
47 5If. 65. uz. 290.
317
Pulci, Bernardo 50f.
Savonarola 290. 435
Obsequens, Julius, Herau-
geber Lycosthenes 522
Occasio (Kairos), Renais-
sance-Darstellung 151;
siehe auch Fortuna (Ty-
pen)
Octavian, Kaisers. Augustus
Odysseus
Ligorio, Pirro 21
Miniatur, Christine de
Pisan 311
Osterreich, Johanna von
siehe Johanna von Oster-
reich
Ogilby, John, Vergiltiber-
setzung 393
Ombrone, FluBgott bei Lo-
renzo de' Medici 36
Omina siehe Monstra (Por-
tenta), Namen, Zahel
(Weissagungsbuch)
Oper, Entstehung 258.
262ff. 265. 294ff. 395.
410. 419. 421. 436.
Orakel siehe Prophezeiung
Orient
Bedeutung ftir die Astro-
logie465. 467.56 Iff. 564
Beziehungen zum Abend-
lande siehe Bajazet, By-
zanz, Johannes Palaeo-
logus, Konzilien, Kreuz-
zugsplline, Mohammed
II., Tracht (byzanti-
nische), Ttirken
Orliac, Johann von, Stifter
des Isenheimer Altars 372
Orosius, Weltperioden 72
Orpheus
Btihnenfigur 317ff.
Cassone, Jacopo del Sel-
laio 317. 447 624
Polizian 33. 36. 113.
290. 295 317 446f. 624
Tod des
Antike Vase 446
Holzschnitt, Ovidaus-
gabe 446. 624
Kupferstich (Manteg-
na-Schule) 37 445ff.
453. 623
Majolika, Museo Correr
Venedig 37 446. 623
Theater37. 317ff.446f.
Zeichnungen
Diirer 37 445ff. 454
461. 623
Giulio Romano ( ?)
446. 623
.,Mantegna" -Skiz-
zenbuch 446
Registey
Orphische H ymnen bei
Ficino und Fico 327
Orsini
Clarice, Frau von Lorenzo
de'Medici 88. 103. 106.
122
Verginio, Mitglied der
Crusca428
Os, Peter van, Druckoffizin
651f.
Osiander, Andreas
Melanchthon an 501
.,Wunderliche \Veissa-
gung" 521
Osthoff, Hermann, Sprach-
philosophie 363
Otranto, Eroberung 391
Ottheinrich, Pfalzgraf, und
Leovitius 516
Otto, Peter Ernst, Besitzer
der Otto-Prints 79 332
Otto-Prints siehe Baldini
Ovid
Nachleben
Allegorisierung siehe
Ovide mora!ise
Boccaccio 35
Botticelli 33 65. 320.
478
Berchorius 627
Cartari I 7 f.
Chaucer 315.
Illustrationen 36. 317.
446. 652
Moralisationen siehe
Ovide moralise
Polizian 14ff. 16f. 34f.
42. 309. 446
Pontanus 313
Pulci 314
Theater 318; siehe auch
oben: Polizian
"Obersetzungen 33 446.
462. 624. 627f 652
Werke
Ars Amatoria 16
Fasten 14ff. 17. 32. 34.
42. 65. 320. 652
Metamorphosen 14ff.
17. 33 36f. 6s. 314.
446. 652
Ovide moralisC
Achill auf Skyros 311
Apoll und Daphne 316
Register
Ovide moralise
Berchorius und 462. 627.
640
Gotterbeschreibungen
453 457 462. 478. 627.
Grazien 640
Miniaturen 413. 462.47If.
627f. 640
Signum Triceps 413
Tradition antiker Mytho-
logie durch 311. 453
457 627f.
Oxford Bibliotheca Bodlei-
ana
Basinius-Hs. 327
Liber Bolhan 629
Padua
Giostra 1466: 48
Humanismus 485. 492
Paulus von Middelburg
514
Salone della Ragione,
Fresken 466. 497 5I6.
562. 565. 628
Palaeologus, Johannes siehe
Johannes
Paleologo, Teodoro, Freund
Sassettis I 3 I
Palermo, Filippo Strozzi in
I62
Pallas
Botticelli 7. 23 ff. 59 84.
87. 3I2. 339 643
Biihnenfigur 264. 425
Fresko
Palazzo Schifanoja 464.
469. 643
Schule von Athen 643
Holzschnitt zur Giostra-
Ausgabe 24f. 3I2
Intarsia, Urbino, Palazzo
Ducale 59. 84
Manilius 4 70. 628. 643
Schild siehe Medusa
Schutzfunktion 2 3 f. 59
469f. 628. 643
Zeichnung, Buontalenti
264
,.Kinder"
Raffael643
Schifanoja-Fresken
469. 643
Palluzzelli, Paolo, Assistent
Cavalieris 263
Palmieri, Matteo, Beschrei-
bung des S. Giovanni-
Festes 48. 363
Palmyra
Altar des Malachbel aus
387
Fresko, Achill auf Skyros
31I
Pannartz, Drucker, Plinius-
ausgabe 22
Panni
Bilderkreis 211. 229.
381
Ersatz fiir den Tcppich
187. 206. 229. 371 f.
Mediceische Inventare
2II. 381
Stil 187. 206. 2II
Panormita, Antonius, Tri-
umph Alfonsos 360
Pantomime siehe Attribute,
Triumphzug
Panzano siehe Bindaccio,
Fruoxino
Paolini, Hochzeitsgedicht
fiir Ferdinanda I. 297
Paolo da Venezia, Weih-
nachtslegende, Stuttgart,
Geml\.ldegalerie 362
Pl!.pste
Alexander VI.
Gesandtschaft Piero de'
Medicis 3I2
Wachsvoto u8
Bonifaz VIII., iiber die
Florentiner 204
Clemens VII. (siehe auch
Giulio di Giuliano de'
Medici)
Bibliothek des Sassetti
I34
Gauricus und 499
Ventura Sassetti im
Dienste von I44
Wachsvoto uS
Eugen IV., Unionskonzil
367. 389
Felix V., Teppiche 227
Innozenz VI. und Polizian
I21
Johann XXII., Bildzau-
ber 100
Johann XXIII., Emblem
52 I
707
Papste
Leo X. (siehe auch Gio-
vanni di Lorenzo de'
Medici)
Acciaiuoli, Bibliothe-
kar 354
Kalenderreformplane
517
Kapitolfest 330
Wachsvoto I IS
Martin V., Teppiche 189
Paul II., Teppiche 227
Paul V., Sta. Maria Mag-
giore, Saule 362
Pius II.
Kreuzzugsplane 390ff.
Mantuaner KongreB
391
,Somnium de fortu-
na" 359. 365. 391
Sismondo Malatesta
und 309
Venusberg, tiber 324
Pius V., Memlings Pas-
sion im Besitz von
377
Sixtus IV.
Rappresentazione, Hi-
storia o n ~ t a n t i n i 391
Rechtsstreit Portinari-
Hansa I92
Empfang der Eleonora
d' Aragona 322
Paranatellonta, Lehre 465.
466. 530. 562. 629
Parenti, Marco, Schwieger-
sohnder Alessandra Stroz-
zi I95f.
Parigi
Alfonso, Beteiligung an
den Festen I 589: 398.
399-4I6
Giulio
lntermedien von 1615,
Zeichnungen 427
Zeichnungsbande Vasa-
ri-Buontalenti (falsch-
lich zugeschrieben)
267. 427
Paris (Frankreich)
Berchorius in 627
Bibliotheken
Bibliotheque de 1' Arse-
nal, Basinius-Hs. 327
Paris (Frankreich)
Bibliotheken
Bibliotheque Nationale
Angulo-Hss., lat. und
franzos. 632
Druck der .,Payse"
385
Echecs Amoureux,
Kommentar 628
Nicander-Hs. 625
Otto-Teller 79 8If.
332
Ovide moralise-Hs.
471f. 628
Ptolemaus-Hs. 366
Zotori Zapari-Hss.
632. 634
Gebaude
Pantheon, Fresken des
Puvis de Chavannes
584
Sammlungen
Cabinet des Estampes,
Federzeichnung des
Hausbuchmeisters 234
Collection Gaillard 226
Louvre
Bellini-Skizzenbuch
29. 412
Botticelli-Fresken
28f.
Giulio Romano-
Zeichnung 446. 623
Jan van Eyck, Ro-
lin-Madonna 228.
Mantegna, HI. Seba-
stian 219
Memlings , , J iingstcs
Gericht" (zu Napo-
leons Zeit) 191
Perugino, Tugenden
und Laster 323
Tabula Bianchini
467
Musec des Arts decora-
tifs, Teppiche, 223ff.
226
Paris (von Troja), in der
Bilderchronik 74 f.
Parker, Gilbert, im Chap-
Book 572
Parma, Galleria, Pellegrino
Tibaldi 4II
Farnall siehe Museu
Parthenon, Nachzeichnung
des Cyriacus von Ancona
155
Par zen
Auffiihrungvon 1589: 276
398. 402. 405
Bardi 271 ff. 429
Ficino 414
Plato 269f. 271 f. 279f.
429
Stich, Caracci 276
Zeichnung Buontalentis
267. 279f.
Passe, Crispin de, Hosen-
kampfstich 368
Passerotti, Astrologenpor-
trat 172. 367
Passignani, Beschrcibung
der Feste von 1567: 265
Passion Christi - -
Bilddarstellungen24.215f.
Typologische Deutung
439f.
Pasti, Matteo de', Brief Al-
bertis an 12
Pastorale
Nympha und 290. 421.
435f.
Oper und 295. 421. 434
437f.
PathosstilsieheAntike (Wir-
kungen)
Patrizzi, Francesco
Anteil an der :\Iusik-
reform 270
Bardi und 270. 412
Harmonia Doria 270
Pythonkampf 283 ff. 434
Tanz 418
Paulus Burgensis de S. Ma-
ria iiber Weltperioden
493 536
Paulus von Middelburg
Planetenkonjunktion von
1484: 514. 524. 651. 654
Verhl!.ltnis zu Gauricus
517f.
Verhl!.ltnis zu Lichten-
berger 514f. 518. 526
Pausanias iiber Magna Ma-
ter 641
Pavoni, Giuseppe, Beschrci-
bung der Feste 1589:
26If. 28of. 297. 422. 423.
432
Register
Pazzi, Familie
Filiale in Briigge 202 ff.
Kapelle 367
Verschworung 99 192.
391
Peele, George, Elisabeth
von England feiernd 415
Peintre des Bourbons, Ver-
haltnis zu florentinischen
Meistern 220
Peixotto, Ernest, Illustra-
tionen in .,The Lark" 577
Pelletier iiber Luthers Ho-
roskop 648
Pentheus, Tod des, auf Sar-
kophagen 446
Peretola, Bauern von, Mai-
baum 261 f. 423
Peri, Jacopo
Anteil an der Musik-
reform 263. 295. 424.
437
..Daphne", Oper 265.
295 425. 437
Sanger 275.294300.405.
406
Persephone
Raub
Claudian 15
Finiguerra-Zeichnung
74
Polizian 7 13. 15
Symbol der Wiederkehr
siehe Wiederkehr
Perseus
Amulette 650
Fresko, Villa Farnesina
562. 649.
Miniatur, Germanicus-
Hs., Lei den 467. 562
Paranatellon des Wid-
ders 466. 562. 629
Dberwinder 390. 649.
Waffen siehe Medusa
Persien, Etappe der Stern-
bilderwanderung 466
Perugia
Arndes als Drucker in
454 485
Beziehungen zu Ham-
burg und Liibeck 454
485f.
Bluthochzeit 354
Flandrische Weber in 187
Museum,Venus-Relief 310
Register
Perugia
San Bernardino, Fassade
12.
Perugino, Pietro
.,Kampf der Tugenden
und Laster" 323
Sixtina-Fresken 67
Zeitgenossisches Urteil
iiber 68
Peruzzi, Baldassare, Farne-
sina-Fresken 367. 5II.
562. 563. 649.
Pervigilium Veneris
!tal. "Obersetzung 307.
Vermeintliche QuelleBot-
ticellis 309
Pesaro
Einzug der Maddalena
Gonzaga 289. 323
Hochzeit
Sforza-Aragona 1476:
329. 417
Este-Urbino 1571: 3I8
Pesellino Francesco, Antike
bei 74
Peter der GroBe von RuB-
land und Memlings
.,Jiingstes Gericht" 373
Petrarca, Francesco
Amors Bestrafung 183.
369
Apoll und Daphne 317
Bonilaccio, bei 313.
Fortuna 357 358
Graziengruppe 640
Laura 65. 317
Miniatur zu den .,Rime"
3I7
Quelle: Ausonius 183.369
Signum Triceps 413
Trionfi, Darstellung
Kupferstiche 150. 183.
I87f.
Teppiche 187.
Petriboni, Familie, Kapelle
in Sta. Trinita 138
Petroni, Benedetto, Beteili-
gung am Fest von 1589:
402. 409. 417
Petrus Noxetanus, Brief
Enea Silvios an 360
Peucer, Caspar
Divination, iiber 492
Schwiegersohn Melanch-
thons 494
Peutinger, Konrad
Melancholie, iiber 526
Ratgeber Maximilians I I 9
526
Pfeyl, Johann, iiberLuthers
Geburtstag 501 f.
Phaeton, Himmelsreise 247
.,Phebo et Cupido" oder
,PheboetPhetonte", my-
thologische Rappresenta-
zione 36. 295. 42I
Philadelphia, Sammlung
Widener, David des Ca-
stagno 449 625
Philipp der Gute von Bur-
gund
Besteller von Teppichen
225ff. 247f. 387
Handelsverkehr mit den
Medici I93
Kreuzzugsplane 387
Portra.t
Alexanderteppich
247f.
Schwanritterteppich
387
Philipp der SchOne, Bestel-
ler von Teppichen 226
Philipp von Cleve, Biirge
Maximilians 236.
Philipp von Hessen, Prophe-
zeiung iiber 494
Philipp von Mazedonien,
Vorbild Philipps von
Burgund 248
Philipp II. von Spanien,
Politik 257. 34I
Philippi, Vespasiano da Bi-
sticci iiber 389 f.
Phobus, astrologisch siehe
Sol, mythologisch siehe
Apollo
Picardie, Heimat der Bilder-
ratsel 85
Picatrix
Autor 527. 564. 657
Bedeutung 527. 53If. 564
Dekane 629. 63off. 633.
636. 638. 639
Handschriften 527.
Jupitermagie 515. 527
Sympathetische Zuord-
nungen 640
Piccolomini, Enea Silvio
siehe Papst Pius II.
Pico della Mirandola
Galeotto, Hochzeit 474
642
Giovanni
Conclusiones 327
Gegner der Astrologie
474
Kommentar zu Beni-
vieni 327
Medaille (Grazien) 39
327
Planetenkonjunktion
von 1484: 5I4
Portrat (angeblich) 25
Pierfrancesco de' Medici,
Steuererklarungen I67f.
Pieri den
Biihnenfiguren 402. 405
Stich des Alfiano :299
Tafelbild Tibaldis 4II
Zeichnung Buontalentis
267. 425
Fiero della Francesca
Entstehung der Areti-
ner Fresken 390
Konstantinschlacht 175.
188. 253f. 390
Portrat des Johannes
Palaeologus 253f. 389.
Vertreter des Realis-
mus 175. 188. 253.
Fiero di Cosimo de'
Medici
Portrll.t der Simonetta
49 323
Affenbecher im Besitz
von 181
B;iefe
Medailleur Lodovico
an 370
Portinari an 377f.
V errinus an 34
Haupt der Firma 130.
193. 199. 375.
Lorenzo und 82f. 335
Steuererklarung 168
Fiero di Lorenzo de' Medici
Brief Polizians an 105.
I2I f.
Franco tiber 106. 122
Kinderbriefe 343
Impresa 23. 311.
Lorenzo iiber 120
710
Piero
di Lorenzo de' Medici
Mediceische Bibliothek
353f.
Portrat
Botticelli 2 5
Ghirlandajo 103 f.
Romreise 3 1 I f.
Pieroni, Alessandro, Betei-
ligung am Fest I 589: 407.
417
Pierre II. de Bourbon, Ma-
ler von 220
Pietro d' Abano
Abu Ma 'schar-Oberset-
zung 466
Herausgeber des Mesuc
642
Prisciani, zitiert bei 475
480
Verfasser des Astrolabi-
um Magnum 465. 466.
5I6. 562. 628
Pighius, Codex des, siehe
Berlin, Staatsbibliothek
(Codex Pighianus)
Piissimi, Vittoria, Schau-
spielerin, Auftreten Flo-
renz 1589: 26I
Pinturicchio
Fresko im Vatikan, Gauk-
ler 440
Sixtina-Fresken 66.
Pirckheimer, Willibald, Du-
rer an 624
Pisa #
Baptisterium, Kanzel I2
Belagerung 1499: 202
Matteo Franco in I06
Museum
antike Vase 12f.
antiker Sarkophag 446.
623
Pisanello, Vittore
Portrll.t des Johannes Pa-
lll.ologus, Medaille 254
Trachtenrealismus 31.188
Pisano, Niccolo, Kanzelre-
liefs, Pisa 12
Pitti, Familie
Gegner der Medici I 50
Palazzo, siehe Florenz
(Sammlungen resp. Alte
Stadtanlagel
Planeten (siehe auch die ein-
zelnen Namen)
Bilder
Blockbucher 179f. 463.
472. 473
Biihnenfiguren 273
275f. 277 317. 398.
400. 402. 405. 406.
417. 430ff.
Fresken
Liineburg, Rathaus
486. 507. 563
Rom
Sta. Maria del Po-
polo 5II
Villa Farnesinas I I
563. 65o
Hl\userfassaden 454
457486. 507563. 646
Holzschnitte
Burgkmairs 457 486.
507. 646
Carious Prognostica-
tio 510
Kalender 454 463.
485. so6f. 645
Kupferstiche
Baldini 86. 113. 179.
325f. 338. 414. 477
644. 646
Tarocchi 271. 412.
429. 453f 457 472.
4
s5f. 507.
5
6
3
. 628.
643 645f.
Plastik
Landshut, Residenz
457 462
Rimini, Ag. di Due-
cia 12. 271. 453
Zeichnungen
Buontalenti 267.280.
427. 432
Durer 457 485
Doktrin
Kindschaftslehre 325 ff.
472f. so6f. 530f. 643
654ff.
Konjunktionen siehe
weiter unten
Monatsregenten 322.
326. 462f. 464f. 469f.
476. 478. 491. 506.
Musen und 271. 413 f.
429
Planeten
Doktrin
Register
Olympische Gotter und
184. 325f. 462 f. 470ft.
476.511. 56J.640.643
Spharentanz und -har-
monic 277. 324. 4I2ff.
417. 475f.
Tagesherrscher 462.465
474 491. 506
Weissagung siehe Pro-
phezeiung
Literatur
Ausonius 413 f.
Ficino 528
Gafurius 271. 413f.
429f.
Jonson, Ben 324. 417
Lorenzo 417
Wanderung siehe Antike
(Dberlieferungsformen)
Planetenkinderbilder, siehe
Baldini (Planeten) und
die Namen der einzelnen
Planeten
Planetenkonjunktionen
Periodisehe 500. 5o4f.
508. 553 555 f. 653 f.
Prophet von 1484:
50rf. 514. 518. 524.
529. 531. 555. 563.
65o. 653f.
Siindflut von 1524:
509. 512. 544 651
Plato
Begriffe
Furor 327
Harmonia Doria 270.
429
Necessitas 26gf. 27I f.
429
Parzen 26gf. 271 f. 429
Pneuma 390. 644
Sirenen 269. 271 f.
Sphl\renharmonie 269 f.
270f.
Nachleben
Baif und Ronsard 275f.
Bardi (Camerata) 265.
269f. 27If. 279f. 425.
429. 431
Botticelli 65. 87. 327.
339 478. 644
Bruni, Leonardo 328
Register
Plato
Nachleben
DschelfU-ed-Din Rumi
420
Ficino 148. 327. 414.
Landino 39 312. 320
Lichtenberger 551
Pica della Mirandola 39
327
Vasari 282
Platonismus, Eros 39 65.
87.312.320. 327f. 478.644
Plinius
Aurae 21 f. 3II
Filarete iiber 21
Kometen 533
SchlangenbiB 440
Vasari 282
Plutarch
Musen 412
De Musica 270
Vitae, Hs. in Cesena 389
Pluto
Finiguerra-Zeichnung 74
lntermedien rs8g: 396.
405. 408
Poggio Bracciolini
Entdecker einer Lucrez-
Hs. 41
Facezien 379
Polaritat
BildhafterAusdruckr46ff.
149. 151. 153 ISS 205.
228. 354 362. 364.448.
531. 649
EinfluB der Antike 55
66. 176. 448. 463. 474
479 491. 492. SII f. 529.
531. 534. 564
LogischesPhanomen 49 I f.
504.so5f.s2o.s34f.s6s.
6r8
Psychologrsches PM.no-
men 72. roof. uo.139f.
146ff. 149. rsr. 153.
155 158. 205. 228f.
247. 344 356. 364.
520
Polen
Gesandtschaft in Frank-
reich 1572: 258
Melanchthon iiber 494
537f.
Polifemo in Polizians Gio-
stra 7
Polixena, Finiguerra-Zeich-
nung 75
Poliziano, Angelo
Antike
Horner 7
Claudian I4. rsf. 43
Horaz 41.
Lucrez 41. 321
Moschus 309
Nympha siehe diese
Ovid 14ff. 17. 33ff. 42.
309. 446f.
Vergil 31
Portrl!.ts
Ghirlandajo, Fresko
103f. 303
Spinello, Medaille 39
103
Werke
Elegie auf Albiera degl'
Albizzi 47 314. 325
Epigramme ro. 23ff. 34
Giostra 7 13ff. 33ff.
42 f. 45 49. sr f. 65.
II2. 324
Gelegenheitspoesie
II2f.
Kommentar zu Ovids
Fasten 34f.
Ode .,in puellam su-
am" 47.
Orpheus 33ff. 36. 37
II3. 290. 295 317.
446. 624
Rusticus 41 ff.
Zeitgenossen
Alberti 13. 16. 309
Botticelli 7 10. 17. 22.
23. 33 35 4rff. 45.
s
4
. 6sf. 87. 309. 321.
339 447 478
Donatus, Hieronymus
126
DUrer 448
Franco, Matteo 105.121
Giuliano und Simonet-
ta siehe oben: \Verke
(Giostra)
Lionardo 5 I f.
Lorenzo de' Medici 35
65. ro3f. ro8f. 123f.
Piero di Lorenzo 23f.
ros. 121 f.
Tornabuoni, Lorenzo
39
7II
Poliziano, Maria, Portra.t
{Medaille) 39
Polk, Willis, Illustrationen
in .. The Lark" 577
Pollaiuolo, Antonio
David, Lederschild { ?)
449 625
Diirer-Vorbild 447
Frauenraub, Stich 447
Goldschmied 86. 339
Herkulestaten
Fresken 229. 447 624
Stich 623
Kampfszene, Zeichnung
446. 623
Lorenzo-Portrat
Medaille 102. 343
Terrakottabiiste ror
Mischstil r 7 5
Pathosformeln 8of. 85.
175 229. 333 337 446.
461
Wirklichkeitssinn 63
Pollaiuolo, Piero, Herkules-
fresken im Palazzo Me-
dici 229. 447
Pollux, Julius, Python-
kampf 284. 286. 295.
419. 437
Pomona
Antike Plastik 38. 319
Holzschnitt, Hypneroto-
machia r8
Vorbild zum Typus der
Hl. Dorothea 320
Pontanus, Jacobus
Lucrez und 321
De Magnificentia 344
Sl'hiiler Bonincontris 539
Vergilausgabe 3 r 3
Pontelli, Baccio, Pallas in
Urbina 59
Pool, Maria Louise, im Chap-
Book 572
Porcellius, Triumph Alfon-
sos 359
Portenta siehe Monstra,
Prophezeiung
Porter, Bruce, ,The Lark",
Herausgeber, Illustrator
573 576f.
Portinari
Acerrito di Folco, Bruder
Tommasos in Mailand
377
712
Portinari
Antonio di Tommaso
Gesch1iftsnachfolger
seines Vaters 200 f.
Portr1it von Hugo van
der Goes 197f. 209.
Benedetto di Pigello,
Portr1it Mernling 20If.
210
Dianora di Tommaso 198.
209f.
Folco (Canonico). Fami-
liennachrichten 197.
209f.
Folco di Pigello, Nachfol-
ger Tommasos in
Briigge 201 f. 373 380
Folco di Tommaso r98
Folco Vecchio, Griinder
des Spitals von Sta.
Maria Nuova 201
Francecso di Tommaso,
Geistlicher 198. 201
Gherardo di Tommaso
198
Giovanni, Milit1iringe-
nieur 329
Giovanni Battista diTom-
maso, Biographische Da-
ten 198
Guido di Tommaso, Bio-
graphische Daten 197.
201. 209f. 379
Margherita di Tommaso,
Geburtsdatum 198.
209f. 378
Maria, Gattin Tommasos,
siehe Baroncelli (Maria)
Maria di Tommaso, Por-
tr1it von Hugo van dec
Goes 198. 209f.
Pigello di Folco, Ge-
sch1iftsvertreter in Mai-
land 372
Pigello di Tommaso, Por-
tr1it von Hugo van der
Goes 197f. 209f.
Tommaso di Folco
Besteller von Bildern
190. 197. 209. 376.
Briefe an Giovanni de'
Medici 187. 371 f.
Briefe an Piero de' Me-
dici 377f.
Portinari
Tommaso di Folco
Charakteristik 199f.
378
Heirat 377f.
Karl der Kiihne und
192. 200. 203 378
Kaufmann 13r. 192.
193 f. 200. 373 375 f.
Kinder 197. 378
Lorenzo und 200
Maximilian I. und 200
Portr1its 197ff. 209f.
Porto Venere, Geburtsort
der Simonetta 324
Portr1it
Bedeutung
Bildzauber, nachleben-
der99f. II9. 138.158.
188f. 204. 34If.
Flandrischer Stil I 16.
188. 205. 228.
Herauslosung aus der
kirchlichen Kunst 97
99 139 158. 188f.
204.
Psychologie des Bestel-
lers 95 97 99f. 138f.
158. 188. 192. 198ff.
204. 372
Realism us und Andacht
xoo. 189. 204i. 228
Stilbildung durch den
Besteller (siehe auch
Stifter, Stifterbild) 95
189. 192. 198ff. 204.
372
Totenmasken I 19. 343
Kiinstler
Bertoldo 391
Botticelli 25. 46ff. 53
66. 340
Bronzino 104
Eyck, Jan van 189.
Filippino 107
Ghirlandajo 96. 101.
1o3f. 105ff. n4. 132.
135
Goes, Hugo van der
197ff. 202.
Gozzoli 82. 334 389
Hausbuchmeister235ff.
Marmion 374
Memling 190.196.197ff.
201 f. 20J. 376f.
Portrllt
Kiinstler
Register
Piero della Francesca
253f. 390
Piero di Cosima 49
Pisanello 254
Pollaiuolo 101. 102
Rosellino 139.
Spinello 39 102 f.
Kunstgattung
Cassani 340
Fresken 82. 96. 101 ff.
105 f. 107. 135 25Jf.
389
Kupferstiche 81 f.334ff.
343
Medaillen 29. 39 1oif.
103 f. II5 254 312 f.
320. 343370391
Plastik 99 II9 139.
200
Tafelbilder 25. 46ff. 49
53 66. 104. 132. 189.
197ff. 202. 367.376.
532
Teppiche 247. 257f.
387
Wachsplastik siehe Ex-
Voto
Zeichnungen 235ff.
Person en
Arnolfini 189f.
Baroncelli
Maria 198
Pierantonio 202f.
Carion 490. 532
Catharina Medici 257.
Fillastre 374
Franco 105.
Giuliano di Lorenzo
104. 343
Johannes Pal!!.ologus
253f. 389f.
Karl der Kiihne 247f.
Kinder Lorenzos 96.
103. 343
Leo X. 104. 343
Lorenzo 81 f. 99 101 f.
334f. 343
Maximilian I. 235ff.
Mohammed II. 391
Philipp der Gute 247f.
387f.
Poliziano
Angelo 39 103f.
Register
Portra.t
Person en
Poliziano
Maria 39
Portinari
Benedetto 201 f.
Tommaso 190. 197ff.
Pucci, Antonio 135
340
Pulci, Luigi 107f.
Sassetti, Francesco
IOI f. 132. 139f.
Tornabuoni, Giovanni
29
Vespucci, Simonetta
46ff. 49 53 66
Vorfahren Maximilians
II8f.
Vrelant ( ?) 377
Practica siehe Nativitaten,
Prophezeiung (astrologi-
sche)
Prato, Kathedrale, Lippi-
Fresken 32
Presse und Astrologie 509f.
513. 649
Primavera, siehe Friihling
Prisciani, Pellegrino
Bildung 475 480
Briefe
Isabella d'Este 479
Leonora von Aragon
475 479ff. 642
Inspirator der Scbifano-
ja-Fresken 474ff.
Procris des Niccolo da Cor-
reggio 36
Prodigien siehe Monstra,
Prophezeiung (wunder-
liche)
Prognostica, Prognostica-
tio siebeNativitAten, Pro-
phezeiung
Prokop von Rabstein, Brief
Enea Silvios an 359.
Propbeten
Elias, Spruch iiber die
Weltalter 493 495 523.
536f.
Jeremias, Spruch gegen
Astrologie 544. 548
Jesaias,Spruch,zitiert619
Kupferstiche 179
Mohammed, bei Lichten-
berger 555
Propheten
Verkiindung durch Pla-
netenkonjunktion 505.
SI4ff. 519. 533 542.
563f. 653f.
Prophezeiung
Antike 466. 49off. 497
so6. 525. 533 546ff. 562
629
Astrologische 464f. 492.
494497509.512ff.s38.
548ff. 562f. 629. 6sof.
654
Biblische 156. r8o. 362.
493 495 523. 536f.
HoroskopesieheNativitll.-
ten
Lichtenbergers siehe die-
sen
Paulus von Middelburgs
siehe diesen
Planetenkonjunktionen
siehe diese
Priscianis siehe diesen
Wiirfel 353 485. 629
.,Wunderliche" (durch
Monstra und Zeichen)
492. 494 496f. 512ff.
52Iff. 524f. 538. 544.
6sof. 653
Sibyllinische 72.156. 362 f.
552
Proportion, antike, Einflua
4953.66.448
Proserpina siehe Persephone
Prosperi, Bernardino, Be-
richt tiber den Karneval
1506 in Ferrara 318
Psellos, Bericht iiber Teu-
kros 562
Pseudo-Joachim, Papst-
katalog 521. 652
Pseudo-Kallisthenes, Alex-
anderroman 629
Psyche
Basinius Parmensis 327
Fresken Raffaels, Villa
Farnesina 477 SII
Ptolemll.us, Claudius
Lichtenberger, bei 551
Sternentanz 418
'Obersetzung des Jacopo
d' Agnolo da Scarperia
r68. 366
7I3
Pucci
Antonio, Portrats
Ghirlandajo 135. 340.
354
Cassone 340. 354
Alessandro und Sibilla,
Tochter und Schwieger-
sohn Sassettis 131. 135.
354
Kardinal, Enkel Sasset-
tis 131
Pucci- Bini, Hochzeitscas-
sone 135 340. 354
Pulci
Bernardo, Elegie auf den
Tod der Simonetta 45
so
Luca
Ciriffo Calvaneo 124f.
Dichter im Dienste der
Medici II I f.
Driadeo d' Amore 289.
314. 421
Epistole 330
Luigi
Briefe an Lorenzo 351 f.
Canzone an Lorenzo
326. 330
Ciriffo Calvaneo 124f.
,,CompareBartolomeo''
I25 f. 345 351 f.
Franco und 105. 108.
345
Gedicht iiber die Gio-
stra von 1469: 82 f.
II2. 124. 126. 326.
335f. 351 f.
Lorenzo und 107. III.
326. 344 345 351.
Morgante I 07. II 1 f.
124. 345 351 f. Holz-
schnittdazu II2. 124f.
Portrat
Filippino 107
Ghirlandajo ro7f.
Sonette ro8. 125
Pulzone, Bildnis einesAstro-
logen 172. 367
Puvis de Chavannes, Vor-
bild fiir Hugo Vogel582f.
584
Pyrrbus bei Luther 549
Pythonkampf
Antiker 283. 286. 419.
420f. 434
Pythonkampf
Bardi 265. 283ff. 286f.
294 4IO. 4I9. 425. 434
Beschreibung von de'Ros-
si 285 ff.
Buontalenti, Zeichnung
284. 4I I
Carracci, Stich 284. 411
Lukian 283f. 420. 434
Marco da Gagliano 295
437
Oper (Daphne) 265. 295.
437
Patrizzi 283 f. 4I9. 434
Poetik 284. 286. 419
Tanz 284. 287f. 295 419.
434
Zarlino 284
Pythonschlange siehe Dra-
che Apollos
Quaresima
Gemalde, Amsterdam 2 I I .
381
Kupferstich, Uffizien 211.
381
Tanz 2II
Rabatta, Familie,Filiale in
Briigge 203
Rabelais, Franc;:ois, tiber
Impresen 331
Raffaello Sanzio
Fresken
Schule von Athen 643
Villa Farnesina 477
5II
Freskenentwurf zur Grab-
kapelle Chigis 5II. 563
.,Grablegung" Gall. Bor-
ghese 354
Polizian und 10
Raffael-Schule, Konstan-
tinschlacht 175
Ramboux, Johann Anton,
Kopien der Fresken des
Fiero della Francesca
175 253.
Rappresentazioni 25. 36.
109. 156. 180. 188. 295.
363. 391. 421
Ratdolt, Erhard, Drucker
des Astrolabium Planum
465. 516. 562
Realism us als Stil, siehe An-
tike C0bergangsstil), Por-
trat (Bedeutung), Tep-
pich, Tracht alia franzese
Reinhold
Carion 533
Nativitll.ten 498. 502.
533
Reisch, Gregor. Abil Ma-
'schar bei 642f.
Rembrandt, Volksheimaus-
stellung 59 I f.
Remigius von Auxerre,
Kommentar zu Martia-
nus Capella 414. 462. 473
Reproduktion undBildwerk
59 d.
Reymann, Leonhard,
Nativitatskalender so8
Stindflutprophezeiung
509
Ricalcati, Ambrogio, Ver-
gerio an 517
Ricasoli
Lorenzo, Medici-Ver-
treter in Brtigge 203
Riniero, in Briigge 193.
203
Riccio, Andrea, Grabdenk-
mal della Torre 327
Riforma melodrammatica
siehe Musikreform (flo-
rentinische)
Rimini
Kloster Scolca bei 309
Tempio Malatestiano, Re-
liefs 12. 29. 271. 453
Rinuccini
Alamanno
Florentiner Beziehun-
gen zu Byzanz 391
\Vachsvoti in S. Gio-
vanni350
Cino, zur Tracht .,alla
franzese" 84
Ottavio
Anteil an der Musik-
reform 283. 294 433
437
,.Euridice" 295
,.Daphne" 265. 295.
415. 425 437
Dichter der Gesange in
den lntermedien von
1589:273. 285. 295.433
Register
Rinuccini
Ottavio
Huldigung ftir Maria
de' Medici 415
Sternenballctt 418
Ripa, Cesare, Harmonia415
Ripoli, Druckerei von II2.
125. 351.
Robbia
Andrea della, Gra bmal ftir
Fillastre 374
Luca della, Kronung Ma-
riae, LUnette 64
Rogati, Saverio, Dber-
setzung des .,Pervigilium
Veneris" 307 f.
Roger van der Weyden, Be-
ziehungen zu Italien I89.
211. 215f. 228. 382
Rolin
Antoine, Sohn des Nico-
las 225
Nicolas
Besteller von Kunst-
werken 224. 228f.
Philipp der Gute und
225
Wappen 224f.
Rollius tiber Maximilians
Gefangenschaft 235.
237
Rom
Aventino, Fundort der
Tabula Bianchini 467.
629
Bankhaus Medici in 130.
376
BerichtFilaretes tiber21f.
Flandrische Weber in 187
Kapitol, Theater auf dem
330
Wunderbare Tiberfunde
156. 521 f.
Bibliotheken
Vaticana
Bonincontri-Hs.
653f.
Fulgentius-Hs. 3IO
Hochzeitsbeschrei-
bung Pesaro 1476:
329
Lazzarelli-Hs. 643
Libro de los Yma-
gines 516. 528. 564
RBgister
Rom
Bibliotheken
Vaticana
Libellus de deorum
imaginibus462.471.
627f.
Ptoleml!.us-Hss. 168.
366
Vergil-Hs. 31
Zahel-Hs. 632
Gebl!.ude
Capella Sistina, Fres-
ken 63. 66ff. II4. 290.
322
Palazzo del Vaticano
Appartamenti Bor-
gia 440
Stanzen 643
Santa Maria
Araceli, Sarkophag
20f.
del Popolo, Capella
Chigi 5II. 563. 650
Maggiore, Sl!.ule vor
362
Santi Cosma e Da-
miano, Sarkophage I 3.
391. 623
Villa Farnesina
Alexanderfresken248
Astrologische Fres-
ken 367. 511. 562.
563. 650
Psyche-Fresken 477
5II
Sammlungen
Galleria
Barberini, Bild des
Fra Carnevale 42 1
Borghese, Raffaels
Grablegung 354
Corsini, Ghirlandajo-
Zeichnung 340
Doria-Pamphili,
Alexanderteppiche
243ff.
Spada, Astrologen-
bildnis 172. 367
Museo Vaticano
A poll vom Belvedere
448
Schlafende Ariadne
323
Pinacoteca Vaticana,
Fredella des Cossa 472
Romena, Ser Giovanni da
Ser Marco, Notar Forti-
naris 201
Ronsard, Pierre, hofischer
Dichter 257 392f.
Rosellino, Antonio, Werk-
statt, Portrl!.tbiiste Sas-
settis 139. 355
Rosselli
Cosimo, Sixtina-Fresken
66f. 290
Francesco, Beteiligung an
den Festen 1589: 398.
400f. 404. 405. 410. 416
Rossetti, Dante Gabriel,
tiber Botticellis Friihling
26
Rossi
Lionetto de', Agent der
Medici in Lyon 131. 141.
355
Sebastiano de'
Beschreibungderlnter-
medien
1585: 319
1589: 26rff. 264.
268. 27off. 277.
28o. 285. 289.
29Iff. 297. 411.
415. 423. 434.
Sitzungsprotokoll der
,Crusca" 428
Rosso, Zoane, Drucker der
Metamorphosen des Bon-
signore 33 446. 624.
052
Roth, Stephan, "Obersetzu ng
von Lichtenberger 513
545ff.
Rucellai
Bernardo, Heirat 15of.
Giovanni
Ausgleichspsychologie
146ff. 149. 356ff.
Bildung 357
Brief Ficinos an 146ff.
356
Fassade von Sta. Mar.
Nov. in Florenz siehe
Florenz (Gebl!.ude)
Finiguerra, tiber 75
Fortunasymbol 75 So.
146ff. 149ff. 330.
356ff. 364
Rombeschreibung 363
Warburg, Gesammelte Schriften. Bd.2
Rucellai
Giovanni
715
Verbindung mit den
Medici 149ff.
Wappen 146. 149
Weihnachtssage bei I s6
,Zibaldone" 146ff.
356ff. 363 ff.
Nannina siehe Nannina
di Fiero de' Medici
Rtihel, Johann, Luther an
522
Ruggieri, Cosimo, Hofzau-
berer Catharinas de' Me-
dici 341
Sabbattini, Nicola, tiber
Theatermaschinen 267
Sabinus, Georg, bei Melan-
chthon 495 538
Sacchetti, Francesco,
Wachsvoti n6
Sachs, Hans, ,Wunderliche
Weissagung" 521. 652.
Sacrobosco, Melanchthons
Einleitung zu 495 538
Sadan bei Prisciani zitiert
480
Sagramoro, Filippo, Wachs-
votobrauch 350
Sahl, 'O!man b. BiSr, b.
Habib b. Hani siehe Za-
hel
Saint-Omer, Grabmal und
Altarbild 373f.
Salimbeni, Nicolo Bartolini,
Namenzauber 132
Sallust
Druck1usgaben,
schnitt 652
Rucel!ai, bei 357
Holz-
Salome als ,Ninfa" 32. 84
Salomo, Finiguerra-Zeich-
nung 73
Saltini, G. E., tiber die
Nympha 290
Salutati, Coluccio
Fortuna 151
Musen 414
Salviati
Familie, Beziehungen zu
Burgund 201. 203
Bernardino, Notar im
Rechtsstreit Portinari
373
716
Salvrati
Giannozzo, Zibaldone
167f. 366
Sammler
Einflu6 auf die kiiustlcri-
sche Stilbildung xSr.
187. 2II. 215.223. 227f.
243 247. 371. 46If.
Flandrischer Kunst in Ita-
lien 181. 187 f. 2 I I. 215.
243 37If.
Teppiche und Panni als
Objekte 188. 206. 2 I r.
223. 227f. 243 247.
371. 46I
San, Sankt, Saut', Santa
vor Heiligcnnamen siehe
Heilige, als Kirchenbe-
zeichnung siehe die be-
treffenden Stl!.dte
San Casciano, Misericordia
354
Sandrart, Joachim von,
iiber Burgkmairs Frcsken
in Augsburg 646
San Franzisco, Druckort
von ,.The Lark" 573
San Gallo, Giuliano da
Antikenzeichnungen 53
155
Skulpturen am Grabmal
des Sassetti 154. 354
Sangiorgio, Carlo da, Divi-
nation 474
Sankt Gallen
Bibliotheca Vadiana, Au-
gulo-Hs. 632
Typologische Bilddarstel-
lung, Fresken 439
San Martino a Gonfieuti,
Villa Sassettis bei 133
Sannazaro, Jacopo, Liebes-
zauber 342
San Paolo, Uomiui della
Casa di 303
Sarazenen (siehe auch Tiir-
ken) ,Bogensch!itze auf Pi-
eros Konstantinschlacht
253f.
Sarepta, Bischof von, bei
Maximilians Friedens-
schwur 236. 238
Sarkophagplastik
Achillauf Skyros 20. 310
Alkestis I54f.
Sarkophagplastik
Amazonen 625
Eros uud Psyche 183
Grazien 30
Kriegergruppe 391. 623
Medea 13
Meleager 154 158. 354
Pentheus 446. 623
Putten 154
Vorbild fUr
Ag. di Duccio 13
Baldini 183
Giuliano da San Gallo
154ff.
Pollaiuolo 446. 623
Verrocchio 155
Sassetta, Schlo6, Herkunft
der Sassetti 145
Sassetti
Azzo, Grabmal in Sta.
Mar. Nov. 142
Baro, Patron des Hochal-
tars in Sta. Maria No-
vella 135 f.
Bartolomeo, Portra.t,
Ghirlandajo 98. 340
Cosimo di Francesco
Bibliothek des Fran-
cesco 134. 354
Gonfaloniere 355
Portrl!.t, Ghirlandajo 98
Notizie, nach den 131
Federigo di Carlo, Grab
in Sta. Mar. Nov.
(1651) 141:
Federigo di Francesco
Geistlicher g8. I43
355
Notizie, nach den 131
Portrl!.t Ghirlandajo
98
Sorge des Vaters fiir
141 f.
Filippo di Galeazzo, Ver-
kauf von Montughi
I44
Filippo di Giovambattista
Biliotti tiber 137
Ausgleichspsychologie
J64f.
Briefe 129. 353 364.
Fortuna, iiber 364
Lezione suite Impre-
se 152. 36r. 364.
Naturforscher 364.
Register
Sassetti
Francesco di Giovambat-
tista
Biliotti iiber 137.
.,Notizie" 129ff.
Francesco di Tommaso
Abstammung 129. 145.
355
Auftraggeber Ghirlan-
dajos 97 115. 134
138. 205. 209
Ausgleichspsychologie
100. I14f. 139.
144. 151. 153f.
155. 158. 364.
Bauta.tigkeit in Genf
133. 353
Bibliothek 133 134.
152!. I54 353f. 361.
362
Biographie, nach den
.. Notizie" 13off.
Ex-libris 15rff. 361
Fortuna 14If. 145. 151
Franziskus von As-
sisi, Patron des 97.
II5. 137. 155
Gelehrte Freunde 133
139 143 155 354
Grabmal us. 134 139.
141ff. 146.152. 154.
156. 158. 205 354
361
Impresa 151 ff.
Lorenzo und IJO. 135.
353
Motti 152ff. 1.58
Nachkommen 131 ff.
355
Namen-Wortspiel 152.
361
Portrats
Ghirlandajo rox. 132.
134. 138. 140.
33
Rosellino- Werkstatt
139. 355
Streit mit den Do-
minikanermonchen
II5. 134 135ff. 142.
355f.
Teilhaber des Bank-
hauses Medici 98.
1JO. 140. 144 192.
375f.
Regiseer
Sassetti
Francesco di Tommaso
Testament,
Bedeutung I 30. I 44 f.
355. 364
Text I4off.
Wappen I36. 142.
I52f. 362
Frondina Adimari, Hoch-
altarbild in Sta. Maria
Novella I35
Gaieazzo di Francesco
Portra.t Ghirlandajo 98
Notizie, nach den I31f.
Nera, siehe Corsi, Nera
Niccolo, Impresa (Schleu-
der) I52
Paolo d'Alessandro, Vor-
fahre des Francesco
I29
Teodoro I. di Francesco
Notizie, nach den 131
Portrl!.t Ghirlandajo 98
138
Teodoro II. di Francesco
Notizie, nach den I31 f.
Portrl!.t Ghirlandajo
132. 138
Sorge des Vaters fiir
I4If.
Verkauf von Montughi
355.
Tommaso di Federigo,
Grabmal 135. 140. I42f.
156. 355f.
Ventura di Tommaso,
natiirlicher Sohn 132.
I43144355
Saturn
Darstellung
Bilderwanderung 453
485. 507. 6srf.
Biihnengestalt 275
Finiguerra-Zeichnung
73
Fresko, Ltineburger
Rathaus 486
Kalenderbild 485.507.
649
Holzschnitt
Leoninische Orakel,
521
Reymanns Practica
509
Saturn
Darstellung
Lutherbild der ,Wun-
derlichen W eissagung"
521. 652 f.
Tarocchi 485. 507
Zeichnung Buontalen-
tis 267
Doktrin
Gegensatz zum Jupiter
508. 526ff. 529ff. 553f.
652
Horoskop Luthers 502.
504. 5I8. 542. 543
654
Planetenkonjunktion
von 1484: 502. 505.
5I4f. 5I8. 563
Zeitgott 507. 652.
Literatur
Bemardus Silvestris
652f.
Ficino 527
Horaz 531
Lichtenberger 529f.
55Jf.
Polizian 7
Saturnalienfest Nachleben
507
Saturnkinder
Acedia der 507
Diirer 529f.
Goethes Faust 653
Hamlet 507
Luther 505. 542. 648.649
Maximilian I. 526
Melancholic der 3I8
526ff. 529ff.
Miniatur, Kalenderhs.
Tiibingen so6f. 530
Vers im Ltibecker Ka-
lender 507
Satyr
Bedeutung als komische
Gestalt 21.7. 229
Filarete, bei 21
Lionardo Rothelzeich-
nung 53
Savinus, Rechtsgelehrter in
Siena 324
Savonarola, Girolamo
Bibliothek von S. Marco
354
EinfluB auf Benivieni 323
Gegner der Astrologie474
717
Savonarola, Girolamo
Nympha, iiber die 290.
435
Zeitliches Verhl!.ltnis zur
heidnischen Renaissance
I58. 3ZI
Sbarra siehe Giostra
Scaliger, J. J.
Sch werttanz 441
Sphl!.rentanz 419
Scarabelli, Orazio, Stiche
der Triumphbogen von
rs89: 394
Scarperia, Jacopo d' Agnolo
da, Ptoleml!.ustiberset-
zung r68
Schauffelein, Hans Leon-
hard,
Holzschnitt, Alex:ander-
legende 386
Miniaturen, Zahel-Hs. 532
Schauspieler
Andreini, Isabella 261 f.
423
Archilei, Vittoria 275.
277. 299 396. 401. 403
Cesarone Basso 269. 275.
300. 406. 428.
,Gelosi" 26rf. 268. 423.
427
Genueser, als Konstan-
tin 391
,lntronati Senesi" 261.
403. 423
Leone de' Somrni 291
Mitwirkende fiir 1589:
268.275f.279.292f.4o3.
4o6. 427
Peri und Caccini 275 292.
299f. 405. 406
Piissirni, Vittoria 261. 423
Schedel, Hartmann
Antikenkopien nach Cy-
riacus von Ancona 155
Bildung 485
Schepper, Cornelius de
Nativitiitensammlung
498. 539
Prophezeiung 494 538
Schicksal und Mensch siehe
Astrologie, Fortuna, Pro-
phezeiung
Schifanoja (Palazzo) Fres-
kenDekane468.476.s6rf.
629. 63off.
46*
718
Schifanoja (Palazzo) Fres-
ken
Grazien 29
Jupiter-Kybele 464.
472f. 476
Pallas 464. 469f. 643
System 463. 476
Tierkreiszeichen siehe
diese
Oberlieferungsgeschichte
der Quellen 463. 468ff.
561. 630ff. 641 f.
Venus 29. 464. 469ff. 477
Schlange
Apollo s. Drache Apollos
Asklepios 303. 440. 515f.
DreikOpfige siehe Si-
gnum Triceps
Heilkraft 303. 439f.
Kleopatra 49 323
Laokoon siehe diesen
Nicander iiber 625
Passionslegende 439f.
Pauluslegende 303. 440
Theriakbereitung 439.
Typologischer Bilderkreis
439f.
Schlender, Wappen Sasset-
tis 152f. 362
Schmalkalden
Luthers Abreise aus 541
Mann von 494 496. 538
SchmalkaldischerBund, Me-
lanchthon iiber 493 495
538
Schoner, Johann, Melan-
chthon an sod.
Schongauer, Martin, HI. Se-
bastian, Kupferstich 183
Schreiter, Christoph Da-
niel, iiber Luthers Nati-
vitAt 648
Schreyer, Sebald, Huma-
nismus 645
S.:hwerttanz, Tradition und
Bilddarstellung 303. 441
Scolca, Kloster bei Rimini
309
Scoonebeke, Bernard von,
Rechtsstreit Portinari373
Scorpio siehe Tierkreiszei-
chen (Skorpion)
Sebastiana del Piombo,
Pieta, Zeichnung der
Warwick-Collection 216
Segel als Symbol, siehe
Fortuna
Sellaio, jacopo, Orpheus-
Cassone 317. 447 624
Semiramis, Finiguerra-
Zeichnung 73
Seneca
Alberti iiber 28
Merkur 40
Rucellai iiber 147 357
Serjacopi, Girolamo
Amt 394.
Briefe an den Gro.l3herzog
396f.
.,Memorie", Text 397ff.
Serlori, Niccolo, Theater-
schneider 1589: 269. 278f.
428. 431
Sermattei, Francesco, Ver-
lust der Galeere St. Tho-
mas 192
Seth, Finiguerra-Zeichnung
72
Seytz, Alexander, Presse-
politik 510f.
Sforza
Costanzo, Hochzeit 1476:
329. 417
Galeazzo Maria
Hochzeit I 489: 3 II f.
Portri!.tmedaille 370
Wachsvoti 350
Ludovico il Mora, For-
tuna ISI
Sharp, W., im Chap-Book
572
Sibyllen
Bilderchronik 72
Ghirlandajo, Capella Sas-
setti I52. 156. 362
Lichtenberger 552
Weihnachtszyklus 156.
362. 363
Sidinghusen, Danziger Ree-
der I92
Siegel
Ausdruckssymboi 258
Historisches Hilfsmittel
595f.
Sammlung 595 f.
Siena
Antike Venus 308
Flandrische Weber 187
Probe fiir die Auffiihrung
von 1589: 269
Register
Siena
Skizzenbuch des Giu-
liano da San Gallo 155
Signorelli, Luca,
Bestrafung Amors 183.
369
Sixtina-Fresken 66f. 290
Signum Triceps bei Gafurius
271. 413- 430
Silenus, Miniatur, Hochzeit
Pesaro 1476: 329
Silvestris, Bernardus, Sa-
turn 652f.
Simonetta V espucci
Fruhlingsgl>ttin im
,.Reich der Venus" 48.
49 51. 87. 321f. 323f.
326. 339- 478. 644
Nympha 45ff. sof. 65.
II2. 325.
Portrats(angebliche) 46ff.
49 53 66
Tod 45 49ff. 32If. 323.
325- 478. 644
Sinnbild siehe Impresa
Siren en
Bardi 271ff. 429
Biihnenfiguren 258. 269.
275 277ff.292-393-398.
429- 430ff.
Ficino 414.
Kostiime 277ff. 428f.
431f.
Plato 269. 27If. 429
Sphll.renherrscherinnen
277- 429
Zeichnung Buontalentis
267. 26g. 277f. 429
Sixtinische Kapelle siehe
Rom (Capella Sistina)
Sizilien, Venusberg 324
Skopas, Art des, Vorbild
fiir Donatello I3
Skyros siehe Achill
Sodoma, Alexanderdarstel-
lung 248
Sol
Biihnenfigur 282. 421.
433
Fresken in S. Lorenzo zu
Florenz 172
Gott siehe Apollo
] alrreszeitenherrscher
17f.
Register
Sol
Luthers Horoskop, in
541 f. 543 648
Monatsherrscher 472
Sphl!.renherrscher 277.
324 414
Tiere, zugehorige, nach
Picatrix 640
,.Kinder"
Blockbuch 473
Fresko, Schifanoja 473
Regenten 542
Sommi, Leone de', Nympha
291. 436
Sonnenmythos und Alexan-
dermythos 24 7
Spalatin, Georg
Melanchthon an 521
Luther an 499 521. 534
Pressepolitik 513
Wunderliche Weissagun-
gen, iiber 52 I
Spanien
Astrologie und Magie
siehe Alfonso el Sabio
Etappe der Sternbilder-
wanderung 466. 491. 562
FlandrischeTeppiche 226
Matteo Strozzi in 162
Politik Philipps II. 257.
341
Spence, Joseph, iiber Lu-
crez 321
Speratus, Luther an 522
Sphaera
Sinnbild 81. 85. 182. 33 r.
334 337
Barbarica, Bedeutung fiir
die Astrologie465f. 516.
561 f.
Sphl!.renharmonie
Bardi 27off. 294.414. 429
Gafurius 271. 413. 429f.
Islamische 420
Macrobius 414
Plato z69f. 271 f. 420
Tarocchi, in den 271.412 f.
429
Sphl!.ren-Herrscher siehe
Museu, Planeten, Sirenen
Spinello, Niccolo siehe Nic-
colo Fiorentino
Spini, Cristofano
Teilhaber der medicei-
schenFilialeinBriigge3 76
Spini, Cristofano
Wirtschaftsvertrag mit
England 200. 203
Spira, Johannes, Drucker
22
Spirito, Lorenzo, Libro del-
le Sorti 485
Statius, Achill auf Skyros
20
Staupitz, Johannes, von
Luther zitiert 542
Steelant, Jean, Berichtiiber
Maximilians Gefangen-
schaft 235 237
Steinmagie siehe Lapida-
rium, Medizin
Stephanus, Bericht iiber
die Hochzeit Aragona-
Sforza 1489: 3 II
Sternbilder siehe Dekane,
Paranatellonta, Tier-
kreiszeichen
Sterne, Laurence, iiber
Luthers Nativitl!.t 647.
Sternenreigen siehe Tanz
(der Sterne)
Stevenson, R. L., im Chap-
Book 572
Stifter, Stifterbild siehe
Portrl!.t (Bedeutung)
Stigliano, Besitz Francesco
Cybos ros
Stoffler, Johannes, Plane-
tentabellen 509
Stoiker, Mantik 492
Stone, Herbert S., Heraus-
geber des Chap-Book 571
Stosch, Baron von, Ent-
decker der Otto-Prints
79 332
Stradanus
Fresken, Florenz, Palazzo
Vecchio 303. 440
Stich, Vipernfang 440
Strigio, Alessandro, Sl!.nger
407
Strozzi
Alessandra Macinghi
Biographische Mittei-
lungen 82ff. 145.
161. 193.204. 211.
334ff. 346. 380
.. Panni" 381
Wachsbilder 204. 346f.
Strozzi
Caterina
Heirat 161 f. 195
Filippo
719
Briefe der Alessandra
an 82. x6Iff. I95 f. 2II
Palast 163
Ricordi 88
Giov. Battista, Theater-
dichter 265
Lorenzo, in Briigge I6I f.
204. 346
Matteo, in den Briefen
der Mutter I6I ff. 204.
346
Niccolo, Begleiter Mat-
teos I62
Palla, Widersacher der
Medici ISO
Stuttgart
Geml!.ldegalerie, Paolo da
Venezia 362
Sammlung von Lanna 234
Siindflut-Panik 1524 siehe
Planetenkonjunktionen
Sufi. Tanz der Derwische
4I9f.
Susanna, Lucrezia Torna-
buonis Gedicht r 1 I
Sweynheim, Drucker 22
Symbol Bedeutung und
Formen, siehe Attribute,
Beiwerk, Fortuna, Im-
presen
Syphilis, siehe Franzosen-
krankheit
Syrien, Kult des Malachbel
247
Tabula Bianchini, Dekane
467.476.562.629
Tanagli
Caterina
Briefe der Alessandra
Strozzi I45 193ff.
Wappen I92f. 194 210
Francesco, Schwiegerva-
ter Tanis I93 196. 376
Tani
Angelo
Biographie 193. 374
375.
Briefe 371. 375.
Portrl!.t siehe Memling
720
Tani
Angeli
Vertreter der Medici in
Brilgge 190. 193. 203.
21of. 373f. 375f.
Wappen 1g2f. 210
Caterina, siehe Tanagli
Tannstetter, Georg
Arzt Maximilians 526
Prophezeiung 1524: 510
Tano di Bartolomeo, Bild-
ner von Wachsvoti I 17
Tanz
Affentanz am Hofe Karls
des Kiihnen 181. 369
Antiker 277. 417f. 434
Entwicklung des Ballets
257f. :z83f. 286. 418f.
434
Moresca siebe diese
Pollux, Julius 284. 286f.
295 419 434 437
Schwerttanz und Morris-
dance 303. 441
Pytbonkampf als 284.
287f.295-419-434 437
Sternenreigen
Bardi 277. 430
Corso, Rinaldo 417f.
Dante 420
Festwesen 418f.
Islam 419f.
Lorenzo de' Medici 417
Lukian 277. 417f. 430
Moresca, als 417
Ptolemaus . .p8
Scaliger 419
,Trattato sulla musica
degli antichi" 277.
417f.
Tanzspiel, Polizians Orfeo,
446
Taroccbi
,,Albricus" -GOtterbilder
472. 628
Aufbau, systematischer
271. 412. 429
Berchorius-Tradition 4 72.
628
Graziengruppe 640
Merkur 454 485. 645
Musen 412
Planeten 271. 412. 429.
453f. 457 472- 486. 507.
563. 628. 643. 645f.
Taroccbi
Saturn 485. 507
Venus 454
V ermittlung nach
Deutschland 475 485.
645f.
Tasso, Torquato
,Aminta" 291. 295. 437
Bonifaccio, bei 313.
Buontalenti und 267. 426
Tauben, Venusvtigel 18.
471f.
Taurus siehe Tierkreiszei-
chen (Stier)
Tazzi, Familie, Wappen193.
210
Tebaldeo, Illustration mit
Impresa 330
Tempio Malatestiano siehe
Rimini
Templum Pacis, Einsturz
bei der Geburt Christi
156. 362. 552
Teppich
Darstellungsinhalt
Antike 23. 187. 223.
243ff. 258. 385f. 461.
Bauern 224ff. 383.
387
Biblische Geschichten
187. 2J6. 388
Festwesen 257. 392f.
Portrats 247. 257f.
387
Romane 187.228.243ff.
385. 386. 387f.
Stilbedeutung
Beweglichkeit 223. 383
Realismus 175 181.
187. 223. 243 461 f.
Vermittler des welt-
lichen Bilderkreises
18x. 187f. 206. 223ff.
227ff. 243 383. 385.
387. 46If.
V erbreitung
Flandrische Weber in
Italien 187. 229. 383
,Kammern" 226f.
Kartons siehe Panni
Mediceischer Besitz
(siehe auch Panni)
187f. 206. 371f.
Papstlicl:ler Besitz 189.
227
Register
Terranova, Andrea di An-
giolo, Notariatsakt,
Stiftung Sassettis 97.
J41
Teukros
der Babylonier
Lapidarium 562. 564
Sphaera barbarica 465f.
516. 56If. 564. 641
von Kyzikos, Identitat
mit Teukros dem Baby-
Ionier 641
Thalia
Gafurius 413
Muse der Erde 271. 412f.
429
Plutarch 412
Theater
Antikes Chorspiel 283.
287.296.418f.434446
Ausdrucksmittel (siehe
auchAttribute,Triumph-
zug) 276f. 278. 28of.
283. 294 . 395 f. 410.
416 f. 418. 430. 431 f.
433 436f.
Bedeutung
der Intermedien von
1589: 262ff. 396ff.
410. 436ff.
der ,macchine" 267.
395f. 399 403 408.
417. 421f. 423. 426.
437
von Polizians Orpheus
siehe Poliziano
Intermedien siehe diese
Musiktheorie und 265.
294f 395f 425. 433
436f.
Nympha siehe diese
Rappresentazioni siehe
diese
Reformation des Musik-
dramas 258. 26zff. 265.
410. 433. 436f.
Theaterfigurinen siehe Bu-
ontalenti, Bernardo
Theaterkostiime siebe
Tracht
Theatermaschinen
Buontalenti siehe diesen
Sabbattini 267
Theben, Geschichte von,
auf Teppichen 385
Register
Theokrit, Liebeszauber 342
Theriak siehe Medizin (Mit-
tel)
Theseion, Nachzeichnung
des Cyriacus von Ancona
155
Theseus, Baldini-Stich 31.
85
Thomas von Cantimpre
fiber Theriakbereitung
439
Tibaldi, Pellegrino
Apollo und Musen, Par-
ma, Galleria 4II
Musen und Pieriden, Bo-
logna, Pinacoteca 4II
Tibull, Venus 327
Tierkampf, Festwesen26If.
Tierkreis
Fresken
Ferrara, siehe Tier-
kreiszeichen
Florenz, S. Lorenzo
I71 f.
Gotterzuordnung nach
Manilius 470. 476
Intermedien I589: 405.
432
Reliefs, Rimini, S Fran-
cesco I2
Tierkreiszeichen
Jungfrau
Deutung 313. 656
Luthers Horoskop 543
656
Palazzo Schifanoja,
Tradition 63of. 638
Krebs,PalazzoSchifanoja,
Tradition 630. 636
LOwe, Palazzo Schifanoja
464. 469. 472f. 474
630f. 637
Skorpion
Monchsbild Lichten-
bergers 515f. sssff.
Planetenkonjunktion
I484: 502f. 505. 514f.
518. 524- 553. 563
Steinbock, Tiibinger Hs.
507
Stier
Holzschnitt Lichten-
bergers 652
Palazzo Schifanoja464.
469. 470f. 634
Tierkreiszeichen
Wage
Lichtenberger 554f.
Palazzo Schifanoja,
Tradition 63off. 639
Wassermann
Bild 507
Wirkung 475 642
Widder
Astrolabium Planum
466f. 628. 629
Fresko, Palazzo Schifa-
noja 464. 469. 562.
629. 631. 633 643
,Kinder" 464.469.628.
643
Lapidarium des Al-
fonso 467
Manilius 62S
Varaha Mihira 468.562
Zwillinge Palazzo Schifa-
noja, Tradition 631. 635
Timideo, Francesco Nur-
sio, Elegie auf Simonetta
45
Titus, auf einer Mfinze 157
Tobias mit dem Engel
Bildtypus 84. 337
Gedicht Lucrezia Torna-
buonis III
Toledo, Hof des AHonso el
Sabio 466. 492. 5I6. 565
Tolfa, pllpstlicher Alaun
aus 378. 390
Tonarten siehe Harmonien
Torcello, Kairos-Relief 151
Tornabuoni
Familie, Ghirlandajos
Fresken siehe Florenz
(Gebll.ude)
Antonio, in Briigge 380
Francesca, Tod der, Re-
lief von Verrocchio I55
Giovanna
Botticelli, Fresken der
Villa Lemmi 2Sf. 39
Ghirlandajo, Portrll.t29
Hochzeitsmedaillen
29ff. 39 312. 320
Giovanni, Leiter der me-
diceischen Filiale in Rom
376
Lorenzo
Botticelli, Fresken der
Villa Lemmi 28.
Tornabuoni
Lorenzo
J2I
Medaille, Hermes 39
312. 320
Lucrezia nei Medici
Brief fiber Wachsvoti
an 346.
Dichterin 1nf.
Pulci,Verhll.ltniszu 108,
III f.
Wappen S2
Tornaquinci (Familie), Hau-
ser der 132
Toscana, Grol3herzoge von
sieheCosimo, Ferdinanda,
Francesco
Tournai
Bischof von, bei Maxi-
milians Friedensschwur
236. 23S. 384f.
Dokumente Fillastre 374
Roger van der Weyden
aus 227f.
Teppichweberei1S7.225ff.
229. 243f. 247 383. 385.
3S7
Tracht
,all' antica" 28. 37f. 47
51. 65. 74 So. S2ff. 179.
IS2. 18S. 223f. 248.
289ff. 292f. 313f. 316.
3IS. 325- 333f. 336ff.
435f. 46I. 477
.,alia franzese" 31. 37 74
So. 84. 150. 179f. 182.
IS8. 223f. 248f. 31 x. 316.
325-329-333f336f.338.
37I. 46If. 463. 477643f.
,alia greca" 246. 253f.
277ff. 289ff. 389. 409-
420. 435
Bisch0fliche238. 384.385.
584
Burgundische 86. 158.
I79f. 182. 188. 198. 209.
248. 338. 371
Byzantinische 246. 253.
277ff. 389f.
Fest und Theater 75 83.
8s f. 182 f. 203. 262 ff.
z68f. 277 ff. z88ff. 291 ff.
311f. 317.322.326. 330f.
336f. 397 . 406f. 416f.
428ff. 431 f. 435 ff.
722
,.Trachtenrealismus" siehe
Tracht alia franzese
Trajan
Bilddarstellung, Teppich
223
Reliefs am Konstantin-
bogen 157
S!!.ule 390. 391
Treviso
Druckort von Plinius S.
N. 3II
Hypnerotomachia ver-
faBt in 18
Trier, Zusammenkunft von
Friedrich III. und Karl
dem Kiihnen 248
Tritonen im Festwesen
258
Triumphalplastik, antike,
Nachleben 67. 75 84.
157. 175f. 253 261. 390.
477
Triumphzug
Bilddarstellungen 18. 29.
67. 74 82. 150. 157.183.
187f. 257. 290. 391. 393
463. 473 477
Festwesen siehe dieses
Theater und 261. 277.
281ff. 292. 294 410. 417.
418f. 430. 432ff. 436
Literatur so. 67. 150.
183. 187. 290. 321
Tubal Kain, in der Bilder-
chronik 72
Tuchhandel, italienischer
189. 203. 376. 390
Tiibingen, Kalenderhand-
schrift so6
Tiirken
Handelsbeziehungen mit
Italien 390f.
Kriege mit dem Abend-
land 248. 253f. 39of.
Tiirkenpascha, Wachsvoto
n8
Tugenden, Figuren des Fest-
wesens 257 274. 276. 393
416. 430
Tura, Cosimo
Fresken in der Bibliothek
zu Mirandola 476. 643
Kreuzabnahme, Teppich-
vorzeichnung 216. 3 8 ~
Turin
Pinacoteca, Memlings
Passion 197ff. 376f. 378
Pollaiuolo-Zeichnung 446
623
Turnier siehe Giostra
Turnierfahnen siehe Fest-
wesco, (Zubehor)
Typologie,
Bilddarstcllungen 439f.
Kreuzigung, der 439f.
Sixtina-Fresken 67
Tzetzes, Scholien 42of.
Ubaldini (Familie), Verhalt-
nis zu Lorenzo 351
Uffizien, siehe Florenz
(Sammlungen)
Ugolino da Siena, Altarbild
von Sta. Maria Novella
136. 354
Ulsenius, Theodor, Weis-
sagung 524
Unionskonzil siehe Konzil
Urania, Herrscherin der
achten Sph!!.re 271. 429
Urbino
Flandrische Weber 187
Francesco Maria von, sic-
he Francesco Maria
Majo!ikate!ler mit Nio-
bidendarstellung 625
Palazzo Ducale, Intarsia,
Pallas 59 84
Urkunden siehe Florenz
(Archivio di Stato). Lu-
beck (Staatsarchiv)
, Utirid, Arabisches Stein-
buch 528
Valandt, Danziger Reeder
192
Val di Bisenzio, Villa Sas-
settis 133
Valencia, Lorenzo Strozzi
in 161
Valenciennes, Fresken, Af-
fen und Kramer 181
Valentine d'Orleans, Tep-
pichbcsitz 227
Valerius Maximus, Heroen
bei 416
Vallombrosa, Epifanio d' Al-
fiano, Monch von 266.
426
Register
Valloton, im Chap-Book
572
Valois, Festwesen am Hofe
der 257.
Valori
Baccio, Brief Filippo Sas-
settis an 364. 365
Francesco, Brief Filippo
Sassettis an 364
Niccolo, iiber Lorenzo
102. 120{.
Valturio iibcr den Tempio
Malatestiano 12
Vanni, Mariano di, Vater
Botticellis 86. 338 f.
Vannucci siehe Perugino,
Pietro
Varaha Mihira, Dekane 468.
-e.. ... l & : . . ~ ...
.):V.l.J.. V.';}
Varro bei Augustinus 473
641
Vasari, Giorgio
Kritik
Antikenverzeichnis 38
Botticelli 6. 26
Castagno 599
Ghirlandajo I 14
Impresen 24. 312
Memling 197. 215. 376
Piero della Francesca
253f.
Pollaiuolo 86. 339
Theatermaschinen 395
Totenmasken 119. 341
Werke
Genealogia degli Dei
267. 282i. 295 410.
433 437 641
Zeichnungen zur ,.Ge-
nealogia degli Dei"
282f. 433
Vasco da Lucena, Alexan-
derroman 248. 388
Vasenmalerei, antike 12f.
446
VaticiniasieheProphezeiung
Venedig
Gesandtschaft in Flo-
renz 263. 428
Hypnerotomachia Poli-
phili, gedruckt 1499 bei
Aldus x8f.
Metamorphosen,gedruckt
1497 bei Zoane Rosso 33
446. 624. 652
Register
Venedig
Museo Correr, Orpheus-
Teller 37 446. 623
Venne, Adrian van de, Ho-
senkampfstich 368
Venus
Charakter
Diana, identifiziert mit
(siehe auch unten:
Venus Virgo)
3
of.
313ff. 316
Hermes und 40.
320
.
325.
Herrin der wiederer-
wachenden Natur (sie-
he auch Wiederkehr)
41. 5If. 6s. 326. 472.
478. 644
Liebesgarten und Reich
41. 65. 86. 322ff.
324ff. 338. 464. 470f.
472. 477f. 644
Planet, siehe unten
Platonisierend-allego-
risch gedeutet 39 6
5
.
312ff. 320. 327. 339
644
Virgo, siehe unten
Darstellung
Antike 10. 149. 3o8. 310
Botticelli, insbesondere
6. 10. 19. 26. z8f.
44
.
so.65. 184.325ff.
339
.
478. 644
Festwesen 275.322.
432
Fresken
Luneburg, Rathaus
486
Palazw Schifanoja
29. 464. 469. 470ff.
477
Raffael477
Holzschnitte
.,Fiore e Biancifiore"
322
Polizians Giostra2
4
f.
Miniaturen
Dares 313. 31
5
Fulgentius Metafo-
ralis 310
Gedichte des Lorenzo
10. 22. 31 I
Ovide moralise
471
f.
640
Venus
Darstellung
Muschel 9f. 310.
4 7
~ .
478. 640
Literatur
Acciajuoli, Zanobio
41
Berchorius 640
Bruni, Leonardo
327
.
Claudian 16. 4
3
Horaz 40.
Jonson, Ben 323 f.
Libellus de deorum
imaginibus 471
Lorenzo de' Medici
42
Lucrez 4I. 321
Manilius 470
Pervigilium Veneris
siehe dieses
Picatrix 640
Fico della Mirandoia
327
Polizian 7f. I3. I6.
34
.
42f. 6s. 3I4
Pulci
Bernardo so
Luigi 326
Planet
Baldini-Kalender 86.
325. 338. 644
Blockbuch
4
72
Botticellis Fruhling
322. 325ff. 478
.,Kinder" siehe oben:
Liebesgarten
Monatsherrscher (siehe
auch oben: Herrin der
wiedererwachenden
Natur) 322. 325f.
4
6
4
.
478
Tarocchi 4
54
Wanderung der Bild-
darstellungen
4
5
3
.
Virgo
Charakterisierung
3
I .
290. 313. 320
Darstellung
30
.
39
.
84. 312. 313. 3I5. 320.
327
Litera tur 30 f. 3 I 2 ff.
314ff.
Venusberg, Legende
31
6.
324
Venuskinder siehe Venus
(Liebesgarten)
723
Verfolgungsszenen, Bedeu-
tung, siehe Antike (Bewe-
gungsmotive resp. Bewe-
gungssteigerung)Nympha
Vergerio, Paolo, tiber Luther
5I7
Vergil
Laokoon 68
Merkur 320
Nachleben
Aeneis-Illustrationen
31. 315
Botticelli, Danteillu-
strationen 67. 317
Kommentare 39.
3
12.
320
Siegel Karls II. von
England 258. 393
Dbersetzung 393
Vasari, bei 282
Prophezeiung 525
Venus und Aeneas 3of.
312ff. 315. 327
Venus Virgo 3of. 3I2ff.
3IS. 327
Zephyr 309
Verino, Ugolino, De Illu-
stratione Urbis F1oren-
tiae 134. 145
Verlaine, Paul, im Chap-
Book 572
Vernio, Conte di, siehe
Bardi, Giovanni de'
Verona, S. Fermo Mag-
giore, GrabdenkmalRic-
cios 327
Verrinus, Michael, Brief an
Fiero de' Medici 3
4
Verrocchio, Andrea
Antike als Vorbild 8
5
.
1
55 337
Lehrer der Benintendi 99
341
Lehrer Lionardos 52
Relief, Tod der Torua-
buoni I55
Voti und Totenmasken
Jig. 34I
Wirklichkeitssinn 63
Vertumnus, Holzschnitt,
Hypnerotomachia 18
Vespasiano da Bisticci, iiber
Griechentracht 389
Vespasianus, Kaiser, .Miinze
I 57
Vespucci
Amerigo, Segelsymbol
360. 410
Marco, Mann Simonettas
45
Simonetta siehe Simo-
netta
Vesta
Boccaccio 64If.
Palazzo Schifanoja 641 f.
Vestalin, Zeichnung Buon-
talentis 267. 412
Villen bei Florenz siehe Ca-
reggi, Castello, Lemmi,
Montughi, Mulinaccio,
Nuvoli, San Martino a
Gonfienti, Val di Bisen-
zio
Vinci, Lionardo da siehe
Lionardo
Virdung, Johannes, Pro-
phezeiung 494 496. 538
Virginia de' Medici, Hoch-
zeit 1585: 263ff. 319. 424
Virgo siehe Tierkreiszei-
chen (Jungfrau)
Visconti
Galeazzo, Petrarca Ge-
sandter des 358
Magieglaube 100
Viti, Timoteo, Orpheus-
teller 37
Vitruv(s.auchProportionen)
Botticelli 66
DUrer 448
Lionardo 53
Vogel, Hugo, Fresken im
Hamburger Rathause
581 ff.
Volaterranus, Jacobus, tiber
Auffilhrung der Kreuz-
legende 391
Vos, Maerteu de, Hosen-
kampfstich 368
Voti, Votivbilder siehe Ex-
Voto
Vredius, Oliver, Siegelbuch
der Grafen von Flandern
596
Vrelant, Willem, Stifter
von Memlings ,.Passion"
( ?) 377
Vulkan
Boccaccio 641
Palazzo Schifanoja 6.p
Vulkan
Polizian 7
Libellus de imaginibus
deorum 471
Manilius 470
Wachsbild siehe Bildzauber,
Ex-Voto, Portrll.t
Waghe, Cornelius, Rechts-
streit Portinari 373
Wahrsagung siehe Prophe-
zeiung
Wappen
Bedeutung 79. 149.192.
332f. 374 595
Personen
Bandini-Baroncelli 202
Bartolini-Salimbeni319
Carion 532
Cleves, Jean de 386
Fillastre 374
Karl der Kilhne, 3 72
Martelli 319
Martellini 320
Medici 82
Rolin 224.
Rucellai 146. 149
Sassetti 136. 142. 152 f.
362
Tanagli 192. 194.210.
3i4f.
Tani 192ff. 210
Tazzi 193. 210
Tornabuoni 82
Sammlung, Hambur-
gische 595.
Warwick-Collection, Se-
bastiano dei Piombo,
Zeichnung, Pieta 216
Wauquelin, Jean, Alexan-
derroman 244. 247.386
Wearmouth, Abt Benedict
Biscop 439.
Weissagung siehe Prophe-
zeiung
Welser, Familie, Expedi-
tion nach Venezuela 533
Weyden, Roger van der, sie-
he Roger van der Weyden
Wiederkehr, Idee der
Polizian 5If.
Lorenzo 49 326
Venusbild Botticellis 41.
51f. 65. 310. 325ff. 478.
644
Wien
Albertina
Register
Otto-Teller 79 332
Petrarca-Stiche 150.
187f.
N ationalbibliothek,
Cod. Vind. 5239: 528
Holzschnitt Meister J.
B. 315
Sammlung Lanckoron-
sky, Cassone 315
Wilde, Oscar, im Chap-
Book 572
Wilton House, Amazonen-
sarkophag 625
Wilwolt von Schaumburg,
iiber Maximilians Gefan-
genschaft 235
\Vinckelmann, J. J.
Antikenauffassung 30. 55
66f. 176
Grazien-Relief in Florenz
28
Winddrehungsgesetz bei Fi-
lippo Sassetti 364
Windgotter
Alberti II
Botticelli r r. 26 f. 38. 41
Cassone, Kestnermuseurn
31
Fortuna als 148. 151
36o. 364.
Liberale da Verona 31
Polizian 9
V ergilhandschrift des V a-
tikans 31
Zephyr siehe diesen
Windsor, Lionardo da Vin-
ci, Zeichnungen 51 f.
Wittenberg
Gauricus in 498. sor. 505.
565
Reinhold Professor in498
Woburn Abbey, Sarkophag,
Achill auf Skyros zof.
J!O
Wolf, Johannes, Lectiones
memorabiles 523
Wolfenbiittel, Herzog Au-
gust-Bibliothek, Plane-
ten-Hs. 528
Wolffhardt, Conrad siehe
Lycosthenes, Conrad
Wolkenstein, Geisel fiir Ma-
ximilian 236
Register
Worms, Reichstag 51of.
\Vortspiele siehe Impresa,
Motti, Namen
Wi.irfel
Ermittlung der Nativitat
durch 629
Zubehor der Saturndar-
stellung 507. 649
Wydenast, Drucker in Pe-
rugia 485
Yolande von Flandern,
Weihgeschenk 347
York, Margaretha von, sie-
he Karl der 1\:iihne (Hoch-
zeit)
Zabel
Dekanliste 632. b35 636
Weissagungsbuch 531 f.
Zahlenmagie, astrologische
526. 528. 531
Zamora, Kathedrale, Tep-
pich 385
Zampini, Compagnons der
Medici in Avignon 130.
353
Zarlino, Musiktheorie 265.
284. 419
Zauber siehe Bildzauber,
Magie, Medizin
Zebel der Araber siehe
Zahel
Zeitschriften, amerikanische
illustrierte 57 Iff.
Zeittracht siehe Tracht alia
franzese
Zephyr
Basinius 327
725
Zephyr
Botticelli 10. 26. 38. 4 r.
65. 325
Lorenzo de' Medici 43
Lucrez 41. 321
Ovid 32. 320
Polizian 15. 42. 65
Vergil309
Ziethen, requiriert Mem-
lings , J i.ingstes Gericht"
191
Zodiakus siehe Tierkreis,
Tierkreiszeichen
Zola, Emile, Portrat im
Chap-Book 572
Zotori Zapari Fenduli, Geor-
gius, f..
Zurich, 595
Zwolle, Drupkort 651f. > ,
\.
!! :\ ,
VEROFFENTLICHUNGEN DER
BIBLIOTHEK WARBURG
I. STUDIEN. Herausgegeben von F. SAXL
E. Cassirer: Die Begriffsform im myth. Denken. (Heft 1.) Geh . .Jl.lt 2.-
E. Panofsky u. F. Saxl: Diirers 'Melencolia I'. Eine quellen- und
typengeschichtliche Untersuchung. Mit zahlr. Taf. 2. Aufl. (Heft 2.) [In
Vorb. 1933)
E. Norden: Die Geburt des Kin des. Geschichte einer religi05en Idee.
2. Abdr. (Heft 3.) Geh . .Jl.lt 6.40, in Ganzleinen geb . .7U{ 8.-
H. Liebeschiitz: Fulgentius Metaforalis. Ein Beitrag zur Geschichte der
antiken Mythologie im Mittelalter. Mit 56 Abb. auf 32 Taf. (Heft 4.)
[Z. Zt. vergriffen]
E. Panofsky: Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der alteren Kunst-
theone. Mit 7 Abb. i. T. (Heft 5.) [Z. Zt. vergriffen]
E. Cassirer: Sprache und Mythos. Ein Beitrag zum Problem der Gotter-
namen. (Heft 6.) [Z. Zt. vergriffen]
R. Reitzenstein u. H. H. Schaeder: Studien zum antiken Synkretis-
mus. Aus Iran und Griechenland. Mit 8 Fig. auf 4 Taf. (Heft 7.) Geh .
.1/.J{ :18.-, in Ganzleinen geb . .1/Jt 20.-
F. Saxl: Antike Gotter in der Spatrenaissance. Ein Freskenzyklus und
ein ,Discorso" des Jacopo Zucchi. Mit 4 Lichtdrucktaf. u. einem Brief-
faksimile. (Heft 8.) Geh . .J/Jt 8.-
R. Schmidt-Degener: Rembrandt und der hollandische Barock. tl'ber-
setzt von A. Pauli. (Heft g.) Geh . .Jl.Jt 5.-
E. Cassirer: Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance.
Mit 29 Abb. u. 2 Lichtdrucktaf. (Heft 10.) Geh . .1/Jt 24.-
H. Ritter, M. Plessner u. E. Jaffe: Picatrix (Arabischer Text,lateinischer
Text und deutsche Dbersetzung). (Heft 12.) [U. d. Pr. 1933]
L E I P Z I G B. G. T E U B N E R B E R L I N
Warburg, Gesammelte Scbriften. Bd. 2
VEROFFENTLICHUNGEN DER
BIBLIOTHEK WARBURG
I. STUDIEN. Herausgegeben von F. SAXL
[ Fortsetzung]
P. Lehmann: Pseudo-antike Literatur des Mittelalters. Mit 6 Taf. (Heft I3.)
Geh . .1l.Jt 5.-
H. Pruckner: Studien zu den astrologischen Schriften des Heinrich von
Langenstein. (Heft I4.) [U. d. Pr. I933]
H. Liebeschiitz: Das allegorische Weltbild der heiligen Hildegard von
Bingen. (Heft I6.) Geh . .1l.Jt IS.-
P. E. Schramm: Kaiser, Rom und Renovatio. I. Studien und Texte zur
Geschichte des romischen Emeuerungsgedankens vom Ende des Karo-
lingischen Reiches his zum Investiturstreit. Geh . .1l.Jt IS.-. II. Exkurse
und Texte. Geh . .1l.Jt 14.-. (Heft I7, I u. II)
E. Panofsky: Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in
der neueren Kunst. Mit II9 Abb. auf 77 Lichtdrucktaf. (Heft r8.) Geh .
.1l.Jt 35-
W. Gundel: Dekane und Dekanstembilder. Ein Beitrag zur Geschichte der
Sternbilder der Kulturvolker. Mit einer Untersuchung fiber die agyptischen
Sternbilder und Gottheiten der Dekane. Von S. Schott. (Heft Ig.) [U. d.
Pr. 1933]
J. Kroll: Gott und Holle. Der Mythos vom Descensuskampfe. (Heft2o.)
Geh . .1l.Jt 25.-
H. Meier u. E. Weil: Studien und Texte zur Geschichte der Astrologie
in der Renaissance. (Heft 21.) [In Vorb. 1933]
R. Pfeiffer: Humanitas Erasmiana. (Heft 22.) Geh . .1l.Jt r.6o
W. Stechow: Apollo und Daphne. Mit 4 Abb. i. T. u. 34 Lichtdrucktaf.
mit 66 Abb. (Heft 23.) Geh . .1l.Jt 8.50
E. Cassirer: Die Platonische Renaissance in England und die Schule
von Cambridge. (Heft 24.) Geh . .1l.Jt 7-
L E I P Z I G B. G. T E U B N E R B E R L I N
VEROFFENTLICHUNGEN DER
BIBLIOTHEK WARBURG
Bd.l:
II. VORTRAGE. Herausgegeben von F. SAXL
Vortrage 1921-1922. Inhalt:F. Saxl, DieBibliothekWarburgundihrZiel,
E. Cassirer, Der Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissen-
schaften. A. Goldschmidt, Das Nachleben der antiken Formen im Mittelalter.
G.Pauli, Dftrer,Italien und dieAntike. E.Wechssler,Erosund Minne. H. Ritter,
Picatrix, ein arabisches Handbuch hellenistischer Magie. H. Junker, Ober
iranische Quellen der hellenistisohen Aion-Vorstellung. [Vergriffen]
Bd. II: Vortrage 1922-1923. I. Teil. Inhalt: E. Ca.ssire:r, Eidos und Eidolon.
R. Reitzenstein, Augustin als antikerund als mittelalterlicher Mensch. H. Lietz
mann, Der unterirdische Kultraum von Porta Maggiore in Rom. A. Doren,
Fortuna im Mittelalter und in der Renaissance. P. E. Schramm, Das Herrscher-
bild in der Kunst des frfthen Mittelalters. [Vergriffen]
Vortrage 1922-1923. II. Teil. R. Eisler, Orphisch-dionysische Mysterien-
gedanken in der christlichen Antike. [Vergriffen]
Bd. III: Vortrage 1923-1924. In_halt: U.v.Wilamowitz-Moellendorff,Zeus.E.Hoff-
mann, Platonismus und Mittelalter. H. Liebeschfttz, Kosmologische Motive
in der Bildungswelt der Frfthscholastik. R. Reitzenstein, Die nordischen, persi-
schen und christlichen Vorstellungen vom Weltuntergang. H. Gressmann, Die
Umwandlung der orientalischen Religionen unter dem EinfluB hellenischen
Geistes. Franz J. DOlger, Gladiatorenblut und Ma.rtyrerblut. A. Goldschmidt,
Frfthmittelalterliche illustrierte Enzyklopll.dien. C. Borchling, Rechtssymbolik
im germanischen und romischen Recht. Geh . .1i.J( 12.-
Bd. IV: V ortrage 1924-1925. Inhalt: R. Reitzenstein, Alt-Griechische Theologie
und ihre Quellen. R. Reitzenstein, Plato und Zarathustra. K. L. Schmidt, Der
Apostel Paulus und die antike Welt. H. H. Schaeder, Urform und Fortbildungen
des manich!l.ischen Systems. A. Doren, Wunschrll.ume und Wunschzeiten.
F. Domseiff, Literarische Verwendungen des Beispiels. E. Fraenkel, Lucan als
Mittler des antiken Pathos. E. Panofsky, Die Perspektive als .,symbolische
Form". R. Kautzsch, Werdende Gotik und Antike in der burgundischen
Baukunst des 12, Jahrhunderts. Geh . . JUt 18.-
L E I P Z I G B. G. T E U B N E R B E R L I N
VEROFFENTLICHUNGEN DER
BIBLIOTHEK WARBURG
Bd.V:
II. VORTRAGE. Herausgegeben von F. SAXL
[ Fortsetzung]
Vortrage 1925-1926. Inhalt: 0. Franke, Der kosmische Gedanke in
Philosophie und Staat der Chinesen. H. Lietzmann, Die Entatehung der
christlichen Liturgie nach den l!.ltesten Quellen. P. Hensel, Montaigne und
die Antike. K. Brandi, Cola di Rienzo und sein VerMltnis zu Renaissance
und Humanismus. J. Mesnil, Die Kunstlehre der Friihrenaissance im Werke
Masaccios. F. Noack, Triumph und Triumphbogen. Geh . .Ji.lt 12.-
Bd.VI: Vortrage 1926--1927. Inhalt: J. v. Schlosser, Vom modernen Denkmal-
kultus. G. Swarzenski, Der KOlner Meister bei Ghiberti. H.Tietze, Romani;;cbe
Kunst und Renaissance. M. D. Henkel, Illustrierte Ansgaben von Ovids Meta-
morphosen im XV., XVI. u. XVII. Jahrh. R. Salomon, Das Weltbild eines
avignonesischen Klerikers. H. Sieveking, Die Akademie von Ham. Geh .
.Ji.Jt zs.-
Bd. VII : Vortrage 1927-1928. Zur Geschichte des DrainaS. Inhalt: K. Th. Preufl,
Der Unterbau des Dramas. J. Geffcken, Der Begriff des Tragischen in der
Antike. 0. Regenbogen, Schmerz und Tod in den TragOdien Senecas.
K. Vofller, Die Antike und die Bflhnendichtung der Romanen. J. Kroll, Zur
Geschichte des Spieles von Christi H6llenfahrt. Geh . .7/.Jt zo.-
Bd. VIII : Vortrage I 928-I 929. 'Ober die Vorstellungen von der Himmelsreise der
Seele. Inhalt: H. Kees, Die Himmelsreise im agyptischen Totenglauben.
R. Reitzenstein, Heilige Handlung. R.Hartmann, Die Himmelsreise Muham-
meds und ihre Bedeutung in der Religion des Islam. H. Schrade, Zur Ikono-
graphie der HimmelfahrtChristi. A. Farinelli, Der Aufstieg der Seele bei Dante.
W. Friedlaender, Der antimanieristische Stil urn 1590 und sein Verhli.ltnis zum
'Obersinnlichen. Geh . .Ji.J(. zo.-
Bd. IX: Vortrage I93o--I93I. England und die Antike. Inhalt: E. F. Jacob,
Some aspects of classical influence in medieval England. H. Liebeschiitz,
Der Sinn des Wissens bei Roger Bacon. J. A. K. Thomson, Erasmus
in England. W. F. Schirmer, Chaucer, Shakespeare und die Antike.
E. de Selincourt, Romanticism and Classicism in Walter Savage Landor.
E. Cassirer, Shaftesbury und die Renaissance des Platonismus in England.
R. W. Livingstone, The position and function of classical studies in modem
English education. 0. Fischel, Inigo Jones und der Theaterstil der Renaissance.
E. Wind, Humanitl!.tsidee und heroisiertes Portrat in der englischen Kultur
des 18. Jahrhunderts. GelL ~ ' l ! . ! t z8.-
L E I P ZIG B. G. T E U B N E R B E R L I N
VEROFFENTLICHUNGEN DER
BIBLIOTHEK WARBURG
III. A. WARBURG GESAMMELTE SCHRIFTEN
Band I und II:
DIE ERNEUERUNG DER HEIDNISCHEN ANTIKE
Kulturwissenschaftliche Beitrage
zur Geschichte der europaischen Renaissance
Mit einem Anhang unver<>ffentlichter Zusll.tze unter Mitarbeit von
Fritz Rougemont herausgegeben von Gertrud Bing
Zirka 700 Seiten mit x81 Abbildungen
BAND I
Die Antike in der Florentiner biirgerlichen Kultur
Botticellis ,.Geburt der Venus" und ,.Frlihling"
Sandro Botticelli
Die Bilderchronik cines florentinischen Goldschxniedes
Delle Imprese Amorose nelle pitt antiche incisioni fiorentine
Bildniskunst und Florentiner Biirgertum
Die letztwillige Verfugung des Francesco Sassetti
Matteo Strozzi, ein florentiner Kaufmannssohn vor soo J ahren
Der Baubeginn des Palazzo Medici
Die Himmelskuppel von S. Lorenzo
Der Eintritt des antikisierenden Idealstils in die Malerei der Frlihrenaissance
Austausch kiinstlerischer K ultur zwischen Flandern und Florenz
Austausch kiinstlerischer Kultur zwischen Siiden und Norden
Flandrische Kunst und florentinische Friihrenaissance
Flandrisch-florentinische Kunst im Kreise des Lorenzo
Die Grablegung Rogers von der Weyden
Un quadro fiorentino che manca all' esposizione dei primitivi francesi
Arbeitende Bauern auf burgundischen Teppichcn
Antike und Gegenwart im festlichen Leben der Renaissance
Zwei Szenen aus Maximilians Briigger Gefangenschaft
Luftschiff und Tauchboot in der xnittelalterlichen Vorstellungswelt
Piero della Francescas Konstantinschlacht
Die flandrischen Bildteppichc im Gange der Uffizien
I Costumi teatrali per gli Intermeni del 1589
Beitrl\ge zur Florentiner Kulturgeschichte
L E I P Z I G B. G. T E U B N E R . B E R L I N
VEROFFENTLICHUNGEN DER
BIBLIOTHEK WARBURG
Til. A. WARBURG. GESAMMELTE SCHRIFTEN
[Fortsetzung]
BAND II
Die italienische Antike in Deutschland
Dllrers Tod des Orpheus und die italienische Antike
Antike GOtterwelt im Sllden und im Norden
Planetendarstellungen auf einem Kamin in Landshut
Die olympischen Gotter als Sterndiimonen
Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu
Ferrara
Die PlanetengOtterbilder im Kalender von 1519
Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten
Orientalisierende Astrologie
Kulturpolitische Gelegenheitsschriften
IV. KULTURWISSENSCHAFTLICHE
BIBLIOGRAPHIE ZUM PROBLEM
DES NACHLEBENS DER ANTIKE
BAND 1:
DIE ERSCHEINUNGEN DES JAHRES 1931 UMFASSEND
Unter Mitarbeit von Fachgenossen
von
Hans Meier, Hamburg, und Richard Newald, Fribourg (Schweiz)
Erscheint Sommer 1933
..
. .
L E I P Z I G B. G. T E U B N E R B E
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Warburg - Gesammelte Schriften. Band 1 PDFDokument520 SeitenWarburg - Gesammelte Schriften. Band 1 PDFvis_contiNoch keine Bewertungen
- De beryllo. Über den Beryll: Zweisprachige Ausgabe (lateinisch-deutsche Parallelausgabe, Heft 2)Von EverandDe beryllo. Über den Beryll: Zweisprachige Ausgabe (lateinisch-deutsche Parallelausgabe, Heft 2)Noch keine Bewertungen
- (Aby Moritz Warburg) Gesammelte Schriften.I PDFDokument514 Seiten(Aby Moritz Warburg) Gesammelte Schriften.I PDFFernando Ferreira da SilvaNoch keine Bewertungen
- Was ist ein Original?: Eine Begriffsbestimmung jenseits genieästhetischer StereotypeVon EverandWas ist ein Original?: Eine Begriffsbestimmung jenseits genieästhetischer StereotypeNoch keine Bewertungen
- Aby Warburg - Gesammelte Schriften - Die Erneuerung Der Heidnischen Antike, Band II 1932Dokument509 SeitenAby Warburg - Gesammelte Schriften - Die Erneuerung Der Heidnischen Antike, Band II 1932Anders Fernstedt100% (3)
- Liber de causis. Das Buch von den Ursachen: Zweisprachige AusgabeVon EverandLiber de causis. Das Buch von den Ursachen: Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Aby Moritz Warburg-Gesammelte Schriften. Die Erneuerung der heidnischen Antike, kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Renaissance mit einem Anhang unveröffentlichter Zusätze-2.pdfDokument328 SeitenAby Moritz Warburg-Gesammelte Schriften. Die Erneuerung der heidnischen Antike, kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Renaissance mit einem Anhang unveröffentlichter Zusätze-2.pdfJefferson de AlbuquerqueNoch keine Bewertungen
- Aby Warburg Gesammelte Schriften Die Erneuerung Der Heidnischen Antike Band II 1932 PDFDokument509 SeitenAby Warburg Gesammelte Schriften Die Erneuerung Der Heidnischen Antike Band II 1932 PDFFrenhofer FrenhoferNoch keine Bewertungen
- Schriften. Band II: Die Schriften 22-29 der chronologischen Reihenfolge (Text und Übersetzung). Zweisprachige AusgabeVon EverandSchriften. Band II: Die Schriften 22-29 der chronologischen Reihenfolge (Text und Übersetzung). Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Aby Warburg Gesammelte Schriften Band I 1Dokument520 SeitenAby Warburg Gesammelte Schriften Band I 1pqxy1234100% (1)
- Schriften. Band II: Die Schriften 22-29 der chronologischen Reihenfolge (Anmerkungen). Zweisprachige AusgabeVon EverandSchriften. Band II: Die Schriften 22-29 der chronologischen Reihenfolge (Anmerkungen). Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Andreas Speer, Lydia Wegener Wissen Uber Grenzen Arabisches Wissen Und Lateinisches Mittelalter 2006Dokument864 SeitenAndreas Speer, Lydia Wegener Wissen Uber Grenzen Arabisches Wissen Und Lateinisches Mittelalter 2006Carminid100% (3)
- Vom Wesen des Seienden: Die Fragmente. Zweisprachige AusgabeVon EverandVom Wesen des Seienden: Die Fragmente. Zweisprachige AusgabeBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (2)
- FPhänomenologie Der MöglichkeitDokument121 SeitenFPhänomenologie Der Möglichkeitcjgc6531Noch keine Bewertungen
- Schriften. Band V: Die Schriften 46-54 der chronologischen Reihenfolge (Anmerkungen). Zweisprachige AusgabeVon EverandSchriften. Band V: Die Schriften 46-54 der chronologischen Reihenfolge (Anmerkungen). Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Faktizität Und Individuation Studien Zu Den Grundfragen Der Phänomenologie by Ludwig LandgrebeDokument176 SeitenFaktizität Und Individuation Studien Zu Den Grundfragen Der Phänomenologie by Ludwig LandgrebeRafaelBastosFerreiraNoch keine Bewertungen
- De coniecturis. Mutmaßungen: Zweisprachige Ausgabe (lateinisch-deutsche Parallelausgabe, Heft 17)Von EverandDe coniecturis. Mutmaßungen: Zweisprachige Ausgabe (lateinisch-deutsche Parallelausgabe, Heft 17)Noch keine Bewertungen
- Cassirer Warburg PDFDokument95 SeitenCassirer Warburg PDFrosenbergalapeNoch keine Bewertungen
- Tu quis es (De principio). Über den Ursprung: Zweisprachige Ausgabe (lateinisch-deutsche Parallelausgabe, Heft 23)Von EverandTu quis es (De principio). Über den Ursprung: Zweisprachige Ausgabe (lateinisch-deutsche Parallelausgabe, Heft 23)Noch keine Bewertungen
- Arnold Gehlen - Philosophische Schriften 1Dokument463 SeitenArnold Gehlen - Philosophische Schriften 1ceprunNoch keine Bewertungen
- Nebel, Plotins Kategorien Der Intelligiblen Welt (1929)Dokument69 SeitenNebel, Plotins Kategorien Der Intelligiblen Welt (1929)alverlinNoch keine Bewertungen
- Adorno Mimesis PDFDokument14 SeitenAdorno Mimesis PDFChristian Goeritz AlvarezNoch keine Bewertungen
- Gesammelte Schriften BD 5 Zur Metakritik Der Erkenntnistheorie Drei Studien Zu Hegel PDFDokument386 SeitenGesammelte Schriften BD 5 Zur Metakritik Der Erkenntnistheorie Drei Studien Zu Hegel PDFMerletoNoch keine Bewertungen
- Agnostos Theos - NordenDokument436 SeitenAgnostos Theos - NordenChristian Bull100% (2)
- Schmitz Hegels LogikDokument61 SeitenSchmitz Hegels LogikSamuel ScottNoch keine Bewertungen
- Becker HinfälligkeitDokument26 SeitenBecker HinfälligkeitTrad AnonNoch keine Bewertungen
- Klaus Düsing - Ontologie Und Dialektik Bei Plato Und HegelDokument56 SeitenKlaus Düsing - Ontologie Und Dialektik Bei Plato Und HegelTxavo HesiarenNoch keine Bewertungen
- Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen SkepsisDokument409 SeitenStudien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen SkepsisMariana MendívilNoch keine Bewertungen
- Das Dictum Des Simonides: Der Vergleich Von Dichtung Und MalereiDokument34 SeitenDas Dictum Des Simonides: Der Vergleich Von Dichtung Und MalereiMax ElskampNoch keine Bewertungen
- Husserl Vorlesungen Zur Phaenomenologie Des Inneren ZeitbewusstseinsDokument137 SeitenHusserl Vorlesungen Zur Phaenomenologie Des Inneren ZeitbewusstseinsTeresa Álvarez MateosNoch keine Bewertungen
- 12 Deleuze LesenDokument10 Seiten12 Deleuze LesencarlNoch keine Bewertungen
- Lohmann-Griechische KulturDokument18 SeitenLohmann-Griechische KulturTrad AnonNoch keine Bewertungen
- Bröcker - Aristoteles (Alemán)Dokument232 SeitenBröcker - Aristoteles (Alemán)Sebastian Castañeda PalaciosNoch keine Bewertungen
- Platon, Plotin Und Marsilio FicinoDokument15 SeitenPlaton, Plotin Und Marsilio FicinoAnonymous eAKJKKNoch keine Bewertungen
- Violetta Weibel - HölderlinDokument383 SeitenVioletta Weibel - HölderlinGonzaloRodriguezVidelaNoch keine Bewertungen
- Henrich, Dieter - Hegel Im KontextDokument106 SeitenHenrich, Dieter - Hegel Im KontextDirk-Michael Hennrich0% (1)
- Salomon Maimon Versuch Uber Die Transzendentalphilosophie PDFDokument378 SeitenSalomon Maimon Versuch Uber Die Transzendentalphilosophie PDFmishagdc100% (1)
- Sybille Krämer. Sprache. Stimme. Schrift - Zur Impliziten Bildlichkeit Sprachlicher Medien. In-Sprache Intermedial-Sprache - Stimme. Bild. TonDokument18 SeitenSybille Krämer. Sprache. Stimme. Schrift - Zur Impliziten Bildlichkeit Sprachlicher Medien. In-Sprache Intermedial-Sprache - Stimme. Bild. Tonmanu BobNoch keine Bewertungen
- Grundriss Der Geschichte Der PhilosophieDokument2.640 SeitenGrundriss Der Geschichte Der PhilosophieBobNoch keine Bewertungen
- Assmann - Stein Und Zeit PDFDokument333 SeitenAssmann - Stein Und Zeit PDFImhotep72100% (2)
- Klages - Vom Kosmogonischen ErosDokument191 SeitenKlages - Vom Kosmogonischen ErosGwalchafed666Noch keine Bewertungen
- (Uni-Taschenbücher) Franz Josef Weber (Ed.,trans.) - Platons Apologie Des Sokrates. Mit Einer Einführung, Textkritischem Apparat Und Kommentar-Ferdinand Schöningh (1971)Dokument152 Seiten(Uni-Taschenbücher) Franz Josef Weber (Ed.,trans.) - Platons Apologie Des Sokrates. Mit Einer Einführung, Textkritischem Apparat Und Kommentar-Ferdinand Schöningh (1971)Andrés Miguel Blumenbach100% (2)
- Strindberg Und Van Gogh - Versuch Einer Pathographischen Analyse Unter Vergleichender Heranziehung Von Swedenborg Und HölderlinDokument160 SeitenStrindberg Und Van Gogh - Versuch Einer Pathographischen Analyse Unter Vergleichender Heranziehung Von Swedenborg Und HölderlinMG BurelloNoch keine Bewertungen
- Texte Und Untersuchungen Zur Geschichte Der Altchristlichen Literatur. 1883. Volume 8.Dokument1.114 SeitenTexte Und Untersuchungen Zur Geschichte Der Altchristlichen Literatur. 1883. Volume 8.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNoch keine Bewertungen
- Pierre Hadot - Zur Vorgeschichte Des Begriffs ExistenzDokument8 SeitenPierre Hadot - Zur Vorgeschichte Des Begriffs ExistenzMark CohenNoch keine Bewertungen
- Das Poetische Der Philosophie - Schlegel Derrida HeideggerDokument362 SeitenDas Poetische Der Philosophie - Schlegel Derrida Heideggertheontos100% (2)
- (Poetik Und Hermeneutik 17) Gerhart Von Graevenitz, Odo Marquard (HG.) - Kontingenz-Wilhelm Fink (1998)Dokument609 Seiten(Poetik Und Hermeneutik 17) Gerhart Von Graevenitz, Odo Marquard (HG.) - Kontingenz-Wilhelm Fink (1998)tcastañon_1Noch keine Bewertungen
- Kurt Flasch: Kampfplätze Der PhilosophieDokument363 SeitenKurt Flasch: Kampfplätze Der PhilosophieSergio M.Noch keine Bewertungen
- 【谢林研究】Neumann - Zeit im Uebergang zu Geschichte - 9783495820841Dokument374 Seiten【谢林研究】Neumann - Zeit im Uebergang zu Geschichte - 9783495820841Tu Alex100% (2)
- UnscheinbarkeitDokument100 SeitenUnscheinbarkeitantoniomarkus100% (1)
- Tugendhat Ti Kata TinosDokument87 SeitenTugendhat Ti Kata Tinosmixpan100% (1)
- Heideggers Rückgang Zu Den Griechen - Werner BeierwaltesDokument29 SeitenHeideggers Rückgang Zu Den Griechen - Werner BeierwaltesJuan SolernóNoch keine Bewertungen
- 1-2 (1976, N. Walter) Frag. Jüdisch-Hellenistischer Historiker.Dokument81 Seiten1-2 (1976, N. Walter) Frag. Jüdisch-Hellenistischer Historiker.sevasteNoch keine Bewertungen
- Blumenberg SchiffbruchDokument50 SeitenBlumenberg Schiffbruchnicola_zambon100% (2)
- I - Kommentar (2009) PDFDokument230 SeitenI - Kommentar (2009) PDFCamila Belelli100% (1)
- Poetik Und Hermeneutik 01 - Nachahmung Und IllusionDokument251 SeitenPoetik Und Hermeneutik 01 - Nachahmung Und IllusionAlicia Nathalie Chamorro MuñozNoch keine Bewertungen
- Über Das Fundament Des Philosophischen Wissens Über Die Möglichkeit Der Philosophie Als Strenge WissenschaftDokument115 SeitenÜber Das Fundament Des Philosophischen Wissens Über Die Möglichkeit Der Philosophie Als Strenge WissenschaftsortvokterNoch keine Bewertungen
- Waldenfels, Bernhard - Phänomenologie in DeutschlandDokument25 SeitenWaldenfels, Bernhard - Phänomenologie in DeutschlandPavel Veraza TondaNoch keine Bewertungen