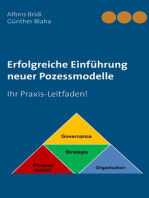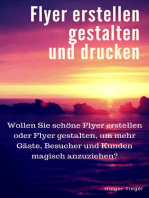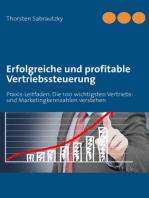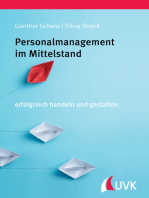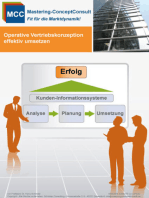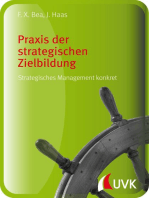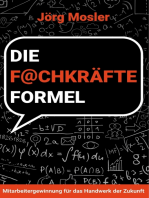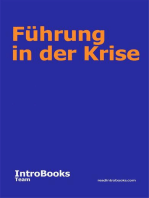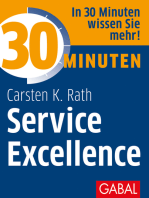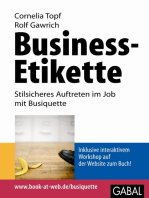Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Unternehmensziele - Zielbildung, Zielinhalte, Zieldimensionen
Hochgeladen von
Christo Pradewa Bornsel67%(3)67% fanden dieses Dokument nützlich (3 Abstimmungen)
7K Ansichten22 SeitenUnternehmensziele- Zielbildung, Zielinhalte, Zieldimensionen
Originaltitel
Unternehmensziele- Zielbildung, Zielinhalte, Zieldimensionen
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenUnternehmensziele- Zielbildung, Zielinhalte, Zieldimensionen
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
67%(3)67% fanden dieses Dokument nützlich (3 Abstimmungen)
7K Ansichten22 SeitenUnternehmensziele - Zielbildung, Zielinhalte, Zieldimensionen
Hochgeladen von
Christo Pradewa BornselUnternehmensziele- Zielbildung, Zielinhalte, Zieldimensionen
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 22
Referat
Unternehmensziele- Zielbildung, Zielinhalte, Zieldimensionen,
Zielbeziehungen
Eingereicht an: Prof. Dr. Jrgen Petzold
Hochschule Bremen
Fakultt: Wirtschaftswissenschaften
Werderstr. 73
28199 Bremen
Vorgelegt von: Roya Alvani
Adresse: Hornerstr. 3
28203 Bremen
Matrikelnummer: 299213
Studiengang: Betriebswirtschaft B.A.
Christoper Dewangga Pramudita
Adresse: Vahrerstr. 249 (Zi. 38)
28329 Bremen
Matrikelnummer: 309493
Studiengang: Betriebswirtschaft B.A.
Nikolova, Snezhina
Adresse: Hohentorsheerstr. 46
28199 Bremen
Marikelnummer: 296966
Studiengang: Betriebswirtschaft B.A.
Bremen, den 31. Mai 2012
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ... IV
1. Einleitung ............................................................................................................................................... 1
2. Definition von Unternehmenszielen .................................................................................................. 2
3. Variablen der Zieldimension .............................................................................................................. 4
4. Zielinhalte .............................................................................................................................................. 6
4.1 Zielanforderungen .......................................................................................................................... 6
4.2 Zielebenen und Kategorien ........................................................................................................... 7
4.3 Ausgewhlte Basiskennzahlen ..................................................................................................... 8
5. Zielbildung ........................................................................................................................................... 11
5.1 Gewinnorientierte Unternehmen ................................................................................................. 13
5.2 Nonprofit-Organisation ................................................................................................................. 13
6. Zielbeziehungen ................................................................................................................................. 14
6.1 Zielkomplementaritt.................................................................................................................... 14
6.2 Zielkonkurrenz .............................................................................................................................. 15
6.3 Zielindifferenz ............................................................................................................................... 15
7. Fazit ...................................................................................................................................................... 16
Literaturverzeichnis ..17
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Einordnung der Ziele im Konzept strategischer Unternehmensfhrung .............. 3
Abbildung 2: Variablen der Zieldimension ............................................................................... 5
Abbildung 3: Betriebswirtschaftliche Zielkategorien................................................................. 7
Abbildung 4: Beispiele fr Bestimmung des Inhaltes, Ausmaes und
der Zeit der Zielformulierung............................................................................. 12
1. Einleitung
Die Unternehmenswelt hat sich in den letzten Jahren schnell und grundlegend verndert.
1
Die Wettbewerbslandschaft befindet sich im Umbruch. Durch die Globalisierung von Produk-
tion und Konsumption, durch stagnierendes Marktwachstum sowie weltweite Internationale
Konkurrenz wird es fr Unternehmen immer schwieriger, ihre Marktanteile zu behaupten bzw.
auszubauen. Durch den immer strker werdenden Konkurrenzdruck, insbesondere aufgrund
der steigenden Leistungsfhigkeit von Volkswirtschaften, haben sich die Mrkte im Laufe der
letzten Jahre von Verkufer- zu Kufermrkten entwickelt.
2
Diese Entwicklung zwingt die Un-
ternehmen zur stndigen Anpassung und Weiterentwicklung ihrer Produkte.
Die Unternehmensstrategien befinden sich deswegen auch im Wandel. Whrend Unterneh-
men frher danach gestrebt haben, durch die Herstellung von Produkten die enorme Nach-
frage zu befriedigen, mssen sie heutzutage die Kundenanforderungen kennen, um ausrei-
chende Marktanteile gewinnen zu knnen. In diesem Zusammenhang hat die Diversifizierung
der Produktpalette eine besondere Bedeutung. Die internationale Konkurrenz und der stei-
gende Preis- und Kostendruck haben auch einen wesentlichen Beitrag fr die Vernderung
der Unternehmensziele und strategien geleistet.
Bei der Formulierung der Unternehmensstrategien soll im ersten Schritt eine Analyse des Un-
ternehmensumfeldes, der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der internen Un-
ternehmensprozesse erfolgen. Weiterhin ist eine Abstimmung mit den jeweiligen Strken und
Schwchen des Unternehmens erforderlich.
3
Die Unternehmensvision muss dem Unterneh-
menszweck entsprechen.
4
1
Vgl. Bea/Haas (2009), S. 1.
2
Vgl. Hans (2006), S. 557.
3
Vgl. o. V. (2005), S. 5.
4
Vgl. Runia/u. a. (2011), S. 68.
2
Einen langfristigen Unternehmenserfolg erfordert die Festlegung von Zielstrategien und berle-
gungen zur langfristigen Unternehmensvision. Unter Ziele werden unterschiedlichen Vorgaben
verstanden werden, die sowohl Zeit- als auch Sachbezug haben knnen. Beispiele fr Unter-
nehmensziele sind Umsatzerhhung, Kundenzufriedenheit, guter Ruf etc.
Dieser Referat beschftigt sich mit der Darstellung der Grundlagen der Begrifflichkeiten Unter-
nehmensziele: Zielbildung, Zielinhalte, Zieldimensionen, Zielbeziehungen und der Erluterung
der Verhltnisse unter denen. Nach dem allgemeinen berblick ber die grundstzlichen Begrif-
fe und Definitionen von Unternehmenszielen werden in den Kapiteln 3 und 4 die verschiedenen
Zielinhalte und Zieldimensionen vorgestellt. Die Kapitel 5 und 6 beschftigen sich mit dem Pro-
zess der Zielbildung und der Zielbeziehungen des Unternehmens. Abschlieend wird eine Beur-
teilung der Bedeutung der Festlegung und der Beschftigung mit den Unternehmenszielen fr
den Unternehmenserfolg abgegeben.
2. Definition von Unternehmenszielen
Durch passende Unternehmensstrategien werden gewnschte Ziele erreicht. Die Ziele sind die
wichtigsten Elemente fr eine aktive Fhrung und Steuerung vom Unternehmen.
5
Sie beschrei-
ben die Richtung fr die zuknftige Entwicklung von Unternehmen. Eine realistische und ver-
stndliche Zielformulierung ermglicht die Zielerreichung und kann auch als Motivierungsinstru-
ment fr die Mitarbeiter dienen.
Die unternehmerischen Zielsetzungen sind immer unternehmensindividuell. Zu den Top- Unter-
nehmensziele zhlen ganz oft die Sicherung der Wettbewerbsfhigkeit und die langfristige Ge-
winnerzielung. Grundstzlich mssen zwei Grundbedingungen erfllt werden:
6
5
Vgl. o.V. (2005), S. 2.
6
Vgl. Runia/u. a. (2011), S. 72.
3
Ziele mssen realistisch sein, damit sie das vorhandene Potential am besten ausnutzen
knnen.
Genauso mssen sie auch eine gewisse Menge Herausforderungen enthalten, um An-
regungen im Unternehmen zu frdern.
Die folgende Abbildung stellt eine Einordnung der Unternehmensziele im Rahmen der strategi-
schen Unternehmensfhrung dar:
Unternehmensleitbild und Zielbildung
Festlegung der Unternehmensziele
Formulierung von Strategien zur Zielerreichung
Implementierung und Durchsetzung der Strategien
Evaluierungsprozess und Kontrollprozess
Abbildung 1: Einordnung der Ziele im Konzept strategischer Unternehmensfhrung
Quelle: in Anlehnung an Gombert, G. (2010): Strategische Unternehmensziele von Architekturbros, Frankfurt am Main, S. 85.
Eine tiefer liegende Stufe der Konkretisierung von Visionen stellen die Unternehmensleitbilder
dar. In der Literatur wird der Begriff Vision auch als eine allgemein und grundstzlich gehaltene
4
Vorstellung des Unternehmens definiert.
7
Fr den Begriff Vision wird auch das Synonym Unter-
nehmensphilosophie verwendet. Einerseits beinhalten die Unternehmensleitbilder Grundstze
fr die Realisierung von Visionen. Andererseits stellen sie Orientierungshilfen in Bezug auf das
Verhalten der Mitarbeiter gegenber dem Partner des Unternehmens dar.
8
Visionen und Leitbilder sind sehr abstrakt und bedrfen einer Przision durch die Unterneh-
mensziele. Die Visionen richten sich mehr nach auen, whrend die Leitbilder an die Mitarbeiter
und Mitglieder des Unternehmens gerichtet sind.
9
Die Unternehmensplanung wird auch an den Unternehmenszielen gekoppelt. Es gibt verschie-
dene Wege und Instrumente, womit die Ziele erreicht werden knnen, z. B. Analyse und Bewer-
tung mglicher Risiken, damit die passenden Entscheidungen fr die Zielerreichung getroffen
werden knnen.
10
Eine weitere und tiefer gehende Konkretisierung der Ziele wird im folgenden Kapitel ber die
umfassende Erluterung der Zielinhalte erreicht. Nach der Darstellung der Zielanforderungen
werden die Zielebenen und Kategorien beschrieben.
3. Variablen der Zieldimension
Der Begriff der Zieldimensionen wird in der Literatur nicht einheitlich verwendet. Die Zieldimen-
sion ist der Zielinhalt, das Zielausma und der zeitliche Bezug eines Ziels. Die fnf Variablen der
Zieldimension sind Umsatz, Leistung, Raum, Kosten und Zeit.
11
7
Vgl. Gombert (2010), S. 83.
8
Vgl. Marquardt (o. J.), S. 9.
9
Vgl. Bea/Haas (2009), S. 70.
10
Vgl. Haunerdinder/Probst (2008), S. 12.
11
Vgl. Drner (2009), S. 150; siehe auch Abbildung 2.
5
Abbildung 2: Variablen der Zieldimension
Quelle: Drner, V. (2009): Gewinne: Global. die taktisch dominierte Zielwertgeregelte Unternehmensfhrung, Kln/Berlin, S. 150.
Bei der Abbildung wird es klar dargestellt, dass die Variablen Umsatz, Leistung und Raum stei-
gen sollen, whrend die Kosten und die Zeit reduziert werden.
Eine andere Bedeutung erhlt der Begriff, wenn das Unternehmen als ein technologisches, wirt-
schaftliches und soziales Konstrukt angesehen wird. Aus dem betriebswirtschaftlichen Denken
in Mengen und Qualitten ergibt sich die technologische (produktive) Zieldimension. Ein typi-
sches Ziel ist die technische Wirtschaftlichkeit (sog. Produktivitt). Die konomische Zieldimen-
sion umfasst neben den technologischen weitere Zielsetzungen wie Rentabilitt und Gewinn.
Die soziale Zieldimension wird durch das Denken in Beziehungen und Rollen ausgedruckt. Hier
kommen Begriffe wie Arbeitszufriedenheit in dem Vordergrund der Betrachtung.
Nachfolgend werden die Zielinhalte, das Zielausma und der zeitliche Bezug sowie die ange-
sprochenen Zielsetzungen definiert und erlutert.
6
4. Zielinhalte
Im Rahmen der Unternehmensplanung stellt sich oft die Frage, wie lange Ziele erreicht werden
knnen. Die Ziele haben drei Hauptmerkmale: Zielinhalt, Zielausma und Zeitbezug.
Der Begriff Zielinhalt ist ein von den drei Merkmalen der Unternehmensziele.
12
Die Zielinhalte
sind die angestrebten Gren und mssen qualitativ nach Art und Richtung formuliert werden.
Im Gegensatz dazu wird der Zielausma (Erfllungsgrad) quantitativ dargestellt. Zum Beispiel
knnte beim Ziel maximaler Gewinn der Zielausma als festgelegter Zielwert (Ge-
winn: 2000 EUR/Monat) oder aber auch in einem festgelegten Zielintervall (Gewinn: 1500 EUR
bis 2500 EUR/Monat) sein.
Der Zeitbezug ist der Zeitpunkt, auf den sich die Zielerreichung bezieht. Unternehmensziele
knnen somit in Abhngigkeit von dem festgelegten Zeitbezug operativ (kurzfristig) oder strate-
gisch (langfristig) sein.
4.1 Zielanforderungen
Bei der Formulierung der Unternehmensziele sollten folgende Anforderungen beachten werden:
Ziele sollten operational sein. Der Entscheidungstrger muss Einfluss auf die Zielerfl-
lung haben. Umgekehrt muss die Zielerfllung fr den Entscheidungstrger prfbar sein.
Ziele sollten messbar sein, damit die Zielerreichung komplett berprft werden kann.
Zum Beispiel sollte ein Ziel nicht nur als Gewinn festgelegt werden, sondern Gewinn in
Hhe von 2000 EUR/Monat sein.
Ziele sollten erreichbar sein. Die Zielvorgaben fr die einzelnen Bereiche sollen reali s-
tisch sein. Sie drfen nicht so hoch gesteckt sein, dass Identifikation verloren geht.
Ohne ein von den drei beschriebenen Anforderungen wird ein Ziel nicht beherrschbar. Die Ziele
knnten aber auch anspornend sein, d.h. das bereits Erreichte kann auch berschritten werden.
12
Vgl. Ziegenbein (2007), S. 104.
7
4.2 Zielebenen und Kategorien
Im Allgemeinen lassen sich die folgenden Gruppen Zielinhalte unterscheiden.
Die Sachziele (non-financials) gehren zu der ersten Gruppe und sind diejenigen betrieblichen
Ziele, die sich durch konkrete Ausbung der einzelnen Funktionen einer Unternehmung inner-
halb des finanz- und gterwirtschaftlichen Umsatzprozesses verwirklichen lassen. Beispiele fr
Sachziele sind:
Leistungsziele: Umsatzvolumen, Marktanteile, Art der Produkte, etc.,
Ziele sozialer oder kologischer Art: Arbeitsklima, Lohngerechtigkeit, Umweltschutz,
Gesundheitsschutz,
Fhrungs- und Organisationsziele: Aufgabenteilung, Fhrungsstil, Art und Weise der
Problemlsungen,
Ziele finanzieller Art: Liquiditt, optimale Kapitalstruktur.
Abbildung 3: Betriebswirtschaftliche Zielkategorien
Quelle: Jung, H. (2006): Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 10. Auflage, Mnchen, S. 20.
Die zweite Gruppe der Unternehmensziele sind Formalziele (sog. financials). Man nennt die
Formalziele auch Erfolgsziele, da sie sich am Erfolg betriebswirtschaftlicher Ttigkeiten ausrich-
8
ten. Diese Formalziele sind eine bergeordnete Stelle zu den Sachzielen.
13
Oft festgelegte For-
malziele sind: Produktivitt, Wirtschaftlichkeit, Rentabilitt und Gewinn. Formalziele beziehen
sich demgegenber auf Anforderungen an den jeweils inhaltlichen spezifizierten Leistungserstel-
lungsprozess und -verwertungsprozess. Im Formalziel konkretisiert sich der konomische As-
pekt.
14
4.3 Ausgewhlte Basiskennzahlen
Wie im Kapitel 4.2. erlutert, knnen nur die Formalziele quantitativ festgelegt werden. Die Ba-
siskennzahlen werden bentigt, um die Erreichung der Formalziele beurteilen zu knnen.
Nachfolgend werden oft verwendete Kennzahlen, die die im Kapitel 4.2. genannten Ziele konkre-
tisieren:
Produktivitt: das mengenmige Verhltnis des Outputs (Ausbringungsmenge) zum Input
(Einsatzmenge):
Produktivitt =
Ausbringungsmenge
Einsatzmenge
Die Produktivitt ist eine besonders wichtige Kennzahl fr Produktionsunternehmen, da sie die
Effizienz des Produktionsprozesses misst. Ist die Einsatzmenge grer als die Ausbringungs-
menge (d.h. Produktivitt kleiner als 1), so erzielt das Unternehmen wirtschaftlich betrachtet ei-
nen Verlust. Dies kann langfristig ein Indikator fr die Gefhrdung der Unternehmensexistenz
sein. Bei der Berechnung der Produktivitt mssen die verschiedenen Gter bewertet werden,
damit der Gesamtoutput als eindimensionale Gre angegeben werden kann. In Abhngigkeit
von der Art des Outputs Gter, Arbeitsleistung oder Kapital eine Material-, Maschinen-, Ar-
beits- bzw. Kapitalproduktivitt berechnet werden.
15
13
Siehe auch Abbildung 3.
14
Kubicek (1981), S. 460.
15
Vgl. o.V (o. J.).
9
Wird im Nenner der Input-Output-Verhltnis nur die Menge eines einzigen Faktors bercksich-
tigt, ergeben sich Teilproduktivitt:
Arbeitsproduktivitt =
Ausbringungsmenge
Arbeitseinsatzmenge
Kapitalproduktivitt =
Ausbringungsmenge
Kapitaleinsatzmenge
Rentabilitt: ist im Allgemein das Verhltnis zwischen Gewinn und Erfolg.
Rentabilitt =
Gewinn
Erfolg
Als Rentabilitt wird die Fhigkeit des Unternehmens bezeichnet, die aus dem Betriebsprozess
entstandenen Kosten durch entsprechende Ertrge zu decken.
16
Dieses Ziel ist neben dem Ziel
der Liquidittssicherung notwendig, damit ein stetiges Unternehmenswachstum zur Sicherung
der Unternehmensexistenz gewhrleistet werden kann.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht stellt die Rentabilitt die Relation des Erfolgs zum eingesetz-
ten Kapital dar. Da die Gren Gewinn und Kapital unterschiedlich definiert werden knnen,
wird zwischen folgende Rentabilittskennziffer unterschieden:
Gesamtkapitalrentabilitt
=
(Gewinn + Fremdkapitalzinsen) 100%
Gesamtkapital
16
Vgl. Jung (2006), S. 20.
10
Eigenkapitalrentabilitt =
Gewinn 100%
Eigenkapital
Fremdkapitalrentabilitt =
Fremdkapitalzinsen
100%
Eigenkapital
Umsatzrentabilitt =
Gewinn 100%
Umsatzerls
Wirtschaftlichkeit: Whrend die Rentabilitt der Inhalt des betriebswirtschaftlichen Handelns
bestimmt, legt die Wirtschaftlichkeit dessen Form. Die Wirtschaftlichkeit ist eine Kennzahl, die
das Verhltnis von Ertrag und Aufwand bzw. Leistung und Kosten zum Ausdruck bringt:
17
Wirtschaftlichkeit =
Ertrag
Aufwand
Eine Wirtschaftlichkeit wird dann gegeben, wenn der Quotient grer oder mindestens gleich 1
ist, da in dieser Situation es ein Gewinn erzielt wurde, der kostendeckend ist. Ob ein Betrieb
wirtschaftlich arbeitet, richtet sich im Wesentlichen danach, ob es gelingt, eine bestimmte be-
triebliche Leistung mit dem geringstmglichen Einsatz an Mitteln (Faktoreinsatzmenge) oder mit
gegebenen Mitteln die bestmgliche Leistung zu erziehen. Dieses Prinzip der Wirtschaftlichkeit
17
Vgl. o.V. (o. J.).
11
ist also stets ein Auswahlprinzip derart, dass fr eine betriebliche Aufgabe stets die gnstigste
Lsung gefunden werden soll.
18
5. Zielbildung
Unter Anwendung der homo oeconomicus
19
-Voraussetzung hat jede Unternehmung in der
klassischen Betriebswirtschaftstheorie das Ziel, Gewinn bzw. Rentabilitt zu maximieren. Die
Unternehmenstheorie, die zeitnah bekannt wird, unterstellt, dass am Zielbildungsablauf der Un-
ternehmung mehrere Willenszentren mit jeweils eigenen Zielvorstellungen beteiligt sind.
20
Die Zielbildung spielt eine wichtige Rolle fr die Gestaltung der Unternehmensorganisation. Der
Zielbildungsprozess kann von vielen Faktoren beeinflusst werden: bspw. von den wirtschaftli-
chen, sozialen, politischen und technologischen Rahmenbedingungen sowie dem internen und
externen Unternehmensumfeld. Diese Faktoren bilden dabei den ueren Rahmen fr die Fest-
legung der Ziele und Entscheidungen, die die Fhrung des Unternehmens steuern.
21
Hufig findet die Zielbildung durch den Unternehmenseigentmer, die Fhrungskraft oder die
Mitarbeiter selber statt. Somit haben die indirekt an der Leistungserstellung der Unternehmung
beteiligten Gruppen aus ihrer Rolle heraus einen Einfluss auf den Zielbildungsprozess. Diese
Gruppen lassen sich in internen (Eigentmer, Management, Belegschaft) und externen Macht-
zentren (Kreditinstitute, Kapitalgeber, Lieferanten, Kunden) aufteilen.
22
Die Eigentmer bzw. die Unternehmensfhrung haben einen wesentlichen Einfluss auf die Ziel-
bildung, weil die in vielen Fllen ber viele Erfahrungen und einen Fhrungsstil verfgen. Die
Arbeitnehmer, die im Betrieb beschftigt sind, haben auch einen Einfluss auf die Zielbildung, da
sie die internen Unternehmensprozesse und die externen Unternehmensbeziehungen kennen.
18
Vgl. Gutenberg (1958), S. 31
19
Jung (2006), S. 33.
20
Vgl. Jung (2006), S. 33.
21
Vgl. Amely/Krickhahn (2009), S. 53.
22
Vgl. Jung (2010), S. 33.
12
Die Unternehmen mssen bei der Zielbildung darauf achten, dass die Zielvorgabe mithilfe des
SMART- Prinzips ausfhren. Die Zielvorgaben mssen Spezifisch formuliert, Messbar, An-
spruchsvoll, Realistisch und zeitlich Terminiert sein.
23
Der Zielbildungsprozess kann in 4 Phasen unterteilt werden:
24
Zielsuche: Sie entsprechen dem Vorgehen bei der Suche nach Zielideen. Kreativitts-
techniken wie z. B.: Brainstorming, Synektik, Eigenschaftslisten, morphologische Me-
thoden etc. knnen dabei eingesetzt werden.
Zielabstimmung: Sie erklrt, in welcher Beziehung die Ziele zu den bisherigen Zielen
stehen. Die Beteiligten an der Zielabstimmung setzten sich in diese Phase mit der Unter-
teilung in Haupt-, Neben-, Ober- oder Unterziele auseinander.
Zielformulierung: Sie sollte durch die Unternehmensleitung nach Inhalt, Ausma und Zeit
erfolgen, die der Erfolg der Zielerreichung gemessen werden kann. In der folgenden Ta-
belle werden Beispiele der Zielformulierung dargestellt:
Inhalt Ausma Zeit
Zunahme des Umsatzes um 30 %... im 1. Quartal 2012
Reduzierung der Mitarbeiter-
zahl
um 5 Schreibkrfte ab dem 1.1.2012
Auslastung des Drehautoma-
ten
mit maximaler Kapazi-
tt
vom 1.3.2012 bis
30.4.2012
Abbildung 4: Beispiele fr Bestimmung des Inhaltes, Ausmaes und der Zeit der Zielformulierung
Quelle: Jung, H. (2010): Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 12. Auflage, Mnchen, S. 177.
23
Vgl. Amely/Krickhahn (2009), S. 54.
24
Vgl. Jung (2010), S. 177.
13
Zielverbindlichkeit: Sie bildet die Soll-Daten, die Basis fr den spteren Soll-Ist-Vergleich
durch den Unternehmenscontroller. Die Ziele, die klar formuliert werden, knnen von der
Unternehmensleitung fr verbindlich erklrt werden.
Gewinnorientierte Unternehmen bzw. NPO (Nonprofit-Organisationen) sind beispielhafte Unter-
nehmenstypen, die im Hinblick auf die Zielbildung nachfolgend beschrieben werden sollen.
25
5.1 Gewinnorientierte Unternehmen
Grundstzlich wird die Zielbildung der Unternehmen, bei denen der Gewinn im Vordergrund
steht, von der Unternehmensphilosophie bestimmt. Davon wird es festgelegt, welche Interessen
in welchem Ausma in dem Zielbildungsprozess im Unternehmen bercksichtigt werden sollen.
Die Kapitaleigner, die Arbeitnehmer und die ffentlichkeit knnen als Interessengruppen die
Zielbildung dem Grunde nach beeinflussen.
26
5.2 Nonprofit-Organisation
NPO sind Organisationen, die nicht gewinnorientiert sind. Bei denen steht nicht das Gewinnziel
im Vordergrund, sondern ein Sachziel. Meistens handelt es sich um die Bedarfsdeckung mithilfe
der Bereitstellung von einem Leistungsprogramm. Vereine, Verbnde, Gewerkschaften, Genos-
senschaften, Anstalten und Stiftungen des ffentlichen Rechts, Naturschutzorganisationen, Kir-
chen, religise Gemeinschaften, Wohlfahrts- und caritative Organisationen, staatliche Kranken-
huser, Theater, Schulen, Universitten, ffentliche Rundfunkanstalten, usw. gehren zu den
Formen der Nonprofit-Organisationen. Zum Beispiel:
27
haben Universitten die Ziele, die wissenschaftlichen Erkenntnisse durch Forschung zu
steigern und die Ausbildung der Akademie zu optimieren.
25
Vgl. Bea/Haas (2009), S. 75.
26
Vgl. Bea/Haas (2009), S. 77.
27
Vgl. Bea/Haas (2009), S. 75.
14
Der ffentliche Nahverkehr hat das Ziel, ein sicheres und bedarfsgerechtes Verkehrs-
netz zu schaffen bzw. kostengnstige und nachfragegerechte Verkehrsleistungen bereit-
zustellen.
Die Gemeindeverwaltungen (z.B.: Standesamt, Sozialamt) haben grundstzlich die Ziele,
die kommunale Wohlfahrt zu steigern und ffentliche Dienstleistungen bereitzustellen
6. Zielbeziehungen
In der Regel wird die Mehrzahl von Einzelzielen (Zielelementen) in der Zielkonzeption der Un-
ternehmung zusammengefasst und gleichzeitig angestrebt. Die Zielelemente knnen in unter-
schiedlichen Beziehungen zueinander stehen.
28
Beziehungen knnen die Informationen liefern, ob die Manahmen des jeweiligen Unternehmen
zu einer bestimmten Zielerreichung positive (untersttzende), negative (einschrnkende) oder
sogar keinerlei Wirkungen auf die Erreichung anderer Ziele ausweisen. Die Zielbeziehungen
lassen sich in Zielkonsens bzw. Zielkonflikt aufteilen.
29
Der Zielkonsens kann in Zielidentitt,
Zielneutralitt und Zielkomplementaritt unterteilt werden, whrend der Zielkonflikt sich aus Ziel-
konkurrenz bzw. Zielanatomie zusammensetzt.
30
In dem folgenden Kapitel werden die Zielkomp-
lementaritt, Zielkonkurrenzen bzw. Zielindifferenz ausfhrlich weiter erklrt.
6.1 Zielkomplementaritt
Eine Zielkomplementaritt entsteht, wenn die zunehmende Erfllung eines Zielelements von der
zunehmenden Erfllung eines anderen Zielelements verursacht wird. Zum Beispiel knnen sin-
kende Kosten im Produktionsbereich zu einer Erhhung des Gewinns fhren.
31
28
Vgl. Jung (2010), S. 34.
29
Vgl. Hummel (2007), S. 76.
30
Vgl. Hummel (2007), S. 76.
31
Vgl. Jung (2010), S. 34f.
15
Solche zusammenhngende Ziele knnen einen positiven Einflu im Hinblick auf die Zielerrei-
chung haben. Beispielsweise frdert eine Bergwanderung die krperliche Fitness.
32
6.2 Zielkonkurrenz
Bei einer Zielkonkurrenz stehen die Zielvorgaben in negativen Beziehungen zueinander. Eine
Erreichung von Ziel 1 (Reduzierung der Kosten) fhrt somit zu einer Behinderung von Ziel 2
(Qualittserhhung). Beispielsweise fhrt ein knappes Urlaubsbudget zu keinen Helikopterflug.
Es bleiben aber weitere Mglichkeiten wie z. B. die Gipfelerreichung per Seilbahn oder mit dem
Bergfhrer.
33
6.3 Zielindifferenz
Die Zielindifferenz, die auch meistens als Zielneutralitt in einigen Bchern genannt wird
34
, be-
deutet, dass die Erfllung eines Zielelements in einer Reihe von Handlungsalternativen sogar
keinerlei Wirkung auf die gleichzeitige Erfllung eines anderen Zielelements hat.
35
Dies hat zur Folge, dass die Erreichung von Ziel 1 (Besetzung von vakanten Stellen) unabhn-
gig von der Erreichung von Ziel 2 (Einkauf eines neuen Autos) sein kann. Beispielsweise ist die
Erreichung des Gipfels unabhngig von einer bernachtung auf einer Berghtte.
36
32
Vgl. Pfaff (2004), S. 135.
33
Vgl. Pfaff (2004), S. 135.
34
Vgl. Kahle (2001), S. 30.
35
Vgl. Jung (2010), S. 34f.
36
Vgl. Pfaff (2004), S. 136.
16
7. Fazit
Die Vision des Unternehmens ist von seinen Zielsetzungen abhngig.
37
Unternehmen verfolgen
tglich zahlreiche Ziele. Deren Erreichung ist der Ma fr die Beurteilung des Unternehmenser-
folges. Zielsetzungen und Zielstrategien sind die wichtigsten Bausteine fr die langfristige Fh-
rung und Steuerung eines Unternehmens.
Die Unternehmensexistenz kann nur durch die Erreichung zahlreicher Hauptziele (Gewinnerzie-
lung, Kundenzufriedenheit, Konkurrenzfhigkeit, Liquidittssicherung) gewhrleistet werden. Un-
ternehmen, die es schaffen, die Hauptziele gleichzeitig zu verfolgen, ohne dass die Erfllung ei-
nes Ziels die Erfllung eines anderen verhindert, haben hhere Chancen, ihre Marktanteile lang-
fristig beizubehalten.
Die im Rahmen dieser Arbeit diskutierten Themen sollen als Hauptbestandteil der strategischen
Unternehmensfhrung betrachtet werden. Die zahlreichen Marktregulierungen, Gesetz-
gebungen, die wirtschaftlichen und kologischen Einschrnkungen mssen im Rahmen der Ziel-
formulierungen bercksichtigt werden, damit die Zielerreichung realistisch wird. Deswegen muss
die Fhrungsebene ber ausreichende Erfahrungen ber das Unternehmensumfeld und die ge-
samtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen verfgen, damit keine Zielkonflikte entstehen.
Auerdem sollen die Ziele nicht einzeln, sondern als Zielsysteme festgelegt werden, weil ein
einseitiges Gewinnmaximierungsziel dazu fhren kann, dass Kunden verloren gehen. Somit
kann langfristig die Unternehmensexistenz gefhrdet werden.
37
Vgl. o. V. (2005), S. 1.
Literaturverzeichnis
17
Amely, T., Krickhahn, T. (2009): BWL fr Dummies: Optimieren Sie ihr Wissen nach dem
Minimierungsprinzip, Weinheim.
Bea, F.X., Haas, J. (2009): Strategisches Management, 4. Auflage, Stuttgart.
Dietger, H., Taylor, B. (Hrsg.) (2006): Strategische Unternehmensplanung Strategische
Unternehmensfhrung, Stand und Entwicklungstendenzen, 9. Auflage, Gieen/Berlin.
Drner, V. (2009): Gewinne, Global. die taktische dominierte Zielwertgeregelte Unterneh-
mensfhrung, Kln/Berlin.
Gombert, G. (2010): Strategische Unternehmensziele, Frankfurt am Main.
Gutenberg, E. (1958): Einfhrung in die Betriebswirtschaftslehre, Wiesbaden.
Hans, J. (2010): Allgemeine Betriebswirtscaftslehre, 12. Auflage, Mnchen.
Haunerdinder, M., Probst, H. (2008): BWL leicht gemacht, Mnchen.
Hummel, T. R. (2007): Betriebswirtschaftslehre Kompakt: Mit bungsaufgaben, 3. Auflage,
Mnchen.
Jung, H. (2006): Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 10. Auflage, Mnchen.
Jung, H. (2010): Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 12. Auflage, Mnchen.
Kahle, E. (2001): Betriebliche Entscheidungen, 6. Auflage, Mnchen.
Marquardt, J. (o. J.): Strategische Planung und strategisches Management, o.O..
o.V. (2005): Einfhrung zur Betriebswirtschaftslehre fr Existenzgrnder, http://www. econo-
mics.phil.uni-erlangen.de/bwl/exist_gr/uziele.pdf, 29.5.2012.
o.V. (o. J.): Produktivitt, http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/produktivitaet/produktivi
taet.htm, 2.6.2012.
Pfaff, D. (2004): Praxishandbuch Marketing: Grundlagen und Instrumente, Frakfurt am Main.
Runia, P., Wahl, F., Geyer, O. (2011): Marketing Eine prozess- und praxisorientierte Ein-
fhrung, 3. Auflage, Mnchen.
Ziegenbein, K. (2007): Controlling, 9. Auflage, o.O..
1. Alvani, Roya : Punkte 3, 4
Ich versichere hiermit, dass die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe selbstndig ver-
fasst wurde und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt worden sind.
Wrtlich oder sinngem aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Anga-
be der Quellen kenntlich gemacht
Bremen, den 31. Mai. 2012
Unterschrift:
2. Pramudita, Christoper Dewangga : Punkte 5, 6
Ich versichere hiermit, dass die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe selbstndig ver-
fasst wurde und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt worden sind.
Wrtlich oder sinngem aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Anga-
be der Quellen kenntlich gemacht
Bremen, den 31. Mai. 2012
Unterschrift:
3. Nikolova, Snezhina : Punkte 1, 2, 7
Ich versichere hiermit, dass die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe selbstndig ver-
fasst wurde und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt worden sind.
Wrtlich oder sinngem aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Anga-
be der Quellen kenntlich gemacht
Bremen, den 31. Mai. 2012
Unterschrift:
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Personalmanagement Teil I: Teil I: Personal planen und gewinnenVon EverandPersonalmanagement Teil I: Teil I: Personal planen und gewinnenNoch keine Bewertungen
- 30 Minuten für erfolgreiche Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitVon Everand30 Minuten für erfolgreiche Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitNoch keine Bewertungen
- Employer Branding PDFDokument69 SeitenEmployer Branding PDFBika HuNoch keine Bewertungen
- Effizienter Arbeiten: Wie Entrepreneure mit Hilfe von virtuellen Assistenten mehr erledigenVon EverandEffizienter Arbeiten: Wie Entrepreneure mit Hilfe von virtuellen Assistenten mehr erledigenNoch keine Bewertungen
- BWL A ZusammenfassungDokument21 SeitenBWL A ZusammenfassungHans_meier123Noch keine Bewertungen
- Erfolgreiche Einführung neuer Pozessmodelle: Ihr Praxis-Leitfaden!Von EverandErfolgreiche Einführung neuer Pozessmodelle: Ihr Praxis-Leitfaden!Noch keine Bewertungen
- Schnittstellenmanagement des Einkaufs: Innovations- und Wertbeitrag aus dem EinkaufVon EverandSchnittstellenmanagement des Einkaufs: Innovations- und Wertbeitrag aus dem EinkaufNoch keine Bewertungen
- Schadensfälle in der Gebäudereinigung: Schäden erkennen und vermeidenVon EverandSchadensfälle in der Gebäudereinigung: Schäden erkennen und vermeidenNoch keine Bewertungen
- Neu in der Führungsrolle: Als Chef akzeptiert werden. Frauen als Führungskraft & Mixed Leadership. Vorgesetzter sein, Mensch bleiben. Eigene Führungstechniken & Führungsstile findenVon EverandNeu in der Führungsrolle: Als Chef akzeptiert werden. Frauen als Führungskraft & Mixed Leadership. Vorgesetzter sein, Mensch bleiben. Eigene Führungstechniken & Führungsstile findenNoch keine Bewertungen
- Strategisches Management für KMU: Unternehmenswachstum durch (r)evolutionäre UnternehmensführungVon EverandStrategisches Management für KMU: Unternehmenswachstum durch (r)evolutionäre UnternehmensführungNoch keine Bewertungen
- Kundenzufriedenheits- und Kundenbindungsmanagement: Am Beispiel der Division Privatkunden, Klein- und Mittelbetriebe der UniCredit Bank Austria AGVon EverandKundenzufriedenheits- und Kundenbindungsmanagement: Am Beispiel der Division Privatkunden, Klein- und Mittelbetriebe der UniCredit Bank Austria AGNoch keine Bewertungen
- Projektmanagement: Nexum AG Im InterviewDokument3 SeitenProjektmanagement: Nexum AG Im Interviewnexum AGNoch keine Bewertungen
- Marketinghaus Synova WA SV1-7 A1 Poster WebDokument1 SeiteMarketinghaus Synova WA SV1-7 A1 Poster WebEv RennNoch keine Bewertungen
- Chancen und Risiken leistungsorientierter VergütungssystemeVon EverandChancen und Risiken leistungsorientierter VergütungssystemeNoch keine Bewertungen
- Flyer erstellen gestalten und drucken: Wollen Sie schöne Flyer erstellen oder Flyer gestalten, um mehr Gäste, Besucher und Kunden magisch anzuziehen?Von EverandFlyer erstellen gestalten und drucken: Wollen Sie schöne Flyer erstellen oder Flyer gestalten, um mehr Gäste, Besucher und Kunden magisch anzuziehen?Noch keine Bewertungen
- Internationales Marketing erfolgreich ausrichten: Praxisbewährte Methoden für ein erfolgreiches internationales MarketingVon EverandInternationales Marketing erfolgreich ausrichten: Praxisbewährte Methoden für ein erfolgreiches internationales MarketingNoch keine Bewertungen
- Erfolgreiche und profitable Vertriebssteuerung: Praxis-Leitfaden: Die 100 wichtigsten Vertriebs- und Marketingkennzahlen verstehenVon EverandErfolgreiche und profitable Vertriebssteuerung: Praxis-Leitfaden: Die 100 wichtigsten Vertriebs- und Marketingkennzahlen verstehenNoch keine Bewertungen
- Demografischer Wandel: Folgen für Unternehmen und LösungsansätzeVon EverandDemografischer Wandel: Folgen für Unternehmen und LösungsansätzeNoch keine Bewertungen
- Innendienst 4.0: Der verkaufsaktive Innendienst der ZukunftVon EverandInnendienst 4.0: Der verkaufsaktive Innendienst der ZukunftNoch keine Bewertungen
- Bewerbungsratgeber A4 NEU Interaktiv FinalDokument15 SeitenBewerbungsratgeber A4 NEU Interaktiv FinalKurdiNoch keine Bewertungen
- Markt- und Kundenorientierung: Ein übergreifender ProzessVon EverandMarkt- und Kundenorientierung: Ein übergreifender ProzessNoch keine Bewertungen
- Marketing-Routenplaner: Strategien effizient erarbeitenVon EverandMarketing-Routenplaner: Strategien effizient erarbeitenNoch keine Bewertungen
- BWL Einheit3 WS22Dokument29 SeitenBWL Einheit3 WS22Florian RedlNoch keine Bewertungen
- Karriereplanung PDFDokument70 SeitenKarriereplanung PDFPatricio PalmaNoch keine Bewertungen
- Variable Entlohnungsmodelle: Leistungsorientierte Oder Erfolgsorientierte Entlohnung?Dokument3 SeitenVariable Entlohnungsmodelle: Leistungsorientierte Oder Erfolgsorientierte Entlohnung?Gunther WolfNoch keine Bewertungen
- Betriebswirtschaftliche KennzahlenDokument14 SeitenBetriebswirtschaftliche KennzahlenBoBo_786Noch keine Bewertungen
- Personalmanagement im Mittelstand: erfolgreich handeln und gestaltenVon EverandPersonalmanagement im Mittelstand: erfolgreich handeln und gestaltenNoch keine Bewertungen
- Operative Vertriebskonzeptionen effektiv umsetzen: Vertriebskonzepte erfolgreich aufbauen & umsetzenVon EverandOperative Vertriebskonzeptionen effektiv umsetzen: Vertriebskonzepte erfolgreich aufbauen & umsetzenNoch keine Bewertungen
- Fachkräftemangel oder Machkräftemangel?: Warum Personalprobleme oft hausgemacht sindVon EverandFachkräftemangel oder Machkräftemangel?: Warum Personalprobleme oft hausgemacht sindNoch keine Bewertungen
- Strategien zur Mitarbeiterbindung für Handwerksunternehmen der Kälte- und Klimabranche am Beispiel von Personal der Generation Y und Z: Praktische Tipps und Überprüfung der Hypothesen anhand einer breiten Online-Umfrage im KältehandwerkVon EverandStrategien zur Mitarbeiterbindung für Handwerksunternehmen der Kälte- und Klimabranche am Beispiel von Personal der Generation Y und Z: Praktische Tipps und Überprüfung der Hypothesen anhand einer breiten Online-Umfrage im KältehandwerkNoch keine Bewertungen
- Stakeholder identifizieren und managen im Market Access-Prozess: Herausforderungen für deutsche Pharmaunternehmen nach der Einführung des AMNOGVon EverandStakeholder identifizieren und managen im Market Access-Prozess: Herausforderungen für deutsche Pharmaunternehmen nach der Einführung des AMNOGNoch keine Bewertungen
- Alle Kompetenzen Liste Mit BedeutungDokument7 SeitenAlle Kompetenzen Liste Mit BedeutungMónika MennerNoch keine Bewertungen
- 2 Jahres Bilanz Lean Für Das KrankenhausDokument2 Seiten2 Jahres Bilanz Lean Für Das KrankenhausDr. med. Hank SchiffersNoch keine Bewertungen
- Ich Werde Datenqualitätsbeauftragter - Und Nun?Dokument2 SeitenIch Werde Datenqualitätsbeauftragter - Und Nun?Ralf BecherNoch keine Bewertungen
- Erfolgsfaktor Mitarbeiterakzeptanz in Veränderungsprozessen: Handlungsempfehlungen für zukünftige Change-Projekte im Rahmen einer proaktiven OrganisationsentwicklungVon EverandErfolgsfaktor Mitarbeiterakzeptanz in Veränderungsprozessen: Handlungsempfehlungen für zukünftige Change-Projekte im Rahmen einer proaktiven OrganisationsentwicklungNoch keine Bewertungen
- Vorlesung - PDM - PLM - Industrielle Informationstechnik - TU BerlinDokument46 SeitenVorlesung - PDM - PLM - Industrielle Informationstechnik - TU BerlinAtef NazNoch keine Bewertungen
- Praxis der strategischen Zielbildung: Strategisches Management konkretVon EverandPraxis der strategischen Zielbildung: Strategisches Management konkretNoch keine Bewertungen
- Die Fachkräfteformel: Mitarbeitergewinnung für das Handwerk der ZukunftVon EverandDie Fachkräfteformel: Mitarbeitergewinnung für das Handwerk der ZukunftNoch keine Bewertungen
- SFM - Shop Floor Management: Führen am Ort der WertschöpfungVon EverandSFM - Shop Floor Management: Führen am Ort der WertschöpfungNoch keine Bewertungen
- ASSESSMENT+Vorlesung+MARKETING FinalDokument195 SeitenASSESSMENT+Vorlesung+MARKETING FinalAlexandra CiorsacNoch keine Bewertungen
- Materielle Und Immaterielle AnreizsystemeDokument3 SeitenMaterielle Und Immaterielle AnreizsystemeDenise31089100% (1)
- Audi Quick Recruiting QuideDokument1 SeiteAudi Quick Recruiting QuidepandasunilNoch keine Bewertungen
- Fakten über Wirtschaft - Band 2 - BetriebsWirtschaftsLehre -: Eine Einführung in hierarchischen Modulen - Betrieb als Erkenntnisobjekt der BWLVon EverandFakten über Wirtschaft - Band 2 - BetriebsWirtschaftsLehre -: Eine Einführung in hierarchischen Modulen - Betrieb als Erkenntnisobjekt der BWLNoch keine Bewertungen
- Spitzenleistungen Im Key-Account-Management Das St. Galler KAM-KonzeptDokument352 SeitenSpitzenleistungen Im Key-Account-Management Das St. Galler KAM-KonzeptDominik Staff0% (1)
- Präsentation - WachstumsstrategienDokument4 SeitenPräsentation - Wachstumsstrategienapi-3735112Noch keine Bewertungen
- Kundenzufriedenheit SteigernDokument60 SeitenKundenzufriedenheit SteigernstrongcheerfulNoch keine Bewertungen
- Mitarbeiterführung erfolgreich und praxisorientiert: Changemanagement – Führungsinstrumente – Betriebliche GesundheitsförderungVon EverandMitarbeiterführung erfolgreich und praxisorientiert: Changemanagement – Führungsinstrumente – Betriebliche GesundheitsförderungNoch keine Bewertungen
- Business-Etikette: Stilsicheres Auftreten im Job mit BusiquetteVon EverandBusiness-Etikette: Stilsicheres Auftreten im Job mit BusiquetteNoch keine Bewertungen
- Von der Fachperson zur Führungsperson: Eine Einführung und Starthilfe für neue oder zukünftige FührungspersonenVon EverandVon der Fachperson zur Führungsperson: Eine Einführung und Starthilfe für neue oder zukünftige FührungspersonenNoch keine Bewertungen
- Globalisierung: Chancen. Beziehungen. Technologie. Ethik. StrategienVon EverandGlobalisierung: Chancen. Beziehungen. Technologie. Ethik. StrategienNoch keine Bewertungen
- Customer Relationship Management (CRM) erfolgreich aufbauen: CRM Grundlagen und Umsetzung für die PraxisVon EverandCustomer Relationship Management (CRM) erfolgreich aufbauen: CRM Grundlagen und Umsetzung für die PraxisNoch keine Bewertungen
- Beratung anders.: Consulting für Betriebsräte und Gewerkschaften Gewerkschaften im Umbruch - neue Anforderungen, neue AntwortenVon EverandBeratung anders.: Consulting für Betriebsräte und Gewerkschaften Gewerkschaften im Umbruch - neue Anforderungen, neue AntwortenNoch keine Bewertungen
- Verfahren Der Reihenfolgeplanung in Der Produktion - HausarbeitDokument34 SeitenVerfahren Der Reihenfolgeplanung in Der Produktion - HausarbeitChristo Pradewa Bornsel100% (2)
- Studienkolleg ZeugnissDokument8 SeitenStudienkolleg ZeugnissChristo Pradewa BornselNoch keine Bewertungen
- Private EquityDokument22 SeitenPrivate EquityChristo Pradewa BornselNoch keine Bewertungen
- LebenslaufDokument3 SeitenLebenslaufChristo Pradewa BornselNoch keine Bewertungen
- Lebenslauf by LinkDokument3 SeitenLebenslauf by LinkChristo Pradewa BornselNoch keine Bewertungen
- MotivationabchreibungDokument1 SeiteMotivationabchreibungChristo Pradewa BornselNoch keine Bewertungen
- Brasilien MorgenDokument17 SeitenBrasilien MorgenChristo Pradewa BornselNoch keine Bewertungen
- KeynesianismusDokument20 SeitenKeynesianismusChristo Pradewa BornselNoch keine Bewertungen
- Informatik HefterDokument43 SeitenInformatik HefterChristo Pradewa BornselNoch keine Bewertungen
- Nestle-Prasentation BWLDokument32 SeitenNestle-Prasentation BWLChristo Pradewa BornselNoch keine Bewertungen
- Nestl Script Beta VersionDokument21 SeitenNestl Script Beta VersionChristo Pradewa BornselNoch keine Bewertungen
- 04 Handout KennzahlenDokument14 Seiten04 Handout KennzahlenmoSphaereNoch keine Bewertungen
- BLP Zusammenfassung PDFDokument76 SeitenBLP Zusammenfassung PDFHansNoch keine Bewertungen
- TD Cas SoprosacDokument4 SeitenTD Cas SoprosacNdiogou GueneNoch keine Bewertungen
- Bundeskartellamt: Beschluss in Dem Verwaltungsverfahren Gegen Die Berliner WasserbetriebeDokument218 SeitenBundeskartellamt: Beschluss in Dem Verwaltungsverfahren Gegen Die Berliner WasserbetriebeBerlinerWassertisch0% (1)