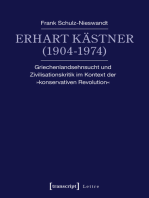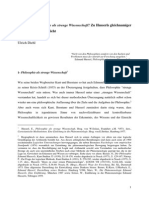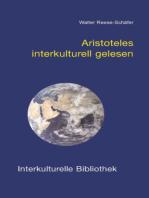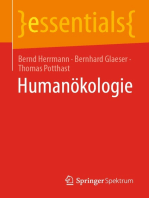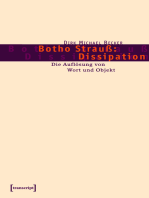Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Roman Dilcher - Über Das Verhältnis Von Lebenswelt Und Philosophie (Aufsatz)
Hochgeladen von
Choi PeterOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Roman Dilcher - Über Das Verhältnis Von Lebenswelt Und Philosophie (Aufsatz)
Hochgeladen von
Choi PeterCopyright:
Verfügbare Formate
Über das Verhältnis von Lebenswelt und Philosophie
Author(s): Roman Dilcher
Source: Zeitschrift für philosophische Forschung , Jul. - Sep., 2003, Bd. 57, H. 3 (Jul. -
Sep., 2003), pp. 373-390
Published by: Vittorio Klostermann GmbH
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/20485163
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
Vittorio Klostermann GmbH is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access
to Zeitschrift für philosophische Forschung
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Roman Dilcher, Heidelberg
Ober das Verhaltnis von Lebenswelt und Philosophie
Husserls Schrift uber die Krisis der europaischen Wissenschaften, in de
ren Zentrum die Problematik der Lebenswelt steht, verdient es, als eines
der Schliisseldokumente des 20. Jahrhunderts bezeichnet zu werden.
Dies nicht nur darum, weil der Begriff der Lebenswelt, obzwar nicht von
Husserl gepragt, doch durch dieses sein Alterswerk zu philosophischer
Bedeutsamkeit gekommen ist. Mehr noch, scheint er ilber seine mannig
fache Aufnahme und Weiterbildung hinaus eine jener gliicklichen Wen
dungen zu sein, die einer vielschichtigen philosophischen Problemlage
Kontur geben. Durch kaum einen anderen Begriffscheint die charakteri
stische Spannung, das Problemfeld, worin das Philosophieren des 20.
Jahrhunderts sich hielt, besser umrissen zu sein. Ob Heidegger und die
Hermeneutik, ob der spate Wittgenstein und die ordinary language phi
losophy - im Riickblick wird ihre Gemeinsamkeit deutlicher, in Ab
stogung von einem traditionellen wissenschaftlichen Selbstverstandnis
der Philosophie sich auf das zuzubewegen, was in dem Husserlschen Ter
minus ausgesprochen ist.
Die Thematik der Lebenswelt gewann auch Husserl aus der Absetzung
gegen die neuzeitlichen Wissenschaften und den in ihnen herrschenden
,,Objektivismus", die, seiner Diagnose nach, zu einer Verdeckung der Le
benswelt und damit zur europaischen Krisis fiihrten. Gleichwohl bedeu
tete dies fur ihn - in deutlichem Gegensatz zu den genannten spateren
Tendenzen der Philosophie - nicht den Abbruch eines auf strenge Wis
senschaftlichkeit verpflichteten Philosophierens. Er selbst betrachtete die
Krisisschrift vielmehr als eine ,,eigenstandige Einleitung in die transzen
dentale Phanomenologie".I So sehr sich die vielfaltigen Diskussionen im
Anschlug an den Husserlschen Lebensweltbegriff in die Breite ziehen,
wird das Programm einer transzendentalphilosophischen Grundlegung
von den wenigsten geteilt und verfallt im Gefolge eines metaphysikkriti
schen Zeitgeistes nahezu einhellig der Kritik. Als machtigster und gerade
1 So Husserls Vorbemerkung zur ersten Druckfassung (Die Krisis der europ?ischen Wis
senschaften und die transzendentale Ph?nomenologie, Husserliana VI, Den Haag 1954, S.
xiv).
Zeitschrift fur philosophische Forschung, Band 57 (2003), 3
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
374 Roman Dilcher
zu unerschopflicher Ansatzpunkt dieser Kritik erw
rufung auf die unverkiirzte vortheoretische Erfah
selbst, die - so der gemeinsame Tenor der Kritik - in d
zendental betriebenen Philosophie sich nicht wieder
die Vernunft als in stets vorausliegenden lebenswelt
gebettet verstanden, so scheint es aussichtslos, sie dies
ven Bedingtheiten wieder entwinden zu wollen. So
Husserl die lebensweltlichen Relativitaten, zu denen er
Riickfiihrung auf eine transzendentale Subjektivita
der entmachtet: im Griff der philosophisehen Refle
dergewonnene Konkretion und Anschaulichkeit eb
wie sie gewonnen war, desgleichen ihre Geschichtlich
Eindruck, dag Husserl zwar das Tor zur Wiedergew
messenen Verstandnisses der lebensweltlichen Vernu
doch vor den Konsequenzen einer durchgehenden V
Vernunft mitsamt der Aufgabe aller fundamentalen
schreckte.2
Die Zweifel an der Tragfahigkeit von Husserls Be
benswelt blieben freilich schal, waren sie nur von a
Nahrung gewinnen sie jedoch nicht zum geringste
keiten, die Husserls eigenen Ausfuhrungen uiber d
wohnen. Allzu viele disparate Bestimmungen sch
bracht, so dag es schwer fallt, dem Lebensweltbegri
Sinn abzugewinnen. In seinen Uneindeutigkeiten u
doxien scheinen sich just jene Probleme niedergesc
sich aus dem Vorhaben ergeben, die Lebenswelt zu
transzendentalen Phanomenologie zu machen.
Gewonnen wird der Begriff der Lebenswelt zuna
2 Ausf?hrlich hat diese Kritik v. a. Bernhard Waldenfels vorg
keit des Sinnes. Kritik an Husserls Idee der Grundlegung, in:
Lebenswelt, Frankfurt 1985,15-33; Die verachtete Doxa. Husse
Krisis der abendl?ndischen Vernunft, ebd. 34-55; Lebenswelt
und Unallt?glichem, in: Ph?nomenologie im Widerstreit. Zum
Husserls, hg. v. Chr. Jamme & O. P?ggeler, Frankfurt a. M. 1
auch R?diger Welter, Der Begriff der Lebenswelt. Theorien vo
welt, M?nchen 1986, 106-15; J?rgen Habermas, Edmund Hu
Philosophie und Wissenschaft, in: Texte und Kontexte, Frankfu
Vernunft und Lebenswelt, in: Praxis Vernunft Gemeinschaft
V. Caysa u. K.-D. Eichler), Weinheim 1994, 216-33; Hans-Helm
st?ndnis und Lebenswelt, Frankfurt a. M. 2001, ? 23.
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Uber das Verhdltnis von Lebenswelt und Philosophie 375
stellung zur Idee einer ,,an sich" wahren Welt, wie von den Wissenschaf
ten vorausgesetzt. ,,Lebenswelt" ist damit, aus diesem Kontrast heraus
sich bestimmend, die Bezeichnung fur den gesamten Bereich des Subjek
tiv-Relativen, eine umfassende Chiffre fur ,,diese wirklich anschauliche,
wirklich erfahrene und erfahrbare Welt, in der sich unser ganzes Leben
praktisch abspielt" (S. -i). Sie ist die ,,eine, allgemeinsame Erfahrungs
welt" (S. 128), ,,uns allen natuirlich" vorgegeben (S. I24), und darin ,,,die'
Welt, die allgemeinsame" (ib.). Derart ist sie ,,immer im voraus" (S. 1I2),
ein ,,Horizont von jeweils unzweifelhaft Seiend-Geltendem" (S. 113). Alle
Praxis (auch, wie sich zeigt, die wissenschaftliche) steht auf dem ,,Boden
dieser standig im voraus, aus dem vorwissenschaftlichen Leben her, sei
enden Welt" (ib.), die wir als ,,stets bereite Quelle von Selbstverstandlich
keiten ... ohne weiteres in Anspruch nehmen" (S. I24).
Husserls Versuch, dieses ,,Reich urspruinglicher Evidenzen" (S. 130) des
Naheren zu erfassen, ist nun von einer durchg'angigen Zweideutigkeit ge
kennzeichnet. Zunachst ist sie bestimmt als ,,die raumzeitliche Welt der
Dinge, so wie wir sie in unserem vor- und augerwissenschaftlichen Le
ben erfahren" (S. 141, ahnlich S. I62). Freilich sind diese ,,,Dinge' der Le
benswelt" in einem weiten Sinne aufzufassen, sie umfassen nicht nur die
,,realen Korper", sondern ebenso die ,,realen Tiere, Pflanzen und auch
Menschen" (S. 133). Und doch ist auch diese Bestimmung noch zu kurz,
da die ,,konkrete Einheit der Lebenswelt ... weiter reicht als die der ,Din
ge"' (S. I33). Auch ,,menschliche Gebilde" fallen darunter (S. I41), somit
miissen auch wissenschaftliche ,,Theorien", als ,,logische Gebilde"
(S. I32), in die Lebenswelt mit hineingenommen werden, ja allgemein al
le ,,Kulturleistungen" (S. Iii). Allein in diesem umfassenden Sinn ist die
,,Erfahrungswelt" ein ,,standiger Horizont seiender Dinge, Werte, prakti
scher Vorhaben, Werke usw." (S. 121).
Die Absetzung von einer objektiv-wissenschaftlichen Weltbestim
mung ftihrt damit auf die jeweilige kulturell gedeutete Welt, worin jedes
konkrete Erfahren statt hat. Husserl lagt keinen Zweifel daran, daB die
vermeintlich gleichen Dinge nur in kultureller Interpretation, also je
nach Kulturkreis differierend, erfahren werden. Die Subjekt-Relativitat
dieser Lebenswelten ware demnach in Hinsicht auf die verschiedenen hi
storischen Kulturen und ihr Weltverstandnis zu verstehen. Doch wird
diese Argumentationstendenz bestandig durch eine anderslaufende
durchkreuzt. In Absetzung gegen die mathematische Idealisierung der
Wissenschaften betont Husserl ebenso nachdrucklich die anschauliche
Gegebenheit der Lebenswelt. Von daher scheint die Lebenswelt gerade
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
376 Roman Dilcher
zu, entgegen aller historischen Variabilitat, zum In
chen raumzeitlichen Dinge zu werden. lhre Subjekt
vorwiegend in der Leibgebundenheit und Perspek
mung.
Der fur die Erfassung der Lebenswelt leitende Begriff des Subjektiv
Relativen schlagt so schon im Ansatz nach zwei Richtungen aus, die eine
grundlegende Unklarkeit im Begriff der Lebenswelt nach sich zieht: Le
benswelt ist einmal Kulturwelt, dann aber doch wieder schlichte An
schauung von Naturdingen.3 Die vielfaltigen Beschreibungen, die Hus
serl im langsam sich dahinschleppenden Gang der Krisisschrift gibt,
bieten keinen eindeutigen Anhalt zu einer Klarung. Dies kann nicht nur
dem Umstand zugeschrieben werden, daB eine letzte glattende Uberar
beitung nicht mehr erfolgt ist. Auch wenn man sich in den umfangrei
chen Nachlag-Manuskripten umtut, steht man vor der gleichen verwir
renden Fiille an Charakterisierungen, die sich nicht recht einem
einheitlichen Verstandnis fuigen wollen. Das Dilemma ist ein grundsatz
liches. Wird die konkrete Kulturwelt als das jeweils Erste gesetzt, so kann
sie nicht mehr den Boden fur eine universale Bestimmung abgeben,
wenn denn alle theoretische Betatigung an sie und ihre Selbstverstand
lichkeiten zuruckgebunden ist. Mit einem Wort: ,,Sofern die Lebenswelt
konkret-geschichtlich ist, ist sie kein universales Fundament, und inso
fern sie ein solches ist, ist sie nicht konkret-geschichtlich."4
Die innere Spannung dieser Problematik hat im Fortgang der Husserl
schen UYberlegungen ihre Spuren deutlich hinterlassen; unmittelbar er
sichtlich wird sie in dem umstandlichen Versuch (im ? 36), die rechte
Weise einer wissenschaftlichen Thematisierung der Lebenswelt zu si
chern. Ausgeschieden ist von Anbeginn ein wissenschaftlicher Zugriff im
Sinne des Objektivismus. Halt man sich nun an ,,die raumzeitliche Welt
der Dinge, so wie wir sie in unserem vor- und augerwissenschaftlichen
Leben erfahren", so mag dies zu gewissen Wahrheiten fuhren; ,,aber alles
3 Insbesondere David Carr hat diese ?discrepancy between life-world as cultural world
and life-world as world of immediare experience" herausgearbeitet: ?Husserl has as
sembled under one title a number of disparate and in some sense even incompatible
concepts" (Husserls Problematic Concept of the Life-world, American Philosophical
Quarterly y, 1970, 331-39, hier S. 337 und 332). Eine eingehende kritische Bestandsauf
nahme der mannigfachen Aspekte des Begriffs bietet, mit ?hnlichem Ergebnis, R.
Welter, op. cit. S. 77-106.
4 So pr?gnant Waidenfels, Lebenswelt zwischen Allt?glichem und Unallt?glichem,
S. 114.
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Uber das Verhdltnis von Lebenswelt und Philosophie 377
ist da subjektiv-relativ" (S. 141). Die Relativitat dieser schlichten lebens
weltlichen Erfahrung ist eine intersubjektiv-kulturelle: ,,Wenn wir in ei
nen fremden Verkehrskreis verschlagen werden, zu den Negern am Kon
go, zu chinesischen Bauern usw., dann stogen wir darauf, dag3 ihre
Wahrheiten, die fur sie feststehenden allgemein bewahrten und zu be
wahrenden Tatsachen, keineswegs die unseren sind" (ib.). Husserl er
kennt hier mithin die kulturelle Relativitat aller alltaglichen Erfahrung
ohne Abstriche an. Ausdriicklich wird verworfen, eine ,,fur alle Subjekte
unbedingt gultige Wahrheit iiber die Objekte" dadurch zu gewinnen,
dag3 man von dem ausgeht, ,,worin normale Europaer, normale Hindus,
Chinesen usw. bei aller Relativitat doch zusammenstimmen" (S. I42). Ei
ne soiche kulturinvariante Bestimmung wiirde das Eigene und Subjekt
Relative der jeweiligen Lebenswelten aufheben und also den Weg der ob
jektiven Wissenschaften gehen.
Die lebensweltliche Ontologie, die Husserl daraufflin in einem ersten
Umrig3 entwirft, scheint jedoch wieder in die entgegengesetzte Richtung
zu laufen. Husserl beharrt darauf, dag ,,doch diese Lebenswelt in allen
ihren Relativitaten ihre allgemeine Struktur hat. Diese allgemeine Struk
tur, an die alles relativ Seiende gebunden ist, ist nicht selbst relativ"
(S. I42). Anstatt die unterschiedlichen historischen Horizonte, aus denen
sich die zugestandenermagen relativen Wahrheiten der Kulturkreise spei
sen, in den Blick zu nehmen, verankert Husserl diese allgemeine Struk
tur nun doch wieder in der anschaulichen Dingwelt. Das lebensweltliche
Apriori wird ausdriicklich von der Weltgliederung der neuzeitlichen Wis
senschaften abgeleitet, durch ,,prinzipielle Abscheidung" von den ,,theo
retischen Idealisierungen und hypothetischen Substruktionen" der Na
turwissenschaftler (S. 143). So bleibt als Grundstruktur der Lebenswelt
die raumzeitliche Welt mit ihren K6rpern und ihrer Kausalitat, freilich
allesamt nicht im Sinne wissenschaftlicher Idealisierung, sondern in an
schaulicher Erfahrbarkeit.
Husserls Vorgehen mag verstandlich sein, insoweit es ihm zunachst,
ausgehend von der Kritik am Ideal der objektiven Wissenschaften, um
ihre ,,Riickbezogenheit" auf das lebensweltliche Apriori geht (ib.). Die
Aufwertung der Lebenswelt geschieht ja durch den Aufweis, dag3 die Wis
senschaften in nicht nur beilaufiger Weise auf die Lebenswelt angewiesen
sind, sondern in dem starken Sinne einer ,,Geltungsfundierung" (ib.). Je
doch wird die Lebenswelt auf diese Weise nur als Voraussetzung fur die
objektiv-wissenschaftliche Bestimmung erfaglt. Mag damit zwar erklar
lich werden, ,,wie die Lebenswelt bestandig als Untergrund fungiert ... fur
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
378 Roman Dilcher
die theoretischen Wahrheiten" (S. I27), SO ist sie doc
einem ihr fremden Standpunkt in den Blick genom
beantwortet bleibt damit die ausdriicklich gestellte
genen und standigen Seinssinn dieser Lebenswelt fu
Menschen", von der Husserl selbst sagt, sie lIge ,,vor
ge ihrer Funktion fur eine evidente Begriindung d
schaften" (S. I25). Damit erhartet sich der Zweifel, o
zuruck zur Lebenswelt auf die rechte Weise gelung
von allen Geltungen der objektiven Wissenschaften
winnung eines angemessenen Blickes fordert, sche
vollkommen vollzogen zu haben. Als ein unverande
wird, aller geschichtlichen Horizontalitat entgegen,
schicht ausgezeichnet, die in schlichter Anschaulich
Diese Anschauung ist freilich nicht die der konkreten
schon kulturell gebildet ist. Es kann sich also nur u
keit handeln, die durch philosophische Analyse gew
selbst spricht diesbeziiglich von einem ,,abstrakt he
Weltkern" (S. I36). Die hoherstufigen kulturellen Ko
waren damit nur eine nachfolgende Hiille um diesen
jedoch ,,ein kiinstliches Praparat den Erfahrungen"
,,urspriingliche, grundlegende Erfahrung" ware a
Konstrukt darstellt, namlich das Produkt einer abst
Die drohende Relativierung, die jeden wissenschaftl
ne apriorischer Allgemeingiiltigkeit untergrabt, wi
durch eine Bestimmung der Lebenswelt umgangen,
schichtlichen Perspektivitat des mannigfachen lebensw
absieht.
Der grundlegende Einwand gegen diese Analyse war erstmals von Hei
degger geiutRert und ausgefuihrt worden: Lebensweltlich erfahren ist
zunachst nicht nur ein anschauliches Naturding, dem dann Kulturbe
deutungen und Wertpradikate ubergeworfen werden. Im lebensweltli
chen Umgang begegnen die Dinge vielmehr zunachst in einer prakti
schen Bedeutsamkeit, die erst durch theoretische Abblendung zu einem
nur noch Vorhandenen nivelliert wird. Der niemals bezweifelte Vorrang,
den die Anschauung und damit die wahrnehmbaren Dinge bei Husserl
geniegen, gehe am eigentlichen Phanomen der Lebenswelt vorbei.
5 Waldenfels, loe. cit.; Die Abgr?ndigkeit des Sinnes, S. 19. ?hnlich Welter, op. cit.
S. 95; Gander, op. cit. S. 147 ff.
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Uber das VerhlItnis von Lebenswelt undPhilosophie 379
So berechtigt diese Einwande sind und bleiben, ist jedoch die Frage,
ob Husserls Vorgehen dadurch ernsthaft getroffen wird. Die phanome
nologische Konstitutionsanalyse hat ja offensichtlich nicht zur Aufgabe,
das natuirliche Weltleben so zu beschreiben, wie es fur es selbst ist. Sie soll
es vielmehr philosophisch durchsichtig machen, setzt also in jedem Fall
eine Distanz zu ihm voraus. Erst die philosophische Reflexion vermag
enthiillen, dag die schlichte Welthabe einer komplexen subjektiven Lei
stung entstammt, die zerlegt werden mug, um sie zur Verstandlichkeit zu
bringen. Die Differenz zwischen philosophischer Reflexion und dem von
ihr Thematisierten gehort zu den methodischen Grundeinsichten der
Phanomenologie: ,,Das die Weltgeltung des natiirlichen Weltlebens lei
stende Leben lagt sich nicht in der Einstellung des naturlichen Weltle
bens studieren" (S. I51). Durch einen bewugt vollzogenen Einstellungs
wechsel versucht die Phanomenologie, ein ,,Universum des Subjektiven"
zu erschliegen, ,,worin die Welt vermoge seiner Universalitat synthetisch
verbundener Leistungen zu ihrem schlichten Dasein fur uns kommt"
(S. I49). Es ist daher von vornherein abwegig, die Konkretion lebenswelt
lichen Erfahrens gegen eine Analyse auszuspielen, die methodisch darauf
reflektiert, wie eben diese Konkretion verstandlich zu machen ist.
Husserls Ausfuhrungen uber die Lebenswelt mussen also unverstand
lich bleiben, wenn nicht beriicksichtigt wird, dag diese stets schon vom
Standpunkt des Philosophen aus gefuhrt sind, und d. h. in der Distanz
der Reflexion. Der scheinbare Gegensatz zwischen Natur- und Kulturbe
stimmtheit der Lebenswelt lost sich denn auch kurzerhand auf, sobald
man, wie es fur Husserl selbstverstandlich ist, auf die ,,Subjektivitat als
Urstatte aller objektiven Sinnbildungen und Seinsgeltungen zuruckgeht
und es unternimmt, die seiende Welt als Sinn- und Geltungsgebilde zu
verstehen" (S. I02). Beide konnen so gleichermagen als Konstitutionslei
stungen der einen universalen Subjektivitat aufgefagt werden. Zugleich
ist damit auch offenkundig, dag im Rekurs auf raumzeitliche Kdrper und
anschauliche Dinge nicht die entscheidende Bestimmung der Lebens
weltthematik liegen kann. Die universale Bodenfunktion der Lebenswelt
ist nicht mit jenem wahrnehmungsmadigen ,,Kern" zu verwechseln. Die
Meinung, Husserl habe das Wahrnehmen in diesem konstitutionstheoreti
schen Sinne mit der ,,konkreten" Erfahrung gleichgesetzt, beruht ihrerseits
auf einer kiinstlichen Verzerrung des phanomenologischen Vorgehens. Ob
Husserl recht darin tat, eine unterste Naturschicht anzunehmen, ist mit
hin von untergeordneter Bedeutung.
Vorausgesetzt ist damit freilich jener Schritt, dessen Moglichkeit und
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
380 Roman Dilcher
Sinnhaftigkeit die Kritiker bestreiten: namlich d
zendentalen Subjektivitat mittels der transze
scheidend ist nun, diese Entdeckung des ,,un
bens" (S. I48) nicht nur als Absprung in eine tr
verstehen, in der die Lebenswelt schon unwieder
ware. Husserls ganzes Bemiihen geht vielmehr d
der eigentumlichen Problematik der Lebenswelt
Zu diesem Zweck stellt Husserl an zentraler Stel
meine Betrachtung" an, um ,,einen wesentlichen
chen Weisen evident zu machen, in welchen fu
Welt, das ontische Universum, zum Thema
Zunachst zieht Husserl den traditionellen Weltb
ist das All der Dinge, ... der raumzeitlichen ,On
nis der Welt wird die Aufgabe der Ontologie d
deren Umrig Husserl davor entworfen hat. Die
tik" ist jedoch untergeordnet gegeniiber einer ,,seh
be", von der sie ,,mitumspannt" wird (ib.). Wird
mer schon da, im voraus fur uns seiend" ver
Universalfeld aller wirklichen und moglichen Pr
geben". Gegenuber der Orientierung an den Ob
dieser Horizont als das Umfassende und Univer
den allein bewuf3t ,,als Objekte im Welthorizont
aus' der Welt, der uns standig als Horizont bewu
sich ein Unterschied der Seinsweise von Horizon
,,nicht seiend wie ein Seiendes, wie ein Objekt,
Einzigkeit, fur die der Plural sinnlos ist. Jeder
ausgehobene Singular setzt den Welthorizont v
der Seinsweise eines Objektes in der Welt und d
offenbar beiden die grundverschiedenen korrela
sen vor" (ib.).
Es ist diese Unterscheidung, auf der Husserls weiteres Vorgehen fugt.
Der Horizontbegriff lenkt den Blick von der naiven Geradehinstellung
auf die Objekte zu den subjektiven Erscheinungsweisen, dem Wie der
Gegebenheit von Dingen. In den nachfolgenden Paragraphen versucht
Husserl auf diese Weise, eine ,,die Normalitat des Dahinlebens durchbre
chende Wandlung des thematischen BewuBtseins von der Welt" (S. I47)
begreiflich zu machen und durchzufiihren. Die Blickwendung auf den
universalen Welthorizont macht ,,eine totale Anderung der natuirlichen
Einstellung" (S. I5i) erforderlich, um durch die Oberfiihrung der vorge
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Uber das Verhdltnis von Lebenswelt und Philosophie 38I
gebenen Welt der Dinge in ein Bewugtseinsphanomen eben dieses ihr
standiges Vorgegebensein zum Thema zu machen.
Die Unterscheidung der Seinsweise von Objekt und Horizont, die im
? 37 getroffen wird, erweist sich somit als der eigentliche Schlussel fur die
Gedankenlinie der Krisisschrift.6 Der Horizontbegriff soll den nachvoll
ziehbaren Ubergang zur eigentlich philosophischen Einstellung ermogli
chen. Dieser Einstellungswechsel ist nicht ein Wechsel des Themas, son
dern der Weise der Thematisierung ein und desgleichen. Im Ubergang
vom dingorientierten zum Horizontbegriff der Welt mug3 folglich die L6
sung fur die Frage gesucht werden, warum Husserl sich berechtigt glaubte,
trotz aller betonten Relativitat der Lebenswelt ein auf strenge Universalitat
verpflichtetes Philosophieren nicht aufgeben zu mussen. Mit dem Aus
schlufg einer Pluralitat von Welthorizonten durch die Setzung der singula
ren Einzigartigkeit von ,,Welt" weist Husserl implicite auch die relativisti
sche Gegenposition zuriick, die die Vielzahl von konkreten Lebenswelten
in ihrerseits beweglichen historischen Sinn- und Deutungshorizonten ver
ankert. Das Problem der historischen Variabilitat und Pluralitat der Le
benswelten fallt so gewissermaien zwischen Husserls zweierlei Weltbegrif
fen hindurch, und wird in der Folge nicht mehr verhandelt. Die sachlichen
Grunde dafiir miissen also in einer Erhellung der beiden Weisen der The
matisierung von Welt, in ihrem Unterschied wie ihrem Aufeinanderbezo
gensein, gesucht werden.
Der objektorientierte Weltbegriff wird ausdriicklich als der zunachst
naheliegende eingefiihrt, er ergibt sich, wenn ,,wir uns unwillkuirlich an
das halten, was fur uns im Leben allein den Sinn der Rede von Welt be
6 Zur Unterscheidung zwischen dem traditionellen Weltbegriff als All der Dinge (om
nitudo realitatis) bzw. Inbegriff all dessen, was ist, und dem transzendentalen Hori
zontbegriff vgl. v.a. Ulrich Claesges, Zweideutigkeiten in Husserls Lebensweltbegriff,
in: Perspektiven transzendentalph?nomenologischer Forschung (FS Ludwig Landgrebe),
hg. v. U. Claesges & Klaus Held (Phaenomenologica 47), Den Haag 1972, 85-101.
Auch Claesges vers?umt es jedoch, die Verh?ltnisbestimmung des ? 37 zur Aufl?sung
der von ihm herausgestellten Zweideutigkeiten zu nutzen; es ist nicht recht ersicht
lich, mit welchem Recht er den ?weitesten LebensweltbegrifF wieder zum Inbegriff
des Alls der Dinge werden l??t (S. 96 f). Freilich ist Husserl der Vorwurf nicht zu er
sparen, der Verwirrung Vorschub geleistet zu haben. Im Gang seiner ?berlegungen
durchkreuzen sich die beiden Weltbegriffe vielmals, oft tauchen sie sogar in einem un
verbundenen Nebeneinander auf: ?... Welt als universaler Horizont, als einheitliches
Universum der seienden Objekte" (S. 110, ?hnlich S. 141). Zu den mannigfachen Be
deutungen des Weltbegriffs s. a. Stephan Strasser, Der Begriff der Welt in der ph?no
menologischen Philosophie, in: Ph?nomenologie und Praxis (Ph?nomenologische For
schungen 3), hg. v. E. W Orth, Freiburg/M?nchen 1976,151-79.
This content downloaded from
1f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff on Thu, 01 Jan 1976 12:34:56 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
382 Roman Dilcher
stimmt" (S. 145). Die Gesamtheit der Dinge ist s
standnis, das fur die lebensweltliche Einstellun
stisch, sondern das allein verstdndliche ist. Dies
mafBen auch vom Horizontbegriff gelten. Sind
mannigfachen subjektiven Leistungen begriffe
von Objekten vorhergehen und insofern ihr Ers
ist der Horizontbegriffals Reflexionsbegriffzu f
weiten Sinne einer Riickbeugung des Subjektes
keiten. Der subjektive Horizont, ,aus" dem die
sichtbar, sobald von dem naiven Gegebensein de
vorausgesetzten Leistungen zuruickgefragt wird.
Die Horizontgebundenheit der Objekthabe wir
an der sinnlichen Wahrnehmung erlautert.7 Wa
mung das Objekt sich selbst als es selbst zu geb
die Reflexion auf seine Gegebenheitsweisen. Zu
subjektiven Leistungen bereits das schlichte Er
bedarf. Das Ding gibt sich der Wahrnehmung st
ten, in einer Ansicht und in perspektivischer N
es doch in allen seinen sich wandelnden Erschein
als es selbst gemeint und ,,wahrgenommen" ist
mithin nur in Perspektivierung auf ein Subjek
wenn auch unbemerkt, berucksichtigt, um dur
jekt zu gewahren. Schon die schlichte Wahrneh
weist damit auf die komplexe subjektive Leistun
uns zum selbigen Ding werden kann. So erschlie
schen Blick ein Hintergrund mannigfacher Vore
nahmen, aus dem heraus die Welt erfahrbar w
tergruindiger Leistungen ist im naiven Dahinleb
nur als hintergruindiger kann er fur die verme
jekthabe aufkommen.
Dennoch ist der natiirlichen Einstellung der Bl
jektiven Voraussetzungen nicht vollstandig ver
tatigen Verschossensein in die Objekte die Riick
ferner liegt, so ist es doch nicht erst die philosoph
Subjektive in Anschlag bringt. Im Gegenteil, da
tiven Gegebenheit der ,,Welt" ist bereits im all
und in allem weltlichen Zu-tun-Haben gegenwar
7 So auch in der Krisis-Schrift, ? 28 und ? 45 ff.
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Uber das Verhaltnis von Lebenswelt und Philosophie 383
Dies wird bereits in der ersten Charakterisierung der Lebenswelt in der
Krisis-Schrift deutlich, die Husserl auf folgende Weise vornimmt: ,,Die
Welt ist vorwissenschaftlich in der alltaglichen sinnlichen Erfahrung sub
jektiv-relativ gegeben. Jeder von uns hat seine Erscheinungen, und jedem
gelten sie als das wirklich Seiende. Dieser Diskrepanz unserer Seinsgel
tungen sind wir im Verkehr miteinander langst innegeworden. Wir mei
nen aber darum nicht, es seien viele Welten. Notwendig glauben wir an
die Welt mit denselben, uns nur verschieden erscheinenden Dingen"
(S. 20). Die lebensweltliche Einstellung lebt also geradezu in und aus der
Unterscheidung von subjektiver Erscheinung und der zugrundeliegen
den einheitlichen Welt der Dinge. Im normalen Verlauf des Weltlebens
bleibt diese Differenz unauffaillig, solange im subjektiven Erscheinen die
Dinge so, wie sie ,,sind" (d. h. lebensweltlich vermeint werden), erschei
nen. Allein die Erfahrung der Diskrepanz, sei es zu der Ansicht anderer,
sei es zu anderslautenden eigenen Erfahrungen, fiihrt dazu, die subjekti
ven Gegebenheiten in Anschlag zu bringen. Im Fall der Uneinstimmig
keit ist das zunachst unthematische Bewugtsein der subjektiven Erschei
nungshaftigkeit jederzeit aktualisierbar, und zwar zugunsten der
Angleichung an das vom Subjekt unabh'angige So-Sein der Dinge.
,,Wahrheit und Falschheit, Kritik und kritische Adaquation an evidente
Gegebenheiten sind alltagliches Thema, schon im vorwissenschaftlichen
Leben ihre bestandige Rolle spielend".8 Die Aufmerksamkeit auf das
Subjektive ist in dem MaBe bedeutsam, als Tauschung und Irrtum eine
standige und standig zu gewartigende Moglichkeit sind.
Lebensweltlich erfaihrt das Subjekt sich selbst also vornehmlich im
Blick auf eine vorgegebene Wirklichkeit als dasjenige, das fur ein Abwei
chen von ihr verantwortlich ist. Gegeniiber dem Objektiven hat Subjek
tivitat zunachst fur es die Bedeutung des ,,nur" Subjektiven, also des An
genommenen, Ungesicherten, bloB Vermuteten, wenn nicht gar
Unwirklichen und Phantastischen. In der alltaglichen Rede ist diese Be
deutung des ,,Subjektiven" die vorherrschende. Die eigene Tatigkeit, et
wa im Zweifel, der Uberlegung, Priufung und Bewahrung der eigenen
Ansichten, versteht die natiirliche Einstellung darum als subjektive
Bemuhung der Annaherung an das an sich Nicht-Subjektive. Die eigene
Leistung ist ihr daher nur als Entsubjektivierung verstandlich, als eine
Zurucknahme des Subjektiven zugunsten der Objektivitat der Weltwirk
lichkeit.
8 CartesianischeMeditationen, Husserliana I(Den Haag 1950), S. 13.
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
384 Roman Dilcher
Der lebensweltlichen Einstellung ist also das Bew
subjektiven Leistungen keineswegs fremd,9 doch vers
in einem Gegenuberstehen zur Welt der Dinge. In
ten bleibt es auf diese auger ihm liegende Wirklich
alles in irgendwelchen Seinsmodalitaten Charakteri
wirkliches Sein bezogen ist. Welt hat ja vorweg den
lich' seienden, der nicht blog vermeinten, zweife
Wirklichkeiten, sondern der wirklichen Wirklichk
Daraus folgt nun, daf3 die Welt dem lebensweltlic
und nimmer a/ Horizontbewuf3t sein kann.lO Sie
stets das All der Dinge, unter denen sich auch die
ihren Erwartungs- und Deutungshorizonten befin
menologisch erforschbaren subjektiven Vorleis
zontbegriff zusammengefagt sind, konnen aus de
lung heraus, sollten sie ihr philosophischerseits na
doch nur in Gegeniiberstellung zum Objektiven
Wird im naturlichen Verstandnis die Perspektivit
bemerklich, so kann dies darum allenfalls als Hor
9 Daher scheint es mir den Ansatz der Husserlschen Ph?nom
wenn man das nat?rliche Leben durch eine generelle Subjekt
siert, wodurch dann die M?glichkeit, diese aufzuheben, zu
wird, - so ausf?hrlich Klaus Held, Husserls neue Einf?hrung
Begriff der Lebenswelt, in: Lebenswelt und Wissenschaft. St
Ph?nomenologie und Wissenschaftstheorie, hg. v. C. F. Gethm
Nur die transzendentale Subjektivit?t ist der lebensweltlich
lich nicht fa?bar, und der Weg zu ihrer Entdeckung f?hrt n
mung des Staunens, die Held hier anf?hrt, als vielmehr durc
triebenen philosophischen Zweifel.
10 Husserl verwischt freilich diesen entscheidenden Unterschied
die Welt als ?uns st?ndig als Horizont bewu?te"; S. 149: ?im
sich darin wissend"; und dergleichen mehr). Dies ist wohl de
in Husserl-treuen Interpretationen der Sachverhalt geradez
wird. So meint Landgrebe etwa, die Welt als Inbegriff des S
losophischer Abstraktion". ?Das nat?rliche Weltverst?ndnis
griff, der aus philosophischer Reflexion stammt, wird dami
Verst?ndnis hineinprojiziert" (S. 32). Dem setzt er gegen?ber
sere Welt urspr?nglich haben, n?mlich als Horizont" (S.
schichtlichkeit des menschlichen Daseins, in: Ph?nomenologi
hg. v. B. Waidenfels u. a., Frankfurt 1977,13-58). Eine ?hnlich
auch bei Held, op. cit. - Ein geeignetes Antidot gegen die Se
neuzeitlichen subjektivierten Weltbegriffes bietet Karl L?wit
zeitlichen Philosophie, Heidelberg i960.
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Uber das Verhaltnis von Lebenswelt und Philosophie 385
Welt begriffen werden: ein ausschnitthaftes und begrenztes Sich-Zeigen
der Welt, fur das die Situierung des Subjekts an einem bestimmten Ort
in der Welt mitverantwortlich ist. Das natuirliche Verstandnis des Hori
zontbegriffes halt sich also im urspriinglichen Bereich der Metapher
vom Gesichtskreis: Die Dinge erscheinen ihm nicht aus, sondern in ei
nem Horizont.
Es ist dies der Punkt, an dem die lebensweltliche und die transzenden
tale Einstellung sich scheiden. Welt als Horizont zu verstehen, besagt, sie
als abhangig von dem in ihm lebenden Subjekt aufzufassen. Indem die
Phanomenologie die Erforschung der subjektiven Leistungen in die Tiefe
treibt, ergibt sich eine Neubestimmung des Verhaltnisses von Subjekti
vem und Objektivem. So verschiebt sich der Sinn dessen, was als das ge
geniiberstehende Nicht-Subjektive gilt, in den Bereich der Subjektivitat
selbst. Das Objektive kann nun nicht mehr naiv als au3erhalb der Sub
jektivitat liegend vermeint werden, sondern wird zum konstituierten Pol
innerhalb ihrer. Welt und welterfahrendes Subjekt werden in der trans
zendentalen Einstellung nicht mehr, wie stets und notwendig in diesem
Erfahren selbst, als selbstandig einander gegenuiberliegend betrachtet,
sondern in einer wesensmiRigen Aufeinanderbezogenheit, dem ,,univer
salen Korrelationsapriori von Erfahrungsgegenstand und Gegebenheits
weisen" (S. I69). Der gesamte Bestand des Objektiven mug3 so als Korre
lat des Bewug3tseins aufgefag3t werden, indem die Vorstellung eines
bewugtseinstranszendenten Alls der Dinge auger Kraft gesetzt wird. Erst
dieser Schritt erlaubt es, den Horizont subjektiver Leistungen im vollen
Sinne als Welthorizont zu verstehen.
Durch diese transzendentale Epoche erschlieg't sich so ein ,,Universum
des rein Subjektiven" (S. ISO), worin ,,Welt" als konstituierte Leistung
verstandlich werden soll. Die Subjektivierung, die in der Rede von der
Welt als Horizont liegt, ist nur sinnvoll, wenn sie konsequent durchge
fuhrt wird, und d. h. wenn nicht noch ein ganzlich unerfahrbares Sub
strat der Dinge jenseits des Welthorizontes angenommen wird. Die trans
zendentale Epoche hat somit auch die Funktion, den Widersinn eines
solchen dem subjektiven Erfahren grundsatzlich entzogenen Dinges an
sich auszuschalten. Die erfahrungsgemifge Gegeniuberstellung von ,,sei
ender Welt" einerseits und ,,menschlicher Weltvorstellung" andererseits
(S. I82) wird durch diese methodische Einsicht auf der Ebene der philo
sophischen Reflexion aufgehoben.
Wird ,,Welt" nun nicht mehr in den subjektunabhaingigen Gesamtbe
stand der Dinge gesetzt, so fallt auch die im Weltbegriff gedachte Tota
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
386 Roman Dilcher
litat und Einheitlichkeit in das Bewug3tsein. Sie ist nun a
re Leistung des Subjektes zu verstehen, die im Wortsinn gru
insofern sie den universalen Boden fur alle Bezugnahme
Objekte abgibt. Der so verstandene Welthorizont ist der b
tergrund der Einheitlichkeit und Einstimmigkeit in all
Dingerleben. ,,Vermoge dieser standig strbmenden Horiz
setzt jede im natiirlichen Weltleben schlicht vollzogene G
schon Geltungen voraus, ... zuriickreichend in den einen
Untergrund, ... alle miteinander ... einen einzigen untren
zusammenhang ausmachend" (S. 152). Der Welthorizont ve
,,unverbriichliche Einheit des Sinn- und Geltungszusamm
durch alle geistigen Leistungen hindurchgeht" (S. II5). Ge
relation von Welt selbst und Weltbewugtsein" (S. I54) erg
eine besondere den Welthorizont leistende Bewug3tseins
einheit der letztlich fungierend-leistenden Subjektivitat,
der Welt - der Welt fur uns, als unseres naturlichen Leb
aufzukommen hat" (S. I49).
Gelangt man also zur ,,absoluten Korrelation von Seiend
und jeden Sinnes einerseits und absoluter Subjektivitat a
(S. I54), So versteht sich, dag3 diese Subjektivitat nicht m
che sein kann. Damit steht die philosophische Einstellung
Tendenz des naturlichen Lebens, Welt immer als aul3erhal
meinen, doch bewahrt sie gerade darin deren Glauben, i
Erfahren Wirklichkeit zu erfahren, und nicht nur eine s
struktion von Welt. In diesem Sinne kann Husserl sagen
starkeren Realismus als den der transzendentalen Phanom
gebe (S. I90).
Im Verstandnis der Welt als des Alles der Dinge liegt als
die grundlegende Voraussetzung des lebensweltlichen
selbstverstandliche Evidenz des Daseins der Welt, in der
Einstellung lebt, erweist sich als der unverruckbare Bode
hin Invariante innerhalb des Stromens der Relativitaten
dingte Weltglaube zeigt sich als solcher freilich erst dem
Standpunkt, der in universalem Zweifel sich daran mach
verstandlichkeit auger Kraft zu setzen. Die Rede vom Al
darum auch nicht geradewegs als Selbstaussage des natur
seins aufzufassen. Sie ist die Selbstauslegung, zu der es gr
muigte es uber seine Selbstverstandlichkeiten Auskunft g
ware es unsinnig, diese Formel historisch zu verorten un
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Uber das Verhdltnis von Lebenswelt undPhilosophie 387
derslautende Weltauslegungen, etwa die des Mythos, zu relativieren.1I
Ebenso fehlgehend ware die Behauptung, die Dinge oder das Seiende
wurden in ihrer Gesamtheit ausdrucklich erst durch Wissenschaft und
Philosophie thematisiert. Dinge sind hier im weitesten Sinne als das
Nicht-Subjektive zu verstehen, als das gegeniuber allen Meinungen, Auf
fassungen und Vermutungen Wirkliche. Zu Worte kommen soll in dieser
Formel mithin allein, dies jedoch pragnant, die Tendenz der lebensweltli
chen Einstellung, alles irgend Begegnende als Teil einer einheitlichen
Wirklichkeit zu verstehen, die an sich besteht. Die leitenden Begriffe von
Subjektivitat und Objektivitat beschreiben mithin die Grundkonstellation
menschlichen Erfahrens, nicht aber notwendig das in diesem Erfahren
selbst lebendige Verstandnis: seine prekare, durch Tauschungsanfalligkeit
gekennzeichnete Weltangewiesenheit. 12
Wenn Husserl nicht zogert, seine Grundbegriffe wie Subjekt, Objekt
usf. der philosophischen Tradition zu entnehmen, so liegt dies nicht an
mangelnder Einsicht in deren kulturspezifische Pragung. Es handelt sich
auch nicht um eine undurchschaute Ubernahme aus der wissenschaftli
chen Weltauslegung. Vielmehr ist es die Pointe seiner Diagnose der eu
ropaischen Krisis, dag der neuzeitliche Objektivismus nur aus einer Ver
langerung der vorwissenschaftlichen Praxis verstandlich zu machen ist:
,,Die objektive Wahrheit gehort ausschlieglich in die Einstellung des
natiirlich-menschlichen Weltlebens. Sie erwachst urspriinglich aus dem
Bediirfnis der menschlichen Praxis, als Absicht, das schlicht als seiend
Gegebene ... gegen die moglichen Modalisierungen der Gewigheit zu si
chern" (S. I79). Der Schritt zur Mathematisierung der Natur, wie Hus
serl ihn paradigmatisch bei Galilei vorfiihrt (? 9), setzt nur fort, was
schon im lebensweltlichen Zutunhaben liegt, dies freilich auf eine Weise,
die jedes anschauliche Erfahren hinter sich laBt. Wissenschaft und alltag
licher Praxis ist es mithin gemein, in der Invarianz gegeniiber der ,,Rela
1 ! So etwa Christoph Jamme, ?berrationalismus gegen Irrationalismus, in: Ph?nomeno
logie im Widerstreit, 65-80; David Carr, The Lifeworld Revisited: Husserl and Some
Recent Interpreters, in: Interpreting Husserl, Dordrecht 1987, 227-46; Waldenfels, Ab
gr?ndigkeit des Sinnes, S. 24 ff. Zur Auseinandersetzung um den ?Relativismus" allge
mein vgl. Gail Soffer, Husserl and the Question of Relativism, Dordrecht 1991.
12 In diesem Sinne sind Husserls fr?heste ?berlegungen zur Lebenswelt-Problematik aus
dem Manuskript einer Vorlesung von 1919 zu verstehen: ?Versuchen wir also in die ty
pische Struktur der vor aller Theorie vorgegebenen Welt einzudringen, so sto?en wir
auf eine erste Scheidung, die wir verst?ndlich bezeichnen als die zwischen Subjekten
und Dingen" (mitgeteilt von G. van Kerckhoven, Zur Genese des Begriffs ,Lebens
welt' bei Edmund Husserl, Archiv f?r Begriffsgeschichte 29,1985, S. 194).
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
388 Roman Dilcher
tivitat der subjektiven Auffassungen" das ,,wahrhaf
(S. 27). Aus diesem Grunde ist die lebensweltliche E
gegenuber den methodischen Abstraktionen, die die
An-sich der Dinge ausgibt. Sie mug3 den Einfluister
mus willfahrig Glauben schenken, ohne die ihr urei
niinftigkeit dagegen behaupten zu k6nnen. Die von
vorgestellte Welterklarung wird von ihr unweigerlich i
eigenen Unterscheidung von subjektiver Erscheinu
Dinge verstanden. Die ihr eignende Objektgerichteth
fahig, den Methodensinn der neuzeitlichen Wissen
schauen. Die Bodenfunktion fur die Wissenschaften
benswelt zuerteilt, ist, solange man auf diesem
ersichtlich.
Damit zeigt sich, dag3 auch der Vorrang, den Husserl den scheinbar
gleichbleibenden Naturdingen gegenuber dem Wandel der geschichtli
chen Auffassungen zuerteilt, aus der lebensweltlichen Einstellung selbst
entstammt. Denn sie ist es, die sich unweigerlich an die anschaulichen
,,Dinge" hailt. Dies ist insbesondere gegeniiber den Versuchen zu beto
nen, die geschichtliche Kulturwelt gegen Husserls Analyse der Lebens
welt auszuspielen. Die Idee sprachlich-kultureller Konstitution von Welt
mug der natiirlichen Einstellung ebenso fremd und unverstiindlich blei
ben wie Husserls transzendentale Subjektivitat. Lebensweltlich erfahren
werden Kultur und Sprache, wenn sie eigens in den Blick treten, auf an
dere Weise, namlich als Sitten, Lebensweisen und Denkweisen der V61
ker. Die unterschiedlichen Sprachen erscheinen zunachst bloB als Ver
schiedenheit der ,,Zunge", als eine andere Namengebung fur die gleichen
Dinge. Selbst wenn sich in der Begegnung mit anderen Kulturen der
Sinn fur die Relativitat der eigenen ,,Weltauffassung" herausbildet und
steigert, wird die lebensweltliche Einstellung doch stets darauf beharren
miissen, daf3 es sich um verschiedene Auffassungen der einen gemeinsa
men Welt handelt. Fur das lebensweltliche Erfahren ist der eigene ,,Hori
zont" nicht Welthorizont, sondern allenfalls eine Denkweise, die als be
dingt gegenuiber anderen im Hinblick auf die gleiche Welt erfahren wird.
Mit einem Wort: die lebensweltliche Einstellung ist relativitatsfeind
lich darin, dag3 sie alle Perspektivierungen, die sie zugestehen mag, nicht
als konstitutive Leistung auffassen kann, sondern sie sogleich auf die eine
zugrundeliegende Welt jenseits aller Perspektiven bezieht. Die Subjekti
vitat, wenn sie sich als relativ erfahrt, kann, lebensweltlich eingestellt,
nicht anders als sich innerhalb einer gemeinsamen Welt zu verorten. Der
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Uiber das Verhdltnis von Lebenswelt und Philosophie 389
lebensweltlichen Einstellung ist daher die Zuriicknahme der Subjekti
vitat im Sinne des ,,blog" Relativen zu eigen. Das Festhalten an den Na
turdingen, selbst der Objektivismus der Wissenschaften, ist ihr naher als
deren Auflosung in subjektive und kulturrelative Horizonte.
Der ,,Kulturrelativismus" hat darum nur eine vermeintliche Nahe zum
lebensweltlichen Erfahren; sein Bestreben, der Lebenswelt gleichsam auf
Augenhohe zu begegnen, ist triugerisch. Er lauft Gefahr, die eigene Refle
xionsleistungzu uiberspielen, durch die allein die weltkonstituierende Kraft
der historischen Weltentwiirfe, Sprachspiele oder Paradigmen behauptet
werden kann. Es ist kein Zufall, da3 ,,Weltbilder" und dergleichen erst
im Gefolge der Transzendentalphilosophie als philosophische Kategorie
aufgekommen sind, namlich wenn diejenige Konstitutionsleistung, die
gemiig Kant im Bewugtsein gelegen war, nun (etwa bei Herder und dann
Humboldt) der Sprache zugesprochen wird. Indem damit die Prioritat
der kulturellen Pragung gegenuiber einer schlichten unhistorischen Ding
erfahrung behauptet wird, hat man sich bereits ebenso wie die Transzen
dentalphilosophie iiber das unmittelbare lebensweltliche Erfahren erho
ben und hinausreflektiert. Die Meinung, sich dabei gegen Husserl auf die
Evidenzen der Lebenswelt berufen zu diirfen, ist folglich hinfallig. Von
der Lebenswelt lift sich nicht sprechen, ohne bereits die Distanz der Re
flexion eingenommen zu haben.
Mag in den Augen der Kritiker die transzendentalphilosophische
Bemuhung wie eine Verstiegenheit wirken, so nimmt sich umgekehrt,
von Husserl her, die Gegenposition wie eine Halbherzigkeit aus, die es
nicht vermag, die Lebenswelt in ihrer Universalitat und Totalitat ange
messen zu erfassen. Denn wenn man sich nur an die Vielzahl historisch
kultureller ,,Welten" halt, so fiihrt dies unweigerlich zu einer Unterbe
stimmung. Die Lebensweltthematik kann auf diese Weise gerade nicht
mehr in jener grundsatzlichen und universalen Funktion zur Sprache ge
bracht werden, die Husserl im Auge hatte. Es ist daher durchweg unan
gebracht, von einer ,,Differenz zwischen der Welt im Ganzen und einer
Lebenswelt, in der ich situiert bin" (Habermas),13 auszugehen. Denn ver
kurzt man die philosophische Bestimmung der Lebenswelt auf die jeweili
gen - historisch oder konkret gedachten - unmittelbaren Situierungen,
so wird dadurch der in ihnen allen unvermeidlich lebendige Glaube be
schnitten, in einer allgemeinsamen und ,,wirklichen" Welt zu leben, in
der sich alle, auf welche Weise auch immer, auf die gleiche Wirklichkeit
J3 Op. cit. S. 37.
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
390 Roman Dilcher
beziehen. Doch eben diese lebensweltliche Grundiib
was Husserl als Urevidenz des menschlichen Lebens
schon-da und Immer-vorweg der Welt, wodurch ihr jen
die der Plural sinnlos ist", zukommt. Bei aller fakt
grenztheit ist die lebensweltliche Einstellung gerade
ihre Jeweiligkeit. Sie, und nur sie, halt sich in einer T
,,Sonderwelten" umgreifenden Horizont. Erst wen
wird, kann sie als der unhintergehbare Boden fir a
gen einschlieg3lich der Wissenschaften ausgezeichnet w
Die verschiedenen konkreten ,,Lebenswelten", die
bildet haben, bezeichnet Husserl in terminologische
den universalen Weltbegriff meistens als Umwelt. W
Lebenswelt mit ihnen gleichgesetzt, so geht das gan
surable, wodurch allein er philosophische Relevanz e
eine je besondere historische Weltdeutung geheftet,
den begrenzten Ausschnitt des Bekannten und ber
dieser Begrenzung liegt tendenziell eine Verdin
,,Weltumschau", wie Husserl sie nennt, ein ,,intere
auf die ,,wechselnden Lebensumwelten der Volk
durchaus ihre Berechtigung, doch als ,,objektive T
ker" (S. 150). So unvermeidlich dem Geistesgeschic
gen, dem Anthropologen dieser Blick ist, so ist dam
der Welt nicht erfagbar. Vielmehr setzt, so Husserl
tung ,,immer schon fur uns, die Betrachter, voraus
den der Weltgeltung" (S. ii). Es ist Sache der philos
on, diesem Umstand Rechnung zu tragen.
Eine objektivierende Untersuchung von aug3en ist
eigentlich phanomenologischen Thematisierung zu
Husserl die ,,Lebenswelt" transzendentalphilosophi
ternimmt, so bedeutet dies keineswegs eine Verna
gensinnes aufgrund einer uiberholten metaphysisc
Auch ist dieser Ansatz unabhangig von den Aporie
Lehre vom Ur-Ich schliei3lich fuhrt. An der einen W
tiven Perspektivitat und historischen Bedingtheit f
dem Wirklichkeitssinn des Weltlebens treu zu bleibe
das Husserl den Relativismen entgegenhalt, ist somit
lebensweltlichen Einstellung selbst entspringt.
This content downloaded from
134.147.116.252 on Fri, 08 Jan 2021 19:46:57 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Husserl: Die Krisis der europäischen Wissenschaften: Eine BesprechungVon EverandHusserl: Die Krisis der europäischen Wissenschaften: Eine BesprechungNoch keine Bewertungen
- Erhart Kästner (1904-1974): Griechenlandsehnsucht und Zivilisationskritik im Kontext der »konservativen Revolution«Von EverandErhart Kästner (1904-1974): Griechenlandsehnsucht und Zivilisationskritik im Kontext der »konservativen Revolution«Noch keine Bewertungen
- Über Das Verhältniss Von Lebenswelt Zur Philosophie (Aufsatz)Dokument19 SeitenÜber Das Verhältniss Von Lebenswelt Zur Philosophie (Aufsatz)Choi PeterNoch keine Bewertungen
- Soldinger Husserl Mach Ergon - Sammelband - ArtikelDokument31 SeitenSoldinger Husserl Mach Ergon - Sammelband - ArtikelCaglar KocNoch keine Bewertungen
- Stephan Strasser - Der Begriff Der Welt in Der Phänomenologischen Philosophie (Aufsatz)Dokument30 SeitenStephan Strasser - Der Begriff Der Welt in Der Phänomenologischen Philosophie (Aufsatz)Choi PeterNoch keine Bewertungen
- Ralf Konersmann - Montaigne DescartesDokument11 SeitenRalf Konersmann - Montaigne DescartesMark CohenNoch keine Bewertungen
- Elisabeth Ströker - Husserls Letzter Weg Zur Transzendentalphilosophie Im Krisis-WerkDokument20 SeitenElisabeth Ströker - Husserls Letzter Weg Zur Transzendentalphilosophie Im Krisis-WerkChoi PeterNoch keine Bewertungen
- (Phaenomenologica 23) Klaus Held (Auth.) - Lebendige Gegenwart_ Die Frage Nach Der Seinsweise Des Transzendentalen Ich Bei Edmund Husserl, Entwickelt Am Leitfaden Der Zeitproblematik-Springer NetherlaDokument199 Seiten(Phaenomenologica 23) Klaus Held (Auth.) - Lebendige Gegenwart_ Die Frage Nach Der Seinsweise Des Transzendentalen Ich Bei Edmund Husserl, Entwickelt Am Leitfaden Der Zeitproblematik-Springer NetherlaTayronizando100% (1)
- Ludwig Landgrebe - Husserls Abschied Vom Cartesianismus (Aufsatz)Dokument46 SeitenLudwig Landgrebe - Husserls Abschied Vom Cartesianismus (Aufsatz)Choi PeterNoch keine Bewertungen
- Faktizität Und Individuation Studien Zu Den Grundfragen Der Phänomenologie by Ludwig LandgrebeDokument176 SeitenFaktizität Und Individuation Studien Zu Den Grundfragen Der Phänomenologie by Ludwig LandgrebeRafaelBastosFerreiraNoch keine Bewertungen
- Sebastian Luft - Phänomenologische Lebensweltwissenschaft Und Empirische Wissenschaften Vom Leben (Aufsatz)Dokument20 SeitenSebastian Luft - Phänomenologische Lebensweltwissenschaft Und Empirische Wissenschaften Vom Leben (Aufsatz)Choi PeterNoch keine Bewertungen
- Süsske, Ralf - Lebenswelt Bei HusserlDokument12 SeitenSüsske, Ralf - Lebenswelt Bei HusserlGuacamole Bamako ShivaNoch keine Bewertungen
- Husserls Neue Einführung in Die PhilosophieDokument40 SeitenHusserls Neue Einführung in Die PhilosophieIván GalánNoch keine Bewertungen
- Waldenfels, Bernhard - Phänomenologie in DeutschlandDokument25 SeitenWaldenfels, Bernhard - Phänomenologie in DeutschlandPavel Veraza TondaNoch keine Bewertungen
- Husserls Phänomenologie Und Die Motive Zu Ihrer UmbildungDokument41 SeitenHusserls Phänomenologie Und Die Motive Zu Ihrer UmbildungCY WuNoch keine Bewertungen
- Der Mensch Und Seine Hoffnung Im Alten TestamentDokument193 SeitenDer Mensch Und Seine Hoffnung Im Alten TestamentM. G.Noch keine Bewertungen
- Habitar Corporalmente El EspacioDokument18 SeitenHabitar Corporalmente El EspacioDanza AefNoch keine Bewertungen
- Diehl,+U ,+Was+heißt+Philosophie+als+strenge+Wissenschaft PDFDokument25 SeitenDiehl,+U ,+Was+heißt+Philosophie+als+strenge+Wissenschaft PDFnukiduzNoch keine Bewertungen
- Die Frage Nach Dem Ursprung Der Geometrie Als IntentionalDokument24 SeitenDie Frage Nach Dem Ursprung Der Geometrie Als Intentionalkeljon65100% (2)
- Philosophie in Experimenten: Versuche explorativen DenkensVon EverandPhilosophie in Experimenten: Versuche explorativen DenkensNoch keine Bewertungen
- Der Begriff Des Lebens in Der Klassischen Deutschen Philosophie - Eine Naturphilosophische Oder Lebensweltliche Frage?Dokument19 SeitenDer Begriff Des Lebens in Der Klassischen Deutschen Philosophie - Eine Naturphilosophische Oder Lebensweltliche Frage?Claudia AguilarNoch keine Bewertungen
- Adorno, Theodor W. - Gesammelte Schriften. Bd.1 - Philosophische Frühschriften - Suhrkamp (1990) PDFDokument384 SeitenAdorno, Theodor W. - Gesammelte Schriften. Bd.1 - Philosophische Frühschriften - Suhrkamp (1990) PDFandressuareza88100% (1)
- Iso Kern - Die Drei Wege Zur Transzendental-Phaenomenologischen Reduktion in Der Philosophie Edmund HusserlsDokument48 SeitenIso Kern - Die Drei Wege Zur Transzendental-Phaenomenologischen Reduktion in Der Philosophie Edmund HusserlsChoi PeterNoch keine Bewertungen
- Evolutionstheorie - Sackgasse der Wissenschaft: Ist die Evolutionstheorie ein Irrweg der Wissenschaft? Viele Fragen - keine glaubwürdigen Antworten!Von EverandEvolutionstheorie - Sackgasse der Wissenschaft: Ist die Evolutionstheorie ein Irrweg der Wissenschaft? Viele Fragen - keine glaubwürdigen Antworten!Noch keine Bewertungen
- Fossilien - Stumme Zeugen Der Vergangenheit: Duane T. GishDokument1 SeiteFossilien - Stumme Zeugen Der Vergangenheit: Duane T. Gishchristusjesus9Noch keine Bewertungen
- Über uns Menschen: Philosophische SelbstvergewisserungenVon EverandÜber uns Menschen: Philosophische SelbstvergewisserungenNoch keine Bewertungen
- Gesammelte Aufsätze 3: Initiation, Einweihungsrituale und Wesensphänomene: Mit einem Vorwort von Wolfgang GiegerichVon EverandGesammelte Aufsätze 3: Initiation, Einweihungsrituale und Wesensphänomene: Mit einem Vorwort von Wolfgang GiegerichNoch keine Bewertungen
- CASSIRER Versuch Über Den Menschen 1944 (Auszug)Dokument10 SeitenCASSIRER Versuch Über Den Menschen 1944 (Auszug)lectordigitalis100% (1)
- Peter Pörtner Das Wichtigste Aber Ist Die HarmonieDokument25 SeitenPeter Pörtner Das Wichtigste Aber Ist Die HarmoniepetzpoertnerNoch keine Bewertungen
- Die Spannweite des Daseins: Philosophie, Theologie, Psychotherapie und Religionswissenschaft im GesprächVon EverandDie Spannweite des Daseins: Philosophie, Theologie, Psychotherapie und Religionswissenschaft im GesprächNoch keine Bewertungen
- Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft (Übersetzt)Von EverandNaturwissenschaft und Geisteswissenschaft (Übersetzt)Noch keine Bewertungen
- Landschaftsmalerei - Korrektiv moderner Naturentfremdung: Lorrain | Turner · Friedrich | Feininger · Monet | v. GoghVon EverandLandschaftsmalerei - Korrektiv moderner Naturentfremdung: Lorrain | Turner · Friedrich | Feininger · Monet | v. GoghNoch keine Bewertungen
- SelbstdarstellungDokument6 SeitenSelbstdarstellungWanderNoch keine Bewertungen
- Helmuth Plessner: Von Der Deskriptiv-Zur Transzendental-Phänomenologischen MethodeDokument48 SeitenHelmuth Plessner: Von Der Deskriptiv-Zur Transzendental-Phänomenologischen MethodeJavierNoch keine Bewertungen
- Was Heißt Eine Welt Beschreiben? Hans Blumenbergs Vielfache HorizontDokument16 SeitenWas Heißt Eine Welt Beschreiben? Hans Blumenbergs Vielfache HorizontjulianalugaoNoch keine Bewertungen
- Von Der Phänomenologie Zur Mathesis Der SubjektivitätDokument18 SeitenVon Der Phänomenologie Zur Mathesis Der SubjektivitätFausto FraisopiNoch keine Bewertungen
- Ereignis Und Affektivitat Zur PhanomenolDokument12 SeitenEreignis Und Affektivitat Zur PhanomenolBen GrafNoch keine Bewertungen
- Luhmann - LifeworldDokument20 SeitenLuhmann - LifeworldEmerson PalmieriNoch keine Bewertungen
- Epiphanie: Reine Erscheinung und Ethos ohne KategorieVon EverandEpiphanie: Reine Erscheinung und Ethos ohne KategorieNoch keine Bewertungen
- Geschlecht und Körper: Studien zur Materialität und Inszenierung gesellschaftlicher WirklichkeitVon EverandGeschlecht und Körper: Studien zur Materialität und Inszenierung gesellschaftlicher WirklichkeitNoch keine Bewertungen
- Wunsch und Bedeutung: Grundzüge einer naturalistischen BedeutungstheorieVon EverandWunsch und Bedeutung: Grundzüge einer naturalistischen BedeutungstheorieNoch keine Bewertungen
- Vorläufige Gewissheiten: Plausibilität als soziokulturelle PraxisVon EverandVorläufige Gewissheiten: Plausibilität als soziokulturelle PraxisNoch keine Bewertungen
- Scheid & Svenbro, (2014) La Tortue Et La Lyre. Dans L'atelier Du Mythe Antique (CR Bierl)Dokument6 SeitenScheid & Svenbro, (2014) La Tortue Et La Lyre. Dans L'atelier Du Mythe Antique (CR Bierl)chdelattNoch keine Bewertungen
- Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 3: 2. Jahrgang (1996)Von EverandZeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 3: 2. Jahrgang (1996)Noch keine Bewertungen
- fzp-003 1972 19 520 DDokument22 Seitenfzp-003 1972 19 520 DPeripecio PoenterNoch keine Bewertungen
- Blumenberg Lesen Lebenswelt Manfred SommerDokument11 SeitenBlumenberg Lesen Lebenswelt Manfred SommerAlexander CaroNoch keine Bewertungen
- Die Kultur des Neoevolutionismus: Zur diskursiven Renaturalisierung von Mensch und GesellschaftVon EverandDie Kultur des Neoevolutionismus: Zur diskursiven Renaturalisierung von Mensch und GesellschaftFabian DeusNoch keine Bewertungen
- Felix Meiner Verlag GMBH Phänomenologische ForschungenDokument36 SeitenFelix Meiner Verlag GMBH Phänomenologische ForschungenPavel Veraza TondaNoch keine Bewertungen
- Soziologien des Lebens: Überschreitung - Differenzierung - KritikVon EverandSoziologien des Lebens: Überschreitung - Differenzierung - KritikNoch keine Bewertungen
- Gesammelte Schriften Viii Band Weltanschauungslehre Abhandlungen Zur Philosophie Der Philosophie 3rdnbsped CompressDokument300 SeitenGesammelte Schriften Viii Band Weltanschauungslehre Abhandlungen Zur Philosophie Der Philosophie 3rdnbsped CompressJason KingNoch keine Bewertungen
- Max Scheler (1928) Die Stellung Des Menschen Im KosmosDokument98 SeitenMax Scheler (1928) Die Stellung Des Menschen Im KosmosDebordSituationist100% (3)
- Waldenfels, Bernhard - DE - Leib Zwischen Natur Und KulturDokument15 SeitenWaldenfels, Bernhard - DE - Leib Zwischen Natur Und Kulturmadalina guzunNoch keine Bewertungen
- Botho Strauß: Dissipation: Die Auflösung von Wort und ObjektVon EverandBotho Strauß: Dissipation: Die Auflösung von Wort und ObjektNoch keine Bewertungen
- Bollnow, Otto Friedrich - Existenzerhellung Und Philosophische Anthropologie. Versuch Einer Auseinandersetzung Mit Karl Jaspers PDFDokument33 SeitenBollnow, Otto Friedrich - Existenzerhellung Und Philosophische Anthropologie. Versuch Einer Auseinandersetzung Mit Karl Jaspers PDFGeorgy PlekhanovNoch keine Bewertungen
- Zwischen Nichts und Ewigkeit: Drei Aufsätze zur Lehre vom MenschenVon EverandZwischen Nichts und Ewigkeit: Drei Aufsätze zur Lehre vom MenschenNoch keine Bewertungen
- Unser Verlangen nach Freiheit: Kein Traum, sondern Drama mit ZukunftVon EverandUnser Verlangen nach Freiheit: Kein Traum, sondern Drama mit ZukunftNoch keine Bewertungen
- Beate Ochsner, Sybilla Nikolow, Robert Stock (HG) - Affizierungs - Und Teilhabeprozesse Zwischen Organismen Und MaschinenDokument235 SeitenBeate Ochsner, Sybilla Nikolow, Robert Stock (HG) - Affizierungs - Und Teilhabeprozesse Zwischen Organismen Und MaschinenChoi PeterNoch keine Bewertungen
- Sebastian Luft - Phänomenologische Lebensweltwissenschaft Und Empirische Wissenschaften Vom Leben (Aufsatz)Dokument20 SeitenSebastian Luft - Phänomenologische Lebensweltwissenschaft Und Empirische Wissenschaften Vom Leben (Aufsatz)Choi PeterNoch keine Bewertungen
- Georg Stenger - Arbeit An Den Lebensformen-Aspekte Interkultureller Phänomenologie (Aufsatz)Dokument31 SeitenGeorg Stenger - Arbeit An Den Lebensformen-Aspekte Interkultureller Phänomenologie (Aufsatz)Choi PeterNoch keine Bewertungen
- Irene Breuer - Ontologie - Der - Person - Und - Geschichte - BeiDokument10 SeitenIrene Breuer - Ontologie - Der - Person - Und - Geschichte - BeiChoi PeterNoch keine Bewertungen
- Ichpol - Schwabe VerlagDokument1 SeiteIchpol - Schwabe VerlagChoi PeterNoch keine Bewertungen
- Roman Ingardens - Ontologie Und Die Welt (Aufsatz)Dokument30 SeitenRoman Ingardens - Ontologie Und Die Welt (Aufsatz)Choi PeterNoch keine Bewertungen
- Ludwig Landgrebe - Husserls Abschied Vom Cartesianismus (Aufsatz)Dokument46 SeitenLudwig Landgrebe - Husserls Abschied Vom Cartesianismus (Aufsatz)Choi PeterNoch keine Bewertungen
- Die) Bersetzung: Ein Modell Der Verst%ndigung Zwischen Kulturellen LebensformenDokument15 SeitenDie) Bersetzung: Ein Modell Der Verst%ndigung Zwischen Kulturellen LebensformenChoi PeterNoch keine Bewertungen
- Iso Kern - Die Drei Wege Zur Transzendental-Phaenomenologischen Reduktion in Der Philosophie Edmund HusserlsDokument48 SeitenIso Kern - Die Drei Wege Zur Transzendental-Phaenomenologischen Reduktion in Der Philosophie Edmund HusserlsChoi PeterNoch keine Bewertungen
- Epiktet Und NTDokument422 SeitenEpiktet Und NTgezedkaNoch keine Bewertungen
- Julian Nida-Rümelin, Internationale Gerechtigkeit Und Institutionelle VerantwortungDokument434 SeitenJulian Nida-Rümelin, Internationale Gerechtigkeit Und Institutionelle VerantwortungHeraklitNoch keine Bewertungen
- Schneider - Foucault-Wahrheitsproduktion.Dokument9 SeitenSchneider - Foucault-Wahrheitsproduktion.Aldo LanfranconiNoch keine Bewertungen
- Mut Zur Freiheit, Ruf Zur Ordnung - Klaus KunzeDokument240 SeitenMut Zur Freiheit, Ruf Zur Ordnung - Klaus KunzeGurki MeyerNoch keine Bewertungen
- Directory HumanitiesDokument81 SeitenDirectory Humanitiesmesato1971Noch keine Bewertungen
- Haider Nina - Von Der Kunst, Sich Selbst Zu LiebenDokument289 SeitenHaider Nina - Von Der Kunst, Sich Selbst Zu Liebenarcoirisgmx100% (1)
- Koltan Marx Deutsche IdeologieDokument99 SeitenKoltan Marx Deutsche IdeologieFabio FrosiniNoch keine Bewertungen
- Pedro Ribeiro Martins Der Vegetarismus in Der Antike Im StreitgesprächDokument240 SeitenPedro Ribeiro Martins Der Vegetarismus in Der Antike Im Streitgesprächxolek63170atzefaraNoch keine Bewertungen
- Vaughan-Lee - Die - Paradoxe - Der - LiebeDokument137 SeitenVaughan-Lee - Die - Paradoxe - Der - LiebeHenningNoch keine Bewertungen
- Niklas Luhmann Paradigm Lost. Über Die Ethische Reflexion Der Moral. Rede Anläß Lich Der Verleihung Des Hegel Preises 1989. ReszensionDokument18 SeitenNiklas Luhmann Paradigm Lost. Über Die Ethische Reflexion Der Moral. Rede Anläß Lich Der Verleihung Des Hegel Preises 1989. ReszensionFritzWaltherNoch keine Bewertungen
- BauhardtDokument21 SeitenBauhardtDome RavinaNoch keine Bewertungen