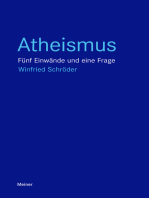Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Kant - Philosophische Religionslehre B67 84
Hochgeladen von
Andreas LöwOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Kant - Philosophische Religionslehre B67 84
Hochgeladen von
Andreas LöwCopyright:
Verfügbare Formate
Philosophisches Seminar – Die Religionsphilosophie Immanuel Kants
Protokoll 25.04.2023 (Andreas Löw)
Lektüre und Diskussion: Philosophische Religionslehre, Zweites Stück: B 67-84
In der Einleitung (B 67-72) beschreibt Kant die mögliche Entwicklung zur Moralität des Menschen
als „Kampf des guten Prinzips, mit dem Bösen, um die Herrschaft über den Menschen“ (67). Die
Stoiker, die richtigerweise das moralische Gesetz unmittelbar und ausschließlich aus der Vernunft
ableiteten, identifizierten den „Feind“ (68) fälschlicherweise mit den Neigungen selbst, weil sie
einen unverdorbenen Willen im Menschen annahmen, und den Feind nicht – wie es nach Kant
richtig ist – „in der verkehrten Maxime, und also in der Freiheit selbst“ (69) suchen.
Im ersten der beiden Abschnitte des zweiten Stücks (B73-76) behandelt Kant die „Personifizierte
Idee des guten Prinzips“ (73) in einer christologischen Denkform. Der moralphilosophischen Idee
(platonisch) der vollkommen realisierten sittliche Willensbildung der Menschheit, entspricht
theologisch reformuliert der dogmatische Topos vom nichtgeschaffenen, „eingeborenen Sohn“
(73) Gottes. Diese Idee hat (philosophisch formuliert) jeder einzelne Mensch in seiner Vernunft in
sich und wird sich ihrer als Ideal bewusst. Die Bewusstwerdung dieses Ideals ist von der Vernunft
nicht begreifbar; sie ist unableitbar. (74) Christologisch reformuliert heißt das, dass der Sohn
Gottes die menschliche Natur angenommen (Zwei-Naturen-Christologie) und sich der Menschheit
offenbart hat. (75) Mit dem praktischen Glauben der Gläubigen an den Sohn Gottes reformuliert
Kant theologisch das Vertrauen der moralisch gesetzbebenden Vernunft, dass die Realisierung des
Sittengesetzes in allen moralischen Herausforderungen durch jeden Menschen möglich sein muss:
„Wir sollen ihr [sc. der moralisch gesetzgebenden Vernunft] gemäß sein, und wir müssen es daher
auch können.“ (76)
Im zweiten Abschnitt des zweiten Stücks (B76-84) behandelt Kant die „Objektive Realität dieser
[personifizierten] Idee [des guten Prinzips]“ (76). Objektive Realität bedeutet philosophisch, dass
diese Idee „ihre Realität in praktischer Beziehung vollständig in sich selbst hat“ (76), d.h. sie ihren
Ort nicht in der Geschichte, sondern in der Vernunft selbst hat und empirisch nicht zu belegen ist
(77). In seinen christologischen Überlegungen, in denen Kant „Lehre, Lebenswandel und Leides“
(79) des die menschliche Natur angenommenen Sohnes Gottes als beispielhaft benennt, spricht
Kant deshalb auch durchgehend hypothetisch (Konjunktiv) von einem historischen Jesus („Wäre
nun ein solcher wahrhaftig göttlich gesinnter Mensch zu einer gewissen Zeit gleichsam vom
Himmel auf die Erde herabgekommen […]“ (78f.)). Es ist ein Versuch, moralische Begriffe, d.h.
Vernunftbegriffe auf sinnliche Zusammenhänge abzubilden. Kant nimmt damit auch theologische
Diskussionen seiner Zeit über die christologische Bedeutung der Leben-Jesu-Forschung auf.
Entscheidend aber, dass der Urbildchristologie philosophisch nur eine begrenzte Bedeutung hat,
ist die philosophische Erkenntnis, dass „das Urbild, welches wir dieser Erscheinung unterlegen,
doch immer in uns […] selbst gesucht werden muss“ (79). Dazu kommt, dass die christologische
Theoriebildung auch interne Fragen aufwirft, die einer „praktischen Anwendung der Idee
desselben auf unsere Nachfolge, nach allem, was wir einzusehen vermögen, eher im Wege sein“
(79) werde.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Wie bestimmt sich die Würde der Tiere?: Eine ethisch-theologische Reflexion mit besonderem Einbezug der tierischen Gefühlswelt.Von EverandWie bestimmt sich die Würde der Tiere?: Eine ethisch-theologische Reflexion mit besonderem Einbezug der tierischen Gefühlswelt.Noch keine Bewertungen
- Kant - Philosophische Religionslehre B208 222Dokument1 SeiteKant - Philosophische Religionslehre B208 222Andreas LöwNoch keine Bewertungen
- Kant - Philosophische Religionslehre B255 296Dokument4 SeitenKant - Philosophische Religionslehre B255 296Andreas LöwNoch keine Bewertungen
- 02 ZeidlerDokument9 Seiten02 ZeidlerIvana GreguricNoch keine Bewertungen
- 02 ZeidlerDokument9 Seiten02 ZeidlerZeljko SaricNoch keine Bewertungen
- Lacan Und Die PsychologieDokument30 SeitenLacan Und Die PsychologieAthanasios MarvakisNoch keine Bewertungen
- Kant. Metaphysik NaturanlageDokument7 SeitenKant. Metaphysik NaturanlageThomas PawelekNoch keine Bewertungen
- Klingner. Intuición Intelectual en Kant. KS 2016Dokument34 SeitenKlingner. Intuición Intelectual en Kant. KS 2016RCNoch keine Bewertungen
- Loidolt, Sophie - Ist Husserls Späte Ethik Existenzialistisch?Dokument11 SeitenLoidolt, Sophie - Ist Husserls Späte Ethik Existenzialistisch?Pavel Veraza TondaNoch keine Bewertungen
- Metz, Wilhelm - Hoehlen Ausgang Der Moderne-1Dokument353 SeitenMetz, Wilhelm - Hoehlen Ausgang Der Moderne-1Pavel Veraza TondaNoch keine Bewertungen
- Theonomous Autonomy Versus Participated TheonomyDokument14 SeitenTheonomous Autonomy Versus Participated TheonomyPaul HorriganNoch keine Bewertungen
- Die Kritik Der Reflektierenden Urteilskraft-Hans FegerDokument42 SeitenDie Kritik Der Reflektierenden Urteilskraft-Hans FegerLeon LeoNoch keine Bewertungen
- Kern 2000 Einsicht Ohne TäuschungDokument24 SeitenKern 2000 Einsicht Ohne TäuschungIdrilNoch keine Bewertungen
- Krings - Freiheit - Ein Versuch Gott Zu DenkenDokument13 SeitenKrings - Freiheit - Ein Versuch Gott Zu DenkenJose Lozano GotorNoch keine Bewertungen
- Rainer Forst (2009) - Zwei-Bilder-Der-Gerechtigkeit (Aus Sozialphilosophie Und Kritik) OCR PDFDokument13 SeitenRainer Forst (2009) - Zwei-Bilder-Der-Gerechtigkeit (Aus Sozialphilosophie Und Kritik) OCR PDFstaraldNoch keine Bewertungen
- Klein - FORMALE UND MATERIALS PRINZIPIEN IN KANTS ETHIKDokument15 SeitenKlein - FORMALE UND MATERIALS PRINZIPIEN IN KANTS ETHIKClaudioSehnemNoch keine Bewertungen
- Geschichte der neuern Philosophie: Von Bacon bis SpinozaVon EverandGeschichte der neuern Philosophie: Von Bacon bis SpinozaNoch keine Bewertungen
- Vittorio Klostermann GMBH Is Collaborating With Jstor To Digitize, Preserve and Extend Access To Zeitschrift Für Philosophische ForschungDokument5 SeitenVittorio Klostermann GMBH Is Collaborating With Jstor To Digitize, Preserve and Extend Access To Zeitschrift Für Philosophische ForschungFrancisco Salaris BanegasNoch keine Bewertungen
- DissertationDokument414 SeitenDissertationJuliane DuftNoch keine Bewertungen
- Kapitalismus als Religion: Überlegungen zu einem Fragment Walter BenjaminsVon EverandKapitalismus als Religion: Überlegungen zu einem Fragment Walter BenjaminsNoch keine Bewertungen
- Nach dem Gesetz Gottes: Autonomie als christliches PrinzipVon EverandNach dem Gesetz Gottes: Autonomie als christliches PrinzipNoch keine Bewertungen
- Pub Der Mensch Handbuch Systematischer Theologie 8Dokument221 SeitenPub Der Mensch Handbuch Systematischer Theologie 8Gustavo SchmittNoch keine Bewertungen
- Die Kontroverse Zwischen Kant Und GarveDokument20 SeitenDie Kontroverse Zwischen Kant Und Garvemarmi79Noch keine Bewertungen
- Beurteilung Von Nietzsches ReligionskritikDokument4 SeitenBeurteilung Von Nietzsches Religionskritikbrandonlewis.nashNoch keine Bewertungen
- Jurgen Habermas-Moralitaet Und Sittlichkeit PDFDokument16 SeitenJurgen Habermas-Moralitaet Und Sittlichkeit PDFWilsonRocaNoch keine Bewertungen
- Geschichte der neuern Philosophie von Bacon von Verulam bis Benedikt SpinozaVon EverandGeschichte der neuern Philosophie von Bacon von Verulam bis Benedikt SpinozaNoch keine Bewertungen
- GottesbeweisDokument19 SeitenGottesbeweissiegfriedstarkgmailNoch keine Bewertungen
- Ina Goy Immanuel Kant Über Das Moralischen Gefühl AchtungDokument25 SeitenIna Goy Immanuel Kant Über Das Moralischen Gefühl AchtungPaulo Borges de Santana JuniorNoch keine Bewertungen
- Glaube und Naturwissenschaft: Widerspruch oder Ergänzung?: Überlegungen zur Existenz des christlichen Dreieinigen Gottes aus der Sicht der modernen PhysikVon EverandGlaube und Naturwissenschaft: Widerspruch oder Ergänzung?: Überlegungen zur Existenz des christlichen Dreieinigen Gottes aus der Sicht der modernen PhysikNoch keine Bewertungen
- Antike Moderne EthikDokument21 SeitenAntike Moderne EthikTijana OkićNoch keine Bewertungen
- GerechtigkeitsdiskurseDokument28 SeitenGerechtigkeitsdiskurseMicha BaNoch keine Bewertungen
- DIe Geschichtlichkeit Des GeistesDokument8 SeitenDIe Geschichtlichkeit Des GeistesReal JiggaNoch keine Bewertungen
- Endlichkeit und Transzendenz: Perspektiven einer GrundbeziehungVon EverandEndlichkeit und Transzendenz: Perspektiven einer GrundbeziehungNoch keine Bewertungen
- Bodo v. Greiff, Hanne Herkommer - Die Abbildtheorie Und Das ArgumentDokument26 SeitenBodo v. Greiff, Hanne Herkommer - Die Abbildtheorie Und Das ArgumentwaltwalNoch keine Bewertungen
- Nietzsche Ästhetik PolitikDokument20 SeitenNietzsche Ästhetik PolitikOrlando Nada OksNoch keine Bewertungen
- Radikaler Konstruktivismus versus Realismus: Apologie des SubjektivismusVon EverandRadikaler Konstruktivismus versus Realismus: Apologie des SubjektivismusNoch keine Bewertungen
- Tatjana Tarkian - Moralischer Realismus: Varianten Und ProblemeDokument38 SeitenTatjana Tarkian - Moralischer Realismus: Varianten Und ProblemeVishnuNoch keine Bewertungen
- Welte, Bernhard - Meister Eckhart. Gedanken Zu Seinen Gedanken-Herder (1992) PDFDokument270 SeitenWelte, Bernhard - Meister Eckhart. Gedanken Zu Seinen Gedanken-Herder (1992) PDFGeorg100% (1)
- Achiati: Geisteswissenschaft Im 3. JahrtausendDokument60 SeitenAchiati: Geisteswissenschaft Im 3. JahrtausendAndrew Phillips100% (1)
- Heidemann Anschauung ÜberhauptDokument18 SeitenHeidemann Anschauung ÜberhauptJesús González FisacNoch keine Bewertungen
- TheodizeeDokument9 SeitenTheodizeeikarus960Noch keine Bewertungen
- Josef Pieper. Über Das Christliche Menschenbild. Vom Menschenbild Überhaupt. Lieferung 13Dokument19 SeitenJosef Pieper. Über Das Christliche Menschenbild. Vom Menschenbild Überhaupt. Lieferung 13Ir. João MicaelNoch keine Bewertungen
- Die Wirklichkeit der Freiheit: Zu den erkenntniswissenschaftlichen und christologischen Grundlagen der AnthroposophieVon EverandDie Wirklichkeit der Freiheit: Zu den erkenntniswissenschaftlichen und christologischen Grundlagen der AnthroposophieNoch keine Bewertungen
- Die Philosophie Der Erlosung IDokument278 SeitenDie Philosophie Der Erlosung IGabriel LopesNoch keine Bewertungen
- Hegel TechnikDokument10 SeitenHegel TechnikDaniel FalbNoch keine Bewertungen
- Belozwetoff Die Leidtragenden Wesenheiten Der Geistige WeltDokument11 SeitenBelozwetoff Die Leidtragenden Wesenheiten Der Geistige WeltFreddy KokkeNoch keine Bewertungen
- Hans-Georg Pott - Das Subjekt Bei LuhmannDokument15 SeitenHans-Georg Pott - Das Subjekt Bei LuhmannJulian HennebergNoch keine Bewertungen
- Buchheim (2012) - Der Begriff Der 'Menschlichen Freiheit' Nach Schellings 'Freiheitsschrift'Dokument16 SeitenBuchheim (2012) - Der Begriff Der 'Menschlichen Freiheit' Nach Schellings 'Freiheitsschrift'mgarromNoch keine Bewertungen
- Wellmer - Ethik Und DialogDokument114 SeitenWellmer - Ethik Und DialogjoaocarlosmpNoch keine Bewertungen
- Axel Bohmeyer Der Begriff GerechtigkeitDokument13 SeitenAxel Bohmeyer Der Begriff GerechtigkeithdruzanovicNoch keine Bewertungen
- Glaube und Vernunft: Der Anspruch des römisch-katholischen Lehramtes auf Wahrheit und die philosophisch-theologische Vernunft-Diskussion der GegenwartVon EverandGlaube und Vernunft: Der Anspruch des römisch-katholischen Lehramtes auf Wahrheit und die philosophisch-theologische Vernunft-Diskussion der GegenwartNoch keine Bewertungen
- Die Beiden Quellen3Dokument1 SeiteDie Beiden Quellen3Philipp TschirkNoch keine Bewertungen
- Tomonaga Tairako, Materialismus Und Dialektik Bei MarxDokument9 SeitenTomonaga Tairako, Materialismus Und Dialektik Bei Marxmarx_dialectical_studiesNoch keine Bewertungen
- Justin Dogmen PDFDokument24 SeitenJustin Dogmen PDFHeiligeOrthodoxieNoch keine Bewertungen
- Gebet Im Kontext Neuzeitlicher Religionskritik - KantB296 314Dokument15 SeitenGebet Im Kontext Neuzeitlicher Religionskritik - KantB296 314Andreas LöwNoch keine Bewertungen
- Spaziergänge in Wien - Vom Judenplatz Zum MorzinplatzDokument3 SeitenSpaziergänge in Wien - Vom Judenplatz Zum MorzinplatzAndreas LöwNoch keine Bewertungen
- Gebet Im Kontext Neuzeitlicher Religionskritik - KantB296 314Dokument15 SeitenGebet Im Kontext Neuzeitlicher Religionskritik - KantB296 314Andreas LöwNoch keine Bewertungen
- Gebet Im Kontext Neuzeitlicher Religionskritik - KantB296 314Dokument15 SeitenGebet Im Kontext Neuzeitlicher Religionskritik - KantB296 314Andreas LöwNoch keine Bewertungen
- Partikeln ÜbenDokument2 SeitenPartikeln ÜbenElenaNoch keine Bewertungen
- Dismod ws1920 SkriptDokument372 SeitenDismod ws1920 SkriptArtjom BeckerNoch keine Bewertungen
- Almanca 8.haftaDokument6 SeitenAlmanca 8.haftaAlone ManNoch keine Bewertungen
- Deutsch GrammatikDokument17 SeitenDeutsch GrammatikRin KagamineNoch keine Bewertungen
- Dell p2311h - User's Guide - De-DeDokument38 SeitenDell p2311h - User's Guide - De-DeRolf7Noch keine Bewertungen
- Einheit 5Dokument5 SeitenEinheit 5midhathusain01Noch keine Bewertungen
- El Orientalismo Como Episteme: Frédéric de Waldeck y Las Ruinas MayasDokument102 SeitenEl Orientalismo Como Episteme: Frédéric de Waldeck y Las Ruinas Mayasamazona2014100% (1)
- Linie1 A1-1 KapitelwortschatzDokument29 SeitenLinie1 A1-1 KapitelwortschatzKonstantin PaidaNoch keine Bewertungen