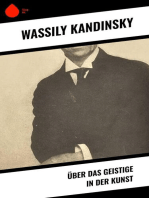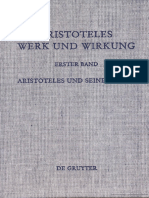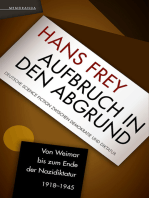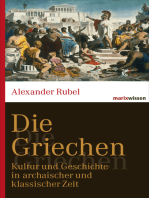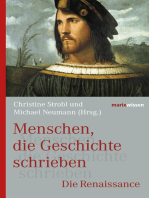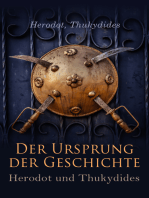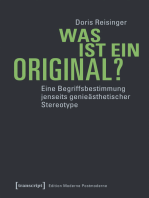Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
bert, Agazzi Elena, Décultot Elisabeth Graecomania - Der europäische Philhellenismus (Klassizistisch-Romantische Kunst (t) räume, Band 1) 2009
Hochgeladen von
brysonruOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
bert, Agazzi Elena, Décultot Elisabeth Graecomania - Der europäische Philhellenismus (Klassizistisch-Romantische Kunst (t) räume, Band 1) 2009
Hochgeladen von
brysonruCopyright:
Verfügbare Formate
I
Klassizistisch-romantische Kunst(t)rume
Band 1
II
Klassizistisch-romantische
Kunst(t)rume
Imaginationen im Europa des 19. Jahrhunderts und
ihr Beitrag zur kulturellen Identittsfindung
Herausgegeben von
Gilbert He, Elena Agazzi und Elisabeth Dcultot
Band 1
Walter de Gruyter Berlin New York
III
Graecomania
Der europische Philhellenismus
Herausgegeben von
Gilbert He, Elena Agazzi und Elisabeth Dcultot
Walter de Gruyter Berlin New York
IV
Gedruckt auf surefreiem Papier, das die US-ANSI-Norm
ber Haltbarkeit erfllt
ISBN 978-3-11-019469-2
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright 2009 by Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 10785 Berlin
Dieses Werk einschlielich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschtzt. Jede Ver-
wertung auerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung
des Verlages unzulssig und strafbar. Das gilt insbesondere fr Vervielfltigungen, berset-
zungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
Printed in Germany
Umschlaggestaltung: Martin Zech, Bremen
Satz: Drlemann Satz GmbH & Co. KG, Lemfrde
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Gttingen
Inhalt V
Inhalt
Gilbert Hess/Elena Agazzi/Elisabeth Dcultot
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
I. Antikenrezeption und Ideolatrie
Annherungen an ein Ideal
Alain Schnapp
Die Antiquitates der Griechen und Rmer, ihr Einflu
auf die Entstehung des antiquarischen Denkens und
ihr Beitrag zur Wiederentdeckung Griechenlands . . . . . . . 3
Elisabeth Dcultot
Winckelmanns Konstruktion der griechischen Nation . . . . . . 39
Kerstin Schwedes
Polychromie als Herausforderung. sthetische Debatten zur
Farbigkeit von Skulptur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Christian Scholl
Normative Anschaulichkeit versus archologische Pedanterie:
Karl Friedrich Schinkels sthetischer Philhellenismus . . . . . . 85
Gabriella Catalano
Griechische Spuren in Stifters Nachsommer . . . . . . . . . . . 99
II. Imaginationen des griechischen Freiheitskampfes
und Neugriechenlands
Valerio Furneri
Die deutschen Freiwilligen im griechischen Freiheitskampf . . . 119
VI Inhalt
Ekaterini Kepetzis
Familien im Krieg Zum griechischen Freiheitskampf in der
franzsischen Malerei der 1820er Jahre . . . . . . . . . . . . . . 133
Arnaldo di Benedetto
Literarischer Philhellenismus von Frauen: Angelica Palli und
Massimina Fantastici Rosellini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Helmut Pfotenhauer
Freiheit 1821: historisch und sthetisch
(Jean Paul, E.T.A. Hoffmann) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Diego Saglia
Tis Greece!: Byrons (Un)Making of Romantic Hellenism
and its European Reinventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Constanze Gthenke
Griechische Liebe. Philhellenismus und kulturelle Intimitt . . . 219
Gilbert Hess
Adelbert von Chamissos Griechendichtungen . . . . . . . . . . 235
Albert Meier
Fhlt, was Wahrheit ist und was Fiction.
Frst Hermann von Pckler-Muskaus Griechische Leiden . . . . . . 261
Marie-Ange Maillet
Auf Hellenen! Zu den Waffen alle!
Bemerkungen zur Rezeption der philhellenischen Gedichte
Ludwigs I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
III. Philologische Annherungen
Chryssoula Kambas
Das griechische Volkslied Charos in Goethes Version und
sein Bild des neuen Griechenland. Mit einem Ausblick
auf die Haxthausen-Manoussis-Sammlung . . . . . . . . . . . . 299
Inhalt VII
Sandrine Maufroy
Die Stimme des griechischen Volkes: Sammlungen
neugriechischer Volkslieder in Deutschland und Frankreich . . . 329
Abbildungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Sachregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
VIII Inhalt
Vorwort IX
Vorwort
Der vorliegende Band erffnet eine neue Reihe, die unter dem Titel
Klassizistisch-romantische Kunst(t)rume. Imaginationen im Europa
des 19. Jahrhunderts und ihr Beitrag zur kulturellen Identittsfindung
firmiert. Ziel dieser Reihe ist es, ikonische Momente kultureller Deu-
tungszuschreibungen im Europa des ausgehenden 18. und beginnenden
19. Jahrhunderts zu analysieren und ihre Rolle fr die Ausprgung so-
wohl nationaler Identitten als auch eines gesamteuropischen Bewut-
seins auszuloten. Im Zentrum stehen hierbei jeweils weniger die zugrun-
deliegenden historischen Prozesse als vielmehr sthetisch-knstlerische
Strategien und Deutungsprozesse dieser Sattelzeit,
1
welche die unter-
schiedlichen Ausprgungen der nationalen wie europischen Identitts-
findung begnstigten. Imaginationen eines anderen, besseren, knst-
lerisch erhhten Lebens so die zugrundeliegende These initiierten
Prozesse der eigenen Verortung, die ihrerseits zwischen sthetisierter
Realitt und imaginiertem Ideal angesiedelt sein konnten. So knnen
u. a. die Phnomene des Philhellenismus, des Raffaelkults und des
Orientalismus als gesamteuropische Phantasmen mit je eigenen, natio-
nalen Ausprgungen interpretiert werden, die im Oszillieren zwischen
Alteritt und Identitt je unterschiedliche, zum Teil sich berschnei-
dende Kulturmodelle implizierten und an der Genese der europischen
Moderne mageblichen Anteil hatten. Der vorliegende erste Band wid-
met sich den Prozessen der Deutungszuschreibung, die im Zuge des
Philhellenismus erfolgten. Weitere Bnde zum Raffaelkult und Orienta-
lismus werden folgen.
Sptestens seit Winckelmanns und Vo Studien bildet die klassische
griechische Kunst ein Muster, dessen postulierte Vorbildlichkeit auch
auf die Kunst der Gegenwart bertragen werden sollte. Das antike Grie-
1
Zum Begriff der Sattelzeit s. Koselleck, Reinhard: Das 18. Jahrhundert als Beginn
der Neuzeit, in: Reinhart Herzog (Hrsg.): Epochenschwelle und Epochenbewutsein.
Poetik und Hermeneutik XII. Mnchen 1987, S. 269283, sowie Ders.: ,Neuzeit.
Zur Semantik moderner Bewegungsbegriffe, in: Reinhart Koselleck (Hrsg.): In-
dustrielle Welt XX: Studien zum Beginn der modernen Welt. Stuttgart 1977, S. 264300.
X Vorwort
chenland galt zugleich als vorbildlich und unnachahmlich, vergan-
gen und gegenwrtig. Im Rahmen dieses produktiven Spannungsver-
hltnisses wurde ,Griechenland als Paradigma entworfen, das eine neue
Orientierung ermglichte. Der europische Klassizismus mit seiner Ori-
entierung an den Idealen der griechischen Antike und der Sympathie
Westeuropas fr die unterdrckten Christen lie zunehmend das Gefhl
einer kulturellen Verpflichtung fr die modernen Griechen entstehen,
sich als Erben von Kultur und Sprache der Antike zu definieren. Der aus
dieser Affinitt erwachsene Klassizismus prgte die Kunst und die archi-
tektonische Formensprache von Metropolen wie Paris, Berlin, Mnchen,
London, St. Petersburg, aber auch der Stdte in der Provinz.
2
In An-
knpfung an Schillers sthetik wurde der Nachahmung des klassischen
Griechenlands insbesondere in den deutschen Territorien zugleich
eine pdagogische Wirkung zugesprochen, die ein Modell des klassisch
inspirierten Kulturstaates zu begrnden half.
3
Dieses Modell, das seinen
deutlichsten Ausdruck im preuischen Schulwesen fand (Humboldt-
Svernsche Reformen, 1812)
4
und in der Literatur und bildenden Kunst
vermittelt wurde,
5
verband sich mit einem ebenfalls bei Schiller deut-
lich formulierten Ideal der Freiheit.
6
Die drei Topoi Griechische An-
tike, Kunst und Freiheit verschmolzen somit zu einer imaginren
Einheit, die geradezu divinatorische Zge annehmen konnte.
7
2
Als Beispiel dieser ubiquitren Antikenrezeption im Bereich der Architektur
kann paradigmatisch die Rezeption der Athener Karyatiden gelten. S. hierzu
Schweizer, Stefan: Epocheimaginationen: Sinnbilder der Antike. Die Rezeptions-
geschichte der Athener Korenhalle, in: Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft 2/2002,
S. 747750. S. ferner Tsigakou, Fani-Maria: The Rediscovery of Greece: Travellers and
Painters of the Romantic Era, introd. by Sir Steven Runciman. London 1981.
3
S. hierzu z. B. von Humboldt, Wilhelm: ber den Charakter der Griechen, die
idealische und historische Ansicht desselben, in: Wilhelm von Humboldt:
Werke in fnf Bnden. Schriften zur Altertumskunde und sthetik; die Vasken, Bd. II.
Hrsg. v. Andreas Flitner u. Klaus Giel. Darmstadt
4
1986, S. 6572.
4
Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 18001866. Bd. 1: Brgerwelt und starker
Staat. Mnchen 1989, S. 5762.
5
Gourgouris, Statis: Dream Nation: Enlightment, Colonization and the Institiution of
modern Greece. Stanford 1996.
6
S. Vick, Brian: Greek Origins and Organic Metaphors: Ideals of Cultural Auto-
nomy in Neohumanist Germany from Winckelmann to Curtius, in: Journal of the
History of Ideas 63/2002, 3, S. 483500.
7
Zur Verbindung der Begriffe ,Natur, ,Freiheit ,Geschichte und ,Griechenland
bei Schiller s. Meier, Albert: Der Grieche, die Natur und die Geschichte. Ein
Motivzusammenhang in Schillers Briefen ber die sthetische Erziehung und
Vorwort XI
Im Umfeld des griechischen Freiheitskampfes verband sich dieses s-
thetische Ideal zugleich mit einer virulent politischen, auf das zeitgens-
sische Griechenland und die Gegenwart ausgerichteten Dimension. Der
1821 ausbrechende Aufstand gegen die Osmanen schrte nicht zuletzt
die Hoffnung, ein aus antikem Geist erwachsenes, neues und freies Grie-
chenland als europischen Modellstaat errichten zu knnen.
8
Seine Dy-
namik verdankte der nun voll zur Entfaltung kommende Philhellenis-
mus insbesondere der Tatsache, da der Kampf der Griechen gegen die
Trken im Schnittpunkt unterschiedlicher Diskurse lag, wodurch die Er-
eignisse in gleicher Weise als Glaubenskrieg des Christentums gegen den
Islam, als Aufbegehren eines unterdrckten Volkes gegen die Obrigkeit
(und damit als Projektionsflche demokratischer Wunschvorstellungen
im brgerlichen Vormrz) sowie als vermeintliche Renaissance eines an-
tiken Idealzustands gesehen werden konnten.
9
Die Verbindung klassizi-
stischer und romantischer Ideale kam dieser Bewegung ebenso zugute
wie die zeitnahe Popularisierung durch den gezielten Einsatz unter-
schiedlicher Medien.
10
Zudem trug insbesondere die Aktivitt des ent-
stehenden (meist brgerlichen) Vereinswesens wesentlich zu ihrer stnde-
und schichtenbergreifenden Wirksamkeit bei und ermglichte eine
bislang ungekannte Massenmobilisierung,
11
die in einer einzigartigen,
ber naive und sentimentalische Dichtung, in: Jahrbuch der Deutschen Schiller-
gesellschaft 29/1985, S. 113124.
8
S. hierzu Kramer, Dieter: Der Philhellenismus und die Entwicklung des politi-
schen Bewutseins in Deutschland, in: Hans Friedrich Foltin u. a. (Hrsg.): Kon-
takte und Grenzen. Probleme der Volks-, Kultur- und Sozialforschung. FS fr Gerhard
Heilfurth. Gttingen 1969, S. 233247.
9
Diese Vermengung unterschiedlicher Interessenlagen im Zeichen des Philhelle-
nismus wurde auch von Zeitgenossen reflektiert. So schreibt z. B. Jacob Sendtner:
Alle Parteien vereinigen sich in dem Interesse fr die Griechen. Die Frommen
werden von der Religion, die Gebildeten von den klassischen Erinnerungen, die
Liberalen von der Hoffnung auf altgriechische Republiken als Vorlufer und
Pflanzschule der knftigen allgemeinen Demokratisierung, Republikanisierung
Europas [] bewegt. N.N. [Sendtner, Jacob]: Bonaparte und Londonderry. Ein Ge-
sprch im Reiche der Todten. Mnchen 1822, S. 12.
10
Zur Rolle der Presse s. z. B. den Sammelband von Konstantinou, Evangelos
(Hrsg.): Europischer Philhellenismus. Die europische Presse bis zur ersten Hlfte des
19. Jahrhunderts. Frankfurt a.M. u. a. 1994, sowie Breil, Michaela: Die Augsburger
,Allgemeine Zeitung und die Pressepolitik Bayerns. Ein Verlagsunternehmen zwischen
1815 und 1848. Tbingen 1996. Zum Einsatz der Medien allgemein s. Erler, Curt:
Der Philhellenismus in Deutschland 18211829. Ein Beitrag zur Geschichte der ffentli-
chen Meinung im 19. Jahrhundert. Diss. Leipzig, Lucka 1906, S. 2638.
11
S. hierzu Ssemann, Bernd: Annherungen an Hellas: Philhellenismus und Deutsch-
XII Vorwort
kaum zu berblickenden Flut literarischer und knstlerischer Erzeug-
nisse ihren Niederschlag bis in den Bereich der Alltagskultur fand.
12
Ar-
rivierte Schriftsteller konnten in diesem Umfeld ebenso ttig werden wie
bislang unbekannte Dilettanten, von der Literaturproduktion normaler-
weise weitgehend ausgeschlossene Teile der Gesellschaft wie Frauen und
Hochadelige zu viel gelesenen Autoren avancieren. Kunstwerke, die
den griechischen Freiheitskampf thematisierten, konnten den Status
von Ikonen erlangen,
13
musikalische Bearbeitungen in Form von Wal-
Griechische Gesellschaften in Berlin. Festschrift zum 75-jhrigen Bestehen der
Deutsch-Griechischen Gesellschaft Berlin e.V. 2 Bde. Berlin 1994; Hauser,
Christoph: Anfnge brgerlicher Organisation: Philhellenismus und Frhliberalismus in
Sdwestdeutschland. Diss. Freiburg 1988. Gttingen 1990; Kramer, Dieter: Der
Philhellenismus und die Entwicklung des politischen Bewutseins.
12
Trotz zahlreicher Forschungen der letzten Jahre bildet das Gebiet des Philhelle-
nismus auf knstlerisch-literarischem Gebiet nach wie vor ein wichtiges For-
schungsdesiderat. Fr den deutschen Raum bietet die Studie von Arnold, Robert
F.: Der deutsche Philhellenismus. Kultur- und literarhistorische Untersuchun-
gen, in: Euphorion, Ergnzungsheft 2/1896, S. 71181 nach wie vor die umfassend-
ste Zusammenstellung. Zum amerikanischen Raum s. Raizis, Marios Byron/Pa-
pas, Alexander (Hrsg.): American poets and the greek revolution 18211828. A study in
Byronic philhellenism. Saloniki 1971; Dies.: Greek Revolution and the American Muse:
Collection of Philhellenic Poetry, 182128. Thessaloniki 1972, sowie Dakin, Douglas:
British and American Philhellenes during the war of Greek independence, 18211833. Sa-
loniki 1955; fr Italien. Di Benedetto, Arnaldo: Motivi filellenici nella lettera-
tura italiana del sec. XIX, in: Ders. (Hrsg.): Tra sette e Ottocento, Poesia, letteratura e
politica. Allessandria 1991; Ders.: ,Le rovine dAtene: Letteratura filellenica in
Italia fra Sette e Ottocento, in: Italica 76/1999, S. 335354; Puppo, Mario: Lel-
lenismo dei romantici, in: Ders. (Hrsg.): Poetica e critica del romanticismo. Mailand
1973, S. 189202, sowie die Akten des Athener Kongresses von 1985: Indipendenza
e unit nazionale in Italia ed in Grecia. Florenz 1987; fr Frankreich: Espagne, Mi-
chel (Hrsg.): Revue Germanique Internationale 12/2005: Philhellnismes et transferts
culturels dans lEurope du XIX
e
sicle. Paris 2005; Dimakis, Jean: La presse franaise
face la chute de Missolonghi et la bataille navale de Navarin. Recherches sur les sources
du philhellnism franais. Salloniki 1976 sowie Canat, Ren: LHellnisme des Roman-
tiques. 3 Bde.: Bd. 1: La Grce retrouve, Bd. 2: Le romantisme des Grecs, Bd. 3: Lveil
du Parnasse. Paris 19511955. Einen allgemeinen berblick ber den Philhellenis-
mus in der europischen Literatur bietet Noe, Alfred (Hrsg.): Der Philhellenismus in
der westeuropischen Literatur 17801830. Amsterdam, Atlanta 1994.
Die Bibliographie von Droulia, Loukia: Ouvrages inspirs par la guerre de lindpen-
dance grecque 18211833. Rpertoire bibliographique. Athen 1974, bedarf dringend ei-
ner Ergnzung. Eine ntzliche Datenbank als Zugang zu Primrtexten und zur
Forschungsliteratur mit dem Fokus auf die deutschsprachigen Texte wird von der
Griechisch-Deutschen Initiative in Wrzburg aufgebaut: http://www.europa-zen-
trum-wuerzburg.de/(Aufruf: 01. 05. 2009).
13
S. z. B. Athanassoglu-Kallmyer, Nina M.: French images from the Greek War of Inde-
Vorwort XIII
zern, Opern und Singspielen fanden ein Massenpublikum,
14
Tafelge-
schirr und Spielkarten trugen die Konterfeis griechischer Freiheitshel-
den.
15
In Theater, Kunst und Literatur wurden die Ideale der insurgenten
Griechen verhandelt.
16
Sammlungen zum besten der Griechen wurden
in ganz Europa eingetrieben, um sowohl Hilfsfonds fr die griechischen
Witwen und Waisen einzurichten als auch Untersttzungstruppen Frei-
williger zu finanzieren. Die allgegenwrtige Griechenbegeisterung stei-
gerte sich zu einer Graecomanie, die bereits von manchem Zeitgenossen
als Tyrannei Griechenlands empfunden wurde.
17
Die Orientierung an der griechischen Antike diente einerseits in Ab-
grenzung zum rmischen Altertum als wichtiges Instrument einer im
Entstehen begriffenen, in den deutschen Staaten nicht zuletzt antifran-
zsisch ausgerichteten deutsch-nationalen Bewegung.
18
Das Konzept ei-
pendence (18211830). Art and politics under the Restoration. New Haven u. a. 1989,
sowie den Ausstellungskatalog: La Grce en rvolte. Delacroix et les peintres franais,
18151848. Paris 1996.
14
Als Beispiele der breiten Musikproduktion seien genannt: Rossinis Le sige de Corin-
the auf das Libretto von Louis Soumet nach Byrons The siege of Corinth (1816), Hector
Berlioz La rvolution grecque. Pome lyrique 1822, Beethovens Ruinen von Athen (1811)
als musikalische Umrahmung zu August von Kotzebues gleichnamigem Einakter
von 1812 und die zahlreichen Ypsilanti-Walzer, meist unbekannter Tonknstler.
15
S. hierzu die zahlreichen Beispiele im Ausstellungskatalog ototj ot I0vo-
oytj Itotrio tj Iooo (Hrsg.): Ao rqv oqoto/or|o orov qt/r//q-
vtoo. Athen 2005, S. 5587.
16
S. hierzu exemplarisch Puchner, Walter: Die griechische Revolution von 1821
auf dem deutschen Theater. Ein Kapitel brgerlicher Trivialdramatik und roman-
tisch-exotischer Melodramatik im deutschen Vormrz, in: Sdost-Forschungen. In-
ternationale Zeitschrift fr Geschichte, Kultur und Landeskunde Sdosteuropas 55/1996,
S. 85127.
17
Marchand, Suzanne: Down from Olympus: Archaeology and Philhellenism in Ger-
many, 17501970. Princeton 1996, S. XVIIIf., sowie S. 2435. Das Zitat stammt
von Butler, E. May: The Tyranny of Greece over Germany. London 1936.
18
Zu den komplexen Wechselbeziehungen zwischen Frankreich und Deutschland
bei der Konstruktion eines Griechenlandbildes um 1800 s. Espagne, Michel:
Le philhellnisme entre philologie et politique. Un transfert franco-allemand,
in: Michel Espagne (Hrsg.): Revue Germanique Internationale 12/2005, S. 6176.
Zu den Spezifika des deutschen Philhellenismus s. Landfester, Manfred: Grie-
chen und Deutsche: Der Mythos einer ,Wahlverwandtschaft , in: Helmut Ber-
ding (Hrsg.): Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewutseins in der Neuzeit. Frank-
furt a.M. 1996, S. 198219; Stauf, Renate: Germanenmythos und Griechenmythos
als nationale Identittsmythen bei Mser und Winckelmann, in: Rainer Wie-
gels/Winfried Woesler (Hrsg.): Arminius und die Varussschlacht: Geschichte My-
thos Literatur. Paderborn 1995, S. 309326; Marchand, Suzanne: Down from
Olympus, sowie Conter, Claude D.: Jenseits der Nation das vergessene Europa des
XIV Vorwort
ner nationalen Identifikation hatte jedoch in den europischen Lndern
unterschiedliche Facetten: In den italienischen Gebieten drngte sich
zur Zeit des Risorgimento eher eine grundlegende Analogiedeutung der
griechischen und italienischen Freiheitsbestrebungen auf, die sich im
oppositionellen Schrifttum durch die Formulierung nationaler Selbst-
bestimmungsansprche und historischer Visionen, deren Ideale der
Pragmatik politischer Interessen jedoch nicht standhalten konnten,
Raum verschaffte.
19
Wurde der Zustand der Unterjochung der Griechen
thematisiert, so geschah dies hier meist im Zuge einer stillschweigenden
bertragung auf die leidvolle Situation Italiens unter der sterreichi-
schen Herrschaft.
20
Griechenland bot sich zugleich als Bezugspunkt fr
die im Entstehen begriffene Nation an, deren bisherige, stndisch struk-
turierte Ordnungsstrukturen den revolutionren Umwlzungen zum
Opfer gefallen waren, weil die hier realisierte Verbindung von Mythos
und Geschichte Mglichkeiten der Konstruktion eines neuen, nationa-
len Schpfungsmythos versprach.
21
Wenn Franois Ren de Chateau-
19. Jahrhunderts. Inszenierungen und Visionen Europas in Literatur, Geschichte und Eu-
ropa. Bielefeld 2004, S. 426461.
19
Vgl. Di Benedetto: Motivi filellenici, sowie Kanduth, Erika: Philhellenismus in
der italienischen Literatur Lombardo-Venetiens, in: Alfred Noe (Hrsg.): Der Phil-
hellenismus in der westeuropischen Literatur 17801830. Amsterdam, Atlanta 1994,
S. 165188.
20
So stellt Salvo Mastellone fest: Spanien-Italien, Griechenland-Italien; Frank-
reich-Italien waren Binome, die sich nur auf ein einziges europisches Volk bezo-
gen, aber wenn jedes einzelne dieser Vlker eine moralische Mission zu erfllen
hatte (Guizot), galt es, diese Binome in einer europischen Vision miteinander in
Einklang zu bringen. Einen Schritt in Richtung der berwindung der einzelnen
Binome in einer europischen Perspektive ging Giuseppe Mazzini, der im April
1834 das Dokument des Jungen Europas vorlegte. (Mastellone, Salvo: Santorre
di Santarosa combattente per la Grecia, in: Indipendenza e unit nazionale in Italia
e in Grecia, a.a.O., S. 3541, bersetzung: E.A.).
21
Vgl. die berlegungen von Luigi Mascilli Migliorini: (Ciuffoletti, Zeffiro/Miglio-
rini, Luigi Mascilli: Il mito della Grecia in Italia tra politica e letteratura, in:
Indipendenza e unit nazionale in Italia e in Grecia, a.a.O., S. 52f.): Die Nation nm-
lich ist die Geschichte: das Vermchtnis der Zeit, das sich mit der Zeit berlagert,
zieht die einzig mglichen Grenzen einer Kollektivitt auf der Suche nach ihrer
eigenen Identitt. Auf diesem Boden ist die Begegnung zwischen Mythos und
Geschichte fruchtbringend und unvermeidbar, da beide, ihrem Wesen nach tief-
gehend, Geschichten rund um die Ursprnge einer Gemeinschaft sind. []
Nachdem die traditionellen kanonischen Formen erschpft sind und mit einem
sicheren Platz im aristokratischen Universum, erlangt auf persnlichem Wege (die
Genealogien) und durch die Verwendung besonderer evokativer Mittel (die He-
raldik, die Moral des Rittertums, die Epik), konstruiert sich die aus der Groen
Vorwort XV
briand 1809 in seinem Roman Les Martyrs schreibt, da ein griechischer
Held [] osa seul sopposer aux Romains, quand ce peuple libre ravit
la libert la Grce.
22
, dann wird damit zugleich die eigene Opposition
gegen die als tyrannisch empfundene Herrschaft Napoleons thematisiert
und letztlich eine ideologische Gleichsetzung Griechenlands mit Frank-
reich vollzogen.
Zugleich konnte der Aufstand der Griechen aber auch als vereinter
Kampf des christlichen, kulturell auf gemeinsamen (klassisch-griechi-
schen) Wurzeln basierenden Abendlandes gegen den im Osten behei-
mateten, islamisch dominierten Orient interpretiert werden. Gerade im
Umfeld romantischer Strmungen kam diesem Aspekt eine besondere
Bedeutung zu.
23
Dem Philhellenismus hafteten somit auch bereits
Kennzeichen eines bernationalen Bewutseins an,
24
das seine konkrete
Ausprgung einerseits in der Formierung einer Art europischer Solidar-
gemeinschaft fand
25
und insbesondere im Kulturtransfer (wie er sich ex-
emplarisch anhand der Wirkung von Byrons Schriften aufzeigen lt)
26
seinen Niederschlag findet.
Revolution hervorgegangene Welt inmitten ihres nationalen Kosmos ihre eigene
Entstehungsgeschichte. In diesem Zusammenhang wird eine Bezugnahme auf
Griechenland zur Pflicht, denn Griechenland ist nicht nur typischerweise das
Land der weit zurckliegenden westlichen Ursprnge, sondern dasjenige, welches
keinen Unterschied zwischen der mythischen und der geschichtlichen Erzhlung
vollzieht, wobei es beide in die schpferische Dimension der Landeskultur mit
einschliet. (bersetzung: E.A.)
22
Chateaubriand, Franois Ren de: uvres romanesques et voyages, Bd. II. Maurice
Regard (Hrsg.): Paris 1969, S. 156.
23
S. hierzu Peter, Klaus: Das Europa-Projekt der deutschen Romantik. Perspek-
tiven der Zukunft bei Friedrich Schlegel, Novalis und Franz Baader, in: Klaus
Peter (Hrsg.): Problemfeld Romantik. Aufstze zu einer spezifisch deutschen Vergangen-
heit. Heidelberg 2007, S. 89104.
24
Zum geistesgeschichtlichen Umfeld s. die Aufstze im Sammelband von von Bor-
mann, Alexander: Volk Nation Europa. Zur Romantisierung und Entromantisie-
rung politischer Begriffe. Wrzburg 1998.
25
S. zur Situation in Deutschland Brendel, Thomas: Zukunft Europa? Das Europabild
und die Idee der internationalen Solidaritt bei den deutschen Liberalen und Demokraten
des Vormrz (18151848). Bochum 2005, S. 169212.
26
Rosen, Fred: Bentham, Byron and Greece. Constitutionalism, Nationalism and Early
liberal political Thought. Oxford 1992; Roessel, David: In Byrons shadow: Modern
Greece in the English and American imagination. New York 2002, S. 7297. Vgl. ferner
He, Gilbert: Missolunghi. Gense, transformations multimdiales et fonctions
dun lieu identitaire du philhellnisme, in: Michel Espagne (Hrsg.): Revue Ger-
manique Internationale 12/2005: Philhellnismes et transferts culturels. Paris 2005,
S. 77107.
XVI Vorwort
Dieser Vielschichtigkeit des Philhellenismus mit seinen vielfltigen
berlagerungen und Brechungen versucht der vorliegende Band Rech-
nung zu tragen, indem er in drei Kapiteln den Fragen (I) der Antikenre-
zeption und der Ideolatrie, (II) Formen der Imagination Neugriechen-
lands und des griechischen Freiheitskampfes in Kunst und Literatur
sowie (III) Philologischen Annherungen nachgeht. Die hier versam-
melten Beitrge dokumentieren das Ergebnis einer trilateralen, deutsch-
italienisch-franzsischen Tagung, die im Dezember 2006 in der Villa Vi-
goni am Comer See stattfand. Ziel dieses interdisziplinr ausgerichteten
Symposions war es, die historischen, kulturellen, medialen und geogra-
phischen Bedingungen des Philhellenismus in seinen sthetisch-knstle-
rischen Ausprgungen zu analysieren und die vorherrschenden Deu-
tungsmuster, die dem klassisch-philologischen Neuhumanismus, der
christlich inspirierten Romantik und dem politischen Liberalismus ge-
schuldet sind, ebenso wie seine Rezeptionsgeschichte in den beteiligten
Lndern vergleichend zu untersuchen.
I. Antikenrezeption und Ideolatrie
Annherungen an ein Ideal
In seinem einfhrenden Beitrag geht Alain Schnapp den Wurzeln der
Antikenbegeisterung in Europa vom 16. Jahrhundert nach und verfolgt
Phasen der stufenweisen Aneignung der Antike bis ins 19. Jahrhundert.
Die im Italien der Renaissance entwickelten technischen Methoden der
antiquarischen Forschung, die dann durch Untersuchungen der Anti-
quare in Deutschland, Skandinavien und Grobritannien zunehmend
bereichert und verfeinert worden waren, trugen wesentlich dazu bei, den
Blick auf das alte Griechenland zu verndern. Fr die Entwicklung der
Archologie aus der Geographie und der Topographie zu einer positiven
Wissenschaft im Dienste des Nationalstaats, wie sie sich dann im
19. Jahrhundert etablieren konnte, spielte das Paradigma Griechenland
eine entscheidende Rolle.
Elisabeth Dcultot erlutert den Stellenwert, welchen die zum Ideal ver-
klrte griechische Kunst und Skulptur in Johann Joachim Winckel-
manns Kunstgeschichte einnimmt. Anhand von Winckelmanns Text,
der gleichsam als Grndungsakte der modernen Kunstgeschichte ver-
standen werden kann, lt sich das schwierige Verhltnis zur Antike, das
Winckelmann in den Gedanken ber die Nachahmung der griechi-
Vorwort XVII
schen Werke in der Malerey und Bildhauerkunst bereits formuliert
hatte, als Bildungsziel, sich auf dem Wege der Nachahmung der Grie-
chen selbst als ,Original zu schaffen, begreifen. Das Oszillieren zwi-
schen Originalitt und Rezeption, das bereits 1755 in Winckelmanns be-
rhmten Satz: Der einzige Weg fr uns, gro, ja, wenn es mglich ist,
unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten formuliert
wurde, bestimmt auch die folgende produktive Rezeption der Klassik
und des Klassizismus, wie sie beispielhaft in der Polychromiedebatte,
die Kerstin Schwedes untersucht, zutage tritt. Die zeitgenssische Diskus-
sion, die insbesondere in kunstkritischen Rezensionsorganen ausgetra-
gen wurde, lt bereits anhand der rhetorischen Schrfe, mit der um den
Gegenstand gerungen wurde, erkennen, welches Gewicht dieser Frage
beigemessen wurde. Vorstellungen zur Polychromie antiker Plastik bil-
den das Scharnier zwischen einem zum Vorbild deklarierten Antiken-
ideal und der damals aktuellen Kritik der Gegenwartskunst. Zugleich
verdeutlicht Schwedes, welcher Stellenwert der Polychromiedebatte
nicht zuletzt im Rahmen der Popularisierung antiker Kunst zur Massen-
ware zukommen konnte.
Da die Rezeption der griechischen Antike im Zeichen des Philhelle-
nismus nicht notgedrungen mittels konkreter Nachahmung antiker Vor-
bilder realisiert werden mu, sondern in der Aneignung grundlegender
sthetischer Qualitten begrndet sein kann, weist Christian Scholl in sei-
nem Beitrag zu Karl Friedrich Schinkel nach. Nicht als Quelle archo-
logischer Detailforschung, wohl aber als Vorbild, bei dem die normbil-
denden Qualitten in einer anschaulichen Tektonik gefat waren, ma
Schinkel der klassischen Architektur der Griechen hchste Bedeutung
zu. Der Berliner Architekt sah bei den griechischen Baumeistern eine zur
Perfektion gebrachte Balance von Leichtigkeit und Tragfhigkeit, Ruhe
und Ma verwirklicht, die es fr die Moderne sthetisch zurckzugewin-
nen galt. Die dadurch zum Ausdruck kommende Stabilitt symbolisiert
zugleich ein Menschheitsideal, das er in seiner Architektur zu verwirk-
lichen suchte: Aufgabe der Architektur ist es demnach im wahrsten
Sinne des Wortes Freirume zu schaffen, die das Gefhl der Leichtigkeit
mit demjenigen der Sicherheit verbinden.
Da auch in der Literatur die Wiederentdeckung der griechischen
Antike nicht nur in unmittelbarer Auseinandersetzung mit konkreten
Artefakten erfolgen mu, sondern auch durch markante Motivkonstel-
lationen verarbeitet werden kann, verdeutlicht Gabriella Catalano an-
hand der Marmorgestalt in Stifters Nachsommer, die als Gipsabgu
ihrer eigentlichen Gestalt beraubt im Verlauf der Erzhlhandlung ihre
XVIII Vorwort
wahre, an die Antike erinnernde Gestalt wieder zu erlangen vermag. Der
Blick auf die griechische Kunst verweist hier einerseits auf die Kontinui-
tt der Menschheitsgeschichte, zugleich deutet er aber auch eine Dis-
kontinuitt an, die erst in einem sthetischen Proze mittels Rekon-
struktion beseitigt werden kann. Die im Roman realisierte Geschichte
der weien Marmorstatue und ihrer Rezeption symbolisiert damit den
Umstand, da die zum Ideal verklrte Welt der Griechen nur unter der
Bedingung einer medialen und musealisierten Aneignung wiedererlangt
werden kann.
II. Imaginationen des griechischen Freiheitskampfes
und Neugriechenlands
Mit den kriegerischen Auseinandersetzungen im griechischen Freiheits-
kampf befat sich Valerio Furneri, der die Situation der Freiwilligenexpe-
ditionen analysiert, die vom Westen meist von Marseille aus nach
Griechenland aufbrachen, um die insurgenten Griechen tatkrftig zu
untersttzen. Miverstndnisse zwischen den westeuropischen Unter-
sttzungscorps und den einheimischen Griechen waren nicht selten
durch schwrmerisch-romantisierende Imaginationen der Kriegsfreiwil-
ligen bedingt, die sich angesichts der von Hunger, Not und Desorgani-
sation geprgten Lage im nachhaltig als Fremde empfundenen zeitge-
nssischen Griechenland als realittsfremd erwiesen. Selbst gegenber
den Heimkehrerberichten, welche die desastrse Lage und die ernch-
ternden Erfahrungen schilderten, erwies sich das idealisierte Bild, das die
Rezeption bestimmte, als dominant.
Wie Ekaterini Kepetzis anhand franzsischer Gemlde nachweist,
entstanden im Kontext des griechischen Freiheitskampfes Bilder, die
sich mit einem bislang so nicht zu beobachtenden Appellcharakter
an die ffentlichkeit wandten. Diese Bilder markieren insofern den
Beginn einer neuen Phase in der Ikonographie des Krieges: Indem sie
meist die gewaltsam gestrte Idylle von Kleinfamilien und insofern
Projektionen westeuropischer bzw. franzsischer Familienstrukturen vor
Augen fhren, berbrcken sie Alterittserfahrungen und schaffen
Identifikationsrume, die zugleich in ihrer potentiellen Gefhrdung
durch Kriege und ihre Folgen vor Augen gestellt werden. Einblicke
in die dem eigenen Umfeld vergleichbare, durch die Barbarei eines
Brgerkriegs jedoch gestrte husliche Intimsphre sollten die Re-
Vorwort XIX
zipienten zum solidarischen Handeln fr die aufstndischen Griechen
bewegen.
Arnaldo Di Benedetto untersucht in seinem Beitrag den Stellenwert,
den der Philhellenismus im Werk der Autorinnen Angelica Palli und
Massimina Fantastici Rosellini einnimmt. Im Gegensatz zu Alessandro
Manzoni, der sich in seinem Werk trotz seiner Freundschaften zum
Intellektuellenzirkel um Andrea Mustoxidi und zu Claude-Charles Fau-
riel (der in Manzonis Villa von Brusuglio das Vorwort zu den Chants
populaires de la Grce moderne verfate) nie ffentlich zum griechischen
Freiheitskampf uerte, lassen die Schriften der beiden Autorinnen
deutliche Einflsse philhellenisch geprgter und von Exilgriechen be-
einfluter Intellektuellenkreise in Livorno und Florenz erkennen. Wh-
rend Pallis Schriften den Antagonismus zwischen Griechen und Trken
hervorheben, scheint das auf intensiven Quellenstudien basierende hi-
storische Drama I Pargi von Rosellini formal wie auf der Handlungs-
ebene strker durch Lord Byrons Werke beeinflut zu sein.
Helmut Pfotenhauer weist anhand der Erzhlung Gesichte einer grie-
chischen Mutter von Jean Paul und E.T.A. Hoffmanns Text Die Irrun-
gen. Fragmente aus dem Leben eines Fantasten nach, wie das in den
20er Jahren des 19. Jahrhunderts ubiquitre Thema des Philhellenismus
sein sthetisches Potential entfalten konnte: Die erhoffte Befreiung
Griechenlands von der osmanischen Vorherrschaft entfesselte die
romantische Einbildungskraft. Letztlich gab damit die unter dem Zei-
chen der Autonomie agierende Literatur und bildende Kunst sthetische
Antworten auf die in der geschichtlichen Realitt gestellte Frage nach
der Freiheit: Neben satirisch-kritischen, politisch-propagandistischen,
affirmativen und humoristisch-reflexiven Verarbeitungen des griechi-
schen Aufstands lassen sich spezifisch sthetisch-metaphysische Heran-
gehensweisen erkennen, die den Tod im Freiheitskampf letztlich als Er-
hebung ber die Beschrnkungen des Diesseitigen im Jenseits, des
Krperlichen im bersinnlichen interpretieren, die mit der Erhebung
der Griechen gegen die Tyrannei korrespondieren.
Diego Saglia rekonstruiert die Genese Griechenlands in Byrons Werk
als eine romantische Imagination, die erst durch den Einsatz des sich als
kmpfenden Dichters gerierenden Lord Byron popularisiert werden
konnte. Dabei schuf der britische Dichter widersprchliche Figuratio-
nen Griechenlands, die zwischen der Hoffnung auf eine Verwest-
lichung einerseits, zugleich aber der Ablehnung dieser Sehnsucht als
nicht-authentisch (weil den Vorstellungen eines Orientalismus zuwider-
laufend) anzusiedeln sind. Byrons wirkmchtiges Griechenlandbild lt
XX Vorwort
sich damit als paradoxes Changieren zwischen Alteritts- und Identitts-
konstrukten begreifen, welche der romantischen Sehnsucht, Griechen-
land als sthetisch gebrochenem Vexierbild prsentische Realitt zu be-
schreiben, Ausdruck verschafften.
Auch Constanze Gthenke zeichnet literarische Reprsentationsstra-
tegien nach, die durch das Prinzip der erstrebten und unerfllten Nhe
realisiert werden. Anhand der Analyse von Texten Byrons und Waib-
lingers bestimmt die Autorin den literarischen Philhellenismus als
gendercodierten Diskurs von Emotionalitt und Intimitt, in dem die
personifizierte Hellas als attraktives und begehrtes, letztendlich aber
unerreichbares Objekt des Begehrens visualisiert wird, dem hufig
auch Merkmale des Morbiden anhaften. Das Prinzip der Sympathie als
Grundannahme unerfllter Liebe ermglicht hierbei einerseits konkret
einen Rollentausch, so da z. B. bei Waiblinger Griechinnen nicht nur
als Objekt der Begierde, sondern auch als Begehrende imaginiert wer-
den knnen. Andererseits lt sich unter diesem Aspekt das Schlag-
wort von der Geistes- oder Seelenverwandtschaft mit Griechenland
als Teil eines empfindsamen und romantischen Diskurses von Intimi-
tt lesen, der es ermglicht, das zeitgenssische moderne Hellas mit
Reprsentationen Griechenlands als Hort klassischer Vergangenheit zu
verbinden.
Gilbert He stellt anhand der Griechendichtungen Adelbert von Cha-
missos die Abhngigkeit philhellenischer Dichtung von den Bedingun-
gen des sich etablierenden literarischen Zeitschriftenmarktes dar. So las-
sen sich in Chamissos Griechengedichten bewute Wirkungsstrategien
erkennen, die durch Verwendung formelhafter Wendungen das Gesche-
hen an zeitgenssische Moden wie die Schauerromantik anschlufhig
machen. Identifikations- und Alterisierungeffekte wie philhellenische
Orient-Topoi, kulturell-religise Oppositionsbeziehungen und Gender-
konfigurationen imaginieren mit zum Teil uerst drastischen Bil-
dern einen apokalyptischen Kampf zwischen Gut und Bse. Die Grie-
chenlyrik erscheint in diesem Licht nicht nur als exemplarischer Fall
moderner Popularisierung von Literatur, sondern zeigt zugleich, da die
sthetisierung und literarische Imagination des griechischen Befreiungs-
krieges auch als Element des Kriegs um die ffentlichkeit zu verste-
hen ist.
Pckler-Muskaus Text Griechische Leiden, der im Rahmen des drei-
teiligen Sdstlichen Bildersaals 1840/41 erschien, konterkariert, wie
Albert Meier nachweist, die konventionalisierte Griechenland-Deutung
winckelmannscher Prgung. Indem Griechenland nicht an seiner gro-
Vorwort XXI
en Vergangenheit, sondern an seiner Gegenwart gemessen wird, in
der das Pathos klassischer Ideale lngst den trivialeren Realitten eines
Vlkergemischs Platz gemacht hat, wird hier der Klassik-Topos griechi-
scher Heiterkeit im Kleid einer fiktionalisierten Reisebeschreibung
ad absurdum gefhrt. Die Reise durch das zeitgenssische Griechenland
erscheint damit als philhellenischer Alptraum, in dem Ungemtlichkeit
und Klte als Inbegriff neugriechischen Lebensgefhls gegen die litera-
rischen Illusionen ausgespielt wird. Andererseits lt der Text durch sei-
nen offensichtlichen Appellcharakter gegenber den europischen Staa-
ten, Neugriechenland durch finanzielle Untersttzung und mavolle
Einflunahme gleichsam zu re-europisieren, erkennen, da Grie-
chenland in Zukunft eine zugedachte Rolle als Bindeglied zwischen Ori-
ent und Okzident erfllen knnte.
Marie-Ange Maillet weist anhand der Griechengedichte des bayeri-
schen Monarchen Ludwig I. nach, da die Thematik des Philhellenis-
mus auch bewut zur Inszenierung des eigenen Images genutzt werden
konnte. So scheint die nachtrgliche Verffentlichung der whrend des
Befreiungskampfes entstandenen Lyrik dem bewuten Kalkl entsprun-
gen zu sein, sich zum Zeitpunkt des Machtantritts als Brgerknig zu
gerieren, der von dem traurigen Schicksal der Griechen berhrt wird. So
autokratisch und religis er auch sein mochte, durch sein ffentliches
Engagement fr den griechischen Befreiungskampf konnten zugleich
liberale Neigungen kenntlich gemacht werden, die ihn als Befrworter
des nationalstaatlichen Gedankens erscheinen lieen. Die Betonung
von Parallelen zwischen dem Geschehen in Griechenland und den
Deutschen Befreiungskriegen dienten dabei ebenso wie der Verweis auf
den Gegensatz zwischen Rom und Griechenland ferner der Akzentuie-
rung des Antagonismus zwischen Deutschland und dem franzsischen
Kaiserreich, wodurch zugleich eine Distanznahme zur francophilen
Regierung unter seinem Vater und Vorgnger, Maximilian I. Joseph mar-
kiert wurde. Auch die in den Gedichten deutlich zum Ausdruck ge-
brachte tiefe Religiositt kam dem Bedrfnis, sich von der Politik seines
Vaters abzusetzen, entgegen. Die Rezeption, die meist wohlwollend
ber die qualitativen Mngel hinwegsah, lie sich jedoch nicht gnzlich
steuern: Whrend Vertreter liberaler Kreise den sthetischen Philhelle-
nismus des Monarchen akzentuierten und die politische Komponente,
die als Gefhrdung der Ruhe und Ordnung htte interpretiert werden
knnen, weitgehend ausblendeten, betonten oppositionell-katholische
Vertreter die grundstzliche Gefhrdung des europischen Staatensystems,
wobei sie den Monarchen von dieser Kritik jedoch ausnahmen, indem
XXII Vorwort
sie dessen Philhellenismus ausschlielich auf religise Motive als Ver-
teidigung des christlichen Glaubens gegen die drohende islamische Vor-
machtstellung zurckfhrten.
III. Philologische Annherungen
Chryssoula Kambas untersucht Goethes Vermittlungsttigkeit neugriechi-
scher Volkspoesie hinsichtlich mglicher kulturpolitischer Intentionen.
So lt sich die Aufnahme von sechs Klephtenliedern in die Sammlung
ber Kunst und Alterthum (1822) weniger als bewuter Akt philhelle-
nischer Gesinnung erklren, sondern vielmehr als Versuch, im Rahmen
eines weitergefaten kulturpolitischen Programms das Publikum im
Sinne seiner Vorstellung von Volkspoesie mit unterschiedlichen Volks-
charakteren u. a. auch dem neugriechischen anhand exemplarischer
Dichtung vertraut zu machen. Eine detaillierte Analyse von Goethes
bertragung des Charos-Liedes lt seine kulturpolitische Einstellung
als gemigt philhellenisch erscheinen: Einerseits zeigt sie den Ver-
such, das neue Griechenland im Sinne einer zeitgenssischen und frem-
den Kultur zu vermitteln. So erscheint die in der Figur des Charos per-
sonifizierte Todesvorstellung im Spannungsverhltnis zwischen antiken
im Namen assoziativ vorhandenen Jenseitsvorstellungen und dem
tropischen Sprechen vom Tod angesiedelt. Die bersetzung lt sich
zugleich im Sinne einer Kulturhermeneutik als Akt der Annherung an
die neugriechische Kultur begreifen, wobei die Vermittlung des griechi-
schen Volksliedes in deutscher Sprache im Sinne des Weltliteratur-Pro-
jekts zugleich die Fhrungsrolle des Deutschen als internationale Bil-
dungs- und Dichtungssprache betonen sollte.
Die Sammelttigkeit griechischer Volkslieder in Frankreich und
Deutschland lt sich also, wie auch Sandrine Maufroy darlegt, als ein
komplexer Vorgang interkultureller Transfers beschreiben, der nicht zu-
letzt der Rehabilitation der zeitgenssischen Griechen gegenber ihren
antiken Vorfahren und der Vermittlung von Kenntnissen ber die neu-
griechische Kultur dienen sollte. Fauriels neugriechische Volkslied-
sammlung mit seinen Paratexten fungierte hierbei als eine Art Basistext,
der in vielfachen bersetzungen kursierte und sowohl die Grundlage
fr deutsche und franzsische Nachdichtungen bildete, als auch eine
breite Diskussion ber die philologischen Grundlagen neugriechischer
Texteditionen initiierte, die schlielich in der Erarbeitung zahlreicher
Folge- und Konkurrenzeditionen ihren Ausdruck fand. Die Tatsache, da
Vorwort XXIII
bis in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts ausschlielich deutsche Neu-
editionen entstanden, whrend Fauriels Sammlung in Frankreich (bis auf
eine Ausnahme) unhinterfragt neu ediert wurde, lt sich so Maufroy
zugleich als Ausdruck einer in den Paratexten auch deutlich zum Aus-
druck kommenden Konkurrenzsituation zwischen der deutschen und
der franzsischen Literatur- und Wissenschaftslandschaft begreifen, die
im Zeichen eines nationalen Antagonismus das Mittel der Edition neu-
griechischer Volkspoesie nicht zuletzt dazu instrumentalisierte, um sich
vom jeweils anderen literarisch-wissenschaftlichen Modell zu distanzie-
ren und die berlegenheit der eigenen Methoden zu demonstrieren.
Den Verfasserinnen und Verfassern gilt unser Dank fr die erfreuliche
und produktive Zusammenarbeit, die bereits whrend der Tagung in
Form von lebhaften, stets zielfhrenden Diskussionen Gestalt annahm.
Der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Villa Vigoni und der Mai-
son des Sciences de lHomme gilt unser herzlicher Dank fr die gro-
zgige Untersttzung der Tagung. Fr die Hilfe bei der Texteinrichtung
danken wir Katja Zawadzki. Unser besonderer Dank gilt ferner Julia
Glasow fr die mhevolle Erstellung der Register. Last but not least
danken wir dem Verlag de Gruyter und insbesondere dem geduldigen
Cheflektor fr den Bereich Sprachwissenschaften, Heiko Hartmann
fr die Mglichkeit eine eigene, klassizistisch-romantischen Kunst(t)ru-
men gewidmete Reihe zu grnden.
Gttingen / Bergamo / Paris im Mai 2009 Gilbert He
Elena Agazzi
Elisabeth Dcultot
Literaturverzeichnis
Quellen
N.N.: [Sendtner, Jacob]: Bonaparte und Londonderry. Ein Gesprch im Reiche der Todten.
Mnchen 1822.
Chateaubriand, Franois Ren de: uvres romanesques et voyages, in: Maurice
Regard (Hrsg.): Bd. II. Paris 1969.
von Humboldt, Wilhelm: ber den Charakter der Griechen, die idealische und hi-
storische Ansicht desselben, in: Wilhelm von Humboldt: Werke in fnf Bnden.
Schriften zur Altertumskunde und sthetik; die Vasken, Bd. II. Andreas Flitner/Klaus
Giel (Hrsg.): Darmstadt 1986, S. 6572.
XXIV Vorwort
Forschungsliteratur
Arnold, Robert F.: Der deutsche Philhellenismus. Kultur- und literarhistorische Un-
tersuchungen, in: Euphorion, Ergnzungsheft 2/1896, S. 71181.
Athanassoglu-Kallmyer, Nina M.: French images from the Greek War of Independence
(18211830). Art and politics under the Restoration. New Haven u. a. 1989.
Von Bormann, Alexander: Volk Nation Europa. Zur Romantisierung und Entroman-
tisierung politischer Begriffe. Wrzburg 1998.
Breil, Michaela: Die Augsburger ,Allgemeine Zeitung und die Pressepolitik Bayerns. Ein
Verlagsunternehmen zwischen 1815 und 1848. Tbingen 1996.
Brendel, Thomas: Zukunft Europa? Das Europabild und die Idee der internationalen Soli-
daritt bei den deutschen Liberalen und Demokraten des Vormrz (18151848). Bochum
2005.
Butler, E. May: The Tyranny of Greece over Germany. London 1936.
Canat, Ren: LHellnisme des Romantiques. 3 Bde.: Bd. 1: La Grce retrouve, Bd. 2: Le
romantisme des Grecs, Bd. 3: Lveil du Parnasse. Paris 19511955.
Conter, Claude D.: Jenseits der Nation das vergessene Europa des 19. Jahrhunderts.
Inszenierungen und Visionen Europas in Literatur, Geschichte und Europa. Bielefeld
2004.
Dakin, Douglas: British and American Philhellenes during the war of Greek independence,
18211833. Saloniki 1955.
Di Benedetto, Arnaldo: Motivi filellenici nella letteratura italiana del sec. XIX,
in: Ders. (Hrsg.): Tra sette e Ottocento, Poesia, letteratura e politica. Allessandria
1991.
: ,Le rovine dAtene: Letteratura filellenica in Italia fra Sette e Ottocento, in:
Italica, 76/1999, S. 335354.
Dimakis, Jean: La presse franaise face la chute de Missolonghi et la bataille navale de
Navarin. Recherches sur les sources du philhellnisme franais. Salloniki 1976.
Droulia, Loukia: Ouvrages inspirs par la guerre de lindpendance grecque 18211833.
Rpertoire bibliographique. Athen 1974.
Espagne, Michel (Hrsg.): Revue Germanique Internationale 12/2005: Philhellnismes
et transferts culturels dans lEurope du XIXe sicle. Paris 2005.
: Le philhellnisme entre philologie et politique. Un transfert franco-allemand,
in: Michel Espagne (Hrsg.): Revue Germanique Internationale 12/2005, S. 6176.
Gourgouris, Statis: Dream Nation: Enlightenment, Colonization and the Institution of
Modern Greece. Stanford 1996.
Hauser, Christoph: Anfnge brgerlicher Organisation: Philhellenismus und Frhliberalis-
mus in Sdwestdeutschland. Diss. Freiburg 1988. Gttingen 1990.
He, Gilbert: Missolunghi. Gense, transformations multimdiales et fonctions
dun lieu identitaire du philhellnisme, in: Michel Espagne (Hrsg.): Revue Ger-
manique Internationale 12/2005, S. 77107.
ototj ot I0vooytj Itotrio tj I oo (Hrsg.): Ao rqv oqoto/or|o
orov qt/r//qvtoo. Athen 2005.
Kanduth, Erika: Philhellenismus in der italienischen Literatur Lombardo-Vene-
tiens, in: Alfred Noe (Hrsg.): Der Philhellenismus in der westeuropischen Literatur
17801830. Amsterdam, Atlanta 1994, S. 165188.
Konstantinou, Evangelos (Hrsg.): Europischer Philhellenismus. Die europische Presse bis
zur ersten Hlfte des 19. Jahrhunderts. Frankfurt a.M. u. a. 1994.
Vorwort XXV
Koselleck, Reinhard: Das 18. Jahrhundert als Beginn der Neuzeit, in: Reinhart Her-
zog (Hrsg.): Epochenschwelle und Epochenbewutsein. Poetik und Hermeneutik XII.
Mnchen 1987, S. 269283.
: ,Neuzeit. Zur Semantik moderner Bewegungsbegriffe, in: Reinhart Koselleck
(Hrsg.): Industrielle Welt XX: Studien zum Beginn der modernen Welt. Stuttgart 1977,
S. 264300.
Kramer, Dieter: Der Philhellenismus und die Entwicklung des politischen Bewut-
seins in Deutschland, in: Hans Friedrich Foltin u. a. (Hrsg.): Kontakte und Gren-
zen. Probleme der Volks-, Kultur- und Sozialforschung. FS fr Gerhard Heilfurth. Gttin-
gen 1969, S. 233247.
Landfester, Manfred: Griechen und Deutsche: Der Mythos einer ,Wahlverwandt-
schaft , in: Helmut Berding (Hrsg.): Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewut-
seins in der Neuzeit. Frankfurt a.M. 1996, S. 198219.
Marchand, Suzanne: Down from Olympus: Archaeology and Philhellenism in Germany,
17501970. Princeton 1996.
Mastellone, Salvo: Santorre di Santarosa combattente per la Grecia, in: Indipen-
denza e unit nazionale in Italia e in Grecia, a.a.O., S. 3541.
Meier, Albert: Der Grieche, die Natur und die Geschichte. Ein Motivzusammenhang
in Schillers Briefen ber die sthetische Erziehung und ,ber naive und sentimen-
talische Dichtung, in: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, 29/1985, S. 113124.
Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 18001866. Bd. 1: Brgerwelt und starker
Staat. Mnchen 1989.
Noe, Alfred (Hrsg.): Der Philhellenismus in der westeuropischen Literatur 17801830.
Amsterdam, Atlanta 1994.
Peter, Klaus: Das Europa-Projekt der deutschen Romantik. Perspektiven der Zu-
kunft bei Friedrich Schlegel, Novalis und Franz Baader, in: Klaus Peter (Hrsg.):
Problemfeld Romantik. Aufstze zu einer spezifisch deutschen Vergangenheit. Heidelberg
2007, S. 89104.
Puchner, Walter: Die griechische Revolution von 1821 auf dem deutschen Theater.
Ein Kapitel brgerlicher Trivialdramatik und romantisch-exotischer Melodra-
matik im deutschen Vormrz, in: Sdost-Forschungen. Internationale Zeitschrift fr
Geschichte, Kultur und Landeskunde Sdosteuropas, 55/1996, S. 85127.
Puppo, Mario: Lellenismo dei romantici, in: Ders. (Hrsg.): Poetica e critica del
romanticismo. Mailand 1973, S. 189202.
Raizis, Marios Byron/Papas, Alexander (Hrsg.): American poets and the greek revolution
18211828. A study in Byronic philhellenism. Thessaloniki 1971.
: Greek Revolution and the American Muse: Collection of Philhellenic Poetry, 182128.
Thessaloniki 1972.
Roessel, David: In Byrons shadow: Modern Greece in the English and American imagina-
tion. New York 2002.
Rosen, Fred: Bentham, Byron and Greece. Constitutionalism, Nationalism and Early liberal
political Thought. Oxford 1992.
Schweizer, Stefan: Epochenimaginationen: Sinnbilder der Antike. Die Rezeptions-
geschichte der Athener Korenhalle, in: Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft,
Jg./2002, S. 747750.
Ssemann, Bernd: Annherungen an Hellas: Philhellenismus und Deutsch-Griechische Ge-
sellschaften in Berlin. Festschrift zum 75-jhrigen Bestehen der Deutsch-Griechi-
schen Gesellschaft Berlin e.V. 2 Bde. Berlin 1994.
XXVI Vorwort
Stauf, Renate: Germanenmythos und Griechenmythos als nationale Identitts-
mythen bei Mser und Winckelmann, in: Rainer Wiegels/Winfried Woesler
(Hrsg.): Arminius und die Varussschlacht: Geschichte Mythos Literatur. Paderborn
1995, S. 309326.
Tsigakou, Fani-Maria: The Rediscovery of Greece: Travellers and Painters of the Romantic
Era, introd. by Sir Steven Runciman. London 1981.
Vick, Brian: Greek Origins and Organic Metaphors: Ideals of Cultural Autonomy
in Neohumanist Germany from Winckelmann to Curtius, in: Journal of the Hi-
story of Ideas, 63/2002, 3, S. 483500.
Vorwort XXVII
1
I. Antikenrezeption und Ideolatrie
Annherungen an ein Ideal
2
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 3
Alain Schnapp
Die Antiquitates der Griechen und Rmer,
ihr Einflu auf die Entstehung des antiquarischen
Denkens und ihr Beitrag zur Wiederentdeckung
Griechenlands
Die Renaissance hat die Antike erfunden und hat aus ihr ein konkretes
Land gemacht, das man fortan erforschen konnte. Petrarca hatte die Ein-
gebung und Vorstellung, da man die Vergangenheit durchwandern und
interpretieren knne, auch wenn sie in der Ferne liege. Die Monumente
wurden auf diese Weise der Schlssel zum Verstndnis der Vergangen-
heit, der die bis dahin unbekannten Epochen und Orte der Antike von-
einander abgrenzte.
1
Von dieser Bewegung getragen, zeigte Flavio Biondo,
2
da die Monu-
mente und Inschriften etwas zur Geschichtsschreibung beitragen konn-
ten, aber diese Anfnge des antiquarischen Denkens standen noch
weitgehend im Schatten der schriftlichen Quellen und einer Tradition,
gegen die Francis Bacon sich mit folgenden Worten wendete: Man sagt
also zu Recht, da die Wahrheit Tochter der Zeit ist und nicht der Au-
toritt.
3
Die Konfrontation von schriftlichen Quellen und materiellen
Resten durchzieht die gesamte Geschichte der antiquarischen Ttigkeit
und der Archologie. Um nur von der antiken Welt zu sprechen (und
nur von den bedeutendsten Mnnern), so haben Herodot, Thukydides
und Tacitus alle drei die Monumente und Gegenstnde aus der Vergan-
1
Kessler, Eckhard: Petrarca und die Geschichte. Geschichtsschreibung, Rhetorik, Philoso-
phie im bergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Mnchen 1978, sowie Auhagen, Ulrike/
Faller, Stefan/Hurka, Florian: Petrarca und die rmische Literatur. Tbingen 2005.
2
Blondus, Flavius: Italia illustrata. Verona 1482. S. hierzu: Brizzolara, Anna Maria:
La Roma Instaurata di Flavio Biondo. Alle origini del metodo archeologico. Bologna
1979, S. 574.
3
Bacon, Francis: Sylva Sylvarum or a Naturall Historie in ten centuries written [].
London 1627, S. 2.
4 Alain Schnapp
genheit in ihre historische Argumentation einbezogen. Denn die Monu-
mente, die Weihgaben oder Grabbeigaben sind ebenso in der Gegenwart
erkennbar wie all die anderen Zeichen, die ein neugieriger Blick oder
eine Ausgrabung enthllen knnen. Die Megalithe oder die Pyramiden
waren nicht mit ihren Erbauern untergegangen, sie markierten in all
ihrer Gre die Landschaft, und auch wenn man sie nicht interpretieren
konnte, mute man sie doch in bestimmten Zusammenhngen be-
schreiben und in Betracht ziehen. Die Geschichtsschreiber des frhen
Mittelalters wie Gregor von Tours oder Geoffrey von Monmouth haben
sich ganz wie ihre Vorgnger hufig bemht, ihre Untersuchungen der
schriftlichen berlieferung mit der Betrachtung einiger Monumente zu
verbinden. Stonehenge, dessen massige Architektur die Ebene von Sa-
lisbury in Wessex beherrschte, war ein Monument, das den Klerikern
des Mittelalters kaum entgehen konnte, die darin das Werk von Riesen
oder des Zauberers Merlin sehen wollten.
4
Die bildliche Darstellung
stellte seit dieser Zeit ein Mittel dar, die Vergangenheit vor Augen zu
fhren, und ging von der Betrachtung und, je nach Lage der Dinge, der
Rekonstruktion aus.
Besondere Monumente zu betrachten und zu zeichnen war also
schon Gegenstand der Neugier, bevor die eigentliche Disziplin der anti-
quarischen Forschung sich als solche selbstndig machte. Aber manch-
mal geschah es auch, da ein Buchmaler oder ein Auftraggeber noch
weiter zurckgehen wollte als auf die Zeit Merlins oder der Riesen und
bis an die Ursprnge der Welt gelangen wollte. Andrzej Abramowicz hat
die Aufmerksamkeit auf die Illustrationen des Buches ber den Besitzer
von Gegenstnden gelenkt, bei dem es sich um eine in Lateinisch ver-
fate aristotelische Schrift handelt, die von einem Mnch des 13. Jahr-
hunderts namens Bartolomus von Glanville stammt und vom Ur-
sprung der Welt handelt.
5
Eine Inkunabel und eine Handschrift vom
Ende des 15. Jahrhunderts zeigen auf Bildern den Ursprung der Pflan-
zen- und Tierwelt. In einer bergigen und bewaldeten Landschaft, die
von einer Wasserflche unterteilt wird, wachsen neben Blumen und
Bumen auch Tiere wie Pferde, Wildschweine und Hunde aus dem Bo-
4
S. die Abbildung bei Schnapp, Alain: The Discovery of the Past. London 1996, S. 12,
die Merlin zeigt, wie er Stonehenge errichtet (London, British Library, ms. Eger-
ton 3028, fol. 30r, 16. Jahrhundert).
5
Sie liegt als Inkunabel vor (Glanville, Barthlmy de: Le livre des proprits des cho-
ses. Paris 1485.) und als Handschrift (Le livre des Proprits des choses, bers. v. Jehan
Corbichon, BNF, Ms 218, fol.173, 15. Jahrhundert).
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 5
den. In dem Meer oder Flu steigen Schlangen und Fische auf. Aber au-
erdem wachsen noch ganz von selbst Vasen aus dem Erdboden hervor.
Dieses Bild bringt nicht nur die Phantasie des Holzschneiders und
Illustrators zum Ausdruck. Es geht auf einen Streit zurck, der in der
deutschen und polnischen gelehrten Welt seit dem Beginn des 15. Jahr-
hunderts ausgetragen wurde. Denn in den Ebenen Polens zeigen sich
zu verschiedenen Jahreszeiten Urnenfelder. Waren diese mit Aschen-
resten und kleinen verkohlten Gegenstnden gefllten Urnen die Spu-
ren alter heidnischer Begrbnissttten oder eine Verirrung der Natur und
Gegenstnde, die von dunklen Krften des Bodens hervorgebracht wur-
den? Die Auffassungen der Kleriker sind geteilt, aber die Mehrheit unter
ihnen war doch berzeugt davon, da es sich um spontan hervorwach-
sende Gegenstnde handelte: sponte nascitur ollae
6
. Die Buchmale-
reien und Holzstiche, die den Text des Bartolomus von Glanville illu-
strieren, sind also keine reinen Gebilde der Phantasie, sondern gehen auf
Beobachtungen zurck, die sich die Kleriker nur sehr schwer erklren
knnen. Die Vasen, die von selbst aus dem Boden hervorwachsen, stel-
len die Grundlage der antiquarischen Forschung des Mittelalters dar
und den Sockel, auf dem das Bemhen der Renaissance aufbaut, wenn
es von der Neugier zur wahren Betrachtung bergehen will. Ich ver-
wende diese beiden Worte bewut, um einen Unterschied und eine Ver-
lagerung der Perspektive deutlich zu machen. Die Neugier, die man dem
Fremden, Entfernten und Unwahrscheinlichen entgegenbringt, ist eine
Konstante menschlichen Verhaltens. Diese Neugier wird zur Betrach-
tung, wenn man sich Fragen ber die Ursprnge und Folgen stellt, und
wenn die neugierigen Menschen beginnen nachzudenken, werden sie
Betrachter, die vieles beschreiben und miteinander vergleichen und ver-
suchen, die Dinge zu bewerten, indem sie auf andere Informationsquel-
len zurckgreifen.
1. Die Betrachtung der Vergangenheit.
Die Renaissance hat die Ttigkeit der Betrachtung von Spuren der Ver-
gananheit nicht etwa erfunden, denn das hatten die Schreiber des Vor-
deren Orients, die Schriftgelehrten Chinas und die weisen Mnner der
griechisch-rmischen Welt schon getan, aber sie hat doch die Betrach-
tung der Natur und der Gesellschaft in den Mittelpunkt der berlegun-
6
Allgemein dazu Schnapp: The Discovery, S. 145ff.
6 Alain Schnapp
gen der Gebildeten gestellt. Die antiken Gegenstnde (oder was man da-
fr hielt) waren schon immer gesucht; was die Renaissance auszeichnet
ist der systematische Wille zur Erforschung der Vergangenheit unter Ein-
satz aller Mittel rationeller Betrachtung. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts
wandte Biondo das Programm Petrarcas auf die Antiken in Italien an.
7
In den darauffolgenden Jahrzehnten brach sich in den meisten Lndern
Europas eine gewaltige Bewegung der Betrachtung des Bodens und der
Quellenkritik Bahn. Man ging von einer Kultur des Sammelns von anti-
quitates zu ihrer systematischen Beschreibung ber und zum Wunsch,
sie der schriftlichen berlieferung gegenberzustellen, das heit zur
Bewertung der Quellen, die der wesentliche Bestandteil der historischen
Methode ist. Diese Wibegier stachelte zur Sammlung von Daten
und zur bildlichen Darstellung an. Der Augsburger Mnch Sigismund
Meisterlin, ein Wegbereiter der Reformation, war der erste, der in einem
reich illustrierten Buch versucht hat, die Frhgeschichte der Menschheit
zu beschreiben und abzubilden.
8
Er berichtet, da die Stadt Augsburg
von den Rmern gegrndet worden sei, da die Bewohner Schwabens
aber vor der Ankunft der Rmer in Htten gelebt und ihren Lebens-
unterhalt aus ihrer Ttigkeit als Jger und Sammler bezogen htten.
Der Einflu des Lukrez ist in dieser Ansicht deutlich, aber die Arbeit
des Illustrators, der die primitive Lebensweise der ersten Bewohner des
Weserlandes zeigen will, steht am Anfang einer spezifischen Art, die
Frhgeschichte des Menschen darzustellen, der eine lange Zukunft
beschieden war. Dieses Bild der primitiven Menschen, die in Tierfelle
gehllt sind und in halb in die Erde versenkten und mit Grasdchern
bedeckten Htten hausen, war weitgehend von der traditionellen mittel-
alterlichen Lebensweise inspiriert, die der Buchmaler leicht beobachten
konnte.
Im bergang vom 15. zum 16. Jahrhundert wurde die Darstellung der
primitiven Menschen ein beliebter Gegenstand der Maler und Illustra-
toren. Die Thematik stand in engem Zusammenhang mit dem Aufkom-
men der Wunderkammern, die zur Leidenschaft der Groen der Welt
wie der bescheideneren Brger wurden. Der Triumphbogen des Habs-
burger Kaisers Maximilian, der von den grten Knstlern seiner Zeit
7
S. Weiss, Roberto: The Renaissance Discovery of Classical Antiquity. Oxford 1988,
und Clavuot, Ottavio: Biondos ,Italia Illustrata. Summa oder Neuschpfung? Tbin-
gen 1990.
8
Die Handschrift Sigismond Meisterlin, Augsburger Chronik. Augsburg, Codex
Holder 532, 1457.
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 7
gezeichnet und in Stichen dargestellt wurde, legt davon Zeugnis ab. Die
Schatzkammer Maximilians wird da schematisch in einem Kellerge-
wlbe dargestellt.
9
Der begleitende Text betont die Kostbarkeit der sehr
unterschiedlichen Gegenstnde von Silber, Gold und Edelstein. Es lie-
gen Welten zwischen diesem Bild und der Darstellung des Kabinetts des
Ferrante Imperato am Ende des Jahrhunderts, in dem alle Arten wunder-
barer Gegenstnde von den naturalia bis zu den artificialia aufgereiht
waren.
10
Die Fachleute, die sich mit der Geschichte der Sammlungen
beschftigen, haben gezeigt, da die zweite Hlfte des 16. Jahrhunderts
durch eine breite Bewegung gekennzeichnet ist, die sich die Welt durch
die Sammlung von antiken, sonderbaren und kostbaren Gegenstnden,
die einen Mikrokosmos des Makrokosmos darstellten, untertnig ma-
chen wollte.
11
Die Zeugnisse dieser Leidenschaft sind offensichtlich und
allgemein bekannt, aber wir mssen hier einen neuartigen Aspekt be-
sonders herausstellen, nmlich die Verwandlung des Sammlerobjekts in
einen musealen Gegenstand, das heit den bergang vom seltenen Ge-
genstand zum Monument, Beleg und Zeugnis einer fernen Vergangen-
heit.
12
Zwei Beispiele knnen diese Bewegung illustrieren. Bei dem
einen handelt es sich um eine frhgeschichtliche Vase der Lausitzer
Kultur, die zu derselben Gruppe von Urnen gehrt, an denen sich der
Streit um die Vasen, die aus dem Boden hervorwachsen, entzndet
hatte. Die Vase war mit eine Zinndeckel versehen worden, auf dem der
Name des Kaiserlichen Rats Haug von Maxen eingraviert war.
13
Das war
ein symbolischer Akt, der die Funktion des Gegenstandes als Semiophor
(Bedeutungstrger) durch diese Vernderung verdoppelt und den Na-
men des glcklichen Besitzers an sein angenommenes hohes Alter an-
9
Klderer, Jrg/Drer, Albrecht: Maximilians Triumpharch, 15151517. Abb. bei
Schnapp: The Discovery, S. 167.
10
Imperato, Ferrante: Historia Naturale. Neapel 1599. Abb. bei Schnapp: The Disco-
very, S. 169.
11
S. Grote, Andreas (Hrsg.): Macrocosmos in Microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur
Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800. Opladen 1994; Kunst- und Ausstellungshalle
der Bundesrepublik Deutschland GmbH (Hrsg.): Wunderkammer des Abendlands.
Museum und Sammlung im Spiegel der Zeit. Bonn 1995; Bredekamp, Horst: Antiken-
sehnsucht und Maschinenglauben. Die Geschichte der Kunstkammer und die Zukunft der
Kunstgeschichte. Berlin 2000.
12
S. Pomian, Krzysztof: Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris-Venise XVI
e
XVIII
e
sicle. Paris 1987, bes. S. 1661; Bujok, Elke: Neue Welten in europischen Sammlun-
gen. Africana und Americana in Kunstkammern bis 1670. Berlin 2004, S. 4561.
13
Frankfurt, Museum fr Kunsthandwerk, Vase der Lausitzer Kultur, um 1560 de-
koriert. Abb. bei Schnapp: The Discovery, S. 147.
8 Alain Schnapp
bindet. Sofern man an der Bedeutung eines solchen Vorgehens zweifelt,
bietet das Beispiel einer rmisch-germanischen Vase aus terra nigra
einen weiteren berzeugenden Beleg.
14
Sie ist mit zwei silbernen Hen-
keln und einem glockenfrmigen Deckel verziert. Auf der Spitze
trgt ein Putto zwei rmische Mnzen wie einen Schild vor sich her, von
denen die eine eine Mnze des Galba und die andere des Vitellius ist
(6869 n. Chr.). Eine sorgfltig in den Deckel eingravierte Inschrift pr-
zisiert:
Diese antike Vase wurde auf dem Landgut des edlen und erlauchten Anthon
Waldposten von Basenheim gefunden zusammen mit einem Topf und einer irde-
nen Flasche in einem Weinberg, in dem sich Vasen gleicher Art fanden [], zwei
Fibeln aus Kupfer, wie sie die Alten benutzten [], und andere Dinge, die viele
hundert Jahre im Boden gelegen haben. Entdeckt Ende April 1563 von einem Be-
wohner von Basenheim.
Diese Art von Dokument belegt eine grundlegende Vernderung in der
Ttigkeit des Sammelns und der Art der Betrachtung. Der Gegenstand
wurde als materielles Zeugnis einer fernen Vergangenheit betrachtet. In-
dem er die zitierte Inschrift eingravieren lie, beabsichtigte Anthon von
Basenheim zu zeigen, da diese Vase deswegen kostbar sei, weil sie antik
sei und weil sie ein historisches Zeugnis einer weit zurckliegenden Zeit
darstelle. Die Umstnde ihrer Entdeckung wurden fr ebenso wichtig
angesehen wie der Gegenstand selbst, der dadurch, da er eine Art Kar-
teikarte erhielt, wie sie in der modernen Museumsverwaltung blich
ist, zur historischen Quelle wurde. Der Semiophor wurde so zu einem
sprechenden Gegenstand, der seinen Ursprung angibt. Die Vase in Ham-
burg wird so in gewisser Weise durch die Hinzufgung von Attributen
zu einem ganz eigenstndigen Monument, und Mnzen, Statuette und
Inschrift machen aus ihr ein monumentum in der etymologischen Grund-
bedeutung des Wortes. Gegenstnde dieser Art waren offensichtlicher
Ausdruck eines Strategiewechsels in der Betrachtung der Vergangenheit.
Der Blick der Antiquare wurde schrfer und kritischer, und er versucht
nun in der Menge aller mglichen Sammlerobjekte und Fundgegen-
stnde voneinander zu trennen, was zur Natur gehrt und was zur Ge-
schichte. Ein Fossil aus Ammonitstein im Museum in York zeigt eine an-
dere Seite dieser Art von Behandlung: Der Fossilstein war berarbeitet
und man hatte den Schlund einer Schlange hinzugefgt, um so seinen
14
Hamburg, Museum fr Kunst und Gewerbe, Inv. 1924.155, rmisch-germanische
Vase. Abb. bei Schnapp: The Discovery, S. 147.
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 9
tierischen Ursprung deutlicher zu machen.
15
Das ist ein naiver Eingriff,
der indes mglichst berzeugend den Vorgang nahelegen wollte, durch
den ein Lebewesen zu einer Versteinerung geworden war.
Der Illustrator der Abhandlung des Bartolomus von Glanville wollte
die Entstehung des Lebens zum Zeitpunkt seines Ursprungs erfassen
und der anonyme Umgestalter der Versteinerung in York wollte die Ver-
wandlung eines Tierkrpers in ein Mineral zeigen. Das 16. Jahrhundert
war demnach die Zeit eines intensiven Interesses fr die Vergangenheit
in allen ihren Formen. Der Antiquar entdeckte auf einmal, da die Welt
ein riesiger botanischer Garten war, dessen Blumen es gengte zu be-
trachten und zu sammeln, um ihre Geschichte zu rekonstruieren. Diese
Explosion der antiquarischen Neugier ist verwirrend. Nach den fort-
schrittlichen Arbeiten Biondos, die indes literarische Beschreibungen
der antiken Welt blieben, gab es nun die ersten Kartographen der Ver-
gangenheit. Mnner wie Marliano, Calvo und Bufalini bemhten sich,
genaue Plne und Karten der wichtigsten Monumente Roms zu erstellen
und zu verffentlichen.
16
Der Maler, Ingenieur und Architekt Pirro
Ligorio machte sich an die systematische Aufnahme und genaue zeich-
nerische Darstellung aller Antiken, die zu entdecken ihm mglich war.
17
Johannes Rosinus verffentlichte im Jahre 1583 in Basel das erste illu-
strierte Handbuch der rmischen Antiken.
18
Dieses Phnomen, das
in Rom gewaltige Ausmae annahm, beschrnkte sich nicht auf die
Klassische Welt, sondern auch in Deutschland, Grobritannien und
Skandinavien und sogar in der Neuen Welt gingen wibegierige Geister
daran, die Spuren der Vergangenheit zu beobachten, zu registrieren und
manchmal auszugraben. Eine derartige Bewegung allgemeiner Neugier
wurde durch berlegungen zum Ursprung der Menschheit begnstigt,
die man aufgrund der Entdeckung Amerikas und der Erforschung Afri-
kas, Asiens und des Pazifiks anstellte. Stephanie Moser hat gezeigt, wie
sehr die Gestalt des Wilden am Ende des 15. Jahrhunderts eine wesent-
liche Anregung zur Begrndung der Naturwissenschaften wurde: Die
thiopier, halb Menschen und halb Tiere, werden im Buch der erstaun-
15
York, Yorkshire Musem, Geschnittener Ammonit in Form einer Schlange. Abb.
bei Schnapp: The Discovery, S. 98.
16
S. dazu Weiss: The Renaissance Discovery.
17
Ligorio, Pirro: Antiquae urbis Romae imago accuratissima ex vetustis monumentis,
ex vestigiis videlicet aedifocior, moenium ruinis, fide numismatum, mouvmentis aeneis,
plumbeis, saxeis tiglinisque collecta. Rom o. J. [ca. 1553].
18
Rosinus, Johannes: Romanarum Antiquitatum libri decem. Ex variis Scriptoribus
summa fide singularique diligentia collecti. Basel 1583.
10 Alain Schnapp
lichen Wunder der Welt von einem wilden und am ganzen Krper
behaarten Menschen begleitet, der eine Keule in der Hand hlt.
19
Bald
sollte er eine Gefhrtin finden und eine Familie grnden, wie der be-
rhmte Mann aus Jean Bordichons Der wilde Mensch oder der Natur-
zustand:
20
In einer lieblichen Landschaft sprudelt eine Quelle aus dem
Boden. Der am Krper behaarte Mann nimmt eine berlegene Haltung
ein und sttzt sich auf eine lange Keule. Am Eingang einer Htte sitzt
seine Frau und stillt ein Kind. Dem Bild ist eine Ballade als Text beige-
geben: Ich lebe nach den Regeln, die mich die Natur gelehrt hat, ganz
ohne Sorgen, immer vergngt. Auf mchtige Schlsser und groe Pal-
ste lege ich keinen Wert. Ich mache mir meine Heimstatt in einem hoh-
len Baum, ich schwelge nicht in feinem Essen oder starken Getrnken,
ich lebe nur von frischen Frchten. Und so habe ich, Gott sei Dank,
mein Auskommen.
Das Bild des primitiven Urmenschen wird eines der Themen, das die
Maler wie Piero de Cosimo oder Lucas Cranach interessiert. Die Entdek-
kung neuer Lnder und unbekannter Kontinente verstrkt diese Faszi-
nation. Verfasser von Pamphleten und Gelehrte wie Paracelsus oder
Giordano Bruno sollten sich bald die Fragen nach dem Ursprung des
Menschen und der Existenz eines oder mehrerer Adame stellen.
21
Die
Erforschung des Raumes wurde ein Instrument der Erforschung der Ver-
gangenheit. Mnner wie John White, Le Moine, Lucas de Heere oder
Theodor de Bry
22
begngten sich nicht damit, die Sitten und Gebruche
der wilden Amerikaner zu betrachten und zu beschreiben, sondern sie
stellen auch ausdrcklich die Frage nach den verschiedenen Stufen der
Zivilisation und der Beziehung zwischen den Sitten der Eingeborenen
der Neuen Welt und denen der frheren Bewohner Europas. Theodor
de Bry zum Beispiel fgt seinen 1591 in Frankfurt a.M. verffentlichten
Bildern Floridas noch icones pictorum olim Britannia partem incolentium
hinzu,
23
um so zu zeigen, da die ersten Bewohner Europas ebenso
Wilde waren wie die von Virginia: ad demonstrandum, Britanniae incolas
19
Moser, Stephanie: Ancestral images. The iconography of human origins. Ithaca 1998,
Tafel 1 (Pierpont Morgan Library, Ms 461, fol. 26v, um 1460).
20
Moser: Ancestral images, S. 51 (Miniatur in der Ecole des Beaux-Arts, no. 90, um
1500).
21
S. Pigott, Stuart: Ruins in a Landscape. Essays in Antiquarianism. London 1976, S. 9
und S. 66f.; Moser: Ancestral images, S. 68ff.
22
S. Moser: Ancestral images, S. 50.
23
Floridiam Indorum provinciam inhabitantium eicones, Frankfurt a.M. 1591. Abb. bei
Schnapp: The Discovery, S. 150. (British Museum, Tinte und Aquarell, 1574).
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 11
non minus aliquando fuisse sylvestris ipsis Virginibus. Diese Art von Bemer-
kungen, die einleuchtende Verbindungen zwischen Raum und Zeit her-
stellten, standen der Arbeit der deutschen Antiquare wie Anthon von
Basenheim nahe und setzten den betrachteten Mikrokosmos und den
Makrokosmos der Welt in eine Beziehung, die es erlaubte, ersteren (den
Mikrokosmos) zu interpretieren. Es ist nicht bedeutungslos anzumer-
ken, da dieselben Mnner, die die fremden Sitten und Gebruche am
Ende der Welt beschrieben, sich auch fr die ltesten Monumente
Europas interessierten: Lucas de Heere, der Bilder von den mit Ttowie-
rungen bedeckten alten Bretonen zeichnete, hat auch ein groartiges
Aquarell von Stonehenge gemalt.
2. Die Illustration der Vergangenheit
Die Verbreitung solcher Bilder und die Entwicklung der antiquarischen
Abbildungen, deren groe Bedeutung Stuart Pigott herausgestellt hat,
24
ist im Zusammenhang mit einer breiten Bewegung zu sehen, die Welt zu
beschreiben, die ihrerseits die Antiquare zu neuen Ufern fhrte. Man
kennt die Verbindung, die zwischen William Camden, dem Erfinder der
archologischen Topographie in Grobritannien, und Abraham Orte-
lius, dem grten Kartographen derselben Epoche, bestand. In demsel-
ben Zusammenhang ist auch das groe Interesse zu sehen, das die Ver-
fasser der umfangreichen Serie der Civitates orbis terrarum von Braun und
Hogenberg den antiken Monumenten entgegenbringen, wenn sie unbe-
dingt den bei Poitiers gefundenen Stein abbilden wollen, bei dem es sich
um einen Megalithen handelt, der schon die Aufmerksamkeit von Ra-
belais erregt hatte. In der Darstellung sieht man eine Gruppe von Topo-
graphen und Zeichnern, die um das Monument herum versammelt sind
und ihre Namen wie bei einer Pyramide oder einem rmischen Monu-
ment in den Stein gravieren.
25
In der Zeit, als diese Art von Bildern
in Mode kam, wurden die Megalithe neben den Urnen zu den male-
rischen Gegenstnden, die die Antiquare sich zu interpretieren und zu
dechiffrieren bemhten. In solchen Monumenten konnte sich die
Geschichte besonders in den Gegenden Europas verkrpern, die der
Romanisierung entgangen waren. Die Werke des Olaus Magnus, jenes
Bischofs von Uppsala, der durch die Reformation gezwungen wurde,
24
S. Piggott: Ruins.
25
S. Schnapp: The Discovery, S. 14.
12 Alain Schnapp
seinen Aufenthalt in Rom zu nehmen, zeigen diese Neugierde sehr gut,
die Raum und Zeit miteinander verwebt. Seine Historia de gentibus septen-
trionalis, die 1567 in Basel erschien, ist mit Stichen bebildert, die zum er-
sten Mal einen Eindruck von den nordischen Antiken vermitteln. Die
Holzschnittillustrationen des Buchs von Magnus zeigen lauter Riesen,
Seeungeheuer und zerklftete Landschaften, aber auch originalgetreue
Abbildungen von Megalithen, die in die Landschaft eingeschrieben sind
wie die Runen der nordischen Tradition.
26
Das Verdienst von Magnus
ist es, da er die Aufmerksamkeit auf die bis dahin weitgehend vernach-
lssigten inschriftlichen Zeugnisse gelenkt hat und gezeigt hat, da
die skandinavische Zivilisation auch fr die Zeit vor der Verbreitung des
Christentums schriftliche Quellen besa.
Heinrich von Rantzau, Statthalter von Schleswig-Holstein und Sch-
ler Philipp Melanchtons, der zusammen mit anderen Reformatoren zur
Durchsetzung der Reformation in Dnemark beigetragen hat, sollte in
seinem Bemhen um die Erforschung der Vergangenheit seines Landes
noch weiter gehen. Er lie Grabungen und Prospektionen auf dem alten
Knigssitz Jelling durchfhren und die Grabinschrift verffentlichen, die
die Grabsttte der ersten heidnischen Knige Dnemarks schmckte.
27
Die Abbildung wird von einer Abschrift und Umschrift des Textes in
nordischer Sprache und einer lateinischen bersetzung begleitet, die
unter der Ansicht der Landschaft, des frhgeschichtlichen Ortes und der
dort errichteten Kapelle steht. Aber Rantzau hat sich nicht auf diese Ver-
ffentlichung beschrnkt, sondern auch auf seinem Landgut zur ehren-
den Erinnerung dieser Entdeckung eine Pyramide errichtet, die die fol-
gende Inschrift trgt: Diese Pyramide ist zur Erinnerung an die drei
Knige Dnemarks errichtet. Im Jahre 5540 nach der Erschaffung der
Welt, dem Jahre 3484 nach der Sintflut, dem Jahre 1572 seit der Geburt
Christi, dem Jahre 985 seit der Geburt des Mahomet. Wie man sieht,
beschrnkte sich die Erforschung der Vergangenheit nicht etwa auf die
Sammlung seltener Gegenstnde oder die Entdeckung von Monumen-
ten, sondern sollte auch eine Lektion in vergleichender Geschichte sein.
Es ist kein Zufall, da sich ein solches Vorgehen in protestantischen
Landen und zu einem Zeitpunkt entwickelte, zu dem die kritische Lek-
tre der Heiligen Schrift eine der Grundlagen der intellektuellen Rck-
26
Olaus Magnus: Historia de gentibus septentrionalis. Basel 1567, S. 35 und 59. Abb.
bei Schnapp: The Discovery, S. 158f.
27
Lindeberg, Peter: Commentarii rerum mirabilium. Kopenhagen 1591. Abb. bei
Schnapp, The Discovery, S. 152f.
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 13
eroberung der historischen berlieferung durch das Studium der hebri-
schen, griechischen und arabischen Quellen wurde. Die kleinen oder
groen Monumente, die als Ganzes oder fragmentarisch erhalten waren
und in stolzer Pracht auf ihren Fundamenten standen oder tief im Bo-
den vergraben lagen, als eine sprechende Quelle der Geschichte zu ver-
stehen, war das Programm einer neuen Generation von Antiquaren im
16. Jahrhundert. Diese Arbeit grndet sich auf die Kartographie, die Epi-
graphik, die Numismatik und natrlich auf die Ausgrabungen. Der erste
illustrierte Grabungsbericht, der uns erhalten ist, liegt in einer Reihe von
Miniaturen vor, die den Text des Buches ber die Antiken Begrbnisriten
des Jean Lemaire de Belges begleiten.
28
Es handelt sich um die Freile-
gung eines rmischen Monuments in der Nhe von Leuwen zu Beginn
des 16. Jahrhunderts. Die Beobachtungsgabe des Antiquars, der diese
Ausgrabungen durchfhren lie, ist erkennbar: Die Landschaft ist sorg-
fltig dargestellt und die Wiedergabe des Mauerwerks ist exakt. Die Aus-
grabungsttigkeit ist keineswegs eine Erfindung der Renaissance, und
vom Alten Orient bis ins Mittelalter liegen zahlreiche Erzhlungen vor,
die von Bodenfunden berichten. Das Beispiel bietet indes einen beson-
deren Aspekt, denn es war die erste bildliche Darstellung eines archo-
logischen Fundes in situ. Wenn die im Boden entdeckten Gegenstnde
zu Belegen der Geschichte wurden, wie die meisten Antiquare der Re-
naissance meinten, dann mute man aus ihnen Dokumente machen,
deren fides und veritas den Regeln der Beweisaufnahme folgten: Die Aut-
opsie im Sinne Herodots mute durch die Aufnahme der Einzelheiten
erhrtet werden. Die Zeichnung ergnzte die Beschreibung mit Worten,
um so die Gltigkeit der Schlufolgerungen zu sichern. Im Laufe des
16. Jahrhunderts verlieh man den jeweiligen Gegenstnden so einen
intellektuellen Standort, die Aufnahme und Beschreibung wurde zur
natrlichen Folge der Ausgrabung. Die Berichte wie derjenige ber die
Grabungen in Jelling sind keine Ausnahme mehr. Wir besitzen zum Bei-
spiel systematisch angelegte Zeichnungen der 1582 von Amerbach im
Theater von Augst vorgenommenen Grabungen
29
oder den topographi-
schen Plan, den der Forscher Simon Studion von dem rmischen Lager
von Benningsen in Wrttemberg angefertigt hat und der am Rande von
28
Lemaire de Belges, Jean: Des anciennes pompes funerailles. Texte tabli, introduit et
annot par Marie-Madeleine Fontaine avec le concours dElisabeth A.R. Brown.
Paris 2002, Taf. 15.
29
Zu Augst s. die Handschrift Amerbach B, ms O IV, No.I, 3, 1582, Basel. Abb. bei
Schnapp: The Discovery, S. 148.
14 Alain Schnapp
einer summarischen Notiz zu jedem topographischen Element begleitet
war.
30
Auch wenn sie selten sind, belegen solche Beispiele doch deutlich
den Wechsel in der Einstellung der Antiquare und die Verlagerung des
Erkenntnisinteresses vom Monument auf seinen Kontext und vom Ge-
genstand auf sein Umfeld. Das Bild des Ausgrbers, der Schtze, aber
auch Informationen aus dem Boden hervorholt, wurde in der Samm-
lung von Emblemata des Ungarn Johannes Sambucus, einem Schler des
Guilleaume Bud, zu einem ikonographischen Thema.
31
Vor dem Hin-
tergrund rmischer Triumphbgen grbt ein Mann mit einem Spaten im
Boden, whrend zwei Gelehrte, von denen einer den Kopf einer Statue
in Hnden hlt, miteinander diskutieren. Das Gedicht, das das Bild be-
gleitet, lautet folgendermaen:
Omnia consumit tempus, longamque senectam,
Quid videt artifices, quod perpere manus?
Imperium fatum eripuit monumenta, vetustas,
Ne quid duraret, confiteretque situs.
Nunc Deusin frugem veterum virtute probatsm
Vt vocet en[!] monstrat marmora, Roma, tibi.
Effodiuntur opes irritamenta bonorum,
Nec poterit nummos vlla abolere secla,
Multorumque monent quae tacuere libri.
32
30
Zu Studion s. Simon Studion, Handschrift A, p.76, 1597, Stuttgart, Wrttenber-
gische Landesbibliothek. Abb. bei Schnapp: The Discovery, S. 149.
31
Sambucus, Johannes: Emblemata. Paris 1564. Abb. abrufbar unter http://diglib.
hab.de/wdb.php?dir=drucke/li-77441 (01. 01. 2008).
32
Sambucus, Johannes: Emblemata, cum aliquod nummis antiqui operis. Antverpen
1554, Emblem 191 (Aniquitatis studium):
Die Zeit kann alles bezwingen, sie sieht alle Menschen
Und auch alles, was sie mit ihren Hnden schmieden,
Und doch ist das allehrwrdige Altertum
Ewig dauernd wie die Zeit.
Wie du sehen kannst, auch die gravierten Marmorsteine
Zeigen die Groartigkeit der kundigen Mnner.
Die groen Triumphbgen und die gewaltigen Mauern,
Die auf den alten Mnzen eigeschnittenen Gesichter,
Bezeugen heute die Gre der Geister,
Deren Namen noch nicht zu Papier gebracht sind.
Zur Verarbeitung archologisch-antiquarischen Wissens in der Emblematik s. fer-
ner: Harms, Wolfgang: Eine Kombinatorik unterschiedlicher Grade des Fakti-
schen. Erweiterungen des emblematischen Bedeutungspotentials bei dem Archo-
logen Jean Jacques Boissard, in: Andreas Kablitz/Gerhard Neumann (Hrsg.):
Mimesis und Simulation. Freiburg 1998, S. 279307.
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 15
Das Gleichnis von der ewig dauernden Zeit, tempus edax, nimmt eine
neue Dimension an: Die Menschen vergehen, aber die Antike ist ewig
dauernd, und die Monumente sind Zeugnisse der Zivilisationen der
Vergangenheit, die auf Papier nicht verzeichnete Tatsachen aufdecken.
In der Subscriptio dieses Emblems findet man eine leise Kritik am Vor-
rang der schriftlichen berlieferung gegenber den Monumenten, die
der Mann von Rang mit dem Spaten in der Hand aus dem Boden an den
Tag gebracht hat. Diese Figur des Antiquars als Ausgrber kommt zwar
nicht hufig vor, aber man findet sie zum Beispiel auf dem Frontispiz
eines Buchs wieder, das die Erneuerung der antiken Topographie in
Grobritannien verkrpert, nmlich der groen Ausgabe der Britannia
von William Camden aus dem Jahre 1600.
33
Der Steinkreis von Ston-
ehenge ist dort wie eine Art Theater abgebildet, auf das ein Antiquar mit
umgebundenem Sbel mit dem Finger weist. Der Ort wird durch eine
niedrige Umfassungsmauer geschtzt, und davor graben zwei Mnner
mit Schaufeln im Boden. Ein in einer Kartusche gerahmter Text unter-
halb des Bildes spricht von einem locus ubi ossa humana effondiuntur,
einem Ort, wo man menschliche Knochen ausgegraben hat. Vor den
Ausgrbern sieht man einen Grabhgel und zwei gewaltige Hftkno-
chen. Viele Fragen zu Funktion, Datierung und Interpretation von
Stonehenge bleiben zwar ungelst, aber es kann kein Zweifel bestehen,
da die Wahl dieses Monuments fr die Titelseite und die Abbildung
der Ausgrber bei der Arbeit ein Lehrstck sein sollen: Der Boden ist wie
ein Geschichtsbuch, und wer in der Lage ist, es zu lesen, es auszugra-
ben, zu analysieren und zu interpretieren, kann daraus intellektuellen
Gewinn ziehen. Zum selben Zeitpunkt wurden die Megalithe, ob sie
nun bei George Owen als Monumente der alten Kelten definiert wurden
oder bei Olaus Magnus als Bauwerke der alten Skandinavier, zu gngi-
gen Abbildungen in den zahlreichen antiquarischen Publikationen. Die
Topographie, die sich auf die Epigraphie, die Numismatik und die Ono-
mastik sttzte, ergnzte die Bodenforschung in hervorragender Weise.
Sie veranlate und begnstigte die Erfassung der Einzelheiten und die
graphische Darstellung, die die Entdeckungen begleiteten. Im Jahre 1612
lie Paul Petau, ein Stadtrat im Parlament von Paris, seine Sammlung
von Mnzen und anderen archologischen Objekten in Stichen abbil-
den, die der traditionellen Methode folgten und jeden Gegenstand fr
sich darstellten. Eine der Tafeln war indes eine Neuheit. Es handelt sich
33
Camden, William: Britannia. London 1600. Abb. bei Schnapp: The Discovery,
S. 16.
16 Alain Schnapp
um die Abbildung der Fundgegenstnde aus zwei gallormischen Gr-
bern, die man im Stadtpalast des Jean Almaric, Intendanten des Knig-
lichen Heeres, entdeckt hatte. Die Funde, die aus Vasen, Fibeln, Arm-
reifen, Mnzen und sogar einer Grabinschrift bestanden, sind am Rande
neben zwei anatomischen Darstellungen der Skelette und dem Mobi-
liar der Grabbeigaben abgebildet.
34
Selbst wenn wir heute feststellen
knnen, da die Gesamtheit der Gegenstnde nicht aus ein und dersel-
ben Zeit stammt, ist diese Darstellung doch von betrchtlichem Inter-
esse. Sie ist das unbestreitbare Zeugnis einer genauen archologischen
Beobachtung, die versucht, eine Beziehung zwischen der Lage der Ge-
genstnde im Boden und ihrer Funktion herzustellen. Auch in diesem
Fall wurde die Betrachtung durch die Zeichnung und Illustration erhr-
tet und gesttzt. Am Ende des 16. Jahrhunderts haben die Antiquare das
Muster ihrer Betrachtung allmhlich gendert.
3. Der Gedanke des archologischen Kontextes
Die Einteilung der Sammlungen, die die Gegenstnde nach dem Schema
der naturalia und der artificialia gliedern, hatte sich als Vorbild durch-
gesetzt. Aber der aus seinem Zusammenhang gelste Gegenstand sagte
nicht viel aus. Wann immer die Antiquare sich wesentlichen Fragen ge-
genbersahen wie: Was ist ein Megalith? Woher kommen die Donner-
keile? Sind die Urnenfelder berreste alter Begrbnissttten?, muten
sie ins Gelnde zurckkehren, die Fundumstnde betrachten und sich
die Frage nach der Art der Herstellung der Gegenstnde stellen, die sie
hatten entdecken knnen. Die Ttigkeit des Antiquars bewegte sich im
Spannungsfeld zweier Pole: Auf der einen Seite stand die Typologie, das
heit die Reihung und Klassifizierung der Gegenstnde und Monu-
mente in unterschiedliche Familien je nach Funktion und Art der Ver-
wendung, auf der anderen die Topographie, die jedem Gegenstand einen
Platz im Raum zuwies. Zwar ist jeder dieser beiden Pole mehr oder we-
niger an einen chronologischen Rahmen gebunden, doch der ist bereits
fr die Klassische Welt ziemlich ungewi und fr die vorangehenden
Epochen gar nicht vorhanden. Die beiden Pole lassen sich kombinieren
oder befinden sich in vlligem Gegensatz zueinander, aber sie gehren
doch zum Werkzeug eines jeden Antiquars. Ein gutes Beispiel bietet uns
34
Petau, Paul: Antiquariae Suppelectilis portiuncula. Paris 1612. Abb. bei Schnapp:
The Discovery, S. 182.
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 17
Ole Worm, dessen 1643 verffentlichten Monumenta Danica zunchst
eine topographische Arbeit reprsentieren, die von einer systematischen
Prospektion der nordischen Lnder ausgeht. Wenn man seine Arbeit mit
der seiner Vorgnger wie Rosinus oder selbst Clver vergleicht, wird die
Bedeutung der Prospektion, der Bodenforschung und der Bestandsauf-
nahme berdeutlich. Worm lie sich nicht (und das aus gutem Grund)
von den antiken Autoren leiten, um die Monumente zu identifizie-
ren oder ihre rumliche Position zu bestimmen. Seine Vorgnger in
Deutschland oder Grobritannien konnten sich auf lateinische Inschrif-
ten oder Mnzfunde sttzen. Er hingegen mute alles selbst finden,
und diese Freiheit erlaubte ihm, einen gewaltigen Fortschritt zu vollzie-
hen. Er ist wie ein Kartograph, der die Fixpunkte bestimmen mu, um
seine Karte zu zeichnen, er mu eine gewisse Anzahl von Ausgangs-
punkten festlegen. Die einzige Lsung, die sich ihm zunchst bietet, ist
der Rckgriff auf die althergebrachte Methode der Autopsie. Doch im
Gegensatz zu seinen Vorgngern war seine Autopsie nicht punktuell und
nicht an die Interpretation eines einzelnen Monuments oder Platzes ge-
bunden. Stattdessen mute er eine einheitliche Methode entwickeln,
die man auf das gesamte Gebiet ausdehnen konnte.
Worm ist meiner Kenntnis nach der erste, der Blick und Mastab auf
diese Weise erweiterte und einen Fragebogen entwickelte, der die Grund-
lage unserer gesamten modernen Archologie geworden ist. Die archo-
logische Topographie entsteht aus der Gegenberstellung zwischen dem
Fundort menschlicher Produkte im geographischen Raum mit den typo-
logischen Einzelzgen, die den jeweiligen Gegenstand kennzeichnen.
Angesichts des Fehlens schriftlicher Quellen legte Worm die Regeln fr
diese Konfrontation fest.
35
Aber zugleich brauchte er doch auch einen
Bezugsrahmen, um eigenartige Monumente zu beschreiben, die er prak-
tisch als erster entdeckt hat. Was die Runen anging, so war die Methode
von Rantzau entwickelt worden: Es gengte, die skandinavischen In-
schriften auf die gleiche Weise zu behandeln wie die lateinischen. Aber
um die Anordnung der Megalithreihen oder die Grabhgel und die Orte
der Wikinger zu beschreiben, brauchte man doch einen neuen Bezugs-
rahmen. Den fand Worm im Corpus der Werke der antiken Autoren
und der italienischen Antiquare, mit denen er so ausgiebig in Verbin-
dung gestanden hatte, als er Paris, Montpellier und Padua besucht hatte,
um dort seine Universittsdiplome zu erweben und sich weiterzubilden.
Fr Worm war der Raum Dnemarks eine Unterabteilung der Antiquita-
35
Worm, Ole: Danicorum Monumentorum libri sex. Kopenhagen 1643.
18 Alain Schnapp
tes im Sinne Varros: Foren, Zirkusanlagen, Schranken, Grenzen, Kult-
bezirke. All diese Kategorien stammten aus dem Vokabular der Anti-
quare in Italien. Das Modell der Gesellschaft des skandinavischen
Altertums basierte auf dem Vorbild der rmischen Gesellschaft. Wie
man daraus ersehen kann, war die Entwicklung der antiquarischen Wis-
senschaft nicht das Ergebnis einer harmonischen Sammlung von Daten,
die allmhlich voranschritt. Um zu betrachten, brauchte man ein
Muster von Unterscheidungskriterien, und das Muster Worms stand im
Zeichen eines offensichtlichen Widerspruchs zwischen dem von ihm be-
schriebenen Terrain und den verwendeten Kategorien. Das grte Hin-
dernis bei der Aufstellung eines geordneten Forschungsinstrumenta-
riums blieb whrend des gesamten 17. und 18. Jahrhunderts die Frage
der Chronologie. Worm, der sonst so systematisch vorging, hat es ver-
mieden, sich ihr zu stellen, whrend John Aubrey in der zweiten Hlfte
des 17. Jahrhunderts einige glnzende Einflle hatte und eine neuartige
Methode ersann. Sicher mute man, wie er in seiner Arbeit zeigte, eine
solide Dokumentation zusammenstellen, genaue Angaben machen, bei
der Freilegung von Grabsttten auf anatomische Weise vorgehen und
die Monumente in ihrem landschaftlichen und topographischen Kon-
text betrachten. Danach war es notwendig, diese Aufzeichnungen und
Feststellungen in ein greres Ganzes einzufgen. Das war eine mh-
same Arbeit, die er folgendermaen beschrieb:
Ich mu zugeben, da diese Untersuchung ein Vorantasten in der Finsterheit ist;
aber auch wenn ich nicht alles Licht hineinbringen konnte, kann ich doch be-
haupten, da ich die Angelegenheit von einer vlligen Dunkelheit in einen fei-
nen Nebel gefhrt habe, und da ich bei diesem Versuch weiter fortgeschritten
bin als jeder andere vor mir. Diese Antiken sind von so hohem Alter, da kein
Buch sie erreichen kann. Und es gibt auch kein anderes Mittel sie auferstehen zu
lassen, als da man auf die Methode der vergleichenden Altertumskunde zurck-
greift, die ich von den Monumenten selbst ausgehend entwickelt habe: historia
quoque modo scripta est.
36
Die Bezugnahme auf Plinius ist an dieser Stelle interessant. Der Text bei
Plinius lautet historia quoque modo scripta delectat. Plinius weist seinen
Leser auf die Ambivalenz der Geschichte hin: Die Geschichte erfreut
den Leser, delectat, so da die Menschen sich von den Geschichten und
Fabeln, sermunculis etiam fabulisque verfhren lassen. Plinius verteidigt
hier eine rationale Art der Geschichtsschreibung gegenber einer ro-
36
Aubrey, John: Monumenta Britannica. John Fowles/Rodney Legg (Hrsg.): Mil-
borne Port 19801982, S. 275. Das Zitat weist auf Plinius, Briefe 5, 8 zurck.
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 19
manhaften und einnehmenden Geschichte. Aubrey ersetzt das Verbum
in dem Zitat. Sein est ist die Behauptung der Existenz einer Methode,
die aus Monumenten Texte macht und Kunstwerke in Worte bertrgt.
Diese Feststellung markiert die Geburt der Archologie im modernen
Sinne und begrndet eine Art der Darstellung, deren Ausgangspunkt
(oq) die Reihung und das Verstehen der Gegenstnde ist, die in eine
systematische Ordnung gebracht worden sind. Das Corpus, das Aubrey
in den Monumenta Britannica zusammengestellt hat, bestand aus heu-
tiger Sicht aus drei Abteilungen, von denen eine der Religion und den
Gebruchen der Druiden gewidmet war, eine zweite der Architektur und
eine dritte den vormonumentalen Strukturen (Hnengrber, Urnen,
Grabsttten, Grben).
37
Im Vergleich zu Worm war dies bereits eine be-
merkenswerte Neuheit, aber Aubrey erfand auerdem noch etwas viel
wichtigeres. Es handelt sich um eine Art Schlssel, ein rganon, das es
erlaubt, von den besonderen Eigenschaften der Gegenstnde ausgehend
Reihen aufzustellen und auf dieser Grundlage eine Chronologie zu ent-
wickeln: Die chronologia architectonica war ein System der Klassifizierung
von Stilen und Ordnungen, die chronologia graphica trug zur chronologi-
schen Reihung der antiken Schriften bei, die chronologia aspidologica
untersuchte die auf Grabsteinen dargestellten Waffen. Aubrey hat ein
System der Beschreibung der Monumente ersonnen, das sich selbst die
notwendigen theoretischen Instrumente zur Erstellung einer universel-
len archologischen Methode schafft. Er hat den sichtbareren mittel-
alterlichen Spuren ebenso Aufmerksamkeit geschenkt wie den uerst
rtselhaften Monumenten der Megalithe, und er hat dabei die systema-
tische Ttigkeit der Registrierung und Beschreibung mit der Verwen-
dung eines Vergleichsmusters verbunden. Es ist nicht zu leugnen, da er
die Praxis dessen, was wir heute Archologie nennen, bereits in sehr
weitgehendem Mae vorweggenommen hat. Die Grnde dafr, da
seine Entdeckungen die wissenschaftliche Arbeit der Antiquare nicht
von Grund auf verndert haben, waren vielfacher Art. Eine solche weit-
gehende Vernderung der Ttigkeit erforderte noch ganz andere Instru-
mente und weitere geistige Entwicklungen. Wie man wei, ist die Ge-
schichte der Wissenschaften nicht das Ergebnis einer gradlinigen und
kumulativen Entwicklung, und es ist durchaus interessant sich zu fra-
gen, warum La Peyrre genau zu derselben Zeit damit scheiterte, die
gelehrte Welt von der Existenz der Menschen vor Adam zu berzeugen
sowie von der Tatsache, da die Geschichte der Menschheit den Rah-
37
Dazu Schnapp: The Discovery, S. 188196.
20 Alain Schnapp
men der jdisch-christlichen Chronologie weit sprengte.
38
Dennoch ist
sicher, da sich das Modell antiquarischer Beobachtung im Laufe des
17. Jahrhunderts grundlegend verndert hat. Es handelt sich aber nicht
um einen pltzlichen Umbruch wie etwa eine grundstzliche Aufgabe
der Vorstellung der Riesen nach der Art Picards oder des Glaubens an
den geologischen Ursprung der Megalithe.
4. Die Trennung von Betrachtung des Menschen
und Betrachtung der Natur
Pltzlich tauchten eine ganze Reihe von berlegungen und Beobachtun-
gen neuer Art auf. Paolo Rossi hat sehr berzeugend dargestellt, wie gro
die Rolle ist, die der Fund von Fossilien und die ersten Anfnge der stra-
tigraphischen Geologie in diesem Zusammenhang der erneuerten Frage-
stellungen spielten.
39
Die Verffentlichung eines stratigraphischen Inter-
pretationsschemas der geologischen Beschaffenheit der Toskana durch
Nicolas Stenon im Jahre 1669 ist gewi ein wichtiges Anzeichen. Aber es
handelt sich nicht um eine isolierte Entdeckung. Im Jahre 1685 entdeckte
der Geistliche Herr von Cocherel, ein bretonischer Edelmann, bei Gele-
genheit der Aufsicht ber Bauarbeiten an einem Flu in der Nhe von
Evreux in der Normandie ein Megalithgrab.
40
Er lie eine genaue Zeich-
nung der Grabsttte anfertigen und seine Bemerkungen ber den Unter-
schied zwischen den von polierten Steinen begleiteten Beisetzungen
und solchen, denen Bronzegegenstnde beigegeben waren, durch einen
Amtsdiener aufzeichnen. Zur selben Zeit grub Olof Rudbeck, einer der
eifrigsten Antiquare Schwedens, die Knigsgrber von Uppsala aus und
lie stratigraphische Schnitte anfertigen, die die Abfolge der Schichten
und die Lage der Grabkammern in aller Deutlichkeit zeigten. Zu Beginn
des 18. Jahrhunderts war die systematische Ausgrabung antiker Sttten
dann sowohl in Italien als auch im brigen Europa gngige Praxis gewor-
den. Die Ausgrabungen des ppstlichen Astronomen und Antiquars
Francesco Bianchini auf dem Palatin sind berhmt geworden.
41
Auch
38
Zu La Peyrre s. Popkin, Richard Henry: Isaac La Peyrre. Leiden 1987.
39
Zu den folgenden Bemerkungen s. Rossi, Paolo: The Dark Abyss of Time. Chicago
1984.
40
Zu Cocherel s. Schnapp: The Discovery, S. 357f.
41
Zu Bianchini s. Kockel, Valentin/Brigitte Slch (Hrsg.): Francesco Bianchini
(16621729) und die europische gelehrte Welt um 1700. Berlin 2005.
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 21
diese Ausgrabungen wurden von Aufzeichnungen in situ und ausfhr-
liche Beschreibungen begleitet. Aber die Demarkationslinie, die die roma-
nisierte Welt von der Welt der Barbaren trennte, blieb deutlich sichtbar.
Abgesehen von Stenon kenne ich keine antiquarischen Publikationen
innerhalb der Grenzen des antiken Limes, die in derselben Epoche
eine Vorstellung oder Aufzeichnung der Stratigraphie boten. Hingegen
gab es in der Tradition Rudbecks Mnner wie Rhode und Nnningh
in Deutschland oder Stukeley in Grobritannien, die sich in gewaltige
Unternehmungen von Ausgrabungen und Gelndeaufnahmen strzten,
whrend andere wie Hermann neue Techniken der Bodenforschung und
der Behandlung von Funden erprobten. Doch erst in der zweiten Hlfte
des Jahrhunderts wurde eine Theorie der Stratigraphie formuliert, wie
die Verffentlichung einer kurzen Abhandlung von Martin Mushard im
Jahre 1761 zeigt, deren Titel Ntzliche Unterweisung ber die Ausgra-
bung von Urnen und die Mittel dagegen, sie umsonst zu suchen trgt.
42
Dieses kleine Werk ist eine systematische Abhandlung ber die ver-
schiedenen Varianten der archologischen Oberflchenbehandlung, die
die Typologie der Bestattungen, die sichtbaren Zeichen ihrer Existenz
und die Mittel zu ihrer Freilegung umfat. Der Boden ist zu einem
Geschichtsbuch geworden, das man nach strengen Regeln betrachten,
methodisch erforschen und dann interpretieren mu, indem man die
Ergebnisse der Betrachtung und die Informationen ber den greren
Zusammenhang miteinander abgleicht. Einige Jahre spter trat Thomas
Jefferson fr eine solche Betrachtung dieser Art von Befunden ein, wel-
che die einzigen seien, die die Geschichte jener Vlker erhellen knnten,
die nicht ber die Schrift und bisweilen auch nicht ber Monumente im
abendlndischen Sinne des Worts verfgten:
Ich kenne nichts, das man ein Monument der Indianer nennen knnte, denn
ich wrde Pfeilspitzen, Steinxte, steinerne Pfeifen und nur halbwegs gestaltete
Bilder nicht als solche bezeichnen wollen. Von groangelegten Arbeiten gibt es,
denke ich, keine so ansehnlichen Reste, wie es ein gewhnlicher Entwsserungs-
kanal wre; auer man wollte die Grabhgel als solche bezeichnen, von denen
man ber das ganze Land verteilt viele findet.
43
42
Mushard, Martin: Ntzliche Unterweisung ber die Ausgrabung von Urnen und
die Mittel dagegen, sie umsonst zu suchen, in: Hannoverische Beitrge zum Nutzen
und Vergngen 2/17601761.
43
Jefferson, Thomas: Notes on the State of Virginia. Ms. 1784. S. Schnapp: The Disco-
very, S. 368ff.
22 Alain Schnapp
Von dieser berlegung ausgehend begann Jefferson die systematische
Ausgrabung eines Tumulus, die er von der Kunst der Freilegung und der
stratigraphischen Beobachtung der Schichten her mit einer derartigen
Genauigkeit betrieb, da sie in nichts der des einhundert Jahre spter
lebenden Englnders A. L. F. Pitt-Rivers nachstand, dem englischen
Evolutionisten und Theoretiker der stratigraphischen Ausgrabung. Die
Antiquare hatten sich allmhlich von dem Muster der Schatzgrberei
gelst, um sich der Sammlung antiker Objekte zuzuwenden. Seit der
Anlage der ersten Sammlungen im Zeitalter der Vernunft hatten sie lang-
same Fortschritte gemacht, um zu entdecken, da die Objekte und
Monumente sich zu Gruppen zusammenfgten, die ein im Zeichnen
und Vergleichen gebtes Auge identifizieren konnte.
Whrend ich diesen langen Weg voller Zuflle und Verzweigungen
in kurzer Zeit durchlaufen habe, war ich mir natrlich dessen bewut,
da der Entwicklungsstrang, dem ich gefolgt bin, sich fortsetzt und ver-
woben ist mit anderen Erfahrungen und anderen Disziplinen. Die
Antiquare in der Zeit der Aufklrung von Montfaucon ber Boulanger
bis Caylus wuten sehr wohl, da die Betrachtung des Bodens und der
Reste nicht ausreichten, um die Vergangenheit zu erforschen. Sie wu-
ten, da man ber eine umfassende theoretische Grundlage verfgen
mute, die es erlaubte, die verstreuten Beobachtungen zu einem Gan-
zen zusammenzufgen und eine Brcke zu schlagen zwischen der Ge-
schichte des Menschen und der Geschichte der Natur. Robert Hooke
forderte zu Beginn des 18. Jahrhunderts die Naturforscher dazu auf, die
Methoden der Antiquare zu bernehmen. Boulanger pldierte am Ende
desselben Jahrhunderts dafr, da die Antiquare ihr Kabinett verlassen
und auf den groen Weiten der Erde die Wunder der Natur untersuchen
sollten. Man mute also die Wissenschaften vom Menschen und die der
Natur miteinander vershnen, indem man dem Rat Buffons folgte:
Wie man in der politischen Geschichte die Literatur konsultiert, nach Mnzen
sucht, die antiken Inschriften entziffert, um die Epoche der menschlichen Revo-
lutionen und die Daten der moralischen Ereignisse zu bestimmen, so mu man
in der Naturgeschichte die Archive der Welt durchsuchen, die alten Monumente
aus den Gedrmen der Erde hervorziehen, ihre Trmmer wiedererwecken und in
einem Corpus von Belegen alle Zeichen der physischen Vernderung sammeln,
die uns zu den verschiedenen Altern der Natur zurckfhren knnen. Das ist das
einzige Mittel, einige Daten in der Unendlichkeit des Raumes festzulegen und
eine gewisse Zahl von Meilensteinen an der ewigen Strae der Zeit aufzustellen.
44
44
Leclerc de Buffon, G. L.: Des poques de la nature. Paris 1776, S. 3.
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 23
5. Die Wiederentdeckung Griechenlands
In all den Jahren, in denen die Antiquare sich in ganz Europa aufge-
macht hatten, ihre regionale, dynastische oder ethnische Vergangenheit
zu erforschen, hatte die Faszination Griechenlands niemals nachgelas-
sen.
45
Allerdings war seit den wissenschaftlichen Reisen des Cyriacus
von Ancona im 15. Jahrhundert und vor den sehr viel spteren Samm-
lern wie Arundel oder Diplomaten wie Nointel niemand mehr in der
Lage gewesen, die Forschung vor Ort aufzunehmen. Die Kenntnis Grie-
chenlands und der Trkei beschrnkte sich whrend des gesamten
16. Jahrhunderts auf die wenigen Beschreibungen der Entdeckungsrei-
senden und Konsuln, zu denen hchstens noch die Berichte der Geist-
lichen
46
und der Kaufleute kamen. Die Forschungsreise eines Gelehrten
war keine leichte Sache. Peiresc hatte sie durch die Kette seiner im ge-
samten Mittelmeerraum verteilten Korrespondenten ersetzt, der Earl
von Arundel war noch weiter gegangen und hatte seine eigenen Agenten
ins Land geschickt. Die Trennung zwischen den Antiquaren, die Grie-
chenland und Italien bewunderten, und ihren lokalen Kollegen, zwi-
schen der Tradition eines Arundel und der eines Camden oder Cotton,
war eine durchlssige Grenze. Lord William Howard etwa, ein Cousin
Arundels und ein ebenso leidenschaftlicher Sammler wie dieser, hatte
im Jahre 1600 in Begleitung von Sir Robert Cotton und William Cam-
den an einer Grabung im Norden des Hadrianswalls teilgenommen. Die
dabei gefundenen Inschriften und Architekturfragmente wurden nach
dem Vorbild der rmischen Palste sorgfltig in die Mauern der Som-
merresidenz Cottons verbaut.
47
Bei der Leidenschaft Arundels handelte
es sich, ganz wie bei Peiresc, um ein zwanghaftes Fieber, dem zwar der
Wunsch nach Wissen und Verstndnis innewohnt, der sich aber mit der
Begierde nach Besitz verbindet und dafr fand er bei seinen Agenten
45
Zur Wiederentdeckung Griechenlands s. Stoneman, Richard: Land of Lost Gods.
The Search for Classical Greece. London 1987.
46
Neben den Bemhungen einiger Missionare sind hierbei insbesondere Versuche
wrttembergischer Geistlicher zu nennen, die Ostkirche auf die Seite der Re-
formation zu ziehen. So wurde die Confessio Augustana ins Neugriechische
bersetzt, und zwei Tbinger Professoren, der Theologe Stephan Gerlach und der
Philologe Martin Crusius, unternahmen eine letztlich aber erfolglose
Gesandtschaftsreise. S. hierzu Zachariades, Georg Elias: Tbingen und Konstanti-
nopel im 16. Jahrhundert. Martin Crusius und seine Verhandlungen mit der Griechisch-
Orthodoxen Kirche. Diss. 1938. Gttingen 1941.
47
Howarth, David: Lord Arundel and his circle. Yale 1985, S. 12.
24 Alain Schnapp
wie Sir Thomas Roe ebenso ungestme und ihrem Herrn und Auftrag-
geber nacheifernde Mitarbeiter. Roe war ein Entdeckungsreisender im
wahren Sinne des Wortes: Er war den Amazonas hinaufgefahren und
hatte Grobritannien beim Gromogul in Indien vertreten. Nach gro-
em Erfolg und einer reichen Ernte von Teppichen und seltenen Gegen-
stnden war er im Jahre 1621 nach Konstantinopel entsandt worden, um
dieselbe Funktion eines Vertreters Grobritanniens am Hofe des groen
Herrschers zu erfllen. Roe war ein Mensch der Tat, der auf die drngen-
den Wnsche Arundels mit einer zutiefst politischen Betrachtung ant-
wortete:
Hereby I find no difficulty in procuring any such reliques [of antiquitiy] if
I could discover them. For I think that they would here follow the precept of a
barbarous Goth; not to destroy, but leave and deliver them to us for our occu-
pation, to divert us from the thought or use of arms. But they are absurdly mis-
taken for civility and knowledge do confirm and not effeminate good and true
spirits.
48
Bildung und Wissen sind Mittel und Grundlage fr die Geschlossenheit
der Gesellschaft und ihre Entwicklung, und sie rechtfertigen die Samm-
lerleidenschaft. In dieser intellektuell konstruierten Apologie der ber-
nahme der Antike entdeckt man die Argumente eines Peiresc wieder, wie
sie Gassendi geschildert hat.
49
Um ein solches Programm realisieren zu
knnen, brauchte es Mnner mit entsprechender Erfahrung: William
Petty verkrperte in hervorragender Weise diese Art von Abenteurer mit
einer hinreichenden Bildung, um selbst zugleich Kenner und Geschfts-
mann zu sein, der in der Lage war, Hndler wie Botschafter gefgig zu
machen. Der Abgesandte des Earl of Arundel unternahm zunchst den
Versuch, die sechs Reliefs des Goldenen Tores von Konstantinopel
in seine Hnde zu bekommen, was glcklicherweise ohne Erfolg blieb,
aber er hatte mehr Glck dabei, dem armen Samson, dem Agenten von
Peiresc, bei der Marmorstele von Paros den Rang abzulaufen, die ein fr
alle Mal den Ruhm Lord Arundels begrndete. Diese Inschrift, eine der
48
Howarth: Lord Arundel, S. 88: Mithin stoe ich auf keinerlei Schwierigkeiten, ir-
gendwelche derartigen Reste [der Antike] zu beschaffen, wenn ich sie entdecken
konnte. Denn ich glaube, sie wollen hier der Lehre eines barbarischen Goten fol-
gen: nicht zerstren, sondern sie stehenlassen und uns bergeben zu unserem
Verderben, um uns von dem Gedanken oder dem Einsatz von Waffen abzulen-
ken. Aber sie irren sich in absurder Weise, denn Bildung und Kenntnis bestrken
ja gute und treue Geister und verweichlichen sie nicht.
49
Gassendi, Pierre: Viri illustri Nicolai Claudii Fabricii de Peiresc Senatori Acquisextensis
Vita. Paris 1641.
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 25
wichtigsten der Klassischen Zeit, sollte alle Gelehrten Europas in hchste
Aufregung versetzen, angefangen von jenem berhmten James Ussher,
dem Primas von Irland, der, wie er meinte, zweifelsfrei und endgltig
das genaue Datum des Tages der Erschaffung der Erde bestimmt hatte.
50
Das Marmor Parium war ein Gegenstand fr den Geist und nicht frs
Auge,
51
und als solches war es ein Meilenstein auf dem Wege der Wie-
derentdeckung des antiken Griechenlands. Mnner wie Petty und Sam-
son waren die Wegbereiter. Die Sammlung von Inschriften, Mnzen
und Statuen trug dazu bei, die Kenntnis und Vorstellung von der anti-
ken griechischen Welt zu verndern. Die Gegenstnde, die von den
Sammlern und ihren Agenten und bald auch, wie man sehen wird, von
reisenden Antiquaren entdeckt wurden, trugen dazu bei, das Bild der
griechischen Welt und das Wissen ber sie vllig zu wandeln. Jacques
Spon war einer der kompetentesten und einflureichsten Begrnder der
Inschriftenkunde des antiken Griechenlands. Er verteidigte die veritas
und auctoritas dieser neuen historischen Quellen:
De plus il nest pas si ais de supposer ou de falsifier une inscription antique que
de falsifier un livre ou de lui donner un autre auteur vritable: il faut une grande
dlicatesse desprit pour reconnatre quune pice nest pas dun tel auteur. Mais
pour prononcer quune inscription nest pas antique, je ne crois quil ait tant de
peine pourvu quon sy soit un peu tudi. La pierre que les Anciens choisissaient,
la forme dont on la taillait, et la figure exacte des lettres jointes la profondeur
quon leur donnait, ne sont pas des choses faciles imiter des ouvriers igno-
rants.
52
Arundel war ein Sammler mit Verbindungen zu den Antiquaren, die
Bodenforschung betrieben, wie Camden und Cotton. Spon hatte sich,
bevor er auf seine einzigartige Reise nach Griechenland ging, dem Stu-
dium der Antiken seiner Heimatstadt Lyon gewidmet, und er hatte mit
50
Gould, Steve J.: Fall in the House of Ussher in Eight Little Piggies. London 1993.
51
Horwarth: Lord Arundel, S. 93: an object for the mind, not the eye.
52
Spon, Jacques: Recherches des Antiquits de la ville de Lyon. Lyon 1673, S. 7: Im
brigen ist es nicht so leicht, eine antike Inschrift zu erfinden oder zu flschen,
wie man ein Buch flschen kann oder ihm einen anderen tatschlich existieren-
den Autor geben: Man braucht eine groe Feinheit des Geistes, um zu erkennen,
da ein Stck nicht von einem bestimmten Verfasser ist. Aber mit der Erklrung,
da eine Inschrift nicht antik ist, hat man, glaube ich, nicht so viel Mhe, sofern
man das ein wenig studiert hat. Der Stein, den die Alten auswhlten, die Form,
in der man ihn zurichtete, und die genaue Form der Buchstaben zusammen mit
der Tiefe, die man ihnen gab, sind keine Einzelheiten, die ein ungebter Arbeiter
leicht nachmachen kann.
26 Alain Schnapp
einem unerhrten Weitblick die Rolle vorausgesehen, die die Epigraphik
beim Aufbau einer neuen Geschichte des antiken Griechenlands spielen
sollte.
53
Tatschlich nahm die Erkundung Griechenlands in der zweiten
Hlfte des 17. Jahrhunderts ein neues Ausma an und folgte einem
neuen Modell. Man wird sehen, aus welchen Grnden das geschah.
Aber zuvor sollte man vielleicht doch daran erinnern, welche Rolle
Griechenland in der europischen Kultur der vorangehenden Zeit ge-
spielt hatte.
6. Die Reisen in Griechenland vor der Zeit der Aufklrung
Whrend des 16. Jahrhunderts gab es nur wenige franzsische Reisende
im stlichen Mittelmeerraum. Dennoch bemhten sich Mnner wie
Guillaume Pellicier, Pierre Gilles, Pierre Belon und der berhmte Andr
Thvet whrend ihrer Reisen, die zugleich wissenschaftlichen wie Han-
delszwecken dienten, Antiken zu sammeln.
54
In den ersten Jahrzehnten
des 17. Jahrhunderts war es blich, da der franzsische Knig Botschaf-
ter entsandte, deren Aufgabe es unter anderem war, Bcher und Antiken
zu kaufen. Wir besitzen noch heute die Korrespondenz dieser Mnner
wie Hurault de Boitaill, Savary de Brves und Harlay de Saucy. Die
meisten von ihnen hatten Verbindungen zu dem Milieu der Antiquare
ihrer Zeit geknpft, vor allem zu den Brdern du Thou und Fabri de
Peiresc. Ein sehr interessanter Brief von Saucy an du Thou fhrt uns die
Atmosphre dieses Austauschs vor Augen: Maintenant que le temps
se fait beau, je miray promener par les bibliothques, et si je trouve
quelque livre ancien que nous nayons point, je lachteray et le feray
transcrire pour vous.
55
Ein anderer Brief des Botschafters du Houssay an Richelieu aus dem
Jahre 1638 lt die politische und kirchliche Dimension der antiquari-
schen Ttigkeit des Diplomaten erkennen:
53
Zu Spon s. Etienne, Roland/Mossire, Jean-Claude (Hrsg.): Jacob Spon. Un huma-
niste lyonnais du XVIIme sicle. Lyon 1993.
54
Zu diesem Thema s. Wolfzettel, Friedrich: Le discours du voyageur. Paris 1996.
55
Harlay de Saucy an Jacques Auguste du Thou am 4. Mai 1612. Der Text bei
Omont, Henri: Missions archologiques francaises en Orient. Paris 1902, S. 55: Jetzt,
wo das Wetter gut ist, werde ich von Bibliothek zu Bibliothek gehen, und wenn
ich ein antikes Buch finde, das wir noch nicht haben, werde ich es kaufen und fr
Sie abschreiben lassen.
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 27
Monseigneur, aprs le service du roi, je ne puis avoir de soin plus lgitime que
ceux de celuy de Vostre Eminence. [] Les plus beaux monuments de lantiquit
semblent navoir surmont linjure de tant de sicles que pour estre jugez dignes
de loger dans ses bibliothques et ses cabinets.
56
Die Sammlung des Knigs bedurfte keiner Rechtfertigung wie die
Sammlung der Hocharistokratie (Arundel) oder Aristokratie (Peiresc).
So wie der Garten des Knigs die schnsten Blumen verdiente, muten
die kniglichen Sammlungen durch die kostbarsten Kunstwerke berei-
chert werden. Das heit nicht etwa, da die Botschafter keinerlei Sinn
fr intellektuelle Betrachtungen hatten, aber ihre Aufgabe im Dienste
des Knigs machte die Diplomaten eher zu Sammlern als zu wissen-
schaftlichen Beobachtern oder gar Forschern von der Art eines Peiresc
oder eines Spon. Doch der junge Knig Ludwig XIV. mochte sich zu
einem Zeitpunkt, wo der franzsische Einflu im Orient von England
und Holland bedroht war, nicht mit der Routine der vorangehenden
Botschafter zufriedengeben.
57
Im August 1670 entsandte er Monsieur de
Nointel als seinen Vertreter an die Heilige Pforte.
58
Das war eine Ge-
sandtschaft in groem Stil, bei der er Nointel von einer ganzen Flotille
und Dutzenden von Mitarbeitern begleiten lie, um so die Gre
des Knigs von Frankreich zu demonstrieren, aber auch in der Absicht,
die katholische und die orthodoxe Kirche einander anzunhern. Im
Gefolge des Botschafters fanden sich uerst gelehrte Mnner. Der
junge Orientalist Antoine Galland, der dem Botschafter von dem illu-
stren Antoine Arnaud aufs Wrmste empfohlen worden war, hatte zur
Aufgabe, zum Nutzen der theologischen Interessen des franzsischen
Knigs die Texte und Glaubensbekenntnisse der Orthodoxen zu sam-
meln. Nointel wurde auch von dem Maler Jacques Carrey begleitet,
der die berhmten Zeichnungen des Parthenonfrieses anfertigen sollte.
Handschriften, Mnzen, Inschriften und die verschiedensten Frag-
mente von Antiken: nichts entging der Leidenschaft Nointels, der dabei
von seinen Mitarbeitern untersttzt wurde. Sammeln, die Landschaft
56
Du Houssay an Richelieu im Jahre 1538. Der Text bei Omont: Missions, S. XI
(Einleitung): Monseigneur, nach dem Dienste im Interesse des Knigs kann ich
keine fglichere Sorge haben als den Dienst fr Eure Eminenz []. Die schn-
sten Monumente der Antike scheinen die Schande so vieler Jahrhunderte nur
deshalb berlebt zu haben, um fr wrdig befunden zu werden, sich in seinen
Bibliotheken und Sammlungen zu befinden.
57
Zur Situation im Zusammenhang mit der Entsendung von Nointel s. Vandal,
Albert: Les voyages du Marquis de Nointel (16701680). Paris 1900, S. 121.
58
Zu Nointel s. auch Omont: Missions, S. 175221.
28 Alain Schnapp
beschreiben, Zeichnungen und Bilder anfertigen lassen war ein Teil des
Alltags der Mission:
Si jay le malheur de ne pas excuter ce que je me promets (rdiger des mmoires
sur les particularits observes pendant son voyage), la peinture y pourra suppler
en quelque sorte par le soin que je prends doccuper des peintres la reprsenta-
tion des plantes, arbres, fruits, fleurs, ports de mer, montagnes, villes, isles, points
de vue, des plus beaux habillements de chaque lieu, dont jay voulu prendre aussy
les originaux, aussy bien que les animaux, plantes et fruits, mdailles et marbres
que jai p rencontrer les plus remarquables.
59
Man sieht hier, wieviel der Marquis der Kultur der Antiquare seiner Zeit
verdankte. Die Idealvorstellung einer umfassenden Beschreibung eines
Camden oder eines Peiresc wird hier als Vorbild erkennbar. Die Natur,
die gesellschaftlichen Verhltnisse, die Monumente, die bemerkenswer-
ten Gegenstnde: alles, was man betrachten konnte, fgte sich in eine
Art virtuelle Kartographie ein. Aber Nointel war nicht nur ein beschei-
dener Antiquar, sondern er konnte auch die Arbeit der Beobachtung in
grozgigem Ausma den ihn begleitenden Malern anvertrauen. Im
Grunde war, wie er andeutete, der Bericht fr ihn von untergeordneter
Bedeutung. Es war das Schauspiel, das zhlte, und er lie es sich nicht
entgehen, daran teilzuhaben, wenn er die Mue dazu fand. David Con-
stantine gibt eine faszinierende Beschreibung des Weihnachtsfestes wie-
der, das Nointel in demselben Jahr 1673 in einer Grotte der neben Anti-
paros liegenden Insel veranstaltet hat:
[] accompagn de plus de 500 personnes, soit de sa maison, soit machands, cor-
saires ou gens du pays qui lavoient suivi. Cent grosses torches de cire jaune, &
400 lampes qui brloient jour & nuit toent si bien disposes, quil y faisoit aussi
clair que dans leglise la mieux illumine. On avoit post des gens despace en
espace dans tous les prcipes, depuis lautel jusques louverture de la caverne: ils
se firent le signal avec leurs mouchoirs, lorsquon leva le corps de J.C. A ce signal
on mt le feu 24 botes & plusieurs pierriers qui toient lentre de la caverne:
les trompettes, les hautbois, les fifres, les violins rendirent cette consecration plus
magnifique. L Ambassadeur coucha presque vis vis de lautel, dans un cabinet
59
Brief an Pomponne vom 10. Dezember 1673 aus Naxos. S. dazu Omont: Missions,
S. 191f.: Wenn ich das Unglck haben sollte, nicht zu vollenden, was ich vor-
habe [Erinnerungen ber die whrend seiner Reise beobachteten besonderen Ein-
zelheiten zu verfassen, A.S.], kann die Malerei in gewisser Hinsicht an ihre Stelle
treten, da ich Sorge trage, die Maler dazu anzuhalten, die Pflanzen, Bume,
Frchte, Blumen, Seehfen, Berge, Stdte, Inseln, Aussichten und die schnsten
Trachten eines jeden Ortes abzubilden, von denen ich auch die Originale bekom-
men wollte, sowohl die Tiere, Pflanzen und Frchte, Mnzen und die bemerkens-
wertesten Marmorsteine, die ich finden konnte.
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 29
long de sept ou huit pas, taill naturellement dans une de ces grosses tours dont
on vient de parler.
60
Nointel war zwar Antiquar, aber vor allem war er doch ein Botschafter,
der seine diplomatische Mission mit seiner persnlichen Wibegier so-
wie seinen politischen und religisen Zielen zu kombinieren wute, und
ebenso natrlich mit seiner ffentlichen Erscheinung. Nchterner gese-
hen bestand ohne Frage zugleich auch ein Interesse der hohen Staatsbe-
amten, die sich des Gewinns bewut waren, den der Knig aus solchen
Missionen ziehen konnte, und von da an veranstaltete man sie regelm-
ig. Die Gelehrten, die fr diese kniglichen Kommissionen ausgewhlt
wurden und unter denen sich manchmal Deutsche wie Pater Wansleben
befanden, empfingen genaue Anweisungen, die die wissenschaftliche
Dimension dieser Art von Unternehmungen belegen, wie auch der fol-
gende Brief Colberts an seinen Beauftragten zeigt:
Il observera et fera des descriptions aussi justes quil pourra des palais et basti-
ments principaux, tant antiques que modernes, scituera les lieux o il passera, et
taschera de tirer et restablir les plans et les profils de ceux qui sont ruins; et sil ne
le peut faire, de tous les bastiments entiers, il le fera du moins des principales par-
ties []. Sil rencontre aussy parmi ces ruines anciennes des statues ou bas-reliefs
qui soient de bon maistre, il taschera de les avoir et de les remettre entre les mains
de ses correspondants. Il dressera recueil des inscriptions anciennes quil trouvera
et taschera des les copier figurativement, en la mesme langue quelles sont crites,
se les faisant lire et expliquer par quelque interprte, sil nen connoit pas les
caractres.
61
60
Constantine, David: Early Greek Travellers and the Hellenic Ideal. Cambridge 1984,
S. 11f.: [] in Begleitung von mehr als 500 Personen, seien es Angehrige seines
Hauses oder Kaufleute, Freibeuter oder rtliche Bewohner, die sich ihm ange-
schlossen hatten. Hundert groe Fackeln von gelbem Wachs und 400 Laternen,
die Tag und Nacht brannten, waren so gut verteilt, da es so hell war wie in der am
besten beleuchteten Kirche. Man hatte Leute in regelmigem Abstand an allen
Vertiefungen vom Altar bis zum Eingang der Hhle aufgestellt: Sie gaben sich mit
ihren Taschentchern das Zeichen, als der Leib Christi aufgehoben wurde. Auf
dieses Signal hin legte man Feuer an 24 Bchsen und an mehrere Mrser, die sich
am Eingang der Hhle befanden. Die Trompeten, die Oboen, die Querpfeifen,
die Geigen machten diese Weihung noch groartiger. Der Botschafter schlief fast
genau gegenber dem Altar in einer Nische von sieben oder acht Schritt, die von
der Natur in einen dieser groen Trme geschnitten war, von der wir vorher ge-
sprochen haben.
61
Omont: Missions, S. 60: Er beobachte und fertige so genaue Beschreibungen der
frstlichen Palste und Gebude an, als er kann, sowohl der antiken wie der mo-
dernen, bestimme die Orte, an denen er vorbeikomme, und mache es sich zur
Aufgabe, die Plne und Umrisse der Gebude, die zu Ruinen geworden sind, zu
zeichnen und wiederherzustellen; und wenn er das nicht von allen erhaltenen Ge-
30 Alain Schnapp
Die Anweisungen Colberts weisen auf ein neue Art der Erkundung und
Forschung voraus, der die meisten Entdecker Griechenlands und des
Orients im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts folgen sollten. Der Brief
bringt dieselbe Art von Interessen zum Ausdruck, die sich bei den wi-
begierigen, aber von Knigen unabhngigen Entdeckungsreisenden
wie Spon und Wheler findet. Bei Spon ist allerdings der Anteil der
Sammlerleidenschaft sehr viel geringer, und was ihn wirklich interes-
siert, ist die Entdeckung eines Griechenlands, das durch die Entziffe-
rung und Sammlung der Inschriften dazu gebracht wird, sein Schweigen
zu brechen. Dieses Erkenntnisinteresse teilen Wansleben und Spon,
und ebenso die Absicht, Plne zur Verfgung zu stellen, und durch Bil-
der die Einzigartigkeit der Landschaft und der Monumente Griechen-
lands zu bezeugen.
7. Griechenland als Horizont und Bezugspunkt
Die Reisettigkeit in Griechenland kann nur im Zusammenhang mit der
Wiederentdeckung der gesamten Antike gesehen werden, deren allge-
meiner Charakter bereits herausgestellt wurde. Die Antiquit explique,
das gewaltige Werk des Bernard de Montfaucon ber die berreste der
Antike, ist eines der Bcher, das in ganz Europa das Interesse an der An-
tike erweckte. Diese Zusammenfassung in zehn Bnden, an welcher der
Benediktinermnch mehrere Jahrzehnte gearbeitet hatte, war sogleich
nach ihrem Erscheinen im Jahre 1719 vergriffen. Montfaucon wollte eine
Art Corpus der Zeugnisse der gesamten Antike nach der Art des Cas-
siano del Pozzo bieten. Doch in dieser Antike, wie sie Montfaucon nach
einem langen Aufenthalt in Italien verstand, fehlten die griechischen
Monumente weitgehend. Sein Werk spiegelte den Bestand der Samm-
lungen in Italien und Europa wider, die sehr viel reicher an rmischen
oder gyptischen Objekten waren als an eigentlich griechischen Monu-
menten. Die Reisebeschreibungen Nointels und Spons und die Berichte
ber die Expeditionen Gallands und Wanslebens blieben indes nicht
buden tun kann, tue er das wenigstens von den hauptschlichen Teilen [].
Wenn er unter diesen antiken Ruinen auch Statuen oder Reliefs finde, die von
einem guten Meister sind, bemhe er sich, sie zu erlangen und in die Hnde sei-
ner Verbindungsleute zu bergeben. Er fertige eine Sammlung der Inschriften an,
die er finden wird, und mache es sich zur Aufgabe, sie abzuzeichnen, in derselben
Sprache, in der sie geschrieben sind, und lasse sie sich von einem Dolmetscher
vorlesen und erklren, wenn er die Buchstaben nicht kennt.
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 31
ohne Echo. Im Jahre 1729, zehn Jahre nach dem Erscheinen der Be-
standsaufnahme Montfaucons, schickte der Knig auf dessen Anraten
Michel Fourmont und Franois Sevin nach Griechenland und in die
Trkei auf eine Mission, die drei Jahre dauerte.
62
Fourmont verfgte
ber eine breite orientalistische Bildung und kannte die Arbeiten seiner
Vorgnger sehr gut. Er unternahm eine ausfhrliche Reise auf dem Pelo-
ponnes, ging daran, die Sttten zu beschreiben und die Inschriften zu re-
gistrieren, und entwickelte eine archologische Topographie des Landes
nach der Art Camdens. Er versuchte sogar Ausgrabungen in Sparta in
Angriff zu nehmen, und unter dem Mantel des Antiquars schien ein we-
nig der Archologe hervor:
Nous marchons dans Athnes avec un train tout fait bizarre: Le drogman va de-
vant nous pour nous indiquer le quartier []. Nous le suivons, lun charg dune
serpette, dun hoyau, et dune pince pour dterrer et pour enlever les marbres, un
autre a une chelle et des cordes pour grimper sur les murailles, pour descendre
dans les enclos abandonns et pour se guinder en lair et gravir jusques sur les
toicts des glises et des clochers, un autre a dans sa main un mataras plein deau,
des ponges, un ballet pour nettoyer les terres et rendre les caractres visibles, et
moi et mon nepveu sommes chargez des registres, comme si nous allions recueil-
lir la taille, ou pour mieux dire, exiger le carasch.
63
Die pittoreske Beschreibung lt ein sehr praktisches Interesse fr die
Inschriften erkennen und einen festen Willen, alles zu betrachten, der
sich mit einer Sammlerleidenschaft paarte. Unter dem Druck des Knigs
und seiner Auftraggeber verhielt sich Fourmont oft nach seinen eigenen
Worten wie ein Barbar, der die Monumente ohne jeden Skrupel zer-
legte, und der nach Aussage seiner Zeitgenossen so weit ging, Inschriften
zu zerstren, damit seine Lesungen keiner Kritik unterzogen werden
konnten. Er hat sogar falsche Inschriften fabriziert, um den Erfolg seiner
62
Stoneman: Land of Lost Gods, S. 96.
63
Brief Fourmonts an den Marquis de Villeneuve vom 17. April 1729. Text bei
Omont: Missions, S. 556: Wir gehen mit einem ziemlich sonderbaren Gefolge
durch Athen: Der Dragoman geht vor uns her, um uns das Viertel zu zeigen [].
Wir folgen ihm, einer trgt eine Brste, eine Hacke und eine Klemme um die
Marmorsteine freizulegen und mitzunehmen, ein anderer eine Leiter und Stricke
um auf die Mauern zu klettern, in verlassene Einfriedungen hinabzusteigen und
um sich in die Hhe zu schwingen und bis auf die Dcher der Kirchen und Glok-
kentrme zu gelangen, ein anderer hlt eine mit Wasser gefllte mataras in Hn-
den, Schwmme, einen Besen um die Erdreste wegzufegen und die Buchstaben
sichtbar zu machen, und ich und mein Neffe haben die Aufgabe der Registrie-
rung, als ob wir Ma nehmen wollten oder, besser gesagt, den carasch.
32 Alain Schnapp
Mission zu sichern.
64
Whrend er als Epigrahiker gewi nicht so kennt-
nisreich und unendlich viel nachlssiger war als Spon, zeigte Fourmont
mehr die Neugier eines Archologen. Er interessierte sich fr die Lage der
Gegenstnde im Boden und dessen Beschaffenheit. Seine zweifelhaften
Methoden drfen nicht die Originalitt seiner Arbeit vergessen lassen,
von der nur ein zusammenfassender Bericht verffentlicht wurde.
65
In der Mitte des 18. Jahrhunderts trugen die technischen Metho-
den der antiquarischen Forschung, die man im Italien der Renaissance
erfunden hatte, die dann aber durch die Forschungen der Antiquare in
Deutschland, Skandinavien und Grobritannien zunehmend bereichert
worden waren, wesentlich dazu bei, den Blick auf das alte Griechenland
zu verndern. Der Comte de Caylus verkrpert diese Vernderung
der Einstellung aufs Beste. Sein Recueil dantiquits gyptiennes, trusques,
grecques et romaines (Paris 17521767) sollte keineswegs ein systematisches
Handbuch nach der Art Montfaucons und seiner Vorgnger sein.
66
Das
Werk besteht aus einem systematischen Katalog der Gegenstnde, die
Caylus sich durch Vermittlung seiner Agenten hatte beschaffen knnen.
Als guter Aristokrat hielt Caylus sich an die Gewohnheit, Beauftragte zu
ernennen, die in den verschiedenen Stdten Italiens fr ihn arbeiteten
und die Beziehungen mit den Konsuln in der Levante aufrechterhielten.
Aber er hat auch selbst Griechenland und Kleinasien bereist, er wute,
wie die Landschaften und die Monumente in ihrer ursprnglichen
Umgebung aussahen. Der Naturforscher in ihm (physicien, wie er selbst
von sich sagte) ist strker als der Philologe. Er wollte selbst die von ihm
beschriebenen Gegenstnde bewahren und zeichnen oder zeichnen las-
sen. Die Autopsie, die Spon fr die Inschriften forderte, wollte er auf die
Monumente oder Gegenstnde anwenden, so klein oder fragmentarisch
sie auch waren. Caylus ging als Erster an die klassischen Monumente
mit einer typologischen Methode heran, die sich, wenn auch mit noch
sehr groben Mitteln, darum bemhte, Ort und Zeit des Ursprungs
zu bestimmen. In der zweiten Hlfte des 18. Jahrhunderts wurden die
Autopsie und die interpretierende Beschreibung mit den zusammenfas-
senden Darstellungen von Leroy und von Stuart und Revett zur Regel.
64
Stoneman: Land of Lost Gods, S. 102109.
65
Fourmont, Michel: Relation abrge du voyage littraire [] fait dans le Levant,
in: Histoire de lAcadmie Royale des Inscriptions et Belles Lettres, Bd. VIII. Paris 1733,
S. 344359.
66
Aghion, Irne (Hrsg.): Caylus, mcne du roi. Collectionner les antiquits au XVIII
e
si-
cle. Cabinet des Mdailles de la Bibliothque Nationale de France, INHA, Paris
2002.
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 33
Diese Architekten setzten sich direkt mit den Monumenten auseinander
und betrachteten sie an ihrem Standort, nahmen eine systematische
Registrierung vor und verffentlichten diese dann in einem Folioband
mit zunehmend originalgetreuen Abbildungen. Es bestand nun ein In-
teresse an Griechenland, wie das Buch Voyages pittoresque des Botschafters
Choiseul-Goffier oder die Berichte des Konsuls Fauvel, seines anfng-
lichen Mitarbeiters und spteren Residenten in Athen, belegen.
67
Die
Entdecker wohnten nun vor Ort, und ihre Protektoren und Auftragge-
ber wie Choiseul und Elgin begleiteten sie. Die scharfe Konkurrenz, die
zwischen den beiden Botschaftern Frankreichs und Grobritanniens um
die Marmorskulpturen des Parthenon entbrannte, ist das Kennzeichen
eines neuen Abenteuers, fr das die Expedition des Generals Bonaparte
nach gypten das Startsignal gegeben hatte. Choiseul und Elgin und
ihre Reprsentanten oder Zeichner Fauvel und Lusieri waren die Prota-
gonisten dieses verbissenen Wettlaufs, der die schlimmsten Auswchse
der Besitzgier zum Vorschein brachte, und das auf Kosten der Vernunft
und des Respekts vor der Zusammengehrigkeit der Monumente, die
Peiresc und Gassendi so teuer gewesen war. Bis zu jenem Zeitpunkt traten
deutsche Reisende, wie Constantine unterstreicht, nicht in Erscheinung,
aber ihre Stunde sollte bald kommen.
68
Winckelmann hatte seinerseits
verstanden, da das Interesse an der griechischen Kunst weit ber die
Kreise der Gelehrten hinausreichte. Er hat aus der Quelle seiner schrift-
stellerischen Ttigkeit die Mittel geschpft, die Kunst des Landes Grie-
chenland nahezubringen, das er selbst niemals hat besuchen wollen.
Die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts sind nicht allein von dem
siegreichen Unternehmen Elgins gekennzeichnet, das das British Mu-
seum in die Lage versetzte, den Parthenonfries auszustellen. Mnner wie
Otto Magnus von Stackelberg in gina oder Haller von Hallerstein
in Bassai gingen denselben Weg einer systematischen Plnderung der
Skulpturen, die bis dahin die Tempel schmckten.
In diesem Wettlauf, sich ber die Monumente die Kultur des antiken
Griechenlands anzueignen, sollte Frankreich mit der Expedition in
die Morea (Peloponnes) im Jahre 1829 eine besondere Rolle spielen. Das
67
S. dazu Bracken, Catherine Philippa: Antiquities acquired. The Spoliation of Greece.
London 1975, sowie Bourguet-Bernard, Marie-Nolle u. a. (Hrsg.): LInvention
scientifique de la Mditerrane. Egypte, More, Algrie (Editions de lEHESSS). Paris
1998.
68
Zu all dem s. Stoneman: Land of Lost Gods, S. 175206 (A Tale of three cities:
London, Munich, Paris).
34 Alain Schnapp
Vorbild war die Expedition nach gypten des Generals Bonaparte.
69
Diese Art von Unternehmen unterschied sich von den klassischen Rei-
sen der Antiquare dadurch, da eine ganze Gruppe von Forschern an
ihnen teilnahm, und da es dabei eine kollektive Arbeitsteilung gab.
Die Expedition nach gypten war ein Vorhaben, das alle Bereiche des
Wissens, der Natur, der menschlichen Ttigkeit und der Knste abdek-
ken sollte. Die Expedition in die Morea hatte bescheidenere Ziele, die
vom Institut de France und seinen verschiedenen Akademien festgelegt
worden waren. Der Gesamtzusammenhang ist derselbe, nmlich der
einer militrischen Kampagne, die den Anspruch erhebt, zur Befreiung
der Bewohner beitragen zu wollen. Doch die Organisation der Expe-
dition nach Griechenland ist ganz anders als das von Bonaparte und
seinem groen Gefolge an Wissenschaftlern festgelegte Programm. Das
neue Vorhaben ist in drei Abteilungen gegliedert: Eine naturwissen-
schaftliche unter der Leitung des Geologen Bory de Saint Vincent, eine
architekturgeschichtliche unter Abel Blouet und eine archologische,
die von Lon Joseph Dubois geleitet wurde. Darin zeigt sich eine neue
Unterteilung des Wissens und die Geburt neuer unabhngiger Diszipli-
nen. In diesem Zusammenhang sieht man, wie der Antiquar in den Hin-
tergrund tritt und die Archologie sich als neue Disziplin etabliert, die
die Aufnahme der Monumente, das Studium der antiken Gegenstnde
und vor allem die Erforschung der landschaftlichen Umgebung mitein-
ander verbindet. Diese Archologie der Eroberer ist indes nicht die von
Dubois, der seine Arbeit nicht zu Ende fhren sollte. Sie wird ein neues
Verhltnis zum Raum entwickeln, einen Willen zur Beherrschung des
Gelndes, von dem Bory de Saint Vincent die folgende groartige Defi-
nition gab:
Il ne sera pas cit dans mes deux volumes une source, un ruisseau, une ruine, une
pierre mme quand ces choses prsenteront quelque particularit digne de remar-
que, que chacune ne soit indique dans une reprsentation topographique desti-
ne guider, par les mmes chemins, ceux qui my voudront accompagner. Cest
la carte sous les yeux quune relation fidle doit se lire.
70
69
Laurens, Henri: Lexpdition dEgypte 17981801. Paris 1989.
70
Bory de Saint-Vincent, Jean Baptiste: Expdition scientifique de More, Section des sci-
ences physiques []. Vol. I. Paris 183236, S. 3: In meinen zwei Bnden wird keine
Quelle, kein Bach, keine Ruine und kein Stein erwhnt werden, selbst wenn diese
Einzelheiten eine bemerkenswerte Besonderheit aufweisen, ohne da sie jede
in einer topographischen Abbildung eingezeichnet sind, die diejenigen, die mir
folgen wollen, auf demselben Weg begleitet. Einen genauen Bericht mu man mit
der Karte vor Augen lesen.
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 35
Buffon hatte den Naturforschern nahegelegt, dem Vorbild der Antiquare
zu folgen. Bory de Saint-Vincent drehte die Argumentation um: Um eine
wirkliche Wissenschaft zu werden, mute die Archologie sich als eine
positive und auf eine exakte Kartographie gesttzte Erfahrung prsentie-
ren. Zu demselben Zeitpunkt, an dem sich Griechenland befreite, rumte
die alte Disziplin der antiquarischen Forschung das Feld vor der vor-
wrtsdrngenden Archologie des Expeditionskorps. Griechenland, das
ein Gebiet ferner Entdeckungsreisen gewesen war, sollte zu einem gewal-
tigen Ausgrabungsort werden. Die Antiquare der Renaissance hatten den
Weg zu einer Kartographie der Vergangenheit erffnet, die eine Quelle
fr die Geschichte sein wollte, und dieses Vorbild hatte die Gelehrsam-
keit in ganz Europa beeinflut, das sich die rmischen Lehren angeeignet
und sie bereichert und weiterentwickelt hatte. Alle Herrscher Europas
hatten wissenschaftliche Expeditionen ausgesandt, um ihre Sammlungen
zu bereichern und ihre diplomatischen Ambitionen zu untersttzen.
Von der Expedition nach gypten an wurde die Kenntnis der Vergan-
genheit zu einem Instrument der kolonialen Expansion, denn die Auf-
rechterhaltung der politischen und wirtschaftlichen Herrschaft erfor-
derte eine topographische Kenntnis der Lnder, die man kolonisieren
wollte. Die Antiquare waren die Handelnden einer Erforschung der An-
tike, die als eine zu entdeckende Landschaft aufgefat wurde. Ausma
und Ziel hatten sich verndert. Nun ging es darum, von der Erforschung
zu einer Verarbeitung der neuen Quellen zu gelangen, die sich auf ganz
andere Strategien des Erwerbs von Wissen sttzte. ber die Geographie
und die Topographie geriet die Archologie zur positiven Wissenschaft
im Dienste des Nationalstaats. Griechenland war nicht mehr ein fernes
Phantasiegebilde, sondern ein Land, das allmhlich aus dem Schatten
der Kolonialmchte trat, die ihm zur Wiedergeburt verholfen hatten.
Literaturverzeichnis
Quellen
Bacon, Francis: Sylva Sylvarum or a Naturall Historie in ten centuries written []. Lon-
don 1627.
Blondus, Flavius: Italia illustrata. Verona 1482.
Bory de Saint-Vincent, Jean Baptiste: Expdition scientifique de More, Section des sciences
physiques []. Vol. I. Paris 183236.
Fourmont, Michel: Relation abrge du voyage littraire [] fait dans le Levant,
in: Histoire de lAcadmie Royale des Inscriptions et Belles Lettres, Bd. VIII. Paris 1733,
36 Alain Schnapp
S. 344359. Fourmont, Michel: Brief an den Marquis de Villeneuve vom 17. April
1729, in: Henri Omont (Hrsg.): Missions archologiques francaises en Orient. Paris
1902, S. 556.
Gassendi, Pierre: Viri illustri Nicolai Claudii Fabricii de Peiresc Senatori Acquisextensis
Vita. Paris 1641.
Leclerc de Buffon, George Louis: Des poques de la nature. Paris 1776.
Ligorio, Pirro: Antiquae urbis Romae imago accuratissima ex vetustis monumentis, ex vesti-
giis videlicet aedifocior, moenium ruinis, fide numismatum, mouvmentis aeneis, plumbeis,
saxeis tiglinisque collecta. Rom o. J. [ca. 1553].
Moser, Stephanie: Ancestral images. The iconography of human origins. Ithaca 1998.
Mushard, Martin: Ntzliche Unterweisung ber die Ausgrabung von Urnen und
die Mittel dagegen, sie umsonst zu suchen, in: Hannoverische Beitrge zum Nutzen
und Vergngen, 2/17601761.
Rosinus, Johannes: Romanarum Antiquitatum libri decem. Ex variis Scriptoribus summa
fide singularique diligentia collecti. Basel 1583.
Spon, Jacques: Recherches des Antiquits de la ville de Lyon. Lyon 1673.
Worm, Ole: Danicorum Monumentorum libri sex. Kopenhagen 1643.
Forschungsliteratur
Aghion, Irne (Hrsg.): Caylus, mcne du roi. Collectionner les antiquits au XVIIIe sicle.
Cabinet des Mdailles de la Bibliothque Nationale de France, INHA. Paris 2002.
Aubrey, John: Monumenta Britannica. Hrsg. von John Fowles/Rodney Legg. Mil-
borne Port 19801982.
Auhagen, Ulrike/Stefan Faller/Florian Hurka: Petrarca und die rmische Literatur. T-
bingen 2005.
Bourguet-Bernard, Marie-Nolle u. a. (Hrsg.): LInvention scientifique de la Mditerrane.
Egypte, More, Algrie (Editions de lEHESSS). Paris 1998.
Bracken, Catherine Philippa: Antiquities acquired. The Spoliation of Greece. London
1975.
Bredekamp, Horst: Antikensehnsucht und Maschinenglauben. Die Geschichte der Kunst-
kammer und die Zukunft der Kunstgeschichte. Berlin 2000.
Brizzolara, Anna Maria: La Roma Instaurata di Flavio Biondo. Alle origini del metodo
archeologico. Bologna 1979.
Bujok, Elke: Neue Welten in europischen Sammlungen. Africana und Americana in Kunst-
kammern bis 1670. Berlin 2004.
Clavuot, Ottavio: Biondos Italia Illustrata. Summa oder Neuschpfung? Tbingen 1990.
Constantine, David: Early Greek Travellers and the Hellenic Ideal. Cambridge 1984.
Etienne, Roland/Jean-Claude Mossire (Hrsg.): Jacob Spon. Un humaniste lyonnais du
XVIIme sicle. Lyon 1993.
Gould, Steve J.: Fall in the House of Ussher in Eight Little Piggies. London 1993.
Grote, Andreas (Hrsg.): Macrocosmos in Microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Ge-
schichte des Sammelns 1450 bis 1800. Opladen 1994.
Harms, Wolfgang: Eine Kombinatorik unterschiedlicher Grade des Faktischen. Er-
weiterungen des emblematischen Bedeutungspotentials bei dem Archologen
Jean Jacques Boissard, in: Andreas Kablitz/Gerhard Neumann (Hrsg.): Mimesis
und Simulation. Freiburg 1998, S. 279307.
Die Antiquitates der Griechen und Rmer 37
Houssay, du: Brief an Richelieu im Jahre 1538, in: Henri Omont: Missions archo-
logiques francaises en Orient. Paris 1902, S. XI (Einleitung).
Howarth, David: Lord Arundel and his circle. Yale 1985.
Kessler, Eckhard: Petrarca und die Geschichte. Geschichtsschreibung, Rhetorik, Philosophie
im bergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Mnchen 1978.
Kockel, Valentin/Slch, Brigitte (Hrsg.): Francesco Bianchini (16621729) und die euro-
pische gelehrte Welt um 1700. Berlin 2005.
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH (Hrsg.): Wun-
derkammer des Abendlands. Museum und Sammlung im Spiegel der Zeit. Bonn 1995.
Laurens, Henri: Lexpdition dEgypte 17981801. Paris 1989.
Lemaire de Belges, Jean: Des anciennes pompes funerailles. Texte tabli, introduit et
annot par Marie-Madeleine Fontaine avec le concours dElisabeth A.R. Brown.
Paris 2002.
Nointel, Marquis de: Brief an Pomponne vom 10. Dezember 1673 aus Naxos, in:
Henri Omont: Missions archologiques francaises en Orient. Paris 1902, S. 191f.
Omont, Henri: Missions archologiques francaises en Orient. Paris 1902.
Pigott, Stuart: Ruins in a Landscape. Essays in Antiquarianism. London 1976.
Pomian, Krzysztof: Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris-Venise XVI
e
-XVIII sicle.
Paris 1987.
Popkin, Richard Henry: Isaac La Peyrre. Leiden 1987.
Rossi, Paolo: The Dark Abyss of Time. Chicago 1984.
Saucy, Harlay de: Brief an Jacques Auguste du Thou am 4. Mai 1612., in: Henri
Omont: Missions archologiques francaises en Orient. Paris 1902, S. 55.
Schnapp, Alain: The Discovery of the Past. London 1996.
Stoneman, Richard: Land of Lost Gods. The Search for Classical Greece. London 1987.
Vandal, Albert: Les voyages du Marquis de Nointel (16701680). Paris 1900.
Weiss, Roberto: The Renaissance Discovery of Classical Antiquity. Oxford 1988.
Wolfzettel, Friedrich: Le discours du voyageur. Paris 1996.
Zachariades, Georg Elias: Tbingen und Konstantinopel im 16. Jahrhundert. Martin Cru-
sius und seine Verhandlungen mit der Griechisch-Orthodoxen Kirche. Diss. 1938. Gttin-
gen 1941.
38 Alain Schnapp
Winckelmanns Konstruktion der Griechischen Nation 39
Elisabeth Dcultot
Winckelmanns Konstruktion
1
der Griechischen Nation*
Woraus besteht die Identitt des griechischen Volks? Welche Bedingun-
gen erlaubten den Aufstieg einer so glnzenden Nation unter den anti-
ken Vlkern? Weisen die modernen Griechen dieselben Eigenschaften
wie ihre antiken Vorfahren auf? Mit all diesen Fragen setzt sich Winckel-
mann von seiner Erstlingsschrift, den Gedanken ber die Nachahmung der
griechischen Werke (1755), bis zu seinem groen Geschichtswerk, der Ge-
schichte der Kunst des Altertums (1764), intensiv auseinander. Da seine
Analyse der antiken Kunst eine Untersuchung der antiken Vlker vor-
aussetzt und in sich birgt, darf angesichts seines Kunstverstndnisses
nicht berraschen, ergeben sich doch in seinen Augen die Kunstwerke
aus einer Entwicklung, die sozusagen sowohl kunstintern als auch kunst-
extern verluft. Um das Werden der bildhauerischen Hervorbringungen
des griechischen Volks zu beschreiben, wird einerseits auf Erklrungs-
modelle zurckgegriffen, die rein knstlerische Faktoren in Betracht zie-
hen, wie etwa die Gesetze der Stilabfolge und der Schnheitsbildung;
andererseits wird aber auch die Kunst als das Ergebnis von zahlreichen
Determinanten aufgefat, die auerhalb des eigentlichen Kunstbereichs
stehen, wie etwa die ethnologischen, politischen, kulturellen und biolo-
gischen Eigenschaften der Griechen.
Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es, Winckelmanns Darstellung
dieser auerknstlerischen Verhltnisse nher zu untersuchen eine
Darstellung, die fr den Aufbau und die Verbreitung des Griechenland-
bildes an der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert von grter Rele-
1
Der vorliegende Aufsatz fhrt Gedanken weiter, die in folgendem Buch: Dcul-
tot, Elisabeth: Johann Joachim Winckelmann. Enqute sur la gense de lhistoire de lart.
Paris 2000 (dt. bersetzung: Untersuchungen zu Winckelmanns Exzerptheften. Ein
Beitrag zur Genealogie der Kunstgeschichte im 18. Jahrhundert, bers. von Wolfgang
von Wangenheim und Ren Mathias Hofter. Ruhpolding 2004) erstmals vorge-
legt wurden.
*
40 Elisabeth Dcultot
vanz gewesen ist. Das Winckelmannsche Konstrukt der griechischen
Nation, das, wie wir sehen werden, nicht nur die antiken, sondern auch
die modernen Griechen betrifft, liefert ein kennzeichnendes Zeugnis von
den komplexen, uerst vielfltigen Komponenten, die den Nation-
Begriff im 18. Jahrhundert bilden. Darber hinaus hat sie eine nachhal-
tige Wirkung auf das Bild des griechischen Volks ausgebt, wie es von
den Vertretern der philhellenistischen Bewegungen des beginnenden
19. Jahrhunderts ausgearbeitet wurde.
1
1. Woraus besteht die Identitt der altgriechischen Nation?
Wenn wir einen Blick auf Winckelmanns gesamtes Werk werfen, lt
sich diese Frage keineswegs eindeutig beantworten. In Winckelmanns
Verstndnis ergibt sich die Identitt der antiken griechischen Nation aus
dem Zusammenwirken zahlreicher, oft miteinander konkurriender Fak-
toren, die sich schwer auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen.
Unter diesen Faktoren sind zunchst einmal institutionell-gesellschaft-
liche Bedingungen zu erwhnen, auf die schon ganz am Anfang der
Gedanken ber die Nachahmung mit besonderem Nachdruck eingegangen
wird. So kennzeichne sich das antike griechische Volk durch seine Vor-
liebe fr die frhzeitigen, intensiven Leibesbungen und Spiele, die
allen jungen Griechen ein krftiger Sporn zur Bildung und Ertchti-
gung des Krpers gewesen seien.
2
Auch die nchternen Ernhrungs-
1
Zu Winckelmanns Rezeption berhaupt, vgl.: Hatfield, Henry Caraway: Winckel-
mann and his German Critics, 17551781. A Prelude to the Classical Age. New York
1943; Seeba, Hinrich C.: Johann Joachim Winckelmann. Zur Wirkungsge-
schichte eines ,unhistorischen Historikers zwischen sthetik und Geschichte,
in: Deutsche Vierteljahrsschrift, Suppl., Sept. 1982, S. 170201; Uhlig, Ludwig (Hrsg.):
Griechenland als Ideal. Winckelmann und seine Rezeption in Deutschland. Tbingen
1988; Snderhauf, Esther Sophia: Griechensehnsucht und Kulturkritik. Die deutsche
Rezeption von Winckelmanns Antikenideal 18401945. Berlin 2004; Mller, Urs:
Feldkontakte, Kulturtransfer, kulturelle Teilhabe. Winckelmanns Beitrag zur Etablierung
des deutschen intellektuellen Felds durch den Transfer der Querelle des anciens et des moder-
nes, 2 Bde. Leipzig 2005.
2
Winckelmann, Johann Joachim: Gedancken ber die Nachahmung der Griechi-
schen Wercke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst (1. Aufl. 1755), in: Ders.:
Kleine Schriften, Vorreden, Entwrfe. Hg. von Walther Rehm. Berlin 1968, S. 2759,
hier S. 31: Zu den Leibesbungen waren die groen Spiele allen jungen Griechen
ein krftiger Sporn, und die Gesetze verlangten eine zehnmonatliche Vorberei-
tung zu den olympischen Spielen, und dieses in Elis, an dem Orte selbst, wo sie
Winckelmanns Konstruktion der Griechischen Nation 41
gewohnheiten der Spartaner und Athenienser, die sich vor allem ber-
flssigen Ansatz des Krpers zu hten versuchten, spielen in Winckel-
manns Analyse der Bildung der griechischen Nation eine grundlegende
Rolle,
3
sowie der Anzug der Griechen, der so beschaffen [war], da
er der bildenden Natur nicht den geringsten Zwang antat.
4
Diesen
Ausfhrungen ber die gesellschaftlichen Einrichtungen und Sitten der
Griechen folgen nun Betrachtungen ber die klimatischen Faktoren,
die die Ausbildung der alten griechischen Nation bedingen sollen. Die
auerordentliche Milde und Ausgewogenheit des griechischen Klimas
wird in der Erluterung der Gedanken ber die Nachahmung als eine ent-
scheidende Ursache der vorzglichen Kennzeichen des griechischen
Volks dargestellt. Die Natur eines jeden Landes hat ihren Eingebohr-
nen so wohl, als ihren neuen Ankmlingen eine ihr einige Gestalt, und
eine hnliche Art zu denken gegeben []. Eben so wrksam mu sich
auch der Himmel und die Luft bey den Griechen in ihren Hervorbrin-
gungen gezeigt haben, und diese Wirkung mu der vorzglichen Lage
des Landes gem gewesen seyn. Eine gemssigte Witterung regierte
durch alle Jahrszeiten hindurch, und die khlen Winde aus der See ber-
strichen die wollstigen Inseln im ionischen Meere, und die Seegestade
des festen Landes.
5
Ihrem milden Klima verdankten die alten Griechen
die Beweglichkeit ihrer Muskeln, die Elastizitt ihrer Nerven, die Ge-
gehalten wurden. Die grten Preise erhielten nicht allezeit Mnner, sondern
meistenteils junge Leute, wie Pindars Oden zeigen. Dem gttlichen Diagoras
gleich zu werden war der hchste Wunsch der Jugend.
3
Ebd., S. 31: Die jungen Spartaner muten sich alle zehn Tage vor den Ephoren
nackend zeigen, die denjenigen, welche anfingen fett zu werden, eine strengere
Dit auflegten. Ja, es war eins unter den Gesetzen des Pythagoras, sich vor allem
berflssigen Ansatz des Krpers zu hten. Es geschah vielleicht aus eben dem
Grunde, da jungen Leuten unter den Griechen der ltesten Zeiten, die sich zu
einem Wettkampf im Ringen angaben, whrend der Zeit der Vorbungen nur
Milchspeise zugelassen war.
4
Ebd., S. 32: Nach dem war der ganze Anzug der Griechen so beschaffen, da er
der bildenden Natur nicht den geringsten Zwang antat. Das Wachstum der sch-
nen Form litt nichts durch die verschiedenen Arten und Teile unserer heutigen
pressenden und klemmenden Kleidung, sonderlich am Halse, an den Hften und
Schenkeln. Das schne Geschlecht selbst unter den Griechen wute von keinem
ngstlichen Zwange in seinem Putze: die jungen Spartanerinnen waren so leicht
und kurz bekleidet, da man sie daher Hftzeigerinnen nannte.
5
Winckelmann, J. J.: Erluterung der Gedanken von der Nachahmung der grie-
chischen Werke in der Malerey und Bildhauer-Kunst; und Beantwortung des
Sendschreibens ber diese Gedanken (1. Aufl. 1756), in: Ders.: Kleine Schriften,
Vorreden, Entwrfe, S. 97144, hier S. 99f.
42 Elisabeth Dcultot
schwungenheit ihrer Gesichtszge, ja sogar die Verfeinerung ihrer
Stimmorgane, was die Schnheit ihrer Sprache und dabei die berle-
genheit ihrer geistigen Hervorbringungen erklre.
6
Zu diesen kulturell-gesellschaftlichen und klimatologischen Determi-
nismen kommen nun biologisch-genetische Betrachtungen hinzu, die
zum grten Teil aus Winckelmanns naturwissenschaftlichen Lektren
und ganz besonders aus Buffons Histoire naturelle (1749) oder Johann
Gottlob Krgers Naturlehre
7
gespeist wurden (Abb. 1). In diese Katego-
6
Winckelmann, J. J.: Geschichte der Kunst des Altertums. Text: Erste Auflage Dresden
1764. Zweite Auflage Wien 1776 (synoptische Edition). Adolf H. Borbein/Thomas
W. Gaehtgens/Johannes Irmscher/Max Kunze (Hrsg.): Mainz 2002, S. 1920:
In kalten Lndern [mssen] die Nerven der Zunge starrer und weniger schnell
seyn [], als in wrmeren Lndern; und wenn den Grnlndern und verschiede-
nen Vlkern in America Buchstaben mangeln, mu dieses aus eben dem Grunde
herrhren. Daher kommt es, da alle Mitternchtige Sprachen mehr einsylbige
Worte haben, und mehr mit Consonanten berladen sind, deren Verbindung und
Aussprache andern Nationen schwer, ja zum Theil unmglich fllt. Vgl. auch
Winckelmann: Erluterung der Gedanken von der Nachahmung, S. 101.
7
Exzerpte Winckelmanns aus: Buffon, Georges Louis Leclerc de: Histoire naturelle
gnrale & particulire avec la description du cabinet du Roy. Paris 1749, in Winckel-
manns Pariser Nachlass: Bibliothque Nationale de France, Paris, Sign.: BN All,
Bd. 64, fol. 17 v. Weitere Exzerpte in deutscher bersetzung aus: Buffon,
Georges Louis Leclerc de: Allgemeine Historie der Natur nach allen ihren besonderen
Theilen abgehandelt, mit einem Vorwort von Albrecht von Haller, bersetzt von
Bartholomus Joachim Zink, 2 Bde. Hamburg, Leipzig 17501754, in: BN All.,
Bd. 64, fol. 59 v-64 v. Exzerpte Winckelmanns aus: Krger, Johann Gottlob:
Naturlehre, 3 Bde. Halle 17401750, in: BN All., Bd. 64, fol. 4959 v, 65 v-78. Fr
Winckelmanns Bezug zu diesen naturwissenschatlichen Fragen, vgl. u. a.: Wies-
ner, Joseph: Winckelmann und Hippokrates. Zu Winckelmanns naturwissen-
schaftlich-medizinischen Studien, in: Gymnasium. Zeitschrift fr Kultur der Antike
und humanistische Bildung 60/1953, S. 149167; Lepenies, Wolf: Der andere Fana-
tiker. Historisierung und Verwissenschaftlichung der Kunstauffassung bei Johann
Joachim Winckelmann, in: Herbert Beck/Peter C. Bol/ Eva Maek-Grard
(Hrsg.): Ideal und Wirklichkeit der bildenden Kunst im spten 18. Jahrhundert. Berlin
1984, S. 1929; Ders.: Johann Joachim Winckelmann. Kunst- und Natur-
geschichte im achtzehnten Jahrhundert, in: Thomas W. Gaehtgens (Hrsg.):
Johann Joachim Winckelmann, 17171768. Hamburg 1986, S. 221237; Franke, Tho-
mas: Ideale Natur aus kontingenter Erfahrung. Johann Joachim Winckelmanns normative
Kunstlehre und die empirische Naturwissenschaft. Wrzburg 2006. Zu Buffon, vgl.
vor allem: Roger, Jacques: Buffon: un philosophe au Jardin du Roi. Paris 1989; Ders.:
Lhistoire naturelle au XVIII
e
sicle: de lchelle des tres lvolution,
in: Ders.: Pour une histoire des sciences part entire. Paris 1995, S. 237251; Ders.:
Buffon et le transformisme, in: Ders.: Pour une histoire des sciences part entire,
S. 272286.
Winckelmanns Konstruktion der Griechischen Nation 43
Abb. 1: Winckelmanns Exzerpte aus Buffon: Histoire naturelle gnrale & particulire
(Bd. 3, Paris 1749), in: Winckelmann, Pariser Nachlass, BN All., Bd. 64, fol. 1.
44 Elisabeth Dcultot
rie gehren etwa die Bermerkungen ber die Gesundheit der alten
Griechen, die die venerischen bel nicht kannten, welche so viel
Schnheiten zerstren und die edelsten Bildungen verderben.
8
Von
noch grerer Bedeutung als die Gesetze der Pathologie sind jedoch
in Winckelmanns Augen diejenigen der Zeugung, d. h. der Genetik.
So seien die alten Griechen besonders sorgfltig gewesen, schne
Kinder zu zeugen: sie kannten die Kunst, aus blauen Augen schwarze
zu machen
9
.
Zu den wichtigsten Merkmalen der griechischen Nation gehren
schlielich politisch-institutionelle Eigenschaften: Fr die Freiheit sol-
len die Griechen eine glhende Liebe gehegt haben, und diese erklre
die auergewhnliche Entfaltung der Knste im antiken Griechenland.
Weil die alten Griechen die Freiheit schtzten und pflegten, erlebten die
Knste bei ihnen einen unvergleichlichen Aufstieg. Nichts zeige diesen
Grundsatz deutlicher als die Bltezeit der athenischen Demokratie im
5. Jahrhundert.
Durch die Freyheit erhob sich, wie ein edler Zweig aus einem gesunden Stamme,
das Denken des ganzen Volks. Denn wie der Geist eines zum Denken gewhnten
Menschen sich hher zu erheben pflegt im weiten Felde, oder auf einem offenen
Gange, auf der Hhe eines Gebudes, als in einer niedrigen Kammer, und in je-
dem eingeschrnkten Orte, so mu auch die Art zu denken unter den freyen Grie-
chen gegen die Begriffe beherrschter Vlker sehr verschieden gewesen seyn. He-
rodotus zeiget, da die Freyheit allein der Grund gewesen von der Macht und
Hoheit, zu welcher Athen gelanget ist, da diese Stadt vorher, wenn sie einen
Herrn ber sich erkennen mssen, ihren Nachbarn nicht gewachsen seyn kn-
nen. Die Redekunst fieng an aus eben dem Grunde allererst in dem Genusse der
vlligen Freyheit unter den Griechen zu blhen; und daher legten die Sicilianer
dem Gorgias die Erfindung der Redekunst bey.
10
Griechenland liefert den positiven Beweis fr die Wohltaten der Freiheit,
aber Winckelmann zhlt auch eine Reihe von negativen Beispielen auf,
die seine Beweisfhrung a contrario bestrken. Weil sie der Freiheit weni-
ger huldigten, muten die gypter, Perser und Phniker unter despoti-
schen Regierungen leben, die den schnen Knsten nachteilhaft sind.
8
Winckelmann: Gedancken ber die Nachahmung, S. 3233. Um diese Behaup-
tung zu untermauern, beruft sich Winckelmann explizit auf die Schriften der
griechischen rzte (Hippocrates, Galenus und Dioskurides), in welchen keine
Spur von Blattern zu finden seien.
9
Ebd., S. 32.
10
Winckelmann: Geschichte der Kunst des Altertums, S. 132133. In Winckelmanns
handschriftlichen Collectanea ad historiam artis findet sich eine Abteilung Libertas
Graeciae, die aus Exzerpten aus Strabon besteht (BN All., Bd. 57, fol. 215 v).
Winckelmanns Konstruktion der Griechischen Nation 45
Wenn wir die Monarchische Verfassung in Aegypten so wohl, als bey den Phni-
ciern und Persern, erwegen, in welcher der unumschrnkte Herr die hchste
Ehre mit niemanden im Volke theilete, so kann man sich vorstellen, da das
Verdienst keiner andern Person um sein Vaterland, mit Statuen belohnet worden,
wie in freyen, so wohl alten als neuen, Staaten geschehen. Es findet sich auch
keine Nachricht von dieser einem Unterthan dieser Reiche wiederfahrnen Dank-
barkeit. [] Folglich bestand die Kunst bey diesen Vlkern mehrentheils blo
auf die Religion, und konnte aus dem brgerlichen Leben wenig Nutzen und
Wachstum empfangen. Die Begriffe der Knstler waren also weit eingeschrnkter,
als bey den Griechen, und ihr Geist war durch den Aberglauben an angenom-
mene Gestalten gebunden.
11
Im Gegensatz zu diesen Barbaren sind Winckelmanns Altgriechen mit
der Freiheit innig verbunden, was einen wesentlichen Bestandteil ihrer
Besonderheit erklre: ihren Patriotismus. Die Liebe zum Vaterland sei
fr einen Griechen genauso notwendig und natrlich wie die Liebe zur
Freiheit. Diese in der Geschichte der Kunst an verschiedenen Stellen aus-
gefhrte Vorstellung liegt Winckelmann sehr am Herzen, der ihr in sei-
nen Collectanea ad historiam artis eine spezielle Abteilung widmet.
12
2. Die griechische Natur
Lassen sich nun diese gesellschaftlichen, klimatischen, biologischen
und politischen Faktoren, die zur Identittsbildung des griechischen
Volks beigetragen haben sollen, auf ein gemeinsames Prinzip zurckfh-
ren? Diese Frage knnte man leicht versucht sein, zu verneinen, denn
Winckelmanns Taxonomie der Eigenschaften des griechischen Volks
scheint zwar beim ersten Anblick eine groe Vielseitigkeit aufzuweisen,
dafr aber einer inneren Kohrenz zu entbehren. Im anscheinend unsy-
stematischen Katalog der Nationaleigenschaften des griechischen Volks
lt sich jedoch bei nherer Untersuchung ein Zusammenhang erken-
nen, der auf dem systematischen Vorzug der naturgegebenen, angebore-
nen Kausalitten gegenber den erworbenen beruht. In Winckelmanns
Auslegung der altgriechischen Bltezeit ist der Anteil der naturbedingten
und der kulturbedingten Faktoren keineswegs gleichwertig. Altgriechen-
land verdankt seine bevorzugte Stellung mehr dem natrlichen Faktor
der Geburt als dem erworbenen der Kultur. Genauer gesagt, die griechi-
11
Winckelmann: Geschichte der Kunst des Altertums, S. 78.
12
BN All., Bd. 57, fol. 203. Die Abteilung trgt den Titel: Liebe der Griechen zu
ihrem Vaterlande und enthlt Exzerpte aus Pausanias. Vgl. auch Winckelmann:
Geschichte der Kunst des Altertums, S. 136137.
46 Elisabeth Dcultot
sche Kultur ist nur scheinbar als eine erworbene zu betrachten; in Wirk-
lichkeit ist sie vor allem das Ergebnis von natrlichen Anlagen.
Dies lt sich am Beispiel von Winckelmanns Freiheitsbegriff beson-
ders deutlich veranschaulichen. Denn im Grunde wird in der Geschichte
der Kunst des Altertums der Grieche nicht frei, sondern er ist frei geboren.
Er erobert nicht die Freiheit im fortschreitenden Beseitigen der Knecht-
schaft durch die bewute Befreiung der Vernunft, sondern er besitzt sie
von Geburt an wie auch immer das politische Regime beschaffen sei.
Bereits unter der Herrschaft der Knige lange vor der Demokratie habe
der angeborene Geist der Freiheit in Griechenland regiert und auch die
Tyrannei berlebt. So existiert fr Winckelmann die Gleichsetzung von
Griechenland und Freiheit unabhngig von jeglicher Regierungsform,
sowohl im Jahrhundert des Perikles als auch in den dunkleren Perioden
nichtdemokratischer Regierungen.
Die Freyheit hat in Griechenland allezeit den Sitz gehabt, auch neben dem
Throne der Knige, welche vterlich regiereten, ehe die Aufklrung der Vernunft
ihnen die Sigkeit einer vlligen Freyheit schmecken lie, und Homerus nennet
den Agamemnon einen Hirten der Vlker, dessen Liebe fr dieselben, und Sorge
fr ihr Bestes anzudeuten. Ob sich gleich nachher Tyrannen aufwarfen, so waren
sie es nur in ihrem Vaterlande, und die ganze Nation hat niemals ein einziges
Oberhaupt erkannt.
13
Die griechische Demokratie des 5. Jahrhunderts v. Chr. sei also nur die
in einem zusammenhngenden politischen System organisierte Aktua-
lisierung einer naturbedingten, angeborenen und erblichen Eigenschaft:
Der griechische Mensch liebe und besitze die Freiheit von Natur aus.
3. Klimatischer oder genetischer Determinismus?
Wenn Winckelmanns breit aufgefchertes Interpretationsmodell der
griechischen Identitt sich also durch die Naturalisierung des Kultur-
Begriffs kennzeichnet, bleibt noch zu untersuchen, ob all die in seinem
Werk evozierten natrlichen Determinismen eine gleichwertige Rolle
spielen. Gibt es mit anderen Worten eine Hierarchie zwischen den
naturgegebenen Eigenschaften des griechischen Volks? Zu einer sol-
chen Fragestellung sind seine Ausfhrungen ber Klima und Geblt
zwei Faktoren, die ja vorzglich als naturgegeben betrachtet werden
knnen besonders aufschlureich.
13
Winckelmann: Geschichte der Kunst des Altertums, S. 130.
Winckelmanns Konstruktion der Griechischen Nation 47
Gerne weist sich Winckelmann als ein berzeugter Anhnger der Kli-
matheorie aus. Bei der Anfhrung klimatischer Argumente verweist
er hufig und bereitwillig auf die antiken Klimatheorien des Polybios,
Cicero oder Lukian.
14
Mit ganz besonderem Nachdruck beruft er sich
dabei auf Hippocrates Lehre der drei Klimazonen kalt, hei und ge-
migt , von denen nur die mittlere, d. h. die milde und ausgewogene
der griechischen Landschaft, der Entstehung der Schnheit gnstig sei.
15
Als entscheidende Grundlage fr seine klimatheoretischen Ausfhrun-
gen benutzte er jedoch vielmehr eine neuzeitliche Quelle, die Rflexions
critiques sur la posie et sur la peinture von Jean-Baptiste Du Bos, die gerade
zu dieser Frage einen breiten Raum in seiner handgeschriebenen Biblio-
thek einnimmt (Abb. 2).
16
In seinen Exzerptheften interessiert er sich fr
Du Bos Notate zu den Unterschieden zwischen den einzelnen Vlkern
14
Winckelmann: Geschichte der Kunst des Altertums, S. 19, 22.
15
Winckelmann: Erluterung der Gedanken von der Nachahmung, S. 100: Un-
ter einem so gemssigtem, und zwischen Wrme und Klte gleichsam abgewoge-
nem Himmel spret die Creatur einen gleich ausgetheilten Einflu desselben.
Alle Frchte erhalten ihre vllige Reife und selbst die wilden Arten derselben ge-
hen in eine bessere Natur hinber; so wie bey Thieren, welche besser gedeyen und
fter werfen. Ein solcher Himmel, sagt Hippocrates, bildet unter Menschen die
schnsten und wohlgebildetesten Geschpfe und Gewchse, und eine Ueberein-
stimmung der Neigungen mit der Gestalt. Fr Hippocrates wie fr Winckelmann
ist dieses vorzglich gemigte Klima vornehmlich im attischen Gebiet und
ganz speziell bei den Atheniensern zu finden, bei denen es feine Sinne und
proportionirte Krper bildete im Gegensatz zu den Einwohnern von Theben,
die auch nach des Hippocrates Beobachtung [Peri Topon] dick und stark wa-
ren, weil ihre Stadt unter einem dicken Himmel gelegen war (Winckelmann:
Erluterung der Gedanken von der Nachahmung, S. 103104).
16
Nach berkommener Ansicht habe Winckelmann seine Klimatheorie von
Montesquieu entlehnt. Wenn auch die Lektre des Esprit des lois entscheidend fr
sein politisches Denken war, mu man dennoch unterstreichen, da in den Ex-
zerptheften nichts darauf hinweist, da er Montesquieus berlegungen ber die
Klimatheorie berhaupt gelesen habe. Ganz im Gegenteil deutet alles darauf hin,
da er sehr aufmerksam diejenigen von Du Bos verfolgte: Du Bos, Jean-Baptiste:
Rflexions critiques sur la posie et sur la peinture (Erstverffentlichung: 1719). Nach
der dritten, 1740 erschienenen Auflage. Dominique Dsirat (Hrsg.): Paris 1993.
Zu den Exzerpten aus den Rflexions critiques von Du Bos, vgl. BN All., Bd. 61,
fol. 4861 v und Bd. 72, fol. 192. Zu den Exzerpten direkt zur Klimatheorie, vgl.
BN All., Bd. 61, fol. 56 v-58 v. Winckelmann arbeitet, nach den Wasserzeichen
zu urteilen, bereits in Nthnitz alle acht Sektionen durch, die Du Bos der
Frage des Klimas widmet (Du Bos, J.-B.: Rflexions critiques, S. 218274, Sektio-
nen 1329). Das Buch wurde erst danach ins Deutsche bersetzt: Du Bos, J.-B.:
Kritische Betrachtungen ber die Poesie und Mahlerey, aus dem Franzsischen des Herrn
Abtes D Bos, bers. von G. Funcke, 3 Bde. Kopenhagen 17601761.
48 Elisabeth Dcultot
Abb. 2: Winckelmanns Exzerpte aus: Jean-Baptiste Du Bos:
Rflexions critiques sur la posie, in: BN All, Bd. 61, Pol. 48.
Winckelmanns Konstruktion der Griechischen Nation 49
(gypter, Englnder, Spanier oder Perser), zum Einflu des Klimas auf
Ernhrung und Krperbildung sowie zum Vorzug der gemigten Wit-
terung. Siehe wie sich das Gesicht der Natur von hier bis nach China
ndert. Andere Gesichter, andere Gestalten; andere Sitten und auch fast
andere Grundstze des Denkens, exzerpiert er aus Du Bos Rflexions
critiques, der hier wiederum Fontenelle abschreibt.
17
Aufschlureich ist jedoch Winckelmanns Beziehung zu Du Bos
weniger durch die Entlehnungen als durch die Abweichungen von den
klimatheoretischen Ausfhrungen der Rflexions critiques. Von Du Bos
unterscheidet sich Winckelmann vornehmich in der Antwort auf die
Kernfrage, ob das genetische Erbe oder das Klima den entscheidendsten
Einflu auf die Eigenschaften des griechischen Volks ausbe. Seine Stel-
lung zu diesem Problem hatte Du Bos ganz klar in den Rflexions critiques
angegeben: Seit jeher hat man bemerkt, da das Klima sehr viel strker
ist als das Blut und die Herkunft.
18
Fr diesen strengen klimatischen
Determinismus fhrt Du Bos mannigfache Beweise an. Die von den
Galliern abstammenden Gallo-Griechen, die sich in Kleinasien nieder-
gelassen hatten, wurden in fnf oder sechs Generationen genauso
weichlich und weibisch wie die Asiaten, obwohl sie von kriegerischen
Vorfahren abstammten. Auch die Makedonen in Syrien und gypten
wurden nach einigen Jahren zu Syrern und gyptern, und die entarteten
Nachkommen behielten von ihren Ahnen nur die Sprache und die
Fahne. Den Vlkern ergehe es wie den Tieren oder den Pflanzen. Ihre
Eigenschaften hngen nicht so sehr von dem Ort ab, wo man sie her-
holt, sondern von dem Boden, in den man sie einpflanzt []. Das Ge-
treide, das in einem Land hervorragend gedeiht, verkmmert, wenn
man es in einem anderen Land aussht. Selbst die Pferde ndern ihre
Natur, wenn sich die Luft und das Futter ndert.
19
In Du Bos Rflexions
critiques nimmt unter den natrlichen Bedingungen das Klima, also die
Witterung oder geographische Lage, einen weit greren Stellenwert ein
als die erblichen Eigenschaften des Blutes.
Als Leser und Exzerpierer nimmt zwar Winckelmann diese Argu-
mente zur Kenntnis, aber er entfernt sich deutlich davon in seinen eige-
nen Schriften. Du Bos strengem klimatischem Determinismus fgt er
17
BN All., Bd. 61, fol. 58; Du Bos, J.-B.: Rflexions critiques, S. 255 (Zitat nach Fon-
tenelle, Entretiens sur la pluralit des mondes, zweiter Abend).
18
Du Bos, J.-B.: Rflexions critiques, S. 257.
19
Ebd., S. 257258, 260. Winckelmann schreibt einen groen Teil dieser Passagen
auf.
50 Elisabeth Dcultot
als weitere entscheidende Form der Kausalitt die des genetischen Erbes
hinzu. Zwar werden diese biologisch-genetischen Anstze in seiner Erst-
lingsschrift nur beilufig erwhnt. Hervorzuheben ist jedoch, da das
Geblt eine immer ausschlaggebendere Rolle in seiner Taxonomie der
Determinismen spielt, die die krperliche und geistige Bildung der Grie-
chen bestimmen. So wird in der Geschichte der Kunst wiederholt darauf
hingewiesen, da die Griechen ihre unvergleichbare natrliche Schn-
heit ihren eigentmlichen genetischen Anlagen verdankten, und da
hingegen die Vermischung mit fremdem Blut diese Schnheit nur beein-
trchtigen konnte.
20
Das Argument des genetischen Determinismus und
die damit zusammenhngende Verwerfung der genetischen Vermischung
mit anderen Vlkern gilt natrlich nicht nur fr die Griechen. Wenn die
neuzeitlichen gypter nicht die Werte ihrer antiken Vorfahren teilen,
obwohl sie unter demselben Himmel leben, dann nicht nur, weil sie in-
zwischen ber eine andere Regierungsform verfgen, sondern auch, weil
sie ein fremder Schlag von Menschen seien.
21
In dieser Argumentation spielen die modernen Griechen eine ent-
scheidende Rolle. Um die These des ausschlaggebenden Einflusses des
Geblts auf die Krpergestaltung und die Geistesverfassung der Hel-
lenen zu untermauern, verweist Winckelmann sehr hufig auf die Eigen-
schaften der modernen Griechen, welche einige der vornehmlichen
Merkmale ihrer Vorfahren beibehalten haben sollen. So wird unter
Rckgriff auf die im 16. und 17. Jahrhundert verfaten Reiseberichte von
Pierre Belon und Corneille le Brun behauptet
22
:
Bey aller Vernderung und traurigen Aussicht des Bodens, bey dem gehemten
freyen Strich der Winde durch die verwilderte und verwachsene Ufer, und bey
dem Mangel mancher Bequemlichkeit, haben dennoch die heutigen Griechen
viel natrliche Vorzge der alten Nation behalten. Die Einwohner vieler Inseln,
20
Winckelmann: Geschichte der Kunst des Altertums, S. 21: Denn, nicht zu gedenken,
da ihr Geblt einige Jahrhunderte hindurch mit den Saamen so vieler Vlker,
die sich unter ihnen niedergelassen haben, vermischet worden, so ist leicht ein-
zusehen, da ihre itzige Verfassung, Erziehung, Unterricht und Art zu denken,
auch in ihre Bildung einen Einflu haben knne. In allen diesen nachtheiligen
Umstnden ist noch itzo das heutige Griechische Geblt wegen dessen Schnheit
berhmt, und je mehr sich die Natur dem Griechischen Himmel nhert, desto
schner, erhabner und mchtiger ist dieselbe in Bildung der Menschenkinder.
Fr den hufigen Gebrauch des Wortes Blut, vgl. ebd., S. 21f., 82f.
21
Ebd., S. 21.
22
Belon, Pierre: Observations de plusieurs singularitez et choses mmorables trouves en
Grce, Asie et Jude. Paris 15531555; Le Brun, Corneille: Voyages au Levant, cest-
-dire dans les principaux endroits de lAsie Mineure []. Delft 1700.
Winckelmanns Konstruktion der Griechischen Nation 51
(welche mehr als das feste Land von Griechen bewohnt werden) bis in klein
Asien, sind die schnsten Menschen, sonderlich was das schne Geschlecht be-
trift, nach aller Reisenden Zeugni.
23
Das schne Geblt der Einwohner der meisten griechischen Inseln, welches
gleichwohl mit so verschiedenem fremden Geblte vermischt ist, und die vorzg-
lichen Reizungen des schnen Geschlechts daselbst, sonderlich auf der Insel
Skios, geben zugleich eine gegrndete Mutmaung von den Schnheiten beider-
lei Geschlechts unter ihren Vorfahren, die sich rhmten, ursprnglich, ja lter als
der Mond zu sein.
24
4. Die Griechen und ihre Nachbarn:
Einige Grundstrukturen von Winckelmanns
Ethnographie der Kunst
Von besonderer Relevanz fr Winckelmanns Griechenlandbild ist nun
die Frage nach der Beziehung des griechischen Volks zu den Nachbar-
vlkern: Haben die Griechen ihre Eigenschaften mit diesen Vlkern
ausgetauscht? Sind solche Wechselbeziehungen berhaupt wnschens-
wert? Von vornherein mu unterstrichen werden, da Winckelmanns
ethnographisches Modell das autarke Wachstum der einzelnen Kulturen
eindeutig bevorzugt. Schon ganz am Anfang der Geschichte der Kunst des
Altertums wird nachdrcklich darauf hingewiesen, da jedes Volk in sich
selber die ntige Wachstumsenergie fr die eigenen knstlerischen Her-
vorbringungen finden sollte: Die Kunst scheint unter allen Vlkern,
welche dieselbe gebet haben, auf gleiche Art entsprungen zu seyn, und
man hat nicht Grund genug, ein besonderes Vaterland derselben anzu-
geben: denn den ersten Saamen zum Nothwendigen hat ein jedes Volk bey sich
gefunden.
25
Im Idealzustand sollte sich also jede Nation nur aus ihren eigenen
Wurzeln nhren und dabei ihre Kunst in vlliger Unkenntnis fremder
Hervorbringungen entfalten. Noch mehr: Diese Autarkie der Kulturen
gilt Winckelmann als sicheres Indiz ihrer Gesundheit. So haben sich die
gypter, Phniker und Perser in ihrer jeweiligen Bltezeit unabhngig
voneinander entwickelt.
23
Winckelmann: Erluterung der Gedanken von der Nachahmung, S. 105.
24
Winckelmann: Gedancken ber die Nachahmung, S. 32.
25
Winckelmann: Geschichte der Kunst des Altertums, S. 4. (Hervorhebungen von
der Verf.).
52 Elisabeth Dcultot
Diese drey Vlker hatten in ihren blhenden Zeiten vermuthlich wenig Gemein-
schaft unter einander: von den Aegyptern wissen wir es, und die Perser, welche
spt einen Fu an den Ksten des Mittellndischen Meeres erlangeten, konnten
vorher mit den Phniciern wenig Verkehr haben. Die Sprachen dieser beyden
Vlker waren auch in Buchstaben gnzlich von einander verschieden. Die Kunst
wird also unter ihnen in jedem Lande eigenthmlich gewesen seyn.
26
Dieses ethnographische System schliet die Mglichkeit eines Austau-
sches zwischen einzelnen Vlkern natrlich nicht aus, aber diese mg-
lichen Wechselbeziehungen gelten als Zeichen einer Schwche, als Nach-
weise einer fehlenden Autonomie, die nur durch den Rckgriff auf
fremde Kulturen wieder ausgeglichen werden kann. Die Kunst einer Na-
tion kann zwar von einer anderen bernommen werden, aber dieser Aus-
tausch steht bei Winckelmann unter der in den spteren Schriften wenig
schmeichelhaften Bezeichnung der Nachahmung. So haben die gypter
den Griechen knstlerische Motive deshalb entlehnt, weil sie die engen
Grenzen ihres eigenen Formenrepertoires etwas erweitern und ihre an-
geborene Trockenheit mildern wollten.
27
Das gleiche gilt fr die Rmer,
die die Nachahmung bis zum vollstndigen Niedergang praktizierten.
28
5. Die griechische Autarkie
In dieser bersicht ber die einzelnen Vlker der Antike nehmen nun
die Griechen einen herausragenden Platz ein. Weil sie ber eine unend-
lich viel grere schpferische Energie als ihre Nachbarn verfgten,
brauchten sie niemals auf sie zurckzugreifen. Als reines, unlegiertes
Metall erreichten sie in voller Autonomie eine unvergleichliche Schn-
heit. Die griechische Kunst ist fr Winckelmann grundlegend eigen-
stndig. Sicher haben die Chalder und die gypter vor den Griechen
Kunstwerke hervorgebracht, doch ohne selber anregend zu wirken.
29
Wenn er den ersten lteren Stil der Griechen vor Phidias beschreibt,
vermeidet Winckelmann denn auch sorgsam, auf eventuelle uere Ein-
flsse hinzuweisen.
30
Um eine solche ethnographische Konstruktion
zu untermauern, beruft sich Winckelmann gerne auf die griechischen
Autoren selber, unter denen vor allem Herodot zu nennen ist: Bey den
26
Ebd., S. 78.
27
Ebd., S. 68.
28
Ebd., S. 289ff.
29
Winckelmann: Geschichte der Kunst des Altertums, S. 5.
30
Winckelmann: Geschichte der Kunst des Altertums, S. 213ff.
Winckelmanns Konstruktion der Griechischen Nation 53
Griechen hat die Kunst, ob gleich viel spter als in den Morgenlndern,
mit einer Einfalt ihren Anfang genommen, da sie, aus dem was sie
selbst berichten, von keinem andern Volke den ersten Saamen zu ihrer
Kunst geholet, sondern die ersten Erfinder scheinen knnen. Die Grie-
chen haben also in Winckelmanns Verstndnis ihre Kunst allein erfun-
den eine Autonomie, die ihre absolute berlegenheit verbrge.
31
Zum Grundsatz der griechischen Autarkie gesellen sich nun weitere
ethnographische Gesetze, unter denen vor allem das Verbot der Vermi-
schung mit anderen Vlkern zu erwhnen ist. Wenn die Griechen allein
ihrer ethnischen Eigenart das auerordentliche Aufblhen ihrer Kunst
verdanken, dann wirken sich Wanderungen und die daraus resultierende
Mischung der Vlker auf ihre knstlerischen Hervorbringungen negativ
aus. Die griechische Kunst entspringe einem besonders gesegneten Volk
und Landstrich allerhand Voraussetzungen, die nicht ohne Verlust
gendert werden knnen. Jede Mischung bewirke notwendig den Nie-
dergang. Von den Gedanken ber die Nachahmung bis zur Geschichte der
Kunst wird Winckelmann nicht mde, Beweise dafr anzubringen. So
bald die Beredsamkeit, sagt Cicero, aus dem atheniensischen Hafen aus-
lief, hat sie in allen Inseln, welche sie berhret hat, und in ganz Asien,
welches sie durchzogen ist, fremde Sitten angenommen, und ist vllig
ihres gesunden attischen Ausdrucks, gleichsam wie ihrer Gesundheit,
beraubet worden.
32
Je mehr sich die griechische Kunst von ihrem ur-
sprnglichen Zentrum entferne, desto unschnere Gestalten bringe sie
hervor.
6. Winckelmann und Caylus:
zwei geschichtliche Modelle im Vergleich
Um die Besonderheit dieser historischen und ethnographischen Kon-
struktion besser einschtzen zu knnen, ist ein Vergleich mit zeitgenssi-
schen Modellen aufschlureich. In seinemRecueil dantiquits (17521767)
entwirft der Comte de Caylus ein Interpretationsschema der antiken
31
Ebd., S. 5. Winckelmann erwhnt erst spt und beilufig die Idee, da die Ph-
niker die Kunst bei den Griechen eingefhrt haben knnten (ebd., S. 71). Die
hnlichkeiten der griechischen und etruskischen Kunst rhren daher, da die
Etrusker die Griechen imitieren, nicht umgekehrt (ebd., S. 86ff.). Zum ersten grie-
chischen Stil, vgl. ebd., S. 213ff.
32
Winckelmann: Erluterung der Gedanken von der Nachahmung, S. 104.
54 Elisabeth Dcultot
Geschichte, das mit dem Winckelmannschen kennzeichnende Unter-
schiede aufweist.
33
Dem vertikalen Schema des selbststndigen Wach-
sens stellt Caylus ein Konstrukt entgegen, das der horizontalen Kommu-
nikation zwischen den einzelnen Vlkern einen weit greren Wert
beimit. Die antiken Vlker beziehen ihre Energie nicht aus ihren eige-
nen Wurzeln, sondern vielmehr aus ihrer gegenseitigen Befruchtung.
Zwar ist der Recueil des Comte de Caylus wie Winckelmanns Geschichte
der Kunst nach den einzelnen Nationen geordnet: gypter, Etrusker,
Griechen, Rmer und Gallier.
34
Indes werden bereits im ersten Band die
nationalen Trennungslinien stark verwischt und relativiert. So finde
man, wie Caylus es hervorhebt, in gypten und Etrurien eine Reihe von
Inschriften und Motiven so z. B. geflgelte Lwen , die eine enge
und fruchtbare Verflechtung des Formenrepertoires dieser jeweiligen
Vlker bezeugen.
35
In Caylus antiquarischem Werk wird der gegenseiti-
gen Beeinfluung der einzelnen Kulturen eine zentrale Bedeutung bei
der Analyse der Kunstentstehung beigemessen. Auf diesen Unterschied
ist Winckelmann schnell aufmerksam geworden, wie seine Exzerpte aus
Caylus Recueil zeigen (Abb. 3). Gerade die Bemerkungen des franzsi-
schen Antiquars ber den gegenseitigen Austausch der Nationen
schreibt er auf. So erregen zwei Zylindersiegel, die trotz ihres unzwei-
felhaft gyptischen Ursprungs persische Figuren zeigen, seine Aufmerk-
samkeit. Durch welchen Zufall, exzerpiert er aus Caylus Recueil, sind
persische Figuren mit gyptischen Hieroglyphen zusammen abgebildet?
Um diese Frage zu beantworten, mu man bemerken, da die Perser
whrend jener 135 Jahre, als sie die Herren gyptens waren, verschie-
dene Gebruche des unterworfenen Volks angenommen und sich vor-
wiegend seiner Handwerker bedient haben (Abb. 4).
36
Fr Caylus ver-
danken die Knste ihren Fortschritt dem Handel und Austausch unter
33
Caylus, Anne Claude Philippe de Tubires, comte de: Recueil dantiquits gyptien-
nes, trusques, grecques et romaines, 7 Bde. Paris 17521767.
34
So kann man im Vorwort des ersten Bandes des Recueil lesen: Der Geschmack
eines Volkes unterscheidet sich von dem eines anderen wie die Grundfarben von-
einander; dagegen wandelt sich ein solcher nationaler Geschmack im Laufe der
Jahrhunderte nur wie die feinen Nuancen derselben Farbe (ebd., Bd. 1 [1752],
S. VIII).
35
ber diesen gegenseitigen Austausch zwischen gyptern und Etruriern vgl.
ebd., Bd. 1 (1752), S. 78; exzerpiert von Winckelmann in: BN All., Bd. 67, fol. 46
v.
36
Ebd., Bd. 1 (1752), S. 5457, zu Taf. XVIII, 1, 2; exzerpiert von Winckelmann in:
BN All., Bd. 67, fol. 46 v.
Winckelmanns Konstruktion der Griechischen Nation 55
Abb. 3: Winckelmanns Exzerpte aus: Caylus: Recueil dantiquits gyptiennes, trusques,
grecques et romaines, in: BN All., Bd. 67, fol. 46 r.
56 Elisabeth Dcultot
Abb. 4: Winckelmanns Exzerpte aus: Caylus: Recueil dantiquits gyptiennes, trusques,
grecques et romaines, in: BN All., Bd. 67, fol. 46v.
Winckelmanns Konstruktion der Griechischen Nation 57
den Vlkern. Fr Winckelmann wird dagegen die Entwicklung eines je-
den Volks durch die ihm eigene Dynamik erklrt.
Aus dieser unterschiedlichen Vorstellung der geschichtlichen Ent-
wicklung entstehen natrlich sehr groe Unterschiede in der Einscht-
zung der einzelnen Kunstnationen. Fr Caylus sind zwar weiterhin die
Griechen das herrlichste Volk, das je die Erde bewohnt hat.
37
Indes
wird ihnen dieser erste Rang nicht zugestanden, ohne auf den positiven
Einflu der gypter hinzuweisen. In direkter Anlehnung an seinen
Freund Pierre-Jean Mariette weist Caylus nachdrcklich darauf hin, da
nur die Liebe zum Ruhm die Griechen ihre betrchtliche Verpflich-
tung gegen die gypter habe vergessen lassen.
38
Caylus Griechen waren
im Gegensatz zu den Griechen Winckelmanns fr lange Zeit nur talen-
tierte Nachahmer eine Eigenschaft, die brigens im Recueil dantiquits
auf die anderen Vlker des Altertums ausgedehnt wird. In den ltesten
Zeiten waren gypter, Griechen, Etrusker und Phniker durch ein inten-
sives Verhltnis von Geben und Nehmen verbunden. Zwischen den eth-
nographischem Modellen Winckelmanns und Caylus ffnet sich also
eine grundstzliche Kluft in der Interpretation des Altertums, die den
zeitgenssischen Lesern nicht entging. Das Andenken an einen fremden
Ursprung ist den Griechen unertrglich, notiert Herder schon 1767 im
lteren Kritischen Wldchen. Und trotz seiner groen Bewunderung fr
die Geschichte der Kunst mu er erkennen, da Winckelmann sich von der
Originalsucht der Griechen, dieser bsartigen Krankheit der Helle-
nen, habe anstecken lassen, whrend Caylus sich vor ihr zu schtzen ge-
wut habe.
39
37
Ebd., Bd. 5 (1762), S. 127. Vgl. auch ebd., Bd. 1 (1752), S. 119.
38
Ebd., Bd. 1 (1752), S. 117118. Fr Pierre-Jean Mariette waren [] es die gypter,
die den Griechen die Werkzeuge der Kunst in die Hand gaben (vgl. Mariette,
Pierre-Jean: Trait des pierres graves. Paris 1750, S. 11).
39
Herder, Johann Gottfried: Kritische Wlder. lteres Kritisches Wldchen, in:
Schriften zur sthetik und Literatur 17671781, Bd. 2. Gunter E. Grimm (Hrsg.):
Frankfurt a.M. 1993, S. 1155, hier S. 28, 31.
58 Elisabeth Dcultot
Literaturverzeichnis
Quellen
Belon, Pierre: Observations de plusieurs singularitez et choses mmorables trouves en Grce,
Asie et Jude. Paris 15531555.
Buffon, Georges Louis Leclerc de: Allgemeine Historie der Natur nach allen ihren beson-
deren Theilen abgehandelt, mit einem Vorwort von Albrecht von Haller, bersetzt
von Bartholomus Joachim Zink, 2 Bde. Hamburg, Leipzig 17501754.
: Histoire naturelle gnrale & particulire avec la description du cabinet du Roy. Paris 1749.
Caylus, Anne Claude Philippe de Tubires, comte de: Recueil dantiquits gyptiennes,
trusques, grecques et romaines, 7 Bde. Paris 17521767.
Du Bos, Jean-Baptiste: Rflexions critiques sur la posie et sur la peinture (Erstverffent-
lichung: 1719). Nach der dritten, 1740 erschienenen Auflage. Dominique Dsirat
(Hrsg.): Paris 1993.
Herder, Johann Gottfried: Kritische Wlder. lteres Kritisches Wldchen, in:
Schriften zur sthetik und Literatur 17671781, Bd. 2. Gunter E. Grimm (Hrsg.):
Frankfurt a.M. 1993, S. 1155.
Krger, Johann Gottlob: Naturlehre, 3 Bde. Halle 17401749.
Le Brun, Corneille: Voyages au Levant, cest--dire dans les principaux endroits de lAsie
Mineure []. Delft 1700.
Mariette, Pierre-Jean: Trait des pierres graves. Paris 1750.
Winckelmann, Johann Joachim: Geschichte der Kunst des Altertums. Text: Erste Auflage
Dresden 1764. Zweite Auflage Wien 1776 (synoptische Edition). Adolf H. Bor-
bein/
Thomas W. Gaehtgens/Johannes Irmscher/Max Kunze (Hrsg.): Mainz 2002.
Winckelmann, Johann Joachim: Kleine Schriften, Vorreden, Entwrfe. Walther Rehm
(Hrsg.): Berlin 1968.
Winckelmann, Johann Joachim: Winckelmann-Nachlass, Paris, Bibliothque Natio-
nale de France, Dpartement des manuscrits, Fonds allemand (Signatur: BN All +
Band-Nummer).
Winckelmann, Johann Joachim: Erluterung der Gedanken von der Nachahmung
der griechischen Werke in der Malerey und Bildhauer-Kunst; und Beantwortung
des Sendschreibens ber diese Gedanken (1. Aufl. 1756), in: Ders.: Kleine Schrif-
ten, Vorreden, Entwrfe. Hrsg. von Walther Rehm. Berlin 1968, S. 97144.
Winckelmann, Johann Joachim: Gedancken ber die Nachahmung der Griechischen
Wercke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst (1. Aufl. 1755), in: Ders.: Kleine
Schriften, Vorreden, Entwrfe. Hrsg. von Walther Rehm. Berlin 1968, S. 2759.
Forschungsliteratur
Dcultot, lisabeth: Johann Joachim Winckelmann. Enqute sur la gense de lhistoire de
lart. Paris 2000 (dt. bersetzung: Untersuchungen zu Winckelmanns Exzerptheften.
Ein Beitrag zur Genealogie der Kunstgeschichte im 18. Jahrhundert, bers. von Wolf-
gang von Wangenheim und Ren Mathias Hofter. Ruhpolding 2004).
Franke, Thomas: Ideale Natur aus kontingenter Erfahrung. Johann Joachim Winckelmanns
normative Kunstlehre und die empirische Naturwissenschaft. Wrzburg 2006.
Winckelmanns Konstruktion der Griechischen Nation 59
Gaehtgens, Thomas W. (Hrsg.): Johann Joachim Winckelmann, 17171768. Hamburg
1986.
Hatfield, Henry Caraway: Winckelmann and his German Critics, 17551781. A Prelude to
the Classical Age. New York 1943.
Lepenies, Wolf: Der andere Fanatiker. Historisierung und Verwissenschaftlichung
der Kunstauffassung bei Johann Joachim Winckelmann, in: Herbert Beck/Peter.
C. Bol/Eva Maek-Grard (Hrsg.): Ideal und Wirklichkeit der bildenden Kunst im sp-
ten 18. Jahrhundert. Berlin 1984, S. 1929.
Lepenies, Wolf: Johann Joachim Winckelmann. Kunst- und Naturgeschichte im
achtzehnten Jahrhundert, in: Thomas W. Gaehtgens (Hrsg.): Johann Joachim
Winckelmann, 17171768. Hamburg 1986, S. 221237.
Mller, Urs: Feldkontakte, Kulturtransfer, kulturelle Teilhabe. Winckelmanns Beitrag zur
Etablierung des deutschen intellektuellen Felds durch den Transfer der Querelle des anciens et
des modernes, 2 Bde. Leipzig 2005.
Roger, Jacques: Buffon et le transformisme, in: Ders.: Pour une histoire des sciences
part entire. Paris 1995, S. 272286.
Roger, Jacques: Lhistoire naturelle au XVIII
e
sicle: de lchelle des tres lvolu-
tion, in: Ders.: Pour une histoire des sciences part entire. Paris 1995, S. 237251.
Roger, Jacques: Buffon: un philosophe au Jardin du Roi. Paris 1989.
Seeba, Hinrich C.: Johann Joachim Winckelmann. Zur Wirkungsgeschichte eines
,unhistorischen Historikers zwischen sthetik und Geschichte, in: Deutsche Vier-
teljahresschrift, Suppl., Sept. 1982, S. 170201.
Snderhauf, Esther Sophia: Griechensehnsucht und Kulturkritik. Die deutsche Rezeption
von Winckelmanns Antikenideal 18401945. Berlin 2004.
Uhlig, Ludwig (Hrsg.): Griechenland als Ideal. Winckelmann und seine Rezeption in
Deutschland. Tbingen 1988.
Wiesner, Joseph: Winckelmann und Hippokrates. Zu Winckelmanns naturwissen-
schaftlich-medizinischen Studien, in: Gymnasium. Zeitschrift fr Kultur der Antike
und humanistische Bildung, 60/1953, S. 149167.
60 Elisabeth Dcultot
Polychromie als Herausforderung 61
Kerstin Schwedes
Polychromie als Herausforderung.
sthetische Debatten zur Farbigkeit von Skulptur
Dieser philhellenische Rausch gab sich vorzglich in Deutschland kund, wo hohe
und hchste Kunstbeschtzer ihn theilten. [] Er war von heilsamen Folgen, []
besonders fr das Studium und die Pflege der Knste, und fr die Verbreitung
der neuen polychromen Auffassungsweise griechischer Kunst kam er gerade
rechtzeitig.
So urteilt beinahe euphorisch 1851 einer der Hauptakteure des Poly-
chromie-Streits, Gottfried Semper.
1
Die Bibliographie der Studien zur
Polychromie der Plastik von Patrik Reuterswrd belegt durch die An-
zahl der Nachweise von Literatur aus dem 19. Jahrhundert, wie fruchtbar
dieser ,Rausch war.
2
Auffllig ist dabei, da angesichts der damals
bereits publizierten Funde von Farbspuren sowie der im 19. Jahrhundert
zusammengetragenen und bersetzten antiken Textquellen zur poly-
chrom gefaten Skulptur,
3
die Anzahl der Zweifler grer ist, als man
vermuten wrde. Selbst die Befrworter sind sich hinsichtlich der Art
der von ihnen vorgeschlagenen Farbrekonstruktionen ein und desselben
antiken Bauwerks erstaunlich uneins, was sich besonders in den einigen
1
Semper, Gottfried: Die vier Elemente der Baukunst [Braunschweig 1851]. Reprint
Braunschweig, Wiesbaden 1981, S. 126.
2
Reuterswrd, Patrik: Studien zur Polychromie der Plastik. Griechenland und Rom.
Untersuchungen ber die Farbwirkung der Marmor- und Bronzeskulpturen.
Stockholm, Oslo, Kopenhagen, Helsingfors 1960, S. 927, insbesondere zum
19. Jahrhundert S. 1022.
3
Reuterswrd: Studien, passim. Mit Literaturangaben zu den Quellenlesarten im
19. Jahrhundert: Primavesi, Oliver: Farbige Plastik in der antiken Literatur? Vor-
schlge fr eine differenzierte Lesung, in: Brinkmann, Vinzenz / Wurnig, Ulrike
(Hrsg.): Bunte Gtter. Die Farbigkeit antiker Skulptur. Eine Ausstellung der Skulp-
turhalle Basel in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Antikensammlungen und
Glyptothek Mnchen und den Vatikanischen Museen, Citt del Vaticano, Skulp-
turhalle Basel 11. August bis 20. November 2005, 3. erweiterte Auflage. Mnchen
2005, S. 231249.
62 Kerstin Schwedes
Publikationen beigefgten, deutlich voneinander abweichenden Illu-
strationen zeigt. Exemplarisch kann dies an den Rekonstruktionen des
Aphaia-Tempels zu Aegina nachvollzogen werden: Hittorff, Garnier,
Cockerell und Furtwngler kamen zu Farbfassungen, die sich sowohl in
der Intensitt der Farbigkeit als auch in der Farbverteilung deutlich von-
einander unterscheiden.
4
Wie und warum es bei den ziemlich genauen
Angaben ber antike Farbreste in den zeitgenssischen Ausgrabungs-
berichten zu solchen Farbunterschieden in den bildlichen Rekonstruk-
tionen kommen konnte, hat bereits Andreas Prater in seinem Beitrag
zum Ausstellungskatalog Bunte Gtter von 2005 plausibel beantwor-
tet: Bildliche Darstellungen der Farbrekonstruktionen antiker Skulptur
im 19. Jahrhundert spiegelten in ihren Abweichungen im Hinblick auf
die Farbfunde die Wirkung zeitgenssischer sthetischer Konventionen
auf die Vorstellung antiker Skulptur wider.
5
Im Folgenden wird exemplarisch untersucht, inwieweit solche im
18. Jahrhundert wurzelnden Konventionen die Rekonstruktionen anti-
ker Skulptur in schriftlichen Beitrgen von Kunstkritik und Kunstwis-
senschaft in Deutschland bestimmten.
6
Darber hinausgehend soll aber
verdeutlicht werden, wie Antikenrekonstruktion als bewute Antiken-
4
Siehe die Abbildungen farbiger Rekonstruktionen aus dem 19. Jahrhundert zum
Aphaia-Tempel in Aegina im Ausstellungskatalog Bunte Gtter, S. 75 (Abb. 118,
119), S. 76 (Abb. 121), S. 79 (Abb. 125), S. 81 (Abb. 129), S. 88 (Abb. 141143),
S. 89 (Abb. 144, 145) und S. 121 (Abb. 214).
5
Prater, Andreas: Streit um Farbe. Die Wiederentdeckung der Polychromie in der
griechischen Architektur und Plastik im 18. und 19. Jahrhundert, in: Brinkmann/
Wurnig (Hrsg.): Bunte Gtter, S. 272283. Bereits 1971 hatte Gnter Bandmann
darauf hingewiesen, da im 19. Jahrhundert Werte als dem Kunstwerk immanent
angesehen, in Wirklichkeit aber dem Kunstwerk oktroyiert wurden, wobei Band-
mann dies aber eher als unbewutes denn bewut strategisches Vorgehen ansieht.
Vgl. Bandmann, Gnter: Der Wandel der Materialbewertung in der Kunstth-
eorie des 19. Jahrhunderts, in: Helmut Koopmann/J. A. Schmoll genannt Eisen-
werth (Hrsg.): Beitrge zur Theorie der Knste im 19. Jahrhundert, 2 Bde. Frankfurt a.M.
1971, Bd. 1, S. 130.
6
Zu den Faktoren, die ihrerseits beispielsweise J. J. Winckelmann in seinem Anti-
kenkonstrukt beeinflussten, siehe Blhm, Andreas: In living colour. Ashort
history of colour in sculpture in the 19
th
century, in: Blhm, Andreas (Hrsg.):
The Colour of Sculpture. 18401910, (Ausstellungskatalog Amsterdam, Leeds). Am-
sterdam 1996, S. 12. Eine Untersuchung zur polychromen Plastik Englands liegt
vor in: Myers, Donald: ,Couleur and colour in the New Sculpture, in: Apollo
143/1996, 412, S. 2331. Siehe des weiteren: Drost, Wolfgang: Colour, sculpture,
mimesis. A 19th-century debate, in: Blhm (Hrsg.): The Colour of Sculpture,
S. 6172.
Polychromie als Herausforderung 63
konstruktion im Hinblick auf die propagierten Kunstkonzepte der dama-
ligen Gegenwart einem dazu passenden Ideal angeglichen wurde. Stell-
vertretend fr die Gruppe der Befrworter farbig gefater Skulptur
stehen die in der Folgezeit immer wieder aufgegriffenen Texte Gottfried
Sempers, fr die der Skeptiker insbesondere Franz Kuglers bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts gern zitierte Schrift Ueber die Polychromie []
von 1835. Wie diese gegenstzlichen Konzepte bis in die siebziger Jahre
des 19. Jahrhunderts hineingewirkt haben wird beispielhaft an den Posi-
tionen Gustav Theodor Fechners und Max Schaslers aufgezeigt.
7
Dabei ist generell festzustellen, da bereits seit dem 18. Jahrhundert
zwei immer wieder ins Feld gefhrte Themenkomplexe durchgehend im
Zentrum der Debatte stehen, nmlich Materialgerechtigkeit und gat-
tungsadquate Darstellungsmittel, sowie Naturhnlichkeit und Illusio-
nismus.
Farbe ist nicht Form, so hatte bereits 1778 Johann Gottfried Herder
festgestellt. Farbe sei dem tastenden Sinn nicht merkbar, sondern sei ein
fremder Anwuchs. Frbung der Statuen sei lediglich der Jugend der
Kunst zuzuschreiben. In den schnsten Zeiten brauchten sie [die
Griechen; K.S.] weder Rcke noch Farben [], die Kunst stand []
nackt da.
8
Dem tastenden Sinn solle eine ununterbrochen schne
Form geboten werden, weshalb der Bildhauer das Unschne der Natur-
gestalt wie Wlste von Adern oder Knorpel in seinem Werk tilge.
Bereits Johann Joachim Winckelmann hatte 1764 an griechischer
Skulptur das Primat von Form und Kontur beobachtet und darauf hin-
gewiesen, da das Wei zur gewnschten Monumentalisierung der
Form beitrage: Da nun die weie Farbe diejenige ist, welche die meh-
resten Lichtstrahlen zurckschicket, folglich sich empfindlich macht, so
wird auch ein schner Krper desto schner seyn, je weier er ist, ja er
wird nackend dadurch grer, als er in der That ist, erscheinen [].
9
Auch Carl Ludwig Fernow steht diesem Standpunkt nah, wenn er in
seiner Canova-Kritik 1802 hervorhebt, da das idealische Prinzip von
7
Dabei wird insbesondere auf Schaslers Beitrge in der von ihm herausgegebenen
Zeitschrift ,Die Dioskuren von 1867 bis 1872 zurckgegriffen, die bislang in der
Forschung unbeachtet blieben.
8
Herder, Johann Gottfried: Plastik. Einige Wahrnehmungen ber Form und Gestalt aus
Pygmalions bildenden Traum. Riga 1778, S. 43, 47.
9
Winckelmann, Johann Joachim: Geschichte der Kunst des Alterthums. Erster Theil.
Dresden 1764, 4. Kapitel, S. 147f. Vgl. zur Farbtheorie und ihrem Bezug zur
Skulptur: Argan, Giulio Carlo: Scultura e plastica, in: Enciclopedia universale dell
arte, 15 Bde. Venedig, Rom 1964, Bd. 12, S. 343365.
64 Kerstin Schwedes
Skulptur das Werk ber das Gemeine der Natur erhebe.
10
Selbst im na-
turhnlichsten Darstellungsbereich von Plastik, dem Ebenbild, sei
idealische Behandlung gefordert, wenn das Produkt ein schnes Kunst-
werk seyn soll.
11
Die von Herder bereits deutlich vertretene strenge Scheidung der
Gattungen findet sich letztlich auch bei Fernow. Dieser sieht Malerei
und Plastik zwar als Geschwister an, vertauschten sie aber ihren Charak-
ter oder helfen in ihrer Armuth einander mit ihren Irrthmern aus, so
sei das der falsche Weg: Die Plastik versucht in Marmor zu malen, und
die Malerei trgt die abstrakten Idealformen der Antike kalt und unbe-
lebt auf die Leinwand ber.
12
Die Gattungen Plastik und Malerei ms-
sen sich fr Fernow aufgrund ihrer grundstzlichen Verschiedenheit
ebenso grundstzlich andersartiger Gestaltungsmodi bedienen. Zu ma-
lerische Anordnungen in modernen Basreliefs weist Fernow dement-
sprechend zurck; zu zierlich-zarte Figurenbildung, wie sie Fernow an
Canovas Amor und Psyche-Gruppe vorzufinden meint, knne allen-
falls fr eine malerische Umsetzung passend sein, fr ein plastisches
Werk sei diese Komposition unschicklich.
13
Erweist sich Herder also in seinem Eintreten fr Effektreduzierung
als typischer Vertreter der klassizistischen Fraktion im 18. Jahrhundert,
dem die allzu sehr die Sinne reizenden, zugleich gattungsaufweichen-
den Gestaltungsformen beispielsweise eines Bernini zuwider waren, so
pat Sinnlichkeit auch nicht in das Plastik-Konzept Fernows. Der von
Fernow gergte gefllige schmeichelnde Reiz,
14
welcher durch Cano-
vas Praxis, seine Werke mglichst neben Antiken ersten Ranges aufzu-
stellen, in seiner Unschicklichkeit deutlich zu Tage getreten sei,
15
wi-
derspreche dem Zweck der Plastik an sich. Unter allen Knsten habe sie
die engste Sfre, den einfachsten Zwek und die strengste Bestimtheit ih-
10
Fernow, Carl Ludwig: ber den Bildhauer Canova und dessen Werke. Zrich 1806,
S. 41.
11
Fernow: Canova, S. 41 und S. 42. Zu Herder und zu den sthetischen Anforde-
rungen an Skulptur im 18. Jahrhundert s. Potts, Alex: The Sculptural Imagination.
Figurative, Modernist, Minimalist. New Haven, London 2000, S. 2437.
12
Fernow: Canova, S. 37.
13
Fernow (Canova, S. 119122) meint hier die Arbeiten Canovas, die seines Erach-
tens wie das Attila-Relief Algardis oder die Baptisteriumstr Ghibertis den Dar-
stellungsmodus der Plastik verlassen. Fernows Missfallen kulminiert schlielich
in seiner Titulierung der ,Amor und Psyche-Gruppe als Windmhle.
14
Fernow: Canova, S. 91.
15
Fernow: Canova, S. 23.
Polychromie als Herausforderung 65
rer Formen. Aber in dieser scheinbaren Beschrnktheit bringt sie allein
das Ideal des Schnen in der hchsten Reinheit [] zur wirklichen An-
schauung. Canova entferne sich von diesem Ideal. Er verletze die Be-
stimmungen der Gattungsform indem er sich nicht mit einer milden
matten Politur der Steinoberflche zufrieden gibt, was fr Fernow mate-
rialgerecht wre. Diese Eigenart des Marmors, seine Zurckhaltung, fr
sich selbst keinen Anspruch zu machen, missachte Canova, indem er
ihn durch Beize und Politur den Anschein eines weicheren Stoffes zu
geben trachte.
16
Worauf der Erfolg Canovas seines Erachtens zum grten Teil be-
ruht, stellt Fernow klar: Der ungebte Sinn des blo gaffenden rohen
Teils des Publikums klebe am Reiz der Oberflche. Ein anderer, der sen-
timentale wrde seine formlosen unplastischen Ideen, [] Ahnun-
gen, Fantasien und Gefhle in das Werk hineinlegen.
17
Letztlich erweist
sich fr ihn damit das Publikum im Ausblenden des Verstandes bei der
Kunstbetrachtung als der Beurteilung unfhig.
Das technische Raffinement von Canovas Marmorbehandlung
empfindet noch Franz Reber 1876 bei seiner Canova-Beurteilung in sei-
ner Geschichte der neueren deutschen Kunst als ein Aufhebung von Monu-
mentalitt und wahrer Gre.
18
Canovas Kompositionen sowie die sei-
ner Nachfolger erscheinen Reber wie schon Fernow als zu zierlich und zu
zart im Formenreiz. Canova wird von Reber deshalb nicht in die Filia-
tion der Antike gestellt. Vielmehr nehme nur moderne nordische Plastik
von Thorvaldsen und seinen Nachfolgern dort ihren Ausgangspunkt.
Canovas falsche Sucht nach Grazie fhre bei vllig geistiger Leere
der Figuren allenfalls zu Lsternheit [] oder wahren Frivolitten.
19
Mndete Fernows Kritik an Canova in dessen Charakterisierung als
Rubens in der Plastik,
20
so lebt sie weniger drastisch formuliert auch
noch bei Franz Reber 1876 weiter, wo Canova vorgeworfen wird, da er
zum Malerischen abirrte, zu keiner stylvollen, d. h. specifisch plasti-
schen Behandlung gedieh.
21
16
Fernow: Canova, S. 91f. Vgl. hierzu auch Potts: Sculptural Imagination, S. 3859.
17
Fernow: Canova, S. 194f.
18
Reber, Franz: Geschichte der neueren deutschen Kunst vom Ende des vorigen Jahrhunderts
bis zur Wiener Ausstellung 1873. Mit Bercksichtigung der gleichzeitigen Kunstentwick-
lung in Frankreich, Belgien, Holland, England, Italien und den Ostseelndern. Stuttgart
1876, S. 669.
19
Reber: Geschichte der neueren deutschen Kunst, S. 78, S. 671.
20
Fernow: Canova, S. 235.
21
Reber: Geschichte der neueren deutschen Kunst, S. 151.
66 Kerstin Schwedes
Postulierten Herder und Fernow eine klare Abgrenzung der Gattun-
gen voneinander, so existierten im frhen 19. Jahrhundert ebenso davon
abweichende Konzepte, die die Mngel der Gegenwartskunst gerade
in der Scheidung der Gattungen voneinander begrndet sahen. Diese
Position spiegelt sich ebenfalls in der Polychromiedebatte: So konsta-
tiert Schelling in seinem Kommentar zu Johann Martin Wagners Bericht
ber die Aeginetischen Bildwerke von 1817 einen direkten Zusammen-
hang zwischen der Trennung von Malerei und Plastik und dem generel-
len Verfall der Kunst: Beide Gattungen dienten mittlerweile nicht mehr
dem ffentlichen, sondern seien nur noch bloe Gegenstnde der
Liebhaberei von Privatpersonen und damit ihrer Potenz beraubt.
Durch diesen gegenwrtigen Mangel in der Kunst knne man nunmehr
den einstigen Idealzustand weder begreifen noch beurteilen.
22
Auch Semper lobt 1834 die einander untersttzende Darstellung
von Malerei und Skulptur bei gefaten Figuren.
23
Der engverwachsene
Zusammenhange der Knste sei gewaltsam aufgelst worden. Unver-
meidbare Folge seien Entkrftung und Entartung gewesen. Diesen
Standpunkt unterstreicht Semper nochmals 1851: Er konstruiert hier
22
Johann Martin Wagners [] Bericht ber die Aeginetischen Bildwerke im Besitz Seiner
Knigl. Hoheit des Kronprinzen von Baiern. Mit kunstgeschichtlichen Anmerkungen von
Fr. W. J. Schelling. Stuttgart, Tbingen 1817, S. 219221. Wagner weist darauf hin,
da es nach heutigem Geschmack wohl auffallend und sonderbar und als bar-
barische Sitte, und ein Ueberbleibsel aus frheren roheren Zeiten erscheinen
knne, da der Zierrat am Tempel und eben auch die Skulpturen farbig gefat wa-
ren. Man trete den Werken aber nicht rein und vorurtheilsfrey entgegen. Wre
man an ein farbiges Erscheinungsbild gewhnt, wrde man dieses preisen, was
wir jetzt zu verdammen uns herausgenommen. Schelling kommentiert: Weiter
verfolgt mag jenes Urtheil des Verfassers auf wichtige Betrachtungen leiten, ber
den nothwendigen Verfall der Kunst durch Isolirung und endlich vllige Tren-
nung der sich gegenseitig fordernden Knste, der Architektur, Malerey und
Sculptur, die bis zu dem Grad, in welchem sie jetzt statt findet, vollends erfolgen
musste, sobald Malerey und Bildhauerkunst, anstatt dem Oeffentlichen zu die-
nen, bloe Gegenstnde der Liebhaberey von Privatpersonen wurden. Jede jener
drey Knste [S. 221] mu in der jetzigen Abstraktion die letzten Forderungen des
Gefhls unbefriedigt lassen, und es darf wohl gesagt werden, da besonders bey
dem jetzigen untergeordneten Zustand der Knste, fr die kaum noch Raum in
der Welt ist, wir von der Herrlichkeit eines griechischen Tempels, die durch die
Vereinigung und Zusammenwirkung von Form und Farbe entstand, keinen Be-
griff noch weniger ein Urtheil haben knnen.
23
Semper, Gottfried: Vorlufige Bemerkungen ber bemalte Architektur und Pla-
stik bei den Alten [Altona 1834], in: Manfred und Hans Semper (Hrsg.): Kleine
Schriften von Gottfried Semper. Berlin, Stuttgart 1884, S. 241.
Polychromie als Herausforderung 67
seine Idealvorstellung einer Antike, in der die Knste so innig zusam-
menwirkten, da ihre Grenzen vollstndig verschmolzen waren und sie
in einander aufgingen.
24
Marmor, dessen Wirkung vor allem beim
teuren feinkristallinen weien punischen Marmor gegen eine Bema-
lung zu sprechen schien,
25
ist fr Semper schlicht ein geeigneter Werk-
stoff, der sich vollkommener bearbeiten lie. Die Kostbarkeit ginge
durch die Bemalung nicht verloren. Im Gegenteil: Auch das nicht
Sichtbare musste an Gehalt dem ueren Glanze entsprechen.
26
Ist die
Naturhnlichkeit fr Semper also nicht an sich etwas Negatives, so wur-
zelt die Gegenposition, Naturhnlichkeit verstoe gegen die Wrde des
Formideals, bereits in den frhen Texten Herders und Fernows.
Herder hatte festgestellt, da, wenn etwas dem Nachgebildeten zu
hnlich werde, es also die Illusion erwecke, es handele sich bei dem
Nachgebildeten um das Nachgebildete selbst, dieser Anspruch letztlich
aber von der ihrem Material verhaftet bleibenden Nachbildung nicht
eingelst werden knne. Dies sei dann schlichtweg Popanz.
27
Fernow
wiederum richtet sich gegen eine direkte bernahme von Naturschn-
heit, denn nicht aus einzelnen schnen Theilen der Natur solle man
mechanisch eine Statue zusammentragen.
28
Vielmehr bilde die genia-
lische Einbildungskraft [] eine Vorstellung, die im Material dann
haptische Gestalt annimmt. So seien eben auch die alten Bildwerke aus
der Natur geschpft, aber nie Nachbildung einer wirklichen Individua-
litt aus ihr, sondern eine genialische Schpfung der Einbildungskraft,
wozu die Natur nur den rohen Stof liefere.
29
Analog dazu musste die
Frage nach einer etwaigen Naturhnlichkeit der bemalten Skulptur in
24
Semper: Die vier Elemente der Baukunst, S. 1.
25
Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Die Skulptur [1837], in: Georg Wilhelm
Friedrich Hegel, Werke nach der Werkausgabe 18321845. Vorlesungen ber die
sthetik, Bd. 14, II, 3. Teil: Das System der einzelnen Knste, 2. Abschnitt. Hrsg.
von Eva Moldenhauer/Karl Markus Michel: Frankfurt a.M. 1980, S. 443: Das
letzte der Skulptur vorzglich entsprechende Material endlich ist der Stein [];
am unmittelbarsten aber stimmt der Marmor in seiner Reinheit, Weie sowie in
seiner Farblosigkeit und Milde des Glanzes mit dem Zwecke der Skulptur zusam-
men und erhlt besonders durch das Krnige und das leise Hindurchscheinen des
Lichtes einen groen Vorzug [].
26
Semper: Vorlufige Bemerkungen [1834], S. 237.
27
Herder: Plastik, S. 47.
28
Vgl. dazu auch Positionen in der Frhen Neuzeit bei Jger, Michael: Die Theorie
des Schnen in der italienischen Renaissance. Kln, 1990; Mahon, Denis: Studies in sei-
cento art and theory. London 1947.
29
Fernow: Canova, S. 46.
68 Kerstin Schwedes
der Polychromiedebatte des 19. Jahrhunderts zu den Hauptstreitpunk-
ten gehren, da sich an ihr die Vorstellungen zu Kunstfertigkeit, Kunst-
ideal und Kunstwert brachen.
Semper hatte 1834 behauptet, da in der Antike Gallier die Statuen
Delphis fr eine Armee gehalten und daher keinen Angriff gewagt ht-
ten ein untrglicher Beweis fr ihn, da die Figuren, um so naturhn-
lich wirken zu knnen, bemalt gewesen sein mussten.
30
Dem stellt Kug-
ler ein Jahr spter 1835 in seiner Publikation die von Herodot und
Pausanias berlieferte Geschichte einer Kriegslist der Phnizier gegen-
ber: 500 ihrer Krieger seien wei bemalt ins gegnerische Lager der
Thessalier vorgerckt. Die Thessalier htten sie daraufhin fr Gespenster
gehalten und nicht gewagt, gegen sie zu kmpfen, was den Phniziern
den Sieg eingebracht habe. Geistreich-strategisch dreht Kugler nun diese
Geschichte gegen Semper: Vielleicht htte in Delphi auch eine Geister-
wache von weien Marmorskulpturen die Gegner verjagt. Vllig indis-
kutabel erscheint Kugler nmlich die Vorstellung einer farbigen Bema-
lung der nackten Fleischpartien. Nur ein gelblich wchserner berzug
kommt fr ihn in Frage, der dem Inkarnat einen wrmeren Ton verlie-
hen htte.
31
Rigoros stellt Kugler klar, da das zurckhaltende Farben-
spiel der antiken Skulptur keinesfalls Naturnachahmung angestrebt
habe. Das Wenige an Bemalung habe nur den Haaren, Augen, Lippen
und Gewandsumen gegolten.
32
Illusionistische Bemalung von Skulptur
sei ohnehin eigentlich unmglich und lasse ein plastisches Kunstwerk in
seiner Schein-Natur nur noch starrer wirken ein Argumentationsmu-
ster, das dem Herderschen hnelt.
33
Marmorskulpturen verkrperten in
ihrer Farblosigkeit den Ernst der hheren Kunst, mit dem Illusionis-
mus nicht in Einklang zu bringen sei allenfalls habe er im bedeutungs-
loseren Bereich der niederen Kunst von Klein- und Gebrauchsplastik
30
Semper: Vorlufige Bemerkungen [1834], S. 239.
31
Kugler, Franz: Ueber die Polychromie der griechischen Architektur und Sculptur und ihre
Grenzen. Berlin 1835, S. 60.
32
Bis zu dem Punkt kann Kugler (Ueber die Polychromie, S. 66) sich auch auf die Be-
funde Wagners in Aegina berufen. Wagner hatte 1817 mitgeteilt, da er Farbreste
an den Sumen der Figuren gefunden habe. Spuren roter Farbe an den Schenkeln
der Figuren sieht Wagner aber als zufllig entstanden an. Da sich rote Farbreste
auf den Waffen gefunden hatten, erscheint es Wagner unwahrscheinlich, da
auch das Inkarnat eine solche Frbung aufgewiesen haben knnte. Lippen und
Augen sowie die Haare stellt er sich gefasst vor, auch wenn nur der gute Erhal-
tungszustand dieser Stellen dafr spreche. Vgl. Wagner: Bericht, S. 214216.
33
Vgl. bereits bei Herder: Plastik, S. 47: Die sich nicht einlsende Illusion sei nur
Popanz. Kugler: Ueber die Polychromie, S. 74.
Polychromie als Herausforderung 69
existiert: Dort habe sie zwar schon wegen des kleineren Formates keine
Absicht auf irgendeine Illusion haben knnen dennoch beginne hier
bereits die Entartung.
34
Kugler betont, da Farbenberzug [] in
keinem Verhltniss zu dem Charakter des Marmors stehe.
35
Die Abbildung von Kuglers Parthenon-Rekonstruktion, welche seiner
Publikation von 1835 beigelegt ist, reit Semper 1851 zu einem Verriss
hin: Zierlich verblasener Marzipanstyl [] gerirte sich lediglich als
Griechisch.
36
Als Hauptverantwortlicher der Fraktion ,Marzipanstil
kann dabei unschwer Kugler ausgemacht werden, denn seine vielbeach-
tete Rekonstruktion des Parthenon-Geblks wirkt neben der Semperschen
Antwort von 1836 geradezu farblos.
37
Bei Kugler dominiert das Wei der
Architektur. Goldgefat erscheinen Akroterien und die Tondi des Archi-
travs. Blau dient als Hintergrundfarbe im Bereich der Figurenfelder so-
wohl im Giebel als auch im Metopenfries. Die Figuren selbst erscheinen
im wesentlichen unbunt. Sie erhalten nur im geringen Ma farbige Ak-
zentuierungen von Rot oder Grn an den Gewndern und zum Teil gold-
braun gefate Haarschpfe. Insgesamt berwiegt der Weianteil, so da
Kuglers rekonstruiertes Bildwerk nicht illusionistisch eine Materialver-
wandlung durch Kunst vortuschen, sondern in seiner Realittsebene ver-
harrend bewut bemalt wirken will. Das steinerne Grundmaterial bleibt
dominant.
38
Da die antike Polychromie eben keine Naturnachahmung
34
Kugler: Ueber die Polychromie, S. 64, 72.
35
Kugler: Ueber die Polychromie, S. 53.
36
Semper: Die vier Elemente, S. 129, Anmerkung.
37
Semper, Gottfried: ber die Anwendung der Farben in der Architektur und Plastik,
Heft 1. Rom 1836, T. 5. Abgebildet in: Brinkmann, Vinzenz: Die nchterne Far-
bigkeit der Parthenonskulpturen, in: Brinkmann/Wurnig (Hrsg.): Bunte Gtter,
S. 135, Abb. 244.
38
Sempers Aversion gegen Kuglers sich als Kompromilsung des Problems emp-
fehlende Schrift von 1835, die Kugler selbst als Mittelstrasse bezeichnet (Kug-
ler: Ueber die Polychromie, S. 75), wird besonders deutlich in der von Ironie und
Sarkasmus geprgten folgenden Kennzeichnung des (vermeintlich) Klugen, aus
dem glcklichen Reich der Mitte. Dieser Gelehrte kehre in sein Antikenkabinett
zurck zu seiner weissen Statue: Er beweise daran, vor Damen und vor Herren,
da die Griechen ein plastisches Volk waren, und giebt gelegentlich zu, da He-
lena einen bunten Saum am Kleide hatte. Auch hier nimmt sich Semper seinen
Gegner Kugler vor, der wie erwhnt 1835 allenfalls bunte Einfassungen der Ge-
wnder bei antiker Skulptur fr denkbar gehalten hatte. Sffisant verhhnt Sem-
per den wissenschaftlichen Gegner weiter, denn dieser Redliche warte vergebens
darauf, da das Bunte sich zu harmonischer Schne gestalte. Das Erkennen der
antiken Einheit von Leben und Kunst, das Ineinanderfliessen aller bildenden
Knste bei den Griechen sei ihm nicht mglich, so da ihm letztlich die antike
70 Kerstin Schwedes
angestrebt habe, so lautet eine der Kernthesen Kuglers. Farben seien von
den Griechen nur eingesetzt worden, um die Skulpturen leichter verstnd-
lich zu machen und schrfer zu bezeichnen.
39
Eine mehr als nur dezent
Details und Formen akzentuierende Art der Fassung verwirft Kugler und
sondert die Werke, die umfangreichere Spuren krftiger Farbtne aufwei-
sen, aus dem Kanon der entwickelten griechischen Kunst aus.
Die Zurckweisung der Polychromie mndet bei ihm schlielich in
der Vorstellung eines zyklischen Entwicklungsmodells der Kunst, in wel-
chem Bemalung von Skulptur schlichtweg mit Barbarei gleichgesetzt
wird: Die schwarzen und roten Bildwerke offenbarten, so Kugler (im ne-
gativen Ummnzen der laut Semper kindlichen Phantasie der frhen
Griechen), das kindische Wohlgefallen an krftiger Farbenwirkung
ihrer damaligen Adressaten. Sie sind fr ihn eine Barbarei der noch
unentwickelten, frhen Kunst, die ihre Gtterbilder zum Teil sogar
noch mit wirklicher Kleidung ausstaffiert habe. Vollbemalung sei in der
Folgezeit ebenfalls nur der entarteten Kunst zuzuschreiben, die bereits
auf den beginnenden kulturellen Verfall hindeute.
40
Das Maasshalten
der griechischen Kunst sei in Vergessenheit geraten, die hhere Kunst
sei zum Spiel geworden.
41
Anknpfungspunkt fr die aktuelle Kunst-
produktion seiner Zeit sei aber die griechische Kunst der entwickelten
Kunstphase. Ihre Darstellungsweise solle mannigfach zur weiteren Aus-
schmckung benutzt werden.
42
Die Beliebtheit von Kuglers Modell nur partieller, unbunt wirkender
Bemalung ergibt sich dabei aus dessen Kompatibilitt mit dem Winckel-
mannschen Antikenkonstrukt, das es zu erhalten galt.
43
Kunst in Gnze fremd bleibe: Er gibt sich mit der zur Bildsule wiedererstarrten
Schpfung des Prometheus zufrieden, die als Reduktion jedoch nur den unvoll-
endeten Rohzustand der Statue vor dem letzten, gewissermaen belebenden Akt
ihrer Erschaffung der Bemalung zeige. Vgl. Semper: Die vier Elemente, S. 7.
39
Kugler: Ueber die Polychromie, S. 69, 75.
40
Kugler: Ueber die Polychromie, S. 51; Semper: Vorlufige Bemerkungen, S. 223. Sem-
per entwickelt im folgenden seine Vorstellungen ber das Zusammenwirken der
Knste in Griechenland unter der Regie der Architektur (Semper: Vorlufige Be-
merkungen, S. 224226).
41
Kugler: Ueber die Polychromie, S. 72. Zum Problem der Konstruktion des Klassi-
schen siehe Settis, Salvatore: Die Zukunft des ,Klassischen. Eine Idee im Wandel der
Zeiten. Berlin 2004, insbesondere S. 8188 (Identitt und Alteritt).
42
Kugler: Ueber die Polychromie, S. 75.
43
Vgl. beispielsweise Kuglers Lob auf Winckelmann, [] dessen prophetisch be-
geistertes Wort von seinen Zeitgenossen bewundert, aber erst von den folgenden
Polychromie als Herausforderung 71
Winckelmanns Werke bildeten deutsch-besetzte Meilensteine im Be-
reich von Kunstgeschichts- und Kulturwissenschaft, die Deutschland
eine Vorreiterrolle in Europa sicherten.
44
Gerade einem Kunsthistoriker
wie Kugler, der die Kunstzeitschrift Museum 1831 grndete, spter im
Kunstblatt publizierte, in Berlin Kunstgeschichte lehrte und Kunstrefe-
rent im Preuischen Kulturministerium war,
45
konnte nicht an einer
Preisgabe der tradierten Antikenrekonstruktion liegen, die zudem im-
mer wieder in Ausstellungsbesprechungen des von ihm selbst heraus-
gegebenen Museums als beispielhaft fr die zeitgenssische Plastik vor-
gestellt wurde. So ist es bezeichnend, da Kugler seinen Vorschlag
abschlieend als Mittelstrasse bezeichnet. Kugler selbst empfiehlt die-
sen Kompromi damit als Lsung der Polychromie-Debatte was Sem-
per natrlich kritisiert, da Kuglers Mitte deutlich in Richtung der Poly-
chromie-Ablehnung verrckt ist. Kuglers Mittelstrasse hatte aber den
Vorzug, die wirkungsmchtige Antikenrekonstruktion, oder vielleicht tref-
fender nunmehr als solche sich entpuppende Antikenkonstruktion frhe-
rer Zeiten nicht auf das wissenschaftliche Abstellgleis zu schieben und
mit ihr all die klassizistischen Schriften, Gipsabgsse und ihre plasti-
schen Nachschpfungen. Eine radikalere Revidierung des Tradierten
mitsamt einer daran anschlieenden Konstituierung eines neuen, ande-
ren Antikenbildes wre im Bereich der zeitgenssischen Plastik dem
Zwang zu einer vlligen Neuorientierung gleichgekommen. Das jahr-
zehntelange Ringen um eine neue Blte der Kunst, das sich gerade auch
in Kuglers Zeitschrift Museum in zahlreichen Beitrgen niedergeschlagen
hatte, htte einen empfindlichen Rckschlag, zumindest im Bereich der
Plastik, erlitten. Insofern wundert es nicht, da Kugler selbst in seinem
Handbuch der Kunstgeschichte keine Umorientierung vornimmt.
Wenngleich er wie bereits 1842 den Begriff der Entartung auen vor
lt, zementiert er in der zweiten Auflage dieses Handbuchs von 1848
im wesentlichen seine Ansichten: Illusionistische Nachahmung der
Naturfarben [liegt] auer dem Wesen der griechischen Sculptur. Nur in
der alterthmlichen Kunst und im Bereich des Kunsthandwerks der
Werke von mehr spielender Bedeutung habe man naturgeme Be-
Generationen in lebendigem Schaffen wiedergeboren ward; in: Kugler, Franz:
Handbuch der Kunstgeschichte. Stuttgart 1842, S. 855.
44
S. hierzu Dcultot, Elisabeth: Untersuchungen zu Winckelmanns Exzerptheften. Ein
Beitrag zur Genealogie der Kunstgeschichte im 18. Jahrhundert. Ruhpolding 2004, ins-
bes. S. 106112.
45
Vgl. Koschnick, Leonore: Franz Kugler (18081858) als Kunstkritiker und Kultur-
politiker. Berlin 1985.
72 Kerstin Schwedes
malung angestrebt.
46
Solche Argumentationsmuster hneln denjenigen
Hegels, der zuvor bereits fr die echte Hhe der antiken Kunst eine
farblose Skulptur, einfarbig, aus weiem Marmor gefertigt als cha-
rakteristisch hinstellte, welche sich nur der rumlichen Formen der
menschlichen Gestalt und nicht der malerischen Frbung bediente.
47
Verkrpert wird in den die Polychromie zurckweisenden Abhand-
lungen das Horrorszenario von gefater Skulptur durch die Wachsfigur.
Wachsfiguren erregten Grauen, das gesteht sogar Semper schon 1834
ein, dies aber fhrt er nicht auf ihre Naturhnlichkeit an sich zurck.
Vielmehr liege es an denen, die sie herstellten. Diese seien nmlich
keine Knstler, sondern Marktschreier oder rzte, denen an bloen
Effekten gelegen sei. Gewissermaen das eigentliche Grauen erwecken
fr Semper die Nachahmungen antiker Skulptur, so wie sie gefunden
werde, bar ihres Schmuckes der Farbe. Solche Nachahmung sei geist-
lose Nachfferei [] von Mammutsknochen erstorbener Vorzeit. Re-
sultat seien, so Semper: Wachslarven, Kopien nach dem Tode.
48
Wie bereits Andreas Blhm feststellte,
49
ndert sich die Haltung ge-
genber farbig gefater Skulptur in der zweiten Hlfte des 19. Jahrhun-
derts in Richtung einer zunehmenden Akzeptanz. Auffallend ist dabei
aber, da die lteren Positionen nicht in Vergessenheit geraten und trotz
der vernderten Kunstkonzepte die alten Thesen des Polychromiestreits
durchaus weitergetragen werden.
46
Kugler, Franz: Handbuch der Kunstgeschichte, 2. Auflage. Berlin 1848, S. 192195, 215.
47
Hegel: Die Skulptur, S. 358.
48
Semper: Vorlufige Bemerkungen, S. 229. Noch Arthur Schopenhauer steht dem
knstlerisch-sthetischen Wert von Wachsfiguren kritisch gegenber, denn es sei
dem Kunstwerk wesentlich, die Form allein ohne die Materie zu geben, und zwar
dies offenbar und augenfllig zu tun. Wachsfiguren knnten zwar tuschender
das Wirkliche nachahmen als Bild oder Statue es vermge, doch dies sei nicht
der Zweck der Kunst. Vgl. Schopenhauer, Arthur: Parerga und Paralipomena.
Kleine philosophische Schriften, in: Artur Schopenhauer. Smtliche Werke,
Band 5/2. Hrsg. von Wolfgang Freiherr von Lhneysen. Darmstadt 1976, S. 498.
Zur Bewertung von Wachsfiguren seitens der Kunstkritik und der damit verbun-
denen imitatio-Kritik siehe Trr, Katharina: Farbe und Naturalismus in der Skulptur
des 19. und 20. Jahrhunderts. Sculpturae vitam insufflat pivtura. Mainz 1994,
S. 125142; Yarrington, Alison: Under the spell of Madame Tussaud. Aspects of
,high and ,low in 19
th
-century polychromed sculpture, in: Blhm (Hrsg.): The
Colour of Sculpture, S. 8392, insbesondere S. 8792.
49
Blhm: In living colour, S. 1160. Zum Zusammenhang mit dem aufkommenden
Ideal vom ,Gesamtkunstwerk siehe Hargrove, June: Painter-sculptors and poly-
chromy in the evolution of modernism, in: Blhm (Hrsg.): The Colour of Sculp-
ture, S. 103114, insbes. S. 107110.
Polychromie als Herausforderung 73
So greift Gustav Theodor Fechner 1876 das bereits von Semper als
Ideal verstandene gemeinsame Wirken der bildenden Knste auf. Das
Herstellen weier Menschen ist fr Fechner eher ein Symptom des Ver-
falls, denn Gtterbilder roher Nationen seien ebenso wie Puppen be-
malt. Dies kommt fr Fechner gewissermaen einem Idealzustand
gleich, wo eine unverdorbene Kunstproduktion auf ein unverbildetes
Publikum trifft. Im vermeintlichen Fortschritt der Ausbildung und
Scheidung der Kunstgattungen sieht Fechner vielmehr eine Degenera-
tion der neueren Kunst. Um die Farbe von der Skulptur abzuziehen,
jene auf die Leinwand zu werfen, diese farbennackt hinstellen zu wol-
len, dazu sei eine Arbeitsteilung der Kunst die Voraussetzung. Man sei
mittlerweile daran gewhnt, es sich von der Kunst gefallen zu lassen
und nun verlange man sogar danach: Die Kunst der Jetztzeit aber be-
steht auf dieser Theilung, und der jetzige Geschmack stellt gebieterisch
diese Foderung.
50
Niedergeschlagen habe sich dies eben auch in den
Specialabhandlungen, die eine Verbannung der Farbe von der Ge-
stalt betrieben allein mache sich die Anzahl der in ihnen geuerten
Grnde bald durch ihre Menge verdchtig.
51
Zu denen, die zu Zeiten Fechners gegen die Verbreitung der Polychro-
mie von Skulptur anschrieben, gehrt eindeutig Max Schasler. Schasler
geht von einem in Hinblick auf Semper und Fechner geradezu gegen-
stzlichen Ideal aus. Rigoros trennt er Malerei und Skulptur, um ihnen
jeweils unterschiedliche, als adquat bewertete Themenbereiche zuzu-
weisen, wobei in seinem strikten System jede Gattung zudem den von
Schasler festgelegten und von ihm als angemessen angesehenen Dar-
stellungsmodi zu folgen habe. Schasler nutzt von 1867 an mit einem ge-
radezu penetranten Sendungsbewutsein immer wieder seine eigenen
Beitrge, insbesondere seine Besprechungen der Berliner Kunstausstel-
lungen in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Die Dioskuren zur
Verbreitung seiner Ideen.
52
50
Fechner, Gustav Theodor: Vorschule der Aesthetik [Leipzig 1876], erster Theil,
2. Auflage. Leipzig 1897, S. 192193.
51
Fechner: Vorschule, S. 192.
52
Schaslers Argumentation gleicht in seinem Aufsatz Die Polychromie in ihrer Anwen-
dung auf die Plastik 1888 lteren Beweisfhrungen, die bei Fechner 1876 in der
Vorschule der Aesthetik aufgefhrt werden. Ein Umstand, der beispielsweise
Katharina Trr irritiert (vgl. Trr: Farbe und Naturalismus, S. 117118). Dabei stellt
der Trr vorliegende, spte Beitrag Schaslers nicht vorrangig ein Wiederaufgreifen
von gewissermaen bereits angestaubten Ansichten Anderer dar, welche Fechner
bereits 12 Jahre zuvor zu widerlegen versuchte. Dieses Missverstndnis beruht auf
74 Kerstin Schwedes
Bereits 1867 hatte Schasler ein Konzept von Wand- und Staffelmale-
rei entworfen, das Inhalt und Form (dabei auch knstlerische Technik)
im jeweiligen Medium adquat zur Einheit fhren sollte.
Einem Staffeleigemlde sei ein hherer Grad an Realitt zu eigen,
whrend die Wandmalerei eher einen abstrakteren Gegenstand darzu-
bieten habe. Ein solcher verlange nach einem dementsprechend abstrak-
teren Kolorit, whrend ein Staffeleibild in der Technik der lmalerei
eben auch in Ausnutzung der knstlerischen Mglichkeiten dieses Me-
diums realittsnah darstellen solle. Wenn daher in einer symbolisieren-
den Historie Personen entfernt auseinander liegender Epochen zugleich
erschienen, dann sei dieser Widerspruch zwischen Realitt und Fiktion
in einem farbrmeren Medium wie einem Karton oder einem Relief
nichts Auffallendes, da der Abstraktionscharakter von Medium und In-
halt zueinander paten. Im Bereich der Wandmalerei, vielleicht sogar
noch mit dem Kolorit eines lgemldes, werde dies zu einer gemalten
Lge, zu einem Gespenst des Lebens wie etwa eine in Naturfarben an-
gemalte plastische Figur.
53
Wrde die gedankenlose Menge vielleicht
auch staunen, dem tiefer fhlenden Geist wird dieses Leben nur als
eine geschminkte Leiche erscheinen.
54
Selbst in einem laut Titel eigentlich der Tiermalerei und -plastik ge-
widmeten Aufsatz von 1875 findet Schasler Gelegenheit, seine ganz
prinzipiellen Vorstellungen zum Unterschied von Plastik und Malerei
ausfhrlich unterzubringen. Er unterlegt dabei der Entwicklung der
Knste eine an Hegel orientierte Stufenfolge.
55
Der Architektur folge die
der Nichtbeachtung von Schaslers Beitrgen in den Dioskuren von 1867 bis 1872
seitens der Forschung. Tatschlich drfte sich Fechners Argumentation auf die
nicht enden wollenden Verffentlichungen Schaslers aus den Jahren 1867 bis 1872
beziehen, mit denen dieser sein Konzept zur bildenden Kunst zu propagieren
gedachte. Schasler bedient sich 1888 ebenfalls wieder aus seinem eigenen Text-
fundus, um seine Argumentation und nicht etwa veraltete fremde Konzepte
zu wiederholen.
53
Schasler, Max: Ueber Wandmalerei, mit besonderer Beziehung zu Berlin ec.,
in: Die Dioskuren 12/1867, 12, S. 8992; 13, S. 97100; 17/18, S. 129132; 19,
S. 141144; 20, S. 153155; 21, S. 161164; insbesondere S. 162.
54
Schasler: Ueber Wandmalerei, S. 163. Letztlich greift Schasler dabei Gedanken auf,
die bereits durch Herder und Kugler vorformuliert wurden. Siehe Herder: Plastik,
S. 47; Kugler: Ueber die Polychromie, S. 60.
55
Siehe Schasler, Max: Bemerkungen ber Thiermalerei und Thierplastik, in: Die
Dioskuren 20/1875, 21, S. 153155; 22, S. 161162. Dieses Modell stellt Schasler in
demselben Jahrgang der Dioskuren nochmals vor: Schasler, Max: Die nationalen
Unterschiede der modernen Plastik, in: Die Dioskuren 20/1875, 23, S. 169170;
Polychromie als Herausforderung 75
Plastik, in der sich das Material zusammenziehe und daher ideell be-
deutsamer erscheine. Durch die grere Freiheit der Plastik gegenber
der Architektur herrsche nunmehr ein Gleichgewicht zwischen Idee
und Material, das sich in der folgenden Stufe der Malerei aber in
Richtung der Darstellung des realen Lebens verschiebe. Plastik und
Malerei stellten dabei zwar beide im Unterschied zur Architektur einen
ideellen Inhalt in den Formen der Naturwirklichkeit dar, die Plastik je-
doch mit ihren Mitteln der Form, die Malerei mit den ihr zukommen-
den der Farbe. Da die Plastik von dem realsten Anschauungsmaterial,
nmlich der Farbe abstrahiere, sei sie insgesamt abstrakter als die Male-
rei und somit auch fr die Darstellung abstrakter Ideen geeignet, wh-
rend die Malerei mehr auf die Darstellung des realen Lebens, sowohl
der Menschen wie der Naturwelt angewiesen sei. Absolut zurckzu-
weisen sei daher die barbarische Verbindung von Plastik und Malerei.
Diese brchte allenfalls Naturtuschung hervor, wie die in Wachsfigu-
renkabinetten aufgestellten plastischen und in Naturfarben bemalten,
zum Teil mit echter Kleidung und Haaren ausstaffierten Figuren.
56
Schasler steht letztlich als Antitypus des knstlerisch-plastischen
Bildwerks immerfort eines vor Augen: Polychrome Plastik, die seiner
Meinung nach einem Wachsfigurenkabinett angehren knnte. Da-
her greift er auch Pietro Calvis Othello-Bste scharf an. Malerei sei
blo wirkliche Farbe und habe Form in Schein zu verwandeln. Plastik
hingegen sei wirkliche Form und abstrahiere daher ganz und gar von
der Farbe. Eine Verbindung von Form und Farbe wie bei Calvis Bste
erwecke lediglich den Eindruck des Gespenstigen, denn es sei un-
knstlerisch, in der Plastik so farbige Eindrcke erzielen zu wollen.
57
Leider, so urteilt Schasler, beginne [] dieser plastische Bldsinn wie
24, S. 177179; 25, S. 185186. Die Plastik, so Schasler, habe sich als organisch
lebendige Kunstanschauung berlebt. Wie die Architektur sei sie eklektisch ge-
worden (S. 170). Da Canova kleinliche Sentimentalitt zeige, gebe es als Vorbild
eigentlich nur noch einen modernen Plastiker: Thorwaldsen. Dieser gehe noch
ber die Antike hinaus, denn er besitze eine Innigkeit des Empfindens (S. 178).
56
Schasler: Thiermalerei, S. 154155.
57
Schasler, Max: Kritische Streifzge auf dem Gebiet der Aesthetik. II. Die ver-
schiedenen Standpunkte in der Kunstwissenschaft, in: Die Dioskuren 15/1870, 2,
S. 915; 3, S. 1718; 4, S. 2527; 5, S. 3336; 6, S. 41f.; 7, S. 4951; 8, S. 57f.; 9,
S. 6567; 10, S. 7175; 11, S. 81f.; 12, S. 8991; 13, S. 9699; 25 (30: Kritische
Streifzge auf dem Gebiet der Aesthetik. III. Schein und Tuschung in der
Kunst), S. 194f.; 26, S. 201203; 27, S. 210212; 28, S. 217f.; 29, S. 225227; 30,
S. 234236. Hier insbesondere S. 15.
76 Kerstin Schwedes
eine ansteckende Krankheit schon weiter um sich zu greifen.
58
Hin-
sichtlich eines anderen plastischen Werkes, das ebenfalls aus verschiede-
nen Materialien zusammengefgt ist, warnt Schasler: In dieser Rich-
tung noch einen Schritt und zwar einen sehr migen weiter, und
wir befinden uns im Wachsfigurenkabinett.
59
Schlielich seien diese
Bsten eine [] bloe Nachffung des Naturwirklichen, dem aber das
Naturleben mangelt. Sie erweckten und hier wiederholt sich Schasler
den Eindruck des Gespenstigen oder Lcherlichen, erschienen daher
nicht nur unknstlerisch, sondern auch unnatrlich.
60
Naturwirklich-
keit drfe nicht in die Wirkung des Kunstschnen eingemischt wer-
den, sonst entstnden unknstlerische angemalte Wachsfiguren.
61
Dabei brauche nicht jede bunte Statue nach der Schaubude auszu-
sehen, verteidigt Georg Treu analog zu Semper noch 1884 die gefate
Skulptur, als er in seiner Schrift Sollen wir die Statuen bemalen? die Poly-
chromie fr Skulptur, auch fr moderne Werke, einfordert. Nur eine pur
handwerkliche Produktion der Wachspuppen mibrauche die Farbe
und verhalte sich zur Plastik wie etwa die Gestaltung eines Wirtshaus-
schildes zur lmalerei.
62
Da die Wirkung von Wachsskulptur mit dem
58
Schasler: Kritische Streifzge, S. 71.
59
Schasler: Kritische Streifzge, S. 71. Schasler polemisiert weiter gegen solche Werke,
indem er sich eine Mechanik in ihnen wnscht, mit deren Hilfe man eine Bste
wie eine Spieluhr beispielsweise zum Singen bringen knnte. Schasler scheint von
dieser Polemik selbst so angetan zu sein, da er sie spter noch mehrfach auf-
greift: Man befnde sich nur einen Schritt vor dem Wachsfigurenkabinett und
bruchte dem Othello von Calvi nur eine Sprechmaschine einzusetzen. Sie
knnte dann eine betreffende Stelle aus Shakespeare citiren [], um den Hum-
bug vollkommen und kleine Kinder graulich zu machen. Calvi knne aber auch
eine Bste einer Sngerin machen, die dann mittels einer Spieluhr eine Arie singe,
womit Calvi dann Furore und viel Geld machen wrde. Vgl. Schasler, Max: Die
akademische Kunst-Ausstellung in Berlin, in: Die Dioskuren 16/1871, 1, S. 57; 2,
S. 13f.; 3, S. 22f.; 4, S. 29f.; 5, S. 36f.; hier insbesondere S. 23. Der plastische
Bldsinn verfolgt Schasler auch noch 1875, wo er die Passagen zu Calvis Bste
und zu der des Bildhauers Petrich kaum verndert wieder zum Abdruck bringt.
Vgl: Schasler, Max: Die nationalen Unterschiede, S. 179.
60
Schasler: Kritische Streifzge, S. 210 (Hervorhebungen im Original).
61
Schasler: Kritische Streifzge, S. 227.
62
Vgl. Treu, Georg: Sollen wir unsere Statuen bemalen? Berlin 1884, S. 10. Zu Treu und
den bemalten Abgssen der Dresdener Skulpturensammlung siehe Kiderlen, Mo-
ritz: Die Abgsse der Dresdner Skulpturensammlung, in: Polychrome Skulptur in
Europa: Technologie, Konservierung, Restaurierung. Dresden 1999, S. 161165. Zur
farbigen Gipsabguss-Sammlung in Braunschweig siehe Dring, Thomas: Her-
zogliches Museum Landesmuseum Herzog Anton Ulrich-Museum:
18872004, in: Jochen Luckhardt (Hrsg.): Das Herzog Anton Ulrich-Museum und
Polychromie als Herausforderung 77
Grad an Idealisierung des Werkes zusammenhnge, betont im Aufgrei-
fen dieses Argumentes Martin Feddersen wenige Jahre spter. Nicht jede
Wachsfigur msse grausig wirken, denn bei Idealgestalten, die eben
eine ideale Auffassung haben, trete eine solche Wirkung nicht ein.
Vielmehr machten sie einen recht angenehmen Eindruck.
63
Dennoch
ist Feddersen kein Vertreter der Polychromie von Skulptur an sich. Viel-
mehr erweist er sich als Gegner der Kunstrichtung eines Realismus ge-
rade im Bereich privater Auftragswerke. Er rechnet nmlich mit einer,
durch das Aufgreifen der Polychromie herbeifhrbaren Katharsis des
Geschmacks und der Skulptur, denn [] mit der Einfhrung der poly-
chromen Plastik werde sich die ganze Kunstrichtung in der Plastik bes-
sern und dem Realismus ein Damm entgegegengesetzt werden: Wenn
die Scheulichkeit durch die Polychromie noch scheulicher wirkt,
noch mehr ins Auge fllt, so sollte man ihr schon deshalb dankbar sein.
Feddersens Hoffnung ist, da die modernen Portrtstatuen hierdurch
abgeschafft werden wrden, die Treu noch propagiert hatte.
64
Im Gegen-
satz zu Treu pldiert Feddersen allerdings fr eine Bemalung ffent-
licher Skulpturen, wie etwa bei Denkmlern, die im Schutz der Farbe
lnger ihr ursprngliches Aussehen behalten knnten und den Sinn fr
die Kunst im Volke heben knnten.
65
Lsungsanstze des Problems, wie Gegenwarts-Kunst zu sein habe,
die den zeitgemen Anspruch vertrete, nicht nur von einem elitren
Publikum, sondern von der breiten Masse der Bevlkerung getragen zu
werden, schlagen sich noch deutlicher als bei Feddersen in der Polychro-
mie-Debatte in der zweiten Hlfte des 19. Jahrhunderts nieder. Semper
selbst stellt bereits 1851 fest, da griechische Polychromie dem Gefhle
der Masse entspreche, nmlich dem allgemein angeregten Verlangen
nach Farbe in der Kunst.
66
Farbigkeit und Lebensnhe wird gerade in
seine Sammlungen. 1578. 1754. 2004, Ausstellungskatalog. Braunschweig 2004,
S. 254304, insbesondere S. 263f. Zum Problem der Prsentation und Wertscht-
zung von Gipsabguss-Sammlungen siehe Cain, Hans-Ulrich: Gipsabgsse. Zur
Geschichte ihrer Wertschtzung, in: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums
und Berichte aus dem Forschungsinstitut fr Realienkunde, 1995, S. 200215; Kammel,
Frank Matthias: Der Gipsabguss. Vom Medium der sthetischen Norm zur toten
Konserve der Kunstgeschichte, in: Andrea M. Kluxen (Hrsg.): sthetische Pro-
bleme der Plastik im 19. und 20. Jahrhundert. Nrnberg 2001, S. 4772.
63
Feddersen, Martin: ber polychrome Plastik, in: Kunstchronik. Wochenschrift fr
Kunst und Gewerbe, N. F. 2/1890/91, Sp. 197f.
64
Treu: Sollen wir unsere Statuen bemalen, S. 6, 9.
65
Feddersen: ber polychrome Plastik, Sp. 200.
66
Semper: Die vier Elemente der Baukunst, S. 12.
78 Kerstin Schwedes
der Bewertung der aktuellen Historienmalerei zu einem Hauptkrite-
rium. Beide Debatten die eine um polychrome Skulptur und die
andere um eine adquat gestaltete Historienmalerei wurden von der
Forschung bislang noch nicht im Zusammenhang betrachtet. Da Argu-
mentationsmuster der von 1830 bis 1860 die Schriften zur bildenden
Kunst dominierenden Auseinandersetzung um das Ideal einer Histo-
rienmalerei eben auch die Diskussion um Polychromie in der Gattung
Skulptur speisten, soll im Folgenden gezeigt werden.
Einer der Hauptakteure des Polychromie-Streits, Kugler, hat in der
von ihm herausgegebenen Zeitschrift Museum in seinen Ausstellungsbe-
sprechungen selbstverstndlich auch Historienbilder einer Bewertung
unterzogen. So hat Kugler in zeitlicher Nhe zu seiner Schrift Ueber
die Polychromie 1836 das Gemlde Jeremias auf den Trmmern von Jerusalem
von Eduard Bendemann ausdrcklich gelobt: Hier [] sehen wir die
Aufgaben [] mit reinem unschuldigen Sinne aufgenommen, mit
Liebe und Wahrheit durchgebildet, mit Kraft und Ausdauer zum ergrei-
fendsten Leben vollendet.
67
Er hebt hervor, da Bendemanns Darstel-
lung trotz des gezeigten furchtbaren Elend[s] [] nirgends grsslich
wirke und unserem Gemth Ruhe, unsern Gedanken und Empfindun-
gen Klarheit und Wrde gebe. Ein Jahr spter jedoch kennzeichnet der
Freund und Mitstreiter Kuglers imMuseum, der Archologe und Kritiker
Gustav Adolph Schll die Stimmung auf Eduard Bendemanns Bildern
bereits als zu lyrisch.
68
Die Kritik an solch einer, als unpassend zur Zeit angesehenen, beru-
higenden Wirkung von Historienbildern, die in ihrer Farblosigkeit und
elegischen Grundstimmung als lebensfern und der neuen Zeit inadquat
bewertet werden, nimmt vor allem in junghegelianischen Kreisen zu. So
vermit 1838 Arnold Ruge die Darstellung des Individuums, wodurch
sich fr ihn das Fehlen vom lebendigen Geist in Bendemanns Bildern
erklrt.
69
Ein Faktum, das Ruge in der aktuellen politischen Situation
67
F. K. [Kugler, Franz]: Jeremias auf den Trmmern von Jerusalem, in: Museum.
Bltter fr bildende Kunst 4/1836, 18, S. 137142, hier insbesondere S. 138.
68
[Schll, Gustav Adolph:] Berlin, im Januar 1837. (Nachtrgliches ber die
Kunstausstellung der Akademie vom 18. September bis 26. November 1836.), in:
Kunst-Blatt 18/1837, 17, S. 6568, hier insbes. S. 67.
69
Ruge, Arnold: [Rezension zu] Die dsseldorfer Malerschule und ihre Leistungen
seit der Errichtung des Kunstvereins im Jahre 1829. Ein Beitrag zur modernen
Kunstgeschichte. Von H. Pttmann. Leipzig 1839. Bei Otto Wigand, in: Hallische
Jahrbcher fr deutsche Wissenschaft und Kunst 2/1839, 200, Sp. 15931600, hier ins-
besondere Sp. 1597.
Polychromie als Herausforderung 79
und angesichts der angestrebten gesellschaftspolitischen Umbrche un-
zeitgem erscheinen musste. Noch deutlicher wird 1844 Friedrich
Theodor Vischer, der in seinem Beitrag in den Jahrbchern der Gegenwart
die Abkanzelung der deutschen Malerei durch Heinrich Gustav Hotho
propagiert. Hotho habe sich gegen die moderne Mattheit der deut-
schen Malerei ausgesprochen, welche keine Farbe zeige und so nur das
Energielose hervorbringe.
70
Die Lage erscheint Vischer hoffnungslos.
In demselben Jahrgang der Jahrbcher der Gegenwart wird dann dazu pas-
send ausdrcklich an der Mnchner Historienmalerei Kritik gebt, wel-
che unbekmmert um die Farbe den Sinnen zu wenig Recht widerfah-
ren lasse. Anders und viel besser seien da die belgischen Bilder eines
Eduard de Bifve oder Louis Gallait, die auf der Mnchner Kunstaus-
stellung zu sehen seien, und die vor Lebenswrme strotzten.
71
Gegenber der als kraft- und farblos kritisierten deutschen Historien-
malerei wird also zunehmend eine sinnlichere, in politischer Hinsicht
das Agieren des Individuums als Ideal darstellende Historienmalerei
propagiert. Semper seinerseits greift einen Aspekt einer aktuellen Rich-
tung der Kritik auf, nmlich die Forderung nach mehr Farbigkeit und
Leben, die eigentlich dem Bereich der Malerei gegolten hatte. Zugleich
mnzt er diese auf die Skulptur-Polychromie und deren von ihm als
zeitgem propagieren Akzeptanz in der Debatte um. Das bertragen
der Forderung nach Farbigkeit vom Bereich der Malerei auf den der
Skulptur musste den Widerwillen der Kuglerschen Seite hervorrufen.
Kugler beispielsweise nutzt 1851 eine Rezension zu Manasse Ungers
Buch Das Wesen der Malerei, um diesbezglich seine prinzipellen Beden-
ken kundzutun: Wir leben, wie es scheint, in der Zeit der bunten gei-
stigen Grung, die ohne Zweifel auch in dem knstlerischen Schaffen
ihr Spiegelbild hat; da kann es in tausendfltigen, oft gewi sehr unrei-
70
Vischer, Fr[iedrich]: Deutsche Kunstgeschichte, in: Jahrbcher der Gegenwart
2/1844, S. 831854, insbesondere S. 842. Siehe zur Forderung nach Farbe und da-
mit Leben in Historienbildern: Vischer, Fr.: Gedanken bei Betrachtung der bei-
den belgischen Bilder, in: Jahrbcher der Gegenwart 2/1844, S. 4654.
71
N.N.: Die belgischen Bilder. Eine Parallele mit der Mnchner Schule, in: Jahr-
bcher der Gegenwart 2/1844, S. 2443, hier S. 24: Die Mnchner Historienmale-
rei, eingezwngt in stylistische Formen und unbekmmert um die Farbe, lsst den
Sinnen zu wenig Recht widerfahren, whrend die beiden belgischen Knstler die
Farbe ebenso wie die Form als poetisches Mittel bentzen, um ihre Gestalten so
concret als mglich hervorzuheben. Schon dieser einzige Unterschied wre hin-
reichend, die Mnchner Gemlde in den [S. 25:] Augen des Publikums so lange
unbeliebt zu machen, als sie derselben Technik, derselben Wahrheit und dann
wohl auch derselben frischen und gesunden Auffassung ermangeln.
80 Kerstin Schwedes
fen Versuchen, nach diesem, nach jenem Ziele hin, auch wohl an giftig
aufsteigenden Dnsten nicht fehlen.
72
Und noch 1876 stellt Kuglers
Parteignger Reber resignierend fest, da die derzeitige realistische und
malerische Strmung zu mchtig sei, als dass sie sich mit dem ihr na-
hestehenden Gebiete der Malerei, begngen knnte: Sie fluthe ebenso
ber die Bildnerei. Es entstehe eine moderne Stilvermischung oder
-verwirrung, die nicht erkenne, da es auch in der Plastik eine Grnze
giebt, welche niemals, also auch nicht aufgrund vernderter moderner
Anschauungen in unseren Tagen berschritten werden darf.
73
Das Festhalten an einer weitgehenden farblichen Abstinenz von
Skulptur auch noch in der zweiten Hlfte des 19. Jahrhunderts resultiert
aus der erfolgreichen Etablierung einer bildmchtigen Antiken-Utopie,
fr deren Erhalt wissenschaftliche Ergebnisse sogar marginalisiert wur-
den. Die Akzeptanz einer partiellen Bemalung bei Kugler 1835 und den
ihm folgenden Schriften entpuppt sich insofern als Trojanisches Pferd,
als dadurch Argumentationsmuster in die Debatte eingeschleust wer-
den, die einer Polychromie zumindest fr die jeweils konstatierte Blte-
zeit antiker Plastik widersprechen. Im Zirkelschlu beeinflusste auch das
Erkennen des Potentials an Auswirkungen einer als farbig akzeptierten,
antiken Skulptur auf die Bildhauer der damaligen Gegenwart die Akzep-
tanz der Entdeckungen und Rekonstruktionen. Vorstellungen zur Poly-
chromie antiker Plastik nehmen die Rolle als Scharnier zwischen einem
zum Vorbild deklarierten Antikenideal Winckelmannscher Prgung
einerseits und andererseits der damals aktuellen Kritik der Gegenwarts-
kunst sowie der damit verbundenen Projektion von Idealskulptur (wie
sie sich den Kunstzeitschriften und Kunstgeschichten der Zeit entneh-
men lt) ein. Der daraus resultierende Zwiespalt spiegelt sich in den
divergierenden Kunstkonzepten der Kunstkritik und der sich entwik-
kelnden wissenschaftlichen Disziplin Kunstgeschichte wider. Vertreter
der Kunstgeschichte in Deutschland muten zwischen neueren, wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und den sthetischen Darlegungen ihrer wis-
senschaftlichen Ahnen zu vermitteln suchen, wenn sie die von ihnen
propagierte Vorreiterrolle des eigenen Landes im Wissenschaftsgefge
72
Siehe Kugler, Franz: Kunstliteratur. Das Wesen der Malerei, begrndet und erlu-
tert durch die in den Kunstwerken der bedeutendsten Meister enthaltenen Prin-
cipien. Ein Leitfaden fr denkende Knstler und gebildete Kunstfreunde von
M. Unger. Leipzig 1851, in: Deutsches Kunstblatt. Zeitung fr bildende Kunst und Bau-
kunst. Organ der deutschen Kunstvereine 2/1851, S. 353355, hier insbesondere S. 355.
73
Reber: Geschichte der neueren deutschen Kunst, S. 678: Ihre Brandung schleudere
gar an die Fassaden der gegenwrtigen Architektur.
Polychromie als Herausforderung 81
nicht gefhrden wollten. Um nicht die eigenen Wurzeln, auf die man
immer mit Stolz hingewiesen hatte, zu kappen, ist es gerade Kugler als
Kunsthistoriker und Politiker ein Anliegen gewesen, die sthetischen
Traditionen Winckelmanns in ein Kunstkonzept zu berfhren, das die
neu propagierten Extreme als negative Erscheinungen aussortierte.
74
Kunst in gesellschaftspolitisch zunehmend brisanter Zeit folgt hierbei
wie auch die Frage der Polychromie im Kleinen einem ausgleichenden,
migenden Kurs der Mitte, der in Richtung der Bewahrung traditionel-
ler Werte tendiert und dafr noch 1878 von Semper kritisiert wird: Kug-
ler throne auf dem Tempel in Mnchen und erklre in seinem Kompro-
miss zwischen der farbenscheuen Aesthetik der Vergangenheit und dem
Semperschen Modell die Akten fr geschlossen.
75
Selbst heute noch ist die Wirkung der Antiken-Utopie Winckel-
mannscher Prgung ungebrochen, was sich im Publikumsgeschmack
niederschlgt: Der Markt bedient in zunehmendem Mae ein offenbar
vorhandenes Kuferinteresse durch die Massenproduktion von zahllo-
sen weien Repliken oder plastischen Neu-Kreationen fr den Bereich
der Wohnraum- und Gartendekoration, wie sie in modernen Lifestyle-
Magazinen zur Veredlung des heimischen Ambientes propagiert wer-
den. Und so scheint Peter Blomes Schlusatz des Vorwortes zum Bunte
Gtter-Katalog von 2005 durchaus auch apotropische Zge zu haben:
Es gibt kein Zurck zum faden Wei.
76
74
Siehe Kugler, Franz: [Rezension von:] Das Wesen der Malerei, begrndet und er-
lutert durch die in den Kunstwerken der bedeutendsten Meister enthaltenen Prin-
cipien. Ein Leitfaden fr denkende Knstler und gebildete Kunstfreunde von
M. Unger. Leipzig 1851, in: Deutsches Kunstblatt. Zeitung fr bildende Kunst und Bau-
kunst. Organ der deutschen Kunstvereine 2/1851, S. 353355, hier insbesondere S. 355.
75
Semper, Gottfried: Der Stil. Mnchen 1878, S. 432.
76
Blome, Peter: Vorwort, in: Brinkmann/Wurnig (Hrsg.): Bunte Gtter, S. 9. Da
die Farbe seit der Antike systematisch verdrngt und abgewertet worden sei,
wobei nicht zuletzt [] Kunsthistoriker und Kulturtheoretiker vewrschiedenen
Ranges [] dieses Vorurteil genhrt und gehegt und gepflegt [] htte, fhrt
2002 David Batchelor aus. S. Batchelor, David: Chromophobie. Die Angst vor der
Farbe. Wien 2002, S. 20. Vgl. Settis: Die Zukunft des ,Klassischen, S. 9697: Settis
fhrt aus, da die Antike als Reservoir von exempla verstanden worden sei.
Heute wie damals zerstrt die Fragmentierung in Einzelteile ohne Kontext zwar
das ,Klassische in seiner Substanz, trgt es jedoch auch weiter und perpetuiert
es. Man knne sogar die Hypothese aufstellen, Da sein hartnckiges periodi-
sches Wiederaufblhen das ,klassische Altertum bei jeder Wiedergeburt noch
mehr zu einer Mischkultur hat werden lassen, da es immer neuen Einflssen aus-
gesetzt war, da es immer neuen kulturellen Situationen als Modell und Bezugs-
punkt diente.
82 Kerstin Schwedes
Literaturverzeichnis
Quellen
N.N.: Die belgischen Bilder. Eine Parallele mit der Mnchner Schule, in: Jahrbcher
der Gegenwart, 2/1844, S. 2443.
Fechner, Gustav Theodor: Vorschule der Aesthetik [Leipzig 1876], erster Theil, 2. Auf-
lage. Leipzig 1897.
Feddersen, Martin: ber polychrome Plastik, in: Kunstchronik. Wochenschrift fr
Kunst und Gewerbe, N. F., 2/1890/91, Sp. 197f.
Fernow, Carl Ludwig: ber den Bildhauer Canova und dessen Werke. Zrich 1806.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Die Skulptur [1837], in: Georg Wilhelm Fried-
rich Hegel, Werke nach der Werkausgabe 18321845. Vorlesungen ber die sthetik,
Bd. 14, II, 3. Teil: Das System der einzelnen Knste, 2. Abschnitt. Eva Molden-
hauer/Karl Markus Michel (Hrsg.): Frankfurt a. M. 1980.
Herder, Johann Gottfried: Plastik. Einige Wahrnehmungen ber Form und Gestalt aus Pyg-
malions bildenden Traum. Riga 1778.
Kugler, Franz: Ueber die Polychromie der griechischen Architektur und Sculptur und ihre
Grenzen. Berlin 1835.
: Handbuch der Kunstgeschichte. Stuttgart 1842.
: Handbuch der Kunstgeschichte.
2
Berlin 1848.
: Kunstliteratur. Das Wesen der Malerei, begrndet und erlutert durch die in den
Kunstwerken der bedeutendsten Meister enthaltenen Principien. Ein Leitfaden
fr denkende Knstler und gebildete Kunstfreunde von M. Unger. Leipzig 1851,
in: Deutsches Kunstblatt. Zeitung fr bildende Kunst und Baukunst. Organ der deutschen
Kunstvereine, 2/1851, S. 353355.
: [Rezension von:] Das Wesen der Malerei, begrndet und erlutert durch die in
den Kunstwerken der bedeutendsten Meister enthaltenen Principien. Ein Leit-
faden fr denkende Knstler und gebildete Kunstfreunde von M. Unger. Leipzig
1851, in: Deutsches Kunstblatt. Zeitung fr bildende Kunst und Baukunst. Organ der
deutschen Kunstvereine, 2/1851, S. 353355.
: F. K. [Kugler, Franz]: Jeremias auf den Trmmern von Jerusalem, in: Museum.
Bltter fr bildende Kunst, 4/1836, 18, S. 137142.
Reber, Franz: Geschichte der neueren deutschen Kunst vom Ende des vorigen Jahrhunderts
bis zur Wiener Ausstellung 1873. Mit Bercksichtigung der gleichzeitigen Kunstentwick-
lung in Frankreich, Belgien, Holland, England, Italien und den Ostseelndern. Stuttgart
1876.
Ruge, Arnold: [Rezension zu] Die Dsseldorfer Malerschule und ihre Leistungen
seit der Errichtung des Kunstvereins im Jahre 1829. Ein Beitrag zur modernen
Kunstgeschichte. Von H. Pttmann. Leipzig 1839. Bei Otto Wigand, in: Hallische
Jahrbcher fr deutsche Wissenschaft und Kunst, 2/1839, 200, Spalte 15931600.
Schasler, Max: Ueber Wandmalerei, mit besonderer Beziehung zu Berlin ec.,
in: Die Dioskuren, 12/1867, 12, S. 8992; 13, S. 97100; 17/18, S. 129132; 19,
S. 141144; 20, S. 153155; 21, S. 161164.
: Kritische Streifzge auf dem Gebiet der Aesthetik. II. Die verschiedenen Stand-
punkte in der Kunstwissenschaft, in: Die Dioskuren, 15/1870, 2, S. 915;
3, S. 1718; 4, S. 2527; 5, S. 3336; 6, S. 41f.; 7, S. 4951; 8, S. 57f.; 9, S. 6567;
10, S. 7175; 11, S. 81f.; 12, S. 8991; 13, S. 9699; 25 (30: Kritische Streifzge
Polychromie als Herausforderung 83
auf dem Gebiet der Aesthetik. III. Schein und Tuschung in der Kunst), S. 194f.;
26, S. 201203; 27, S. 210212; 28, S. 217f.; 29, S. 225227; 30, S. 234236.
: Die akademische Kunst-Ausstellung in Berlin, in: Die Dioskuren, 16/1871, 1,
S. 57; 2, S. 13f.; 3, S. 22f.; 4, S. 29f.; 5, S. 36f.
: Bemerkungen ber Thiermalerei und Thierplastik, in: Die Dioskuren, 20/1875,
21, S. 153155; 22, S. 161162.
: Die nationalen Unterschiede der modernen Plastik, in: Die Dioskuren, 20/1875,
23, S. 169170; 24, S. 177179; 25, S. 185186.
[Schll, Gustav Adolph:] Berlin, im Januar 1837. (Nachtrgliches ber die Kunst-
ausstellung der Akademie vom 18. September bis 26. November 1836.), in:
Kunst-Blatt, 18/1837, 17, S. 6568.
Schopenhauer, Arthur: Parerga und Paralipomena. Kleine philosophische Schrif-
ten, in: Artur Schopenhauer. Smtliche Werke, Band 5/2. Hrsg. von Wolfgang Frei-
herr von Lhneysen. Darmstadt 1976.
Semper, Gottfried: Vorlufige Bemerkungen ber bemalte Architektur und Plastik
bei den Alten [Altona 1834], in: Manfred und Hans Semper (Hrsg.): Kleine Schrif-
ten von Gottfried Semper. Berlin, Stuttgart 1884.
: ber die Anwendung der Farben in der Architektur und Plastik, Heft 1. Rom 1836.
: Die vier Elemente der Baukunst [Braunschweig 1851]. Reprint Braunschweig, Wies-
baden 1981.
: Der Stil. Mnchen 1878.
Treu, Georg: Sollen wir unsere Statuen bemalen? Berlin 1884.
Vischer, Fr[iedrich]: Deutsche Kunstgeschichte, in: Jahrbcher der Gegenwart,
2/1844, S. 831854.
: Gedanken bei Betrachtung der beiden belgischen Bilder, in: Jahrbcher der Ge-
genwart, 2/1844, S. 4654.
Wagner, Johann Martin: Johann Martin Wagners [] Bericht ber die Aeginetischen Bild-
werke im Besitz Seiner Knigl. Hoheit des Kronprinzen von Baiern. Mit kunstgeschicht-
lichen Anmerkungen von Fr. W. J. Schelling. Stuttgart, Tbingen 1817.
Winckelmann, Johann Joachim: Geschichte der Kunst des Alterthums. Erster Theil. Dres-
den 1764.
Forschungsliteratur
Argan, Giulio Carlo: Scultura e plastica, in: Enciclopedia universale dell arte, 15 Bde.
Venedig, Rom 1964.
Bandmann, Gnter: Der Wandel der Materialbewertung in der Kunsttheorie des
19. Jahrhunderts, in: Helmut Koopmann/J. A. Schmoll genannt Eisenwerth
(Hrsg.): Beitrge zur Theorie der Knste im 19. Jahrhundert, 2 Bde. Frankfurt a. M.
1971.
Batchelor, David: Chromophobie. Die Angst vor der Farbe. Wien 2002.
Blome, Peter: Vorwort, in: Vinzenz Brinkmann/Ulrike Wurnig (Hrsg.): Bunte
Gtter. Die Farbigkeit antiker Skulptur. Eine Ausstellung der Skulpturhalle Basel
in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek
Mnchen und den Vatikanischen Museen, Citt del Vaticano, Skulpturhalle
Basel 11. August bis 20. November 2005, 3. erweiterte Auflage. Mnchen 2005,
S. 9.
84 Kerstin Schwedes
Blhm, Andreas: In living colour. A short history of colour in sculpture in the 19th
century, in: Andreas Blhm (Hrsg.): The Colour of Sculpture. 18401910, (Ausstel-
lungskatalog Amsterdam, Leeds). Amsterdam 1996.
Brinkmann, Vinzenz: Die nchterne Farbigkeit der Parthenonskulpturen, in:
Brinkmann/Wurnig (Hrsg.): Bunte Gtter, S. 132147.
Cain, Hans-Ulrich: Gipsabgsse. Zur Geschichte ihrer Wertschtzung, in: Anzeiger
des Germanischen Nationalmuseums und Berichte aus dem Forschungsinstitut fr Realien-
kunde, 1995, S. 200215.
Dcultot, Elisabeth: Untersuchungen zu Winckelmanns Exzerptheften. Ein Beitrag zur
Genealogie der Kunstgeschichte im 18. Jahrhundert. Ruhpolding 2004.
Dring, Thomas: Herzogliches Museum Landesmuseum Herzog Anton Ulrich-
Museum: 18872004, in: Jochen Luckhardt (Hrsg.): Das Herzog Anton Ulrich-Mu-
seum und seine Sammlungen. 1578. 1754. 2004, Ausstellungskatalog. Braunschweig
2004, S. 254304.
Drost, Wolfgang: Colour, sculpture, mimesis. A 19th-century debate, in: Blhm
(Hrsg.): The Colour of Sculpture, S. 6172.
Hargrove, June: Painter-sculptors and polychromy in the evolution of modernism,
in: Blhm (Hrsg.): The Colour of Sculpture, S. 103114.
Jger, Michael: Die Theorie des Schnen in der italienischen Renaissance. Kln 1990.
Kammel, Frank Matthias: Der Gipsabguss. Vom Medium der sthetischen Norm
zur toten Konserve der Kunstgeschichte, in: Andrea M. Kluxen (Hrsg.). stheti-
sche Probleme der Plastik im 19. und 20. Jahrhundert. Nrnberg 2001, S. 4772.
Kiderlen, Moritz: Die Abgsse der Dresdner Skulpturensammlung, in: Polychrome
Skulptur in Europa: Technologie, Konservierung, Restaurierung. Dresden 1999, S. 161
165.
Koschnick, Leonore: Franz Kugler (18081858) als Kunstkritiker und Kulturpolitiker.
Berlin 1985.
Mahon, Denis: Studies in seicento art and theory. London 1947.
Myers, Donald: ,Couleur and colour in the New Sculpture, in: Apollo, 143/1996,
412, S. 2331.
Reuterswrd, Patrik: Studien zur Polychromie der Plastik. Griechenland und Rom. Un-
tersuchungen ber die Farbwirkung der Marmor- und Bronzeskulpturen. Stock-
holm, Oslo, Kopenhagen, Helsingfors 1960.
Potts, Alex: The Sculptural Imagination. Figurative, Modernist, Minimalist. New Haven,
London 2000.
Prater, Andreas: Streit um Farbe. Die Wiederentdeckung der Polychromie in der
griechischen Architektur und Plastik im 18. und 19. Jahrhundert, in: Brinkmann/
Wurnig (Hrsg.): Bunte Gtter, S. 272283.
Primavesi, Oliver: Farbige Plastik in der antiken Literatur? Vorschlge fr eine diffe-
renzierte Lesung, in: Brinkmann/Wurnig (Hrsg.): Bunte Gtter, S. 231249.
Settis, Salvatore: Die Zukunft des ,Klassischen. Eine Idee im Wandel der Zeiten. Berlin
2004.
Trr, Katharina: Farbe und Naturalismus in der Skulptur des 19. und 20. Jahrhunderts.
Sculpturae vitam insufflat pivtura. Mainz 1994.
Yarrington, Alison: Under the spell of Madame Tussaud. Aspects of ,high and ,low
in 19tn-century polychromed sculpture, in: Blhm (Hrsg.): The Colour of Sculp-
ture, S. 8392.
Normative Anschaulichkeit versus archologische Pedanterie 85
Christian Scholl
Normative Anschaulichkeit
versus archologische Pedanterie:
Karl Friedrich Schinkels sthetischer
Philhellenismus
Man geht sicher nicht zu weit, wenn man Karl Friedrich Schinkel als
einen Philhellenen bezeichnet. Fr sein Schaffen bot die Kunst der grie-
chischen Antike einen wichtigen Mastab. Dies gilt vor allem fr die
Zeit nach den Befreiungskriegen, als Schinkel Gebude wie die Neue
Wache, das Schauspielhaus und das Museum am Lustgarten fr Berlin ent-
warf. Wenn die damalige preuische Residenzstadt als Spreeathen
1
gilt, so beruht dies nicht zuletzt auf diesen Bauwerken. Da die griechi-
sche Kunst der klassischen Antike ein entscheidender Bezugspunkt fr
den Knstler war, manifestiert sich auch in dem Gemlde Blick in Grie-
chenlands Blte von 1824/25. Es zeigt die Vision der gesellschaftlichen
und knstlerischen Blte Griechenlands zur Zeit der Antike und formu-
liert zugleich ein Ideal fr das aktuelle Baugeschehen in Berlin.
2
1
Die Bezeichnung geht auf den Berliner Dichter Erdmann Wircker zurck, der
1706 in einem Gedicht Knig Friedrich Wilhelm I von Preuen huldigte: Die
Frsten wollen selbst in deine Schule gehn, darum hast du auch gebaut fr sie ein
Spree-Athen (Wircker, Erdmann: Mrckische Neun Musen, welche sich unter den
allergromchtigsten Schutz Sr. Knigl. Majestt in Preuen als Ihres allergndigsten
Erhalters und andern Jupiters bey glcklichen Anfang ihres Jubel-Jahres auff dem Franck-
furtischen Helicon frohlockend auffgestellet. Berlin 1706, S. 5860, hier S. 59:
Da ganz Europa nicht von einem Frsten hrt! /
Der so der Knste Kern als Knig Friedrich liebet.
Die Frsten wollen selbst in deine Schule gehn /
Drumb hastu auch fr Sie ein Spree-Athen gebauet.
Wo Prinzen in der Zahl gelehrter Musen stehn/
Da wird die Weisheit erst in rechter Pracht geschauet.
2
Es ist sicher kein Zufall, da das Gemlde Blick in Griechenlands Blte eine hn-
liche Perspektive zeigt wie der von Schinkel in seiner Sammlung Architektonischer
Entwrfe verffentlichte Blick aus dem Treppenhaus des gleichzeitig errichteten
86 Christian Scholl
Freilich gehrt Schinkel noch zu derjenigen Generation von Knst-
lern, die in der Nachfolge Winckelmanns ein Griechenland-Ideal ver-
folgten, ohne selbst in Griechenland gewesen zu sein.
3
Sein Wissen ber
die griechische Kultur und Architektur bezog er indirekt aus der Lektre
von Stichwerken und Traktaten sowie aus der Kenntnis Italiens.
4
Fr
einen Architekten, der in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
wirkte, war dies nicht ungewhnlich. Folgenreicher war, da Schinkel
gerade mit den Bauten, die als sein wichtigster Beitrag zur klassizisti-
schen Architektur gelten, nmlich mit dem Schauspielhaus und dem
Alten Museum in Berlin, bei Zeitgenossen auf eine entschiedene Kritik
stie, die sich ihrerseits auf die Baukunst der Alten berufen konnte. So
erfuhr unter anderem Johann Wolfgang Goethe von den Einwnden ge-
gen die Architektur des 181821 errichteten Berliner Schauspielhauses.
In einem Brief an seinen Freund Karl Friedrich Zelter vom 14. 10. 1821
erkundigte sich der Dichter nach den Kritikpunkten. Zelter antwortete:
Die Architekten vermissen einen reinen Stil. Zu viele Ecken und
Kropfwerk; zu viele schmale Fenster werden anstig gefunden.
5
Mit dem Vorwurf, da das Schauspielhaus zu viele Ecken und Kropf-
werk aufweise, berliefert Zelter einen Standpunkt, der um 1800 fr eine
klassizistische Kunstauffassung charakteristisch war. Die extensive Ver-
Museums am Lustgarten. Vgl. hierzu Vogt, Adolf Max: Karl Friedrich Schinkel. Blick
in Griechenlands Blte. Ein Hoffnungsbild fr ,Spree-Athen. Frankfurt a.M. 1985,
S. 58f. Zu der wechselseitigen Beziehung von Gemlde und Stadtlandschaft vor
dem Hintergrund des Griechenland-Ideals vgl. auch Scholl, Christian: Optimi-
stischer Sentimentalismus: Karl Friedrich Schinkels ,Blick in Griechenlands
Blte als Vision fr Spaziergnger, in: Gellhaus, Axel/Moser, Christian/Schnei-
der, Helmut J. (Hrsg.): Kopflandschaften Landschaftsgnge. Kulturgeschichte und Poe-
tik des Spaziergangs. Kln, Weimar, Wien 2007, S. 127146.
3
Zum Griechenland-Bild Schinkels vgl. u. a. Vogt: Karl Friedrich Schinkel, S. 511;
Jaff, Hans C. L.: Schinkels Gemlde ,Blick in Griechenlands Blte ein
Bildungsbild, in: Grtner, Hannelore (Hrsg.): Schinkel-Studien. Leipzig 1984,
S. 199205, S. 203205.
4
Vgl. u. a. Forssman, Erik: Karl Friedrich Schinkel. Bauwerke und Baugedanken. Mn-
chen, Zrich 1981, S. 89f.
5
Karl Friedrich Zelter an Johann Wolfgang Goethe, Brief vom 21. 10. 1821. Zitiert
nach Hecker, Max (Hrsg.): Der Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter, Bd. 2. Bern
1970 (zuerst Frankfurt a.M. 1919), S. 137. Zur Kritik am Schauspielhaus vgl. etwa
Rave, Paul Ortwin: Berlin. Erster Teil. Bauten fr die Kunst. Kirchen / Denkmalpflege
(Karl Friedrich Schinkel: Lebenswerk), Erweiterter Nachdruck. Mnchen, Berlin
1981, S. 122124; Peschken, Goerd: Das Architektonische Lehrbuch (Karl Friedrich
Schinkel: Lebenswerk). Nachdruck der Ausgabe von 1979. Mnchen, Berlin 2001,
S. 7779.
Normative Anschaulichkeit versus archologische Pedanterie 87
krpfung von Geblken ber Sulen und Pilastern, wie sie in der barok-
ken Architektur gepflegt worden war, geriet im ausgehenden 18. Jahr-
hundert zunehmend in Verruf. Dabei berief sich die Kritik auf die
griechische Antike und auf die Natur.
6
Schinkel wird gleichsam ein
Rckfall in die berwundene Tradition des Barock vorgeworfen. In der
Tat hat dieser fr seine Schauspielhausfassaden Pfeiler- und Geblkfor-
mationen entwickelt, die sich nicht mehr auf das Vorbild der griechi-
schen Antike beziehen. Zwar whlte er das antike Trasyllos-Monument
in Athen gleichsam als Keimzelle fr seine Fassaden und verwies in
der Sammlung architektonischer Entwrfe ausdrcklich darauf, im Stil so
weitgehend wie mglich griechische Formen und Construktionswei-
sen befolgt zu haben.
7
Die Lsung, die er fand, blieb gleichwohl in den
Augen archologisch gebildeter Zeitgenossen unkanonisch. So fasst
Schinkel zwei Geschosse mit eng gestellten Pfeilern, die jeweils ein Ge-
blk tragen, mit einer bergreifenden Kolossalordnung zusammen.
Diese Kolossalordnung, in die die Einzelgeschosse gewissermaen ein-
geschachtelt sind, hat ihr eigenes Geblk, das direkt ber dem Geblk
der oberen Einzelgeschosspfeilerstellung liegt. Durch die Schachtelung
ergeben sich an einigen Stellen komplizierte Versprnge, angesichts de-
rer man tatschlich von Kropfwerk sprechen kann. Nicht nur mit die-
sem Kropfwerk, sondern auch mit der Anlage geschossbergreifender
Kolossalpfeiler hat Schinkel im Verstndnis der damaligen Architektur-
theorie ungriechische und damit verwerfliche Formen gewhlt.
6
Vgl. etwa Laugier, Marc-Antoine: Das Manifest des Klassizismus. Nach dem Original-
titel: Essai sur lArchitecture (1753). Zrich, Mnchen 1989, S. 48: 1. Das Geblk
mu immer gerade auf den Sulen aufliegen. 2. Auf seiner ganzen Lnge darf es
keine Ecke, keine Verkrpfung haben. Laugier leitet diese Forderungen vom Mo-
dell der Urhtte ab, das eine naturgeme Architektur garantieren sollte und
von ihm auch als Vorbild antiker Tempelbauten verstanden wurde (vgl. ebd.,
S. 3337).
7
Schinkel, Karl Friedrich: Sammlung architektonischer Entwrfe. Smtliche Texte und
Tafeln der Ausgabe Potsdam 18411845 (2., erweiterte Auflage). Alfons Uhl
(Hrsg.): Nrdlingen 2006, S. 143: Ueber den Styl der Architektur, welchen ich
dem Gebude gab, bemerke ich nur im Allgemeinen, dass ich mich, so viel es ein
so mannigfach zusammengesetztes Werk irgend zulassen wollte, den griechischen
Formen und Constructionsweisen anzuschliessen bemhte. Im folgenden Text
verweist Schinkel ausdrcklich auf das Thrasyllos-Monument (ebd.). Zu Schin-
kels Gebrauch dieses Motivs vgl. auch Bothe, Rolf: Antikenrezeption in Bauten
und Entwrfen Berliner Architekten zwischen 1790 und 1870, in: Willmuth
Arenhvel (Hrsg.): Berlin und die Antike. Architektur, Kunstgewerbe, Malerei, Skulp-
tur, Theater und Wissenschaft vom 16. Jahrhundert bis heute. Ausstellungskatalog Ber-
lin 1979, S. 294333, S. 308310; Forssman: Karl Friedrich Schinkel, S. 108f.
88 Christian Scholl
Der Vorwurf, mit Mitteln zu arbeiten, die nicht durch die Architektur
der Griechen sanktioniert waren, steigerte sich im Falle des 182330 er-
richteten Museums am Berliner Lustgarten. Hier fasste Schinkel nicht nur
einen zweigeschossigen, hoch aufgesockelten Bau mit kolossalen Eck-
pfeilern ein, sondern stellte auch eine Reihe von Kolossalsulen vor den
Bau. All dies rief die zeitgenssische Kritik hervor.
8
Es war namentlich
der Berliner Archologieprofessor Alois Hirt, der Schinkels Museums-
plne angriff. Seine Einwnde wogen besonders schwer, da sie vom Ver-
fasser der Baukunst nach den Grundstzen der Alten stammten, der als aus-
gewiesener Experte antiker Architektur galt. Schinkel musste auf die
Kritik reagieren, zumal sie noch whrend der Genehmigungsphase des
Museumsbaues vorgebracht wurde und das gesamte Projekt zu gefhr-
den drohte.
Die Reaktion des Architekten ist insofern bemerkenswert, als sie von
vornherein auf einer sthetischen Ebene argumentiert. So schreibt
Schinkel in seinem Votum zu dem Gutachten des Herrn Hofrat Hirt vom Fe-
bruar 1823: Ein solcher Entwurf ist ein Ganzes, dessen Teile so genau
zusammenhngen, da darin nichts Wesentliches gendert werden
kann, ohne aus der Gestalt eine Migestalt zu machen.
9
Wie wichtig
dem Architekten die sthetische Auffassung seines Entwurfs als eines
unteilbaren Ganzen war, an dem sich kein Detail ohne Einbuen n-
dern lasse, zeigt sich daran, da er dieses Argument bereits zur Verteidi-
gung seiner Schauspielhaus-Architektur genutzt hat. So heit es in der
Verffentlichung in der Sammlung Architektonischer Entwrfe:
Am fertigen Werke glauben viele sich berufen, nach dunklem und einseitigem
Gefhl das Einzelne ndern zu knnen, weil Unwissenheit und Mangel an Fhig-
keit ein vielfach und verschiedenartig Gegebenes auf Einheit zu bringen, sie
gegen die Zerstrungen blind macht, welche diese Aenderungen in den Zusam-
menhang des Ganzen bringen wrden.
10
Schinkel verstand jeden seiner Entwrfe als ein zusammenhngendes
Ganzes und verteidigte diesen als solches gegen seine Kritiker. Damit
8
Vgl. u. a. Rave: Berlin I, S. 32. Vogtherr, Christoph Martin: Das Knigliche Museum
zu Berlin. Planungen und Konzeption des ersten Berliner Kunstmuseums. Jahrbuch der
Berliner Museen 39/1997, Beiheft, sowie Hammer-Schenk, Harold: ,[] nicht so-
wohl etwas Anderes, sondern mehr Sachgemsseres. Zeitgenssische Kritik an
Schinkels Museum in Berlin, in: Margit Kern (Hrsg.): Geschichte und sthetik:
Festschrift fr Werner Busch zum 60. Geburtstag. Mnchen, Berlin 2004, S. 349361,
gehen auf die Frage der Kolossalsulen nicht ein.
9
Zitiert nach Rave: Berlin I, S. 34.
10
Schinkel: Sammlung architektonischer Entwrfe, S. 136.
Normative Anschaulichkeit versus archologische Pedanterie 89
konnte er auch eine Detailkritik zurckweisen, die sich etwa an den
ungriechischen Kolossalsulen strte. Weil diese Kritik den Gesamt-
zusammenhang des Kunstwerks verfehlte, kam ihr gem Schinkels
Argumentation kein Gewicht zu. In seinen Skizzen zu einem Architekto-
nischen Lehrbuch, in welchen sich die zeitgenssischen Diskussionen um
seine Bauten spiegeln, schreibt er ber die Verwendung von Kolossal-
sulen: das Vorurtheil dagegen gehrt zu den modernen Pedante-
rien.
11
Alois Hirt, der die Kolossalsulen des Museums am Lustgarten kri-
tisiert hatte, wird somit unter die Pedanten gerechnet, von denen sich
Schinkel bewut abzusetzen sucht.
12
Diese Distanzierung ist fr Schin-
kels Selbstverstndnis als Knstler signifikant, und sie entspricht auch
der Sichtweise der Forschung, welche den Bruch mit Hirts normativ-
klassizistischer Argumentation als Indiz fr die Modernitt des Archi-
tekten gewertet hat.
13
Schinkel vertrete demnach ein dynamisches
Geschichtsverstndnis, bei dem der Baukunst der Vergangenheit keine
normgebende Stellung mehr eingerumt werde. Die Bemerkungen des
Knstlers scheinen dies zu besttigen. So heit es in den Skizzen zum
Architektonischen Lehrbuch:
Historisches ist nicht das alte allein festzuhalten oder zu wiederholen, dadurch
wrde die Historie zu Grunde gehen, historisch handeln ist das welches das Neue
herbei fhrt und wodurch die Geschichte fortgesetzt wird.
14
11
Peschken: Das Architektonische Lehrbuch, S. 79.
12
Es ist wichtig, da Schinkel sich schon nach Erscheinen von Hirts Baukunst nach
den Grundstzen der Alten im Jahre 1809 beraus kritisch mit den normativ gesetz-
ten Ansichten des Archologen auseinandergesetzt hatte. Vgl. hierzu u. a. Pesch-
ken: Das Architektonische Lehrbuch, S. 2830; Forssman Erik: Karl Friedrich Schinkel,
S. 5964; Ders.: Schinkel und die Architekturtheorie, in: Susan Peik (Hrsg.):
Karl Friedrich Schinkel. Aspekte seines Werks. Stuttgart, London 2001, S. 1017, S. 11;
Haus, Andreas: Karl Friedrich Schinkel als Knstler. Annherung und Kommentar.
Mnchen, Berlin 2001, S. 5766.
13
Vgl. u. a. Peschken: Das Architektonische Lehrbuch, S. 28; Potts, Alex: Schinkels
Architectural Theory, in: Michael Snodin (Hrsg.): Karl Friedrich Schinkel. A Uni-
versal Man. New Haven, London 1991, S. 4755, S. 51; Haus: Karl Friedrich Schin-
kel als Knstler, S. 65. Vgl. aber auch die umsichtige Bewertung bei Forssman: Karl
Friedrich Schinkel, S. 15f. Zur Stilisierung Schinkels als Knstler ohne Lehrer
in Abgrenzung von Hirt vgl. Wittich, Elke Katharina: ,Muster und ,Abarten
der Architektur. Was Karl Friedrich Schinkel von Aloys Hirt lernen konnte, in:
Claudia Sedlarz (Hrsg.): Aloys Hirt. Archologe, Historiker, Kunstkenner. Hannover-
Laatzen 2004, S. 217246, insbes. S. 217219.
14
Peschken: Das Architektonische Lehrbuch, S. 71.
90 Christian Scholl
Da Schinkel bei der Fassadengestaltung des Schauspielhauses und des
Museums am Lustgarten sehr frei mit Formen der griechischen Antike um-
geht, erscheint als Besttigung dieses dynamischen Geschichtsverstnd-
nisses.
Gleichwohl darf die Rolle der griechischen Antike fr Schinkels Schaf-
fen nicht unterbewertet werden. Sie steht, wie nachfolgend gezeigt werden
soll, durchaus hinter den sthetischen und tektonischen Konfigurationen,
die der Architekt an den genannten Berliner Bauten verwirklicht hat. Eine
intensivere Auseinandersetzung mit den schriftlichen und zeichnerischen
Skizzen zu Schinkels leider nie fertig gestellten Architektonischen Lehrbuch
besttigt dies. Im sogenannten Langen Blatt, das den Kern dieses Lehr-
buchplans ausmacht, hat der Architekt eine Folge tektonischer Komposi-
tionsprinzipien in annhernd historischer Folge aufgereiht. Was er damit
bezweckte, machte er in einem dazugehrigen Text deutlich:
Nachdem im Verlauf der Zeiten fr das Wesen der Architectur durch das Bestre-
ben der wrdigsten Mnner, auf dem Wege geschichtlicher Forschung, auf dem
Wege genauester Messung architectonischer Monumente aller Zeiten, endlich
durch vielfltige Bearbeitung der einzelnen Constructionen u ganzer Werke der
Baukunst auf empirische Weise, und durch veranstaltete Sammlungen von Dar-
stellungen solcher Gegenstnde der ganze Umfang der Baukunst wie sie sich bis
auf unsere Tage herab gestaltet hat, zur bersichtlichen Anschauung vor uns aus-
gebreitet und dargelegt worden ist, drfte es vielleicht kein ganz vergebliches Be-
mhen seyn, den Versuch zu machen, in der Manigfaltigkeit der Erscheinungen
dieser vielfltig und verschiedenartig behandelten Kunst, besonders was den Styl
betrift die Gesetze festzustellen, nach welchen die Formen u die Verhltnisse die
sich im Verlaufe der Entwicklung dieser Kunst gestalteten, und auerdem jedes
nothwendig werdendes Neues in dieser Beziehung, bei den vorkommenden Auf-
gaben der Zeit eine vernunftgeme Anwendung finden knne.
15
Eine empirisch-archologische Annherung an Architektur, bei der die
Untersuchung konkreter, als vorbildlich angesehener Bauten in den
Dienst der zeitgenssischen Architektur gestellt wird, um diese mit rei-
nen Mustern zu beliefern, wird von Schinkel hier als ein verdienstvolles,
allerdings auch berholtes Vorgehen bezeichnet. Der Architekt hat sich
ein weiterreichendes Ziel gesteckt: Er will die Gesetze herausarbeiten,
nach denen sich diese Einzelbauten historisch entwickelt haben. Nicht
aufgefundene Einzelformen, sondern diese Gesetze bieten seiner Ansicht
nach Anhaltspunkte fr eine moderne, noch zu entwickelnde Architektur.
Man knnte dies als eine einlinige Fortschrittsgeschichte des archi-
tektonischen Konstruierens missverstehen, bei dem komplexere tektoni-
15
Peschken: Das Architektonische Lehrbuch, S. 54.
Normative Anschaulichkeit versus archologische Pedanterie 91
sche Formen wie der Bogen und das Gewlbe einfachere Formen wie das
gerade Geblk ein fr allemal abgelst htten. Fr Schinkel behalten je-
doch nachweislich auch die historisch lteren Konstruktionsweisen ihre
Bedeutung. Dies gilt gerade fr das Prinzip der geraden Bedeckung,
das seiner Ansicht nach von den alten Griechen zu einer Perfektion ge-
bracht worden sei, die fr alle Zeit und auch fr andere Konstruktions-
formen Mastbe setze. So heit es in Schinkels Lehrbuchtexten:
Die Masse im Steinbau hat bei den alten Sulenordnungen, gewissermaen das
Minimum erreicht, um Festigkeit zu behalten, die anschaulich wird welches hier
immer die Hauptsache bleibt u zugleich frei und schn, durch die Kunst bis auf
diesen Grad hinaus der Masse Meister zu werden. Ein weiteres Hinausgehn in
Nichtachtung der Masse giebt Styllosigkeit u auch in ein consequentes Princip
durchgefhrt immer etwas berspanntes, Fieberhaftes, lst sich aus den Gesetzen
los verliert die schne Haltung. Nimmt man also die Theile des Sulenbaues in
seiner hchsten Vollendung als letztes Maa fr Haltbarkeit der Steinmassen /
weil seine anschauliche Statik durch eine lange Praktik in einem hchst gebilde-
ten Volk sich nach und nach auf die freieste Weise gestaltet und durchaus gebildet
hat, so erhalten die hier entstandenen Verhltnisse etwas positiv Festes und geben
fr die anschauliche Statik den ersten Anknpfungspunkt worinn sich auch eine
Beziehung / auf Gewlbconstruction bequem ergeben wird.
16
Mit dem hchst gebildeten Volk, das die Sulenkonstruktion zur Voll-
endung gefhrt habe, meint Schinkel die Griechen. Seiner Auffassung
nach bildet das von diesem Volk in der Antike perfektionierte tektoni-
sche System den Anknpfungspunkt fr alle weiteren Konstruktions-
weisen. Dabei gebhre diesem System auch der Vorzug gegenber den-
jenigen tektonischen Systemen, welche die architektonische Masse noch
weiter reduziert haben, selbst wenn sie an sich vllig konsequent seien.
Dies bezieht sich auf die Gotik, deren Tektonik Schinkel zu diesem Zeit-
punkt als berspannt und fieberhaft ablehnt. Durch ihr ausgewogenes
Verhltnis von Leichtigkeit und anschaulicher Stabilitt sei die griechi-
sche Architektur der gotischen berlegen. Es ist wichtig, da Schinkel
immer wieder auf die besondere Qualitt der Anschaulichkeit rekurriert.
Tatschlich ist Anschaulichkeit das zentrale Ziel des Architektonischen
Lehrbuchs. Die Figuren, die er zeichnet, sind nmlich keineswegs als reale
tektonische Konstruktionen zur Umsetzung gedacht, sondern dienen
als Vorbilder fr eine anschauliche Gestaltung.
17
Schinkel entwirft
monolithe Konstruktionen, die fr eine direkte Realisierung berhaupt
16
Ebd., S. 55.
17
Vgl. auch Scholl, Christian: Die schne Kunst der Konstruktion. Charakterisie-
rung als Mittel der Darstellung in der Architektur Karl Friedrich Schinkels, in:
Zeitschrift fr Kunstgeschichte 68/2005, S. 7190, hier: S. 7780.
92 Christian Scholl
nicht geeignet waren, weil es fr ihre Umsetzung in Preuen gar kein
adquates Baumaterial gab. Die Funktion dieser Figuren ist es, eine Art
architektonische Grammatik zu entwerfen, die sich durch ein Hchst-
ma an Anschaulichkeit auszeichnet. So spricht er in seinem Lehrbuch
von der
Stein-Construction als Grund und Boden der Architectur als einer schnen
Kunst, weil darinnen alles was Verhltni ist klarer u einfacher heraustritt, das
jedem angeborene Gefhl fr Statik darinnen am meisten Befriedigung finden
kann, unmittelbar bei der Anschauung erricht wird.
18
Wozu diese Steinkonstruktion dient, wird aus den folgenden Stzen
deutlich:
Um das Statische ganz klar aus der Steinconstruction heraustreten zu lassen, ist es
nothwendig sich streng an den Begriff des Bauens, des Zusammen u Aufeinander-
stellens der Massen zu halten wodurch ihnen diejenigen Gren erwachsen, wel-
che geeignet sind sie gegenseitig zu halten, untersttzen und tragen ohne andere
Hlfsmittel. Bei einer Theorie der Architektur auf diesem Wege um Raum- u Mas-
sen-Verhltnisse und Raum- u Massen-Formen abzuleiten, wird daher jedes che-
misch bindende Material auer Acht gelassen werden mssen, weil dessen Krfte
nicht unmittelbar in der Anschauung des Kunstwerks dem Verhltni nach auf-
gefat werden knnen und dehalb fr die schne Kunst die nur Anschauliches
fordert nicht geeignet sind.
19
Schinkels Lehrbuchzeichnungen sollen dazu dienen, anschauliche Raum-
und Massenverhltnisse sowie Raum- und Massenformen abzuleiten,
wobei unanschauliche Bindemittel wie Mrtel auer Acht gelassen
werden. Diese Entwurfspraxis fhrt unmittelbar zur spezifischen Form
von Schinkels Schauspielhaus-Fassaden. Bei diesem Bau handelt es sich
um eine Backsteinkonstruktion, die ursprnglich nur verputzt worden
war.
20
Nicht in seiner Tektonik, wohl aber in den Proportionen und For-
men seiner Fassadenoberflche folgt das Schauspielhaus den Figuren in
Schinkels Architektonischen Lehrbuch. Auf demLangen Blatt hat der Archi-
tekt eine Konstruktion entworfen, bei der eine zweigeschossige Pfeiler-
Geblk-Stellung in eine kolossale Ordnung hineingeschachtelt ist. Sie
bildet den Ausgangspunkt fr die Fassadengestaltung beim Schauspiel-
haus. Dabei ist sie nicht direkt von antiken Vorbildern hergeleitet, stellt
aber eine Weiterentwicklung des antiken Prinzips der geraden Bedek-
kung dar.
18
Peschken: Das Architektonische Lehrbuch, S. 55.
19
Ebd.
20
Erst 1881 erhielt das Schauspielhaus eine Verkleidung aus Sandstein. Vgl. Rave:
Berlin I, S. 136.
Normative Anschaulichkeit versus archologische Pedanterie 93
Fr ein Verstndnis von Schinkels Baukunst ist diese Entwurfsmethode
von groer Bedeutung. Der Architekt bezieht von der griechischen
Antike eine abstrahierte Tektonik, die in ihren Proportionen und For-
men zum Vorbild fr die Architektur in Preuen gewhlt wird. Hier
kann sie aufgrund der verfgbaren Baumaterialien jedoch nur an der
Fassadenoberflche oder in der Raumgestaltung nachgebildet werden.
Die Bedeutung der Antike liegt primr in den sthetischen Qualitten
ihrer Architektur: Es ist die Anschaulichkeit und die Balance von Leich-
tigkeit und Tragfhigkeit, welche die Griechen Schinkel zufolge zur Per-
fektion gebracht haben. Die Vorbildnahme dieser Eigenschaften fhrt
gleichsam zu einem sthetischen Klassizismus, bei dem nicht die ge-
naue Befolgung archologischer Vorbilder der griechischen Antike, son-
dern die Form ihrer Grundtektonik magebend wird. Diese anschau-
liche Grundtektonik war fr Schinkel nicht zuletzt deshalb so wertvoll,
weil er der Anschauung des Schnen eine gesellschaftliche Wirkung zu-
schrieb, welche einer sthetischen Erziehung im Sinne Schillers ent-
spricht.
21
Das sthetische Erlebnis, das Schinkel mit seiner Architektur
zu evozieren sucht, entspricht demnach der Begegnung mit einem voll-
endeten Kunstwerk, das die gegenstzlichen Triebe des Betrachters in
einen Ausgleich zu bringen vermag. Dabei geht es Schinkel zufolge vor
allem um Ruhe. Der Architekt schreibt hierzu in seinen Lehrbuch-
skizzen:
Das Kunstwerk sondert seinen Gegenstand ganz von der brigen Welt ab, u
schliet alles brige von ihm aus, er ist vollendet seiner Natur gem. [] Immer
ist eine vollkommene Kunst: Befriedigung das ist Ruhe, Abschlu nach allen Sei-
ten nothwendig das Kunstwerk hervorzubringen. [] Das ruhigste ist der Bau der
Sule u Architrav. Der HalbkreisBogen bringt schon Beunruhigung hinein, fhrt
aber zur Ruhe zurck.
22
Von hier aus ergibt sich eine Erklrung fr Schinkels Prferenz fr
Formen, die dieser mittelbar aus dem antiken Prinzip der geraden
Bedeckung ableitet, ohne da sie sich noch berzeugend auf konkrete
archologische Vorbilder der Antike beziehen lassen. Das erklrte Ziel,
Abschlu nach allen Seiten zu schaffen, begrndet die Wahl der Ko-
lossalordnung beim Alten Museum und beim Schauspielhaus, die im
Sinne Alois Hirts verwerflich, weil ungriechisch war, die aber im Sinne
Schinkels die formale Geschlossenheit seiner Bauten gewhrleisten
21
Zur Beziehung zu Schillers Konzept der sthetischen Erziehung vgl. Scholl: Die
schne Kunst der Konstruktion, S. 8090.
22
Peschken: Das Architektonische Lehrbuch, S. 70f.
94 Christian Scholl
sollte. Auch hier geht es um die anschauliche, d. h. sthetische Wirkung.
So schreibt der Architekt neben eine Lehrbuchskizze, die das Schema
der Schauspielhaus-Fassaden zeigt:
Die Pilaster an der Ecke eines Gebudes sind mglichst stark zu halten, besonders
wenn Fllmauern zwischen den Pilastern angebracht sind. Sie mssen den Cha-
racter haben fr sich selbststndig als Thrme oder Hauptpfeiler des Hauses zu
stehn.
23
Diese Forderung entspricht seinem Postulat der optischen Ruhe und
Stabilitt eines Bauwerkes:
Es mu ein gewisses berma der Sicherheit da seyn in der Masse eines Bauwer-
kes, damit ein zu ngstliches Characterisiren der einzelnen ConstructionsTheile
nicht nthig ist, sondern alles dies mu gemigt seyn um ins Reich des Schnen
aufgenommen werden zu knnen, u um den brigen schnen Knsten einen
freieren Raum dabei zu gestatten. / damit die einzelnen Krfte nicht gengstigt
dienen, sondern mit Anmuth u Ruhe u Gemchlichkeit thtig sind. Thtigkeit ist
etwas Herrliches sie kann krftig seyn aber sie mu nicht Sclavisch seyn sie mu
keine Gengstigte [sic!].
24
Die Veranschaulichung der Stabilitt entspricht folglich einem Mensch-
heitsideal. Architektur soll demnach im wahrsten Sinne des Wortes Frei-
rume schaffen, die das Gefhl der Leichtigkeit mit dem der Sicherheit
verbinden. Aus diesem Grund befrwortete Schinkel die Verwendung
kolossaler Pfeiler und Sulen, namentlich wenn es um die Ecklsung
von Gebuden ging wie es beimSchauspielhaus und beimAlten Museum
der Fall ist.
Wie bereits angefhrt wurde, hat Schinkel das Vorurteil gegenber
der Kolossalordnung zu den modernen Pedanterien gerechnet.
25
Die
Selbststilisierung Schinkels als freier, unkanonisch zu Werke gehender
Bauknstler entspricht durchaus dem in der Forschung verbreiteten
Schinkel-Bild. Die Kehrseite dieses Bildes ist, da Schinkel seine for-
malen Destillationen der griechischen Tektonik, von denen er sich eine
beruhigende, ja sogar heilende Wirkung auf die Gesellschaft verspricht,
durchaus als normativ ansah. Verletzungen verstand er als Fehler der
Architektur. Im Architektonischen Lehrbuch hat er derartige Fehler auf-
gefhrt, die er vermieden wissen wollte. Es ist kein Zufall, da diese
Fehler nicht zuletzt das Verhltnis von Leichtigkeit und Standfestig-
keit betreffen. So rgt er in Nr. 8 seines Fehlerkatalogs, die ein Detail
von St. Paul vor den Mauern in Rom zeigt: zuviel Last ber der Bogen-
23
Ebd., S. 78.
24
Ebd., S. 71.
25
Ebd., S. 78f.
Normative Anschaulichkeit versus archologische Pedanterie 95
stellung auf Sulen oder Pfeiler
26
. Die Tragweite dieser Auflistung von
Fehlern wird deutlich, wenn man sich verdeutlicht, da Schinkel als
oberster Baubeamter in Preuen durchaus die Macht hatte, seine Vor-
stellungen durchzusetzen. Zahlreiche Entwrfe von Architektenkolle-
gen, die ihm zur Begutachtung vorlagen, hat er genutzt, um Korrekturen
anzubringen oder gar komplette Gegenentwrfe zu liefern.
27
Hier wen-
dete Schinkel seine Grundstze mit einem durchaus normativen An-
spruch an im Bewutsein, da die von ihm geforderten architektoni-
schen Qualitten geradezu den Charakter von Menschenrechten haben.
Nicht als Quelle archologischer Detailforschung, wohl aber als Vor-
bild, bei dem die normbildenden Qualitten in einer anschaulichen Tek-
tonik gefasst waren, ma Schinkel der klassischen Architektur der Grie-
chen hchste Bedeutung zu. Die von ihm entwickelte Verbindung von
historischem Denken und normativer sthetik lsst sich als ein Weg an-
sehen, wie man Winckelmanns paradoxes Postulat, ber die Nachah-
mung der Griechen unnachahmlich zu werden, in die knstlerische
Praxis bertragen konnte.
28
Im Sinne des damals verbreiteten Griechen-
bildes war die anschauliche Tektonik das Resultat einer freien Gesell-
schaft. Nun sollte sie nicht in ihrer tektonischen Struktur, sondern in
ihrer sthetischen Wirkung der eigenen Gegenwart gleichsam als visu-
elle Therapie verordnet werden. Es ist daher wichtig, zu sehen, wie
Schinkel sein bereits zitiertes Bekenntnis zu einem dynamischen Ge-
schichtsverstndnis fortsetzt:
Historisches ist nicht das alte allein festzuhalten oder zu wiederholen, dadurch
wrde die Historie zu Grunde gehen, historisch handeln ist das welches das Neue
herbei fhrt und wodurch die Geschichte fortgesetzt wird. Aber dadurch eben da
die Geschichte fortgesetzt werden [soll] ist sehr zu berlegen, welches Neue u wie
dies in den vorhandenen Kreis eintreten soll. Es gehrt hchste Bildung dazu, die
schne Kunst welche alles in Maa und Ruhe setzt, ist vielleicht ein Probirstein.
29
26
Ebd., S. 98.
27
Einen aus der Flle der Beispiele herausgegriffenen Fall bietet Schinkels Korrek-
tur des vom Dsseldorfer Baurat Adolph von Vagedes angefertigten Entwurfs fr
die evangelische Kirche in Kelzenberg im Rheinland aus dem Jahre 1825: Vgl.
Bres, Eva: Die Rheinlande (Karl Friedrich Schinkel: Lebenswerk). Mnchen, Ber-
lin 1968, S. 253259.
28
Vgl. Winckelmann, Johann Joachim: Gedancken ber die Nachahmung der Grie-
chischen Wercke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst (1. Aufl. 1755), in: Ders.:
Kleine Schriften, Vorreden, Entwrfe. Hrsg. von Walther Rehm. Berlin 1968, S. 2759.
29
Peschken: Das Architektonische Lehrbuch, S. 71. Der Begriff Probierstein stammt
aus dem Bereich der Alchemie und bezeichnet den Stein, an dem der wahre Ge-
halt des Goldes gemessen werden kann.
96 Christian Scholl
Als Probierstein sollte die Kunst wirken. Sie sollte als Experimentier-
feld fungieren, in dem man der politischen Geschichte vorausgreifen
konnte.
30
Die gestalterischen Eigenschaften, die hierfr erforderlich wa-
ren, und deren Einfhrung Schinkel zufolge hchste Bildung verlangte,
erweisen sich dabei als zentrale Kategorien eines sthetischen Klassizis-
mus: Es sind Ruhe und Ma: Von den Griechen als tektonische Prinzi-
pien zu anschaulicher Gltigkeit entwickelt, sollten sie fr die Moderne
sthetisch zurckgewonnen werden.
Literaturverzeichnis
Bothe, Rolf: Antikenrezeption in Bauten und Entwrfen Berliner Architekten zwi-
schen 1790 und 1870, in: Willmuth Arenhvel (Hrsg.): Berlin und die Antike. Ar-
chitektur, Kunstgewerbe, Malerei, Skulptur, Theater und Wissenschaft vom 16. Jahrhundert
bis heute. Ausstellungskatalog. Berlin 1979, S. 294333.
Bres, Eva: Die Rheinlande (Karl Friedrich Schinkel: Lebenswerk). Mnchen, Berlin
1968.
Forssman, Erik: Karl Friedrich Schinkel. Bauwerke und Baugedanken. Mnchen, Zrich
1981.
Forssman, Erik: Schinkel und die Architekturtheorie., in: Susan Peik (Hrsg.): Karl
Friedrich Schinkel. Aspekte seines Werks. Stuttgart, London 2001, S. 1017.
Hammer-Schenk, Harold: ,[] nicht sowohl etwas Anderes, sondern mehr Sach-
gemsseres. Zeitgenssische Kritik an Schinkels Museum in Berlin., in: Margit
Kern (Hrsg.): Geschichte und sthetik: Festschrift fr Werner Busch zum 60. Geburtstag.
Mnchen, Berlin 2004, S. 349361.
Haus, Andreas: Karl Friedrich Schinkel als Knstler. Annherung und Kommentar. Mn-
chen, Berlin 2001.
Hecker, Max (Hrsg.): Der Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter. Bern 1970 (zuerst
Frankfurt a.M. 1919).
Jaff, Hans C. L.: Schinkels Gemlde ,Blick in Griechenlands Blte ein Bildungs-
bild., in: Hannelore Grtner (Hrsg.): Schinkel-Studien. Leipzig 1984, S. 199205.
Laugier, Marc-Antoine: Das Manifest des Klassizismus. Nach dem Originaltitel: Essai
sur lArchitecture (1753). Zrich, Mnchen 1989.
Peschken, Goerd: Das Architektonische Lehrbuch (Karl Friedrich Schinkel: Lebens-
werk). Nachdruck der Ausgabe von 1979. Mnchen, Berlin 2001.
Potts, Alex: Schinkels Architectural Theory., in: Michael Snodin (Hrsg.): Karl Friedrich
Schinkel. A Universal Man. New Haven, London 1991, S. 4755.
30
Vgl. die Fortsetzung des Zitats, ebd.: Ehemals ging diese Kunst den Politisch gro-
en Ereignissen nach und war Folge davon. Es wre vielleicht, die hchste Blthe
einer neuen Handlungsweise der Welt wenn die schne Kunst voran ginge, etwa
so wie das Experiment in der Wissenschaft der Entdeckung vorher geht, und als
ein eigenthmliches Element der neuen Zeit angesehn werden kann.
Normative Anschaulichkeit versus archologische Pedanterie 97
Rave, Paul Ortwin: Berlin. Erster Teil. Bauten fr die Kunst. Kirchen / Denkmalpflege (Karl
Friedrich Schinkel: Lebenswerk). Erweiterter Nachdruck. Mnchen, Berlin 1981.
Schinkel, Karl Friedrich: Sammlung architektonischer Entwrfe. Smtliche Texte und Ta-
feln der Ausgabe Potsdam 18411845 (2., erweiterte Auflage). Alfons Uhl (Hrsg.):
Nrdlingen 2006.
Scholl, Christian: Die schne Kunst der Konstruktion. Charakterisierung als Mittel
der Darstellung in der Architektur Karl Friedrich Schinkels, in: Zeitschrift fr
Kunstgeschichte, 68/2005, S. 7190.
: Optimistischer Sentimentalismus: Karl Friedrich Schinkels ,Blick in Griechen-
lands Blte als Vision fr Spaziergnger, in: Axel Gellhaus/Christian Moser/
Helmut J. Schneider (Hrsg.): Kopflandschaften Landschaftsgnge. Kulturgeschichte
und Poetik des Spaziergangs. Kln, Weimar, Wien 2007, S. 127146.
Vogt, Adolf Max: Karl Friedrich Schinkel. Blick in Griechenlands Blte. Ein Hoffnungsbild
fr ,Spree-Athen. Frankfurt a.M. 1985.
Vogtherr, Christoph Martin: Das Knigliche Museum zu Berlin. Planungen und Konzep-
tion des ersten Berliner Kunstmuseums. Jahrbuch der Berliner Museen, 39/1997, Beiheft.
Wittich, Elke Katharina: ,Muster und ,Abarten der Architektur. Was Karl Friedrich
Schinkel von Aloys Hirt lernen konnte., in: Claudia Sedlarz (Hrsg.): Aloys Hirt.
Archologe, Historiker, Kunstkenner. Hannover-Laatzen 2004, S. 217246.
98 Christian Scholl
Griechische Spuren in Stifters Nachsommer 99
Gabriella Catalano
Griechische Spuren in Stifters Nachsommer
Spuren enthalten Gedchtnis und Vergessen zugleich. Sie sind Zeichen
von Erhaltenem und von Verlorenem, sie verbergen das schon Dage-
wesene und zeigen das noch Vorhandene.
1
So gesehen kann man die
Spuren auch mit jenen indirekten Zeichen gleichsetzen, die jeder Text in
seinem immanenten Doppelakt des Aufzeigens und des Verbergens hin-
terlsst.
Insofern kann man die Welt der Antike in Stifters Nachsommer als sol-
che Spuren betrachten: Der Vergessenheit entzogen wird sie als Projekt
einer Wiederaufnahme erkennbar, die aber die unkontrollierbaren Zei-
chen des Verschwindens in sich trgt. Der Blick auf die griechische
Kunst bedeutet hier einerseits einen Hinweis auf die Kontinuitt der
Menschheitsgeschichte, zugleich deutet er aber auch auf eine Diskonti-
nuitt hin, die erst dank der Vermittlung mittels Rekonstruktion besei-
tigt werden kann. Damit verbunden ist jene Praxis der Restaurierung, die
im 1857 von Stifter publizierten Roman literarisch produktiv wird. Sie
befasst sich mit kulturell schon vorgeformten Objekten: Das Vorgefun-
dene, das Bestehende und das Wiederherstellende erhalten im Erzhlen
ihre historisch-knstlichen Konturen.
Paradigmatisch kann die Spurenproblematik am Beispiel der Mar-
morgestalt griechischer Herkunft erlutert werden, die, wie schon fter
hervorgehoben wurde, im Mittelpunkt der Erzhlung steht und in man-
cher Hinsicht das wahre Zentrum im Leben des Jnglings Heinrich dar-
stellt.
2
Die Rede ist von der Epiphanie der Statue, deren Schnheit erst
1
Vgl. Assmann, Aleida: Texte, Spuren, Abfall. Die wechselnden Medien des kul-
turellen Gedchtnisses, in: Hartmut Bhme/Klaus R. Scherpe (Hrsg.): Literatur
und Kulturwissenschaften. Positionen, Theorien, Modelle. Reinbek bei Hamburg 1996,
S. 96111, hier: S. 106.
2
Vgl. dazu Sjgren, Christine Oertel: The marble statue as idea: collected essays on
Adalbert Stifters Der Nachsommer. Chapel Hill 1972. Roli, Maria Luisa: Il modello
della statua e losservatore pigmalionico, in: Maria Luisa Roli (Hrsg.): Adalbert
100 Gabriella Catalano
allmhlich aufgeht: Heinrich hat das Marmorbild im Hause seines Men-
tors Risach gesehen, ohne es aber wirklich wahrgenommen zu haben.
Wenn auch verzgert, wird die Inszenierung des sthetischen Augen-
blicks durch kurze Erwhnungen vorbereitet: Der Leser kennt schon
die zentrale Stelle der Statue in der Mitte des Treppenhauses, der Erzh-
ler hat bereits den Akzent auf die weie Farbe der Gestalt und auf den
unentbehrlichen Lichteffekt gesetzt und auch auf den rumlichen Kon-
text hingewiesen. Die Verdichtung dieser Elemente kennzeichnet die
epiphanische Szene im 19. Kapitel, das den Titel Die Annherung trgt:
In der Wahrnehmung kulminiert das pltzliche Sichtbarwerden der
Schnheit der Statue, die erhellende Rolle des Blitzlichts, das erstmals
den schauenden Einblick und die Beschreibung der Figur ermglicht.
3
Es wurde bisher aber kaum wahrgenommen, wie das Transitorische
dieses Augenblicks durch die nachfolgende Erzhlung umformuliert
wird, welche das expressive Moment der Wahrnehmung unter einer an-
deren Perspektive betrachtet. Das Transitorische des imaginativen Seh-
Aktes wird durch ein materielles bzw. historisches Verfahren relativiert,
das die Mehrschichtigkeit des Textes veranschaulicht. Aus der Darstel-
lung des prgnanten Erlebnisses ergibt sich eine lange argumentatio, wel-
che die Ambivalenz der ganzen Textstelle aufdeckt: Zwei verschiedene
Lesemglichkeiten des Kunstwerks greifen variierend das Thema der
Kunsterziehung auf. Die umfangreiche Nacherzhlung, in der Risach
selbst das Wort ergreift, ist als eine Folge und zugleich als eine Inversion
der epideiktischen Rede zu verstehen: Dem Lob folgt die eigentliche Be-
zeichnung und Klassifizierung des Objekts. Das genus demonstrativum,
das die Schnheit der Statue zur Schau gestellt hat, wird durch die
Stifter. Tra filologia e studi culturali. Atti del convegno di Milano 11 e 12 Novembre 1999.
Milano 2001, S. 165179. Auf die Rolle von Marmorstatuen in Stifters Werk hat
Helmut Pfotenhauer hingewiesen: Pfotenhauer, Helmut: Sprachbilder. Untersu-
chungen zur Literatur seit dem achtzehnten Jahrhundert. Wrzburg 2000, S. 161.
3
Ich blickte auf die Bildsule, und sie kam mir heute ganz anders vor. Die Md-
chengestalt stand in so schner Bildung, wie sie ein Knstler ersinnen, wie sie sich
eine Einbildungskraft vorstellen, oder wie sie ein sehr tiefes Herz ahnen kann, auf
dem niedern Sockel vor mir, welcher eher eine Stufe schien, auf die sie gestiegen
war, um herumblicken zu knnen. Ich vermochte nun nicht weiter zu gehen, und
richtete meine Augen genauer auf die Gestalt. Stifter, Adalbert: Der Nachsom-
mer, hrsg. von Wolfgang Frhwald/Walter Hettche, in: Stifter Werke und Briefe.
Historisch-Kritische Ausgabe. Hrsg. von Alfred Doppler und Wolfgang Frhwald,
Bd. 4,2: Stuttgart, Berlin, Kln 1999, S. 73. Vgl. dazu Vogl, Joseph: Der Text als
Schleier. Zu Stifters Der Nachsommer, in: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft
37/1993, S. 298312, hier: S. 304.
Griechische Spuren in Stifters Nachsommer 101
erzhlte Handlung ausgelegt, die insgesamt als eine restitutio der wahren
Gestalt des Kunstobjekts zu interpretieren ist. Die wahrgenommene
Nhe, die synthetische Pltzlichkeitsstruktur des Kunsterlebnisses wird
in der Distanz schaffenden analytischen Betrachtung aufgehoben. Die-
ser Modus der Deduktion nimmt zuerst die Form eines dialogischen
Kommentars an. Im Gesprch mit Heinrich kommt die Phnomenolo-
gie des sthetischen Erlebnisses als aufklrender Beitrag der intellektuel-
len Kultur Risachs zum Ausdruck. Die tiefempfundene Zuneigung, jene
Bewunderung, welche der Tradition des Motivs des Marmorbilds ge-
m von Brentano ber Eichendorff bis hin zu Balzac zur Inszenie-
rung der belebten Statue gelangt, wird sozusagen seziert, in seinen kon-
stitutiven Faktoren ausgelegt.
4
Ist Risach davon berzeugt, da nur das
intuitive Erlebnis die Entstehung des Kunstsinnes garantiert, da keine
Auslegung die subjektive Erfahrung des Objekts ersetzen kann, so ist
die Wahrnehmung aber in einer Erzhlhandlung eingebettet, welche die
andere Seite des Kunstgegenstands aufdeckt. Die vergangene Zeit des
Auffindens der Statue und die Entdeckung ihrer ursprnglichen Gestalt
verweisen auf verschiedene Zeitebenen und zugleich auf eine berzeit-
liche Kontinuitt, welche das genealogisch motivierte Kunstverstndnis
kennzeichnet. Diese notwendigen Voraussetzungen gelten nicht nur fr
den jungen Heinrich, dessen Existenz sich in der ganzen Erzhlung mit
den sukzessiven Aneignungsetappen verschiedener Gebiete der Natur
und der Kunst identifiziert, sondern auch fr Risach selbst, der in An-
lehnung an seine Rolle als Erzieher die Entstehung des Kunstsinns be-
reits an sich selbst experimentiert hat. Auch in seinem Leben hat die
griechische Statue eine Vermittlungsfunktion gespielt. Wenn alles, d. h.
Menschen, Dinge, Rume und sogar historische Epochen im Roman in
ein Wiederholungssystem involviert sind, so ist auch die lange Nach-
geschichte, welche Heinrichs Wahrnehmung der Statue folgt, (Stifters
Roman lsst sich als ein Werk des Nach bezeichnen), genau gesehen eine
Vorgeschichte (das Nach bezieht sich immer auch auf ein Vor): Es han-
delt sich um eine andere Wahrnehmung, die dieses Mal Risach betrifft.
Die Rck-Perspektive der Erzhlung wiederholt die Gegenwart im Zei-
chen der Vergangenheit. Die Vergangenheit betrifft aber in diesem
Falle vor allem das Wesen der Statue, ihre Materie, ihre Existenz und ihr
berleben.
4
Begemann, Christian: Der steinerne Leib der Frau. Ein Phantasma in der euro-
pischen Literatur des 18. und des 19. Jahrhunderts, in: Aurora 59/1999, S. 135159.
102 Gabriella Catalano
Risach erzhlt, da er auf die von ihm als Gipsexemplar erworbene
Marmorgestalt zufllig in einem Belustigungsort in Cuma aufmerksam
wurde, wo die Statue zum trivialen Ornament und dann zum Abfall-
objekt erniedrigt worden war.
5
Erst nachdem die Statue in sein Haus ge-
bracht worden war, hatte sie sich als ein griechisches Original entpuppt.
Die simple Fabel enthlt den Kern der Sache. Sie verweist auf die Trans-
mission des Kunstobjekts und seine Funktion als Medium der knstle-
rischen Erkenntnis. Unentbehrlich fr die Enthllung des griechischen
Originals erweist sich seine Nach- bzw. Neuschpfung. Die Wiederbele-
bung des Kunstgegenstands ist Zeichen eines historischen Bewutseins,
das von der Verfeinerung des Kunstgefhls nicht zu trennen ist. Auf bei-
den Komponenten basiert die Arbeit des Restaurators. Die sthetische
Wahrnehmung ist nicht mehr zu trennen von der Materie des Kunst-
werks, Natur und Kultur experimentieren neue Vermittlungsformen.
6
Die Entdeckung des Marmororiginals unter der Gipsstatue darauf
kommt es im nachfolgenden Bericht an ist das Ergebnis eines komple-
xen Verfahrens, das die Entstehung des historisch-sthetischen Bewut-
seins zur Folge hat. Die Erzhlung Risachs lsst einen ganzen Zyklus
Revue passieren: von der Restaurierung bis zur Ausstellung. Dieser Pro-
duktionsablauf kommt einem Sehverfahren gleich, das kulturell mar-
kiert ist. Risach hatte eine Gestalt aus Gips erworben, die dem Kunstge-
schmack der vorhergehenden Epoche entsprach. Es handelt sich um
einen Stoff, der bekanntlich das klassizistische Kunstbild geprgt hat, da
schon im 18. Jahrhundert die Verbreitung der antiken Welt in ganz Eu-
ropa auf Gipskopien angewiesen war.
7
Stifters Urteil ber dieses Material
5
Maria Fancelli vermutet, da der Hinweis auf die kleine Stadt bei Neapel auf
Winckelmanns Geschichte der Kunst des Altertums zurckgreift: Fancelli, Maria:
Winckelmann und Stifter: eine mgliche Beziehung, in: Stephanie-Gerrit Bruer
(Hrsg.): Altertumskunde im 18. Jahrhundert. Wechselwirkungen zwischen Italien und
Deutschland. Stendal 2000, S. 133143, hier: S. 138. Krzystof Pomian hat das
Thema der Umwandlung der Funktionslosigkeit von gewissen Abfallprodukten
in Zeichen von Symbolcharakter und der damit zusammenhngenden Entste-
hung vom kulturellen Erbe behandelt: Pomian, Krzystof: Museum und kulturel-
les Erbe, in: Gottfried Korff/Martin Roth (Hrsg.): Das historische Museum. Labor,
Schaubhne, Identittsfabrik. Frankfurt a.M., New York 1990, S. 4164.
6
Vgl. Conti, Alessandro: Storia del restauro e delle opere darte. Milano 2002.
7
S. hierzu: Kockel, Valenin: ,Dhieweilen wier die Antiquen nicht haben kon-
nen Abgsse, Nachbildungen und Verkleinerungen antiker Kunst und Archi-
tektur im 18. und 19. Jahrhundert, in: Dietrich Boschung/Henner von Hesberg
(Hrsg.): Antikensammlungen des europischen Adels im 18. Jahrhundert als Ausdruck
einer europischen Identitt. Internationales Kolloquium in Dsseldorf vom 7.2. 10. 2.
Griechische Spuren in Stifters Nachsommer 103
nimmt aber dessen Trivialisierung vorweg: Nach fast einem Jahrhundert
kommen in Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften die [] sym-
metrisch einander gegenberstehenden Gipsbste im Arbeitszimmer
des Vaters Ulrichs lediglich als Zeichen eines pedantischen Geistes vor.
8
Ganz anders verhielt es sich noch im 18. Jahrhudert, damals waren Gips-
kopien hchst begehrt: Sie wurden nicht nur in der didaktischen Praxis
benutzt, sondern auch als knstliche Wiederbelebung und Ersatzfor-
men verlorener Originalien verstanden. Die Verbreitung eines Marktes
von reproduzierten Stcken, die besonders in der Goethezeit blhte,
kam dem Kunstgeschmack des neuen Milieus der Kunstliebhaber, Dilet-
tanten, Kunstkritiker und Sammler entgegen, obwohl die Anfertigung
der Gipsabdrucke nicht ohne Gefahr fr die Originalien verlief. Trotz-
dem galten die Gipsabdrucke als unentbehrliche Stutzstcke fr die
Prioritt des Kunstgegenstands. Die zum Studium angelegten Kopien
dienten der Vergewisserung der antiken Welt, und nicht zuletzt fingier-
ten sie ihre verlorengegangene Realitt: das Schauspiel der Gipssamm-
lungen mit ihrer charakteristischen Anhufung von Standbildern trug
zur Wiederbelebung der verlorengegangenen Welt bei.
9
An die Stelle der
existentiellen Vergewisserung der Objekte ist die Geschichte der Origi-
nale getreten. In dieser Hinsicht wird ihre materielle Beschaffenheit un-
tersucht, die dann andere Zeitkategorien involviert: Die komplexe
Struktur des Gedchtnisses und die zuknftige Perspektive der Konser-
vierung werden zusammengedacht. Risachs Erzhlung stellt insofern die
historische Ordnung wieder her. Das Original zeigt sich, indem man auf
den Ursprung zurckgeht.
In Stifters Erzhlung hat der Gips seine sthetische Rolle verloren, er
wird als betrogene Hlle weggeworfen und auf seine rein stoffliche Iden-
titt zurckgeworfen: Die Gipsstatue hat lediglich die Funktion, den
1996. Mainz 2000, S. 3148; Cain, Hans-Ulrich: Gipsabgsse. Zur Geschichte
ihrer Wertschtzung, in: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums und Berichte
aus dem Forschungsinstitut fr Realienkunde, 1995, S. 200215.
8
Musil, Robert: Der Mann ohne Eigenschaften, Bd. 1. Reinbek bei Hamburg 1978,
S. 686.
9
Vgl. hierzu neben den o.g. Titeln Bauer, Johannes: Gipsabgusssammlungen an
deutschsprachigen Universitten. Eine Skizze ihrer Geschichte und Bedeutung,
in: Jahrbuch fr Universittsgeschichte 5/2002, S. 117132, sowie Borbein, Adolf H.:
Zur Geschichte der Wertschtzung und Verwendung von Gipsabgssen antiker
Skulpturen (insbesondere in Deutschland und in Berlin), in: Henry Lavagne/
Franois Queyrel (Hrsg.): Les Moulages de sculptures antiques et lhistoire de larcheolo-
gie, Actes du colloque international Paris, 24 octobre 1997, Hautes tudes du
monde grco-romain 29. Genve 2000, S. 2943.
104 Gabriella Catalano
inneren Kern der ursprnglichen Gestalt am besten zu bewahren. Es ver-
steht sich, da es in diesem Falle um keinen Abdruck, sondern um eine
vollkommene Verheimlichung des Originals ging, auf dessen Tilgung
und Flschung gezielt wurde, vermutlich verursacht durch die Notwen-
digkeit, wie Risach behauptet, unter kriegerischen Umstnden die Sta-
tue vor feindlichen Hnden zu schtzen. Die eher unwahrscheinliche
Geschichte suggeriert aber eine Analogie mit dem Begriff der Entrestau-
rierungen. Im 19. Jahrhundert nimmt die Wiedergutmachung alter
Restaurierungen den Hauptteil der praktischen Arbeit ein.
10
Hatte der
Klassizismus zum ersten Mal die Frage aufgeworfen, ob man berhaupt
ergnzen sollte oder nicht, kreist jetzt die Diskussion um die Art und
Weise der Fehlstellenergnzungen, um die Anerkennung des Originals,
das als Dokument betrachtet wird. Puristische Vorstellungen, die hierbei
bekundet werden, beabsichtigen, eine utopische Urzeit des Werks in
Wirklichkeit umzusetzen.
Stifter, der Kunstreferent fr das Linzer Museum Carolinum und ab
1853 als Konservator von Obersterreich ttig war, hat sich auch fr die
Praxis der Restaurierung interessiert.
11
Sein ber das Thema der Restaurie-
rung verfasster Aufsatz ber den geschnitzten Hochaltar in der Kirche zu Ke-
fermarkt zeigt schon im Aufbau, da jeder Vorschlag zur Konservierung
auf einem analytischen Kunsturteil beruht: Die historisch-stilistische
Interpretation des Werks bildet die unausweichliche Voraussetzung des
Restaurierungsgedankens. Jeder Eingriff soll von der Beschaffenheit
der Kunstgestalt ausgehen. Bezeichnend ist auch Stifters Wortschatz. Der
mittelalterliche Altar wird an klassizistischen Kategorien gemessen: Typi-
sche Begriffe und Ausdrcke Winckelmanns (Einfachheit des Gesamt-
eindrucks und Reichtum der Einzelheiten, Schlichtheit und Ergebenheit
bis hin zu Einfalt und Grsse des Kunstwerks) treten in den Vordergrund.
Erinnerung und Dauer bestimmen die Frage nach der Verwendung von
Kunststoffen und nach der Wiederherstellung des ursprnglichen Sinnes.
In Stifters Roman werden zwei Dinge neu gedacht: die Entstellung
der Zeit und die fr die Zukunft verheiende Stabilitt des restaurierten
Werks. Als leitendes Modell gilt die Griechenzeit, die als Konstrastfolie
10
Althofer, Heinz: Restaurierung im 19. Jahrhundert, in: Giuseppina Perusi
(Hrsg.): Il restauro dei dipinti nel secondo Ottocento: Giuseppe Uberto Valentinis e il me-
todo Pettenkofer. Udine 2002, S. 1528.
11
Vgl. Jungmair, Otto: Adalbert Stifter als Denkmalpfleger. Linz 1973. Lipp, Wilfried:
Adalbert Stifter als ,Conservator (18531865). Realitt und Literatur, in: Hart-
mut Laufhtte/Karl Mseneder (Hrsg.): Adalbert Stifter. Dichter und Maler, Denk-
malpfleger und Schulmann. Tbingen 1996, S. 185203.
Griechische Spuren in Stifters Nachsommer 105
fr die Gegenwart erscheint; sie wird als Welt der Kunst schlechthin ver-
standen. Stellt das Mittelalter das ethisch-politische Ideal einer nationa-
len Kunst dar, so wird den griechischen Antiken eine universale Funk-
tion zugeschrieben. Darauf wird schon in den ersten Seiten des Romans
hingewiesen: Die Sammlung der geschnittenen Steine (noch ein Hin-
weis auf Winckelmann) von Heinrichs Vater stammen aus dem kunst-
gebtesten Volke alter Zeiten, nehmlich aus dem alten Griechenlande
her
12
. Die am Anfang des Romans behauptete Prioritt der griechischen
Kunst gibt im Bild der Antike den Ton an. Ausschlielich das alte Grie-
chenland, das zur Vergangenheit gehrt, garantiert das berleben des
sthetischen Diskurses. Das moderne Griechenland, obwohl Stifter die
Werke Byrons kannte und dessen Gedicht Finsternis in seiner Schrift
ber die Sonnenfinsternis zitierte, findet gar kein Echo im Roman.
13
Vielmehr hat Stifter im Nachsommer die antike Welt der Griechen als ein
scheinbar zeitenthobenes Vorbild vor Augen. Trotzdem bezeugt das In-
teresse an Byron, da die gemeinte Zeitentrckung auch Brche kennt.
Um Altertum und Vergangenheit, Griechenland und Mittelalter, wie-
der aktuell zu machen, widmet man sich in Risachs musealem Wohnsitz
Asperhof einer paradigmatischen Restaurierungskunst. Man restauriert
altertmliche Mbel, Gerte und Artefakte jeder Art, man versucht ver-
schollene Teile wiederherzustellen, man neigt dazu, die Fehlstellen zu
integrieren, die die Anschauung des Werks stren.
14
Chemie und natur-
wissenschaftliche Methoden werden verwendet, Spiegel und Vergr-
erungsglser herangezogen, um die optische Untersuchung zu gewhr-
leisten. In der Werkstatt entstehen vergangene Epochen: mit ihrem
ideellen und materiellen Bild wird, wie ausdrcklich formuliert wird, ex-
perimentiert:
Wir suchten selbstndige Gegenstnde fr die jezige Zeit zu verfertigen mit Spu-
ren des Lernens an vergangenen Zeiten. Haben ja selbst unser Vorfahrer aus un-
seren Vorfahrern geschpft, diese wieder aus den ihrigen, und so fort, bis man auf
unbedeutende und kindische Anfnge stt.
15
12
Stifter: Der Nachsommer, S. 11.
13
Lachinger, Johann: Schreiben gegen den ,Weltschmerz. Adalbert Stifter im Ho-
rizont von Byronismus und Skeptizismus, in: Jahrbuch des Adalbert Stifter Institutes
3/1996, S. 1727.
14
Zur Ttigkeit der Restaurierung in Stifters Roman siehe Schlaffer, Hannelore/
Schlaffer, Heinz (Hrsg.): Studien zum sthetischen Historismus. Frankfurt a.M. 1975,
S. 114119. Borchmeyer, Dieter: Stifters Nachsommer Eine restaurative Uto-
pie?, in: Poetica 12/1980, S. 7677.
15
Stifter: Der Nachsommer, S. 99.
106 Gabriella Catalano
Diese Methode wird auch bei der Entdeckung der Statue angewendet,
die sich in einem komplexen Verfahren konkretisiert. Hier ist die nahe-
zu protokollartige Beschreibung der Restaurierung als ein erzhltechni-
sches Arrangement zu verstehen, das vor allem die Notwendigkeit der
Beobachtung und der Bezeichnung betont. Alles muss genannt und de-
finiert werden, um die Diskontinuitt zu beseitigen, die gerade damit
zum Ausdruck kommt. Die verschiedenen Phasen der Offenlegung
bedeuten eine empirische Verfahrensweise, welche die Sinnenwelt in
Anspruch nimmt. Whrend der mit aller Vorsicht durchgefhrten und
detailliert beschriebenen Reinigung stt man auf eine unerwartete Un-
terschicht: Der Klang der Materie lsst den Restaurator Eustach ver-
muten, da es sich um Marmor handelt: Er sei auf dem Schulterblatte
mit dem feinen Messer auf einen Stoff gestoen, der nicht das Taube
des Gipses habe, sondern das Messer gleiten mache, und etwas wie die
Ahnung eines Klanges merken lasse.
16
Dem Toneindruck
17
folgt die op-
tische Besttigung: Das Auge sagte, es sei Marmor. In ihrer Schlicht-
heit macht die Aussage ber die Sehkraft deutlich, da nun die Erkennt-
nis des Originals vollendet ist. Der Tastsinn, der in Herders Plastik die
Auslegung der Bildhauerkunst prgt, spielt keine Rolle mehr.
18
An die
Stelle des Tastsinnes tritt nun der Gehrsinn, der einerseits die sinnliche
Komponente zurckbekommt und andererseits auf die handwerkliche
Anfertigung des Werks und auf dessen materielle Identitt zurckgreift:
Schlielich kann der Bildhauer bei der Auswahl des Werkstcks im
Steinbruch anhand des Tons des Marmors Risse und Spalten erkennen.
19
Der Gipsabguss, der als Spur des Originals verstanden wird und
als Garantie fr sein zuknftiges Leben gilt, hat zwischen einer zum Ver-
gessen verurteilten Vergangenheit und ihrer Wiedergewinnung fr die
Gegenwart vermittelt. Andererseits greift die Gipskopie, die eigentlich
als eine Flschung betrachtet werden kann, auf das Original zurck, sie
16
Stifter: Der Nachsommer, S. 80.
17
Ich lie das Messer auf dieser Stelle gleiten, ich lie es an ihr erklingen, und auch
ich hatte das Gefhl, da es Marmor sei, was ich eben behandle. (Ebd.).
18
In der theoretischen Rezeption der Bildhauerkunst hatte Herders 1778 publizier-
ter Aufsatz eine Wende markiert: Die sinnliche Wahrnehmung des Tastsinns cha-
rakterisiert die Bildhauerkunst und unterscheidet sie von der Malerei, die nur
vom Sehen bestimmt wird. Herder, Johann Gottfried: Schriften zur sthetik und
Literatur 17671781, in: Werke, Bd. 2. Gunter E. Grimm (Hrsg.): Frankfurt a.M.
1993.
19
Fr diesen Hinweis bin ich Dr. Kristina Hermann Fiore vom Museo Borghese-
Rom dankbar.
Griechische Spuren in Stifters Nachsommer 107
trgt in sich die Spur desselben, die auch Risach von Anfang an beein-
druckt hatte. Die Doppelgnger-Erscheinigung, die auf diese Weise
zum Ausdruck gebracht wird, verweist auf die Historizitt des Prozesses
der Entstehung und der Rezeption jedes Kunstwerks. Die Gegenber-
stellung von Original und Replik frdert die synthetische Kunst des Ver-
gleichs, den Risach zu ben gelernt hat, und der unentbehrliches Ele-
ment seiner Kunstauffassung geworden ist. Nur durch den Vergleich mit
anderen von ihm gesehenen Werken ist er imstande, das Original als
eine griechische Plastik zu erkennen.
Das Regenerierungsverfahren bringt ein unbekanntes Werk aus alten
Zeiten ans Licht. Es zeigt aber auch, da jedes Kunstwerk wie auch jedes
Naturphnomen oder auch Handlungen von Menschen aus Zeitschich-
ten bestehen. Schon am Anfang des Romans widmet sich Heinrich mit
groer Zuneigung dem Studium der Erdoberflche, die ihm die schich-
tenartige Struktur der Erde aufzeigt. Was nun durch die zeitbedingte
Restaurierungsarbeit an die Oberflche kommt, ist eine nach einer
Formulierung von Cesare Brandi zweite Historizitt, die mit der Er-
kenntnis darber, was Kunst ist, zusammenhngt. Es handelt sich um
die methodologische Anerkennung einer sthetischen und historischen
Polaritt, die dem Kunstwerk innewohnt.
20
Aus dem Verlauf der Restau-
rierung ergibt sich, da die Materie der Epiphanie des Bildes notwendig
ist. Nicht zufllig ist Heinrich auf die Schnheit des Marmors schon auf-
merksam geworden, und der ganze Marmorsaal, wo die Statue steht,
stellt die sthetische Qualitt dieses Materials und dessen Farbeindruck
zur Schau. In der Architektur des Rosenhauses spielt die Glasdecke des
Marmorsaals eine nicht zu unterschtzende Rolle. Fast zu gleicher Zeit
von Stifters Nachsommer wird 1851 das Crystal Palace von Paxton in der
Londoner Ausstellung als Sinnbild der modernen Architektur gezeigt,
welche der Ideologie der Transparenz und des Ausstellens entgegen-
kommt; von nun an wird die Glasarchitektur zum Symbol einer nach
auen gerichteten Welt.
21
Die Aufhebung der Trennung von Licht und
Natur tritt auch bei der Glasdecke in Risachs Residenz in den Vorder-
grund: Die vom ausgebrochenen Gewitter bestimmte Lichtperspektive
ist ein entscheidender Faktor der Offenbarung der Statuenfigur, die
auf dem Effekt des Blitzlichts basiert. Das Ideale und das Sinnliche
der Wahrnehmung pldieren fr ein Ineinandergreifen von Innen und
20
Brandi, Cesare: Theorie der Restaurierung. Mnchen 2006.
21
Vgl. Hamon, Philippe: Expositions. Littrature et architecture au XIXme sicle. Paris
1989.
108 Gabriella Catalano
Auenwelt. Durch die Glasdecke wird der ganze Raum von oben er-
leuchtet nach einem Muster, das schon in der ersten Hlfte des XIX. Ja-
hunderts in der Museumsarchitektur verwendet worden war: Sie er-
laubte eine gleichmssige zenitale Beleuchtung, welche die Lesbarkeit
der Werke ermglichte. Auch Schinkel hatte in seinem Projekt fr das
knigliche Museum in Berlin an eine solche Glasbedachung gedacht.
22
Die Glasdecke des Marmorsaals drckt nicht zuletzt Stifters Anlehnung
an ein museales Vorbild aus: Eine griechische Statue kann, wie Heinrich
gleich versteht, erst in einem musealisierten Kontext rezipiert werden:
Mir dnkte es gut, da man die Gestalt nicht in ein Zimmer gestellt hatte, in wel-
chem Fenster sind, durch die alltgliche Gegenstnde herein schauen, und durch
die verworrene Lichter einstrmen, sondern da man sie in einen Raum getan
hat, der ihr allein gehrt, der sein Licht von oben bekmmt, und sie mit einer
dmmerigen Helle wie mit einem Tempel umfngt.
23
Vom Alltag fern und der religisen Ritualitt der Kunst nah stellt der
museale Raum vor allem das Einmalige des schnen Originals aus:
Die kulturelle Wertsetzung ist nicht mehr von der Kunstinszenierung zu
trennen, da der Kontext zum Identifikationsraum geworden ist. Schon
Risach hatte darauf hingewiesen: im Hause gibt es Rume, die []
nicht zum Bewohnen, sondern nur zum Besehen bestimmt sind. Die
Schwelle zum musealen Interieur ist durch ein eigenes Verhalten, das
Anziehen von Filzschuhen, markiert.
Die Gipsentfernung in Stifters Nachsommer bedeutet mitten im XIX.
Jahrhundert ein neues Ideal der griechischen Kunst. Das Marmorwerk
macht die Frage nach der restitutio einer vergangenen Epoche aktuell, die
nicht separat vom Verstndnisprozess des Beobachters hervortritt. Sei-
ner Maskierung und Demaskierung entspricht die anfngliche Entwer-
tung als Abfall und die Neubewertung als Kunstwerk. Nur scheinbar
handelt es sich aber um eine lineare Entwicklung. Vielmehr geht man
den Spuren eines Gedchtnisses nach, das unvermeidliche Lcken auf-
weist. Stifters systematischer Versuch im ganzen Roman, diese Lcken
zu schlieen, ist dafr ein Zeichen. Schon die Ritualitt der Erzhlung,
welche in der Wiederholung den Perspektivenwechsel thematisiert, gilt
als eine Rckgabe dessen, was verloren gegangen ist. Die umfassende
Betrachtung und die detaillierte Beschreibung regenerieren den Sinn der
ursprnglichen Gestalt und offenbaren sich gleichzeitig als notwendige
22
von Wolzogen, Alfred (Hrsg.): Aus Schinkels Nachlass, Nachdruck der Ausgabe
von 1862. Mnchen 1981, S. 231.
23
Stifter: Der Nachsommer, S. 7475.
Griechische Spuren in Stifters Nachsommer 109
mediale Instanz. Verbindet das Werk, das zutage tritt, Materie und Ideal,
Kunst und Natur im Begriff eines Kunstorganismus goethescher Her-
kunft, so wird es auch entmaterialisiert, bleibt jedoch gleichzeitig in
seiner stofflichen Immanenz stndig gegenwrtig.
24
Die ikonische Vor-
richtung der Statue veranschaulicht die zugrundelegende Genealogie.
Sie ist rein und unversehrt bertragen worden, um das Primat der altgrie-
chischen Plastik und ihrer Rezeption zu ratifizieren, um zu zeigen, da
Plastik eine intakte Einheit des restituierten Leibes versinnbildlicht.
25
Gerade im Ungebrochensein des Marmorstcks liegt seine neue ab-
strakte Dimension: Es ist zum Simulacrum geworden.
Im Zusammenhang mit dieser abstrahierenden Neubelebung der
Antike steht die weie Farbe der Statue, denn gerade die versptete Ent-
hllung hebt deren Reinheit hervor:
Durch den Gips war der Marmor vor den Unbilden folgender Zeiten geschzt
worden, da er nicht das trbe Wasser der Erde oder sonstige Unreinigkeiten
einsaugen mute, und er war reiner, als ich je Marmor aus der alten Zeit gesehen
habe, ja er war wei, als sei die Gestalt vor nicht so langer Zeit erst gemacht
worden.
26
In einer Zeit, in der die Polychromiefrage schon lngst gestellt worden
war, beharrt Stifter auf der weien Qualitt des griechischen Originals.
27
Das Weie stimmt mit einem Bild der Antike berein, das, wie Hegel
in seiner Philosophie der Weltgeschichte sagt, eine konkrete Abstraktion
bildet. Der griechische Knstler ist nach Hegels Auffassung der plasti-
sche Knstler. Er schafft einen Kunstgegenstand, der die Natrlichkeit
der Materie mit dem Geist verbindet: Der Stein bleibt nicht Stein;
jenes Bild ist keine uerliche Form, die nicht blo verschwunden ist,
24
Die Frage nach den Materialien lsst sich insofern als eine Kernfrage des Romans
betrachten.
25
Pfotenhauer, Helmut: Vorbilder. Antike Kunst, klassizistische Kunstliteratur
und Weimarer Klassik, in: Wilhelm Vokamp (Hrsg.): Klassik im Vergleich. Stutt-
gart 1993, S. 4261, hier: S. 50.
26
Stifter: Der Nachsommer, S. 82.
27
Oesterle, Gnter: Gottfried Semper: Destruktion und Reaktualisierung des Klas-
sizismus, in: Sigrid Weigel/Thomas Koebner (Hrsg.): Nachmrz. Der Ursprung
des sthetischen Moderne in einer nachrevolutionren Konstellation. Opladen 1996,
S. 8889. Prater, Andreas: Streit um Farbe. Die Wiederentdeckung der Polychro-
mie in der griechischen Architektur und Plastik im 18. und 19. Jahrhundert,
in: Vinzenz Brinkmann/Raimund Wnsche (Hrsg.): Bunte Gtter. Eine Ausstel-
lung der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek Mnchen. Mnchen 2004,
S. 257272.
110 Gabriella Catalano
sondern das Entgegengesetzte. Es ist gegen die Natur des Steins, zum
Ausdruck des Geistigen gemacht zu werden, und so ist er umgebildet;
das Natrliche bleibt nicht als Natrliches.
28
Wei als Farbe der Abstraktion schlechthin bedeutet fr Stifter die
Aufhebung der Orientierungspunkte, wie die Kinder in Bergkristall
im Schneesturm bereits erfahren haben.
29
Der puristische Hintergrund,
der hinter der Hervorhebung der weien Gestalt im Nachsommer steht,
ist jedoch nicht einfach mit der Aufhebung der geschichtlichen Entwick-
lung gleichzusetzen. Vielmehr bezieht sich hier die Farblosigkeit auf
den Versuch einer poetischen Integration. Stifters Idealismus entspricht
einer globalen Aufnahme des Kunstobjekts als Form und Idee, Gestalt
und Oberflche.
Es versteht sich von selbst, da die Operation der Gipsentfernung
eine Demontage des Kunststcks mit sich bringt. Sie folgt, wie schon
erwhnt, der epiphanischen Szene, die mit einer Vielfalt von Bedeutun-
gen beladen ist. Heinrichs Einweihung in die Kunstwelt wird als Pr-
figuration der Liebe fr Natalie vorgestellt, sie wird spter mit einer
Gemmengestalt der vterlichen Sammlung verglichen. Eine moderne
Nachahmung der Statue ist auch die Brunnennymphe im Garten des
Sternenhofs, bei der die Liebe zwischen den Jugendlichen zum Aus-
druck kommt. Gerhard Neumann hat den Nachsommer als Roman ber
die kulturbildende Kraft des Dj-vu bezeichnet, das gilt auch fr die
Marmorstatue, die nicht nur in einer Roman- sowie in einer Kunstgestalt
wiederzuerkennen ist, sondern als Resultat eines schon gesehenen
Objekts erscheint. Die Gipskopie wiederholt bis ins Detail die uere
Form, die Marmorstatue verrt als ikonischer Prototyp der griechischen
Antike ihre nachtrgliche Funktion.
30
Das Neben- und Gegeneinander unterschiedlicher Formen von
Dauer und Kontinuitt findet im Roman des Nachsommers ohne einen
vorhergehenden Sommer seinen Ausdruck. Stifters griechisches Ideal
28
Hegel, Georg Friedrich Wilhelm: Philosophie der Geschichte, in: Smtliche
Werke, Bd. IX. Georg Lasson (Hrsg.): Leipzig 1923, S. 571.
29
Es wurde von dem Scheine der Sterne auch lichter um die Kinder; aber sie sahen
kein Thal keine Gegend, sondern berall nur Wei, lauter Wei. Stifter, Adal-
bert: Bergkristall, hrsg. von Wolfgang Frhwald/Walter Hettche, in: Stifter
Werke und Briefe. Historisch-Kritische Ausgabe. Alfred Doppler/Wolfgang Frhwald
(Hrsg.), Bd. 2,2: Stuttgart, Berlin, Kln 1999, S. 225.
30
Neumann, Gerhard: Archologie der Passion. Zum Liebeskonzept in Stifters
Nachsommer, in: Michael Minden (Hrsg.): History, Text, Value. Essays on Adalbert
Stifter. Londoner Symposium. Linz 2006, S. 6993.
Griechische Spuren in Stifters Nachsommer 111
klingt auch hier an.
31
In den Jahren der Romanniederschrift veranschau-
licht der Briefwechsel mit dem Freund und Verleger Heckenast die hu-
fige Verwendung von klassischen Begriffen Winckelmannscher Prgung:
Einfach und edel, ruhig und abgerundet soll sein neues Werk sein. Die
Statue steht im Zentrum einer Romanstruktur, deren geglttete span-
nungslose Oberflche jede Wende sowie jeden Konflikt beseitigt. Stif-
ters Streben nach Klassizitt und Abrundung entspricht der Absicht, ein
episches Werk der Modernitt zu verfassen.
Nach dem Plan seines Autors muss sich die Harmonie dieses hand-
lungsarmen Romans vor allem auf den Zusammenhang zwischen den
Teilen und dem Ganzen sttzen. Die isolierten Weltbereiche, die Hein-
rich allmhlich erfhrt, entsprechen dem Prinzip der Sammlung, das die
einzelnen Teile und das zusammengesetzte Ganze in sich birgt. Dieses
Prinzip bezeichnet auch die Ttigkeit des Schreibens. Schon am Anfang
hatte Heinrich die Freude daran entdeckt. Die Niederschrift seiner Na-
tur- oder Kunstbeobachtungen charakterisieren seinen Bildungsgang,
der Erinnerung und Wiederholung miteinander verknpft. Im Laufe der
Erzhlung zeigt sich die Schrift als ein unentbehrliches Vermittlungsin-
strument zur Lesbarkeit der Welt.
32
Heinrichs Beschreibungen der
Sammlungsobjekte, die sich im vterlichen Haus befinden, drcken die
berzeugung aus, da die Zeichen der Schrift den Objekten eine neue
Prsenz garantieren. Diese besteht aus gesammelten Zeichen, die wie-
derum wie bei jeder Sammlung Zeitschichten darlegen. Die Hand-
lungen des Schreibens, des Zeichnens und des Malens verweisen aber
vor allem auf ihre Zeichenhaftigkeit: Sie sind mit dem Versuch verbun-
den, Form und Substanz der Weltordnung noch einmal aufzunehmen,
zu bezeichnen und zu interpretieren.
33
Das Vertrautsein mit den Gegenstnden ist lediglich unter den Bedin-
gungen der Denkordnung eines Katalogs mglich, der die einzelnen Ob-
jekte zusammenfasst, und ihnen eine einheitliche Identitt verleiht. Das
31
Zum Zeitbegriff vgl. Assmann, Aleida: Zeit und Tradition: kulturelle Strategien der
Dauer. Kln, Weimar, Wien 1999, S. 13. Koselleck, Reinhart: Zeitschichten. Studien
zur Historik. Frankfurt a.M. 2000.
32
Zum Thema der Schrift im Werk Stifters vgl. Keller, Thomas: Die Schrift in Stifters
Nachsommer. Kln, Wien 1982. Koschorke, Albrecht: Das buchstabierte Pan-
orama: Zu einer Passage in Stifters Erzhlung Granit, in: Adalbert-Stifter-Institut
des Landes Obersterreich 38/1989, S. 315.
33
Vgl. Begemann, Christian: Die Welt der Zeichen. Stifter-Lekturen. Stuttgart 1995.
Stiegler, Bernd: Philologie des Auges. Die photographische Entdeckung der Welt im
19. Jahrhundert. Mnchen 2001, S. 352353.
112 Gabriella Catalano
Inventar, das sich in der Anhufung der kommalosen Substantive aus-
drckt, wird als eine Ausdrucksform der Sammlung und als deren herme-
neutischer Sprachgestus dargestellt. Sammeln ist mit einer Gedankenfigur
gleichzusetzen, die den ganzen Text stilistisch und thematisch charakteri-
siert. Zugespitzt gesagt: Der Nachsommer ist ein Haus-Museum in Text-
form. Alles kommt auf den Akt der Sammlung an, der sich Heinrichs Va-
ter und Risach widmen und auf deren Ausstellung. Heinrich selbst wird
in seinem Bildungsgang als Vertreter eines Sammlungsprinzips verstan-
den. Diese Vorherrschaft des Sammelns und der Musealisierung ent-
spricht der Vergegenstndlichung der Romanfiguren, die ihr Wesen auf
die Rume und die in ihnen befindlichen Sammelobjekte projizieren.
Ist Sammeln ein erzhlerisches System, das in jedem Teil das Ganze er-
kennt, so gehrt die Entdeckung der Satue zu einem solchen System:
Daraus ergibt sich eine Poesie der Zusammenstellungen, die das Fragmen-
tarische in sich birgt. Jede Phase wird beschrieben, von der Entstehung bis
zur Rezeption, vom Verschwinden bis zu ihrer Neuschpfung. Jeder Teil
der Statue wird betrachtet und das Ganze in der musealen Einrichtung
neu formuliert. Der Raum der Ausstellung stellt ein weiteres Mal den
Sinn des Ganzen in den Vordergrund: Auf einem Sockel auf der Marmor-
treppe unter der Glasbedachung gestellt, findet die Marmorstatue in der
musealen Inszenierung eines Erinnerungs-Ortes ihre neue Wirkung.
Die Pltzlichkeit der Epiphanie bedeutet eine Rezeptionsform, die
Teil und Ganzes verbindet. Aus der Dialektik der Marmorstatue resul-
tiert die schichtenartige Identitt des Kunstwerks. Deshalb kann man
die ganze Episode der Marmorstatue als eine mise en abyme des Romans
betrachten. Die uerliche Gestalt ist ein Hinweis auf seine Tiefe und
nicht zuletzt auf eine verborgene Wahrheit. Die beiden Zeiterlebnisse,
die epiphanische und die graduelle Erfahrung der Entdeckung stellen
Zeitschichten dar, die nach einer Integration suchen. Das Erlebnis
der Statue veranlasst Heinrichs Homer-Lektre. Er denkt an Nausikaa
und an ihre Abschiedsszene. Das Sehen ist mit dem Lesen verbunden,
und die griechische Welt erweist sich als ein Vorbild der Vermittlung
zwischen den Lebenssphren und der Totalitt. Lesen und Schreiben,
Sehen und Erzhlen lassen Spuren der Vergangenheit durchblicken. Be-
zeichnend ist dabei eine Szene, in der Nataliens Mutter Mathilde ihrem
Sohn eine Ausgabe der Werke Goethes schenkt:
Wenn du in den Bchern liesest, so liesest du das Herz des Dichters und das Herz
deiner Mutter, welches, wenn es auch an Werthe tief unter dem des Dichters steht,
fr dich den unvergleichlichen Vorzug hat, da es dein Mutterherz ist. Wenn ich
an Stellen lesen werde, die ich unterstrichen habe, werde ich denken, hier erinnert
Griechische Spuren in Stifters Nachsommer 113
er sich an seine Mutter, und wenn meine Augen ber Bltter gehen werden, auf
welche ich Randbemerkungen niedergeschrieben haben, wird mir dein Auge vor-
schweben, welches hier von dem Gedruckten zu dem Geschriebenen sehen, und
die Schriftzge von Einer vor sich haben wird, die deine beste Freundin auf der
Erde ist.
34
Offensichtlich handelt es sich um eine Romanmetapher: Jeder Text trgt
die Zeichen von frheren Lektren und zeigt die Spuren differenzierter
Schichten auf. Im Falle des Nachsommers lassen die bedeutungstragen-
den Zeichen die Schwierigkeiten beim Entstehen des Romans sichtbar
werden und das Ideal der Vollendung, das Streben nach einem makel-
losen Kunstwerk
35
.
Die Instanz der Vollendung, welche der Bildhauerkunst innewohnt
und den Kontrast zwischen Antike und Moderne bezeichnet, wird von
Stifter rehabilitiert und gleichzeitig in Frage gestellt. Daraus ergibt sich
eine Ambivalenz, die nicht aufgehoben werden kann: das griechische
Zeitalter, das als eine berzeitliche Kunstepoche betrachtet wird, zeigt
zugleich eine wenn auch verborgene zeitliche Spur mit ihrer zusammen-
hngenden Schichten, die auf die notwendige Knstlichkeit der Wieder-
aufnahme hinweist. Die Geschichte der weien Marmorstatue und ihrer
Rezeption sind Zeichen dafr, da die schne Welt der Griechen nur un-
ter der Bedingung einer medialen und musealisierten Aneignung, die fr
den Roman konstitutiv ist, wieder zu gewinnen ist.
Literaturverzeichnis
Quellen
Hegel, Georg Friedrich Wilhelm: Philosophie der Geschichte, in: Smtliche Werke,
Bd. IX. Georg Lasson (Hrsg.): Leipzig 1923.
Herder, Johann Gottfried: Schriften zur sthetik und Literatur 17671781, in:
Werke, Bd. 2. Gunter E. Grimm (Hrsg.): Frankfurt a.M. 1993.
Musil, Robert: Der Mann ohne Eigenschaften, Bd. 1. Reinbek bei Hamburg 1978.
Stifter, Adalbert: Bergkristall, hrsg. von Wolfgang Frhwald/Walter Hettche, in:
Stifter Werke und Briefe. Historisch-Kritische Ausgabe. Alfred Doppler/Wolfgang
Frhwald (Hrsg.), Bd. 2,2: Stuttgart, Berlin, Kln 1999.
34
Stifter: Der Nachsommer, S. 250.
35
Hettche, Walter: ,Dichten oder ,Machen? Adalbert Stifters Arbeit an seinem
Roman Der Nachsommer, in: Walter Hettche/Johannes John/Sibylle von Steins-
dorff (Hrsg.): Stifter-Studien. Ein Festgeschenk fr Wolfgang Frhwald zum 65. Ge-
burtstag. Tbingen 2000, S. 7586, hier: S. 78.
114 Gabriella Catalano
: Der Nachsommer, hrsg. von Wolfgang Frhwald/Walter Hettche, in: Stifter
Werke und Briefe. Historisch-Kritische Ausgabe. Alfred Doppler/Wolfgang Frhwald
(Hrsg.), Bd. 4,2: Stuttgart, Berlin, Kln 1999.von Wolzogen, Alfred (Hrsg.): Aus
Schinkels Nachlass, Nachdruck der Ausgabe von 1862. Mnchen 1981.
Forschungsliteratur
Althofer, Heinz: Restaurierung im 19. Jahrhundert, in: Giuseppina Perusi (Hrsg.):
Il restauro dei dipinti nel secondo Ottocento: Giuseppe Uberto Valentinis e il metodo Pet-
tenkofer. Udine 2002, S. 1528.
Assmann, Aleida: Texte, Spuren, Abfall. Die wechselnden Medien des kulturellen Ge-
dchtnisses, in: Hartmut Bhme/Klaus R. Scherpe (Hrsg.): Literatur und Kultur-
wissenschaften. Positionen, Theorien, Modelle. Reinbek bei Hamburg 1996, S. 96111.
: Zeit und Tradition: kulturelle Strategien der Dauer. Kln, Weimar, Wien 1999.
Bauer, Johannes: Gipsabgusssammlungen an deutschsprachigen Universitten. Eine
Skizze ihrer Geschichte und Bedeutung, in: Jahrbuch fr Universittsgeschichte,
5/2002, S. 117132.
Begemann, Christian: Der steinerne Leib der Frau. Ein Phantasma in der europi-
schen Literatur des 18. und des 19. Jahrhunderts, in: Aurora, 59/1999, S. 135159.
: Die Welt der Zeichen. Stifter-Lektren. Stuttgart 1995.
Borbein, Adolf H.: Zur Geschichte der Wertschtzung und Verwendung von Gips-
abgssen antiker Skulpturen (insbesondere in Deutschland und in Berlin), in:
Henry Lavagne/Franois Queyrel (Hrsg.): Les Moulages de sculptures antiques et lhi-
stoire de larcheologie, Actes du colloque international Paris, 24 octobre 1997, Hau-
tes tudes du monde grco-romain 29. Genve 2000, S. 2943.
Borchmeyer, Dieter: Stifters Nachsommer Eine restaurative Utopie?, in: Poetica,
12/1980, S. 7677.
Brandi, Cesare: Theorie der Restaurierung. Mnchen 2006.
Cain, Hans-Ulrich: Gipsabgsse. Zur Geschichte ihrer Wertschtzung, in: Anzeiger
des Germanischen Nationalmuseums und Berichte aus dem Forschungsinstitut fr Realien-
kunde, 1995, S. 200215.
Conti, Alessandro: Storia del restauro e delle opere darte. Mailand 2002.
Fancelli, Maria: Winckelmann und Stifter: eine mgliche Beziehung, in: Stepha-
nie-Gerrit Bruer (Hrsg.): Altertumskunde im 18. Jahrhundert. Wechselwirkungen zwi-
schen Italien und Deutschland. Stendal 2000, S. 133143.
Hamon, Philippe: Expositions. Littrature et architecture au XIXme sicle. Paris 1989.
Hettche, Walter: ,Dichten oder ,Machen? Adalbert Stifters Arbeit an seinem
Roman Der Nachsommer., in: Walter Hettche/Johannes John/Sibylle von Steins-
dorff (Hrsg.): Stifter-Studien. Ein Festgeschenk fr Wolfgang Frhwald zum 65. Ge-
burtstag. Tbingen 2000, S. 7586.
Jungmair, Otto: Adalbert Stifter als Denkmalpfleger. Linz 1973.
Keller, Thomas: Die Schrift in Stifters Nachsommer. Kln, Wien 1982.
Koschorke, Albrecht: Das buchstabierte Panorama: Zu einer Passage in Stifters
Erzhlung Granit, in: Adalbert-Stifter-Institut des Landes Obersterreich, 38/1989,
S. 315.
Kockel, Valentin: ,Dhieweilen wier die Antiquen nicht haben konnen Abgsse,
Nachbildungen und Verkleinerungen antiker Kunst und Architiektur im 18. und
Griechische Spuren in Stifters Nachsommer 115
19. Jahrhundert, in: Dietrich Boschung/Henner von Hesberg (Hrsg.): Antiken-
sammlungen des europischen Adels im 18. Jahrhundert als Ausdruck einer europischen
Identitt. Internationales Kolloquium in Dsseldorf vom 7.2. 10. 2. 1996. Mainz 2000,
S. 3148.
Koselleck, Reinhart: Zeitschichten. Studien zur Historik. Frankfurt a.M. 2000.
Lachinger, Johann: Schreiben gegen den ,Weltschmerz. Adalbert Stifter im Hori-
zont von Byronismus und Skeptizismus, in: Jahrbuch des Adalbert Stifter Institutes,
3/1996, S. 1727.
Lipp, Wilfried: Adalbert Stifter als ,Conservator (18531865). Realitt und Litera-
tur, in: Hartmut Laufhtte/Karl Mseneder (Hrsg.): Adalbert Stifter. Dichter und
Maler, Denkmalpfleger und Schulmann. Tbingen 1996, S. 185203.
Neumann, Gerhard: Archologie der Passion. Zum Liebeskonzept in Stifters Nach-
sommer, in: Michael Minden (Hrsg.): History, Text, Value. Essays on Adalbert
Stifter. Londoner Symposium. Linz 2006, S. 6993. Oesterle, Gnter: Gottfried
Semper: Destruktion und Reaktualisierung des Klassizismus, in: Sigrid Weigel/
Thomas Koebner (Hrsg.): Nachmrz. Der Ursprung des sthetischen Moderne in einer
nachrevolutionren Konstellation. Opladen 1996, S. 8889.
Pfotenhauer, Helmut: Sprachbilder. Untersuchungen zur Literatur seit dem achtzehnten
Jahrhundert. Wrzburg 2000.
: Vorbilder. Antike Kunst, klassizistische Kunstliteratur und Weimarer Klassik,
in: Wilhelm Vokamp (Hrsg.): Klassik im Vergleich. Stuttgart 1993, S. 4261.
Pomian, Krzystof: Museum und kulturelles Erbe, in: Gottfried Korff/Martin Roth
(Hrsg.): Das historische Museum. Labor, Schaubhne, Identittsfabrik. Frankfurt a.M.,
New York 1990, S. 4164.
Prater, Andreas: Streit um Farbe. Die Wiederentdeckung der Polychromie in der
griechischen Architektur und Plastik im 18. und 19. Jahrhundert, in: Vinzenz
Brinkmann/Raimund Wnsche (Hrsg.): Bunte Gtter. Eine Ausstellung der Staat-
lichen Antikensammlungen und Glyptothek Mnchen. Mnchen 2004, S. 257272.
Roli, Maria Luisa: Il modello della statua e losservatore pigmalionico, in: Maria
Luisa Roli (Hrsg.): Adalbert Stifter. Tra filologia e studi culturali. Atti del convegno di
Milano 11 e 12 Novembre 1999. Milano 2001, S. 165179.
Schlaffer, Hannelore/Schlaffer, Heinz (Hrsg.): Studien zum sthetischen Historismus.
Frankfurt a.M. 1975.
Sjgren, Christine Oertel: The marble statue as idea: collected essays on Adalbert Stifters
Der Nachsommer. Chapel Hill 1972.
Stiegler, Bernd: Philologie des Auges. Die photographische Entdeckung der Welt im 19. Jahr-
hundert. Mnchen 2001.
Vogl, Joseph: Der Text als Schleier. Zu Stifters Der Nachsommer, in: Jahrbuch der deut-
schen Schillergesellschaft, 37/1993, S. 298312.
116 Gabriella Catalano
Griechische Spuren in Stifters Nachsommer 117
II. Imaginationen des griechischen
Freiheitskampfes und Neugriechenlands
118 Gabriella Catalano
Die deutschen Freiwilligen im griechischen Freiheitskampf 119
Valerio Furneri
Die deutschen Freiwilligen
im griechischen Freiheitskampf
Die Teilnahme von fremden Freiwilligen am griechischen Freiheits-
kampf, der 1821 begann, kann aus verschiedenen Perspektiven be-
trachtet werden. Die militrische Hilfe, die diese Freiwilligen den Grie-
chen geleistet haben und die allgemeine Sympathie fr Griechenland
sind an sich kein typisch deutsches Phnomen geblieben. Die griechi-
sche Revolution hat von Anfang an ein sehr breites, vielfltiges Publi-
kum berhrt. Ob Intellektuelle oder Ungebildete, Adlige oder nicht,
viele Menschen in ganz Europa haben sich spontan fr die Freiheit der
Griechen eingesetzt. Dieses Engagement manifestierte sich nicht nur
im geschriebenen Wort, sondern auch in Geldspenden und militri-
scher Untersttzung. Unter den Soldaten, die in den ersten Jahren auf
Seiten der Griechen gekmpft haben, gab es auer der weitaus grten
Zahl an Deutschen auch Italiener, Franzosen, Schweizer, Polen und
Englnder.
Whrend der Jahre 18231825 kann man in Deutschland eine Ab-
nahme des ersten groen Enthusiasmus feststellen. In einer zweiten
Phase des Philhellenismus, ab 1825, wurde dann durch den Schweizer
Bankier Jean Gabriel Eynard auf gesamteuropischer Basis eine Hilfsak-
tion fr die Griechen organisiert, die weniger militrische Hilfe leisten,
als der notleidenden Bevlkerung durch Geldspenden und Lebensmit-
tellieferungen Erleichterung verschaffen wollte.
In der ersten Phase des Philhellenismus aber hat kein anderes Land
eine so starke griechenfreundliche Propaganda erlebt wie Deutschland,
das Land, das den Griechen sogar ihren ersten Knig nach der Unabhn-
gigkeit gegeben hat. Daher wollen wir uns hier auf die deutschen Frei-
willigen und deren Taten konzentrieren.
Die deutschen Freiwilligen, die in Griechenland zwischen 18211822
gekmpft haben, waren zumeist, so wie auch die (weniger zahlreichen)
Freiwilligen aus anderen Lndern, einfache Menschen, die nicht der Ge-
120 Valerio Furneri
bildetenschicht angehrten, aber dennoch durch die klassischen Idealen
und die klassische Welt bezaubert und beeinflusst waren.
Die kulturelle Grundlage bildeten die Studien des 18. Jahrhunderts,
die von Dichtern und Denkern wie Hlderlin, Kant, Goethe und
Winckelmann bestimmt waren.
Viele Schriften und Werke der bedeutendsten Schriftsteller waren
von der griechischen Antike inspiriert und schilderten jene faszinie-
rende Welt auf eine idealisierte Weise. Dies ist z. B. der Fall bei dem Hy-
perion von Hlderlin, oder der Iphigenie auf Tauris von Goethe und sei-
nem Gedicht Prometheus, Werke, die Generationen von der Antike
haben trumen lassen.
Die politischen Grundlagen des besonderen Interesses an Griechen-
land, vor allem nach dem Ausbruch der griechischen Revolution im
Jahre 1821, lagen in den Ideen der Aufklrung, die in der franzsischen
Revolution realisiert wurden, sowie in einem neuen Begriff von Na-
tion, der durch die Bewegung der Romantik mitgeprgt wurde. D. h.
die Vlker verlangten nach Freiheit, Unabhngigkeit und nationaler
Einheit. Und dazu gab es auch ein christliches Gefhl der Solidaritt ge-
genber unterdrckten Vlkern, wie es insbesondere die Griechen wa-
ren, die fast 400 Jahre unter dem trkischen Joch gestanden hatten.
In Deutschland schrieb bereits im Jahre 1801 Johann Gottlob Hey-
nig ein politisches Pamphlet, dessen Titel lautete: Europas Pflicht die Tr-
ken wieder nach Asien zu treiben und Griechenland mit dem Occident zu verei-
nigen.
1
Andere frhere und sptere Schriften, besonders Reiseberichte von
Englndern und Franzosen, hatten dazu beigetragen, in Westeuropa ein
gewisses Bild von den Neugriechen und von den Trken zu verbreiten.
Das Bild von den Griechen trug vorwiegend positive Zge, das Bild von
den Trken hingegen mehr negative Zge.
Dies war vor allem in Deutschland der Fall, wo kaum jemand eine di-
rekte Kenntnis von den Trken und den Neugriechen hatte. Deutsche
Reiseberichte aus erster Hand gab es nur sehr wenige, so da man auf
fremde Schilderungen und Bezeugungen zurckgreifen mute. Und
diese wurden dann oftmals gem den eigenen Anschauungen und Vor-
lieben rezipiert.
1
Heynig, Johann Gottlob: Europas Pflicht, die Trken wieder nach Asien zu treiben,
und Griechenland mit unserer christlichen Welt zu vereinigen. Zum zweiten Mal darge-
stellt. Dessau 1821.
Die deutschen Freiwilligen im griechischen Freiheitskampf 121
So ist eine parteiliche Voreingenommenheit zugunsten der Neugrie-
chen in fast allen deutschen Schriften zu erkennen.
Vereinzelt gab es zwar auch negative uerungen ber die Neugrie-
chen, so u. a. von dem hollndischen Philosophen Cornelius de Pauw,
der die Neugriechen fr geistig tot erklrte.
2
Insgesamt aber herrschte eine apologetische Tendenz den Neugrie-
chen gegenber vor, wobei ihre guten Seiten gelobt und ihre negativen
Seiten gerechtfertigt wurden, whrend die Trken fast nur von ihren
negativen Seiten dargestellt und wegen ihrer Grausamkeit moralisch ver-
urteilt wurden. Eindeutig kam darin die tiefe und leidenschaftliche
Liebe zu Griechenland zum Ausdruck.
Schon im Jahr 1807, also noch etliche Jahre vor dem Ausbruch der
griechischen Revolution, hatte der populre Komdiendichter Julius
von Vo ein Lustspiel geschrieben, das in Berlin uraufgefhrt wurde. Es
hie Die Griechheit und handelte von der berschwnglichen Liebe
zur griechischen Antike und zu den Alten Griechen. Es wurde hierin die
Grkomanie der Deutschen karikiert.
3
Als die Revolution unter Alexandros Ypsilantis am 6. April 1821 aus-
gerufen und einen Monat spter in ganz Europa bekannt wurde, begr-
ten viele in Deutschland wie auch in anderen Lndern dieses Ereignis
mit groer Begeisterung. Man glaubte, da die Zeit des endgltigen
Untergangs der Osmanen und der Befreiung der unterdrckten Vlker
gekommen sei. Am Palmsonntag, dem 15. April 1821 gab der bekannte
Publizist Wilhelm Traugott Krug in Leipzig ein Pamphlet mit dem Titel
Griechenlands Wiedergeburt heraus.
4
Krug, der zu diesem Zeitpunkt noch
nicht wissen konnte, da die Revolution auch auf Griechenland ber-
gegriffen hatte, hielt dies dennoch, und zwar zurecht, fr eine selbstver-
stndliche Konsequenz der Aufstnde, die in der Moldau und Walachei
ausgebrochen waren.
In seinem Pamphlet, das als eine Art Grndungsmanifest des griechi-
schen Freiheitskampfes gelesen werden kann, befrwortet er den grie-
chischen Aufstand und sagt, da die Revolution gegen die Trken die
allergerechteste Sache der Welt sei. Er betrachtet nmlich die Neugrie-
2
Quack-Eustathiades, Regine: Der Deutsche Philhellenismus whrend des griechischen
Freiheitskampfes. Mnchen 1984, S. 24.
3
von Vo, Julius: Die Griechheit. Original-Lustspiel in fnf Aufzgen. Berlin 1807.
4
Krug, Wilhelm Traugott: Griechenlands Wiedergeburt. Ein Programm zum Auferste-
hungsfeste. Leipzig 1821 (Wiederabgedruckt in: Gesammelte Schriften, Bd. 4, Abt.
II,2: Politische und juridische Schriften. Braunschweig 1834, S. 273280).
122 Valerio Furneri
chen als direkte Nachkommen der Altgriechen und behauptet, da die
Zeit reif sei, der osmanischen Herrschaft in Griechenland ein Ende zu
setzen. ber die Diskussion, die schon seit Ende des vorausgehenden
Jahrhunderts gefhrt wurde, ob nmlich die Neugriechen ihrer berhm-
ten Ahnen noch wrdig und ob sie berhaupt die echten Nachkommen
der Altgriechen seien, antwortet Krug, da sie dies schon allein dadurch
seien, da sie die Kraft und den Mut htten, einen Aufstand gegen den
ihnen so weit berlegenen Unterdrcker zu unternehmen. Somit hatte
Krug als erster die Seele der deutschen Griechenfreunde entzndet und
den entscheidenden Ansto fr die Verffentlichung vieler politischer
Schriften ber das Thema gegeben.
In Mnchen war Friedrich Thiersch ttig. Er schrieb gleich anfangs
zahlreiche Artikel (einige erschienen auch anonym) und untersttzte
darin leidenschaftlich die griechische Sache. In diesen und vielen ande-
ren griechenfreundlichen Verffentlichungen spielte das Argument der
Dankesschuld eine wichtige Rolle. Die These war folgende: Die Altgrie-
chen haben mit ihren unsterblichen Leistungen auf dem Gebiet der Li-
teratur, der Philosophie, der Wissenschaft und der schnen Knste, die
Grundlage der modernen europischen Kultur geschaffen. Dafr war
man den Griechen zu hchstem Dank verpflichtet.
5
Mit dem griechischen Aufstand gegen die Trkenherrschaft bot sich
nun fr die Europer die Gelegenheit, die alte heilige Schuld an den
Nachfahren der Alten Griechen, d. h. an den Neugriechen, abzutragen.
Dies konnte man durch eine tatkrftige Untersttzung der Griechen in
ihrem Freiheitskampf tun. Kennzeichnend fr diese Idee ist eine Schrift,
die mit dem Titel erschien: Die Rettung Griechenlands, die Sache des dank-
baren Europa.
6
Solch vehemente philhellenische Propaganda, der sich so-
gleich viele Schriftsteller, Dichter und Denker anschlossen, blieb nicht
ungehrt. Bald wurden in einigen Stdten Deutschlands Griechenhilfs-
vereine gegrndet, deren Ziel die moralische und die praktische Unter-
sttzung des griechischen Freiheitskampfes war.
7
Als eine Art Zentral-
verein wirkte der Verein in Stuttgart, zu dessen Mitgliedern so berhmte
Mnner wie die Dichter Ludwig Uhland und Gustav Schwab zhlten.
5
S. hierzu: Heyer, Friedrich: Das philhellenische Argument: ,Europa verdankt
den Griechen seine Kultur, also ist jetzt Solidaritt mit den Griechen Dankes-
schuld., in: Evangelos Konstantinou (Hrsg.): Die Rezeption der Antike und des eu-
ropischen Philhellenismus. Frankfurt a.M. u. a. 1998, S. 7991.
6
N.N.: Die Rettung Griechenlands die Sache des dankbaren Europa. Leipzig 1821.
7
S. hierzu Hauser, Christoph: Anfnge brgerlicher Organisation: Philhellenismus und
Frhliberalismus in Sdwestdeutschland. Diss. Freiburg 1988. Gttingen 1990.
Die deutschen Freiwilligen im griechischen Freiheitskampf 123
Die Griechenvereine sammelten Geld, um Freiwillige zu rekrutieren, sie
auszursten und nach Griechenland zu schicken. Vom ersten Augen-
blick an waren alle davon berzeugt, da man den Griechen helfen
msse und da diese Hilfe nicht nur eine rein theoretische Befrwor-
tung der griechischen Sache sein drfte, sondern da man militrischen
Beistand leisten msste. Man beschloss daher, Freiwillige nach Grie-
chenland zu schicken, die zusammen mit den Griechen gegen die Tr-
ken kmpfen sollten.
Zwischen Oktober 1821 und November 1822 gingen von Marseille
nach Griechenland insgesamt neun Schiffsexpeditionen ab. Unter den
Freiwilligen befanden sich viele Offiziere und Soldaten, die schon in
den napoleonischen Kriegen gekmpft hatten und die daher hofften,
griechische Soldaten befehligen zu drfen. Es gab auch viele Mnner,
die einfach aus Liebe und Sympathie fr Griechenland dorthin gingen,
aber es gab natrlich auch Eigenntzige, die Geldgewinn und Ruhm
oder auch nur das Abenteuer suchten.
Was diese Mnner mit den verschiedensten Motivationen vereinte,
waren ein groer Enthusiasmus und nicht selten kmpferische Lust.
Schnell wurden sie aber in ihren Erwartungen enttuscht: Schon die
ersten Begegnungen mit den Einheimischen, gleich nach der Ankunft,
waren problematisch. Die Freiwilligen hatten geglaubt, mit Dankbarkeit
von den Griechen empfangen zu werden. Stattdessen wurden sie von
Anfang an voller Misstrauen betrachtet. Die Griechen wuten nicht, was
diese Fremden eigentlich in ihrem Land wollten, und es kam des fteren
sogar zu Zusammensten zwischen den Freiwilligen und den Griechen.
Die Memoiren einiger Freiwilliger lassen uns verstehen, wie vllig ver-
schieden die Situation von ihnen selbst einerseits und den Griechen an-
dererseits wahrgenommen wurde. Fr die Fremden war der Befreiungs-
kampf mit Begeisterung verbunden, die Griechen aber erschienen ihnen
wie unkriegerische, traurige Gestalten aus deren Mienen Unlust und
berdru sprachen.
8
Was die Mnner aus Westeuropa berraschte, waren
die eher morgenlndischen als europischen Sitten der Griechen.
So wunderten sich manche darber, da die Griechen beim Essen auf
dem Boden saen und kein Besteck benutzten. Andere kritisierten den
Mangel jeder Bildung bei den Griechen, da sie nicht einmal Kenntnisse
ihrer eigene Geschichte besen und eine Musik htten, die eine Belei-
8
Quack-Eustathiades: Der Deutsche Philhellenismus, S. 71. Zitat aus den Memoiren
des Freiwilligen Striebeck: Lindes, Fr. (Bearb.): Mittheilungen aus dem Tagebuche
eines Philhellenen. Hannover 1828, S. 3132.
124 Valerio Furneri
digung fr das Ohr sei. Die Freiwilligen lernten also eine Wirklichkeit
kennen, die sie sich ganz anders vorgestellt hatten. Hinzu kamen auch
hufige Konflikte und Missverstndnisse mit der lokalen Bevlkerung,
die sich zum Teil aus den unterschiedlichen Mentalitten und Bedrfnis-
sen der Beteiligten und zum Teil aus der schwierigen Situation selbst er-
klren lassen. Als charakteristisches Beispiel mge hier die Geschichte
der dritten deutschen Expedition stehen: Diese aus 35 Mann bestehende
Expedition segelte von Marseille Ende Januar 1822 ab. Als die Freiwilli-
gen in Navarino ankamen, wurden sie pomps und feierlich empfangen.
Gleich darauf wurde aber seitens der Einheimischen frs Gepcktragen
Geld verlangt, was die Fremden emprte. Auch war die Verpflegung
durch die Ephoren (Ortsvorsteher) mangelhaft, und so fhlten sich die
Freiwilligen missachtet. Das war natrlich auf das allgemeine Chaos und
die Not der Einheimischen zurckzufhren, aber auf jeden Fall erzeug-
ten die schwierigen Verhltnisse Unruhe und Unzufriedenheit auf allen
Seiten. Zehn Tage saen die Freiwilligen in Navarino und muten unt-
tig bleiben, weil der geplante Angriff gegen die von den Trken besetzte
Festung von Modon (in der Nhe von Navarino) nicht stattfand. Einige
beschlossen daher, sich nach Tripolitza zu begeben, um sich dort in den
Dienst des Senats zu stellen. Sie bekamen dafr Lasttiere, die aber durch
eine Requisition bei den einheimischen Bauern beschafft wurden. Die
Besitzer forderten ihre Tiere von den Freiwilligen zurck, und das gelang
ihnen zum Schlu auch, und zwar mit Gewalt: auf dem Weg nach Tri-
politza, in einer Schlucht, warteten viele bewaffneten Bauern auf die
Fremden, und diese konnten schlielich nichts anderes tun als nach Ka-
lamata zurckzukehren. Nach diesem unangenehmen Erlebnis entschie-
den sich bereits die ersten fr die Heimkehr, whrend andere erneut
nach Tripolitza gingen oder sich der vierten, von General Normann ge-
fhrten Expedition anschlossen. Wenige Wochen nach ihrer Ankunft
hatte sich die dritte Expedition weitgehend aufgelst, und auch den
nachfolgenden Expeditionen erging es hnlich.
9
Wenn sich dann aber einmal die Gelegenheit fr militrische Aktio-
nen bot, was selten der Fall war, dann bewiesen die Freiwilligen immer
wieder ihre Tapferkeit, ihren Mut und vor allem ihren guten Willen, den
Griechen zu helfen. So z. B. bei der Belagerung der Akropolis von Athen
im Mai 1822 und noch mehr bei der Schlacht von Peta am 4. Juli 1822,
wo sie zum ersten Male einen offenen Kampf gegen die Trken fhren
konnten und wo viele von ihnen fr die griechische Freiheit starben.
9
Quack-Eustathiades: Der Deutsche Philhellenismus, S. 7475.
Die deutschen Freiwilligen im griechischen Freiheitskampf 125
Die deutschen Freiwilligen entrichteten einen sehr hohen Blutzoll:
Fast die Hlfte von ihnen kehrte nicht mehr in die Heimat zurck, son-
dern starb in Griechenland. Die meisten von ihnen starben allerdings
nicht auf dem Schlachtfeld, sondern an Krankheiten. Und dennoch war
dies nicht der Hauptgrund ihres Scheiterns. Sie mussten doch von vorn-
herein damit rechnen, auf dem Schlachtfeld zu sterben.
Was die Fremden am meisten hinderte, den Griechen ntzlichen
Beistand zu leisten, war der Mangel an jeder Organisation. Es fehlte ein
regulres Heer und es gab keine Koordination zwischen den verschiede-
nen Kampftruppen. Wochenlang mussten die Freiwilligen oft auf einen
Befehl warten, und waren so zur Unttigkeit verurteilt. Ein groes Pro-
blem war auch die Kriegsstrategie. Viele unter den Freiwilligen hatten an
den napoleonischen Kriegen teilgenommen und hatten gedacht, auch
in diesem Krieg eine wichtige Rolle spielen zu knnen.
Die Griechen fhrten aber eine Art Guerillakrieg und vermieden,
wenn mglich, den offenen Kampf gegen die Trken. Sie mussten vor
allem das menschliche Leben schonen, denn sie waren dem Feind ja
zahlenmig weit unterlegen. Die Freiwilligen hielten die Griechen des-
wegen fr feige, was aber ein groes Missverstndnis war. Sie waren mit
einem stark idealisierten Griechenbild nach Griechenland gekommen
und hatten geglaubt, dort die Helden der prachtvollen Vergangenheit zu
finden. Doch die Neugriechen waren nicht die Altgriechen.
Eine andere groe Schwierigkeit war die schlechte Ausrstung dieser
Mnner, und der Mangel an allem Notwendigen. Das ist insbesondere
der Fall bei der letzten Expedition deutscher Freiwilligen. Diese wurde
unter dem Namen Deutsche Legion nach Griechenland geschickt. Sie
sollte mit ihren etwa hundertdreiig Mann als Vorbildstruppe fr die
Griechen dienen. Bei der Ausschiffung erhielten die Mnner nur aber
alte verrostete Gewehre ohne Feuersteine und hatten keine Patronen-
taschen. Ohne ein einziges Mal zum Einsatz gekommen zu sein, lste
sich die Legion bereits nach einem Monat auf. Vom Schicksal ihrer
Mitglieder hat der Freiwillige Heinrich Joseph Kiefer 1823 in seinen
Memoiren Nachrichten ber Griechenland, insbesondere ber das Schicksal
der letzten Expedition deutscher Philhellenen berichtet.
10
Mit Bitterkeit
beschreibt er hier das Elend dieser Mnner, die von den Griechen aus-
gelacht und verspottet wurden. Nach dem Scheitern dieser letzten Expe-
10
Kiefer, Heinrich Joseph: Nachrichten ber Griechenland, insbesondere ber das Schick-
sal der letzten Expedition deutscher Philhellenen. Aus dem Tagebuch und offiziellen Akten-
stcken zusammengetragen nebst einem Nachtrag in Briefen. Mainz 1823.
126 Valerio Furneri
dition wurde den Freiwilligen endgltig klar, da ihre Anwesenheit dort
nutzlos war. Auch bei den Griechenvereinen, die die Expeditionen or-
ganisierten, sah man das schlielich ein. So wurden Ende 1822 die
Schiffsexpeditionen eingestellt und die berlebenden kehrten heim.
Die recht zahlreichen Memoiren von heimgekehrten Freiwilligen sind
verstndlicherweise sehr stark durch die negativen Erfahrungen, die
diese Mnner gemacht hatten, geprgt.
Einige haben ihren Gefhlen sogar in poetischer Form Ausdruck ge-
geben, wie beispielsweise Gottfried Mller und Adolf von Lbtow. Gott-
fried Mller war ein wohlhabender junger Mann aus Bremen. Von dort
war er 1822 mit seinem Freund Georg Dunze nach Griechenland aufge-
brochen. In Griechenland starb sein Freund an einer Seuche, und er
selbst kehrte vllig verarmt nach Hause zurck. In pathetisch-schwrme-
rischer Art ruft Gottfried Mller in seinem Gedicht Erinnerungen an das
Alte Griechenland wach und bringt seine Enttuschung ber das Neue
Griechenland zum Ausdruck, das ihn so schmhlich verkannt habe:
Hellas! Hellas! Land der schnen Trmmer,
Bild von jenem letzten Abendschimmer,
Der voll Wehmuth durch die Wolken scheint.
Zu dir eilt ich mit der Jugend Sehnen,
Von dir scheid ich mit ohnmchtgen Thrnen,
Die um dich mein mattes Auge weint.
Schmhlich, schmhlich, mut ich hier verderben,
Meine Losung Siegen oder Sterben
Brach des Kummers zehrende Gewalt.
O, mit Fen hast du mich getreten,
Dennoch will ich brnstig fr dich beten,
Laut, da es zum hohen Herrgott schallt.
Grne Lorbeern dachte ich zu pflcken,
in dem Land der Lorbeern mich zu schmcken,
Mit Osmannischem Trophen-Glanz.
Htte mich die Schlacht zum Tod getrieben,
Wr ich in dem heien Kampf geblieben,
Deckte wohl mein Grab der heilge Kranz.
Nicht dem Feinde sollte ich erblassen,
Freundes-Volk, das mich verkannt, verlassen,
Stt mich fhllos in der Siechheit Graus.
Statt dem Schwerdt, das Deutschland mir gegeben,
fr des Kreuzes, fr der Freiheit Leben,
Nehm ich meine Krcke mit hinaus.
Die deutschen Freiwilligen im griechischen Freiheitskampf 127
Alles hast du, Hellas, mir genommen,
Deinem bittern Undank zu entkommen,
Flcht ich bettelnd zu der Trken Strand.
Deutschlands Shne wollten fr dich fechten,
Wollen nicht mit deinem Unglck rechten,
O verkenne nicht das Freundesland.
11
In diesem Gedicht erhebt Mller Anklage gegen das moderne Griechen-
land, das Land, das sich ihm gegenber so unfreundlich und undankbar
gezeigt hat. Die Gefhle der Ohnmacht, der Bitterkeit und der Ent-
tuschung, die in diesen Zeilen zum Ausdruck kommen, sind, wie wir
schon gesehen haben, das Leitmotiv in den meisten Tagebchern und
Memoiren der zurckgekehrten Freiwilligen, die sich irgendwie verraten
fhlten.
Zugleich gibt es aber immer noch die Sehnsucht nach der idyllischen
Welt der Vergangenheit: Gleich am Anfang finden wir den melancholi-
schen Ausruf (Hellas! Hellas! Land der schnen Trmmer), der uns darauf
hinweist, wie tief in den Freiwilligen das idealisierte Bild vom antiken
Griechenland verwurzelt war.
Viele Kriegsfreiwillige behielten jedoch trotz aller Schwierigkeiten
und schlimmer Erlebnisse ihre Bewunderung fr jene alte faszinierende
Welt, die sie ursprnglich in das ferne Land gelockt hatte. So begrt
der preuische Leutnant Adolf von Lbtow bei seiner Ankunft auf dem
Peloponnes das Land mit einer leidenschaftlichen Hymne:
Seid mir gegrt, Gebsche Arkadiens! Land von Gttern geliebt! Berge, der
Oreaden Aufenthalt! Reizende Thler der Hirten! Duftende Matten, auf denen
Pan, die Dryaden und die Nymphen tndelnd spielten, bei bucolischen Gesngen
voll Unschuld! Und ihr dunkle Haine, die mit geheimnisvollen Schleier Diana
und ihr keusches Gefolge umhllten! Seid mir gegrt! Und: ,auch ich habe in
Arkadien gelebt!
12
11
Mller, Gottfried: Reise eines Philhellenen durch die Schweiz und Frankreich nach Grie-
chenland und zurck durch die asiatische Trkei und Italien in seine Heimat. Bamberg
1825. Teil II, S. 164, zitiert nach Quack-Manoussakis, Regine: Die deutschen
Freiwilligen im griechischen Freiheitskampf von 1821, in: Otto-Knig-von-Grie-
chenland-Museum der Gemeinde Ottobrunn (Hrsg.): Jahresgabe 2003. Mnchen
2003, S. 21. In diesem Heft befinden sich eine Auswahl von Gedichten sowie Aus-
zge aus Tagebchern der heimgekehrten Freiwilligen. Eine italienische Fassung
des Textes ist im Internet unter http://www.miti3000.it (siehe Filellenismo) ver-
fgbar (bersetzt von Valerio Furneri).
12
von Bollmann, Ludwig (Bearb.): Der Hellenen Freiheitskampf im Jahre 1822 aus dem
Tagebuche des Herrn A. v. L., Kampfgenosse des Generals Grafen von Normann, S. 13,
zitiert nach ebd.
128 Valerio Furneri
Mit der letzten Zeile gibt der Autor zu erkennen, da seine Inspiration
nicht nur aus dem Anblick der griechischen Landschaft selbst ent-
stammt, sondern auch aus den Dichtern, die Griechenland geliebt und
besungen haben: Die erste Strophe aus Friedrich Schillers, erstmals in
der Thalia von 1786 erschienenen Gedicht Resignation lautet:
Auch ich war in Arkadien geboren,
Auch mir hat die Natur
An meiner Wiege Freude zugeschworen,
Auch ich war in Arkadien geboren,
Doch Trnen gab der kurze Lenz mir nur.
13
Schon in der ersten Zeile von Lbtows feierlichem Anruf wird der Leser
in eine mythische Dimension eingefhrt. Die gegenwrtige Welt mit all
ihren Problemen wird durch eine zeitlose reizende Landschaft ersetzt,
das vielbesungene und erst durch die Literatur erschaffene idyllische Ar-
kadien. Lbtow spricht von den Dryaden und Oreaden, d. h. den Nym-
phen der Wlder und der Berge. Er entwirft das Bild eines zeitlosen bu-
kolischen Lebens mit all seinen typischen Merkmalen, und so kann er
seine Enttuschung ber die negativen Aspekte des griechischen Aufent-
haltes, seine Ernchterung ber den langweiligen Alltag des Freiheits-
kampfes berwinden. An dieser Hymne lt sich ablesen, wie nicht nur
Dichter, sondern auch einfache Militrpersonen fr Griechenland begei-
stern konnten.
Auch der schsische Leutnant Maximilian von Kotsch drckt ganz
hnliche Gefhle aus: Nach vielen schlechten Erfahrungen hatte er sich
zur Heimkehr entschlossen, aber trotzdem bedauerte er es, [] dies
schne Land mit dem herrlichen Klima und alle die herzerhebenden
berreste einer edleren Zeit, diese prchtigen Altertmer, an denen man
sich nicht satt sehen kann, zu verlassen.
14
Die groe Leidenschaft, mit der sich zumindest ein guter Teil der
Freiwilligen fr die griechische Sache einsetzen wollten, zeigt, da sie
nicht bloe Abenteurer waren. Dies wurde ihnen nmlich nach ihrer
13
Schiller, Friedrich: Resignation, in: Gedichte, Erzhlungen, bersetzungen. Nach
den Ausgaben letzter Hand unter Hinzuziehung der Erstdrucke und Handschrif-
ten. Helmut Koopmann (Hrsg.): Mnchen 1968, S. 112115, hier: S. 112. (ED. in:
Thalia 1/1786, 2, S. 6469).
14
von Mauvillon, F. W. [Bearb.]: Reise eines deutschen Artillerieoffiziers nach Grie-
chenland und Aufenthalt daselbst von August 1822 bis Juli 1823. Nach den Tagebchern
und Aufzeichnungen desselben. Essen 1824, S. 70, zitiert nach Quack-Manous-
sakis: Die deutschen Freiwilligen im griechischen Freiheitskampf von 1821,
S. 22.
Die deutschen Freiwilligen im griechischen Freiheitskampf 129
Rckkehr von den Philhellenen vorgeworfen, die nicht mit dem Schwert
in der Hand nach Griechenland zogen, sondern zu Hause die griechi-
sche Sache mit der Feder, d. h. in Wort und Schrift, verteidigten.
Die Philhellenen der Feder waren ebenso wie die Freiwilligen von
Griechenland bezaubert. Aber auch sie hatten natrlich keine direkte
Kenntnis von der gegenwrtigen Situation. Die Reiseberichte der Heim-
gekehrten schienen ihnen, teilweise zu Recht, unsachlich und bertrie-
ben negativ.
15
Nach der Verffentlichung der ersten Memoiren begann
eine Jahre andauernde polemische Auseinandersetzung zwischen Heim-
gekehrten und Daheimgebliebenen, wobei die letzten alle negativen
uerungen der Freiwilligen ber Griechenland und die Neugriechen
verurteilten.
16
Sie schrieben das Scheitern der Expeditionen allein den
Freiwilligen zu, weil diese mit reiner Sldnermentalitt nach Griechen-
land gegangen seien, und dort nur den eigenen Vorteil gesucht htten.
Da ihre Wnsche aber nicht in Erfllung gingen, so stellten sie die Grie-
chen in dsterstem Licht dar und verffentlichten ihre Tagebcher nur,
um zumindest einen Teil der Reisekosten zurckzugewinnen. Sie knn-
ten sich berhaupt kein Urteil erlauben, weil sie die griechische Wirk-
lichkeit nur ganz oberflchlich kennengelernt htten.
Gewi gab es unter den Freiwilligen auch Eigenntzige und Abenteu-
rer. Aber auch sie waren, schon allein durch die intensive Werbepropa-
ganda, von dem idealen Griechenbild geprgt. Einige warnten in ihren
Berichten davor, die Neugriechen mit den Altgriechen gleichzusetzen.
Diese Botschaft blieb aber meist ungehrt oder wurde absichtlich ber-
hrt. Denn, whrend die Heimgekehrten hufig nur kritisierten, so
vertrugen die Daheimgebliebenen hingegen keinerlei Tadel an den Neu-
griechen. Sie verurteilten die Freiwilligen pauschal, ohne die Reise-
berichte kritisch auf ihre Glaubwrdigkeit bzw. Unglaubwrdigkeit hin
zu untersuchen. So wurden die meisten Heimkehrer zum Teil zu un-
recht mit negativen Attributen als Abenteurer, Nrgler oder Egoisten
bedacht. Dies geschah zum Teil zu Unrecht, weil es unter den Freiwilli-
gen auch zahlreiche Selbstlose gab, die, durch die hchsten Ideale inspi-
riert, ihre Heimat und ihre Familien fr Griechenlands Freiheit ver-
lassen hatten. Die Kmpfer des Schwertes hatten teilweise einiges fr
15
S. Scheitler, Irmgard: Deutsche Philhellenenlyrik. Dichter, Verffentlichungsfor-
men, Motive, in: Evangelos Konstantinou (Hrsg.): Ausdrucksformen des Europi-
schen und Internationalen Philhellenismus vom 17.19. Jahrhundert. Bern u. a. 2007,
S. 7082, hier: S. 72.
16
S. hierzu Quack-Eustathiades: Der deutsche Philhellenismus, S. 90124.
130 Valerio Furneri
Griechenland geopfert, ihr Vermgen, einen guten Freund, oder sogar
das eigene Leben.
17
Und selbst wenn sie, besonders in den ersten Jahren der Revolution,
wenig fr die griechische Befreiung leisten konnten, so war ihr Opfer
doch nicht ganz umsonst.
Die Sympathie fr das kleine Land, das fr seine Freiheit kmpfte, er-
losch im westlichen Europa nie ganz. Und in den spteren Jahren, d. h.
1825 und 1826, fand man auch andere zweckmigere Wege der Grie-
chenhilfe, z. B. in Form von Geld- und Lebensmittelspenden an die not-
leidende Bevlkerung.
Die Freiwilligen von 18211822 waren offensichtlich meist aus
Liebe zu Griechenland und mit den besten Absichten gekommen. Aber
sie hatten sich ein idealisiertes, durch die Antike geprgtes Griechen-
land voller Heldengestalten vorgestellt. Von der wirklichen chaotischen
Situation im gegenwrtigen Griechenland, das 400 Jahre die trkische
Herrschaft ertragen hatte und jetzt den Krieg gegen seine Unterdrcker
begann, wuten sie nichts. Die Freiwilligen sind daran gescheitert, da
sie sich an diese unerwartete Situation nicht gewhnen konnten.
Literaturverzeichnis
Quellen
N.N.: Die Rettung Griechenlands die Sache des dankbaren Europa. Leipzig 1821.
Heyer, Friedrich: Das philhellenische Argument: ,Europa verdankt den Griechen seine
Kultur, also ist jetzt Solidaritt mit den Griechen Dankesschuld. , in: Evangelos Kon-
stantinou (Hrsg.): Die Rezeption der Antike und der europische Philhellenismus. Frank-
furt a.M. u. a. 1998, S. 7991.
Heynig, Johann Gottlob: Europas Pflicht, die Trken wieder nach Asien zu treiben, und
Griechenland mit unserer christlichen Welt zu vereinigen. Zum zweiten Mal dargestellt.
Dessau 1821.
17
Der Arzt Boldemann z. B. hatte sich in Argos (wo eine Seuche ausgebrochen war)
mit Flei um die Kranken gekmmert. Als er selbst das Fieber bekam, lieen
ihn die Griechen ohne Nahrung und Pflege auf der Strae sterben. Von hnlichen
Fllen haben zahlreiche Freiwillige berichtet. Karl Emil von Rosenstiel berichtet
in seinen Memoiren zu diesem Fall: Es gefiel uns nicht, da die Griechen so
an einem Franken handeln konnten, der fr ihre Sache seine Heimat verlassen
hatte und ihnen sogar wesentliche Dienste bei seinem Leben leistete (Nelisteros
[d.i. Karl Emil Rosenstiel]: Tagebuch eines Griechenfreundes. Seinen Freunden gewid-
met. Liegnitz 1824, zitiert nach Quack-Eustathiades: Der Deutsche Philhellenismus,
S. 77).
Die deutschen Freiwilligen im griechischen Freiheitskampf 131
Kiefer, Heinrich Joseph: Nachrichten ber Griechenland, insbesondere ber das Schicksal
der letzten Expedition deutscher Philhellenen. Aus dem Tagebuch und offiziellen Aktenstk-
ken zusammengetragen nebst einem Nachtrag in Briefen. Mainz 1823.
Krug, Wilhelm Traugott: Griechenlands Wiedergeburt. Ein Programm zum Auferstehungs-
feste. Leipzig 1821 (Wiederabgedruckt in: Gesammelte Schriften, Bd. 4, Abt. II,2:
Politische und juridische Schriften. Braunschweig 1834, S. 273280).
Lindes, Fr. (Bearb.): Mittheilungen aus dem Tagebuche eines Philhellenen. Hannover 1828.
von Mauvillon, F. W. [Bearb.]: Reise eines deutschen Artillerieoffiziers nach Griechenland
und Aufenthalt daselbst von August 1822 bis Juli 1823. Nach den Tagebchern und Auf-
zeichnungen desselben. Essen 1824.
Mller, Gottfried: Reise eines Philhellenen durch die Schweiz und Frankreich nach Griechen-
land und zurck durch die asiatische Trkei und Italien in seine Heimat. Theil 2. Bam-
berg 1825.
Nelisteros [d.i. Karl Emil Rosenstiel]: Tagebuch eines Griechenfreundes. Seinen Freunden
gewidmet. Liegnitz 1824.
Schiller, Friedrich: Gedichte, Erzhlungen, bersetzungen. Nach den Ausgaben letzter
Hand unter Hinzuziehung der Erstdrucke und Handschriften. Helmut Koop-
mann (Hrsg.): Mnchen 1968.
von Vo, Julius: Die Griechheit. Original-Lustspiel in fnf Aufzgen. Berlin 1807.
Forschungsliteratur
Hauser, Christoph: Anfnge brgerlicher Organisation: Philhellenismus und Frhliberalis-
mus in Sdwestdeutschland. Diss. Freiburg 1988. Gttingen 1990.
Quack-Eustathiades, Regine: Der Deutsche Philhellenismus whrend des griechischen Frei-
heitskampfes. Mnchen 1984.
Quack-Manoussakis, Regine: Die deutschen Freiwilligen im griechischen Freiheits-
kampf von 1821., in: Otto-Knig-von-Griechenland-Museum der Gemeinde
Ottobrunn (Hrsg.): Jahresgabe 2003. Mnchen 2003.
Scheitler, Irmgard: Deutsche Philhellenenlyrik. Dichter, Verffentlichungsformen,
Motive, in: Evangelos Konstantinou (Hrsg.): Ausdrucksformen des Europischen
und Internationalen Philhellenismus vom 17.19. Jahrhundert. Bern u. a. 2007, S. 7082.
132 Valerio Furneri
Familien im Krieg 133
Ekaterini Kepetzis
Familien im Krieg
Zum griechischen Freiheitskampf in der
franzsischen Malerei der 1820er Jahre
Auf dem Salon von 1827 prsentierte der Maler Auguste Jean-Baptiste
Vinchon (17891855) sein Gemlde Modernes griechisches Thema Nach
dem Massaker von Samothrake.
1
Der franzsische Schriftsteller und Kunst-
kritiker Anthony Braud leitet seine Besprechung dieses Werkes mit der
Feststellung ein:
[] de nos jours, quel prix de sang et de larmes la Grce a-t-elle acquis le droit
dinspirer tous les enfans des muses! Les Hellnes, leur hrosme, leur dsastres,
leurs victoires, leurs revers ont fourni nos peintres une foule de sujets de com-
position.
2
Diese Zeilen charakterisieren in prgnanter Form sowohl den zeitgens-
sischen Enthusiasmus fr die griechische Erhebung gegen die osma-
nische Herrschaft (18211827) als auch die hohe Aufmerksamkeit, die
diesem Kampf insbesondere in der zeitgenssischen franzsischen Lite-
ratur und Kunst zuteil wurde.
Bereits auf dem drei Jahre zuvor veranstalteten Salon hatte sich das
Interesse der Kunstkritik auf Eugne Delacroix (17981863) Gemlde
Das Massaker von Chios konzentriert.
3
Die Verbindung von bildknstle-
rischer Rezeption des Unabhngigkeitskrieges und tagespolitischem
Engagement demonstrierten sodann die beiden vom 17. Mai bis zum
19. November 1826 in der Galerie LeBrun in Paris gezeigten Benefiz-
ausstellungen Au profit des Grecs;
4
dort waren fast 200 Werke zu sehen,
1
274 342 cm; Paris, Louvre.
2
Vgl. Braud, Anthony: Annales de lcole franaise des Beaux-Arts. Paris 1827, S. 129.
Anthony Braud war das Pseudonym Antoine-Nicolas Brauds (1794?-1860).
3
419 354 cm; Paris, Muse du Louvre.
4
Der fr das Jahr 1826 geplante Salon fand aufgrund von Renovierungsarbeiten im
Louvre nicht statt. Die Benefizausstellung zu Gunsten der Griechen, die erste
nicht von Juroren bestimmte ffentliche Kunstschau, entwickelte sich daher zu
134 Ekaterini Kepetzis
darunter auch Delacroix Allegorie Griechenland auf den Ruinen von
Missolonghi.
5
Im Folgejahr schlielich, als die Kmpfe in Griechenland
bereits zum Erliegen gekommen waren, wurden auf dem Salon erneut
Bilder mit entsprechender Thematik ausgestellt.
Die generelle Bedeutung des griechischen Freiheitskampfes als
Thema der franzsischen Malerei und insbesondere im Werk Delacroix
ist vor allem durch die Studien von Athanassoglou-Kallmyer sowie die
Ausstellung La Grce en rvolte von 1996 gut erforscht.
6
Hingegen sind
bergreifende Fragestellungen bis dato kaum aufgegriffen worden.
So wurde die Tatsache bislang noch nicht untersucht, da die beiden
in der Rezeption des griechischen Freiheitskampfes dominierenden
argumentativen Storichtungen dune part la lutte des chrtiens contre
lIslam et dautre part la guerre de la civilisation occidentale, fille de la
Grce antique, contre la barbarie orientale
7
ihren primren visuellen
einem knstlerischen Groereignis in Paris und zog fast 30000 Besucher an. Ne-
ben einer Prsentation der aufstrebenden Maler der jngeren Generation fand
hier de facto eine Retrospektive der franzsischen Malerei seit den 1790er Jahren
und zugleich ein Gedenken an den im Jahr zuvor im Brsseler Exil verstorbenen
Jacques-Louis David statt. Zu dieser Ausstellung vgl. Athanassoglou-Kallmyer,
Nina: French images from the Greek war of independence, 18211830: Art and politics
under the Restoration. New Haven, London 1989, S. 3941; Bajou, Valrie: Les
Expositions de la Galerie Lebrun en 1826, in: La Grce en rvolte: Delacroix et les
peintres franais, 18151848. Ausst.-Kat. Bordeaux, Muse des Beaux-Arts, 1996;
Paris, Muse National Eugne Delacroix, 199697; Athen, Pinacothque Natio-
nale, Muse Alexandre-Soutzos, 1997. Paris 1996, S. 5158; Chaudonneret, Ma-
rie-Claude: LEtat et les artistes: de la Restauration la monarchie de Juillet (18151833).
Paris 1999, S. 110f.; Martin, Catherine: LExposition en faveur des Grecs la
Galerie Lebrun ou le ,Salon de 1826. Une Organisation non officielle pour un
vnement devenu officiel, in: Recherches en Histoire de lart 3/2004, S. 91104.
5
209 147 cm; Bordeaux, Muse des Beaux-Arts.
6
Athanassoglou-Kallmyer, Nina: Under the Sign of Leonidas: The Political and
Ideological Fortune of Davids ,Leonidas at Thermophylae under the Restora-
tion, in: The Art Bulletin 63/1981, 4, S. 633649; dies.: French images; dies.: La
guerre dIndpendance grecque en France: politique, art et culture, in: Ausst.-
Kat. La Grce en rvolte, S. 4550; dies.: Delacroix zwischen ,Griechenland und
,Die Freiheit. Anmerkungen zur politischen Ikonographie im Frankreich der
Restaurationszeit, in: Stefan Germer/Michael F. Zimmermann (Hrsg.): Bilder
der Macht Macht der Bilder. Zeitgeschichte in Darstellungen des 19. Jahrhunderts. Mn-
chen, Berlin 1997, S. 257266; Ausst.-Kat. La Grce en rvolte.
7
Martin: LExposition, S. 93. Vgl. auch die Kulturschuld-Theorie und die
Abendland-Theorie bei Conter, Claude D.: Jenseits der Nation das vergessene
Europa des 19. Jahrhunderts. Die Geschichte der Inszenierungen und Visionen Europas in
Literatur, Geschichte und Politik. Bielefeld 2004, S. 436445.
Familien im Krieg 135
Ausdruck in Darstellungen fanden, in welchen von den Kmpfen betrof-
fene Familien gezeigt werden.
8
Zu sehen sind jeweils Shne, die den Krieg
an Stelle ihrer Vter weiterfhren, Mtter, die sich und ihre Kinder tten,
Vter, die hilflos den Untergang ihrer Nchsten hinnehmen mssen. Das
Bild der Familie spielte fr die Wahrnehmung des griechischen Freiheits-
kampfes in Westeuropa in doppelter Hinsicht eine entscheidende Rolle
9
:
Im Sinne der Kulturbringer galten die Griechen der klassischen Antike als
Begrnder der abendlndischen Zivilisation und daher als Ahnen der
Menschen des frhen 19. Jahrhunderts; ihre modernen Nachfahren wie-
derum wurden als christliche und kulturelle Brder verstanden. Sym-
ptomatisch schreibt der Historiker und Philhellene Camille Paganel
(17971859), die Beziehung zu den kmpfenden Griechen gehe ber das
bloe Mitgefhl hinaus, das man tous les membres de la grande famille
humaine schulde und erklrt: Ce sont nos parens, ce sont nos frres.
10
Mittels der in solchen Szenen gezeigten Vernderungen von Familien-
strukturen und Geschlechterrollen durch den Krieg wurde die tradierte
Ikonographie dieses Themas um ein neues Motiv erweitert. Es entstan-
den insofern im Kontext des griechischen Freiheitskampfes Bilder, die
sich mit einem bislang so nicht zu beobachtenden Appellationscharak-
ter an die ffentlichkeit wandten.
Familiendarstellungen, beginnend mit Bildern der Heiligen Familie, sind
seit langem Gegenstand kunsthistorischer Untersuchungen. Dabei kon-
zentriert sich die Literatur auf Aspekte der Dynastie und Memoria, auf
Familienportrts oder auf sentimentale Darstellungen.
11
Hinsichtlich
8
Lediglich im zweiten Kapitel von Fraser, Elisabeth A.: Delacroix, Art and Patrimony
in Post-Revolutionary France. Cambridge 2004 finden sich berlegungen zur Signifi-
kanz des Familienmotivs. Allerdings beschrnkt sich Fraser weitgehend auf Dela-
croix Gemlde und fokussiert ihre Ausfhrungen auf eine die patriarchalischen
Strukturen der Restaurationszeit sttzende Ausdeutung der Thematik. Dabei postu-
liert sie grundstzlich eine Interpretation des Familienmotivs als Ausdruck kolonia-
ler Bestrebungen Frankreichs gegenber dem zerfallenden Osmanischen Reich.
9
Siehe hierzu auch den Beitrag von Gilbert He im vorliegenden Band mit Ver-
gleichen aus dem Bereich der Literatur.
10
Vgl. Paganel, Camille: Le Tombeau de Marcos Botzaris. Paris 1826, Vorwort, S. IIf.
Auf dem Frontispiz dieses Werkes befindet sich der Vermerk: Se vend au profit
des Grecs.
11
Vgl. z. B. Ciappelli, Giovanni/Rubin, Patricia Lee (Hrsg.): Art, memory, and family
in Renaissance Florence. Cambridge 2000; Laarmann, Frauke K.: Families in beeld: de
ontwikkeling van het Noord-Nederlandse familieportret in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw. Hilversum 2002; Weber-Kellermann, Ingeborg: Die Familie: eine Kul-
136 Ekaterini Kepetzis
des Themenkomplexes Krieg und Kunst ergibt sich die paradoxe Situa-
tion, da es einerseits eine Flut spezialisierter monographischer Untersu-
chungen zu einzelnen Knstlern, Epochen oder spezifischen Kriegen
gibt. Andererseits besitzt jedoch die 1996 von Gerster und Helbing getrof-
fene Feststellung bis heute Gltigkeit, wonach es [] an umfassender
berblicksliteratur zu diesem Thema mangelt.
12
Zwar ist seit den An-
schlgen vom 11. September 2001 die Literatur zur Visualisierung des
Krieges im Zeitalter medialer Berichterstattung sprunghaft angestiegen, in
der Regel aber auf zeitgenssische Darstellungen konzentriert.
13
Eine grundstzliche Erforschung des Motivs Familien im Krieg
steht bislang aus. Auch die im Zuge der visuellen Auseinandersetzungen
mit dem hellenischen Kampf erfolgten ikonographischen Umstrukturie-
rungen sind bislang in ihrer letzten Konsequenz nicht hinreichend
bercksichtigt worden. So wird die Untersuchung der im Weiteren ana-
lysierten Gemlde nachweisen, da eine der im Hinblick auf Visualisie-
rungen kriegerischen Geschehens zu Grunde gelegten Zielsetzungen,
das Publikum zwar immer noch zeitverschoben in das Geschehen
einzubinden und so dessen patriotische Identifikationsbereitschaft zu
strken,
14
hier erstmals auer Kraft gesetzt ist.
turgeschichte der Familie. Frankfurt a.M. 1996; Lorenz, Angelika: Das deutsche Fami-
lienbild in der Malerei des 19. Jahrhunderts. Darmstadt 1985; Weber-Kellermann,
Ingeborg: Die Familie: Geschichte, Geschichten und Bilder. Frankfurt a.M.
3
1984.
12
Vgl. Gerster, Ulrich/Helbing, Regine: Vorwort, in: dies. (Hrsg.): Krieg und Frie-
den in der bildenden Kunst. 2 Bde. Bd. 1. Zrich 1996, S. 1. Einen berblick geben
Hofmann, Werner: Die Krfte wachsen, in: ders. (Hrsg.): Schrecken und Hoff-
nung. Knstler sehen Krieg und Frieden. Hamburg 1987, S. 2538 sowie Palm, Gode-
hart: Das Format des Unfalichen. Zur historischen Koexistenz von Krieg und
Kunst, in: Kunst und Krieg. Kunstforum International 165/2003, S. 6597; interes-
sante Bemerkungen zur Beziehung zwischen Dargestelltem und Betrachter in den
ersten beiden Kapiteln von Kppen, Manuel: Das Entsetzen des Beobachters: Krieg
und Medien im 19. und 20. Jahrhundert. Heidelberg 2005. Paul, Gerhard: Bilder des
Krieges, Krieg der Bilder. Zur Visualisierung des modernen Krieges. Paderborn 2004 be-
handelt nur im ersten Kapitel seiner Arbeit Darstellungen vor 1850. Dabei bleibt
jedoch der griechische Unabhngigkeitskrieg trotz seiner paradigmatischen Be-
deutung unbeachtet.
13
Z.B.: Seelen, Georg/Metz, Markus (Hrsg.): Krieg der Bilder Bilder des Krieges.
Abhandlung ber die Katastrophe und die mediale Wirklichkeit. Berlin 2002; Matt,
Gerald: Attack. Kunst und Krieg in den Zeiten der Medien. Ausst.-Kat. Wien, Kunst-
halle, 2003. Gttingen 2003; Knieper, Thomas/Mller, Marion G. (Hrsg.): War
visions: Bildkommunikation und Krieg. Kln 2005; Jrgens-Kirchhoff, Annegret
(Hrsg.): Warshots: Krieg, Kunst & Medien. Weimar 2006.
14
Vgl. Paul: Bilder, S. 37.
Familien im Krieg 137
Einleitend werden einige der im Kontext des Befreiungskampfes der
Griechen gegen die Osmanen entstandenen Gemlde analysiert und so-
dann exemplarisch traditionellen Kriegsdarstellungen gegenber ge-
stellt. Dieser Vergleich wird den visuell innovativen Umgang mit dem
Krieg und seinen Folgen sowie die gewandelte Funktion der Darstellun-
gen des griechischen Freiheitskampfes offen legen. Abschlieend wird
demonstriert, da die Voraussetzung fr diesen hier erstmals zu konsta-
tierenden ikonographischen Paradigmenwechsel die vernderte Auffas-
sung von Familie und Kindheit war, die sich seit dem ausgehenden
18. Jahrhundert in Frankreich entwickelt hatte und die Visualisierung
kriegerischer Konflikte bis heute beeinflut.
1. Familien als Sinnbilder des Aufbegehrens
Im Vordergrund von Delacroix Gemlde Scnes des massacres de Scio
(Abb. 1) lagern dem Tod geweihte Liebende, gescheiterte Kmpfer, eine
sybillenhaft starrende Alte, eine tote Mutter, deren Kind vergeblich
nach ihren Brsten tastet, und weitere Griechen in apathischer Passivitt
auf dem ausgedrrten Boden. Rechts versucht ein Hellene, einen osma-
nischen Reiter am Raub eines Mdchens zu hindern.
Die Fragmentierung des Bildvordergrundes in mehrere, anscheinend
gleichberechtigte Personengruppen und der damit einhergehende Ver-
zicht auf einen zentralen, die Aussage des Gemldes tragenden Hel-
den,
15
irritierte die zeitgenssische Kunstkritik und bildete, neben der
Diskussion des Stils, den Fokus der Kritik.
16
Geradezu symptomatisch
15
Zu Delacroix Verzicht auf den traditionellen Bildhelden vgl. Brown, Roy H.:
The Formation of Delacroix Hero between 1822 and 1831, in: The Art Bulletin
66/1984, 2, S. 237254; Gaehtgens, Thomas W.: Der Knstler als Held. Eugne
Delacroix, in: Ekkehard Mai (Hrsg.): Triumph und Tod des Helden. Europische
Historienmalerei von Rubens bis Manet. Ausst.-Kat. Kln, Wallraf-Richartz-Mu-
seum, 198788. Kln 1987, S. 115125.
16
MacNamidhe hat drauf hingewiesen wie sehr die Kritiker, die Delacroix Ge-
mlde vor diesem Hintergrund mangelnde narrative Kohrenz vorwarfen, durch
die Historienbilder Jacques-Louis Davids geprgt waren. Vgl. MacNamidhe, Mar-
garet: Delcluzes Response to Delacroixs ,Scenes from the Massacres at Chios
(1824), in: The Art Bulletin 89/2007, 1, S. 6381. Vermittels der Symmetrie und
Rhythmisierung sei in Davids Bildern kriegerische Gewalt zu idealer Gestz-
migkeit gelutert; die Dominanz der Linie wird zur Signatur der Vernunft; vgl.
Kppen: Das Entsetzen, S. 23.
138 Ekaterini Kepetzis
Abb. 1: Eugne Delacroix: Das Massaker von Chios, 1824, Paris, Louvre
Familien im Krieg 139
ist in diesem Zusammenhang der Vorwurf eines mit dem Krzel M.
bezeichneten Kritikers, der feststellt:
[] a central thought must provide the single foundation, and must permeate
even the accessories which concur to the genral effect. However in M. Delacroixs
composition, I am looking in vain for such a single thought; but all I see is a host
of Greeks thrown at random and confusedly, while awaiting slavery or death [].
17
Obschon in der kunsthistorischen Literatur zu Delacroix Gemlde
der Verweis auf die im Bildtitel in den Plural gesetzten Begriffe Scnes
und Massacres bereits seit Jahrzehnten als Beleg dafr dient, da der
Maler bewut auf eine narrative Verklammerung der Figurengruppen
verzichtet habe und dies ein wesentlicher Teil der Bildaussage sei,
wurde der zweite Teil des im livret des 1824er Salons verffentlichten
Originaltitels bislang kaum beachtet: Familles grecques attendant la mort
ou lesclavage, etc. Es geht also nicht allein um einzelne, zu Opfern
der osmanischen Willkr gewordene Menschen, sondern speziell um
Familien.
18
Die Signifikanz des Familienmotivs lt sich insbesondere anhand
der im linken Bildvordergrund erscheinenden Gruppe nachvollziehen,
die den Nukleus der hier zur Debatte stehenden Darstellungen kriegs-
geschdigter Familien bildet: dem starr ins Leere blickenden Vater mit
seinen drei Kindern. Ein unter dem Krzel P.A. schreibender Kunst-
kritiker widmet dieser Gruppe besondere Aufmerksamkeit und hebt den
bewegenden Ausdruck der Familienmitglieder hervor:
Plus loin un jeune enfant voit son frre dfaillir, le prend dans ses bras et lem-
brasse troitement; derrire eux un jeune garon vient se jeter dans les bras de son
pre, qui le regarde immobile; mais dans ses yeux se peignent sa rage et son ds-
espoir.
19
Der Mann drckt ein Tuch auf eine blutende Wunde unterhalb des
Herzens. Seine Tochter blickt flehend zu ihm auf und umfat die linke
Hand des Vaters. Zu ihren Fen die jngeren Geschwister: zrtlich
kt ein junges Mdchen zum Abschied den sterbenden Bruder auf die
Wange. Der Vater aber beachtet seine Kinder nicht, zudem ist die Fami-
lie unvollstndig: die Mutter fehlt. In dieser Figurengruppe sind bereits
17
M***: Revue critique des productions de peinture, sculpture et gravure, exposes au Salon
de 1824. Paris 1825, S. 5, zitiert nach Athanassoglou-Kallmyer: French images, S. 31.
18
Delacroix presents a range of familial relationships and ages, intimating a tragic
terminus to an allegory of the stages of life; vgl. Fraser: Delacroix, S. 39.
19
P.A.: Notice sur lexposition des tableaux en 1824. Deuxime article: Peinture
historique, in: Revue encyclopdique 24/1824, 70, S. 1840, hier S. 38f.
140 Ekaterini Kepetzis
drei wesentliche Aspekte angelegt, welche von den im Anschlu entstan-
denen und hier thematisierten Darstellungen des Freiheitskampfes auf-
gegriffen werden: Teile der Familien fehlen oder sind als Tote gezeigt, El-
tern knnen ihrer Rolle als Frsorger nicht mehr nachkommen und
umgekehrt bernehmen bisweilen Kinder diese Aufgabe.
Aus der Flle des Materials seien zunchst drei Werke beispielhaft vor-
gestellt, die zum einen die Adaption und visuelle Umsetzung der oben
angesprochenen, mit dem Freiheitskampf der Griechen verbundenen
Argumentationsfelder Christentum gegen Islam sowie Zivilisation
gegen Barbarei charakterisieren und zum anderen verdeutlichen, wie
das Motiv der Familie dabei zum Tragen kommt.
In Michel Philibert Genods (17961862) Schwur des jungen Kmpfers
lagert eine vierkpfige Familie unter einer Baumgruppe (Abb. 2).
20
Im
linken Vordergrund sitzt der Vater auf dem Bruchstck eines antiken
Tempelgeblks. Sein rechtes Bein ist ausgestreckt, oberhalb des Kn-
chels trgt er einen blutbefleckten Verband. Obschon den gekrmmten
Degen noch in der Hand, wird er den Kampf nicht fortsetzen knnen.
Diese Aufgabe fllt nun der nchsten Generation zu: Der Vater verweist
seinen kaum dem Kindesalter entwachsenen Sohn, der bereits ein Ge-
wehr hlt, auf ein rechts aufgepflanztes Kreuz. Dieses scheint aus einem
weiteren Geblkstck zu erwachsen. Dahinter lodernde Flammen, die
auf eine im Gange befindliche kriegerische Auseinandersetzung hindeu-
ten. Zwischen und hinter der interagierenden Vater-Sohn-Gruppe sitzen
die weinende Mutter und die kleine Tochter, die sich dem Betrachter zu-
wendet.
Die antiken Artefakte setzen die in der Gegenwart angesiedelte Szene
zur glorreichen Vergangenheit Griechenlands in Beziehung. Allerdings
sind diese nurmehr inmitten einer Naturlandschaft verstreute Trmmer
und damit bloe Reminiszenz an die historische Bedeutung von Hellas.
Abweichend von dem durch Winckelmanns Schriften in der zweiten
Hlfte des 18. Jahrhunderts initiierten Idealbild einer kulturellen wie
sozio-politischen Bltezeit im antiken Griechenland begannen sich die
Literaten und Knstler seit 1821 verstrkt den zeitgenssischen Griechen
20
50 55 cm; Athen, Privatsammlung. Eine weitere Fassung des Gemldes in der
Sammlung N. Dikaios in Lyon ist abgebildet in: Athanassoglou-Kallmyer: French
images, S. 20, Abb. 5. Zu dem Lyoneser Maler Genod vgl. Chaudonneret, Marie-
Claude: Genod, Michel Philibert, in: Saur. Allgemeines Knstlerlexikon, Bd. 51.
Mnchen, Leipzig 2006, S. 350f.
Familien im Krieg 141
zuzuwenden.
21
Vor allem liberale Schriftsteller und Kunstkritiker be-
saen kaum noch Interesse an den immer gleichen Paradigmen der
antiken Geschichte, die noch die Dramen und Historienbilder der Vor-
gngergeneration dominiert hatten.
22
Beispielhaft schreibt Auguste Jal
(17951873) im Jahre 1824:
21
Vgl. dazu meinen Aufsatz ,Griechenland ist grulich schn Carl Rott-
manns Griechenland-Rezeption, in: Horst-Dieter Blume/Cay Lienau (Hrsg.):
Deutsch-Griechische Begegnungen seit der Aufklrung. Mnster 2007, S. 6590.
22
Bereits in den 1790er Jahren hatte es erste Vorste gegeben, das Primat der mit
dem Absolutismus assoziierten Historie sowie der von der Antike inspirierten
Themen zugunsten von zeitgenssischen Sujets zu durchbrechen; vgl. Sandt,
Udolpho van de: ,Grandissima opera del pittore sar listoria. Notes sur la hir-
archie des genres sous la rvolution, in: Revue de lart 83/1989, 1, S. 7176; White-
ley, Jon: Art, hirarchie et Rvolution franaise, in: Georges Roque (Hrsg.): Ma-
jeur ou mineur? Les Hirarchies en Art. Nmes 2000, S. 6777.
Abb. 2: Michel Philibert Genod: Der Schwur des jungen Kmpfers, 1825,
Privatsammlung
142 Ekaterini Kepetzis
Je ne men plains pas, au surplus, jai assez des vieux Grecs; ce sont les Grecs mo-
dernes qui mintressent. Hector, Achille, Agamemnon me fatiguent de leur subli-
mit; Georges, Colocotroni, Odyssus, Jorgaki, voil les noms qui retentissent dans
mon cur . Salut toi, Hellenic, jeune et fire, qui sors de ton berceau en ruines
aux cris de patrie et de libert! Et toi, Rome des Dcius! cesse de me poursuivre.
23
Zwar verweisen die antiken Artefakte in Genods Gemlde auf die antike
Vergangenheit als zeitlich entferntes Fundament der griechischen Ge-
genwart, jedoch liegt der eigentliche Fokus auf den Figuren sowie auf
dem mit einem Kranz geschmckten Kreuz, durch welches der Krieg im
Sinne seiner zeitgenssischen Charakterisierung als Kampf des Chri-
stentums gegen den Islam aufgefat wird. Die durch den zweifachen
Zeigegestus von Vater und Sohn unterstrichene Bedeutung des Glau-
benssymbols wird noch dadurch verstrkt, da der im Bildtitel ange-
sprochene Schwur des Jungen (an Stelle des verwundeten Vaters den
Kampf gegen die Ottomanen weiterzufhren) offensichtlich auf dieses
Zeichen der christlichen Religion geleistet wird.
Entsprechend argumentiert noch das mit A. Jacqume signierte
Gemlde Abschied eines Freiwilligen aus dem Jahre 1837 (Abb. 3).
24
Im
Zentrum der schlichten Stube stehend segnet der gen Himmel blickende
Vater seinen erwachsenen Sohn, der sich bereit macht in den Freiheits-
krieg zu ziehen. An der Trschwelle auf ein Knie gesunken hlt er eine
Standarte mit einer Kreuzesfahne. Diese ist mit der Inschrift versehen:
Tutto nika dieses [Zeichen] wird siegen. Gleich doppelt begibt sich der
knftige Streiter der griechischen Erhebung damit unter den Schutz des
christlichen Glaubens: zum einen durch den vterlichen Segen, zum an-
deren durch das Zeichen des Kreuzes. Links vom Vater steht die wei-
nende Frau des jungen Kmpfers, die von ihrer Tochter getrstet wird.
Zwischen Vater und Sohn applaudiert der vielleicht fnfjhrige Enkel
des alten Mannes dem bevorstehenden Aufbruch seines Vaters. Durch
die geffnete Tr rechts sieht man weitere Kmpfer am Haus der Familie
vorbeiziehen.
Deutlicher noch als im vorherigen Beispiel wird die Bildaussage mit-
tels einer Bezugnahme auf Motive der Genremalerei zum Ausdruck ge-
bracht. Somit untersttzt das seit den 1820er Jahren verstrkt kritisierte
23
Jal, Auguste: Lartiste et le philosophe. Entretiens critiques sur le salon de 1824. Paris
1824, S. 13. Zu Jal vgl. Kohle, Hubertus: Kunstkritik als Revolutionsverarbei-
tung. Das Beispiel Auguste Jal, in: Gudrun Gersmann/ders. (Hrsg.): Frankreich
18151830: Trauma oder Utopie? Stuttgart 1993, S. 171186.
24
89 112 cm; Athen, Privatsammlung. ber den Maler dieses Werkes ist leider
nichts herauszufinden.
Familien im Krieg 143
Phnomen einer Kontaminierung der Historie durch das Genre die
Zielrichtung der hier untersuchten Darstellungen. Der Maler orientierte
sich offenkundig an der Komposition des Gemldes Der Fluch des Vaters
von Jean Baptiste Greuze (17251805), dem bekanntesten franzsischen
Genremaler des 18. Jahrhunderts.
25
Auch hier wird der Sohn, von Mut-
ter und Schwestern beklagt, in den Krieg ziehen. Wiederum erscheint
rechts die geffnete Tr, wo nun allerdings ein Werber steht, der den
jungen Mann ins Verderben fhren wird. Umsonst protestieren die Fa-
milienmitglieder gegen den Plan des Mannes, sich dieser zwielichtigen
Gestalt anzuschlieen. Jacqume hat die dargestellte Disposition der
Szene adaptiert, jedoch ihre Aussage ins Gegenteil verkehrt: Hier wird
der Sohn mit dem Segen des Vaters in einen gerechten Krieg ziehen, und
statt des dubiosen Anwerbers sieht man im Hintergrund den Aufbruch
freier Brger. Ebenso fllt auf, da sich die Familie von fnf auf nur
mehr zwei Kinder verringert hat. Darauf wird zurckzukommen sein.
25
130 162 cm, 1777; Paris, Muse du Louvre.
Abb. 3: A. Jacqume: Abschied eines Freiwilligen, 1837, Athen, Privatsammlung
144 Ekaterini Kepetzis
Sowohl Genods als auch Jacqumes Gemlde rekurrieren auf die aus
der franzsischen Malerei der zweiten Hlfte des 18. Jahrhunderts ver-
traute Dialektik der beiden Geschlechter. Die schon in Greuzes Fluch des
Vaters deutlich werdende Kontrastierung der flehentlich klagenden
Frauen und Kinder einerseits mit dem verfluchenden Vater andererseits
findet eine pathetische Steigerung in Jacques-Louis Davids (17481825)
vorrevolutionren Historien Der Schwur der Horatier (1784) und Die Lik-
toren bringen Brutus die Leichen seiner Shne (1789).
26
In beiden Gemlden
wird jeweils in der rechten Bildhlfte den unter Missachtung der priva-
ten Opfer zum Wohle des Vaterlandes aktiv agierenden Mnnern eine
Gruppe passiv klagender Frauen und Mdchen gegenber gestellt, die
offenkundig nur an das zu erwartende oder bereits eingetretene Leid ih-
rer Familien denken. Dieses im Sinne der Zeit geschlechtskonforme und
in der Malerei der Vorgngergenerationen paradigmatisch umgesetzte
Bildmuster aufgreifend, tragen Genod wie Jacqume ihre visuelle Argu-
mentation vor: Mnner und Jungen nehmen aktiv am Kampf teil,
Frauen und Mdchen sind dessen Opfer.
Derartige Szenen sind als bildknstlerische Umsetzung der Hoffnung
zu verstehen, da die jngere Generation den Freiheitskrieg unter dem
Zeichen des Kreuzes fortsetzen werde.
27
Angesichts des fr die Griechen
ungnstigen Kriegsverlaufs erscheinen in der franzsischen Malerei an-
stelle heroischer Kmpfer jedoch zunehmend fragmentierte Familien als
verzweifelte, sinnlos aufbegehrende Opfer und das geschlechtskon-
forme Verhalten der Dargestellten wird aufgegeben.
In Ary Scheffers (17951858) Gemlde Junger Grieche verteidigt seinen
Vater sind die tradierten Rollen von Beschtzer und Schutzbefohlenem
vertauscht (Abb. 4):
28
Der Knabe steht breitbeinig ber seinem verwun-
det zu Boden gesunkenen Vater und schiet auf den fr den Betrachter
26
Horatier: 330 425 cm; Brutus: 323 422 cm; beide Paris, Muse du Louvre.
27
Sie erschpfen sich eben gerade nicht in einem topischen Appell an das Auftreten
einer mchtigen franzsischen Vaterfigur, die den Kampf an Stelle der wehrlo-
sen Griechen fortsetzen mge, wie Fraser: Delacroix, S. 69, postuliert.
28
45 37 cm; Athen, Benaki-Museum. Zu dem in Dodrecht geborenen Schler
Pierre-Narcisse Gurins vgl. Ewals, Leo: Ary Scheffer, 1795 * 1858. Gevierd Romanti-
cus. Ausst.-Kat. Dordrecht 199596; ders.: Scheffer, Ary, in: Jane Turner (Hrsg.):
Dictionary of Art, 34 Bde. Bd. 28. London, New York 1996, S. 67f. Auch in Schef-
fers um 1825 entstandenen Gemlde Die Flchtlinge aus Parga (Amsterdam, Histo-
risches Museum) liegt der Fokus auf einer Familie und natrlich zeigt Scheffers
Hauptwerk zur griechischen Erhebung, Die Frauen von Souli (1827, Paris, Muse du
Louvre), das Leiden der griechischen Frauen und Kinder unmittelbar vor ihrem
kollektiven Freitod; vgl. Ewals: Ary Scheffer, 1795 * 1858, Kat. 22, S. 124128.
Familien im Krieg 145
Abb. 4: Ary Scheffer: Junger Grieche verteidigt seinen Vater, 1827, Athen,
Benaki-Museum
146 Ekaterini Kepetzis
unsichtbaren Feind. Wie populr solche Darstellungen des Unabhngig-
keitskampfes waren, zeigt sich daran, da von Scheffers Gemlde nicht
nur Lithographien und Stiche angefertigt wurden, sondern da dieses
sogar Verwendung als Dekor von Porzellanvasen und Mbelbezgen
fand.
29
In Franois-mile de Lansacs (18031890) Szene aus dem Auszug von
Missolonghi von 1828 ist der Mann als traditioneller Beschtzer der Fa-
milie bereits umgekommen (Abb. 5).
30
Die Mutter sah sich gezwungen
ihren Sohn eigenhndig zu tten, um zu verhindern, da er dem Feind
in die Hnde fllt. Nun wird sie sich selbst mit dem noch blutbefleck-
ten Dolch umbringen. Hier ist die traditionelle Rollenverteilung aufge-
hoben, die in den beiden eingangs analysierten Darstellungen noch ge-
wahrt blieb: Die Frau tritt an Stelle des Mannes als Kmpferin auf,
31
zu-
gleich wird ihre Aufgabe als Beschtzerin der heranwachsenden
Generation ad absurdum gefhrt.
In diesen Bildern wurden die in der internationalen Presse aus dem
griechischen Freiheitskampf gefhrt unter dem Schlachtruf Elevtheria
i Thanatos, Freiheit oder Tod berichteten Vorkommnisse von Massen-
selbstmord und Freitod aufgegriffen und zu Ikonen heroischer Ent-
schlossenheit verdichtet, die an das Mitgefhl des Betrachters appellier-
ten. Da diese visuellen Verbildlichungen des Krieges geeignet waren,
den Betrachter emotional zu rhren, war allgemein akzeptiert, wie fol-
gende Passage aus Jals Vorwort seiner Besprechung des Salons von 1824
beispielhaft demonstriert. Die Malerei so Jal sei geeignet,
[] rveiller dans le cur des citoyens lamour de la patrie, lhrosme filial,
le dvouement maternel, la passion du travail et de lordre, [], enfin tous les
sentimens gnreux qui font grandes les socits, que loubli de ces choses rend
petites.
32
Diese seit Jahrhunderten tradierte berzeugung wurde jedoch in den
hier betrachteten Bildern der griechischen Erhebung in einer Form pr-
29
Dazu Beispiele in Ausst.-Kat. Grce en revolte, Kat. 107109, S. 238f.
30
200 238 cm; Missolonghi, Pinakothek. Lansac war u. a. Schler Scheffers und
stellte bis ins Jahr 1878 im Pariser Salon aus; vgl. Ausst.-Kat. Grce en revolte, Kat.
54, S. 168.
31
In derartigen Darstellungen sowie in den zahlreichen Verbildlichungen griechi-
scher Freiheitskmpferinnen wie Assimo Lidoriki, der Heldin der Akropolis,
oder der berhmten Laskarina Bouboulina findet sich keine Spur der von Fraser:
Delacroix, S. 70f. postulierten ausschlielichen Opferrolle von Frauen in den
Kmpfen wie in deren visuellen Verbildlichungen.
32
Vgl. Jal: Lartiste, S. XXI.
Familien im Krieg 147
Abb. 5: Franois-mile de Lansac: Szene aus dem Auszug von Missolonghi, 1828,
Missolonghi, Pinakothek
148 Ekaterini Kepetzis
sentiert, die von frheren bildknstlerischen Umsetzungen kriegerischer
Auseinandersetzungen signifikant abweicht. Zum einen wurde durch
die oben erwhnte verstrkte Inkorporierung genrehafter Elemente in
Werke, welche als Kriegsdarstellungen eigentlich der Historie angeh-
ren, die tradierte Idealisierung der hchsten Bildgattung aufgebrochen,
diese so der eigenen Lebenswirklichkeit des Betrachters angenhert und
teilweise sogar sentimentalisiert. Delacroix schreibt im Hinblick auf die
erhoffte Wirkung des Massakers in seinem Tagebuch:
sourire dun mourant! Coup dil maternel! Etreintes du dsespoir, domaine
prcieux de la peinture! Silencieuse puissance qui ne parle dabord quaux yeux,
et qui gagne et sempare de toutes les facults de lme!
33
Zum anderen wurde in der Prsentation der nicht der eigenen Nation
angehrenden Leidtragenden auf die bliche Konfrontation von Ttern
und Opfern verzichtet. Wie eine knappe Gegenberstellung belegt, mar-
kieren diese Gemlde den Beginn einer neuen Phase in der Ikonographie
des Krieges.
2. Traditionelle Darstellungen des Krieges
Wie Kriege waren, das knnen weder schriftliche Zeugnisse, noch Bilder oder
Filme vermitteln, aber sie zeigen, wie Kriege gesehen wurden. Die Sichtweisen auf
das kriegerische Geschehen unterliegen dabei den verschiedensten Einschreibun-
gen: den jeweiligen kulturellen oder nationalen Realittskonstruktionen, den tra-
dierten und immer wieder korrigierten bzw. neu formulierten Darstellungssche-
mata, [] und nicht zuletzt den je spezifischen Darstellungsmglichkeiten der
Medien selbst.
34
Anstelle einer allgemeinen Zusammenschau des Themas Krieg in der
bildenden Kunst, die hier nicht geleistet werden kann und zudem an der
Zielrichtung meiner Argumentation vorbei ginge, konzentriere ich mich
im Folgenden auf Darstellungen der negativen Auswirkungen von Krie-
gen in der Malerei; drei Beispiele sollen zur Charakterisierung der gene-
rellen Typen einer Verbildlichung negativer Kriegsfolgen gengen.
35
33
Vgl. Joubin, Andr (Hrsg.): Journal de Eugne Delacroix. Tome premier 18221852.
Paris 1932, S. 96 (Eintrag vom 9. Mai 1824).
34
Vgl. Kppen: Das Entsetzen, S. 1.
35
Die zu Rubens, Callot und Goya publizierte Literatur bertrifft das im vorliegen-
den Rahmen Darstellbare. Da es hier lediglich um eine exemplarische Typologie
geht, sei auf eine formelle Auflistung entsprechender Titel verzichtet. Eine
knappe Typisierung von Kriegsdarstellungen bei Paul: Bilder, S. 2831.
Familien im Krieg 149
Einerseits finden sich mythologisch-allegorisch verbrmte Bilder wie
Peter Paul Rubens (15771640) ca. 163738 entstandenes Gemlde Die
Schrecken des Krieges.
36
Konzipiert als diplomatischer Appell an die Herr-
schenden sollte dieses Bild helfen, ein Ende des Dreiigjhrigen Krieges
herbeizufhren. Sinnbilder des Wohlstandes, der Wissenschaften und
Knste liegen zerbrochen am Boden, im Bildzentrum versucht Venus
vergebens, den Kriegsgott Mars zurckzuhalten. Schon die allegorische
Rhetorik des Bildes ist auf einer von den hier diskutierten Darstellungen
diametral abweichenden Stilhhe angesiedelt und zielt auf eine die Ra-
tio ansprechende berzeugung der Verantwortlichen anstelle auf eine
an das Mitgefhl des Betrachters appellierende Parallelisierung des Ge-
zeigten mit dem eigenen Leben.
Andererseits gibt es ,realistisch erscheinende Bilder, in denen z. B.
die Folgen fr die Zivilbevlkerung gezeigt werden: Jacques Callots
(15921635) Radierung Plnderung eines Gutshofs aus der 1633 verffent-
lichten, 18teiligen Serie Les Grandes Misres de la guerre zeigt eine Solda-
teska, die mordet, foltert, vergewaltigt und brandschatzt. Durch die
Kleinteiligkeit der Szene treten die einzelnen Greueltaten und damit die
anonymen Opfer in den Hintergrund. Auch die unterhalb des Blattes er-
scheinenden Verse
Voyl les beaux exploits de ces curs inhumans
Ils ravagent par tout rien nchappe a leurs mains
Lun pour avoir de lor, invente des supplices,
Lautre mil foys faiets anime ses complices;
Et tous dun mesme accord commettent mchamment
Le vol, le rapt, le meurtre, et le violement.
37
thematisieren nicht die Leiden der Zivilisten, sondern ausschlielich die
Verbrechen der Tter. Dies entspricht der Ausrichtung der Bildfolge, die
in Beschreibungen und Inventaren des 17. und 18. Jahrhunderts unter
der Bezeichnung La vie des soldats erscheint und in der es um das ad-
quate Verhalten von Truppen im Krieg geht. Konsequenterweise wird
die Plnderung des Gutshofes auch marodierenden Soldaten zur Last
gelegt, die im Fortgang der Serie von Teilen der regulren Armee ergrif-
fen und zur Rechenschaft gezogen werden.
38
Callots Blatt ist demnach
36
206 342 cm; Florenz, Galleria Palatina (Palazzo Pitti).
37
Chon, Paulette: Jacques Callot 15921635. Ausst.-Kat. Muse Historique Lorrain,
Nancy, 1992. Paris 1992, Kat. 511, S. 404.
38
Chon, Paulette: Les Misres de la guere ou ,la vie du soldat: la force et le droit,
in: dies.: Jacques Callot, S. 396400.
150 Ekaterini Kepetzis
kein pauschal gegen den Krieg gerichtetes Bild, sondern dient im Rah-
men der Narration des Zyklus der Prsentation eines negativen exem-
plums, welches sich infolge des Abgehens von den Regeln guter Kriegs-
fhrung ergibt.
In Francisco de Goyas (17461828) Erschieung der Aufstndischen
vom 3. Mai 1808 (1814) fhrt ein gesichtsloses Exekutionskommando
Erschieungen durch.
39
Der ins Bildzentrum gesetzte Mann im weien
Hemd wird zur Appellationsfigur fr den Betrachter. Goyas Bild ist be-
kanntermaen eine Huldigung an die als Mrtyrer aufgefaten spani-
schen Opfer des brutalen Vorgehens der napoleonischen Truppen wie
an die siegreiche Monarchie; es ist zudem retrospektiv, nach den Ereig-
nissen entstanden, besitzt daher eine Erinnerungs- und Verweisfunktion.
Jedoch liegt der Fokus hier auf der Konfrontation von Ttern und
Opfern. Auch in den Radierungen aus Goyas um 1810 und um 1820 ent-
standener, aber erst 1863 publizierter Serie Desastres de la Guerra steht
zumeist die Gegenberstellung von franzsischen Soldaten und spani-
schen Freiheitskmpfern bzw. der Zivilbevlkerung im Mittelpunkt.
So ist Janzing zwar zuzustimmen, da Goyas Szenen zum Verhalten der
napoleonischen Truppen in Spanien einen asymmetrischen Gewalt-
konflikt im Sinne einer ungleichen Krfteverteilung zwischen Partisanen
und gesichtslosen Soldaten als Teil einer berlegenen Kriegsmaschinerie
zeigen.
40
Jedoch bleibt die Symmetrie in gewisser Weise dadurch erhal-
ten, da Goya in der Regel beide Seiten der Auseinandersetzung vorfhrt.
Die hier vorgestellten Gemlde der griechischen Erhebung sind zeit-
gleich mit den Ereignissen gemalt worden und galten nicht den Leiden
der eigenen Mitbrger. Vor allem aber verzichten sie auf die Darstellung
der Tter, so da eben keine binre Konfrontation der Gegner statt-
findet: Kmpferische Auseinandersetzungen sind in den Mittel- oder
Hintergrund verschoben und hufig durch Qualmwolken dem Blick des
Betrachters entzogen. Zumeist werden lediglich die Folgen vorhergegan-
gener kriegerischer Handlungen ins Bild gesetzt Leichen, Verwundete,
Traumatisierte. Bisweilen, wie z. B. bei Scheffer, stellt sich der Eindruck
ein, die Figuren auf dem Bild knnten ihre Gegner sehen; fr die Rezi-
39
266 345 cm; Madrid, Museo del Prado.
40
Janzing, Godehard: Bildstrategien asymmetrischer Gewaltkonflikte, in: Ikono-
graphie der Gewalt. Kritische Berichte 3/2005, 1, S. 2135, hier 24f. Vgl. auch ders.:
Die Geburt des Partisanen aus dem Geist der Graphik. Krieg als Caprichio bei
Francisco de Goya, in: Steffen Martus/Marina Mnkler/Werner Rcke (Hrsg.):
Schlachtfelder. Codierung von Gewalt im medialen Wandel. Berlin 2003, S. 5165.
Familien im Krieg 151
pienten vor dem Bild aber bleiben diese weitgehend unsichtbar und sind
nur aufgrund der Mimik der griechischen Opfer zu imaginieren.
41
Vor
diesem Hintergrund kann man von Darstellungen eines doppelt asym-
metrischen Gewaltkonfliktes sprechen: Die Griechen sind einerseits den
Osmanen eindeutig militrisch unterlegen, andererseits konzentrieren
sich die Maler allein auf die Prsentation der Opfer. Damit fehlt hier ein
wesentliches Element tradierter Kriegsdarstellungen, in denen der Feind
[] durch die Bilder der Verrohung, Unmenschlichkeit und Gier dia-
bolisiert [wird], um damit die eigene Sache und jede Schandtat gegen-
ber den Besiegten zu rechtfertigen.
42
Die Zielrichtung dieser Bilder weicht also signifikant von frheren Kriegs-
darstellungen ab, zumal an diesem Punkt erstmals die Parteinahme fr
einen geographisch weit entfernt ausgefochtenen Krieg vorliegt, dessen
Ausgang fr die franzsischen Knstler wie fr die zeitgenssischen Be-
trachter ihrer Werke keine unmittelbare Bedeutung hatte. Tatschlich
stand das Eintreten fr den Freiheitskampf der Griechen sogar im dezi-
dierten Gegensatz zur offiziellen Politik. Damit leiten diese Darstellun-
gen eine Entwicklung ein, an deren Ende die heutige Auseinanderset-
zung mit Kriegen steht zumindest in Europa und Nordamerika:
Being a spectator of calamities taking place in another country is a quintessential
modern experience, the cumulative offering by more than a century and a half s
worth of professional, specialized tourists known as journalists. Wars are now also
living room sights and sounds.
43
Mit diesen Gemlden wurde an das Mitgefhl des einzelnen Brgers
und ebenso einer internationalen Vlkergemeinschaft appelliert. Die
Reaktionen auf den in der internationalen Presse breit kommentierten
griechischen Freiheitskampf haben eine neue ra im Umgang mit inter-
nationalen Krisen und Katastrophen eingeleitet: In Westeuropa grnde-
ten engagierte Privatleute Schulen fr die Kriegswaisen oder Komitees,
die Sach- und Geldspenden an die griechischen Kmpfer und Flcht-
41
Wahrnehmungspsychologisch gehen solche Darstellungen im Vergleich mit
Delacroix Gemlden noch einen Schritt weiter, ist doch die Vorstellung hufig
schlimmer als die Realitt. Signifikanterweise taucht eine Prsentation zweier Par-
teien erst im Rahmen der Darstellungen auf, welche die Sieger der Schlacht von
Navarino 1827 in Auftrag geben sei es in der Konfrontation der befreiten Grie-
chen mit ihren Rettern oder der besiegten Ottomanen mit den siegreichen Ge-
nerlen.
42
Palm: Das Format, S. 77, 79.
43
Sontag, Susan: Regarding the pain of others. New York 2003, S. 16.
152 Ekaterini Kepetzis
linge weiterleiteten.
44
Benefizausstellungen wie die eingangs erwhnte
Schau in der Galerie LeBrun wurden organisiert; das dort eingenom-
mene Geld war dazu bestimmt, Frauen und Kinder freizukaufen, welche
nach der Einnahme Missolonghis versklavt worden waren. Auch Wohl-
ttigkeitskonzerte wurden veranstaltet, deren Programme auf den Anla
bezogen waren;
45
bis heute sind solche ,Events ein probates Mittel fr
das Aufbringen groer Geldsummen. In diesem Zusammenhang entwik-
kelten sich Formen einer internationalen Solidaritt, die sich an das Mit-
gefhl und die Verantwortung des einzelnen Brgers richteten. Anders
als klassisch-akademische Historienbilder und traditionelle Visualisie-
rungen kriegerischer Ereignisse, die in der Regel eine Lesart vorgeben
und fr deren Verstndnis insofern eine passive Rezeptionshaltung hin-
reichend war, erforderten die zur Debatte gestellten Gemlde einen ak-
tiven und politisch engagierten Betrachter, um die hier postulierte Wir-
kung entfalten zu knnen.
3. Eine neue Rezeptionshaltung
Im Gegensatz zu allegorischen Darstellungen wie denen von Rubens
wandten sich die Szenen des Freiheitskampfes nicht an die Herrschen-
den. Sie dienten auch nicht wie die Bilder Callots oder Goyas der retro-
spektiven Anprangerung von Fehlverhalten und Brutalitt. Sie appellier-
ten an das Mitgefhl des Einzelnen und an etwas, das eigentlich noch
nicht existierte: eine internationale Solidargemeinschaft. Dies fhrte zu
einer bisher in der Kunst unbekannten, auf ein neues Publikum ausge-
richteten Ikonographie des Krieges.
Im Verlauf des 18. Jahrhunderts begann sich im Kontext der Salon-
ausstellungen eine neue ffentlichkeit herauszukristallisieren,
46
die sich
44
Vgl. hierzu Hauser, Christoph: Anfnge brgerlicher Organisation: Philhellenismus
und Frhliberalismus in Sdwestdeutschland. Gttingen 1990.
45
Vgl. Lschburg, Winfried: Es blitzt das Schwert in Missolunghis Nacht. Die
Griechenkonzerte des Jahres 1826 im Spiegel der Presse, in: Jahrbuch Preuischer
Kulturbesitz 37/2000, S. 395406.
46
Noch immer grundlegend: Habermas, Jrgen: Strukturwandel der ffentlichkeit: Un-
tersuchungen zu einer Kategorie der brgerlichen Gesellschaft. Neuwied 1962. Eine kriti-
sche Beleuchtung von Habermas Thesen in Calhoun, Craig (Hrsg.): Habermas
and the public sphere. Cambridge, Mass., 1992. Zur Bedeutung der Pariser Salonaus-
stellungen fr die Herausbildung der ffentlichkeit vgl. Crow, Thomas: Painters
and public life in eighteenth century Paris. New Haven, London 1985, S. 122.
Familien im Krieg 153
nicht mehr aus den traditionellen Auftraggeberschichten Adel, Klerus
und Grobrgertum zusammensetzte und die man zu beeinflussen
suchte. Die Salonkritiken Denis Diderots (17121784), beispielsweise zu
Greuze, verdeutlichen, da sich diese Werke an ein brgerliches Publi-
kum richten sollten, dem didaktische, die patriarchalische Familien-
struktur hervorhebende exempla aus der eigenen Lebenswirklichkeit pr-
sentiert wurden. So schreibt der Kritiker angesichts einer Skizze von
Greuzes Vielgeliebter Mutter, die im Salon von 1765 gezeigt wurde:
Das ist vortrefflich, sowohl im Hinblick auf das Talent wie im Hinblick auf die
Sitten. Das predigt uns Kindersegen und schildert recht eindringlich das Glck
und den unschtzbaren Wert des huslichen Friedens. Das sagt jedem Mann, der
Seele und Verstand hat: ,Erhalte deine Familie im Wohlstand; zeuge Kinder mit
deiner Frau, so viele Kinder wie mglich; zeuge sie nur mit ihr und sei sicher, da
du dich dann zu Hause wohlfhlen wirst.
47
Das Auftreten des in den Schriften der Aufklrer und Enzyklopdisten
noch geforderten mndigen, fr das Gemeinwesen engagierten Staats-
brgers, der das neue Publikum solcher Werke und auch den Adressaten
der hier verhandelten Bilder darstellte, war in zweifacher Hinsicht ein
Produkt der Franzsischen Revolution: Einerseits handelte es sich da-
bei um die franzsischen citoyens, die aufgefordert waren, am Aufbau
und an der Verteidigung des neuen Staates gegen uere Bedrohungen
mitzuarbeiten. Andererseits galt dies ebenso fr die europischen Vl-
ker, die erst im Kampf gegen Napoleon ein Bewutsein fr die eigene
nationale Identitt entwickelten und begannen, eine Beteiligung an der
Politik zu fordern. Die von den Mchtigen als letztes Mittel der Abwehr
des Franzosenkaisers auf den Plan gerufenen Vlker, die eigenverant-
wortlichen Brger Europas, lieen sich nach 1815 auch durch die
Gleichgewichtspolitik Metternichs nicht mehr zurckdrngen.
In der Untersttzung des griechischen Freiheitskampfs sah die libe-
rale Opposition Frankreichs, in welcher auch alte Revolutionre und
Bonapartisten ihre neue politische Heimstatt fanden, die Chance, aus
der restriktiv-restaurativen Ordnung der Heiligen Allianz [] das
schwchste Glied, die Sultansherrschaft, herauszubrechen, um so das
47
Diderot, Denis: Salon von 1765, in: Ders.: sthetische Schriften. Aus dem Fran-
zsischen bersetzt von Friedrich Bassenge und Theodor Lcke. Mit einer Einlei-
tung von Friedrich Bassenge. 2 Bde. Bd. 1. Frankfurt a.M. 1968, S. 509634, hier
S. 577. Es kann nicht eindeutig festgestellt werden, welche Zeichnung Diderot
hier beschreibt; das 1769 ausgefhrte Gemlde (99 131 cm) befindet sich heute
in der Sammlung des Comte de la Viaza, Marquis de Laborde, in Madrid.
154 Ekaterini Kepetzis
Gesamtsystem zu erschttern.
48
Die von der Zensur behinderten
Gegner der Regierungspolitik nutzten bekanntermaen auch die Salon-
kritiken als Feld politischer Agitation gegen die Regierung Knig
Charles X.
49
Beispielsweise gipfelt Jals Besprechung von Delacroix
Massaker in einer Anklage gegen die Unttigkeit der franzsischen Poli-
tiker in der griechischen Sache:
Mais la libert vous fait peur, et vous ne voulez pas prendre parti dans sa querelle,
contre le despotisme oriental! [] Non, vous tes amis de loppression; vous
navez ni charit chrtienne, ni respect pour la loi qui ordonne de protger le mal-
heureux, ni amour de lhumanit!
50
Wichtige formale Bezugspunkte fr die hier untersuchten Familiensze-
nen waren bezeichnenderweise Darstellungen, die im Kontext der Fran-
zsischen Revolution und der napoleonischen Herrschaft entstanden
waren: In einem am 31. Mai 1826 verffentlichten Stich einer Mademoi-
selle Formentin, der junge Damen beim Spenden vor dem Pariser Comit
Grec zeigt,
51
hngt an der Wand im Hintergrund eine druckgraphische
Reproduktion nach Davids Gemlde Leonidas bei den Thermopylen.
52
In
48
Grimm, Gerhard: ,We are all Greeks. Griechenbegeisterung in Europa und
Bayern, in: Reinhold Baumstark (Hrsg.): Das neue Hellas: Griechen und Bayern zur
Zeit Ludwigs I. Ausst.-Kat. Mnchen, Bayerisches Nationalmuseum, 19992000.
Mnchen 1999, S. 2132, hier S. 28. hnliche internationale Aufmerksamkeit
wurde dem (im 19. Jahrhundert erfolglosen) Ringen um einen polnischen Natio-
nalstaat zuteil. Insbesondere in der Publizistik sind hier Parallelen zur Rezeption
des griechischen Freiheitskampfes zu verzeichnen. Hingegen finden zeitgenssi-
sche Ereignisse in Polen in den Bildmedien nur ein geringes Echo, der Fokus liegt
vor allem in den glorreichen Siegen des Mittelalters sowie in dem Aufstand von
Tadeusz Kosciuszo von 1794. Beide Themenkomplexe werden in Form traditio-
neller Historienbilder gezeigt; vgl. dazu Molik, Witold: ,Noch ist Polen nicht
verloren, in: Flacke Monika (Hrsg.): Mythen der Nationen: ein europisches Pan-
orama: Begleitband zur Ausstellung des Deutschen Historischen Museums 1998. Berlin
1998, S. 295320.
49
Vgl. Fraser: Delacroix, S. 95; Wrigley, Richard: The Origins of French Art Criticism
from the Ancien Rgime to the Restauration. Oxford 1993. In hnlicher Weise ver-
lagerte sich Charles Philipon (18001862), einer der fhrenden Publizisten der
1830er und 1840er Jahre, angesichts der Pressezensur auf Gesellschafts- und Kul-
tursatiren; vgl. dazu meinen Beitrag Honor Daumiers Histoire ancienne Ein
Kommentar zur Kulturpolitik und Gesellschaft der Julimonarchie, in: Roland
Kanz (Hrsg.): Das Komische in der Kunst. Kln, Weimar 2007, S. 161185.
50
Jal: Lartiste, S. 48f. Die gesamte Besprechung S. 4753.
51
Vgl. Athanassoglou-Kallmyer: French images, S. 61, Abb. 28.
52
395 531 cm; Paris, Muse du Louvre. Zur Signifikanz des Gemldes fr die
liberale Opposition der 1820er Jahre vgl. Athanassoglou-Kallmyer: Under the Sign
of Leonidas.
Familien im Krieg 155
den Stellungnahmen zur griechischen Erhebung war die Parallelsetzung
der modernen Hellenen mit dem Knig von Sparta und seinem he-
roischen Kampf ein topischer Vergleich. Diese Tatsache, ferner die allge-
meine Beachtung, die der griechischen Erhebung in der ffentlichkeit
geschenkt wurde sowie die Mglichkeit fixer lattention gnrale, dans
un moment o tout lintrt se tourne vers la Grce, drften die Grnde
gewesen sein, die den Stecher Laugier motivierten, eben im Jahre 1826
einen groformatigen Stich nach Davids Lonidas zu fertigen.
53
Ein wichtiges formales Vorbild fr die Maler der griechischen Er-
hebung war Pierre-Narcisse Gurins (17741833) Gemlde Marcus Sextus
vom 1799 (Abb. 6),
54
welches signifikanterweise ebenfalls auf der Aus-
stellung Au profit des Grecs gezeigt wurde, dem panorama de lart fran-
ais post-rvolutionnaire et imprial.
55
In Gurins Bild lehnt ein aus
dem Exil heimgekehrter Mann am Totenbett seiner Frau und starrt ins
Leere; der zu seinen Fen sitzenden Tochter, die seine Knie umklam-
mert, kann er keinen Trost bieten. Das vom Knstler eigens erfundene
antike Thema des Bildes verweist auf die nach der Terreur aus dem Exil
in ein verheertes Land zurckgekehrten Franzosen;
56
schon fr die Zeit-
genossen war die Wirkung insbesondere des gebrochenen Vaters be-
wegend. Noch am 24. Juni 1826 hebt ein anonymer Rezensent der
Schau in der Galerie LeBrun bei dieser Figur die lobenswerte expression
du proscrit, sa douleur concentre hervor.
57
Derartige Werke waren die
Anknpfungspunkte fr das Motiv der vom Krieg beeinfluten Fami-
53
Eine Ankndigung des Stiches findet sich in Revue encyclopdique 31/1826, 91,
S. 281. Bei dem Stecher handelt es sich wahrscheinlich um Jean-Nicolas Laugier
(17851875), einem Schler Girodets; vgl. den entsprechenden Eintrag in Bnzit,
Emmanuel: Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. 10 Bde. Bd. 6.
Repr. Paris 1976, S. 475.
54
217 243 cm; Paris, Muse du Louvre. Zu Gurin, dem Lehrer u. a. von Dela-
croix, Scheffer und Gricault, fehlt noch immer eine umfassende Monographie.
Einen berblick bietet Whiteley, Jon: Gurin, Pierre(-Narcisse), Baron, in: Tur-
ner: Dictionary of Art, Bd. 13, S. 791795. Vgl. auch Bordes, Philippe: La mort de
Brutus de Pierre-Narcisse Gurin. Vizille 1996.
55
Vgl. Martin: LExposition, S. 96.
56
Wie mit Hilfe antiker Themen die Situation der in den 1790er Jahren ins Exil
geschickten Franzosen visuell kommentiert wurde, zeigt Rubin, James Henry:
Oedipus, Antigone and Exiles in Post-Revolutionary French Painting, in:
The Art Quarterly 36/1973, S. 141171.
57
Ch. . . . . .: Beaux-Arts. Exposition de tableaux au profit des Grecs, rue du Gros-
Chenet, n. 4, in: Gazette de France 175/1826 (24. Juni), o. S. Die Zeitung ist nicht
paginiert; das Zitat befindet sich auf der letzten Seite der Nummer.
156 Ekaterini Kepetzis
lien; auf die Heranziehung of ancient history as allegory related to cur-
rent events, einem key element in both the theater and the painting of
the French Revolution,
58
wurde dabei allerdings auffllig verzichtet.
Gurins Gemlde besitzt offensichtlich Modellcharakter fr die oben
charakterisierte Familiengruppe im linken Vordergrund von Delacroix
Massaker von Chios. Der Maler erwhnt unter dem 30. Dezember 1823 in
seinem Tagebuch, er habe Gurins Marcus Sextus gesehen, am 12. Januar
1824 vermerkt er an gleicher Stelle den Beginn seiner Arbeit an dem
Gemlde zum Massaker.
59
Es steht zu vermuten, da sich die Adaption
dieser Figur nicht nur in formalen Anleihen niederschlug; die zeitgens-
sischen Betrachter fanden die Akteure des weit entfernten Freiheits-
kampfes vielmehr in Bildformeln gesetzt, die ihnen von der Darstellung
58
Rubin: Oedipus, S. 146.
59
Joubin: Journal, S. 39 (Gurin) und 45 (Arbeit am Massaker beginnt).
Abb. 6: Pierre-Narcisse Gurin: Die Rckkehr des Marcus Sextus, 1799, Paris, Louvre
Familien im Krieg 157
ihrer eigenen Landsleute her vertraut waren und in einem eindeutigen
politischen Kontext standen, denn: Mit der bernahme figurativer
Konfigurationen geht gewollt oder ungewollt auch der Transfer s-
thetischer und moralischer Wertmastbe einher.
60
Symptomatisch fr die hier konstatierte Signifikanz von Gurins Bild
ist auch Vinchons eingangs erwhntes, auf dem Salon von 1827 prsen-
tiertes Werk Nach dem Massaker von Samothrake (Abb. 7). Der Fokus der
60
Janzing: Bildstrategien, S. 22. Die Adaption tradierter Bildformeln zur Visualisie-
rung bzw. Zuspitzung tagespolitischen Geschehens findet sich wiederholt im Zu-
sammengang mit Darstellungen aus dem griechischen Unabhngigkeitskampf,
vgl. z. B. Gilbert He Ausfhrungen zu dem 1826 entstandenen Gemlde
Der Tod Byrons (166 234,5 cm; Groeninge Museum, Brgge) von dem Da-
vid-Schler Joseph-Denis Odevaere (17761830) in: Missolunghi. Gense, trans-
formations multimdiales et fonctions dun lieu identitaire du philhellnisme,
in: Revue Germanique Internationale 12/2005: Philhellnismes et transferts cultu-
rels dans lEurope du XIXe sicle. Paris 2005, S. 77107, hier S. 89.
Abb. 7: Auguste Jean-Baptiste Vinchon: Modernes griechisches Thema
Nach dem Massaker von Samothrake, 1827, Paris, Louvre
158 Ekaterini Kepetzis
Darstellung liegt wiederum auf einer von den Geschehnissen des Frei-
heitskampfes zerstrten Familie; entsprechend der vom Maler fr das
livret des Salons verfate Begleittext:
Un vieillard, assis sur les ruines de sa maison incendie, et prs du corps de sa fille
qui vient dtre tue dans le massacre de lle de Samothracia, tient dans ses bras
lenfant quelle allaitait.
61
Der alte Grieche, der vor seinem brennenden Haus sitzt, berhrt mit der
linken Hand seine tote Tochter; den Enkel an sich gedrckt, starrt er zu
Boden. Im linken Mittelgrund erkennt man einen buchlings niederge-
fallenen Mann, in dem zeitgenssische Quellen den Schwiegersohn des
Alten vermuteten. Die mit der Rechten noch gehaltene Pistole zeigt,
da dieser offensichtlich beim vergeblichen Versuch ums Leben gekom-
men ist, Frau und Sohn zu verteidigen. Isoliert und monumentalisiert
wird der alte Mann, der seine Familie ebenfalls nicht hatte schtzen
knnen, zu einer berlebensgroen Allegorie der Trauer und Verzweif-
lung, vergleichbar dem aus dem Exil heimgekehrten Marcus Sextus.
Schilderungen ber solche Personen und Ereignisse teilweise in
Form von Augenzeugenberichten berlebender, teilweise in fiktiona-
lisierter Bearbeitung fanden sich in diesen Jahren fast tglich in der eu-
ropischen Presse und Literatur.
62
In Paganels Text Le Tombeau de Marcos
Botzaris beispielsweise berichtet ein als alter ego des Autors fungierender
franzsischer Reisender, er habe auerhalb der Stadt Missolonghi
am Grab des griechischen Freiheitshelden Marcos Botzaris (17901823)
einen trauernden Alten vorgefunden, und stellt fest: la douleur dun
vieillard a quelque chose de touchant qui rclame le respect.
63
Der alte
Mann namens Xnocls erzhlt dem Franzosen seine Lebensgeschichte
und schildert ihm das Leid, das er infolge der Taten der Osmanen erlit-
ten habe: Jai tout perdu, pouse, enfans, amis; les Turks ont tout mas-
sacr [].
64
Nach dem Massaker habe Xnocls auch Chios besucht,
wo er seine Kinder zum letzten Mal gesehen hatte, und schildert immer
wieder Greueltaten, die an Familien begangen wurden. So beschreibt er
jeunes filles, poignardes dans les bras maternels und mres, fendues
en deux coups de cimeterre, et le fruit de leur amour cras sans piti
61
Braud: Annales, S. 129.
62
Nicht umsonst verweist der dritte Teil des Titels von Delacroix Massaker Voir les
relations diverses et les journaux du temps auf den unmittelbareren Bezug des Bildes
zur Tagespresse.
63
Paganel: Le Tombeau, S. 6.
64
Ebd., S. 10.
Familien im Krieg 159
contre les murailles ou jet des chiens dvorans.
65
Derartige in zahlrei-
chen Variationen erschienene, die Leiden von Familien in den Fokus rk-
kende Texte und die entsprechenden Gemlde jener Jahre setzen einen
positiven Gegenentwurf voraus, um ihre ganze Wirkung zu entfalten.
4. Das neue Ideal der Familie
In der zweiten Hlfte des 18. Jahrhunderts wandelten sich die Konzepte
von Ehe, Familie und Kindheit. Unter dem Einflu naturrechtlicher
Vorstellungen erkannte man von staatlicher Seite aus den Garanten fr
stabile, gesellschaftspolitische Verhltnisse nicht mehr in der Haus- und
Hofgemeinschaft, sondern insbesondere in der gattenzentrierten Klein-
familie.
66
Zeitgleich propagierten die Aufklrer eine neue Bedeutung der
patriarchalisch strukturierten Kernfamilie als ,Keimzelle von Staat und
Gesellschaft,
67
innerhalb derer den Ehepartnern feste Rollen zugedacht
waren.
Gerade die Aufgaben der Frau und die Rolle des Kindes wurden hierbei
neu definiert: Die wahre Bestimmung und das Glck einer Frau lgen in
der Mutterschaft und im Bereitstellen eines komfortablen Heimes fr den
arbeitenden Familienvater. Dies reflektieren vor allem die Werke Jean
Jacques Rousseaus (17121778): Im Briefroman Julie ou la Nouvelle Helose
(1761) wird das Ideal der treusorgenden Gattin gefeiert, immile (1762) wer-
den die Maximen einer modernen Erziehung zum Staatsbrger formu-
liert. Dabei kam der Mutter als der Person, die den ersten prgenden Ein-
flu auf das Kind ausbte, entscheidende Bedeutung zu: Sie stillte es
selbst,
68
bildete es aus und sorgte fr ein sicheres und behtetes Umfeld.
69
65
Ebd., S. 25f.
66
Gestrich, Andreas: Neuzeit, in: ders./Jens-Uwe Krause/Michael Mitterauer
(Hrsg.): Geschichte der Familie. Stuttgart 2003, S. 364652, hier S. 375.
67
Ebd., S. 385.
68
Zum Stillen in der Malerei des 18. Jahrhunderts vgl. Ivinski, Patricia R./Payne,
Harry C./Galitz, Kathryn Calley u. a.: Farewell to the wet nurse: Etienne Aubry and
images of breast-feeding in eighteenth-century France. Ausst.-Kat. Williamstown, Mass.,
Sterling & Francine Clark Art Institute, 199899. Williamstown, Mass., 1998.
69
Zum Ideal der treuen Ehefrau und Mutter vgl. Mhrmann, Renate (Hrsg.): Ver-
klrt, verkitscht, vergessen: Die Mutter als sthetische Figur. Unter Mitarbeit von Bar-
bara Mrytz. Stuttgart 1996; Westhoff-Krummacher, Hildegard: Als die Frauen noch
sanft und engelsgleich waren: die Sicht der Frau in der Zeit der Aufklrung und des Bie-
dermeier. Ausst.-Kat. Mnster, Westflisches Landesmuseum fr Kunst und Kul-
turgeschichte, 199596. Mnster 1995.
160 Ekaterini Kepetzis
Obschon die sozialhistorische Familienforschung in den letzten
zwanzig Jahren nachweisen konnte, da sich entgegen frherer Annah-
men die Gre der Familien mit dem Beginn der Industriellen Revo-
lution nicht wesentlich verndert hatte,
70
war dies im Hinblick auf
die Wahrnehmung der Familie sehr wohl der Fall: In den Jahrzehnten um
1800 entstand das bis in die heutige Zeit hinein gltige Idealbild einer
vierkpfigen Kleinfamilie, innerhalb derer sich die ganze Anstrengung
der Eltern auf das Wohl ihrer Kinder konzentriert. Vor diesem sozial-
historischen Kontext wird auch die oben erwhnte Verringerung der
Kinderzahl zwischen Greuzes Fluch des Vaters und den hier verhandelten
Darstellungen verstndlich.
Die Bilder von Familien im Unabhngigkeitskrieg sind dennoch
keineswegs als ,realistische Darstellungen griechischer Familien zu deu-
ten. John Hajnal stellte 1965 fest, da Familiengre und soziale Zu-
sammensetzung von Haushalten in West- und Ost- bzw. Sdosteuropa
im hier interessierenden Zeitraum signifikant voneinander abwichen.
71
Hajnals heute weitgehend akzeptierte Konzeption belegt,
72
da westlich
einer ungefhr von St. Petersburg bis Triest verlaufenden imaginren
Grenze die Partner mit durchschnittlich ber 25 Jahren relativ spt
heirateten und viele Menschen unverheiratet blieben, whrend stlich
davon die Ehe frher geschlossen wurde, die Frau hufig deutlich jnger
als der Mann war und es zudem weniger unverheiratete Menschen gab.
Daraus resultierten hhere Kinderzahlen und grere Haushalte in
Sdosteuropa sowie schlielich die Dialektik eines simple houshold
system[s] mit einem joint household system.
73
Diese demographische Distribution legt nahe, da die hier zur De-
batte gestellten Darstellungen nicht die Familienstruktur im Griechen-
70
Zur Revision des Mythos der vorindustriellen Grofamilie in der jngeren For-
schung Gestrich: Neuzeit, S. 388f., S. 407.
71
Hajnal, John: European marriage patterns in perspective, in: David Victor
Glass/David E.C. Eversley (Hrsg): Population in history. Essays in historical demogra-
phy. London 1965, S. 101143.
72
Die jngere Forschung hebt lediglich die Existenz adaptierbarer Modelle innerhalb
dieses Rahmens strker hervor; vgl. Wall, Richard: Zum Wandel der Familien-
strukturen im Europa der Neuzeit, in: Josef Ehmer/Tamara K. Hareven/ders.
(Hrsg.): Historische Familienforschung: Ergebnisse und Kontroversen. Michael Mitterauer
zum 60. Geburtstag. Frankfurt a.M. 1997, S. 255282. Eine kritische Diskussion der
Rezeption von Hajnals Definition der Strukturen in Westeuropa als European
marriage pattern bei Todorova, Maria: Zum erkenntnistheoretischen Wert von
Familienmodellen. Der Balkan und die ,europische Familie , in: ebd., S. 283300.
73
Gestrich: Neuzeit, S. 410.
Familien im Krieg 161
land des 19. Jahrhunderts reflektieren, zumal soweit bekannt keiner
der Maler je selbst dorthin gereist war. Vielmehr sind diese Gemlde
als Projektionen westeuropischer bzw. franzsischer Familienstrukturen
zu betrachten; den intendierten Betrachtern wurden in diesen Bildern
unter Adaption formalstilistischer Modelle der Malerei des spteren
18. Jahrhunderts die eigene Lebensrealitt und deren mgliche, negative
Beeinflussung durch Kriege und ihre Folgen vor Augen gestellt. In Rck-
griff auf das im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts entwickelte Ideal der
Kleinfamilie diente dieser in den Gemlden vorgefhrte, durch Gewalt
bewirkte Bruch konsequenterweise als Auslser fr das bei den Be-
trachtern zu erzielende tatkrftige Mitgefhl. Konsequenterweise mu
man noch einen Schritt weiter gehen als Fraser, die im Hinblick auf
Delacroix Massaker den nominally ,universal appeal of family bonds,
grounding the image in supposedly imutable truths betont.
74
Vor dem Hintergrund der nach 1770 immer wieder in den Salons
gezeigten Gemlde familiren Glcks wird nun verstndlich,
75
warum so
viele Maler in ihren Bildern zum griechischen Freiheitskampf vom Krieg
zerstrte Kleinfamilien in den Mittelpunkt stellten: Erst die neuen Vor-
stellungen von der Kernfamilie, von der Rollenverteilung innerhalb der
Familie, kurz: von einem Ideal huslicher Idylle, erlauben die adquate
Deutung der vorliegenden Darstellungen.
76
ber das bisher Festgestellte hinausgehend spielen weitere kulturge-
schichtliche Faktoren fr die Konstituierung des Familienverstndnisses
und in der Folge fr die Wahrnehmung und Darstellung der idealen
Familie sowie dieser Gemlde eine Rolle: Im Anschlu an die bereits
von Aris beobachtete Fortentwicklung des Privatlebens und der hus-
lichen Intimitt
77
und in Korrelation zur Herausbildung der Sensibilit
74
Vgl. Fraser: Delacroix, S. 44.
75
Vgl. z. B. Duncan, Carol: Happy Mothers and Other New Ideas in French Art,
in: The Art Bulletin 55/1973, 4, S. 570583; Maza, Sarah: The ,Bourgeois Family
Revisited: Sentimentalism and Social Class in Prerevolutionary French Culture,
in: Richard Rand (Hrsg.): Intimate Encounters. Love and Domesticity in Eighteenth-
Century France. Princeton 1997, S. 3947.
76
Im Gegensatz zu den formaljuristischen Grundlagen, um deren Rckfhrung auf
den Status des ancien rgime sich die Regierungen in der Restaurationszeit bemh-
ten, wie Fraser: Delacroix, S. 52, postuliert, blieben eben diese Vorstellungen trotz
der diesbezglichen Versuche und Vorste whrend und im Zuge der Franzsi-
schen Revolution im Wesentlichen konstant.
77
Aris, Philippe: Geschichte der Kindheit. Mit einem Vorwort von Hartmut von Hen-
tig. Aus dem Franzsischen von Caroline Neubaur und Karin Kersten. Mnchen,
Wien
4
1975 (Original: Lenfant et la vie familiale sous lancien rgime. Paris 1960), S. 516f.
162 Ekaterini Kepetzis
im spteren 18. Jahrhundert wurde auch der Familiensinn immer strker
ausdifferenziert. Beispielsweise wurden Kinder zunchst in den oberen
und sodann auch in den mittleren Schichten der Gesellschaft nicht
mehr zu Ammen aufs Land geschickt, sondern man erstrebte eine Inte-
gration der Ammen in das Haus sofern berhaupt noch Fremde fr
diese Aufgabe heranzogen wurden.
78
Die in den Schriften der aufklre-
rischen Pdagogik geforderte liebevolle Zuwendung zum Kind und die
Aufwertung des Status der Familie spielte in der Literatur und Kunst fol-
gerichtig eine immer wichtigere Rolle.
79
Schlielich ist noch ein mentalittsgeschichtlicher Aspekt fr die
Wahrnehmung der Szenen aus dem griechischen Freiheitskampf von
Bedeutung: Seit dem 18. Jahrhundert wurden ffentlichkeit und Heim
als zwei einander diametral entgegengesetzte Sphren aufgefat. Im Ver-
lauf des 18. Jahrhunderts bildete sich anscheinend ein Bewutsein fr
die Intimitt des privaten Bereichs heraus, der von Auenstehenden zu
achten und mit Diskretion zu behandeln war:
80
People developed a new consciousness of private versus public life and a pressing
new need for a secure and tranquil sanctuary removed from the impersonal and
competitive relations that increasingly marked commercial and civic affairs.
81
Die in den Gemlden gezeigte negative Beeinflussung der Familien in-
folge des Krieges und die dort vorgefhrte Zerstrung des als Rckzugs-
ort und Hort der Sicherheit definierten Heims sind vor diesem Hinter-
78
Dieser Wandel fand nicht nur aufgrund der von Rousseau u. a. propagierten
neuen Aufgaben der Mutter statt, zu denen auch das Stillen der eigenen Kinder
zhlte; ebenso trug die Erkenntnis, da die Sterblichkeit von Suglingen, die zu
Ammen aufs Land verschickt wurden, deutlich hher lag als die von Kindern, die
in ihrer eigenen Familie aufwuchsen, dazu bei, die Einstellung zum Stillen zu n-
dern; vgl. Gestrich: Geschichte der Familie, S. 571575; Shorter, Edward: Der Wan-
del der Mutter-Kind-Beziehungen zu Beginn der Moderne, in: Jrgen Kocka
(Hrsg.): Soziale Schichtung und Mobilitt in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert.
Gttingen 1975, S. 256287, hier S. 263266.
79
Zum Einflu pdagogischer Literatur auf die Malerei vgl. z. B. Sloman, Susan:
,Innocence and health: nursing women in Gainsboroughs Cottage-door pain-
tings, in: Ann Bermingham (Hrsg.): Sensation and sensibility: viewing Gains-
boroughs Cottage door. Ausst.-Kat. New Haven, CT, Yale University, Yale Center
for British Art, 2005; San Marino, CA, Huntington Library, Art Gallery and
Botanical Gardens, 2006. New Haven, CT, 2005, S. 3751. Allgemein: Vavra, Eli-
sabeth (Hrsg.): Familie Ideal und Realitt. Ausst.-Kat. Riegersburg, Niederster-
reichische Landesausstellung, 1993. Horn 1993.
80
Aris: Geschichte der Kindheit, S. 549.
81
Duncan: Happy Mothers, S. 579. Aus sozialgeschichtlicher Sicht vgl. Shorter:
Der Wandel der Mutter-Kind-Beziehungen.
Familien im Krieg 163
grund als bergriff der ffentlichen in die private Sphre zu deuten,
welche fr die moderne Familie ein der Gesellschaft entgegengesetztes
Refugium geworden war.
82
5. Die Wirkmacht der Bilder
Die franzsischen Rezipienten dieser Werke betrachteten sich letztlich
also selbst und sollten auf diese Weise zu solidarischen Handlungen
bewegt werden. In einer Zeit, in der die Mutterliebe zum Mittelpunkt
des Sentiments wurde,
83
und aufgrund des in der Literatur, den moral-
philosophischen Schriften
84
sowie der Bildkunst seit Jahrzehnten propa-
gierten Familienideals muten die Szenen, in denen Vter verzweifeln,
Kinder kmpfen und Mtter morden, auf den zeitgenssischen Betrach-
ter erschtternd wirken. ber eben diese Erschtterung vollzog sich in
der Folge der neuartige Appell an tatkrftiges Mitgefhl, das den einzel-
nen Brger zum Handeln fr Griechenland aufforderte.
85
Dieses Han-
deln uerte sich in Form von Spenden, persnlichem Engagement
in Komitees, Mitarbeit beim Sammeln von Sachgtern, die nach Hellas
verschickt wurden, Aufnahme von Waisen und Flchtlingen u. . Die
verheerenden Niederlagen der Griechen sowie die in der europischen
Presse publizierten und in den Bildmedien propagierten tragischen Ein-
zelschicksale fhrten 1827 mit der Seeschlacht von Navarino schlielich
tatschlich zu der seit Jahren geforderten Intervention der europischen
Mchte England, Ruland und Frankreich in Griechenland.
82
Aris: Geschichte der Kindheit, S. 554. Die anfngliche Entpolitisierung von weiten
Teilen des Brgertums in den ersten Jahren der Restauration spielte dabei sicher-
lich eine Rolle.
83
Shorter, Edward: Die Geburt der modernen Familie. Hamburg 1977, S. 259.
84
Ein weiteres Indiz fr die zunehmende Beachtung, die dem Kind als frderungs-
wrdigem Individuum und sodann der Familie als zentraler Einrichtung des pri-
vaten Lebens geschenkt wurde, war die sukzessive Ablsung von Anleitungen
zum korrekten Benehmen fr Erwachsene hin zu Erziehungsschriften, die an El-
tern und Pdagogen gerichtet waren; vgl. Aris: Geschichte der Kindheit, S. 534537;
Rutschky, Katharina: Einleitung, in: dies. (Hrsg.): Schwarze Pdagogik. Quellen
zur Naturgeschichte der brgerlichen Erziehung. Berlin, Wien 1977, S. XVIILXXIV.
85
In der Literaturwissenschaft wurde fr den appellativen Charakter entsprechend
ausgerichteter Texte der Begriff der operativen Literatur geprgt; vgl. Peter
Stein: Operative Literatur, in: Gert Sautermeister/Ulrich Schmid (Hrsg.): Zwi-
schen Restauration und Revolution: 18151848. Mnchen 1998, S. 485504. Ich
danke Gilbert He fr diesen Hinweis.
164 Ekaterini Kepetzis
Die technischen Mglichkeiten moderner Kriegsfhrung, die Erfahrung
des globalen Charakters der beiden Weltkriege und die Unmenschlich-
keit menschlichen Verhaltens im 20. Jahrhundert haben nicht nur die
seit der Antike tradierte Doktrin des Krieges als ultima ratio der Politik
und als deren Fortfhrung mit anderen Mitteln nachhaltig erschttert;
sie haben die visuelle Darstellbarkeit des Grauens grundstzlich in Frage
gestellt. Die fotografische Dokumentation von Massakern und Leichen-
bergen, wiewohl vorgebildet in der Kunst, hat die Idee des Kriegs-
Erhabenen
86
gnzlich auer Kraft gesetzt. Zwar gehen bildknstlerische
Stellungnahmen wie z. B. diejenigen von Grosz, Dix oder Picasso von
konkreten Erlebnissen oder Ereignissen aus. Diese Bilder dienen aber
nicht mehr dazu, die Teilnahme an einem als gerecht empfundenen Kon-
flikt herbeizufhren, sie zielen auf die generelle Verurteilung des Krieges.
Jedoch bleibt die hier anllich des griechischen Freiheitskampfes
exemplifizierte Strategie, ber das Schicksal einzelner Familien die Not-
lage einer ganzen Nation oder Volksgruppe zu versinnbildlichen, noch
heute virulent. Der Fotograf Yannis Kontos (*1971) kommentiert seine
im Mai 2006 in Amsterdam mit dem World Press Photo Award ausge-
zeichnete Aufnahme Abu Bakarr Kargbos eines Vaters, dem whrend
des Brgerkrieges in Sierra Leone die Hnde abgehackt wurden und des-
sen siebenjhriger Sohn ihm das Hemd zuknpft wie folgt:
In Sierra Leone herrschte mehr als ein Jahrzehnt ein brutaler Brgerkrieg. Nach
dessen Ende im Jahr 2002 hat sich die Weltffentlichkeit aber nicht mehr dafr
interessiert []. In dem Krieg starben mehr als 75000 Menschen, 20000 wurden
ihre gesunden Gliedmae amputiert. Abu Bakarr Kargbo steht also stellvertretend
fr Tausende, die dasselbe Schicksal erlitten haben. Mit seinem Bild lsst sich die
ganze Brutalitt eines Brgerkrieges zeigen, der fr die westliche Welt sehr wenig
Bedeutung hat.
87
Dieses Zitat illustriert, wie durch das Bild einer einzelnen, als Opfer
eines Krieges charakterisierten Familie bis heute Aufmerksamkeit erregt
und Mitleid erzeugt wird. Die in der bildknstlerischer Rezeption des
griechischen Freiheitskampfes der 1820er Jahre entwickelten Strategien
visueller berzeugung sind demnach noch immer hchst wirksame Mit-
tel, die Anonymitt von Zahlen und Statistiken zu umgehen und den
Leiden der namenlosen Opfer ein Gesicht zu verleihen. Und ein Weite-
86
Vgl. Kppen: Das Entsetzen, S. 18.
87
Arzt, Ingo/Mathias Menzel: Wir fragen nicht. Wir schieen Bilder, in: Sd-
deutsche Zeitung, 11. 05. 2006; vgl. http://www.sueddeutsche.de/politik/89/
358914/text/ (Stand: 24. 04. 2009). Dort auch eine Abbildung des Fotos.
Familien im Krieg 165
res ist gleich geblieben: Gezeigt wird eine alltgliche Situation, die dem
Rezipienten vertraut ist und in die er sich demnach einzufhlen vermag.
Vermittels der durch die Einwirkung des Krieges gezeigten Beeinflus-
sung oder gar Zerstrung dieser Situation wird Betroffenheit erzielt, die
im Idealfall zu solidarischem Handeln fhrt. Somit kann abschlieend
die Paradoxie besttigt werden, da visuelle Authentizitt durch
Inszenierung, Virtualisierung bis hin zur Flschung gerade nicht dazu
fhrt, da die Bilder dadurch ihre [] Wirkmacht verlieren, im Gegen-
teil, sie werden als ein ,Handeln im Symbolischen mystifiziert und zum
kalkulierten Instrument der Politik.
88
Literaturverzeichnis
Bilder und Quellen
David, Jacques-Louis: Der Schwur der Horatier (1784). 330 425 cm; Paris, Muse du
Louvre.
: Die Liktoren bringen Brutus die Leichen seiner Shne (1789). 323 422 cm; Paris, Mu-
se du Louvre.
: Leonidas bei den Thermopylen (1814). 395 531 cm; Paris, Muse du Louvre.
Delacroix, Eugne: Das Massaker von Chios (1824). 419 354 cm; Paris, Muse du
Louvre.
: Griechenland auf den Ruinen von Missolonghi (1826). 209 147 cm; Bordeaux, Mu-
se des Beaux-Arts.
Genod, Michel Philibert: Schwur des jungen Kmpfers (1825). 50 55 cm; Athen, Pri-
vatsammlung.
Goya, Francisco de: Erschieung der Aufstndischen vom 3. Mai 1808 (1814). 266 345
cm; Madrid, Museo del Prado.
Greuze, Jean Baptiste: Vielgeliebte Mutter (1769). 99 131 cm; Madrid, Sammlung des
Comte de la Viaza, Marquis de Laborde.
: Der Fluch des Vaters (1777). 130 162 cm; Paris, Muse du Louvre.
Gurin, Pierre-Narcisse: Die Rckkehr des Marcus Sextus (1799). 217 243 cm; Paris,
Muse du Louvre.
Jacqume, A: Abschied eines Freiwilligen (1837). 89 112 cm; Athen, Privatsammlung.
Lansac, Franois-mile de: Szene aus dem Auszug von Missolonghi (1828). 200 238 cm;
Missolonghi, Pinakothek.
Revue encyclopdique, 31/1826, 91, S. 281.
88
Kampmann, Sabine/Ltgens, Annelie: Editorial, in: Ikonographie der Gewalt.
Kritische Berichte 3/2005, 1, S. 3. Neben den Herausgebern dieses Bandes mchte
ich auch Herrn Prof. Dr. Hans Ost, Frau Dr. des. Anna Pawlak sowie Frau Dipl.
Bibl. Denise Digrell fr fruchtbare Diskussionen, Anregungen und redaktionelle
Hilfe herzlich danken.
166 Ekaterini Kepetzis
Rubens, Peter Paul: Die Schrecken des Krieges (163738). 206 342 cm; Florenz, Galle-
ria Palatina (Palazzo Pitti).
Scheffer, Ary: Junger Grieche verteidigt seinen Vater (1827). 45 37 cm; Athen, Benaki-
Museum.
: Die Frauen von Souli (1827). Paris, Muse du Louvre.
: Die Flchtlinge aus Parga (um 1825). Amsterdam, Historisches Museum.
Vinchon, Auguste Jean-Baptiste: Modernes griechisches Thema Nach dem Massaker von
Samothrake (1827). 274 342 cm; Paris, Muse du Louvre.
Forschungsliteratur
Aris, Philippe: Geschichte der Kindheit. Mit einem Vorwort von Hartmut von Hentig.
Aus dem Franzsischen von Caroline Neubaur und Karin Kersten. Mnchen,
Wien
4
1975.
: Lenfant et la vie familiale sous lancien rgime. Paris 1960.
Ingo, Arzt/Mathias Menzel: Wir fragen nicht. Wir schieen Bilder, in: Sddeutsche
Zeitung, 11. 05. 2006; vgl. http://www.sueddeutsche.de/politik/89/358914/text/
(Stand: 24. 04. 2009).
Athanassoglou-Kallmyer, Nina: Under the Sign of Leonidas: The Political and Ideo-
logical Fortune of Davids ,Leonidas at Thermophylae under the Restoration,
in: The Art Bulletin, 63/1981, 4, S. 633649.
: French images from the Greek war of independence, 18211830: Art and politics under the
Restoration. New Haven, London 1989.
: La guerre dIndpendance grecque en France: politique, art et culture, in:
Ausst.-Kat. La Grce en rvolte: Delacroix et les peintres franais, 18151848. Ausst.-
Kat. Bordeaux, Muse des Beaux-Arts, 1996; Paris, Muse National Eugne Dela-
croix, 199697; Athen, Pinacothque Nationale, Muse Alexandre-Soutzos, 1997.
Paris 1996, S. 4550.
: Delacroix zwischen ,Griechenland und ,Die Freiheit. Anmerkungen zur politi-
schen Ikonographie im Frankreich der Restaurationszeit, in: Stefan Germer/
Michael F. Zimmermann (Hrsg.): Bilder der Macht Macht der Bilder. Zeitgeschichte
in Darstellungen des 19. Jahrhunderts. Mnchen, Berlin 1997, S. 257266.
Bajou, Valrie: Les Expositions de la Galerie Lebrun en 1826, in: La Grce en rvolte:
Delacroix et les peintres franais, 18151848. Ausst.-Kat. Bordeaux, Muse des Beaux-
Arts, 1996; Paris, Muse National Eugne Delacroix, 199697; Athen, Pinacoth-
que Nationale, Muse Alexandre-Soutzos, 1997. Paris 1996, S. 5158.
Bnzit, Emmanuel: Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. 10 Bde.
Bd. 6. Repr. Paris 1976.
Braud, Anthony: Annales de lcole franaise des Beaux-Arts. Paris 1827.
Bordes, Philippe: La mort de Brutus de Pierre-Narcisse Gurin. Vizille 1996.
Brown, Roy H.: The Formation of Delacroix Hero between 1822 and 1831, in: The
Art Bulletin, 66/1984, 2, S. 237254.
Calhoun, Craig (Hrsg.): Habermas and the public sphere. Cambridge, Mass., 1992.
Ch. . . . . .: Beaux-Arts. Exposition de tableaux au profit des Grecs, rue du Gros-Che-
net, n. 4, in: Gazette de France, 175/1826 (24. Juni), o.S.
Chaudonneret, Marie-Claude: LEtat et les artistes: de la Restauration la monarchie de
Juillet (18151833). Paris 1999.
Familien im Krieg 167
: Genod, Michel Philibert, in: Saur. Allgemeines Knstlerlexikon, Bd. 51. Mnchen,
Leipzig 2006, S. 350f.
Chon, Paulette: Jacques Callot 15921635. Ausst.-Kat. Muse Historique Lorrain,
Nancy, 1992. Paris 1992.
: Les Misres de la guere ou ,la vie du soldat: la force et le droit, in: dies.: Jacques
Callot 15921635. Ausst.-Kat. Muse Historique Lorrain, Nancy, 1992. Paris 1992,
S. 396400.
Ciappelli, Giovanni/Rubin, Patricia Lee (Hrsg.): Art, memory, and family in Renais-
sance Florence. Cambridge 2000.
Conter, Claude D.: Jenseits der Nation das vergessene Europa des 19. Jahrhunderts. Die
Geschichte der Inszenierungen und Visionen Europas in Literatur, Geschichte und Politik.
Bielefeld 2004.
Crow, Thomas: Painters and public life in eighteenth century Paris. New Haven, London
1985.
Diderot, Denis: Salon von 1765, in: ders.: sthetische Schriften. Aus dem Franzsi-
schen bersetzt von Friedrich Bassenge und Theodor Lcke. Mit einer Einleitung
von Friedrich Bassenge. 2 Bde. Bd. 1. Frankfurt a.M. 1968, S. 509634.
Duncan, Carol: Happy Mothers and Other New Ideas in French Art, in: The Art
Bulletin, 55/1973, 4, S. 570583.
Ewals, Leo: Ary Scheffer, 1795 * 1858. Gevierd Romanticus. Ausst.-Kat. Dordrecht
199596.
: Scheffer, Ary, in: Jane Turner (Hrsg.): Dictionary of Art, 34 Bde. Bd. 28. Lon-
don, New York 1996, S. 67f.
Fraser, Elisabeth A.: Delacroix, Art and Patrimony in Post-Revolutionary France. Cam-
bridge 2004.
Gaehtgens, Thomas W.: Der Knstler als Held. Eugne Delacroix, in: Ekkehard
Mai (Hrsg.): Triumph und Tod des Helden. Europische Historienmalerei von Rubens
bis Manet. Ausst.-Kat. Kln, Wallraf-Richartz-Museum, 198788. Kln 1987,
S. 115125.
Gerster, Ulrich/Helbing, Regine: Vorwort, in: dies. (Hrsg.): Krieg und Frieden in der
bildenden Kunst. 2 Bde. Bd. 1. Zrich 1996, S. 1.
Gestrich, Andreas: Neuzeit, in: ders./Jens-Uwe Krause/Michael Mitterauer
(Hrsg.): Geschichte der Familie. Stuttgart 2003, S. 364652.
Grimm, Gerhard: ,We are all Greeks. Griechenbegeisterung in Europa und Bay-
ern., in: Reinhold Baumstark (Hrsg.): Das neue Hellas: Griechen und Bayern zur Zeit
Ludwigs I. Ausst.-Kat. Mnchen, Bayerisches Nationalmuseum, 19992000.
Mnchen 1999, S. 2132.
Habermas, Jrgen: Strukturwandel der ffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie
der brgerlichen Gesellschaft. Neuwied 1962.
Hajnal, John: European marriage patterns in perspective, in: David Victor Glass/
David E.C. Eversley (Hrsg): Population in history. Essays in historical demography.
London 1965, S. 101143.
Hauser, Christoph: Anfnge brgerlicher Organisation: Philhellenismus und Frhliberalis-
mus in Sdwestdeutschland. Gttingen 1990.
He, Gilbert: Missolunghi. Gense, transformations multimdiales et fonctions
dun lieu identitaire du philhellnisme, in: Revue Germanique Internationale 12/
2005: Philhellnismes et transferts culturels dans lEurope du XIXe sicle. Paris
2005, S. 77107.
168 Ekaterini Kepetzis
Hofmann, Werner: Die Krfte wachsen, in: ders. (Hrsg.): Schrecken und Hoffnung.
Knstler sehen Krieg und Frieden. Hamburg 1987, S. 2538.
Ivinski, Patricia R./Payne, Harry C./Galitz, Kathryn Calley u. a.: Farewell to the wet
nurse: Etienne Aubry and images of breast-feeding in eighteenth-century France. Ausst.-
Kat. Williamstown, Mass., Sterling & Francine Clark Art Institute, 199899. Wil-
liamstown, Mass., 1998.
Jal, Auguste: Lartiste et le philosophe. Entretiens critiques sur le salon de 1824. Paris 1824.
Janzing, Godehard: Die Geburt des Partisanen aus dem Geist der Graphik. Krieg als
Caprichio bei Francisco de Goya, in: Steffen Martus/Marina Mnkler/Werner
Rcke (Hrsg.): Schlachtfelder. Codierung von Gewalt im medialen Wandel. Berlin 2003,
S. 5165.
: Bildstrategien asymmetrischer Gewaltkonflikte, in: Ikonographie der Gewalt. Kri-
tische Berichte, 3/2005, 1, S. 2135.
Joubin, Andr (Hrsg.): Journal de Eugne Delacroix. Tome premier 18221852. Paris
1932.
Jrgens-Kirchhoff, Annegret (Hrsg.): Warshots: Krieg, Kunst & Medien. Weimar
2006.
Kampmann, Sabine/Ltgens, Annelie: Editorial, in: Ikonographie der Gewalt. Kriti-
sche Berichte, 3/2005, 1, S. 3.
Kepetzis, Ekaterini: ,Griechenland ist grulich schn Carl Rottmanns Grie-
chenland-Rezeption, in: Horst-Dieter Blume/Cay Lienau (Hrsg.): Deutsch-Grie-
chische Begegnungen seit der Aufklrung. Mnster 2007, S. 6590.
: Honor Daumiers Histoire ancienne Ein Kommentar zur Kulturpolitik und Ge-
sellschaft der Julimonarchie, in: Roland Kanz (Hrsg.): Das Komische in der Kunst.
Kln, Weimar 2007, S. 161185.
Knieper, Thomas/Mller, Marion G. (Hrsg.): War visions: Bildkommunikation und
Krieg. Kln 2005.
Kppen, Manuel: Das Entsetzen des Beobachters: Krieg und Medien im 19. und 20. Jahr-
hundert. Heidelberg 2005.
Kohle, Hubertus: Kunstkritik als Revolutionsverarbeitung. Das Beispiel Auguste
Jal, in: Gudrun Gersmann/ders. (Hrsg.): Frankreich 18151830: Trauma oder Uto-
pie? Stuttgart 1993, S. 171186.
Laarmann, Frauke K.: Families in beeld: de ontwikkeling van het Noord-Nederlandse fami-
lieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Hilversum 2002.
Lschburg, Winfried: Es blitzt das Schwert in Missolunghis Nacht. Die Griechen-
konzerte des Jahres 1826 im Spiegel der Presse, in: Jahrbuch Preuischer Kultur-
besitz, 37/2000, S. 395406.
Lorenz, Angelika: Das deutsche Familienbild in der Malerei des 19. Jahrhunderts. Darm-
stadt 1985.
M***: Revue critique des productions de peinture, sculpture et gravure, exposes au Salon de
1824. Paris 1825.
MacNamidhe, Margaret: Delcluzes Response to Delacroixs ,Scenes from the
Massacres at Chios (1824), in: The Art Bulletin, 89/2007, 1, S. 6381.
Martin, Catherine: LExposition en faveur des Grecs la Galerie Lebrun ou le ,Sa-
lon de 1826. Une Organisation non officielle pour un vnement devenu offi-
ciel, in: Recherches en Histoire de lart, 3/2004, S. 91104.
Matt, Gerald: Attack. Kunst und Krieg in den Zeiten der Medien. Ausst.-Kat. Wien,
Kunsthalle, 2003. Gttingen 2003.
Familien im Krieg 169
Maza, Sarah: The ,Bourgeois Family Revisited: Sentimentalism and Social Class in
Prerevolutionary French Culture, in: Richard Rand (Hrsg.): Intimate Encounters.
Love and Domesticity in Eighteenth-Century France. Princeton 1997, S. 3947.
Mhrmann, Renate (Hrsg.): Verklrt, verkitscht, vergessen: Die Mutter als sthetische
Figur. Unter Mitarbeit von Barbara Mrytz. Stuttgart 1996.
Molik, Witold: ,Noch ist Polen nicht verloren, in: Flacke Monika (Hrsg.): Mythen
der Nationen: ein europisches Panorama: Begleitband zur Ausstellung des Deutschen
Historischen Museums 1998. Berlin 1998, S. 295320.
P.A.: Notice sur lexposition des tableaux en 1824. Deuxime article: Peinture histo-
rique, in: Revue encyclopdique, 24/1824, 70, S. 1840.
Paganel, Camille: Le Tombeau de Marcos Botzaris. Paris 1826.
Palm, Godehart: Das Format des Unfalichen. Zur historischen Koexistenz von
Krieg und Kunst, in: Kunst und Krieg. Kunstforum International, 165/2003, S. 6597.
Paul, Gerhard: Bilder des Krieges, Krieg der Bilder. Zur Visualisierung des modernen Krie-
ges. Paderborn 2004.
Rubin, James Henry: Oedipus, Antigone and Exiles in Post-Revolutionary French
Painting, in: The Art Quarterly, 36/1973, S. 141171.
Rutschky, Katharina: Einleitung, in: dies. (Hrsg.): Schwarze Pdagogik. Quellen zur
Naturgeschichte der brgerlichen Erziehung. Berlin, Wien 1977, S. XVII-LXXIV.
Sandt, Udolpho van de: ,Grandissima opera del pittore sar listoria. Notes sur la
hirarchie des genres sous la rvolution, in: Revue de lart, 83/1989, 1, S. 7176.
Seelen, Georg/Metz, Markus (Hrsg.): Krieg der Bilder Bilder des Krieges. Abhandlung
ber die Katastrophe und die mediale Wirklichkeit. Berlin 2002.
Shorter, Edward: Der Wandel der Mutter-Kind-Beziehungen zu Beginn der Mo-
derne, in: Jrgen Kocka (Hrsg.): Soziale Schichtung und Mobilitt in Deutschland im
19. und 20. Jahrhundert. Gttingen 1975, S. 256287.
: Die Geburt der modernen Familie. Hamburg 1977.
Sloman, Susan: ,Innocence and health: nursing women in Gainsboroughs Cot-
tage-door paintings, in: Ann Bermingham (Hrsg.): Sensation and sensibility:
viewing Gainsboroughs Cottage door. Ausst.-Kat. New Haven, CT, Yale University,
Yale Center for British Art, 2005; San Marino, CA, Huntington Library, Art Gal-
lery and Botanical Gardens, 2006. New Haven, CT, 2005, S. 3751.
Sontag, Susan: Regarding the pain of others. New York 2003.
Stein, Peter: Operative Literatur, in: Gert Sautermeister/Ulrich Schmid (Hrsg.):
Zwischen Restauration und Revolution: 18151848. Mnchen 1998, S. 485504.
Todorova, Maria: Zum erkenntnistheoretischen Wert von Familienmodellen. Der
Balkan und die ,europische Familie , in: Josef Ehmer/Tamara K. Hareven/ders.
(Hrsg.): Historische Familienforschung: Ergebnisse und Kontroversen. Michael Mitter-
auer zum 60. Geburtstag. Frankfurt a.M. 1997, S. 283300.
Vavra, Elisabeth (Hrsg.): Familie Ideal und Realitt. Ausst.-Kat. Riegersburg, Nieder-
sterreichische Landesausstellung, 1993. Horn 1993.
Wall, Richard: Zum Wandel der Familienstrukturen im Europa der Neuzeit, in:
Josef Ehmer/Tamara K. Hareven/ders. (Hrsg.): Historische Familienforschung: Ergeb-
nisse und Kontroversen. Michael Mitterauer zum 60. Geburtstag. Frankfurt a.M. 1997,
S. 255282.
Weber-Kellermann, Ingeborg: Die Familie: Geschichte, Geschichten und Bilder. Frank-
furt a.M.
3
1984.
: Die Familie: eine Kulturgeschichte der Familie. Frankfurt a.M. 1996.
170 Ekaterini Kepetzis
Westhoff-Krummacher, Hildegard: Als die Frauen noch sanft und engelsgleich waren: die
Sicht der Frau in der Zeit der Aufklrung und des Biedermeier. Ausst.-Kat. Mnster,
Westflisches Landesmuseum fr Kunst und Kulturgeschichte, 199596. Mnster
1995.
Whiteley, Jon: Art, hirarchie et Rvolution franaise, in: Georges Roque (Hrsg.):
Majeur ou mineur? Les Hirarchies en Art. Nmes 2000, S. 6777.
Whiteley, Jon: Gurin, Pierre(-Narcisse), Baron, in: Jane Turner (Hrsg.): Dictionary
of Art, 34 Bde. Bd. 13. London, New York 1996, S. 791795.
Wrigley, Richard: The Origins of French Art Criticism from the Ancien Rgime to the
Restauration. Oxford 1993.
Literarischer Philhellenismus von Frauen 171
Arnaldo di Benedetto
Literarischer Philhellenismus von Frauen:
Angelica Palli und Massimina Fantastici Rosellini
1
Richard Wagner schildert in seiner Autobiographie Mein Leben im Kon-
text seiner frhesten Eindrcke neben der Entdeckung des Theaters,
die er in Dresden seinem Stiefvater sowie seinem leiblichen Vater, dem
Schauspieler und Maler Ludwig Geyer verdankte, den Abenteuern von
Robinson Crusoe, welche der Pfarrer Wetsel abends seinen Schlern
erzhlte und der Lektre einer Mozartbiographie den nachhaltigen Ein-
druck, den in ihm die Nachrichten vom griechisch-trkischen Krieg
erweckten. Als kleines Kind lebte er in Passendorf bei Dresden lebte, wo
er nach Geyers Willen eine herausragende besonnene und anstndige
Erziehung erfuhr. Aufflligerweise berichtet Wagner hier in Umkeh-
rung der blichen Reihenfolge seinen Zugang zum Philhellenismus
2
als
Weg vom neuen Hellas, das ihm spter die Antike erschloss:
[] des Abends wurde uns Robinson vom Pfarrer erzhlt und mit vortrefflichen
dialogischen Belehrungen begleitet. Groen Eindruck machte auf mich die Vor-
lesung einer Biographie Mozarts, wogegen die Zeitungs- und Kalenderberichte
ber die Vorflle des gleichzeitigen griechischen Befreiungskampfes drastisch
aufregend auf mich wirkten. Meine Liebe fr Griechenland, die sich spterhin mit
Enthusiasmus auf die Mythologie und Geschichte des alten Hellas warf, ging
somit von der begeisterten und schmerzlichen Theilnahme an Vorgngen der
unmittelbaren Gegenwart aus. Ich entsinne mich, spter in dem Kampf der Hel-
lenen gegen die Perser immer die Eindrcke dieses neuesten griechischen Aufstan-
des gegen die Trken wiedergefunden zu haben.
3
1
Aus dem Italienischen bersetzt von Valerio Furneri.
2
Philhellenismus verstehe ich hier als jene Bewegung der Sympathie fr Griechen-
land, die whrend der 1821 ausgebrochene Revolution gegen die Trken entstand.
Heutzutage bezeichnet man mit diesem Begriff auch die Bewunderung fr das
alte Griechenland in unserer Epoche; letztendlich bekam ich sogar von einem
Gelehrten zu hren, da Philhellenismus die Anziehungskraft sei, welche die
griechische Kultur und die griechische Mode auf den antiken Nahosten ausbten.
Diesen weiten Philhellenismus-Begriff kann ich berhaupt nicht teilen.
3
Wagner, Richard: Mein Leben. Bd. 1. Mnchen 1911, S. 12.
1
172 Arnaldo di Benedetto
Wagners Erinnerungen dokumentieren die tiefe Prgung, welche in den
20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts die ffentlichkeit in Deutsch-
land und anderen Lndern Europas erfuhr. Jene Zeitungen und Zeit-
schriften, die das Kind so sehr beeindruckten, neigten offensichtlich zu
einer deutlichen Parteinahme. Aus der Autobiographie des Autors vom
Nibelungenring erfahren wir, da ihm in frher Jugend ein Ypsilanti Val-
zer als das wunderbarste Tonstck galt.
4
Knig Ludwig I. von Bayern
war selber ein berzeugter Philhellene und wurde durch die Aufstnde
im modernen Griechenland, die er in einer Reihe von Griechendichtun-
gen besang, inspiriert. Aus dem Jahr 1824 stammt das in Weimar aufbe-
wahrte Gemlde von Caspar David Friedrich Huttens Grab. Es ist nicht
nur eine Huldigung an den deutschen Reformator, sondern uert zu-
gleich durch subtile Anspielungen Kritik des Knstlers an der politi-
schen Restauration in Deutschland, wie man aus verschiedenen Indizien
feststellen kann. Nicht nur, da Friedrich selbst den Verkaufserls des
Werkes, das zwischen 1824 und 1826 in Dresden, Hamburg und Berlin
ausgestellt- und wahrscheinlich vom Groherzog Carl August von Sach-
sen-Weimar-Eisenach gekauft wurde (und daher Goethe bekannt war),
sicherheitshalber fr die griechische Sache bestimmt hatte. Man vermu-
tet sogar, da das Datum 1821, das auf dem Rstungssockel mitten
des Bildes eingemeielt ist, auf den in jenem Jahr begonnenen griechi-
schen Freiheitskampf anspielt. Goethe seinerseits hatte 1821, am Anfang
des griechischen Freiheitskampfes, aus den Spalten der Zeitschrift ber
Kunst und Altertum dem italienischen Schriftsteller Alessandro Man-
zoni empfohlen, sich das Parga-Thema auszusuchen:
Nicht als Vorschlag, sondern nur eines schnellern Verstndnisses wegen, nennen
wir die Rumung von Parga. Zwar mchte dieses Sujet gegenwrtig zu behandeln
einigermaen gefhrlich seyn, unsere Nachkommen werden sichs nicht entgehen
lassen. Wenn es aber Herr Manzoni ergreifen drfte und es nur in seiner ruhigen,
klaren Art durchfhrte, sein berzeugendes Rednertalent, seine Gabe elegisch zu
rhren und lyrisch aufzuregen in Thtigkeit setzen wollte, so wrden von der er-
sten bis zur letzten Scene Thrnen genug flieen; so da der Englnder selbst,
wenn er auch, durch die bedenkliche Rolle die seine Landsleute dabey spielen,
sich einigermaen verletzt (offended) fhlte, er das Stck doch gewi keine
schwache Tragdie nennen wrde.
5
4
Ebd.
5
Vgl. Goethe, Johann Wolfgang: sthetische Schriften. 18211824. Stefan Greif/
Andrea Ruhlig (Hrsg.): Frankfurt a. M. 1998, S. 146.
Der Englnder war der Reverend Henry Hart Milman (17911868), Dichter, Histo-
riker und Professor in Oxford von 1821 bis 1831, der in einer Rezension in
der Zeitschrift Quarterly Review Manzonis Drama Conte di Carmagnola als
Literarischer Philhellenismus von Frauen 173
Andere Beispiele verdeutlichen diese Omniprsenz: 1825 schrieb Cha-
teaubriand Note sur la Grce, eine Schrift, in der der bretonische Vicomte
Griechenlands Erwachen mit Begeisterung begrte.
6
Der griechisch-tr-
kische Krieg taucht im Hintergrund der letzten Kapitels von Stendhals er-
stem Roman Armance auf der Roman erschien 1827:
7
Der Protagonist,
Octave schickt Armance ein kurzes Gedicht ber Griechenland, das vor
Kurzem von Lady Nelcombe verffentlicht wurde. Von diesem bekannten
Text gab es in Frankreich nur zwei Kopien. Zum Schlu beendet er seine
Existenz als finsterer und nicht so sehr berzeugter Freiwilliger der griechi-
schen Sache, indem er sich auf dem Schiff vergiftet, als Griechenland, das
von ihm als Heldenland begrt wird, in Sicht ist. Die von Baudelaire
angenommene Legende, nach der Edgar Allan Poe 1826 versucht habe,
sich nach Griechenland zu begeben, um sich dort den philhellenischen
Freiwilligen anzuschlieen besttigt weiterhin die Suggestionskraft jener
Ereignisse und der Wirkung, die Byron bei den Zeitgenossen verursachte.
Die kulturelle Grundlage des Philhellenismus, der von Gabriele
dAnnunzio in einer spteren Schrift sarkastisch als Leidenschaft der
romantischen Zeit bezeichnet wurde,
8
wurde in der zweiten Hlfte des
XVIII. und zum Beginn des XIX. Jahrhunderts gelegt. Ab den 60er und
70er Jahren des XVIII. Jahrhunderts hatte Griechenland aufgrund der
durch Ruland geschrten Verschwrungen und Rebellionen gegen die
trkische Herrschaft, sowie dank der Unternehmungslust seiner Kauf-
leute Europas Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In diesem Kontext
schlug Voltaire 1769 das khne bzw. schwrmerische Projekt vor, den
Grafen Alessio Komnenos mit Untersttzung der Zarin Katharina II.
von Ruland auf den Konstantinopler Thron wiedereinzusetzen. Kom-
nenos Schwager, der Mailnder Giuseppe Gorani, gab diese Nachricht
in seinen Mmoires bekannt.
9
1771 wurde in zwei Folgen auf der floren-
schwach beurteilte, obwohl er es zum Teil geschtzt hatte. Milman forderte Man-
zoni auf, sich wieder der Lyrik zu widmen; Goethe hingegen besttigte sein im
vorigen Jahr schon ausgesprochenes, positives Urteil.
6
Viscomte de Chateaubriand, Franois Ren: Note sur la Grce, nouvelle dition, aug-
mente, revue et corrige. Paris 1826.
7
Stendhal: Armance ou quelques scnes dun salon de Paris en 1827. Paris 1827.
8
DAnnunzio, Gabrile: Teneo te Africa, in Prose di ricerca , Band III, Mondadori.
Mailand 1962, S. 666f.
9
Gorani, Giuseppe: Dal despotismo illuminato alla Rivoluzione [17671791], in:
Mondadori. Le memorie di Giuseppe Gorani, Bd. III. A. Casati (Hrsg.): Mailand
1942, S. 147151. ber den erwhnten Vorfall vgl. Venturi, Franco: Settecento ri-
formatore. La prima crisi dellAntico Regime. 17681776, Bd. 3. Einaudi, Turin 1979,
S. 29.
174 Arnaldo di Benedetto
tinischen Notizie dal mondo der Aufruf des epirotischen Offiziers der
russischen Armee Antonio Gicca (Ghiccas) Voti dei Greci allEuropa cri-
stiana verffentlicht: Franco Venturi bezeichnet ihn als [] den wich-
tigsten philhellenischen Aufruf, der nicht nur in Italien, sondern in ganz
Europa je erschienen war, und welcher auch weit auerhalb der Toskana
widerhallen musste.
10
Hier kann jedoch keine, wenn auch nur summarische Geschichte des
Philhellenismus von den ersten manchmal widersprchlichen Ausfor-
mungen des XVIII. bis zu den zahlreichen literarischen, bildknstleri-
schen und musikalischen Dokumenten des XIX. Jahrhunderts gezogen
werden: In Italien gehren zu den wichtigsten Zeugnissen das Kurzepos
von Giovanni Berchet I profughi di Parga, die bersetzungen der grie-
chischen Volkslieder von Niccol Tommaseo und einige Gemlde von
Francesco Hayez. Nicht zu vernachlssigen sind auch Foscolos Schrif-
ten, u. a. der scharfe Artikel On Parga (1818) sowie die unvollendete
Narrative of Events Illustrating the Vicissitudes and the Cession of Parga
(18191820). Es ist bemerkenswert, wie Manzoni, der von Goethe er-
muntert wurde, sich des Themas anzunehmen (s. o.) und mit Berchet,
Mustoxidi, Viesseux und Claude Fauriel (der in Manzonis Villa in Bru-
suglio das Vorwort seiner Chants populaires de la Grce moderne verfate)
befreundet war, nicht einmal das Bedrfnis sprte, sich mit dem Thema
zu befassen, whrend es in Leopardis Werk nur am Rande steht, obwohl
dieses zahlreiche Anlsse zu einer Beschftigung geboten htte.
Ein dem Philhellenismus zuzuschreibendes Verdienst besteht dar-
in, da die Aufmerksamkeit der europischen Intellektuellen sich von
jenem idealen Vaterland, welches das alte Hellas fr die Neoklassizisten
gewesen war, auf das moderne pittoreske Griechenland fokussierte;
wenngleich es sich nicht immer um ein richtig verstandenes Griechen-
land handelte, um ein Land also, das sich wegen eklatanter Kenntnislk-
ken auch manchen Freiwilligen, die ab 1821 seitens der Griechen gegen
die Trken gekmpft hatten, als enttuschend erwies.
10
Venturi, Franco: La prima crisi dellAntico Regime, 17681776, S. 83 und 100103.
Der Aufruf lautet wrtlich: Votivgaben der Griechen dem christlichen Europa.
Das Originalzitat lautet nach Venturi: il pi importante appello filellenico ap-
parso allora non solo in Italia, ma nella intera Europa, destinato a risuonare anche
ben lontano dalle terre toscane.
Literarischer Philhellenismus von Frauen 175
Die bald in Vergessenheit geratene Schriftstellerin Angelica Palli (1798
1875), die seit den letzten Jahren wieder im Mittelpunkt einiger literatur-
wissenschaftlicher Forschungen steht, war gleich alt wie Giacomo
Leopardi (17981837), sie lebte jedoch lnger. Palli stammte aus der be-
deutenden griechischen Gemeinde, die seit langer Zeit in Livorno ange-
siedelt war, und die in den Jahren der hellenischen ,Wiedergeburt fr
die aufstndische Bewegung gegen die Trken Geld sammelte, Hilfssen-
dungen nach Griechenland schickte, die ffentlichkeit informierte und
eine intensive Propaganda fr den Befreiungskampf betrieb. Livorno,
die bedeutendste Hafenstadt des Groherzogtums der Toskana und eine
der wichtigsten im Mittelmeerraum, war schon im XVIII. Jahrhundert
eine kosmopolitische Stadt und ein wichtiges Kulturzentrum mit Druk-
kereien, ffentlichen Bibliotheken und Lesekabinetten. In Livorno wur-
den u. a. eine Neuauflage der Encyclopdie von Diderot und DAlembert
und die erste Ausgabe des Aufsatzes Dei delitti e delle pene von Cesare Bec-
caria gedruckt. Dank stdtischer Privilegien und einer toleranten Hal-
tung der Stadtoberen wurden hier sogar mit verbotenen Bchern gehan-
delt.
11
Auch in der ersten Hlfte des XIX. Jahrhunderts spielte die Stadt
hinsichtlich kultureller Entwicklungen eine bedeutende Rolle, wie sich
z. B. anhand zweier wichtiger Figuren demonstrieren lt: Des glhen-
den Philhellenen, Erzhlers und Politikers Enrico Mayer, und Francesco
Domenico Guerrazzis, einem sehr berhmten und seinerzeit in Italien
vielgelesenen Autor, der der Edeldame Angelica Bartolomei geborenen
Palli seine Schrift Discorso sopra le condizioni della odierna letteratura in Ita-
lia widmete.
12
Dieser Text erschien als Vorwort des Romans La battaglia
di Benevento und trug das Datum: Livorno, 1 Aprile 1845.
Ein wesentlicher Bezugspunkt fr die griechisch-livornesische Gemein-
schaft in den Jahren der griechischen Revolution war die Zeitschrift An-
tologia, die 1821 von Giovan Pietro Viesseux in Florenz gegrndet
wurde. Sie trat das Erbe des mailndischen Conciliatore an und wurde
bald auch generell zum grten Bezugspunkt des italienischen Philhelle-
nismus. Der patriotische Schwung jener wohlhabenden griechischen
11
Vgl. Corrieri, Susanna: Il torchio fra ,palco e ,tromba. Uomini e libri a Livorno nel Set-
tecento. Modena 2000.
12
Guerrazzi, Francesco Domenico: La battaglia di Benevento. Sstoria del secolo 13. Un
Discorso sopra le condizioni della odierna letteratura in Italia. Mailand 1845. Die Wid-
mung lautet im Original: Alla nobile donna Angelica Bartolomei nata Palli und
der Aufsatztitel: Rede ber den Stand der heutigen Literatur in Italien.
176 Arnaldo di Benedetto
Kaufleute aus Livorno war bewundernswert und einige von ihnen spen-
deten derart erhebliche Geldsummen fr die griechische Sache, da sie
selbst in Armut gerieten. Giuseppe Montani, der bedeutendste Literatur-
kritiker der Antologia bemerkte, da die romantischen Dichter es we-
sentlich reizvoller fnden, den Tod des furchtlosen Markos Botzaris, des
Leonidas des modernen Griechenlands zu besingen, anstatt denjenigen
Hektors oder des Achill erneut zu besingen. Er betonte auch, da, bis auf
wenige akademische Ausnahmen, niemand mehr bereit sei, seine eige-
nen Leser mit dem Gesang bis zu den Gipfeln des Parna und des
Olymp zu fhren, die so glanzvoll den Alten auch scheinen mochten, fr
uns aber so dster sind, weil wir darauf keine neuen Gtter stellen kn-
nen, wie z. B. das Genie der Freiheit und das Genie der Zivilisation, die
das wiedergeborene Griechenland anlcheln. 1825 bezeichnete er By-
ron und die Griechen als modische poetische Themen in Frankreich.
13
Angelica Palli, bzw. Pallis, war Schlerin des provenzalisch-toskani-
schen Literaten Giovanni Salvatore (Salvadore) De Coureil (17601822),
der Shakespeare und die englische Poesie schtzte und sie gegen Voltaire
verteidigte. In Gedichten und Schriften hatte er auch den Italiener
Alfieri gelobt, war aber ein schonungsloser Kritiker von Monti, der ihm
dies mit Boshaftigkeit vergalt.
14
Von Giovanni Carmignani wurde er der-
art bekmpft, da De Coureil 1808 Pisa verlie und nach Livorno um-
siedelte, wo er bis zu seinem Tode lebte. Er widmete seiner Schlerin die
von ihm 1816 herausgegebene neue Grammatik der englischen Sprache
fr Italiener.
15
Auch Enrico Mayer war sein Zgling gewesen und nach
13
Montani, Giuseppe: Scritti letterari. Angiola Ferraris (Hrsg.): Turin 1980, S. 101,
184, 112 und 114. Die Zitate im Original lauten: dellintrepido Marco Botzaris,
il Leonida della Grecia moderna und: col canto sulle vette del Parnaso e
dellOlimpo s brillanti per gli antichi e s squallide per noi, ove non sappiamo
collocarvi nuovi Dei, il genio, per esempio, della libert e quello della civilt che
sorridono alla Grecia rigenerata.
14
ber De Coureil vgl. Parra, Anton Ranieri: Un francese italianato traduttore dallin-
glese: Giovanni Salvatore De Coureil. Livorno 1975; Dionisotti, Carlo: Un sonetto
su Shakespeare, in: Ders. (Hrsg.): Ricordi della scuola italiana. Rom 1998,
S. 115141; Di Benedetto, Arnaldo: ,Arrivammo a Firenze . La Toscana di Vit-
torio Alfieri fra esperienza e mito, in: Ders. (Hrsg.): Il dandy e il sublime. Nuovi
studi su Vittorio Alfieri. Florenz 2003, S. 5577. ber seine moralistische Auffas-
sung des Romans vgl. Bertoncini, Giancarlo: ,Una bella invenzione. Giuseppe Mon-
tani e il romanzo storico, Liguori. Neapel 2004, S. 113116.
15
De Coureil, Giovanni Salvatore: Nuova grammatica della lingua inglese per gli ita-
liani compilata sulle grammatiche precedenti di Barker, di Vergani e di Peyton colla pro-
nunzia accanto ad ogni aprola inglese. Livorno 1816.
Literarischer Philhellenismus von Frauen 177
De Coureils Tod gedachte er seiner in der Akademie von Livorno, der
Accademia Labronica.
Palli wurde bald zu einer hochgeschtzten Stegreifdichterin, als das
Phnomen der Stegreifdichter in Italien noch in Mode war. Sie ist mit
Sympathie und Bewunderung in den Tagebchern von Emilia Peruzzi
erwhnt, deren florentinischer Salon eine wichtige Rolle auf gesell-
schaftlicher, politischer und literarischer Ebene spielte. Nachdem Man-
zoni 1827 in Pallis Haus in Livorno einer ihrer Lesungen beigewohnt
hatte, in der Angelica die Liebe Sapphos und Phaons besungen hatte,
improvisierte er fr sie die folgenden Verse:
Prole eletta dal ciel, Saffo novella,
che la prisca sorella
di tanto avanzi in bei versi celesti,
e in tanti modi onesti
canti della infelice tua rivale,
del Siculo sleale,
dello scoglio fatal, mattristi: ed io
ai numeri dolenti
toffro il plauso migliore, il pianto mio.
Ma tu credilo intanto ad alma schietta,
che dinsigne vendetta
lombra illustre per te placata fora,
se il villano amator vivesse ancora.
16
Bei derselben Gelegenheit improvisierte Alphonse de Lamartine ein
Epigramm:
En coutant les vers dont vous peignez
de la tendre Sapho les soupirs, les malheurs,
jeune et savante demoiselle,
je pleurs et dis: pourquoi cette grecque beaut
neut elle pas votre esprit, votre cur?
Phaon volage aurait t fidle.
17
16
Manzoni, Alessandro: Tutte le opere. I promessi sposi. Testo definitivo del 1840,
Bd. 2,1. Alberto Chiari (Hrsg.): Mailand 1958, XLV: AD ANGELICA PALLI
[Agosto 1827]: Vom Himmel auserwhlte Ahnin, junge Sappho, / mge die be-
tagte Schwester / mit schnen himmlischen Versen hervortreten / und auf viele
sittsamen Arten / deine unglckliche Rivalin besingen, / den unehrlichen Sikuler
/ den schicksalhaften Klippe, grme mich: und ich, / den schmerzhaften Zahlen /
dir biete ich den besten Beyfall, mein Wehklagen./Du glaube es aber der freimt-
higen Seele,/da mit hervorragender Rache / wrde fr dich den vornehmen
Schatten besnftigt, / wenn der flegelhafte Liebhaber noch leben wrde.
17
Beim Zuhren der Verse, wo Sie besingen / die zrtliche Sappho das Seufzen und
die Leiden, / ach junge und weise Dame, / ich weine und sage: warum diese grie-
178 Arnaldo di Benedetto
Sie schrieb auerdem Dramen, Erzhlungen und Gedichte (auch in neu-
griechischer Sprache), die von den Zeitgenossen geschtzt wurden. Ihr
Mann war Giovan Paolo Bartolommei (Bartolomei), ein berschwng-
licher Befrworter des italienischen Risorgimento, der als Freiwilliger im
ersten italienischen Freiheitskampf diente. Sie hatte ihn bei diesem
Abenteuer begleitet und das Ehepaar lebte einige Jahre im Exil in Turin,
wo die Schriftstellerin mit dem bekannten Literaturkritiker Francesco
De Sanctis, der damals auch als Exilant in der piemontesischen Haupt-
stadt lebte, in Berhrung kam. Kurz nach der Rckkehr in Livorno grn-
dete sie die Zeitschrift Il romito (18581861).
Zeitgenssische Geschichtsschreiber betonen, wie sie 1824 als einzige
Frau ausnahmsweise an den von Viesseux veranstalteten Gesprchen
teilnehmen durfte: Sie wurde nmlich am Abend des 3. Mai jenes Jahres
im Palazzo Buondelmonti in Florenz, auch wegen ihrer griechischen
Herkunft, gefeiert.
18
Giancarlo Bertoncini vermutet, da sie in diesem
Milieu der Antologia aufgefordert wurde, einen Teil ihres Werks den
philhellenischen Themen zu widmen.
1827, als der historische Roman sich in Italien durchsetzte, gab sie
Alessio ossia gli ultimi giorni di Psara heraus. Der Roman wurde auf dem
Titelblatt romanzo istorico (d. h. historischer Roman; es handelte sich
allerdings um eine in der Gegenwart angesiedelte Geschichte, was un-
gewhnlich war) definiert und die Autorin lie ihn auf eigene Kosten
drucken.
19
Der Verkaufserls war fr die unterjochten Griechen be-
stimmt und der Preis betrug fnf florentinische Lire.
20
Dem langen
Krieg, der in jenen Jahren in Griechenland stattfand, widmete Angelica
Palli verschiedene Gedichte: die Ode zu Byrons Tod, die 1824 auf Neu-
griechisch gefat und dann von der livornischen Schriftstellerin ins Ita-
lienische bersetzt wurde, sowie die Ode sugli avvenimenti di Psar, deren
Thema die heldenhafte Verteidigung der kleinen Insel Psara 1824 gegen
die Trken war. Auch dieses Gedicht wurde zuerst auf Neugriechisch ge-
schrieben (1825) und dann ins Italienische bersetzt.
Den griechischen Freiheitskampf verarbeitete sie auch in ihrem ein-
zigen Roman Alessio: Die sechstgige Handlung endet mit der Flucht
chische Schnheit, / hatte sie nicht Ihren Geist, Ihr Herz? / der unbestndige
Phaon wre treu gewesen.
18
Bertoncini: ,Una bella invenzione, S. 100102.
19
Palli Bartolommei, Angelica: Alessio ossia Gli ultimi giorni di Psara romanzo istorico.
[o.O.] 1827.
20
All diese Widmungen sind ebenfalls auf dem Titelblatt des Romans auf Italie-
nisch zu finden.
Literarischer Philhellenismus von Frauen 179
des Protagonisten und seiner Genossen nach der tapferen vergeblichen
Verteidigung der Insel. Prolepsen und Andeutungen verweisen auf die
nach der erzhlten Handlung angesiedelten Geschehnisse wie die
Wiedereroberung von Psar seitens der Griechen (im Roman wird des
fteren darauf verwiesen), die Hochzeit von Alessio und der Gelobten
Evantia, sowie die Fortsetzung des Kampfes fr Alessio und den Italie-
ner Eutimio.
21
Der Roman beginnt mit Alessios Rckkehr auf Psara nach einer
Kampfaktion. Neben ihm auf dem Schiff sitzt eine schne trkische
Gefangene: Es ist Amina aus dem Harem des Aga Selim. Amina verliebt
sich vor Beginn der Handlung in Alessio und in den folgenden Tagen
entwickelt sich eine leidenschaftliche Liebe. Alessio erwidert sie aber
nur mit Zuneigung, weil er die treue Verlobte Evantia nicht verraten
kann. Zum Schluss opfert die mutige Amina ihr eigenes Leben, um
Alessios Leben zu retten, indem sie Selim ttet, der vor kurzem mit sei-
nem Gefolge in Psara ausgeschifft war, und daraufhin selbst gettet
wird.
22
In diesem mittelmigen Roman spielt der Gegensatz zwischen
griechischer Menschlichkeit und trkischer Barbarei eine relevante
Rolle:
puoi tu confrontare la situazione della prigioniera dun Greco con quella della
schiava dun Turco? (chiede ad esempio Evantia) luna va incontro alle fatiche,
al disonore, agli strazj, laltra trova la piet che consola, che le accorda un so-
spiro [].
23
Die Figur des Eutimio ist vielleicht von Santorre di Santarosa inspiriert,
wie Giuseppe Montani in einer Rezension des Romans in der Antolo-
gia vermutete (aus verschiedenen Indizien kann man verstehen, da
21
Ich beziehe mich fr Zitate auf die folgende Ausgabe des Romans: Palli, Angelica
Bartolommei: Alessio ossia gli ultimi giorni di Psara. Romanzo istorico. Giancarlo Ber-
toncini (Hrsg.): Livorno 2003. Es handelt sich um ein Reprint der Ausgabe aus
dem Jahr 1827, die Varianten von 1876 sind im Anhang verzeichnet.
22
An diesem Handlungsverlauf kann man wenngleich abgemildert den Einflu
Byrons erkennen.
23
Ebd., S. 2829. (kannst du die Lage einer trkischen Gefangenen mit der einer
griechischen Sklavin vergleichen? [So fragt z. B. Evantia] die Sklavin eines Trken
muss Strapazen, Schande und Qual ertragen, whrend die Gefangene von einem
Griechen Mitleid, Trost und Erbarmen findet []). Man merke dabei die unter-
schiedliche Charakterisierung der Gefangenschaft: Eine trkische Frau in griechi-
schen Hnden ist nur eine Gefangene (prigioniera), whrend eine Griechin unter
trkischer Herrschaft als Sklavin (schiava) bezeichnet wird.
180 Arnaldo di Benedetto
Eutimio aus dem Piemont kommt)
24
, und sie stellt Parallelen zwischen
Griechenland und Italien fest, die typisch fr die philhellenische Lite-
ratur in Italien sind.
25
Die Figur des Eutimio verweist zugleich auf ein
wichtiges Thema fr die Protagonisten des italienischen Frhrisorgi-
mento (vgl. auch Manzonis Adelchi, das berhmteste literarische Bei-
spiel fr solche Assoziationen):
guai alla nazione che fonda le sue speranze sopra i soccorsi promessi dagli stra-
nieri [] guai a chi spera in altri che s medesimo! Guai alla nazione che spera
libert, non acquistata a prezzo del proprio sangue.
26
Eine hnliche Ermahnung ist in der Erzhlung Un episodio dellinsurre-
zione greca del 1854 zu finden: Einer der Protagonisten spielt auf die Zarin
Kathrin II. an, die die Griechen 1770 zum Aufstand gegen die Trken
aufgefordert und sie dann im Stich gelassen hatte:
Figliuoli! Non contate sugli stranieri, e siano anche cristiani ortodossi.
27
In einer Neuauflage von Alessio (der Roman erschien im nachgelassenen
Band Racconti im Jahr 1876) dmpfte die Autorin den geschwollenen
Stil, ohne dabei die sprachliche Ebene grundstzlich zu verndern. Da-
durch versteht man, welch eine stilistische Revolution Manzoni mit der
24
Vgl. Bertoncini: ,Una bella invenzione, S. 205211, mit einigen Zitaten aus Mon-
tanis Rezension. Auerdem erschien diese Rezension auch in Pallis nachgelasse-
nem Band Racconti, Successori Le Monnier. Florenz 1876, S. 351359.
Annibale Santorre De Rossi di Pomarolo, Graf von Santarosa (17831825) war
ein italienischer Patriot und einer der Protagonisten des italienischen Risorgi-
mento. Er versuchte im Piemont eine liberale Verfassung und eine relative Frei-
heit der Brger einzufhren. Sein Ziel war es, Italien von der fremden Besatzung
zu befreien und das Land zu vereinigen. Nach dem gescheiterten Aufstand von
1821 emigrierte er nach sterreich und spter nach Frankreich, wo er verhaftet
wurde. 1824 begab er sich nach Griechenland, um dort fr die griechische Unab-
hngigkeit zu kmpfen. Er starb 1825 whrend der Belagerung von Navarin, als
die Trken mit Untersttzung von Ibrahim Pascha die Griechen niederschlugen
und die Festung einnahmen.
25
Vgl. Di Benedetto, Arnaldo: Le nazioni sorelle. Momenti del filellenismo lette-
rario italiano, in: Fancesco Bruni (Hrsg.): Niccol Tommaseo: popolo e nazioni. Ita-
liani, corsi, greci, illirici. Rom, Padua 2004, S. 436458.
26
Palli Bartolommei: Alessio ossia, S. 60f. (Weh, der Nation, deren Hoffnungen auf
dem versprochenen Beistand von Fremden basieren [] weh demjenigen, der auf
andere und nicht auf sich selbst hofft! Weh jener Nation, die auf eine blutzollfreie
Freiheit hofft).
27
Kinder! Rechne nicht mit Fremden, mgen sie auch Christen Orthodoxen
sein..
Literarischer Philhellenismus von Frauen 181
sogenannten Ventisettana
28
eingefhrt hatte: Eine verfeinerte aber nicht
erhabene Sprache, die nichts mit der Nachlssigkeit der italienischen
Romanciers des vorigen Jahrhunderts zu tun hatte (der berhmte Schrift-
steller Vittorio Alfieri, der zugleich ein leidenschaftlicher Leser von fran-
zsischen Romanen war, hatte behauptet, da es keinen italienischen
lesbaren Roman gbe).
Auerdem schrieb Angelica Palli drei Erzhlungen mit philhellenischen
Motiven: Il villaggio incendiato. Memorie di Lambro; die schon erwhnte
Un episodio dellinsurrezione greca del 1854 und Il maggiore DArgincourt.
Diese Erzhlungen wurden im Sammelband Racconti verffentlicht und
sie wurden zu einer Zeit geschrieben, als der whrend des ersten grie-
chisch-trkischen Krieges verbreitete Enthusiasmus der Europer sich
etwas abgeschwcht hatte und dieselben Regierungen, die die Entste-
hung des ersten hellenischen Staates untersttzt hatten, ihre Politik
nderten. Einen solchen Stimmungsumschwung merkt man auch den
philhellenischen Seiten von Ippolito Nievos Confessioni dun Italiano an.
In Il villaggio incendiato schildert Palli die entsetzliche Rache, die eine
junge khne trkische Frau (man erfhrt spter, da sie nur Halbtrkin
ist) an einigen aufstndischen Griechen durch Vergiftung nimmt, weil
sie ihren Mann im Kampf verloren hat. Wiederum betont hierin die
Autorin den Gegensatz zwischen griechischer Menschlichkeit und tr-
kischer Barbarei; Zulime, so heit die Frau, wird am Ende in ein Kloster
mitleidig aufgenommen, dort bernimmt sie den christlichen Glauben
und stirbt wenige Jahre darauf.
Un episodio dellinsurrezione greca del 1854 spielt sich im ersten Jahr
des Krimkrieges
29
ab. Es geht um die unglckliche Ehe Edoardos, eines
Offiziers der englischen Marine mit einer Griechin, die tragisch endet.
Die beiden lieben sich, Edoardo aber erhlt den Befehl, mit seiner Brigg
(im Text als brick bezeichnet) die epirotische Kste zu bewachen, um zu
vermeiden, da Ruland mit Lebensmitteln und Waffen die Griechen
in ihrem Aufstand gegen die Trken untersttzt. Edoardo gehorcht,
seine Frau und er sterben aber dennoch unter grausamen Umstnden.
28
Ventisettana lautet die zweite Auflage von Manzonis Roman I Promessi sposi
(Die Brautleute), die 1827 herausgegeben wurde. Hierin schafft Manzoni eine
Mischung von lombardischer und toskanischer Mundart, mit der Absicht eine
gereinigte aber nicht erhabene Sprache zu verwenden.
29
Der Krimkrieg spielte eine relevante Rolle im italienischen Risorgimento und ist
daher in Italien sehr bekannt.
182 Arnaldo di Benedetto
England (und bald auch Piemont) ist nun mit der Trkei gegen Russland
alliiert. So bemerkt Anastasio, eine der Personen des Romans, wie sich
die jetzige Situation von derjenigen vor vierzig Jahren grundstzlich un-
terscheidet:
Certo che lEuropa non ha pi per noi gli affetti del 21!
30
Auch in Il maggiore DArgincourt wird eine Geschichte aus dem Jahr 1854
erzhlt. Der im Titel erwhnte franzsische Offizier, der schon whrend
der Pariser Barrikadenkmpfe am 15. Juli 1848 gegen den Tyrannen ge-
kmpft hat, ist nun im Dienst der Trken, und man sagt ber ihn mit
bitterer Ironie:
venuto per aiutare i Turchi ad esterminare la cos detta canaglia che ardisce solle-
varsi contro i proprii padroni, dai quali, secondo le idee del maggiore e lopinione
di tutto il giornalismo europeo, trattata colla massima umanit e dolcezza.
31
DArgincourt begreift aber, wie grausam diese Herren sind und er lsst
einige griechische Gefangene frei, bevor sie entsetzlich gefoltert und ge-
ttet werden.
Aus dem Milieu von Livorno und von Florenz entstand auch das Drama
von einer anderen Schriftstellerin. Es handelt sich um I Pargi von Mas-
simina Fantastici Rosellini, der Tochter der berhmten Stegreifdichterin
Fortunata Sulgher Fantastici. Es wurde 1838 in Florenz herausgegeben
und verarbeitet ebenfalls philhellenistische Sujets: Es geht nmlich um
die berlassung der griechischen Stadt Parga durch die Englndern an
den grausamen albanischen Fhrer Al Pascha, dessen Herrschaft in
Childe Harolds Pilgrimage von Byron (der ihn kennengelernt und trotz-
dem bewundert hatte) als gesetzliche Illegalitt bezeichnet wird. In
Florenz hatte dieses Thema auch den vermeintlichen Erben von Alfieri,
Giovan Battista Nicolini verfhrt, doch lie er das Projekt, darber zu
schreiben, wieder fallen. Fantastici Rosellini schrieb in der Widmung,
da der denkwrdige Fall von Parga schon in Dichtung und Prosa ver-
ewigt worden sei. Das romantische historische Drama setzte Lektren
und Archivforschungen voraus, daher zitiert die Autorin historische
Quellen aus der Histoire de la rgnration de la Grce von Franois-Char-
30
Sicher ist, da Europa uns nicht mehr wie 1821 lieb hat.
31
Er ist gekommen, um den Trken zu helfen, dieses schwachsinnige Gesindel zu
vernichten, das wagt, sich gegen seine Herren zu erheben, whrend sie nach Mei-
nung der europischen Presse die Majore mit hchster Menschlichkeit und Sanft-
heit behandeln.
Literarischer Philhellenismus von Frauen 183
les-Hugues-Laurent-Pouqueville (1825) und aus dem 1820 in Paris an-
onym erschienen Expos des faits qui ont prcd et suivi la cession de Parga
dieses Werk wurde Andrea Mustoxidi zugeschrieben. Das Geschehnis ist
in fnf Akte aufgeteilt und es inszeniert den Verrat der Englnder, den
Verdacht, die ngste und die Entschiedenheit der Einwohner von Parga,
die schlielich mit Wrde ihre Heimat verlassen und ihre Toten vor der
Schande des Ali Pascha retten. Die Autorin bercksichtigt die Einheit
der Zeit, aber nicht des Ortes. Formal handelt es sich also um einen
Kompromiss zwischen der Klassik und der Romantik, wie er fr das
Theater Byrons typisch ist. Die dargestellte allgemeine Situation wird
durch die ehrliche und krftige Liebe von Carlo, dem Sohn des engli-
schen Gouverneurs Maitland, zu Primas Nikeforos Tochter Eudossia
kompliziert. Carlo protestiert gegen die ungerechten Staatsaffren und
gegen den englischen Verrat. Am Ende nimmt er sich das Leben und ver-
flucht die Nachfahren von Albion.
Ein weiteres Echo der griechischen Begebenheiten im XIX. Jahrhun-
dert findet man bei bedeutenden Schriftstellern wie Ippolito Nievo,
Giosue Carducci und Giovanni Pascoli: Eigentlich sind Pascolis Hym-
nen A Giorgio navarco ellenico und Ad Antonio Fratti schwach, whrend
die literarischen Beitrge von Nievo und Carducci deutlich relevanter
sind. Ippolito Nievo bersetzte 1859 aus dem Franzsischen die in Paris
von Marino Vrets herausgegebenen Volkslieder in Versen; ein anderes
in Prosa bersetztes Volkslied ist in seinen Bekenntnissen Confessioni
dun Italiano zitiert, wo auch der Schriftsteller Rigas Velestinls erwhnt
wird; Dort spielt das zeitgenssische Griechenland eine relevante Rolle:
Die Wiedergeburt der Schwesternation wird hier als Vorlufer des italie-
nischen Risorgimento interpretiert.
184 Arnaldo di Benedetto
Literaturverzeichnis
Quellen
De Coureil, Giovanni Salvatore: Nuova grammatica della lingua inglese per gli italiani
compilata sulle grammatiche precedenti di Barker, di Vergani e di Peyton colla pronunzia
accanto ad ogni aprola inglese. Livorno 1816.
Guerrazzi, Francesco Domenico: La battaglia di Benevento. Sstoria del secolo 13. Un Dis-
corso sopra le condizioni della odierna letteratura in Italia. Mailand 1845.
Palli Bartolommei, Angelica: Alessio ossia Gli ultimi giorni di Psara romanzo istorico.
[o.O.] 1827.
: Racconti, Successori Le Monnier. Florenz 1876.
Stendhal: Armance ou quelques scnes dun salon de Paris en 1827. Paris 1827.
Viscomte de Chateaubriand, Franois Ren: Note sur la Grce, nouvelle dition, augmen-
te, revue et corrige. Paris 1826.
Forschungsliteratur
DAnnunzio, Gabrile: Mondadori. Teneo te Africa, in Prose di ricerca , Bd. III. Mai-
land 1962.
Bertoncini, Giancarlo: ,Una bella invenzione. Giuseppe Montani e il romanzo storico.
Neapel 2004.
Corrieri, Susanna: Il torchio fra ,palco e ,tromba. Uomini e libri a Livorno nel Settecento.
Modena 2000.
Di Benedetto, Arnaldo: ,Arrivammo a Firenze . La Toscana di Vittorio Alfieri
fra esperienza e mito, in: Ders. (Hrsg.): Il dandy e il sublime. Nuovi studi su Vittorio
Alfieri. Florenz 2003.
: Le nazioni sorelle. Momenti del filellenismo letterario italiano, in: Fancesco
Bruni (Hrsg.): Niccol Tommaseo: popolo e nazioni. Italiani, corsi, greci, illirici. Rom,
Padua 2004.
Dionisotti, Carlo: Un sonetto su Shakespeare, in: Ders. (Hrsg.): Ricordi della scuola
italiana. Rom 1998.
Goethe, Johann Wolfgang: sthetische Schriften. 18211824. Stefan Greif/Andrea Ruh-
lig (Hrsg.): Frankfurt a. M. 1998.
Gorani, Giuseppe: Dal despotismo illuminato alla Rivoluzione [17671791], in:
Mondadori. Le memorie di Giuseppe Gorani, Bd. III. A. Casati (Hrsg.): Mailand
1942.
Manzoni, Alessandro: Tutte le opere. I promessi sposi. Testo definitivo del 1840, Bd. 2,1.
Alberto Chiari (Hrsg.): Mailand 1958.
Montani, Giuseppe: Scritti letterari. Angiola Ferrarsi (Hrsg.): Torino 1980.
Palli, Angelica Bartolommei: Alessio ossia gli ultimi giorni di Psara. Romanzo istorico.
Giancarlo Bertoncini (Hrsg.): Livorno 2003.
Parra, Anton Ranieri: Un francese italianato traduttore dallinglese: Giovanni Salvatore
De Coureil. Livorno 1975.
Venturi, Franco: Settecento riformatore. La prima crisi dellAntico Regime, 17681776,
Bd. 3. Turin 1969.
Wagner, Richard: Mein Leben. Bd. 1. Mnchen 1911.
Freiheit 1821 185
Helmut Pfotenhauer
Freiheit 1821: sthetisch und historisch
(E. T. A. Hoffmann, Jean Paul)
1820, wenige Monate vor Beginn des griechischen Aufstandes, schreibt
E.T.A. Hoffmann eine Satire auf den deutschen Philhellenismus: Die
Irrungen. Fragmente aus dem Leben eines Fantasten.
1
Darin lsst er
einen Berliner Baron, Theodor von S., von einer griechischen Vita mit
vornehmen griechischen Vorfahren und mit der Mission, Griechenland
von den Trken zu befreien, trumen und sich als eitler Geck und Ha-
senfu lcherlich machen. Seine eingebildete Expedition endet bereits
in Zehlendorf. Theodor trifft neben einer vermeintlichen griechischen
Frstin, die ihren Mann und den Retter ihres Volkes sucht, auch auf eine
schwrmerische Bankierstochter, die ihn an sich fesseln will und sich
ihm in neugriechischer Tracht vorstellt. Um sich ihren Traum von grie-
chischem Heldentum recht plastisch einbilden zu knnen, muss sie, so
heit es im Text, ausreichend in Friedrich Richters Werken belesen
sein.
2
Bei Jean Paul kann man lernen, was Phantasterei ist.
Jean Paul hat neben seinen vielen anderen Traumgesichten 1821, kurz
nach Beginn der griechischen Befreiungskriege, tatschlich auch einen
griechischen Traum literarisch getrumt. Hoffmann hat ihn wohl nicht
zur Kenntnis genommen. Es ist der fiktive Traum einer griechischen
Mutter in den letzten Tagen des Juli-Monats 1821.
3
Darin schildert Jean
1
Hier nach der Ausgabe: Hoffmann, E.T.A.: Smtliche Werke in sechs Bnden.
Lebens-Ansichten des Katers Murr. Werke 18201821, hrsg. von Hartmut Steinecke u.
Mitarb. v. Gerhard Allroggen. Wulf Segebrecht u. a. (Hrsg.), Bd. 5: Frankfurt a.M.
1992, S. 461507.
2
Hoffmann: Die Irrungen. Fragmente aus dem Leben eines Fantasten, S. 500.
3
Gesichte einer griechischen Mutter. Ein Traum in den letzten Tagen des Juli-
Monats, erschienen in der Nachlese zu den Vermischten Schriften (Aufstze
17951825), hier nach: Jean Paul: Smtliche Werke. Vermischte Schriften II, II. Ab-
teilung, Bd. 3. Norbert Miller (Hrsg.): Mnchen 1978, S. 993996. Vgl. den Kom-
mentar II.4, S. 717f. Der Herausgeber der historisch-kritischen Ausgabe des Tex-
tes (Jean Pauls smtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Verstreute gedruckte
186 Helmut Pfotenhauer
Paul, wie die Enkel der Lehrer Europas in einer mrderischen Gegenwart
von Tieren versklavt werden. In dieser Gegenwart, 1821, trumt sich die
Mutter eines griechischen Opfers in jene Zeit zurck, in der es die Frei-
heit und die Tempel als Zeichen griechischer Gre noch gab, in die An-
tike also, ins alte Athen. Aber die steinernen Denkmale der alten Gtter
strzen im Traum zusammen; sie knnen dem griechischen Volk nicht
helfen. Eine wahnsinnige Seherin, eine Kassandra, sieht das Unglck
der Griechen voraus:
4
Sie sieht die Versklavung Griechenlands durch das
rmische Reich, sie sieht Konstantinopel, eine neue Siebenhgelstadt
mit sieben Kerkertrmen, in denen ihre griechischen Kinder gefangen
liegen. Sie kommen mit ihren Ketten, die Barbaren! O ihr Kinder, ihr
werdet gebunden und liegt Jahrtausende in Ketten. Sie verzweifelt und
sieht keine Rettung und schreit: So gibt es denn keinen Gott. Da sieht
sie sich in Athen pltzlich vor dem Altar des unbekannten Gottes, den
schon Paulus in der Apostelgeschichte als den Altar des christlichen
Gottes bezeichnet hatte.
5
Sie ruft ihn um Hilfe an und wird erhrt. Erst
der christliche Gott sprengt schlielich die Ketten und holt einen neuen
Themistokles und Alexander zur Hilfe gemeint ist wohl der russische
Zar Alexander, auf dem damals anfangs die Hoffnungen ruhten. Das
prophetische Traumgesicht ist wieder in der Gegenwart angelangt.
Die Rollenverteilung scheint in Hoffmanns Erzhlung einfach: Jean
Paul als der phantastische Propagandist der griechischen Sache, Hoff-
mann als der Skeptiker, der den Philhellenismus als deutsche Mode
Schriften, Erste Abt., Bd. 18. Weimar 1963), Eduard Berend, meint, da Jean Paul
nicht zuletzt durch Artikel von Friedrich Wilhelm von Thiersch, Rektor der
Mnchner Universitt und Philhellene, in der Augsburger ,Allgemeinen Zeitung
angeregt worden sei (S. XXXII). Dort sind 1821 unter Titeln wie Bemerkungen und
Nachrichten ber die neuesten Begebenheiten im eigentlichen Griechenland Berichte ber
die Lage mit Meldungen ber angebliche trkische Greuel erschienen.
Zu Jean Paul und den Ereignissen von 1821 vgl. neuerdings: Polaschegg, An-
drea: Der andere Orientalismus. Regeln deutsch-morgenlndischer Imagination im
19. Jahrhundert. Berlin, New York 2005, S. 219277, hier: S. 266275; dort auch
zu Hoffmanns griechischen Erzhlungen, S. 242245. Zu den Wenigen, die in
der Forschung die kleine Schrift Jean Pauls bisher beachtet haben, gehrt auch
Schulz, Gerhard: Die deutsche Literatur zwischen franzsischer Revolution und Restau-
ration, Zweiter Teil: Das Zeitalter der napoleonischen Kriege und der Restauration.
18061830. Mnchen 1999, S. 159.
4
Jean Pauls Text drfte unter anderem auch von Schillers Kassandra-Gedicht
von 1802 beeinflut sein. Vgl. den Kommentar in: Jean Pauls Smtliche Werke.
Historisch-kritische Ausgabe. Verstreute gedruckte Schriften, Erste Abt., Bd. 18. Edu-
ard Berend (Hrsg.): Weimar 1963. S. XXXIIff.
5
Apg. 17, 23.
Freiheit 1821 187
durchschaut und ber ihn seinen Spott ausgiet. Aber so einfach ist es
nicht. In Wahrheit gibt es zwischen den Texten, die noch nicht vollstn-
dig aufgezhlt sind, subtile Verbindungen. Sie drften ihren Autoren gar
nicht bewut geworden sein, existieren aber trotzdem. Ihre Rekonstruk-
tion, die im folgenden vorgenommen werden soll, zeigt, wie das Thema
der politischen Freiheit bei beiden Autoren und Jean Paul war hier of-
fenkundig Hoffmanns Vorbild, nicht Gegenstand seines Spottes in das
des freien literarischen Spiels moderner Autorschaft transponiert wird.
Die wahren Helden, so hiee das, sind die Schriftsteller, die sich die
Freiheit nehmen, frei und mit allen Wassern sthetischer Reflexionskraft
gewaschen ber Freiheit zu schreiben. Die Parteinahme gegen Unfrei-
heit ist hier, in einer der weniger direkten Optionen im Bekenntnisjahr
1821, nicht primr oder nicht ausschlielich politisch motiviert, sondern
selbstreferentiell auf den Fortschritt literarischer Reflexionskultur gegen-
ber der klassischen Antike und dem Klassizismus um 1800 bezogen.
Befreiung ist analog zur politischen und auf eine indirekte, nicht leicht
verstndliche Weise solidarisch Entfesselung romantischer Einbildungs-
kraft.
Auch E.T.A. Hoffmann befasst sich 1821 noch einmal literarisch mit
dem griechischen Unabhngigkeitstraum. Er greift seine Erzhlung vom
Vorjahr wieder auf und nennt sie nun Die Geheimnisse. Fortsetzung
des Fragments aus dem Leben eines Fantasten: die Irrungen.
6
Theodor,
der eingebildete Philhellene, tritt nun zurck hinter die Dokumente, die
ber ihn und die Griechin vorliegen er spielt noch eine Rolle, aber
keine entscheidende mehr. Ein Schriftsteller namens Hoffmann viel-
mehr tritt in den Vordergrund, der diese fragmentarischen berlieferun-
gen, die ihm zugetragen werden, zu einer Geschichte zusammensetzen
muss. Ein Verwirrspiel mit Schnspelpold, dem Aufpasser der Griechin
beginnt, in dem es um die Gefhrdung der erzhlten Geschichte mehr
noch als um die Gefahren der politischen Geschichte geht. Die Satire
des Philhellenismus wird nach den Ereignissen ab Mrz 1821 zurck ge-
nommen. Die Fortsetzung der Satire Die Irrungen ist genau genommen
keine Fortsetzung, sondern eine Revision. Das Lcherliche tritt in den
Hintergrund; der seinem Philhellenen der ersten Erzhlung auktorial
berlegene Erzhler wird nun in ein phantastisches und artistisches Ver-
6
Hoffmann, E.T.A.: Die Geheimnisse. Fortsetzung des Fragments aus dem Leben
eines Fantasten: die Irrungen, in: Smtliche Werke in sechs Bnden. Lebens-
Ansichten des Katers Murr. Werke 18201821, Bd. 5. Hartmut Steinecke (Hrsg.),
S. 509568.
188 Helmut Pfotenhauer
wirrspiel um Autorschaft hinein gezogen. Daraus ergeben sich dann
allerlei Geheimnisse, die aber eben keine bloen Irrungen mehr
sind. Alle Register poetischer Selbstreflexion des Erzhlens werden ge-
zogen, das Spiel der Abhngigkeit des Erzhlens von der ueren Wirk-
lichkeit und den Informationen, die sie bereit hlt, sowie deren poeti-
sche Aufhebung wird gespielt die Referenz romantischer Freiheiten
gegenber dem politischen Freiheitskampf. Aber direkte politische Be-
kenntnisse, wie sie der Hoffmann-Kritiker Wilhelm Mller, der Grie-
chen-Mller, gegenber Hoffmann einfordert,
7
werden nicht daraus.
Freie, d. h. autonome Literatur ist die Antwort auf die in der geschicht-
lichen Realitt gestellte Frage nach der Freiheit, nicht Gebrauchsliteratur
in deren Interesse.
8
Jean Paul, so mchte ich zeigen, spielt dabei nun
pltzlich eine Rolle als avanciertes literarisches Modell; er figuriert nicht
mehr nur als Ziehvater verstiegener Trume.
In seiner Vorschule der sthetik von 1804 spricht Jean Paul den Griechen
der Antike und ihrer Kunst in gut Winckelmannscher Tradition den Sta-
tus eines Ideals zu.
9
Aufgrund der klimatischen Vorzge, die sie gens-
sen, und der politischen Freiheit den freigelassenen Brgern allerdings
nur ermglicht durch den Arbeitflei der Sklaven
10
, seien unwieder-
bringliche kulturelle Steigerungsformen mglich gewesen. Das Mensch-
liche sei gttlich, das Gttliche menschlich geworden. Das Sinnliche sei
7
Vgl. den Kommentar in Hoffmann: Die Irrungen. Fragmente aus dem Leben
eines Fantasten, S. 1067.
8
Ich folge hier einer Anregung von Wulf Segebrecht (Von der Graecomanie-Kritik
zur poetischen Reaktion auf den Philhellenismus. E.T.A. Hoffmanns Erzhlun-
gen ,Die Irrungen und ,Die Geheimnisse , in: Wulf Segebrecht (Hrsg.): Europa-
visionen im 19. Jahrhundert. Vorstellungen von Europa in Literatur und Kunst, Geschichte
und Philosophie. Wrzburg 1999, S. 171ff.); Segebrecht fhrt dies in Bezug auf Jean
Paul nicht nher aus.
Segebrechts Studie steht aber am Beginn eines neuen, nunmehr differenzierteren
Interesses an Hoffmanns Doppelerzhlung in der neueren Forschung; vgl. neuer-
dings Lehmann, Marco: Kabbalistische Mysterien des Selbst. Schrift und Iden-
titt in E.T.A. Hoffmanns Doppelerzhlung ,Die Irrungen / Die Geheimnisse,
in: E.T.A. Hoffmann Jahrbuch 14/2006, S. 7ff.; dort auch ein, wenn auch nur flch-
tiger Verweis auf Jean Paul (S. 19). Vgl. auch: Praet, Danny/Janse, Mark: ,Dem
Namen nach. Greek and Jewish references and word play in the Character names
of E.T.A. Hoffmanns ,Die Irrungen and ,Die Geheimnisse, in: E.T.A Hoffmann
Jahrbuch 13/2005, S. 78ff.
9
Jean Paul: Vorschule der sthetik, IV. Programm, 16, in: Smtliche Werke, I.
Abt., Bd. 5. Norbert Miller (Hrsg.): Mnchen 1963, S. 6771.
10
Ebd., 16, S. 68.
Freiheit 1821 189
fr sich bedeutend gewesen, ohne Dazwischenkunft der Reflexion.
Nmlich nicht die bloe Gelegenheit, das Nackte zu studieren, sagt
Jean Paul in Fortfhrung der Winckelmannschen Gedancken ber
die Nachahmung und seiner Kunstgeschichte, stellte den griechischen
Knstler ber den neuern, sondern jene sinnliche Empfnglichkeit tat
es, womit das Kind, der Wilde, der Landmann jeden Krper in ein viel
lebendigeres Auge aufnimmt als der zerfaserte Kultur-Mensch, der hin-
ter dem sinnlichen Auge steht mit einem geistigen Sehrohre.
11
Jean Paul aber stellt im Gegensatz zu Winckelmann dieser griechi-
schen Krperwelt dann doch auch eine christlich-romantische Geister-
welt positiv gegenber, die zwar das blo Sinnliche entwerte, um aber
auf einen Himmel ber ihm zu verweisen.
12
So blhe denn in der ro-
mantischen Poesie das Reich des Unendlichen ber der Brandsttte der
Endlichkeit auf.
13
Der Autor tritt in der kulturellen Hierarchie an die
Stelle des plastischen Knstlers, der vormals das Sinnliche objektiv vor-
gestellt hatte der Autor, der dem neuen bersinnlichen seine Mytho-
logien und Geschichten zuschreibe. Es ist auch der Autor, der das End-
liche und darin humoristisch sich selbst relativiert, um indirekt auf das
Unendliche zu verweisen.
14
Die Griechen brauchen jetzt, in der neuen Welt, einen poetischen
Geist, der sie aus der Unterdrckung in das Reich der Trume und der
Phantasie entrckt und erhebt. Der Autor ist das imaginative Pendant
des Freiheitskmpfers in dsterer, unfreier Zeit. Er rettet hinweg ber
eine mrderische Gegenwart,
wo Christen von Tieren den Tieren vorgeworfen [], und die Enkel der Lehrer
Europas zu neuen tiefern Sklaven alter despotischer Sklaven niedergekrmmt
[werden]; eine Zeit, wo das lichte milde Europa vor einem offnen Tiergarten los-
gelaner, auf gebundne Christen losstrzender Tiger mit ohnmchtigen Trnen
stehen mu und vor Stdten voll Schlachtfelder ohne Schlachten.
15
Im Traum werden zunchst die alten Gtter lebendig; sie knnen aber
nicht mehr helfen. Da lsst der Traumgeber den vormals noch unbe-
kannten Gott in Erscheinung treten. Die griechische Seherin, die ihre
Shne auf den Schlachtfeldern verliert, und die in der Not eine Vision
11
Ebd., 17, S. 72.
12
Ebd., V. Programm, ber die romantische Poesie, S. 82101.
13
Ebd., 23, S. 93.
14
Ebd., VII. Programm, ber die humoristische Poesie, S. 124144.
15
Gesichte einer griechischen Mutter. Ein Traum in den letzten Tagen des Juli-
Monats (Jean Paul: Smtliche Werke. Vermischte Schriften II, II. Abteilung, Bd. 3),
S. 993.
190 Helmut Pfotenhauer
von der knftigen Errettung berkommt, ruft den Christen-Gott an:
Unbekannter Gott, betet sie, bist Du der Gott meiner Kinder? und
stehest ihnen bei, und die wilde Riesenschlange hat sie nur umwunden,
nicht vergiftet? Und dann erblickt sie die rettenden Schiffe jenes neuen
Themistokles und jenes anderen Alexander, der seine Krone als Helm
schtzend auf das Vaterland legt, und erwacht selig aus diesem Traum.
Jean Paul hat viel gelesen, um sich ber die Fremdherrschaft in Grie-
chenland kundig zu machen. Er kennt Sonnini und dessen Reise nach
Griechenland und der Trkei von 1801,
16
den auch E.T.A. Hoffmann kon-
sultiert hat.
17
Jean Pauls Liste der Libri legendi
18
verzeichnet ferner
eine Geschichte Griechenlands von Mitford
19
sowie Wilhelm Dru-
manns Ideen zur Geschichte des Verfalls der griechischen Staaten von 1811.
20
Die von Jean Paul regelmig angelegten und fr ihn so wichtigen Ex-
zerpthefte nennen berdies Sievers Reisebeschreibung, derzufolge die
Griechen unter den Trken kein Haus und Zimmer wei tnchen dr-
fen
21
oder auch aktuelle Tageszeitungen wie die Neckarzeitung von
1822,
22
nach der die Christen bzw. die Griechen in der Trkei ihre Kir-
chen nicht reparieren oder herstellen, nur in Htten ohne Stockwerk
wohnen drfen, alle drei Tage muhammed. Reisende bei sich ernh-
ren mssen, keine Justiz ausben knnen und keine Zeugen und Klger
16
Sonnini de Manoncourt, Charles Nicolas Sigisbert: Voyage en Grce et en Turquie.
Paris 1801, gelesen in der bersetzung von Weyland: Reise nach Griechenland und
der Trkei auf Befehl Ludwigs XVI. unternommen von C. S. Sonnini, 1801; vgl. dazu
Jean Paul: Exzerpte, Fasz. IIc, Bd. 34 (1802).
17
Vgl. den Kommentar zu den Quellen der Irrungen und der Geheimnisse,
Hoffmann: Die Irrungen. Fragmente aus dem Leben eines Fantasten, S. 1064.
Hoffmann konsultiert auch Bartholdy, Jakob L. S.: Bruchstcke zur nhern Kenntnis
des heutigen Griechenlands, gesammelt auf einer Reise von J. L. S. B. Im Jahre 1803/1804.
Erster Theil. Berlin 1805.
18
Vgl. Jean Pauls smtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe (HKA). Dichtun-
gen, Merkbltter, Studienhefte, Schriften zur Biographie, Libri legendi, Zweite Abt.,
Bd. 6. Gtz Mller (Hrsg.): Weimar 1996, S. 895.
19
Mitford, William: Geschichte Griechenlands. Aus dem Englischen von J.F. Baron.
2 Bde. Breslau 18001801, vgl den Kommentar zu HKA II.6, S. 209. Eine weitere
bersetzung von Heinrich Abr. Eichstdt erschien in 6 Bden, Leipzig 18021808.
20
Jean Pauls smtliche Werke, HKA Bd. 6: Libri legendi, S. 927. Vgl. den Kommen-
tar, S. 255.
21
Fasz. IVb, Bd. 7 (1823/24).
22
Vgl. zu den Zeitschriften, die damals Nachrichten ber den griechischen Frei-
heitskampf brachten, Scheitler, Irmgard: Griechenlyrik (18211828). Literatur
zwischen Ideal und Realitt, in: Internationales Jahrbuch der Bettina von Arnim-
Gesellschaft 67/1994/95, S. 196ff.
Freiheit 1821 191
sein sowie keine Waffen tragen drfen, nicht einmal einen Stock, kein
gesatteltes Pferd besteigen, keinen Wein verkaufen, sich keinen Schnurr-
bart wachsen lassen, nicht Namen noch Zeichen noch Kreuze auf ihre
Pettschafte setzen drfen.
23
Jean Paul unterschlgt aber auch nicht Be-
richte ber christlichen Vandalismus in Griechenland, wie den des
Herrn Michael Fourmont, franzsischen Abbs und Akademikers, der
laut der Zeitschrift Eos vom 18. 3. 1820 im Jahr 1729 auf Befehl Lud-
wig XV. Griechenland bereitste.
24
Dieser habe griechische Stdte nie-
derreien lassen und habe Inschriften, nachdem er sie abgeschrieben,
auskratzen oder absprengen
25
lassen.
E.T.A. Hoffmann, der dem renommierten lteren Autor die, wenn
auch reservierte Vorrede zu seinem Erstlingswerk, den Fantasiestcken in
Callots Manier von 1813 verdankt, hat ein ambivalentes Verhltnis zu
Jean Paul gehabt, wie an der Griechenfrage zu ersehen ist. In den Irrun-
gen ist er noch fr ,fantastische Trume verantwortlich, in den Geheim-
nissen wird er zwar nicht mehr direkt zitiert, steht aber umgekehrt nun
unverkennbar Pate fr jenes Spiel mit der Autorschaft, das nun, nach
dem Mrz 1821, als humoristische Inszenierung alles Griechischen und
des ber die Griechen Schreibenden die bloe Satire ber die Griechen-
mode ersetzt. Die Schriftsteller-Figur Hoffmann in der Erzhlung ist
wie der in Jean Pauls Schriften allgegenwrtige Jean Paul konfiguriert.
Er wird fr seine Darstellung der Geschichte von Schnspelbold zur Re-
chenschaft gezogen; sein knftiges Schreiben ist von Strungen be-
droht. Wie bei Jean Paul, etwa imHesperus, in dem der fiktive Autor von
Hundspost, von geschriebenen Informationen also, die ihm ein Hund
zutrgt, abhngig ist, muss Hoffmann die Geschichte des griechen-
begeisterten Baron Theodor von S., so wie er es im Taschenkalender von
1821 versprochen hat, fortsetzen. Aber er ist abhngig davon, weiteres
schriftliches Material als Vorlage zu erhalten, Material also, ber das
er nicht selbst verfgt. Es beginnt nun jenes Spiel um Autorschaft, ihre
Abhngigkeit von den Zufllen der realen Gegebenheiten und den
Informationen, die diese hergeben sowie die freie poetische Erhebung
23
Fasz. IIc, Bd. 48 (1820).
24
Eos, Nr. 22 vom 18. 3. 1820; vgl. Jean Pauls Exzerpt Fasz. IIc, Bd. 48 (1820): Der
Abb und Akadem. Michael Fourmont ri in Griechenland Mauern und Tempel
zusammen, z. B. ganz Sparta war die 5te Stadt die er im Pelopones umgeworfen,
damit man nicht wisse, wo alles gestanden, so Festungen; die Inschriften lie er
auskratzen, nachdem er sie abgeschrieben. Brachte 3000 zusammen; die meisten
noch unediert; im Verdacht des Verflschens.
25
Ebd.
192 Helmut Pfotenhauer
darber. Hoffmann muss ihm zugestellte Briefe ausschlachten, und er
kommt in Besitz einer geheimnisvollen himmelblauen Brieftasche, die
im ersten Teil schon Theodor zugefallen war. In ihr befinden sich nur
ganz kleine, sehr dnne, mit feiner Schrift beschriebene Blttchen, und
sonst nichts anders.
26
Aus ihnen muss Hoffmann sich die weitere Ge-
schichte zusammenreimen in deutlichem Anklang an den Jean Paul
im Leben Fibels, des Erfinders des ABC-Bchleins. Dessen Biographie
muss sich der fiktive Jean Paul des Textes nach verstreuten Makulatur-
blttern, heraus gerissen aus einer frheren Lebensbeschreibung und
zerstreut und fragmentarisch berliefert als Pfeffer-Tte oder Papierdra-
che, zusammenleimen. Auch das Zusammenbinden der Autobiographie
des Katers Murr mit den Makulaturblttern, welche fragmentarisch ber
die Biographie des Musikers Johannes Kreisler berichten, durch den fik-
tiven Herausgeber Hoffmann in einem Buch, steht in dieser Tradition.
Hoffmann, so heit es in Die Geheimnisse, ordnete jene vereinzelten
Blttlein aus der Brieftasche, verglich sie mit den von Baron Achatius
von F. (einer anderen Schrift-Quelle) mitgeteilten Notizen und brachte
beides, Blttchen und Notizen, soviel mglich in Zusammenhang.
27
So viel mglich die Autorschaft ist gefhrdet, weil fremdbestimmt.
Hoffmann ist von griechischen Einbildungen kaum besser geschtzt
als der Phantast Theodor. Aber Hoffmann ist der Schriftsteller im Text.
ber ihn triumphiert Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann,
der den Text schreibt und mit ihm sein Spiel treibt. Er verwandelt da-
mit analog den Befreiern Griechenlands Heteronomie in Autono-
mie. Es fllt auf, da diese auktoriale Inszenierung von Beschrnkung,
humoristischer Relativierung und reflexiver Befreiung erst nach dem
Mrz 1821 in die Erzhlung eintritt, und da Jean Paul in dieser neuen,
zeitgemen Akzentuierung als das Inbild humoristischer Poesie in
Deutschland eine andere Funktion zukommen muss. Er wandelt sich
unausgesprochen vom Verspotteten zum kongenialen Sptter. Wenn
Hoffmann jene Gesichte einer griechischen Mutter, jene Traumvision Jean
Pauls aus Anlass der anbrechenden Befreiungskmpfe gekannt htte,
dann htte er erkannt, wie auch in dieser scheinbar rein politisch ge-
meinten Schrift der auktoriale Triumph mitschwingt, ja am Ende die
Oberhand behlt. Denn die ngste dieser Mutter, ihr Alptraum, werden
ja auch mit der groen Geste des literarischen Traumgebers inszeniert,
des modernen, romantischen Schriftstellers, der hnlich dem rettenden
26
Hoffmann: Die Irrungen. Fragmente aus dem Leben eines Fantasten, S. 522.
27
Ebd., S. 527.
Freiheit 1821 193
christlichen Gott das Sinnliche, die physische Not, ins bersinnliche,
Metaphysische aufzuheben und zu befreien wei.
Hoffmanns griechische Geschichte gelangt nicht zu einem eindeuti-
gen Ende. Alles bleibt im Zwielicht des blo durch zufllige Vermittlung
berlieferten. Einen Professor fragt Baron Theodor, ob es denn wahr
sei, da die Trken ihre Gefangenen im Krieg aufs Grausamste ums
Leben brchten.
28
Darauf hlt dieser eine Art Vorlesung ber das Vlker-
recht, welches gegen Osten zu in seiner Verbindlichkeit immer mehr
abnehme. So msse man denn die Handlungen der Trken gegenber
ihren Gefangenen mehr nach sthetischen und utilitaristischen Ma-
stben beurteilen als nach denen unserer Vorstellung von Recht. Schn
sei jenes Abtun wehrloser Gefangener nicht, aber oft ntzlich. Aber
selbst auf diese Ntzlichkeit verzichteten die Trken neuerdings, indem
sie sich gelegentlich mit bloem Ohrabschneiden begngten. Wenn es
den Griechen jedoch einfallen sollte, mit Gewalt ihr Joch abstreifen zu
wollen, dann trten die im Orient blichen Martern wieder in Kraft.
Und der Professor zhlt sie nun mit seinem Reichtum historischer
Kenntnisse bis ins Detail prahlend und gensslich auf:
Er begann mit dem geringen Ohr- und Nasenabschneiden, berhrte flchtig das
Augenausreien oder -ausbrennen, lie sich nher aus ber die verschiedenen Ar-
ten des Spieens, gedachte rhmlich des humanen Dschingiskhan der die Leute
zwischen zwei Bretter binden und durchsgen lie, und wollte eben zum langsa-
men Braten und In-l-Sieden bergehen als pltzlich zu seiner Verwunderung
der Baron Theodor von S. mit zwei Sprngen hinaus war durch die Tre.
29
Es bleibt unklar, ob Theodor daraufhin wirklich noch in die Befreiungs-
kriege zieht; wahrscheinlich ist dies nicht. Wovon wir erfahren, ist nur
der Professorendiskurs ber angebliche trkische Unmenschlichkeiten.
Gezeigt wird, wie der zivilisierte Professor offenbar lustvoll Anteil nimmt
am Barbarischen. Nichts ist eindeutig in diesem Verwirrspiel, auch nicht
die im Philhellenismus sonst scheinbar so klaren Grenzziehungen zwi-
schen Zivilisation und Barbarei. Auch was es letztlich mit der frstlichen
Griechin und mit Schnspelpold auf sich hat ob sie wirklich dazu aus-
ersehen ist, dem knftigen Erretter Griechenlands, Teodoros Capita-
naki, die palmen- und lorbeerumwundene Krone zu reichen, ob Schns-
pelpold ihr Vormund oder ein feindlicher Magus sei, der Theodor als
Teraphim fr die Griechin erfindet, um sie in seine Gewalt zu bringen
und ihre politische Mission zu verhindern; all diese Dinge bleiben Ge-
28
Ebd., S. 533.
29
Ebd., S. 534.
194 Helmut Pfotenhauer
heimnisse. Denn die Blttlein, auf denen sie mitgeteilt werden, sind
unvollstndig; und es ist nicht ganz klar, welches von wem stammt. Die
Erzhlung bricht ab. In einem Nachtrag meldet sich ein Herausgeber zu
Wort, der noch einmal ber Hoffmann berichtet und wie er in Wahr-
heit zu all diesen Geschichten gekommen sei. Aber auch das ist nur
eine, seine Version. Fest steht nur, da das, was im vorigen Jahr (1820)
aus der Luft gegriffene leere Fabel schien, Andeutung ins Blaue hinein
(nmlich der Befreiungskampf der Griechen), in diesem Jahr (1821)
in den Ereignissen des Tages eine Basis gefunden.
30
Und darunter
steht: Geschrieben im Junius 1821. Hoffmann macht also ausdrck-
lich darauf aufmerksam, da sich durch die Ereignisse von 1821 Ent-
scheidendes gendert habe nicht nur in der Wirklichkeit, sondern
auch in seiner Art des Erzhlens. Alles andere als dieses Faktum des Ein-
schnittes aber sind Gerchte, Einbildungen, Erzhlungen, geschpft aus
ungewissen Quellen. Nur der Autor, der sich souvern darber erhebt
und mit all dem spielt sowie die Erhebung des griechischen Volkes ste-
hen fest.
Nicht alle haben diesen spielerischen Umgang mit der Zeitgeschichte
geschtzt. Wilhelm Mller hlt ihn fr frivol. Wir erhalten nichts als
einen willkrlich zusammengereiheten Mischmasch von nrrischen
Spukgeschichten, zauberhaften Foppereien und wunderlichen Begegnis-
sen. Hoffmann habe so den Griechischen Freiheitskampf mit seinen kab-
balistischen Phantastereien in Verbindung gebracht. Und dies sei sehr
unwrdig der groen Sache.
31
Mller selbst zieht es vor, Gesinnungen
einzufordern. Schluss msse sein mit den Phantastereien und Idealisie-
rungen. Nicht vom alten freien Griechenland schwrmen, sondern das
neue untersttzen, sei die Parole. Erkennt ihr es nicht wieder, das freie
Griechenland?, fragt er die neuhumanistischen Verehrer des Alten in
seinen Liedern der Griechen.
32
Kehrt heim, ihr Hochentzckten!
der Weg [zum Alten, H.P.] ist gar zu weit. / Das Alt ist neu geworden,
die Fern ist euch so nah, / Was ihr ertrumt so lange, leibhaftig steht es
da []
33
Fr auktoriale Selbstbezglichkeiten und literarische Autono-
mie-Gebrden ist da kein Platz. Aufruf zur Untersttzung, Handlungs-
30
Ebd., S. 568.
31
Zitiert nach dem Kommentar der hier verwendeten Hoffmann-Ausgabe, S. 1067.
32
Die Griechen an die Freunde ihres Altertums (Oktober 1821), in: Wilhelm Ml-
ler: Werke, Tagebcher, Briefe. Gedichte 1, Bd. 1. Maria-Verena Leistner (Hrsg.):
Berlin 1994, S. 219.
33
Ebd.
Freiheit 1821 195
anleitung, politisch eindeutige Stellungnahme will diese Lyrik sein. Das
literarische Griechenland um 1821 hat, wie man sieht, ganz gegenstz-
liche Gesichter.
Hoffmann stirbt im Juni 1822. Jean Paul hat ihn um etwas mehr als
drei Jahre berlebt. In dieser Zeit befasst er sich noch einmal mit dem
griechischen Freiheitskampf. Selina oder ber die Unsterblichkeit der Seele
heit die Schrift, die dann schlielich unvollendet geblieben ist. Darin
tritt ein Rittmeister Karlson auf, den man schon aus dem Kampaner Thal
von 1797 kennt und der inzwischen an den deutschen Befreiungskriegen
gegen Napoleon teilgenommen hat. Dessen Sohn Henrion zieht nun in
den griechischen Freiheitskampf. Ihm erschienen die blutenden Grie-
chen ohne Ketten im Felde und da entbrannte sein Herz und er schlug
seine Bcher zu, berichtet sein Vater.
34
Er zieht in die grimmigen Tier-
gefechte von Barbaren und in einen weltbrgerlichen Krieg, einen
Krieg, der ein anderer Erbfolgekrieg sei, da es darum gehe, ob nmlich
Bildung oder wieder Barbarei auf den Thron gelangen soll.
35
Vor der
Abreise erlebt Henrion zusammen mit seiner Geliebten Selina ein Ge-
witter.
Pltzlich war in Osten ein schwarzes feuerspeiendes Ungeheuer von Gewitter er-
wacht und spie auf der Schwelle des Tags sein wildes Feuer neben der stillen blas-
sen Sonne. [] Henrion sah mit entzckten Augen in den feurigen Morgen-
sturm, in die auflodernde Wolkenschlacht, zwischen deren Feuer die Sonne als
Heerfhrerin vorleuchtete. ,Dort im Osten, rief er begeistert, ,seh ich das Wetter-
leuchten der griechischen Waffen und hre Kanonendonner der Griechen ber
ihre Tyrannen rollen und niederfahren.
36
Henrion trumt nun, die allegorische Bedeutsamkeit der Szenerie wei-
terspinnend, von der Schnheit des Todes, der wie ein blitzender Todes-
engel herniederfahre. Denn mit ihm kommt die Unsterblichkeit. Der
Tod im Freiheitskampf bringt die Befreiung der Seele vom vergnglichen
Krper dies ist das groe Thema dieses Buches. Erhebung ist das
Motto; Erhebung ber die Beschrnkungen des Diesseitigen im Jenseits,
des Krperlichen im bersinnlichen, so, wie die der Griechen gegen die
Tyrannei. Henrion steht schlielich unter dem berhmten deutschen
General Normann vor der Festung Napoli di Romania, wie es im Text
heit, also dem griechischen Nauplion, wo es 1822 einen griechischen
34
Jean Paul: Selina oder ber die Unsterblichkeit der Seele, in: Smtliche Werke.
Spte Erzhlungen, Schriften, I. Abt., Bd. 6. S. 1112.
35
Ebd., S. 1113.
36
Ebd., S. 1136.
196 Helmut Pfotenhauer
Sieg ber die Trken gab. Er wird dort, so stellt sich am Ende heraus,
tdlich verwundet.
In diesem Sptwerk Jean Pauls treten die auktorialen Selbstinszenie-
rungen nunmehr zurck. Freiheit tritt mehr thematisch in Erscheinung:
als politische und als metaphysische. Denn der Begeisterung des Jng-
lings und dem Mitfhlen seiner Geliebten ber alle Entfernung hinweg,
den metaphysischen Potentialen der unsterblichen Seele also, kann die
Gefahr der physischen Vernichtung nichts anhaben. Henrion wird im
Freiheitskrieg schwer verwundet und stirbt wie gesagt schlielich. Aber
Selina bleibt mit dem unsterblichen Teil ihres Wesens bei ihm. Und den-
noch geht auch in diesen Text ein Jean Paul, eine fiktive Reduplikation
des Autors ein und agiert zusammen mit den anderen fiktiven Figuren.
Er ist aber nun nicht mehr auf Hundepost und Papierabflle angewie-
sen, um seine und ihre und die griechische Geschichte zu schreiben.
Hier, ganz am Ende von Jean Pauls Schreiben, treffen wir auf einen ern-
sten, nicht mehr humoristischen, mit der Autorschaft frei spielenden
Schriftsteller.
Dies ist also eine weitere, letzte Option, literarisch mit dem griechi-
schen Befreiungskampf umzugehen: neben der satirisch-kritischen, der
politisch-propagandistischen und affirmativen, der humoristisch-reflexi-
ven und sthetischen die tiefsinnig ins Metaphysische hinberspielende.
Literaturverzeichnis
Quellen
Bartholdy, Jakob L. S.: Bruchstcke zur nhern Kenntnis des heutigen Griechenlands,
gesammelt auf einer Reise von J. L. S. B. Im Jahre 1803/1804. Erster Theil. Berlin 1805.
Hoffmann, E.T.A.: Smtliche Werke in sechs Bnden. Lebens-Ansichten des Katers
Murr. Werke 18201821, Bd. 5, hrsg. von Hartmut Steinecke u. Mitarb. v. Gerhard
Allrogen: Frankfurt a.M. 1992.
Jean Paul: Gesichte einer griechischen Mutter. Ein Traum in den letzten Tagen des
Juli-Monats, in: Smtliche Werke. Vermischte Schriften II, II. Abt., Bd. 3. Norbert
Miller (Hrsg.): Mnchen 1978. S. 993996.
Jean Paul: Selina oder ber die Unsterblichkeit der Seele, in: Smtliche Werke.
Spte Erzhlungen. Schriften, I. Abt., Bd. 6. Norbert Miller (Hrsg.): Mnchen
4
1987.
S. 11051236.
Jean Paul: Vorschule der sthetik, in: Smtliche Werke. Vorschule der sthetik. Le-
vana. Politische Schriften, I. Abt., Bd. 5. Norbert Miller (Hrsg.): Mnchen 1963.
Jean Pauls smtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Verstreute gedruckte Schriften,
Erste Abt., Bd. 18. Eduard Berend (Hrsg.): Weimar
6
1995. S. 7514.
Freiheit 1821 197
Jean Pauls smtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Dichtungen, Merkbltter,
Studienhefte, Schriften zur Biographie, Libri legendi, Zweite Abt., Bd. 6. Gtz Mller
(Hrsg.): Weimar 1996. S. 895.
Mitford, William: Geschichte Griechenlands. Aus dem Englischen von J.F. Baron. 2 Bde.
Breslau 18001801. Und: Ders.: Dass. Aus dem Englischen von Heinrich Albr.
Eichstdt. 6 Bde. Leipzig 18021808.
Mller, Wilhelm: Werke, Tagebcher, Briefe. Gedichte 1, Bd. 1. Maria-Verena Leistner
(Hrsg.): Berlin 1994.
Sonnini de Manoncourt, Charles Nicolas Sigisbert: Voyage en Grce et en Turquie. Paris
1801. Ins Deutsche bertragen von Weyland unter dem Titel: Reise nach Grie-
chenland und der Trkei auf Befehl Ludwigs XVI. unternommen von C. S. Son-
nini. 1801.
Forschungsliteratur
Cremer-Swoboda, Thordis: Der griechische Freiheitskrieg. Diss. Mnchen. Augsburg
1974.
Lehmann, Marco: Kabbalistische Mysterien des Selbst. Schrift und Identitt in
E.T.A. Hoffmanns Doppelerzhlung ,Die Irrungen/Die Geheimnisse , in:
E.T.A. Hoffmann Jahrbuch, 14/2006, S. 7ff.
Polaschegg, Andrea: Der andere Orientalismus. Regeln deutsch-morgenlndischer Imagina-
tion im 19. Jahrhundert. Berlin, New York 2005.
Praet, Danny/Janse, Mark: ,Dem Namen nach. Greek and Jewish references and
word play in the Character names of E.T.A. Hoffmanns ,Die Irrungen and ,Die
Geheimnisse, in: E.T.A. Hoffmann Jahrbuch, 13/2005, S. 78ff.
Scheitler, Irmgard: Griechenlyrik (18211828). Literatur zwischen Ideal und Rea-
litt, in: Internationales Jahrbuch der Bettina von Arnim-Gesellschaft, 67/1994/95,
S. 196234.
Schulz, Gerhard: Die deutsche Literatur zwischen franzsischer Revolution und Restau-
ration. Zweiter Teil: Das Zeitalter der napoleonischen Kriege und der Restauration.
18061830. Mnchen 1999.
Segebrecht, Wulf: Von der Graecomanie-Kritik zur poetischen Reaktion auf den
Philhellenismus. E.T.A. Hoffmanns Erzhlungen ,Die Irrungen und ,Die Ge-
heimnisse, in: Ders. (Hrsg.).: Europavisionen im 19. Jahrhundert. Vorstellungen von
Europa in Literatur und Kunst, Geschichte und Philosophie. Wrzburg 1999. S. 171ff.
198 Helmut Pfotenhauer
Tis Greece! 199
Diego Saglia
Tis Greece!: Byrons (Un)Making of Romantic
Hellenism and its European Reinventions
It is a generally undisputed fact that, if eighteenth-century literature
both in Britain and on the Continent offers many conspicuous manifes-
tations of the worship of Greek culture, Lord Byrons arrival on the
poetical scene in the 1810s brought about a radical reorganization of this
field. From the perspective of early nineteenth-century Western litera-
tures, Byron effectively created Romantic Greece and, to many modern
commentators, his verse marked an unsurpassed climax in literary phil-
hellenism, at least in the English-language tradition. Thus, in Terence
Spencers opinion, Byron appeared just in time, a few years before the
[Greek] Revolution. There was not likely to be another English poet of
Greece; at least, not of that kind.
1
Byron was in the right place at the
right time, the personal and authorial embodiment of an unrepeatable
historical and geographical intersection.
Given the finality of this statement, and notwithstanding the attenu-
ated tone of its closing, it is not difficult to find this critic at fault. For
countless followers and imitators tirelessly returned to Byrons well-
trodden Hellenic paths during the nineteenth and twentieth centuries.
2
Moreover, Byrons version was not the only fictional Hellenism circu-
lating in early nineteenth-century literature. In Britain, John Keats and
Percy Bysshe Shelley produced their distinctive versions of an idealized
Greece in ways that visibly diverge from Byrons own elaboration.
On the Continent, Franois-Ren de Chateaubriand, Ugo Foscolo and
Friedrich Hlderlin produced representations of Greece on the cusp
between the Neoclassical and Romantic aesthetics well before Byron
1
Spencer, Terence: Fair Greece, Sad Relic: Literary Philhellenism from Shakespeare to
Byron. London 1954, S. 294.
2
See Roessel, David: In Byrons Shadow: Modern Greece in the English and American
Imagination. Oxford, New York 2002.
200 Diego Saglia
and in fairly independent, although parallel and generally comparable,
ways.
3
Nonetheless, Spencer correctly stresses the unprecedented impact of
Byron on the construction of Romantic Greece. And this impact lies
precisely in the fact that, in some decisively innovative ways, Byrons
Greece is genuine, that is, consistently and insistently placed under
the sign of truthful and reliable fictional representation, the outcome
of an ostensibly transparent mimesis which, among other things, distin-
guishes other Romantic-period discourses and figurations of geo-cul-
tural otherness such as Orientalism.
4
Byrons poetry about Greece
promises unmediated access to this place and culture, thus de facto popu-
larizing that realistic image of it which European travel writers had been
piecing together since the late eighteenth century in their first-hand nar-
ratives of a culturally hybrid contemporary country still inextricably
bound up with the ruinous traces of its past.
5
1. Byrons (Un)Making of Greece
The topical realism of Byrons Hellenic imagination is clearly visible in
the second canto of Childe Harolds Pilgrimage (1812), the poem which
consecrated him as the unsurpassed Romantic interpreter of contempor-
3
A brief overview of Hellenism in European Romanticisms is in Van Tieghem,
Paul: Le Romantisme dans la littrature europenne. Paris 1969 [1948], S. 261263. On
the different approaches to Greece in Byron, Shelley and Keats, see Webb, Tim-
othy: Romantic Hellenism, in: Stuart Curran (Hrsg.): The Cambridge Companion
to British Romanticism. Cambridge 1993, S. 15758.
4
On the documentary aspects of Romantic-period literary Orientalism in Britain,
see Leask, Nigel: Romantic Writers and the East: Anxieties of Empire. Cambridge
1992, and Sharafuddin, Mohammed: Islam and Romantic Orientalism: Literary En-
counters with the Orient. London, New York 1994.
5
For a bibliographic overview of Byron and his treatment of Greece, see Raizis,
Marius Byron: Philhellenism in English Literature 17801830, in: Alfred Noe
(Hrsg.): Der Philhellenismus in der westeuropischen Literatur 17801830. Amsterdam,
Atlanta 1994, S. 11131. More generally, see Tsigakou, Fani-Maria: The Rediscovery
of Greece: Travellers and Painters of the Romantic Era, introd. by Sir Steven Runciman.
London 1981. See also Spencer: Fair Greece, Sad Relic, on British travellers to
Greece. On French travellers, see Augustinos, Olga: From Hellenism to Philhellen-
ism: The Emergence of Modern Greece in French Literature 17701820. PhD Thesis. In-
diana University 1976, and for Italy see Di Benedetto, Arnaldo: Le rovine
dAtene: letteratura filellenica in Italia fra Sette e Ottocento, in: Italica 76/1999,
S. 335354.
Tis Greece! 201
ary Greece.
6
The success of this poem was such that the Duchess of De-
vonshire wrote to her son to inform him that, in fashionable private
homes and public gatherings in London, The subject of conversation,
of curiosity, of enthusiasm almost, one might say, of the moment is []
Lord Byron.
7
And, indeed, Byrons representation of Greece was of the
moment because his verse narrative is firmly rooted in the present of
the travelling eponymous hero, and because of the information on the
country contained in its prose annotations. Thus, the Additional Note,
on the Turks provides useful advice to travellers and concise insights
into the state of modern Greece and the character of its people. Here,
Byron emphatically expresses his sincere admiration for the Ottomans:
they are not treacherous, they are not cowardly, they do not burn her-
etics, they are not assassins, nor has an enemy advanced to their capital.
8
As for the subjected Greeks, the appendix to the canto includes a list of
Romaic Authors and two Romaic Extracts accompanied by unpol-
ished translations that, nonetheless, bear witness to Byrons intention of
providing his readers with an accurate, up-to-date report on Greece
(CPW, 2, S. 21317). The fact is, Byron complains, we are deplorably
in want of information on the subject of the Greeks, and in particular
their literature, so that even incomplete or deficient accounts are pre-
ferable to the paradoxes of men who have read superficially of the
ancients, and seen nothing of the moderns (CPW, 2, S. 204).
9
Byron also emphasized his experience of Greece as being of the
moment by stressing the physical nature of his contact with this land.
On 3 May 1810 he wrote to a friend This morning I swam from Sestos
to Abydos, the mythical termini of what he calls the broad Hellespont,
giving his correspondent a detailed account of the dangers and diffi-
6
Spencer: Fair Greece, Sad Relic, S. 292.
7
Undated letter, quoted in Rutherford, Andrew (Hrsg.): Byron: The Critical Heri-
tage. London 1970, S. 35.
8
Byron, Lord: Childe Harolds Pilgrimage, in: The Complete Poetical Works, Bd. 2.
Jerome J. McGann (Hrsg.): Oxford 198093, S. 209211 (hereafter cited as CPW
in the text).
9
See also the lyrics Byron wrote during his journey to Greece in 181011, compris-
ing several compositions translated from the Romaic, such as the song of the pa-
triotic martyr Constantine Rhigas, or the Translation of a Romaic Love Song
and Translation of the Romaic Song (I enter thy garden of roses, / Beloved and
fair Haide). The Song (Maid of Athens, ere we part), composed in 1810 and
destined to become one of Byrons most famous love lyrics, features a line in
modern Greek at the end of each stanza (Zuj ou o0 oyou) which the poet
defines as a Romaic expression of tenderness (CPW, 1, S. 280f., 421).
202 Diego Saglia
culties encountered during his crossing of an hour and ten minutes.
10
Extremely proud of this impressive physical feat, Byron mentions it re-
peatedly in his letters, diaries and conversations. Moreover, soon after
this contact with the classic seascape between Asia and Europe, imbued
with the myth of Hero and Leander, on 9 May 1810 he translated his en-
terprise into poetry by penning a few lines Written after Swimming
from Sestos to Abydos, a composition that encapsulates the first-hand
experience of touching Greece as a complex of landscapes and myths,
places and tales (CPW, 1, S. 2812). Thus Byron impresses his own physi-
cal presence on a geo-cultural construct which becomes spectacularly
present because actually experienced on the body. By the same token,
on this occasion the poet leaves a trace of his progress across Greece by
mixing presence and impermanence in the tumultuous waters between
Europe and Asia.
Thanks to the impact of his poetical works and personal legend,
Byron popularized a new way of writing Greece distinguished by a
heady mixture of history and nostalgia, cultural echoes and personal
experience. This popular version of Greece, however, is anything but
a straightforward and easily decodable object. In fact, it is an intricate
intersection of presence and absence. On the one hand, Byrons im-
agined Greece is absent because it belongs to a mythical past and is thus
lost forever. On the other, its presence lies in that the poetic subject sees
and touches it in the immanent dimensions of experience and writing.
The apostrophe to Greece in the second canto of Childe Harold
Fair Greece! sad relic of departed worth! / Immortal, though no more!
though fallen, great! (II. 73. 12, CPW, 2, S. 68) encapsulates the tex-
ture of contradictions typical of Byrons evocations of place with their
interweaving of affect and art, the landscape and the human traces it
bears on its surface.
11
Similarly, this net of lexical ambivalences reson-
ates a few lines later in his representation of the sons of Greece, In all
save form alone, how changd! (II. 75. 1, CPW, 2, S. 69). These lines are
inwoven with contradictions and paradoxes to the extent that Greece is
imaginatively located between conflicting discursive axes and defined as
10
Letter of 3 May 1810 to Henry Drury, in: Lord Byrons Letters and Journals, Bd. 1.
Leslie A. Marchand (Hrsg.): London 197394, S. 237.
11
On Byrons reflections about the link between writing and place, especially the
fact that art enables us to feel the place, see his Letter to John Murray (dated
Ravenna, 7 February 1821), in Byron, Lord: The Complete Miscellaneous Prose.
Andrew Nicholson (Hrsg.): Oxford 1991, S. 120160.
Tis Greece! 203
the meeting point of dissonant statements. And Byron adds a further
component to this intricate chronotopic foundation by giving Greece
a body and an unmistakably gendered identity. For, in line with tradi-
tional figurations of countries (especially subjected ones) as female, his
lines consistently posit Greece as a sensually, indeed sexually, connoted
female hypostasis. She often features as fair Greece, the prey of tyran-
nical and sanguinary Turkish overlords, yet also at risk from covetous
Western powers, and in The Giaour she is specifically presented as an
unsettling gendered compression of life and death: Tis Greece but
living Greece no more! / So coldly sweet, so deadly fair (ll. 912, CPW,
3, S. 4243).
12
Fraught with such ambivalences, Byrons construction
of Greece exposes itself to endless contradictions and self-subversions.
Indeed, a Greece that is present and past, physically at hand and lost in
memory, makes for a fascinating literary figure, but can hardly offer any
semantically stable figuration.
As Massimiliano Demata correctly notes, literary history has gen-
erally placed Byron and his philhellenic works within the cultural
coordinates of a glorious Greek past which had to be retrieved in opposi-
tion to Ottoman (and therefore Asiatic) tyranny.
13
This inherited view,
however, stands in the way of an appreciation of the complexities of the
poets Greek construct and the possibility of what Demata calls a philo-
Turkish or philo-Islamic reading of his works.
14
What is more, this
wavering attitude towards Greece and its inhabitants is not limited to
12
For occurrences of the vocative Fair Greece, see Childe Harolds Pilgrimage,
II. 15. 1, CPW, 2, S. 49, and again II. 73. 1, CPW, 2, S. 68. This figuration is at its
most conspicuous in The Giaour (1813) and in the figure of the beautiful harem
slave Leila who, in Caroline Franklins words, is the fought-over focus of the
eternal triangle, situated between a Turkish tyrant and a debased would-be West-
ern liberator, resulting in an obvious political allegory [that] is a commonplace
of moden criticism. Byrons Heroines. Oxford 1992, S. 73. Line 91 in the quo-
tation fromThe Giaour (Tis Greece but living Greece no more!) was illustrated
by J.M.W. Turner in a watercolour of 1822. See Tsigakou: The Rediscovery of Greece,
S. 41.
13
Demata, Massimiliano: Byron, Turkey and the Orient, in: The Reception of Byron
in Europe, Bd. 2. Richard A. Cardwell (Hrsg.): London, New York 2004, S. 440.
14
Demata: Byron, Turkey and the Orient, S. 440. For an example of Byrons cel-
ebration as a philhellene poet to whom all the Greeks must be eternally grateful
for his sincere love for Greece and its people, see Protopsaltis, E.G.: Byron and
Greece: Byrons Love of Classical Greece and His Role in the Greek Revolution,
in: Paul Graham Trueblood (Hrsg.): Byrons Political and Cultural Influence in Nine-
teenth-Century Europe: A Symposium. London, Basingstoke 1981, S. 105.
204 Diego Saglia
Byrons later, more disenchanted, verse. Already in early interventions
such as the second canto of Childe Harold, his adoption of the familiar
stereotype of the sons of Greece as the unworthy descendants of an
ancient heroic race is keyed to expressions of admiration for their Tur-
kish masters. His representation of Constantinople in the same poem is
far from that of a polluted and tainted city, and rather reveals, as Demata
remarks, a deep concern for Turkish culture, art and history which
is anything but spiteful or hegemonic.
15
And in The Giaour, with its
complex interplay of narrative voices, Byron does not hesitate to convey
the Turks dismissive view of the Greeks as Slaves nay, the bondsmen
of a slave (l. 151, CPW, 3, S. 44). In a note to the poem Byron explains
this definition as follows: Athens is the property of the Kislar Aga
(the slave of the seraglio and guardian of the women), who appoints the
Waywode. A pandar and eunuch these are not polite yet true appel-
lations now governs the governor of Athens (CPW, 3, S. 4167). The
multiplicity of voices that compose The Giaour also betrays traces of
Byrons own fascination with the Ottomans, his disesteem for the
Greeks, and a mixture of indignation and irony at the fact that the
sacred classic ground of Athens belongs to an emasculated slave. Once
again, there is no single, straightforward interpretation to the poets
figurations of the semantic maze that is contemporary Greece.
Byrons creation and simultaneous dismantling of Greece is a double-
edged fictional operation characterizing his lifelong involvement in Hel-
lenic themes. As a result, in Byrons output, every image of Greece
presupposes and contains an impasse in the shape of its obverse. His sug-
gestive and influential figuration of this land as a beautiful female body
and sexual object clashes with his frequent representations of Greece as
a land of homosocial and homosexual possibilities, from his experiences
during the Grand Tour of 180911 to the handful of poems he composed
immediately before his death in Missolonghi in 1824. In addition, the
notion of a purely Hellenic Greece regularly breaks down in Byrons
works, and most visibly in the episode of the wedding between Don
Juan and Haide in the third canto of Don Juan, the description of which
conjures up the picture of an Eastern bazaar of festive confusion drawn
from Richard Tullys Narrative of a Ten Years Residence at Tripoli in Africa
(1816), an account detailing an unmistakably Muslim setting and orien-
tal traditions.
16
15
Demata: Byron, Turkey and the Orient, S. 445.
16
See Lord Byrons Letters and Journals, 8, S. 186.
Tis Greece! 205
A further instance of Byrons unmaking of his own Greek mythol-
ogy is then located in what, ironically, became one of the hallmarks of
his philhellenism, and one the best-known of his pro-Greek lyrics, the
song The Isles of Greece intoned by the aptly named poetaster Rau-
cocanti in the third canto of Don Juan, and thus at the heart of an al-
ready heavily compromised, because orientalized, picture of Greece. On
one level, the song reads like a melodious celebration of the natural
beauties of this land and its ancient civilization, and as a heart-felt in-
vocation to the people to fight for the resurgence of their nation. It is an
outburst of enthusiasm at the sight of the sea and land of Greece and the
recollection of its heritage: The Isles of Greece, the isles of Greece! /
Where burning Sappho loved and sung, / Where grew the arts of
war and peace (III. 68991, CPW, 5, S. 188). Yet, in fact, The Isles of
Greece is a deeply ironic text sung by an opportunistic versifier who is a
thinly disguised cl figure for the Poet Laureate Robert Southey, one of
the main targets of Byrons political and literary animosity in the 1820s.
The irony is even greater, in that the poem is effectively a conscious
demolition of the literary mechanisms of the Romantic image of
Greece. It is a poem about other poems on Greece (inspired by Byrons
own model) that gives the lie to the clichd artificiality and verbal insin-
cerity of the philhellenic mode. Finally, it is also a parody of all the folk
songs Byron had started to collect and translate during his journey to
Greece and the Near East, and that were to become popular among phil-
hellenes in 1820s Europe thanks to Claude Fauriels erudite collection of
Chants populaires de la Grce moderne (1824, 1825).
Even as he fashions one of his most poetically achieved and influen-
tial formulations of the myth of Greece, Byron calls into question the
discursive mechanisms and ideological motivations of this literary in-
vestment. He simultaneously pieces together and breaks up Romantic
Greece. And yet, this did not prevent The Isles of Greece from becom-
ing one of the central texts of Byronic philhellenism, one of the loci clas-
sici of the literary cult of Greece for an entire generation of Romantic
writers all over Europe and for their post-Byronic efforts at constructing
countless enthusiastic visions of this country.
206 Diego Saglia
2. Post-Byronic Hellenisms and the Ostension of Greece
Although undercut by different intersecting idioms, Byrons poetic pro-
jections of Greece were mainly received as untrammelled celebrations of
the country, its people and its past. At a European level, one of the prin-
cipal reasons for this reception lay in Byrons death at Missolonghi in
April 1824, a death which was seen as the apotheosis of his formulation
of Greece between presence and absence, the transfigurative power of
writing and the grounding of experience. As Byron died in the land he
had mythologized in his poetry, he became an essential component of
the myth of Greece. In Stephen Cheekes words, this death was pre-
cisely the kind of powerful historical event-in-place that had shaped and
commanded Byrons own imagination.
17
When Byron went to Greece in 1823, the most famous poet in Eu-
rope had joined the most important conflict on the Continent. Philhel-
lenism became inseparable from the Byronic persona and Missolonghi
was transformed into a shrine to the cause of Greek independence and
national self-definition, a name as illustrious as those of Salamis or
Thermopylae. Virtually unknown before Byron died there, the town ac-
quired an even more tragic fame because of the long siege, concluded on
25 April 1826, after which the Turks seized and razed the citadel to the
ground and slaughtered the besieged. Fired by the news of these trau-
matic events, the Italian Angelo Brofferio wrote his youthful lines on
La caduta di Missolungi (1826), while the Spanish Estanislao de Cosca
Vayo set his philhellenic historical novel Grecia o la doncella de Misso-
longhi (1830) in the famed city. Between 1821 and 1826 the Austrian Wil-
helm Mller published his popular series of Lieder der Griechen, the first
instalment of which (in its second edition of 1825) included Byron,
a poem originally written in 1814 and suitably filled with references to
Greece, while in 1826 he published a volume of verse entitled Misso-
lunghi entirely dedicated to the fall of the citadel.
Narratives of Greece and its troubled present became inseparable from
Byrons arrival on the scene of the war. In 1824 the improvvisatrice and
woman of letters Angelica Palli, an Italian of Greek origins, wrote an ode
Alla Morte di Byron, and in 1827 published a philhellenic novel, Ales-
sio, the structure of which partly rehearses the tale of Conrad and Gulnare
in Byrons The Corsair (1814). In addition, Italy in the mid-1820s saw the
17
Cheeke, Stephen: Byron and Place: History, Translation, Nostalgia. Basingstoke,
New York 2003, S. 193.
Tis Greece! 207
publication of a large number of anonymous poems celebrating Byrons
death as a coded treatment of the theme of the liberation of Italy from
post-Napoleonic Austrian influence, as in the anonymous Stanze alla
memoria di Lord Byron (1825).
18
Furthermore, one of the most authori-
tative accounts of the early phases of the Greek war of independence,
F.-C.-H.-L. Pouquevilles Histoire de la rgnration de la Grce (1824), culmi-
nates with Byron, the moderne Tyrte, and his arrival at Missolonghi:
son exemple donnant limpulsion aux esprits, un horizon immense
apparut aux Grecs, qui dcouvrirent, au milieu dun ocan de gloire, des
dangers et de nouveaux triomphes.
19
In Italy, Giuseppe Rovanis Storia
della Grecia (1854), written explicitly in continuazione a quella di
Pouqueville, also dedicated ample space in its opening sections to
Byron, whose landing in Greece is described as a messianic event.
20
After the poets supposedly heroic death, even authors who were
established philhellenists in their own right had to come to terms with
his authoritative version of Greece. Thus, for instance, in a discussion of
the present affairs of Greece in his posthumously published Lettera
apologetica (written in 1825), Ugo Foscolo inevitably introduces
Byrons figure and verse into the picture, whilst also forcefully defend-
ing himself against those detractors who accused him of having fatto
danaro trafugando alla misera Grecia le lodi e scritture di Lord Byron.
21
Later, in the second part of Faust (published in 1832), Goethe intro-
duced the figure of Euphorion, the son of Faust and Helen, as a tribute
to Byron and his heroic death in Greece.
Byrons impact on the Romantic-period cultural map of Greece was
incalculable. His Continental readers and admirers received his version
of this country as an irresistible amalgamation of life and art, history
and literature, the visual and the verbal. Greece was celebrated through
Byron who was celebrated through Greece, whereas the critiques in-
herent in his pictures of this cultural geography went largely unnoticed.
A feature of Byrons Greece that found particular favour with Euro-
pean authors was his distinctive recourse to ostensions of it those em-
phatic evocations in which he offers the country to his readers in seem-
18
See Melchiori, Giorgio: Byron and Italy: Catalyst of the Risorgimento, in: True-
blood (Hrsg.): Byrons Political and Cultural Influence in Nineteenth-Century Europe,
S. 10821.
19
Pouqueville, F.-C.-H.-L.: Histoire de la rgnration de la Grce, Bd. 4. Paris 1824,
S. 465.
20
Storia della Grecia negli ultimi trentanni 18241854. Milano 1854, S. 18.
21
Giuseppe Nicoletti (Hrsg.): Lettera apologetica. Torino 1978, S. 128.
208 Diego Saglia
ingly unmediated form. These images invoke Greece through a deictic
gesture that weaves surprise and fascination into an awareness of the
paradoxical identity of the country and its history. As anticipated above,
one of the most familiar examples is the double exclamation The Isles
of Greece, the isles of Greece! opening the inset lyric in the third canto
of Don Juan. But this formulation has important, and equally popular,
precedents in the apostrophe Fair Greece! sad relic of departed worth!
in the second canto of Childe Harold (II. 73. 1, CPW, 2, S. 68), as well
as in the similar compression of ecstatic surprise and realization of
absence in The Giaour: Tis Greece but living Greece no more!
(l. 91, CPW, 3, S. 42).
These iconic encapsulations of Byrons far from straightforward con-
struction of Greece found a particularly receptive audience among
French poets, also in view of the fact that, in France, the profound
impact of Byrons literary construction of Greece coincided with the
belated emergence of the Greek question as a major geo-political and
diplomatic concern.
22
Byrons pervasive influence in this process is em-
blematically demonstrated by the fact that in late 1824, when the repro-
duction of a painting of his death was exhibited in the Parisian rue des
Filles-Saint-Thomas, on the corner of the Passage Feydeau, large crowds
of people stopped to contemplate it. A contemporary account describes
the painting as follows:
Le corps [] tendu sur un lit, est demi recouvert dun linceul []
une lampe spulcrale claire lappartement o est dpos le noble
lord. Lpe que Childe Harold avait tir pour la cause des Grecs est
suspendue au socle dune statue de la Libert. La lyre dont les sons
devaient entretenir le feu sacr de lindpendance est jete prs du
cercueil du Tyrte moderne; les cordes en sont brises. Les ombres de
quelques Grecs agenouills entourent le lit de mort de leur gnreux
dfenseur.
23
22
On this point, as expressed for instance in Franois-Ren de Chateubriands Note
sur la Grce (1825), see St Clair: That Greece Might Still Be Free, S. 263265. Between
1824 and 1826, as French foreign policy began to address the Greek question,
there was a surge in the interest in Greek subjects that translated into a consider-
able number of literary and visual representations. See Estve, Edmond: Byron
et le romantisme franais: essai sur la fortune et linfluence de loeuvre de Byron en France
de 1812 1850. Paris 1907, S. 533535.
23
Le Diable boteux, 18 December 1824, quoted in Estve: Byron et le romantisme fran-
ais, S. 120.
Tis Greece! 209
The arresting power of this hagiographic image bears witness both to the
centrality of the Byronic icon and to the poets iconic rendition of
Greece for Romantic-period French culture. In addition, it provides
further evidence of the power of Byrons poetry and persona to posit
Greece as an embodied, ostensibly present, object.
An early example, predating Byrons death, of a French adaptation of
the poets ostension of Greece is in Alfred de Vignys poem Hlna pub-
lished in his 1822 collection of Pomes. A verse tale laden with Byronic
tones and inflections (and especially indebted to The Bride of Abydos), Hl-
na centres on a young Greek woman who is familiar with the condition
of enslavement and degradation of her country, but is also proud of its
great heritage, which her fianc, the patriot Mora, discovers to her during
a long voyage around the Aegean sea. As a tragic personification of the
condition of Greece (the link between the names Hlna and Hellas is
an obvious one), the heroine is raped by Turkish soldiers and commits
suicide in a dramatic climax that is significantly counterbalanced by hints
at Moras victory over the Turks and the eventual liberation of Athens. In
the second canto, in a manner that is strongly reminiscent of Madame de
Stals Corinne, the heroine raises a paean to her native land in which
Vigny audibly rehearses the modes of the Byronic presentation of Greece:
Regardez cest la Grce; oh! regardez! cest elle!
Salut, reine des Arts! Salut, Grce immortelle!
Le monde est amoureux de ta pourpre en lambeaux,
Et lor des nations sarrache tes tombeaux.
24
Hlnas ecstatic portrait of the Hellenic land, immortal though ravis-
hed by foreign powers, intertwines past and present, greatness and de-
cadence in an ultimately ambivalent image. And Vigny appositely cou-
ches this contradiction (made evident by the conjunction of immortal
and tombs) in an apostrophe containing a deictic expression, thus re-
working the formula of ostension typical of Byronic presentations and
problematizations of Greece.
25
24
II. 5458, in: Vigny, Alfred de: Oeuvres compltes, Bd. 1. Franois Germain et
Andr Jarry (Hrsg.): Paris 1986, S. 185.
25
On Vignys poem in the context of French philhellenism, see Jaeckel, Katja:
LEngagement philhellne et limage de la Grce dans la littrature franaise de
1770 1830, in: Noe (Hrsg.): Der Philhellenismus in der westeuropischen Literatur
17801830, S. 92f.
210 Diego Saglia
A later instance of the adoption of the expressive modes of Byronic
Greece, and one in which the British poet himself plays a major role,
is in Casimir Delavignes Messniennes (1824), a collection that seeks to
construct a multiform image of contemporary Greece and, among other
things, features a poem, Le Jeune Diacre, ou la Grce chrtienne, dedi-
cated to the celebrated historian Pouqueville and centred on the topos
of the dying Greek virgin as a metaphor for the national predicament.
The composition entitled Lord Byron, instead, examines and cel-
ebrates the poets involvement with Greece through an intertextual dia-
logue with his biography and verse, some lines of which, Delavigne as-
serts, are so familiar to French readers that there is no need to refer them
to the original in the notes. Accordingly, his text conjures up a vision of
Greece that is closely modelled on the combination of life and death
presented in The Giaour:
Il brille dun clat que rien ne peut ternir,
Ce tableau de la Grce au cercueil descendue
Qui na plus de vivant que le grand souvenir
De sa gloire jamais perdue
26
The same Byronic image returns after a few lines in yet another rework-
ing of Byrons ostension of Greece through exclamation and paradox:
Cest la Grce, as-tu dit, cest la Grce opprime;
La Grce belle encore, mais froide, inanime;
La Grce morte! Arrte, et regarde ses yeux:
Leur paupire long-temps ferme
Se rouvre la clart des cieux.
27
Intertextual echoes coupled with the progressively decreasing distinc-
tion between character and poet in Childe Harold are also central to
Alphonse de Lamartines Le Dernier chant du plerinage dHarold (1825).
In what is essentially an act of ventriloquism of Byrons poetic voice,
as well as a testament to his life and achievements, Lamartine imagines
that, on his way to fight for Greece, Harold comes upon an Otto-
man ship loaded with Greek prisoners from Scio, mostly women and
26
Oeuvres compltes de C. Delavigne, Bd. 3. Bruxelles 1832, S. 66.
27
Ebd., S. 67.
Tis Greece! 211
children.
28
The wandering hero and his men attack the Turks, capture
the ship and free the Greek prisoners, but the enemies set fire to the
vessel and kill everyone on board. Harold can only rescue one little
Greek girl, Adda, an emblematic figure who bears the same name as
Byrons daughter yet also reprises the character of the orphan Leila
whom the protagonist saves at the siege of Ismail in the seventh canto of
Don Juan. After this tragic incident, the coast of Greece eventually
heaves into view:
Cest la Grce! A ce nom, cet auguste aspect,
Lesprit ananti de piti, de respect,
Contemplant du destin le dclin et la cime,
De la gloire au nant a mesur labme.
[]
Le regard, que lesprit ne peut plus rappeler,
Avec ses souvenirs cherche les repeupler
[]
Tel, si, pendant le cours dun songe dont lerreur
Lui rappelle des traits consacrs dans son coeur,
Un fils, le sein gonfl dune tendresse amre,
Dans un brillant lointain voit lombre de sa mre,
Dvorant du regard ce fantme chri,
Il contemple en pleurant ce sein qui la nourri []
29
The ostension embedded in the exclamation Cest la Grce! is the
only possible reaction to the sudden manifestation of the Greek main-
land, as it succeeds in encapsulating the emotive impact of this manifes-
tation, the abrupt emergence of Greece as a present object. Reacting to
this vision, Harold reflects on destiny, life and death in a geo-cultural
context that Lamartine elaborates as a compressed version of Byrons
tormented self through the cataclysmic image of the abyss separating
28
One of the bloodiest episodes in the war of Greek independence, the massacres of
Scio were sparked off in 1822 when insurgents from Samos attacked the island
and its Ottoman fortress. On 11 April 1822 a Turkish fleet arrived and several
thousand soldiers disembarked to relieve the citadel. The Ottoman troops began
an indiscriminate slaughter of rebels and local civilians (who, in fact, had given
no help to the Samian raiders), taking large numbers of civilians as prisoners and
prolonging the atrocities for over two months.
29
Stanza 21, in Lamartine, Alphonse de: Oeuvres potiques compltes. Marius-Franois
Guyard (Hrsg.): Paris 1963, S. 215f.
212 Diego Saglia
glory from nothingness. Thus the French poet brings together Scio
and the massacres, Byron and his poetry (harmonizing the distinct
voices of Harold and Don Juan), and the exclamation that introduces
the image of Greece as a living corpse. The result is a layered poetic con-
struct aimed at containing the polysemy of Byrons Hellenic imagin-
ation and its uncanny presence. Aptly, just like Byron, Lamartines Ha-
rold will meet his end in Greece.
Furthermore, as is well known, some of the most resonant versions of
Byronic Greece in French Romantic-period culture were produced by
Eugne Delacroix. Indeed, his numerous philhellenic paintings, coinci-
ding with the high point of this fashion between 1824 and 1826, are im-
pressive visual transpositions of Byrons ostensions of Greece. If con-
temporary poets translated the immediacy of Byrons Greek imagination
through apostrophes and exclamations such as Cest la Grce, Dela-
croix renders the same experience of fascination and surprise through a
visual idiom steeped in Byronic Hellenism and Orientalism. His diary
from this period presents a wide array of references to the poets exotic
imagination, and, for instance, on 11 May 1824 he writes:
Le pote est bien riche: rappelle-toi, pour tenflammer ternellement, certains
passages de Byron; ils me vont bien. La fin de la Fiance dAbydos, la Mort de
Selim, son corps roul par les vagues et cette main surtout, cette main souleve
par le flot qui vient mourir sur le rivage. Cela est bien sublime et nest qu lui.
Je sent ces choses-l comme le peintre les comporte. La Mort dHassan, dans le
Giaour. Le Giaour contemplant sa victime et les imprcations du musulman
contre le meurtrier dHassan. La description du palais dsert dHassan. Les vau-
tours aiguisant leur bec avant le combat. Les treintes des guerriers qui se saisis-
sent. En faire un qui expire en mordant le bras de son ennemi.
30
Delacroix read part of The Giaour probably in the original, since he
could read English, or alternatively in Amede Pichots translation as
early as 10 May 1824, and the poem became a crucial matrix for his
Greek paintings and their distinctive combination of the fictional and
the historical through the mediation of Byrons verse.
31
Thus, at the
Salon of 1824, he presented his Scnes des massacres de Scio, the
30
Journal dEugne Delacroix, Bd. 1. Andr Joubin (Hrsg.): Paris 1950 [1932], S. 99f.
31
Delacroixs use of Byronic sources continues throughout his career as a painter.
Thus, the episode from The Giaour in which the protagonist contemplates the
corpse of his enemy Hassan will become a painting (Le Giaour contemplant son
ennemi mort) well after the climactic period of philhellenism and will be ex-
hibited only in 1830. Similarly, The Bride of Abydos inspires some oils dating from
the 1840s.
Tis Greece! 213
painting that confirmed him as resolutely Romantic and opposed to
the manner of J.A.D. Ingres, and, at the same time, he began to develop
smaller projects based on Byrons orientalist metrical tales. When the
Exposition au profit des Grecs opened at the Galerie Lebrun on
15 May 1826, he exhibited both Un officier turc tu dans les mon-
tagnes often wrongly identified and more generally known as La
Mort dHassan and the Byronic Combat du Giaour et du Pacha Has-
san. Although the motifs are different, the Byronic subtext is omnipre-
sent and creates a fascinating short-circuit between the representation
of actual historical facts and Byrons fictional transfigurations.
32
Further
echoes of Byrons subtexts and intersections of history and fiction
emerge in the contemporaneous Episode de la guerre hellnique, poss-
ibly finished after the summer of 1826 because it was not sent to the
Galerie Lebrun but was rather shown at the Salon of 1827.
Delacroix provides one of the most resonant examples of how the
Byronic imaginary conquered and colonized philhellenic represen-
tations in European art after 1824. Its contagious influence permeates
the painters vision, confusing fact and fiction, yet also contributing
to one of the most remarkable and impactful Romantic representations
of Greece. Thus, on the one hand, Delacroixs visual corpus may be seen
as part of a wider strategy for the adoption and adaptation of Byrons
practice of ostension. On the other, by mixing reality and imagination,
history and fiction, his paintings retain some of the complexities,
although not the ironic dismantling, typical of Byrons constructions of
a Hellenic cultural geography.
Delacroixs reworking of Byronic Greece reaches its climax in his
famous La Grce sur les ruines de Missolonghi, first shown at the
Galerie Lebruns exhibition Au profit des Grecs and then in London at
Hobdays Gallery in 1828. The figurative materials of the painting may
have been directly inspired by Byrons lines on the hand of the dying
Selim in The Bride of Abydos, from the entry in the Journal quoted
above. Yet it is equally true that the central image of the Greek woman is
recurrent in allegorical philhellenic representations. Thus, for instance,
a similar figure in chains (Greece Expiring among Classical Ruins)
illustrates the first volume of the Comte de Choiseul-Gouffiers Voyage
32
On these interferences, see Joannides, Paul: Delacroix and Modern Literature,
in: Beth S. Wright (Hrsg.): The Cambridge Companion to Delacroix. Cambridge
2001, S. 144146.
214 Diego Saglia
pittoresque de la Grce published in 1782.
33
Later, in 1827, Ary Scheffer also
paints a tableau de chevalet on the subject of La Grce sur les ruines
de Missolonghi, a work that follows the line of development begun
with his initial sketch for Les Femmes suliotes of 1823, and continued
with Jeune grec dfendant son pre (1825) and, in the same year, an in-
evitably Byronic Gulnare inspired by the heroine of The Corsair.
34
The Byronic inspiration of Delacroixs La Grce sur les ruines de
Missolonghi is deep and far-reaching. If Byrons arrival in Greece had
struck the painter, it was the poets death in the citadel then so merci-
lessly defeated by the Turks which must have been responsible for in-
spiring the painting.
35
Moreover, it is undeniable that, as in Delacroixs
other literary-inspired pictures, in many ways this work moves beyond
the Byronic inspiration, even that of the single image of Selims hand
that left such a long-lasting impression on him. Yet it is through the
filter of Byrons imagination that Delacroix structures his homage to
Greece in distress and his response to recent catastrophic news of the
conflict. Therefore, it is relevant that the painting should often be
referred to as La Grce expirant sur les ruines de Missolonghi (Greece
expiring on the ruins of Missolonghi), although the female figure is cer-
tainly not dying, for this alternative title reinforces the possibility of a
link with Byrons ambivalent imagery of Greece as both dead and alive.
In addition, Delacroixs painting represents a reformulation of the
Byronic image of Greece also because of its ostension of the nation
contained in the womans gesture. Her open arms may be read both as
expressive of desolation at the massacres of the war, yet also as a presen-
tation of the body of Greece, its physical presence, to its viewers and
worshippers. In view of the popularity of Byrons ostended images of
Greece in 1820s France, it seems possible to suggest that Delacroix bor-
rows and adapts their figurative mode in order to give iconic and cul-
tural authority to his own allegorical summation of Greece in its current
predicament and, in the process, to emphasize his appeal for help and
support.
33
Tsigakou: The Rediscovery of Greece, S. 43.
34
See Kolb, Marthe: Ary Scheffer et son temps 17951858. Paris 1937, S. 471f.
35
For a useful overview on Delacroixs painting, see Johnson, Lee: The Paintings of
Eugne Delacroix: A Critical Catalogue 18161831, Bd. 1. Oxford 1981, S. 6971.
Tis Greece! 215
3. Love and Death in Missolonghi
As with other contemporary Continental writers and artists, Delacroix
took what he needed from Byron, and at the time he needed it, in order
to foster a nascent national discourse of philhellenism. Byron enabled
Delacroix to depict a Greece that is heroic even in defeat and destruc-
tion. And, as is normally the case with intercultural transference, appro-
priation does not amount to a mere recovery of the meanings of the
original, but rather implies the creation of new meanings adapted to the
receiving culture. Thus, followers of Byrons philhellenic verse con-
spicuously moved in the opposite imaginative direction from that taken
by the poet in his last months in Greece. Here, in the midst of military
action in the land he had chosen as his own fated soil, he continued to
dissociate his voice and separate himself from a geo-cultural construct
which, by contrast, the poets writing after his death would incessantly
merge and combine with his own figure and myth.
At 36 years of age, the celebrated poet and hero composed Greek
verse in which his own self is overwhelmed by a passion that replaces the
pre-eminence of Greece with the unchallenged supremacy of sentimen-
tal and sexual desire. In these lyrics he transforms himself from hero and
man of action into a fool of passion, a passive figure at the mercy of the
cruel Greek boy who spurns his gestures of love and friendship. Thus,
on the one hand, the Song of the Suliotes (composed in January 1824)
is yet another of his reinventions of Romaic culture aimed at animating
the warlike feelings of the 500 Suliote soldiers under his personal com-
mand at Missolonghi; on the other, in the contemporaneous On this
day I complete my thirty sixth year the call to arms and war soon gives
way to the expression of his passion for a Greek boy. The latter senti-
ment might be read as a reworking of the classical theme of homosexual
love between Spartan soldiers, were it not for the fact that images of war
and heroism become problematically enmeshed in sentimental and
erotic images to the extent that warlike feelings almost completely van-
ish into the sphere of desire. This tendency climaxes in what seems to
be Byrons last composition, the ten-line Last Words on Greece. Here
the poetic subject dejectedly asks What are to me those honours or
renown / Past or to come, a new-born peoples cry [?], since, as he
then confesses to his beloved (once again, the Greek boy Loukas Cha-
landritsanos) I am the fool of passion and a frown / Of thine to me is
as an Adders eye / To the poor bird [] (ll. 12, 57, CPW, 7, S. 83).
The very last fragment of Byrons poetic trajectory dismisses any ideas of
216 Diego Saglia
Greece, fighting and military glory in favour of a picture of his own tor-
mented self in the throes of an unrequited passion. Indeed, there is
something cruelly ironic in the fact that this final unmaking of Greece
should coincide with his own self-unmaking, the dissolution of body
and spirit announcing the poets death.
A few months before, the representative of the London Greek Com-
mittee William Parry, in a conversation with Byron on the subject of the
Greeks, had remarked with some astonishment that the image the poet
gave of this land is so much opposed [] to what might be expected
from the poet of Greece, so completely free from all romance and de-
lusion, that it was plainly the dictate of close observation and mature
reason.
36
As Byron instructs him in the nature of Greek society, Parry
unexpectedly experiences the poets disenchanted views on Greece and
its people, and reports that, according to the noble lord, there is no dis-
tinct country and no distinct people.
37
As Greece and the Greeks dis-
appear as discrete objects, Byrons words contrast starkly with the imma-
nence characterizing the ostensions so popular among his French and
other Continental followers. Whereas, for him, Greece becomes more
and more labile as an object for literary representation and military ac-
tion, they insist on presenting it as a concrete and coherent whole. Even
so, they are still labouring the margin between presence and absence es-
tablished by Byrons verse.
Commenting on the ambiguities in Byrons figurations of Greece,
David Roessel has observed that his interventions lay the bases of the
enduring paradox of philhellenism, an intensely contradictory attitude
split between the desire for Greece to become Western and the simul-
taneous rejection of Westernization in Greece as inauthentic.
38
No-
netheless, in the light of the texts examined here, there seem to be
further reasons for the ambiguities in Byrons Greece, as well as for the
simplifications enacted by those who followed in his philhellenic path.
The roots of the inversions, ironic debunking, and the other look, that
is the Turk-friendly look, lie in his awareness of the conflict between a
geo-cultural experience that is present and available yet also beyond re-
covery. By contrast, for European Romantic philhellenic writers and art-
36
Parry, William: The Last Days of Lord Byron (1825), quoted in: Ernest J. Lovell, Jr.
(Hrsg.): His Very Self and Voice: Collected Conversations of Lord Byron. New York
1954, S. 516.
37
Lovell (Hrsg.): His Very Self and Voice, S. 517.
38
Roessel: In Byrons Shadow, S. 52.
Tis Greece! 217
ists, Byrons Greece is a treasure trove of intensely authentic and end-
lessly recyclable images. Paradoxically, what Continental literary and
artistic philhellenism learned from Byron was how to undo his subtleties
and replace them with the desire to see and write Greece again and again
as a present reality.
Bibliography
Sources
Byron, Lord: The Complete Miscellaneous Prose. Andrew Nicholson (Hrsg.): Oxford
1991.
Byron, Lord: The Complete Poetical Works, 7 Bd. Jerome J. McGann (Hrsg.): Oxford
198093.
Byron, Lord: Lord Byrons Letters and Journals, 13 Bd. Leslie A. Marchand (Hrsg.):
London 197394.
Literature
Augustinos, Olga: From Hellenism to Philhellenism: The Emergence of Modern Greece in
French Literature 17701820. Ph D Thesis. Indiana University 1976.
Di Benedetto, Arnaldo: Le rovine dAtene: letteratura filellenica in Italia fra Sette e
Ottocento, in: Italica, 76/1999, S. 335354.
Cheeke, Stephen: Byron and Place: History, Translation, Nostalgia. Basingstoke, New
York 2003.
Demata, Massimiliano: Byron, Turkey and the Orient, in: Richard A. Cardwell
(Hrsg.): The Reception of Byron in Europe, 2 Bde. London, New York 2004,
S. 439452.
Estve, Edmond: Byron et le romantisme franais: essai sur la fortune et linfluence de
loeuvre de Byron en France de 1812 1850. Paris 1907.
Fauriel, Claude: Chants populaires de la Grce moderne, 2 Bde. Paris 1824, 1825.
Foscolo, Ugo: Lettera apologetica. Giuseppe Nicoletti (Hrsg.): Torino 1978.
Franklin, Caroline: Byrons Heroines. Oxford 1992.
Jaeckel, Katja: LEngagement philhellne et limage de la Grce dans la littrature
franaise de 1770 1830, in: Alfred Noe (Hrsg.): Der Philhellenismus in der west-
europischen Literatur 17801830. Amsterdam, Atlanta 1994, S. 87109.
Joannides, Paul: Delacroix and Modern Literature, in: Beth S. Wright (Hrsg.): The
Cambridge Companion to Delacroix. Cambridge 2001, S. 130153.
Johnson, Lee: The Paintings of Eugne Delacroix: A Critical Catalogue 18161831, 6 Bde.
Oxford 198189.
Journal dEugne Delacroix, 3 Bde. Andr Joubin (Hrsg.): Paris 1950 [1932].
Kolb, Marthe: Ary Scheffer et son temps 17951858. Paris 1937.
Lamartine, Alphonse de: Oeuvres potiques compltes. Marius-Franois Guyard (Hrsg.):
Paris 1963.
218 Diego Saglia
Leask, Nigel: Romantic Writers and the East: Anxieties of Empire. Cambridge 1992.
Oeuvres compltes de C. Delavigne, 3 Bd. Bruxelles 1832.
Pouqueville, F.-C.-H.-L.: Histoire de la rgnration de la Grce, 4 Bde. Paris 1824.
Protopsaltis, E.G.: Byron and Greece: Byrons Love of Classical Greece and His
Role in the Greek Revolution, in: Paul Graham Trueblood (Hrsg.): Byrons Politi-
cal and Cultural Influence in Nineteenth-Century Europe: A Symposium. London, Bas-
ingstoke 1981, S. 91107.
Raizis, Marius Byron: Philhellenism in English Literature 17801830, in: Alfred
Noe (Hrsg.): Der Philhellenismus in der westeuropischen Literatur 17801830. Amster-
dam, Atlanta 1994, S. 111131.
Roessel, David: In Byrons Shadow: Modern Greece in the English and American Imagin-
ation. Oxford, New York 2002.
Rovani, Giuseppe: Storia della Grecia negli ultimi trentanni 18241854. Milano 1854.
Rutherford, Andrew (Hrsg.): Byron: The Critical Heritage. London 1970.
St Clair, William: That Greece Might Still Be Free: The Philhellenes in the War of Indepen-
dence. London, New York 1972.
Sharafuddin, Mohammed: Islam and Romantic Orientalism: Literary Encounters with the
Orient. London, New York 1994.
Spencer, Terence: Fair Greece, Sad Relic: Literary Philhellenism from Shakespeare to Byron.
London 1954.
Tsigakou, Fani-Maria: The Rediscovery of Greece: Travellers and Painters of the Romantic
Era, introd. by Sir Steven Runciman. London 1981.
Van Tieghem, Paul: Le Romantisme dans la littrature europenne. Paris 1969 [1948].
Vigny, Alfred de: Oeuvres compltes, 2 Bde. Franois Germain/Andr Jarry (Hrsg.):
Paris 1986.
Webb, Timothy: Romantic Hellenism, in Stuart Curran (Hrsg.): The Cambridge
Companion to British Romanticism. Cambridge 1993, S. 15758.
Griechische Liebe 219
Constanze Gthenke
Griechische Liebe.
Philhellenismus und kulturelle Intimitt
Der Begriff ,Philhellenismus lt sich, wenn man so will, als philia, als
Streben zu oder Intimitt mit dem Hellenischen, bersetzen. David Ro-
essel hat unlngst von der Romance of Liberation gesprochen, mit der
er sowohl ein Hauptmotiv von Byrons Werken zu umschreiben sucht
als auch den nachhaltigen Einflu Byrons auf die Anglo-Amerikanische
Begegnung mit dem neuen Griechenland und seiner Reprsentation.
1
Romantische Vorstellungen des Individuellen haben ebenso wie Netz-
werke und Verbindungen zwischen Individuen viel zum Bild und zur
Historiographie des Philhellenen als Figur beigetragen.
2
Als Objekt philhellenischer Aufmerksamkeit wird jedoch nicht nur
der Philhellene, sondern auch Griechenland selbst personifiziert und als
belebte menschliche Figur imaginiert. Im folgenden soll ein kritischer
Aufri eines solchen konzeptuellen Rahmens vorgestellter ,kultureller
Intimitt gegeben werden, in dem eine kulturproduzierende, bzw. kul-
turbesttigende Nhe mit einem personifizierten Hellas den Diskurs
philhellenischen Schreibens bestimmt.
3
Was heit es, Griechenland so-
wohl als Objekt als auch als Subjekt menschlichen Begehrens vorzustel-
len, und was sind die Folgen? Was bedeutet, darber hinaus, Begehren
im frhen neunzehnten Jahrhundert, und was ist seine innere Logik, so
1
Roessel, David: In Byrons Shadow. Modern Greece in the English and American Ima-
gination. Oxford 2002, S. 61.
2
Gthenke, Constanze: Translating Philellenism. Comments on the Movement
of a Movement, in: E. Konstantinou (Hrsg.): Figuren des Europischen Philhellenis-
mus, 17.19. Jahrhundert. Figures of European Philhellenism, 17
th
to 19
th
Century. Frank-
furt a.M. 2007, S. 181193.
3
,Kulturelle Intimitt bzw. ,cultural intimacy ist, im Bezug auf Griechenland, von
dem Anthropologen Michael Herzfeld als Begriff verwendet worden, allerdings in
einer unterschiedlichen Bedeutung, auf die ich am Schluss dieses Aufsatzes zu-
rckkommen werde.
220 Constanze Gthenke
wie sie sich auf die Bildlichkeit und strukturellen Annahmen des Phil-
helllenismus auswirkt?
1887 verffentlicht Murrays Magazine in London posthum zwei von
Byrons letzten Gedichten.
4
Beide waren bis dato nicht nur unbekannt,
sondern auch unbenannt geblieben und erschienen bei Murray unter
neuen Titeln. Das erste der beiden, Love and Death, richtet sich an
ein Du, um dessentwillen Gefahren bereitwillig ausgestanden worden
sind:
I watched thee when the foe was at our side
Ready to strike at him, or thee and me
Were safety hopeless rather than divide
Aught with one loved save love and liberty.
I watched thee in the breakers when the rock
Received our prow and all was storm and fear,
And bade thee cling to me through every shock
This arm would be thy bark or breast thy bier.
I watched thee when the fever glazed thine eyes
Yielding my couch and stretched me on the ground
When overworn with watching neer to rise
From thence if thou an early grave hadst found.
The Earthquake came and rocked the quivering wall
And men and nature reeled as if with wine
Whom did I see around the tottering Hall
For thee whose safety first provide for thine.
And when convulsive throes denied my breath
The faintest utterance to my fading thought
To thee to thee even in the grasp of death
My Spirit turned Ah! Oftener than it ought.
Thus much and more and yet though lovst me not,
And never wilt Love dwells not in our will
Nor can I blame thee though it be my lot
To strongly wrongly vainly love thee still.
5
4
Zur detaillierten Publikationsgeschichte dieser letzten Gedichte, siehe Fiona
MacCarthys verlliche biographische Studie Byron. Life and Legend. London 2002,
S. 503505.
5
Love and Death 1824, in: Jerome McGann (Hrsg.): Lord Byron. The Complete Poe-
tical Works, vol. Vii. Oxford 1993, S. 81f.
Griechische Liebe 221
Zeitgenssische Berichte, Byrons Briefe, und andere Quellen legen
nahe, da das Du grere hnlichkeit mit Lukas Chalandritsainos hat
als mit einem abstrakten Griechenland, mit seinem griechischem Pagen,
der vor Missolonghi von den Trken gefangen genommen, dann aus
Seenot errettet, und schlielich von Byron whrend eines heftigen Fie-
bers gepflegt worden war, whrend eines der fr die Gegend hufigen
Erdbeben Missolonghi erschtterte.
6
Der sptere Titel Love and Death
assoziiert allerdings fraglos, und seitens Murray vermutlich absichtlich,
das bekannteste Motto des Griechischen Unabhngigkeitskriegs, wel-
ches in ganz Europa leicht als Schlagwort des Philhellenismus identifi-
zierbar war: das von Freiheit oder Tod. Die emotionale Ausrichtung
von Byrons Lyrik entlang des Landes Griechenland ist noch strker in
dem zweiten Gedichtentwurf, der posthum als Last Words on Greece
erschien:
What are to me those honours or renown
Past or to come, a new-born peoples cry
Albeit for such I could despise a crown
Of aught save Laurel, or for such could die;
I am the fool of passion and a frown
Of thine to me is as an Adders eye
To the poor bird whose pinion fluttering down
Wafts unto death the breast it bore so high
Such is this maddening fascination grown
So strong thy Magic or so weak am I.
7
Auch hier lassen sich Leidenschaft und Mierfolg gleichermaen auf die
politische und emotionale Situation beziehen und mehr noch, als dies
der neue Titel vermuten lt. Die spten berschriften mgen aller-
dings weniger Ausdruck viktorianischen Anstands sein, der Byrons Kult
als Mrtyrer Griechenlands und als europische Berhmtheit zu besie-
geln suchte,
8
als da sie einer etablierten Laufrichtung folgen, die Grie-
chenland als personifiziertes, komplex gender-kodiertes, begehrtes und
letztendlich unerreichbares Objekt des Begehrens visualisiert.
In Byrons Werk berschneidet sich der Topos der Desillusion ange-
sichts des Zustands des zeitgenssischen Griechenlands mit dem Thema
der unerfllten, schuldbeladenen und zumeist tdlichen Liebe. Die Ge-
walt, die vor allem in seinen populren Verserzhlungen vorherrscht, ist
6
MacCarthy: Byron, S. 499501.
7
Complete Poetical Works, vii, S. 83.
8
Zur Rezeption Byrons in Grossbritannien, siehe z. B. Elfenbein, Andrew: Byron
and the Victorians. Cambridge 1995.
222 Constanze Gthenke
dabei allerdings bewut mit dem Motiv der Schnheit verbunden und
mit sthetischen Qulitten versehen nicht ohne Bedeutung in einem
Umfeld, in dem Schnheit, sptestens seit Winckelmann und dem s-
thetischen Hellenismus des ausgehenden 18. Jahrhunderts, als Grundei-
genschaft und daher Grundwert des Hellenischen identifiziert wurde.
Das wohl prominenteste, wenn auch gewhnlich nur anzitierte Beispiel
fr die erotischen und sthetischen Qualitten des griechischen Verfalls
findet sich in Byrons The Giaour, wo die kurze Schnheit des noch fri-
schen Todes, nach einem langen Vergleich, sich auf das personifizierte
Griechenland bezieht:
He who has bent him oer the dead,
Ere the first day of death is fled;
The first dark day of nothingness,
The last of danger and distress;
(Before Decays effacing fingers
Have swept the lines where beauty lingers)
And marked the mild angelic air
The rapture of repose thats there
The fixed yet tender traits that streak
The languor of the placid cheek,
And but for that sad shrouded eye,
That fires not wins not weeps not now
And but for that chill changeless brow,
[]
Yes but for these and these alone,
Some moments aye one treacherous hour,
He still might doubt the tyrants power,
So fair so calm so softly seald
The first last look by death reveald!
Such is the aspect of this shore
Tis Greece but living Greece no more!
9
Das zeitgenssische Griechenland ist mit der noch schnen Toten iden-
tifiziert,
10
selbst wenn Byron die Erwartung weiblicher Personifizierung
tatschlich in der Schwebe hlt. Dies wird besonders deutlich in sei-
nen mit dem Giaour verffentlichten Notizen: hier beschreibt er das-
selbe Phnomen im Bezug auf diejenigen, die gewaltsam an Stich- oder
Schuwunden verstorben sind Todesarten, und sthetische Erfahrun-
gen, die statt der weiblichen Toten des Giaour eher, oder zugleich, eine
mnnliche Welt von Militr und Gesellschaft suggerieren:
9
Complete Poetical Works, vol. iii, S. 42 (= Z. 68ff.).
10
So z. B. Bronfen, Elizabeth: Nur ber ihre Leiche. Tod, Weiblichkeit und sthetik.
Mnchen 1994.
Griechische Liebe 223
I trust that few of my readers have ever had an opportunity of witnessing what is
here attempted in description, but those who have will probably retain a painful
remembrance of that singular beauty which pervades, with few exceptions, the
features of the dead, a few hours, and but for a few hours after ,the spirit is not
there. It is to be remarked in cases of violent death by gun-shot wounds, the
expression is always that of languor, whatever the natural energy of the sufferers
character; but in death from a stab the countenance preserves its traits of feeling
or ferocity, and the mind its bias, to the last.
11
Dies ist nicht der Ort, der komplexen gender-Zuordnung speziell bei
Byron in all ihren Einzelheiten gerecht zu werden aber es sei festge-
halten, da das homoerotische Moment, dessen Objekt knabenhaft
oder tot ist, darin einen festen Platz einnimmt neben der Reprsentation
Griechenlands als feminin (und somit auch wieder als mnnlich defizi-
tr oder passiv).
Ein anderes Beispiel fr den sthetisierten und personifizierten Ruin
bieten die 1823 erschienenen Lieder der Griechen und die 1826 erschie-
nenen Vier Erzhlungen aus der Geschichte des jetzigen Griechenlands von
Wilhelm Waiblinger. In den stark von Byron und der Reiseliteratur ge-
prgten Verserzhlungen wiederholt sich als Grundthema die wahre,
aber illegitime, und letzendlich tdliche, also die in jeder Hinsicht zum
Scheitern verurteilte Liebe, ob am Hofe und im Bannkreis Ali Pashas in
Ioannina (wie in der Verserzhlung Euphrosyne), oder in der Intimitt
zweier verbundener Huser im griechischen Viertel Konstantinopels
(in der Verserzhlung Kalonasore).
12
Whrend die Erzhlperspektive ge-
11
Complete Poetical Works, vol. III, S. 416.
12
Zu Byron siehe Glck, Friedrich: Byronismus bei Waiblinger. Tbingen 1920; zu
Modellen der Reiseliteratur Mygdalis, Lampros: Francois C.H.L. Pouquevilles
Nachwirkung auf F.W. Waiblingers Briefroman Phaeton. Tbingen 1971. Ebenso der
Stellenkommentar in der Gesamtausgabe von F.W. Waiblinger, Werke und Briefe.
Textkritische und kommentierte Ausgabe in fnf Bnden. Hans Kniger (Hrsg.): Stutt-
gart 1980.
Zu Waiblingers Begeisterung fr Byron sowohl als Messlatte der eigenen
Schriftstellerperson als auch als aktiver Philhellene, siehe auch Tagebcher und
Briefe, z. B. Tagebuch vom 9. Mrz 1823: Der origininellste aller Dichter der
neuesten Zeit, ist Byron. Skott hat diese Geistesflle, dieses geniale Rasen nicht.
Schon Byrons Leben lehrt ihn kennen. Southey ist gewiss der tief-zarteste. Zu er-
kennen die Schranken seiner Kraft, zu erkennen: das kann ich nicht! das hab ich
nicht! Es ist etwas grssliches!; dazu einen Tag spter: Ich habe viel von Byron in
meinem Wesen im Leben! wenn ich Lord wre!; an Eser schreibt Waiblinger
am 5. Dezember 1823: Wt ich, wie ich mit Byron auskme, ich ginge zu ihm
nach Kephalonien. Italien ist halb vor mir verschwunden, und ich sehne mich
mehr noch nach Griechenland, nach Asien, nach Indien!.
224 Constanze Gthenke
whnlich entweder die eines neutralen Sprechers oder die des verraten-
den, bzw berforderten, meist europischen Liebhabers ist (Kalonasore;
Euphrosyne; Rose von Farsistan), so liegt der Fokus doch fest auf den
weiblichen Gestalten. Es ist sicher mglich, Waiblingers nahezu obses-
siven Fokus auf das Motiv der zerstrerischen Liebe im Lichte seiner
enormen Selbststilisierung zu erlutern, aufgespannt im Rahmen seiner
literarischen Aspirationen und seiner tatschlichen emotionalen Bin-
dungen, bzw. Verwirrungen.
13
Selbst wenn oder gerade weil Waiblinger
das Autobiographische bewut zur Selbststilisierung nutzt, ist es auf-
schlureich, da schon in den frheren Griechenliedern ganz hnliche
Motive der Liebe berwiegen (die ihm nicht zuletzt Kritik fr Mangel
an Spezifitt und fr leichte Erregbarkeit einbringen),
14
ganz abgesehen
von der Motivik des Sehnens und der Landschaften erotischer Allusio-
nen. In den Liedern findet sich prometheische Sturm und Drang Lyrik
unterlegt mit der erotischen Sprache der ,Liebeswonne, Extreme die
sicher Waiblingers Verlangen, literarische Motive und Persnlichkeiten
und deren jeweiligen Stil zu multiplizieren, gut anzeigen.
15
Im Gedicht
Wechselgesang steht der Strke und dem starken Sinn der Jnglinge
und Mnner die bewundernde Liebeslust, Schnheit und Ruhe des
Kusses der Mdchen gegenber; die Jungfrau unter den Propylen,
im Stil prometheischen Sturm und Dranges mit Anlehnungen an den
von Waiblinger verehrten Hlderlin (Wie wunderbar umfngst mich/
Alliebend,/ Heiliges Licht?/ Aus jungem Grn hebt/ Dunkel-einsam,
wie ein Geist,/ Grau verwittert Gestein,/ Sul an Sule/ Sich empor),
charakterisiert sich durch eine zunchst objektlose Sehnsucht und ein
Liebesbedrfnis (Und die Sonne fat/ Allebend, umquillend,/ Laub-
13
Im Jahr 1824 erlebt und durchschreibt Waiblinger eine intensive und schluend-
lich desastrse Verbindung mit der Tbinger Professorentochter und -nichte Julie
Michaelis, die mit einem Kontaktverbot und nicht geringem gesellschaftlichen
Aufruhr endet.
14
Auch stellt er uns nicht einzelne Momente des griechischen Freiheitskampfes
dar, oder preist einen oder den andern seiner Helden; er behlt berall das Allge-
meine im Auge und greift nicht mit lebendiger Theilnahme in das Leben und
Treiben des wiedergebornen Volkes ein. [] Waiblingers Griechenlieder zeugen
von einem gebildeten Geschmack und einem fr das Schne empfnglichen und
leicht erregbaren Gemth. Literarisches Conersations-Blatt, Nr. 59 (10. Mrz 1824),
S. 234.
15
Zu Waiblingers leidender Verehrung literarischer Gren, siehe beispielsweise
Dcker, Burckhard: ,Warum bin ich kein Goethe? Formen literarischer Selbst-
inszenierung bei Wilhelm Waiblinger, in: Euphorion 2 /2002, S. 171192.
Griechische Liebe 225
grn, Sulengrau,/ Fllet alles,/ Mit Liebe, mit Liebe!/ Fort drngt
michs/ Im schwellenden Busen!/ Ach wohin?), das sich zuletzt auf
Griechenland als adquates Ziel richten kann (Du bists! Du bists!/
Bildende! Liebende!/ Fassest mich! Ziehest mich/ Ganz zu dir!// Hin-
ber!/ ber das Hellgrn/ Und graue Trmmer,/ ber Berg und Meer,/
ber die blauen Inseln!/ Hinber! hinber!/ Ach! verschwimmen/
Ganz in dich,/ Du heiterer Himmel!); ein hnliches Drngen be-
stimmt Das Mdchen auf dem Eurotas, das angesichts der Natur fragt
Ists der Himmelslaut der Liebe,/ Der das Innerste durchklingt, Und
mit namenlosem Triebe/ Herz an Herz zusammenschlingt?. Die Vater-
landsliebe in Mdchens Vaterlandslied schlielich bernimmt die
Funktion der heien Ksse des Freiheitskmpfers (Du liebes teures
Vaterland!/ Dann denk ich, wie er vor mir stand,/ Und seiner heien
Ksse!/ In seinem Arm, an seiner Brust!/ Ach welche Wonn, ach wel-
che Lust/ Ich dir zuliebe misse!). Die nachfolgende und letzte Strophe
des Gedichts macht berdeutlich, wie sehr es das weibliche Sehnen ist,
das in den Griechenliedern sein Recht einfordert und die Dynamik be-
stimmt, im Gegensatz zu der Rhetorik von Strke und bestimmter Frei-
heitserwartung der mnnlichen Figuren: Du liebes teures Vaterland!/
Was ich geno und was ich fand,/ Dank ich ja deiner Liebe!/ Es liebt
der Mann dich nicht allein;/ Dir darf sich auch das Mdchen weihn/
Mit heilig zartem Triebe!
Waiblingers bewegte Heldinnen sind nicht nur Objekte eines begeh-
renden Blickes, sondern selbst Figuren eines berschwellenden Sympa-
thiestrebens. Waiblinger beschreibt in seinen Tagebchern und Briefen
recht wrtlich sein eigenes Sehnen (der Sprachgebrauch der eigenen
Erwartungen entspricht der Bildlichkeit in Lieder der Griechen und Vers-
erzhlungen, v. a. in krperlichen Zeichen), und damit sich selbst als lie-
bendes und sich somit konstituierendes Subjekt, und eben jene Kenn-
zeichen manifestieren sich erneut in den Figuren junger Griechinnen,
wie auch in den die Liebe enttuschenden Figuren der philhelleni-
schen Kmpfer. Ein Blick in Waiblingers Selbstzeugnisse macht somit
deutlich, da es nicht Griechenland ist, das Emotionalitt provoziert,
sondern da eine kontinuierlich von Waiblinger an sich selbst kon-
statierte Emotionalitt und unsagbare Sehnsucht im Falle Griechen-
lands ihren privilegiertesten und selbstverstndlichsten objektiven Aus-
druck findet. Einige weitere Beispiele fr Waiblingers autotrophe und
lyrik-provozierende Selbstdarstellung seien hier genannt. Am 18. Okto-
ber 1822 artikuliert sich der unbedingt Dichter sein Wollende folgen-
dermaen:
226 Constanze Gthenke
Um ein Mdchen, das mich liebte, dem ich ihr Alles wre, die auer mir nichts kennte,
als Gott und seine Schpfung, und diese nur in mir ach alles, was ich habe, Uni-
versitt, Eltern, alles gb ich darum. Ich reibe mich auf noch ber dieser grnzenlosen
Sehnsucht (229).
16
Am 1. Dezember des gleichen Jahres: Es drngt mich, meinen eigenen
Zustand, die unendliche Wehmuth und Trauer, die halb Sehnen ist nach einem
Unerreichbaren, halb Schmerz ber etwas Verlorenes, in einer Reihe lyrischer
Gedichte auzudrcken (243). Dies ist just die Zeit zu der er seine Griechen-
lieder zu verfassen beginnt: ,Knabe und Mutter gedichtet. Ich sehne
mich unbeschreiblich zu reimen. Ich meine, dies wunderbare, alldurch-
bebende Sehnen msse und knne sich am besten in einem Gleichklang
aussprechen (2. Dezember 1822, 245). Form (Reim) und Inhalt entspre-
chen auf ostensiv natrliche Weise dem Sehnen des Dichters:
Das Mdchen auf dem Eurotas gedichtet. [] Meine Brust schwillt ebenso in Sehn-
sucht nach wilden schrankenlosen Genssen, nach einem alle Nerven durchbebenden
Schwelgen wie nach Ruhm, Ehre, Wahrheit und reiner Liebe. Einmal zu rasen, in Wol-
lust zu schwelgen, auszusaufen bis auf den Boden den Becher des wildesten
Genusses, allen meinen Trieben, der tollsten Sinnlichkeit den freyesten Lauf zu
lassen das, das wnscht ich! Ich mchte recht eigentlich alles, die hchsten
Wonnen des Lebens, das Leben selbst und den Himmel im Wollustschooss eines
bebenden Mdchens genieen! (3. Dezember 1822, 245).
Mehr noch, werden so doch fr Waiblinger das Lieben einerseits und
Griechenland als Ziel philhellenischer Aktivitt andererseits zu den zwei
Seiten der gleichen Medaille:
Die Kritik der reinen Vernunft geht darauf hinaus, zu beweisen, da synthetische
Stze a priori mglich seyen. Ach! ein Mdchen an Lippen und Busen, wre mir lieber,
als Analytik und Dialectik, lieber als Universitt und Vikariat und Pfarramt. Da wrd
ich erwarmen, die Bcher lassen mich kalt. Da wrd ich krftig und stark werden und
Lebensflle saugen aus ihrem Kusse, aus ihrem wallenden Busen, aus ihrem Wol-
lustscho, und nun verdumpf ich, trockn ich aus ber Bcherhufen, in leeren
Beschftigungen, hinter dem dampfenden Ofen, und die hchste uerung mei-
ner Thatkraft ist, da ich mir selbst mit der Maschine den Thee mache. Mich ek-
kelt all das Getriebe an: ich bin Mensch: ich will die hchten Wonnen der Erde genieen.
Ich dachte oft schon dran, zu entfliehen, nach Griechenland zu gehen, zu kmp-
fen und zu bluten! Das wre doch was anderes als das ewige Lesen und Studie-
ren. [] Es haucht mich tdtlich an aus diesen aufgeschichteten Bchern und Pa-
pieren. Da ist kein Heil, da ist Erstarrung, Verwesung, Tod. Oh Gott! lieben! das
wre etwas anderes! Ich kann nicht lnger zehren von der Idee. (28. Januar 1823).
16
Die Seitenangaben im Folgenden beziehen sich auf die Ausgabe der Tagebcher.
18211826, in Zusammenarbeit mit Erwin Breitmeyer. Herbert Meyer (Hrsg.):
Stuttgart 1956.
Griechische Liebe 227
Gleichzeitig ist Griechenland, als materieller Garant der antiken Vergan-
genheit, auch der Ort, an dem kulturelle Harmonie und eine kulturelle
Hoch-Zeit (so wie in Winckelmanns Geschichte der antiken Kunst)
historisch verwirklicht und historisch erkennbar wurden. Der folgende
Brief an Friedrich Eser vom 6. Februar 1823 nimmt bezug auf jene Kri-
tiker und Rezensionen, die Waiblingers Lieder als zu wenig konkret be-
mngelt hatten:
Glaube nicht, wie andere, es sei darin zu wenig Beziehung auf Griechenland
selbst. Ein solches Land, wo jede Kraft des starken hellen Geistes aufgefodert,
jede Regung des schnen Gemtes gestillt und befriedigt wurde, wo der Mensch
in einer unendlichen Liebesflle sich an den keuschen allnhrenden Mutterbusen
einer in reichern und vollern Gestalten hervordrngenden Natur drngte, liebte
und geliebt ward wahrlich, ein solches Land ist nur Hellas, und Hellas ist es nur
durch jene in diesen Liedern ausgehauchte, unmittelbar nicht auszusprechende
Einung mit dem allbeseelenden Naturgeist. Ich versprach mir wenig Erfolg davon:
sie sollten nur eine zarte Blume sein fr manche Seelen, die mich lieben, ahnen
und verstehen. Und Du bist eine solche!.
17
Griechenland wird fabar nur durch einen Diskurs der Emotionalitt
und Intimitt, der zugleich Griechenlands eigensten Charakter wider-
spiegelt, wobei Charakter selbst ein Begriff ist, der das Bild einer Persn-
lichkeit und menschlichen Figur voraussetzt. Die Frage ist daher nicht
so sehr, wie sich Waiblingers (sicher extremer) romantischer Diskurs und
seine Modellwahl auf das Genre der philhellenischen Literatur auswirkt,
sondern eher, inwieweit eben dieses Genre fr Waiblinger (aber womg-
lich nicht nur fr ihn) auerordentlich sinnvolle und angemessene Kon-
stellationen und Diskurse fr die Artikulation seiner knstlerischen und
emotionalen Erwartungshaltung bieten kann.
Trotz aller Unterschiede, die sich in ihrer gender-Politik ergeben
mgen, teilen Waiblinger und Byron das Prinzip der erstrebten und
unerfllten Nhe, die sich in griechischen Figuren nicht exklusiv, aber
auerordentlich wirkungsvoll manifestiert. Hier mag sich deswegen
zeigen, da sich die Konstellation von Philhellenismus und einer
Rhetorik der Liebe nicht allein ber das (bekannte) Modell erotisier-
ter Machtvorstellungen gegenber einer exotisierten (oder orientali-
sierten) Weiblichkeit annhern lt, oder ber die Mglichkeiten
und die Rolle einer homoerotischen Bildlichkeit im Rahmen zeitge-
nssischer sexueller Identittsstiftung, sondern um eine echte Inve-
17
Waiblinger, Wilhelm: Werke und Briefe.Textkritische und kommentierte Ausgabe
in 5 Bnden, Bd. 5,1. Hans Kniger (Hrsg.): Stuttgart 1982, S. 180.
228 Constanze Gthenke
stition des romantischen Liebesbegriffs im Diskurs des Philhelle-
nismus.
18
Waiblinger poltert in seinen Tagebchern gegen die Klte und Trok-
kenheit der analytischen Wissenschaften, und selbst wenn er hier spe-
ziell von der akademischen Philosophie spricht, so ist der Topos von
der unfruchtbaren Lehre gerade auch im Bezug auf das klassische Wis-
sen ein verbreiteter Topos schon Byron sprach von den cold drills
of Greek grammar denen er im Internat Harrow ausgesetzt war, im
Gegensatz zu dem lebendigen Griechenland seiner ersten Reisen. Die
Rhetorik von der Neubelebung oder Revitalisierung der Antike ist uns,
sptestens seit dem spten neunzehnten Jahrhundert, beinahe zu gelu-
fig um als folgenreiche Rhetorik wahrgenommen zu werden. Trotzdem
ist bei der Betrachtung des klassischen Griechenlands, innerhalb und
auerhalb der institutionalisierten Wissenschaft schon seit dem spten
achtzehnten Jahrhundert die Personifizierung eine gngige Herange-
hensweise. Wie also gestaltet sich das Bild Griechenlands als mensch-
liche, begehrenswerte Figur? Da ist zunchst der Hintergrund der Per-
sonifizierung des klassischen Griechenlands, die sich in zwei Bereichen
niederschlgt: der Historiographie und der Kunstbetrachtung, bzw.
Kunstgeschichte. Griechenland suggeriert Jugend und physische At-
traktivitt; fr Herder beispielsweise ist Griechenland die Adoleszenz-
Phase von Jnglingstraum und Mdchenblte in der Biographie der
Humanitt;
19
Winckelmanns ephebische Statuensthetik schliet sich
dem an, und fixiert verkrzt gesprochen die Dimension des eroti-
sierten jugendlichen Krpers. Inwieweit Herder fr Waiblinger relevant
ist, sei dahingestellt, ebenso wie Herders Rezeption in dem begin-
nenden institutionalisierten wissenschaftlichen Studium der Antike
erfolgte. Fraglos ist allerdings Winckelmanns allgemeiner Bekannt-
heitsgrad, und auch Waiblinger waren Winckelmanns Schriften selbst-
18
Zu Homoerotik, bzw. Homosexualitt, und Hellenismus, siehe z. B. Potts, Alex:
Flesh and the Ideal. Winckelmann and the Origins of Art History. New Haven 1994;
Blanchard, Alastair: Hellenic Fantasies: Aesthetics and Desire in John Ad-
dington Symonds A Problem in Greek Ethics, in: Dialogos 7/2000, S. 99123;
Davis, Whitney: Winckelmanns ,Homosexual Teleologies, in: Natalie B. Kam-
pen (Hrsg.): Sexuality in Ancient Art. Cambridge 1996, S. 262276; Derks, Paul:
Die Heilige Schande der Pderastie. Homosexualitt und ffentlichkeit in der deutschen
Literatur, 17501850. Berlin 1993.
19
Herder, Johann Gottfried: Auch eine Philosophie der Geschichte der Menschheit,
Smmtliche Werke, Bd. 5. Bernhard Suphan (Hrsg.): Berlin 1891, S. 495, 497.
Griechische Liebe 229
verstndlich wohlvertraut.
20
Dazu gehrte vermutlich auch die rhetori-
sche Figur, mit der Winckelmann seine Geschichte der Kunst des Altertums
beschliet, und die ein weiteres und erstaunliches Beispiel bietet fr
diese Form autorialer Intimitt und Sympathie: hier ist es das Sprechen
durch eine antike, oder beinahe zeitlose, weibliche, griechische Figur:
21
Ich bin in der Geschichte der Kunst schon ber ihre Grenzen gegangen, und un-
geachtet mir bei Betrachtung des Untergangs derselben fast zu Muthe gewesen ist,
wie demjenigen, der in Beschreibung der Geschichte seines Vaterlandes die Zer-
strung desselben, die er selbst erlebt hat, berhren msste, so konnte ich mich
dennoch nicht enthalten, dem Schicksale der Werke der Kunst, so weit mein
Auge ging, nachzusehen. So wie eine Liebste an dem Ufer des Meeres ihren ab-
fahrenden Liebhaber, ohne Hoffnung ihn wieder zu sehen, mit betrhnten Augen
verfolgt und selbst in dem entfernten Segel das Bild des Geliebten zu sehen
glaubt. Wir haben, wie die Geliebte, gleichsam nur einen Schattenriss von dem
Vorwurfe unsrer Wnsche brig; aber desto grssere Sehnsucht nach dem Verlor-
nen erweckt derselbe, und wir betrachten die Copien der Urbilder mit grsserer
Aufmerksamkeit, als wie wir in dem vlligen Besitze von diesen nicht wrden get-
han haben.
22
Wie lassen sich die Konzeptualisierungen Griechenlands als eine attrak-
tive, unerreichte oder verlorene und natrlich gebildete jugendliche
menschlichen Figur, vom Laufe der Zeit bedroht und erhht, mit der
Vorstellung eines neuen, zeitgenssischen Griechenlands vereinbaren?
Entweder mu es als neue Realisierung einer alten Rolle erscheinen oder
als nicht gealterte, sondern in die Vergangenheit versetzte Position der
Liebe: Mit anderen Worten: als erste Liebe, vormalige Liebe, verlassene
20
Siehe auch hierzu Tagebuchnotizen, die sich auf Winckelmann sowohl als Vor-
bild wie auch als mittlerweile Quelle sthetischer Gemeinpltze beziehen, z. B.
am 2. April 1823 zu einem Besuch bei einem Bekannten Hetsch: In meinen Grie-
chenliedern schien ihm hie und da etwas Unverstndliches zu seyn, er bat mich
um nhere Erklrung, die ich ihm denn auch gab. Auch der alte Pfarrer von Lau-
barzhausen war in der Post. Nun ward noch ein paar Stunden getrunken und ge-
sprochen. Noch einmal wiederholte der Pfarrer sein Und Griechenland bleibt,// Wie
Winkelmann schreibt,// Die Werkstatt der schnen Natur.
21
Die Figur ist Dibutades, Tochter eines korinthischen Tpfers, die Plinius zufolge
als ,Erfinderin der Kunst gilt: Sie zeichnet mit Hilfe einer Lampe den Umriss
ihres schlafenden Geliebten vor seiner Abreise (Hist. Nat. vi, 35). Zur Popularitt
Dibutades im 18. Jahrhundert siehe Muecke, Frances: ,Taught by Love: The
Origin of Painting Again, in: The Art Bulletin, 81.2 (June 1999), S. 297302; King,
Shelley: Amelia Opies ,Maid of Corinth and the Origins of Art, in: Eighteenth-
Century Studies 37.4/2004, S. 629651.
22
Winckelmann, J.-J.: Geschichte der Kunst des Alterthums, Schriften und Nachla,
vol. 4. Max Kunze (Hrsg.): Mainz 2002, S. 637639.
230 Constanze Gthenke
Liebe und dazu mit einem Objekt der Liebe das gender-ambivalent ist:
Ob weiblich oder jnglingshaft, es weicht ab von der erwachsenen Reife,
und verbleibt in diesem Sinne gefhrlich nahe an Passivitt und sogar
Degeneration: beides Themen, die aus dem Repertoire des philhelleni-
schen Diskurses bekannt sind.
Auf diese Weise liee sich eine Taxonomie erstellen, die aber noch
nicht erklrt, was die Attraktivitt der Personifizierung an sich ausmacht.
Die Diskurse der Romantik und des Philhellenismus (wie brigens auch
des Hellenismus und der Altertumswissenschaft) teilen das program-
matische Interesse an der Entwicklung des Individuums und des Indi-
viduellen, an Bildung und an der Reflektion der eigenen Person und
Position, die sich an der Beschftigung mit und am Verstehen von Grie-
chenland ablesen lt. (Daher zum Beispiel auch das bermige Inter-
esse an Byron als Persnlichkeit). Und daher auch die berschneidung
mit der romantischen Vorstellung von Liebe als von Unverstndnis
bedrohter, aber Synthese versprechender, aufeinander bezogener Inti-
mitt.
Das erlaubt uns weiterzufragen nach den Grnden, warum Liebe als
eine relevante analytische Kategorie im frhen neunzehnten Jahrhun-
dert bestehen sollte? Sptestens seit Werther, so hat Gerhard Neumann
argumentiert, war Liebe ein Kulturthema und Begriffssystem, das kul-
turinterpretierend und -schaffend wirkte.
23
Stendhal, in seinem Essay De
lAmour von 1821, erhebt Liebe zum generellen analytischen Konzept
europischer und nationaler Kultur (ganz so als wre es ein Gegenstck
zu Madame de Staels Kategorie der Europa einteilenden und verbin-
denden Romantik) und es ist ein schner Zufall, da dieses Werk
Stendhals 1822 auf der gleichen Seite des von Cotta herausgegebenen
Literarischen Conversationsblatts rezensiert wird wie die neuesten philhel-
lenischen Berichte aus Griechenland.
24
Um knapp (und auch hier verkrzt) darzulegen, was die Grundlage
und Dynamik Romantischer Liebe bildet, lt sich Niklas Luhmanns
historische und soziologisch-theoretische Analyse von Liebe und Inti-
mitt als kommunikativem Code nutzbar machen.
25
Luhmann beschreibt
23
Neumann, Gerhard: Lektren der Liebe, in: Heinrich Meier/Gerhard Neu-
mann (Hrsg.): ber die Liebe. Ein Symposium. Mnchen 2001, S. 980, hier: S. 10.
24
Das System der Liebe, in: Literarisches Conversations-Blatt Nr. 268 (21. November
1822), 1072.
25
Luhmann, Niklas: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimitt. Frankfurt a.M.
1986.
Griechische Liebe 231
einen historisch variablen Code der Liebe als die Verbindung von Kon-
ventionen, Annahmen und rhetorischen Strategien, die interpersonelle
Kommunikation ermglichen, bzw. erleichtern und somit Liebe und
Darstellungen der Liebe wie jeden anderen Diskurs analysierbar ma-
chen. Vor allem im Zusammenhang mit der Rhetorik des Philhellenis-
mus ist es hilfreich, die Kodifizierung von Liebe auch gerade durch die
Kategorie der Kommunikation (als Erwartung, wenn auch nicht immer
als Effekt), statt nur durch die Linse des (in seiner Wirkung einseitigen)
Verlangens zu erfassen.
Luhmann entwirft eine Linie von der Idealisierung mittelalterlicher
Liebe, ber den Code des Paradoxen im 17. und 18. Jahrhundert, hin zu
einer zunehmenden Fokussierung auf die Reflektion von Autonomie
um 1800. Diese Entwicklung wird begleitet von der Mglichkeit der In-
kommunikabilitt, im gleichen Mae in dem das Bewutsein der eige-
nen Subjektivitt und der fremden des Anderen, mit dem man eine
neue, eigene Welt zu etablieren und zu teilen versucht, zunimmt. Wh-
rend die Konkretheit und Einzigartigkeit des Individuums zum univer-
salistischen Prinzip erklrt wird, [] setzt sich eine neuartige, typisch
romantische Paradoxie durch: die Erfahrung der Steigerung des Sehens,
Erlebens, Genieens durch Distanz.
26
Es ist diese kognitive Strapaze,
die fr Luhmann durch einen Code der Liebe wenn nicht lsbar, so
doch praktizierbar wird.
27
Mit anderen Worten, Romantische Liebe be-
ruht auf der spannungsreichen Annahme, da eine persnliche, geistige
und emotionale Verbindung zwischen zwei Individuen Ausgangspunkt
und Ziel ist, die jedoch, gerade wegen deren Individualitt, bestndig
unvollstndig, verloren, oder noch nicht erreicht ist. Auf die Landkarte
des (Phil-) Hellenismus, und der historischen und geographischen Di-
stanz zu Griechenland, projiziert, greift diese Annahme gut die Prva-
lenz, Griechenland als vergangene, verlassene, oder dem Tode nahe ge-
liebte Figur darzustellen: nicht nur als Objekt des Begehrens, sondern
als unerreichbares anderes Subjekt erstrebter Kommunikation. Philhel-
lenismus einerseits, besonders da wo er vom Einschlu der Antike ge-
prgt ist, und Romantische Liebe und ihre Reprsentation andererseits
ergnzen sich so.
Was Griechenland in seiner Modernitt ob gewollt oder nicht
durch seine klassische Vergangenheit definiert und positioniert, beson-
ders macht, ist dabei Sympathie als Grundannahme unerfllter Liebe.
26
Luhmann: Liebe als Passion, S. 172.
27
Ebd., S. 29.
232 Constanze Gthenke
Das Schlagwort von gerade der deutschen Geistes- oder Seelenver-
wandtschaft mit Griechenland ist zurecht keine analytische Kategorie,
aber es wird einleuchtender in seiner Funktion, wenn wir solche Sym-
pathie mit Griechenland als Teil eines empfindsamen und romanti-
schen Diskurses von Intimitt neu lesen. Sympathie erlaubt und fat
Grenzberschreitungen und Austausch mit dem Anderen (wie zum Bei-
spiel in den sozialen Utopien vieler Romane des achtzehnten Jahrhun-
derts einer davon Wilhelm Heinses Ardinghello, in dem diese Utopie
auf tatschlichem griechischen Boden gegrndet sein soll). Sie erklrt
nicht zuletzt auch den Rollentausch, den wir zum Beispiel in Waiblin-
gers Griechinnen finden, die nicht nur durch ihren Charakter als Objekt
der Begierde, sondern auch als Begehrende imaginiert werden. Darber
hinaus sind es gerade auch Waiblingers Griechenlieder, die Sympathie
und Gemeinschaft mit denen provozieren sollen, die ihn lieben, und zu
denen er, wie oben zitiert, seinen Briefadressaten Eser zhlt.
Der Anthropologe Michael Herzfeld hat in den letzten Jahren den
Terminus der cultural intimacy vor allem im Rahmen der kulturanthro-
pologischen Analyse des griechischen Nationalstaats geprgt.
28
Kultu-
relle Intimitt bezieht sich in diesem Fall auf die komplexe Logik, mit
der eine Gruppe auf die Intrusion durch einen Auenseiter (in dem Fall
den Anthropologen) reagiert und dadurch kulturelle Intimitt innerhalb
der Gruppe postuliert. Die kulturelle Intimitt, von der ich im Bezug auf
die Reprsentations-Strategien des Philhellenismus spreche, ist in vieler
Hinsicht eine andere. Trotzdem sind Herzfelds ,emotionaler Zusammen-
halt, der sich auf eine traditionelle Intimitt beruft (und sie dadurch erst
schafft), und die Sehnsucht als Komponente der philhellenischen Rheto-
rik gleichermaen offen, als historisch konditionierte Kategorien gelesen
und analysiert zu werden. Trotzdem, die innere Dynamik und die Pr-
missen des Philhellenismus konditionieren in mancher Hinsicht noch
immer die zeitgenssische Wissenschaft, wenn es um die Herangehens-
weise an Kulturen, wie die griechische, geht, die als anders aber auch als
besonders ,nah angesehen werden, oder sich selbst so verstehen.
Der Romantische Philhellenismus operiert also mit einem Erwar-
tungshorizont, in dem kulturelle Intimitt nicht etwas ist, das durch den
auenstehenden Philhellenen bedroht bzw. konstituiert wird, sondern
das, was gem der eigenen strukturellen Logik solcher Intimitt und ih-
rer historisch konditionierten Form der Reprsentation als behauptet,
gesucht und verloren galt.
28
Herzfeld, Michael: Cultural Intimacy. Social Poetics in the Nation State. London
2
2005.
Griechische Liebe 233
Literaturverzeichnis
Quellen
Literarisches Conversations-Blatt. Leipzig: Brockhaus 18201826.
Herder, Johann Gottfried: Auch eine Philosophie der Geschichte der Menschheit, Smmt-
liche Werke, Bd. 5. Bernhard Suphan (Hrsg.): Berlin 1891.
Lord Byron. The Complete Poetical Works, vol. Vii. Jerome McGann (Hrsg.): Oxford
1993.
Waiblinger, Wilhelm: Werke und Briefe. Textkritische und kommentierte Ausgabe in
5 Bnden, Bd. 5,1. Hans Kniger (Hrsg.): Stuttgart 19801982.
: Tagebcher. 18211826, in Zusammenarbeit mit Erwin Breitmeyer. Herbert Meyer
(Hrsg.): Stuttgart 1956.
Winckelmann, Johann Joachim: Geschichte der Kunst des Alterthums, Schriften und
Nachla, vol. 4. Max Kunze (Hrsg.): Mainz 2002.
Forschungsliteratur
Blanchard, Alastair: Hellenic Fantasies: Aesthetics and Desire in John Addington
Symonds A Problem in Greek Ethics, in: Dialogos, 7/2000, S. 99123.
Bronfen, Elizabeth: Nur ber ihre Leiche. Tod, Weiblichkeit und sthetik. Mnchen
1994.
Davis, Whitney: Winckelmanns ,Homosexual Teleologies, in: Natalie B. Kampen
(Hrsg.): Sexuality in Ancient Art. Cambridge 1996, S. 262276.
Derks, Paul: Die Heilige Schande der Pderastie. Homosexualitt und ffentlichkeit in der
deutschen Literatur, 17501850. Berlin 1993.
Dcker, Burckhard: ,Warum bin ich kein Goethe? Formen literarischer Selbstinsze-
nierung bei Wilhelm Waiblinger, in: Euphorion, 2/2002, S. 171192.
Elfenbein, Andrew: Byron and the Victorians. Cambridge 1995.
Glck, Friedrich: Byronismus bei Waiblinger. Tbingen 1920.
Gthenke, Constanze: Translating Philellenism. Comments on the Movement of
a Movement, in: E. Konstantinou (Hrsg.): Figuren des Europischen Philhellenis-
mus, 17.19. Jahrhundert. Figures of European Philhellenism, 17
th
to 19
th
Century. Frank-
furt a.M. 2007, S. 181193.
Placing modern Greece. The dynamics of Romantic Hellenism, 17701840. Ox-
ford/New York 2008.
Herzfeld, Michael: Cultural Intimacy. Social Poetics in the Nation State. London
2
2005.
King, Shelley: Amelia Opies ,Maid of Corinth and the Origins of Art, in:
Eighteenth-Century Studies, 37.4/2004, S. 629651.
Luhmann, Niklas: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimitt. Frankfurt a.M.
1986.
MacCarthy, Fiona: Byron. Life and Legend. London 2002.
Muecke, Frances: ,Taught by Love: The Origin of Painting Again, in: The Art Bul-
letin, 81.2 (Juni 1999), S. 297302.
Mygdalis, Lampros: Francois C.H.L. Pouquevilles Nachwirkung auf F.W. Waiblingers
Briefroman Phaeton. Tbingen 1971.
234 Constanze Gthenke
Neumann, Gerhard: Lektren der Liebe, in: Heinrich Meier/Gerhard Neumann
(Hrsg.): ber die Liebe. Ein Symposium. Mnchen 2001, S. 980.
Potts, Alex: Flesh and the Ideal. Winckelmann and the Origins of Art History. New Haven
1994.
Roessel, David: In Byrons Shadow. Modern Greece in the English and American Imagina-
tion. Oxford 2002.
Adelbert von Chamissos Griechendichtungen 235
Gilbert He
Adelbert von Chamissos Griechendichtungen
Adelbert von Chamisso ist heutzutage in erster Linie als Verfasser der mr-
chenhaften Erzhlung Peter Schlemihl bekannt. Wenngleich er neben
diesem Werk als bersetzer, Weltreisender, und angesehener Botaniker
in Erscheinung getreten ist, hat im literarischen Gedchtnis einer breite-
ren ffentlichkeit eigentlich nur dieser Prosatext die Zeiten berdauert
abgesehen von einzelnen Gedichten und dem Zyklus Frauen-Liebe und
Leben, die durch die Vertonung Robert Schumans populr wurden.
Dabei waren Chamissos Lieder und Balladen, die in Auswahl
erstmals als Anhang zur zweiten Auflage des Peter Schlemihl 1827 er-
schienen,
1
vom Publikum mit einer beispiellosen Begeisterung aufge-
nommen worden. Bis zu seinem Tod im Jahre 1838 verfate er ein be-
achtliches lyrisches uvre, das bis zur Jahrhundertwende zum festen
Zitat- und Formenschatz des Bildungsbrgertums gehrte. Die 1831 in
der Weidmannschen Verlagsbuchhandlung in Leipzig erschienene Aus-
gabe der gesammelten Gedichte machte den Dichter zum fhrenden
deutschen Lyriker neben Heinrich Heine.
2
In immer neuen, stets erwei-
terten Ausgaben
3
wurde Chamissos Lyrik zum Manifest des engagier-
1
S. hierzu Tardel, Hermann: Chamissos Werke. Erster Band. Leipzig, Wien 1907,
S. 60.* Zur weiteren Editionsgeschichte s. ebd., S. 60*-63*.
2
Vgl. Chamissos Selbstaussagen in seinen Briefen, z. B. 1832 an De la Foye: Das
Volk singt meine Lieder, man singt sie in den Salons, die Komponisten reien sich
danach, die Jungen deklamieren sie in den Schulen, mein Portrait erscheint nach
Goethe, Tieck und Schlegel als das vierte in der Reihe der gleichzeitigen deut-
schen Dichter, und schne junge Damen drcken mir fromm die Hand oder
schneiden mir Haarlocken ab, bzw. anders gewendet ebenfalls in einem Brief
an De la Foye vom Juni 1828: Was man sich in der Jungend wnscht, hat man im
Alter die Flle; ich glaube fast, ich sei ein Dichter Deutschlands. (von Chamisso,
Adelbert: Werke, Bd. 6: Leben, 3. Buch. Briefe, Gedichte, Kleine Aufstze. Julius
Eduard Hitzig (Hrsg.): Leipzig 1839, S. 53).
3
Bereits die zweite Auflage von 1834 umfate weit ber 500 Seiten, die dritte
nahezu 600. 1826 erschien bereits die 23. Auflage. (Hermann Tardel: Chamissos
Werke, S. 60*-63*).
236 Gilbert He
ten, spter zum Hausbuch des sehaften Brgertums.
4
In diesem Um-
feld bilden die Texte, die sich dem griechischen Freiheitskampf wid-
men neun Einzeltexte und der dreihundert Verse umfassende Zyklus
Chios
5
eine bescheidene Gruppe, die in den meisten Literaturgeschich-
ten und selbst in der Spezialliteratur zur Lyrik Chamissos hufig genug
gnzlich bergangen wird.
6
Allzu leichtfertig wird die Griechenlyrik Chamissos gemeinhin in
einem Atemzug mit derjenigen Wilhelm Mllers genannt. Dies mag dar-
in begrndet liegen, da Mller und Chamisso in qualitativer Hinsicht
zwei deutlich aufragende Leuchttrme in einem weiten, fast unber-
schaubaren Meer philhellenischer Tendenz- und Gelegenheitsdichtung
markieren.
7
Eine adquate Interpretation dieser Dichtung darf jedoch
4
Miller, Norbert: Chamissos Schweigen und die Krise der Berliner Romantik, in:
Aurora 39/1979, S. 101119, hier: S. 102.
Insbesondere durch zahlreiche Vertonungen wurden Chamissos Gedichte
schnell populr. Tardel nennt zahlreiche Komponisten, unter ihnen Ludwig
Spohr, Max Bruch, Edward Grieg und Robert Schumann, welche Werke von Cha-
misso vertonten (Herman Tardel: Chamissos Werke, S. 69*).
5
Im einzelnen handelt es sich um die Texte Lord Byrons letzte Liebe (S. 360f.),
Sophia Kondulimo und ihre Kinder (S. 361363), Bisson vor Stampalin
(S. 400f.), sowie die bersetzungen Georgis (S. 357360), Verratene Liebe
(S. 230), Die schne Sngerin (S. 723), Das Mdchen und das Rebhuhn
(S. 725), Die Quelle (S. 231), sowie das Terzinengedicht auf Ludwig I. von Bay-
ern Deutsche Barden (S. 381383), in: Smtliche Werke. Adelbert von Chamisso.
Nach dem Text der Ausgaben letzter Hand und den Handschriften. Bibliographie
und Anmerkungen von Volker Hoffmann. 2 Bde. Jost Perfahl (Red.): Mnchen
1975. Das Terzinengedicht Verbrennung der trkischen Flotte zu Tschesme
(S. 417f.) literarisiert ein Ereignis aus dem ersten russisch-trkischen Krieg.
6
Dies beklagte bereits Herman Tardel: Chamissos Werke, S. 66*: [] die fr die ge-
schichtliche Auffassung wichtigen politischen Gedichte werden dabei meistens
wegen ihres uns fremd gewordenen Inhalts bersehen.
Eine ausfhrliche Wrdigung erhalten die Gedichte jedoch bei Tardel, Hermann:
Studien zur Lyrik Chamissos. Bremen 1902, S. 2833, sowie bei Feudel, Werner:
Chamisso als politischer Dichter. Diss. Halle 1965.
7
Den nach wie vor besten berblick ber die deutsche Literatur des Philhellenis-
mus bietet die dringend revisionsbedrftige Zusammenstellung von Arnold, Ro-
bert F.: Der deutsche Philhellenismus. Kultur- und literarhistorische Untersu-
chungen, in: Euphorion, Ergnzungsheft 2/1896, S. 71181. Speziell zur Lyrik hat
Irmgard Scheitler zwei instruktive berblicksdarstellungen vorgelegt: Scheitler,
Irmgard: Griechenlyrik (18211828). Literatur zwischen Ideal und Realitt, in:
Internationales Jahrbuch der Bettina von Arnim-Gesellschaft. Forum fr die Erforschung
von Romantik und Vormrz 5/1993, S. 188234, sowie Dies.: Deutsche Philhelle-
nenlyrik. Dichter, Verffentlichungsformen, Motive, in: Evangelos Konstanti-
Adelbert von Chamissos Griechendichtungen 237
nicht von zweifelhaften Qualittsmastben geleitet werden, sondern
mu vielmehr die Fiktionalisierungs- und Imaginationsmechanismen
sowie intendierte Wirkungsstrategien in den Blick nehmen, um dieser
Form operativer Literatur
8
gerecht zu werden.
Als 1781 geborener Abkmmling eines franzsischen Adelsgeschlechts,
das infolge der Revolution den angestammten Familiensitz verlassen
mute und auswanderte, wuchs Chamisso lange Jahre in nationaler,
aber auch politischer Heimatlosigkeit auf.
9
Als Mann zwischen den
Vaterlndern hat er sich lange Zeit gefhlt. Selten wohl hat sich ein
Dichter seine Sprache so schwer erarbeiten mssen wie Chamisso,
10
wie
Reinhold Schneider konstatiert. Chamisso behielt Zeit seines Lebens
einen deutlichen Akzent und die sprachliche Unsicherheit scheint trotz
der poetischen Virtuositt an einigen Stellen seines Werkes deutlich
durch. Nach lngeren Aufenthalten in Frankreich, dem intensiven Kon-
takt mit dem Kreis um Madame de Stal und der Weltreise in den Jahren
18151818, bestimmte dann die Existenz als dezidiert deutscher Botani-
ker und Dichter seinen als frhzeitige Vergreisung stilisierten Lebens-
abend der Jahre ab 1820 bis zu seinem Tod 1838. Seine um 1800 erfolgte
Hinwendung zum Berliner Frhromantikerkreis (so war er Mitglied in
der Berliner Mittwochsgesellschaft und ab 1802 im Nordsternbund, in
welchem der Kunstauffassung A.W. Schlegels schwrmerisch gehuldigt
wurde), von dessen sthetischen Konzepten er sich spter allerdings los-
sagte, markiert fr Chamisso zugleich eine Hinwendung zum Paradigma
des Griechischen: Hier wurde er mit dem romantischen Konzept einer
Kunstpoesie, der Durchdringung von Kunst und Politik, dem Postulat
nou (Hrsg.): Ausdrucksformen des Europischen und Internationalen Philhellenismus
vom 17.19. Jahrhundert. Bern u. a. 2007, S. 7082.
8
Zu diesem Begriff s. Stein, Peter: Operative Literatur, in: Gert Sautermeister/
Ulrich Schmid (Hrsg.): Zwischen Restauration und Revolution: 18151848. Mn-
chen 1998 (= Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhun-
dert bis zur Gegenwart, Bd. 5), S. 485504, hier: S. 499. In der Aussage hnlich
Scheitler: Deutsche Philhellenenlyrik, S. 72.
9
Zur Biographie s. Feudel, Werner: Adelbert von Chamisso. Leben und Werk. Leipzig
1971; Lahnstein, Peter: Adelbert von Chamisso. Der Preue aus Frankreich. Mnchen
1984; Fischer, Robert: Adelbert von Chamisso. Weltbrger, Naturforscher und Dichter. Ber-
lin u. a. 1990, sowie neuerdings Lagner, Beatrix: Der wilde Europer. Adelbert von Cha-
misso. Eine Biografie. Berlin 2008, welche Chamissos Griechenbegeisterung aber weit-
gehend ausblendet und lediglich auf den Seiten 276278 eher beilufig erwhnt.
10
Schneider, Reinhold: Chamissos Geschichtserfahrung, in: Reinhold Schneider,
gesammelte Werke. Reinhold Schneider: Dem lebendigen Geist, Bd. 6. Carsten Peter
Thiele (Hrsg.): Frankfurt/Main 1980, S. 178190, hier: S. 180.
238 Gilbert He
einer sthetischen Sittlichkeit und dem frhromantischen Hellas-Kult
11
vertraut, der in Weiterfhrung des Weimarer Bildungsideals die Wieder-
gewinnung des Rouseauschen Naturzustands aus einer Erneuerung des
Griechischen postulierte.
12
Stilistisch wird dies in seinen ersten, wohl
von Friedrich Schlegels Theorien beeinfluten Gedichten erkennbar im
Changieren zwischen einfacher Liedform und klassischer Ode, zwischen
Klopstockscher Odendichtung und Homerischem Epos. Chamissos Auf-
gehen in der deutschen Kultur lt sich somit weniger als mimikry-artige
Wandlung oder gar resignative Aufgabe einer eigenen Identitt interpre-
tieren, sondern vielmehr als Versuch, ein vermeintlich im antiken Grie-
chenland verwirklichtes Ideal unter dem Vorzeichen von Romantik und
Idealismus auf einer neuen, hheren Stufe nachzuvollziehen,
13
wobei er
spter in den dreiiger Jahren gegenber seinem Bruder Hyppolite
seine zwiespltige Haltung zur Bewegung der franzsischen Romantik
gerade mit deren Huldigung eines falschen Griechentums und der
allzu ehrfrchtigen Haltung gegenber dem klassischen Hellas begrn-
det: Wir brauchen keine Agamemnons, Jupiter oder Cupidos []. In
der Literatur haben eure sogenannten Romantiker das franzsische Grie-
chentum, das doch nur auf den Brettern existierte, aufgegeben, und ich
htte ihnen applaudiert, wenn sie bis zum Leben selbst vorgedrungen
wren.
14
Chamissos weitgehender Verzicht auf die sonst allgegenwr-
11
S. hierzu: Brueck, Martin: Antikenrezeption und frhromantischer Poesiebegriff: Stu-
dien zur ,Graecomanie Friedrich Schlegels und ihrer Vorgeschichte seit J.J. Winckelmann.
Diss. Konstanz 1981.
12
S. hierzu Miller, Norbert: Chamissos Schweigen, S. 104107.
13
S. hierzu auch ebd., S. 108: So ist Chamissos fast noch kindlicher Versuch, ganz
in die deutsche Sprache einzudringen, ganz sich an die deutsche Mentalitt an-
zugleichen, mitnichten als ein Tausch der Nationalitt aufzufassen, sondern als
die leidenschaftliche Assmimilation an einen neuen Zustand menschlicher Gesit-
tung, der fr ihn mit Goethe und Fichte, durch Tieck und Schlegel mit den Deut-
schen verbunden ist. Da er ausgerechnet von Deutschland die berwindung der
franzsischen Zustnde erwartete, von einem zerissenen, handlungsunfhigen
und grotesk rckstndigen Staatenbund von Zwergenknigen, hngt bei ihm []
von der grundstzlichen Trennung zwischen dem Reich der Ideale und der eo
ipso beschrnkten Realitt der Gegenwart ab: auch die Griechen hatten ja bei aller
Zerstrittenheit, bei aller niedertrchtigen Kabale ihrer Geschichte doch in der
Idee die Morgenzeit des Menschlichen bewahrt, die klare Schnheit des Gesetzes
und das, was Jean Paul eben damals die sittliche Grazie genannt hat. So soll fr
Chamisso das Deutsche einstehen fr die Wiedererweckung dieser humanisti-
schen Ideale aus der romantischen oder sentimentalischen Sehnsucht nach ihm.
14
Brief vom 17. April 1838 an Hyppolyte de Chamisso, in deutscher bersetzung
zitiert nach Feudel, Werner: Chamisso als Mittler zwischen franzsischer und
Adelbert von Chamissos Griechendichtungen 239
tige Parallelisierung von antikem Hellas und modernem Griechenland
in der philhellenischen Dichtung
15
drfte hierin seine Wurzel haben.
Von Anfang an hatte Chamisso den griechischen Freiheitskampf mit
groem Interesse verfolgt
16
und in Briefen bereits im Vorfeld des Auf-
stands seine Bereitschaft zum aktiven Kampf zumindest indirekt
angedeutet,
17
ffentlich meldete er sich aber erst nach dem Fall von
Missolunghi und der entscheidenden Seeschlacht von Navarino (20. 10.
1827) zu Wort.
1827 wurde im viermal wchentlich in Berlin erscheinenden Gesell-
schafter, einem Kulturjournal, das es trotz strenger preuischer Zensur
(insbesondere versteckt im Rezensionsteil) verstand, von den Ereignissen
in Griechenland zu berichten,
18
Chamissos Gedicht Lord Byrons letzte
Liebe gedruckt.
19
Es verbindet das Motiv der Selbstaufopferung einer
Griechin, die ihrem im Kampf fr das Vaterland gefallenen Geliebten in
den Tod folgt, mit dem tragischen Lebensende Lord Byrons, das von
Zeitgenossen ebenfalls als Opfer fr Griechenland verstanden wurde:
Byron ist erschienen, der Kamnen
und des Ares Zgling strahlt,
ein Held unter Hellas heldenmtgen Shnen
Auf dem blutgedngten Freiheitsfeld. (Z. 14)
Schon diese erste Strophe evoziert durch die Signatur Lord Byrons als
Sohn der Musen und des Kriegsgottes Ares in der ersten Zeile das in der
deutscher Literatur, in: Weimarer Beitrge 32/1986, S. 753765, hier S. 759. Bereits
1836 hatte Chamisso in hnlichem Sinne an seinen Bruder geschrieben. S. ebd.,
S. 765, Anm. 23.
Der Vorwurf des falschen Griechentums richtet sich konkret gegen Victor
Hugos Drama Hernani (Ebd., Brief v. 30. Oktober 1831, zitiert ebenfalls nach Feu-
del: Chamisso als Mittler, S. 765, Anm. 24).
15
Zu diesem Themenfeld s. allgemein Lbker, Friedgar: Antike Topoi in der deutschen
Philhellenenliteratur: Untersuchungen zur Antikerezeption in der Zeit des griechischen Un-
abhngigkeitskrieges (18211829). Mnchen 2000.
16
Vgl. Feudel: Chamisso als politischer Dichter, S. 104.
17
Vgl. den Brief vom 12. Dezember 1821 an De la Foye: Wer wird uns nach Grie-
chenland bringen, wenn es da losgehen wird und wo der Angelander mit den
Jonischen Inseln und Irland! (Chamisso: Briefe. Gedichte. Kleine Aufstze, S. 179).
18
Wiedenmann, Ursula: ,Der Gesellschafter als Quelle philhellenischer Publizi-
stik, in: Konstantinou, Evangelos (Hrsg.): Die europische philhellenische Presse bis
zur 1. Hlfte des 19. Jahrhunderts. Frankfurt a.M. 1994, S. 255271.
19
Von Chamisso, Adelbert: Lord Byrons letzte Liebe, ED in: Der Gesellschafter
11/1827, S. 155. Hier zitiert nach Smtliche Werke. Adelbert von Chamisso. Jost Per-
fahl (Red.), S. 360f.
240 Gilbert He
Philhellenendichtung wirkmchtige Bild des englischen Dichters als
aktivem Kmpfer fr Griechenland, das zugleich als allgemeines Sinn-
bild fr das agitativ motivierte Anliegen der Griechenlyrik insgesamt
instrumentalisiert wurde.
20
uerst effektvoll wird zudem durch den
Hinweis auf Hellas heldenmthge Shne sowie das blutgedngte[n]
Freiheitsfeld die den Philhellenismus wie ein cantus firmus durchzie-
hende Mehrfachcodierung Griechenlands als Verbindung von antikem
Hellas und zeitgenssischem Griechenland zur Imagination eines ber-
zeitlichen Horts der Freiheit inszeniert eine markante Ausnahme aller-
dings in Chamissos Griechendichtung, die ansonsten den rhetorischen
Rckgriff auf das idealisierte antike Hellas als ,Mutterland aller europi-
schen Bildung und Kultur
21
penibel meidet.
22
Byron, der englische Dichter, dessen extravagante amourse Aben-
teuer sich geradezu ideal mit Vorstellungen eines den Hauch des Exoti-
schen versprhenden, griechischen Weiblichen
23
inszenieren lieen,
24
stt im fiktiven Rahmen dieses Gedichts bei der stolzen Palikarenbraut
allerdings an seine Grenzen:
Wie mein Volk, so will ich dich verehren!
Mild, doch ungerhrt die Jungfrau spricht:
Magst die Krone von Byzanz begehren,
Meine Liebe nur begehre nicht! (Z. 912)
20
S. He, Gilbert: Missolunghi. Gense, transformations multimdiales et fonc-
tions dun lieu identitaire du philhellnisme, in: Revue Germanique Internatio-
nale 12/2005: Philhellnismes et transferts culturels dans lEurope du XIXe sicle. Paris
2005, S. 77107, hier: S. 8596.
21
S. hierzu: Heyer, Friedrich: Das philhellenische Argument: ,Europa verdankt
den Griechen seine Kultur, also ist jetzt Solidaritt mit den Griechen Dankes-
schuld. , in: Evangelos Konstantinou (Hrsg.): Die Rezeption der Antike und der
europische Philhelenismus. Frankfurt a.M. u. a. 1998, S. 7991.
22
S. o. S. 238 f. Mglicherweise liegt dieser Darstellungsweise zudem aber auch eine
durch die Weltreise bedingte Hinwendung zur empirischen Wissenschaft und eine
daraus gewonnene, antispekulative Grundhaltung zugrunde. In diese Richtung ar-
gumentiert Pille, Ren-Marc: Adelbert von Chamisso, in: Gunther E. Grimm/
Frank Rainer Max (Hrsg.): Deutsche Dichter. Leben und Werk deutschsprachiger Autoren.
Romantik, Bidermaier und Vormrz, Bd. 5. Stuttgart 1989, S. 218228, hier: S. 223; so-
wie Feudel, Werner: Nachwort, in Werner Feudel (Hrsg.): Adelbert von Chamisso.
Smtliche Werke in zwei Bnden. Mnchen 1982 S. 781809, hier insbes. S. 804808.
23
S. hierzu neben den Arbeiten von Constanze Gthenke auch auch He, Gilbert:
Zwischen den Fronten. Weibliche Rollenkonzepte in philhellenischen Erzhl-
texten, in: Evangelos Konstantinou (Hrsg.): Das Bild Griechenlands im Spiegel der
Vlker (17.20 Jh.). Bern u. a. 2008, S. 363383.
24
S. hierzu den Aufsatz von Constanze Gthenke im vorliegenden Band.
Adelbert von Chamissos Griechendichtungen 241
In der Sterbestunde lt die Griechin den Dichter zu sich bitten und
enthllt ihm ihr Geheimnis:
Sie beginnt: Du sollst es jetzt erfahren;
Frhe traf ich schon der Liebe Wahl,
Gab sein Schwert auch meinem Palikaren,
Als das Vaterland es mir befahl.
Scheidend sprach ich ernst in ernster Stunde:
Sieg nur oder Tod, das wissen wir;
Auf denn! und ein Wort aus treuem Munde:
Stirbst du unserm Volke, sterb ich dir.
Du nun siehst mich dem Gestorbnen sterben;
Fallend sandt er mir zurck sein Schwert;
Nimm es hin, du Dichterheld, zum Erben
solchen Gutes bist nur du mir wert. (Z. 2132)
Mit dem hochgradig emotionalisierten Bild der doppelten Schwertber-
gabe korrespondiert hier die auffllige Personenzeichnung: So wird die
Palikarenbraut im Text als Jungfrau, Stern der innern Nacht, als
Schmerzensreiche und geisterartig, herrliche Gestalt einer erhaben-
sakralen Sphre zugerechnet,
25
der ein nicht minder erhaben geschilder-
ter Dichter als mythologische Gestalt, als Held, Schmerzenstrger
usw. gegenbertritt. Das Selbstopfer der Griechin effektvoll an den
Schlachtruf der Palikaren: Sieg oder Tod! geknpft erscheint damit
ebenso wie der angekndigte Tod des Dichters als dstres Los, als Erfl-
lung einer religisen Prophetie:
Byrons Zge seit der Stunde waren
Trb und nchtlich, wie sein dstres Los;
Und er nahm das Schwert des Palikaren
bald mit sich hinab in Grabes Scho. (Z. 3740)
Letztlich vollzieht sich somit erst im Tod des Dichters, der allein als
rechtmiger Erbe[n] Solchen Gutes und damit als Erbe des grie-
25
In hnlicher Weise wird auch im Gedicht Sophia Kondulimo und ihre Kinder
(Smtliche Werke. Adelbert von Chamisso. Jost Perfahl (Red.), S. 235237) die Mutter
mit Epitheta, die der christlich-sakralen Sphre zuzurechnen sind, als blhende
Jungfrau (Z. 9), Schmerzensreiche (Z. 33) und Schmerzensmutter (Z. 53)
apostrophiert, der in umso deutlicherem Kontrast die gegenerischen, heidnischen
Trken gegenbergestellt werden (Z. 13: ,Auf, auf! Der wste Lstling, der Trke
strmt herbei []; Z. 3: Einziehend jauchzt der Moslim, der unserm Glauben
flucht).
242 Gilbert He
chischen Freiheitstraumes schlechthin gelten kann, das Los des Pali-
karen. Sein Tod erscheint damit als sehnsuchtsvolle Erfllung des fr
griechische Freiheitsideale gestorbenen Heroen, als Opfer fr den grie-
chischen Freiheitskampf, was zugleich einer postumen Nobilitierung, ja
Sakralisierung des zu Lebzeiten bekennenden Atheisten Byron
26
gleich-
kommt.
Dem Gedicht lag eine am 27. Juni 1827 erschienene Zeitungsmel-
dung in dem von Johann Friedrich Cotta herausgegebenen Stuttgarter
Morgenblatt fr gebildete Stnde, dem aufgrund der weniger restriktiven
Zensurpraxis im Herzogtum Wrttemberg wohl einflureichsten Perio-
dikum des Philhellenismus,
27
zugrunde. hnlich wie Gustav Schwab
28
und andere Dichter nutzte Chamisso die Lyrik als Instrument der zeit-
nahen (zwischen der Verffentlichung des Zeitungsberichts und der
Erstpublikation des Gedichts lagen nur wenige Tage!) und publikums-
wirksamen Distribution politischer Nachrichten. Eine Abschrift des Ar-
tikels aus demMorgenblatt befindet sich noch heute in Chamissos Nach-
la.
29
Whrend in der Zeitungsmeldung das Geschehen durch mehrfach
gestufte Beglaubigungsstrategien und Erzhlebenen authentisiert wird
26
Zu dieser Sakralisierung Byrons im Moment des Todes s. St. Clair, William: That
Greece might still be free. The philhellenes in the war of Independence. London, New York,
Toronto 1972, S. 183: After his death, the vile seducer and dangerous atheist
became in the eyes of his detractors, that celebrated, that talented, that erring
nobleman, Lord Byron. Suddenly it was universally realized that he had been
one of the most remarkeble men of his time, sowie Wilson, S[amuel]. S[heri-
dan].: A narrative of the Greek mission, or sixteen years in Malta and Greece: including
tours in the Peloponnesus, in the Aegean and Ionian Isles. With remarks on the religeous
opinions, moral state, social habits, politics, language, history, and lazarettos of Malta and
Greece. London 1839, S. 495.
27
S. Scheitler: Griechenlyrik, S. 195197.
28
So basiert Gustav Schwabs am ersten Mrz 1824 im Stuttgarter Morgenblatt (Mor-
genblatt fr gebildete Stnde 25/1924, S. 205f.) erschienenes Gedicht: Die Engels-
kirche auf Anatolikon auf einer Meldung aus der Augsburger Allgemeinen Zei-
tung, die sechs Tage zuvor (am 25. Februar 1824) erschienen war. Die Markie-
rung als Neueste Mhr aus Hellas weist ausdrcklich auf diesen Aktuali-
ttsaspekt hin. Zur Rolle der Allgemeinen Zeitung s. Breil, Michaela: Die All-
gemeine Zeitung, in: Helmut Gier/Johannes Janota (Hrsg.): Augsburger Buch-
druck und Verlagswesen. Von den Anfngen bis zur Gegenwart. Wiesbaden 1997,
S. 11191134.
29
Feudel: Chamisso als politischer Dichter, S. 228f. (vermutlicher Standort des Auto-
graphs: Staatsbibliothek Berlin: Handschriftenabteilung, Nachla Adelbert von
Chamisso, Kasten 16).
Adelbert von Chamissos Griechendichtungen 243
(so berichtet ein Ich-Erzhler von einer Gesellschaft in Genf
30
in welcher
der aufgrund seines deutlich von Strapazen des Hungers gezeichnete
und damit als gaubwrdig einzustufende Grieche Spikiades das
Geschehen wiedergibt),
31
konzentriert Chamisso in seiner literarischen
Umsetzung die Handlung auf das Zusammentreffen der beiden Protago-
nisten. Der Fokus verschiebt sich damit von der ausfhrlichen Schil-
derung des vergeblichen Liebeswerbens und der Charakterisierung der
Griechin als gebildete Schnheit (und damit letztlich als moderne Ver-
krperung des antiken Ideals der Koooyo0io) im Zeitungsbericht
zum Konflikt zwischen dem als Held stilisierten Dichter und der we-
sentlich strker als Kmpferin typisierten Palikarenbraut. Das vom
Dichter eingefhrte Motiv des Schwertes dient dabei ebenso wie die
weniger erotisierte Gestaltung der Frauenfigur einer Emotionalisierung
des Geschehens. Der Verlobte der Griechin, der gefallene Freiheits-
kmpfer, erscheint hingegen lediglich als handlungsmotivierendes Ele-
ment: Das eigentliche Kampfgeschehen wird somit wie in der Vorlage
aus dem Handlungsraum gelst und bildet den atmosphrischen Hin-
tergrund, whrend die Kriegsfolgen gleichsam im Brennglas zwischen-
menschlicher Intimitt fokussiert
32
ihr empathisches Potential voll
entwickeln knnen.
hnliche Fiktionalisierungstrategien lassen sich auch in Chamissos epi-
schem Gedicht Georgis
33
erkennen, das 1827 erstmals im Berliner Conver-
sations-Blatt ediert wurde. Als Vorlage diente ein Heldenlied aus der 1825
erschienenen Sammlung griechischer Volkslieder von Claude Fauriel in
30
Wenngleich der Ort nicht genauer bestimmt wird, drfte der zeitgenssische Re-
zipient das Geschehen im Palais des Bankiers und aktiven Philhellenen Jean-
Gabriel Eynard angesiedelt haben. Zu diesem s. Anm. 49.
31
Ich wohnte unlngst einer Abendgesellschft in Genf bey. Es war ein Grieche ein-
geladen, der in Missolunghi gekmpft und sich mit seinen Kampfgenossen durch-
geschlagen hatte. Seine Zge waren edel, sein Auge voll Feuer; aber noch zeigten
sich auf seinem Gesichte die Spuren des berstandenen Elends und der Hungers-
noth. Von Napoli die Romania aus war er, mit heien Empfehlungen versehen,
hierher gekommen, um seine Gesundheit wiederherzustellen. (Morgenblatt fr
gebildete Stnde Nr. 153 vom 27. Juni 1827, S. 609f., hier: S. 609; der Text der Zei-
tungsmeldung mit geringfgigen Fehlern auch bei Feudel: Chamisso als politischer
Dichter, S. 225f.).
32
Diese Argumentationsstrategien gleichen insofern den Formen der bildknst-
lerischen Umsetzung des Freiheitskampfes. S. hierzu den Aufsatz von Ekaterini
Kepetzis in diesem Band.
33
WA, S. 357360. Erstdruck Conversations-Blatt 1/1827, S. 245f.
244 Gilbert He
der bersetzung durch Wilhelm Mller.
34
Whrend Mller eine mg-
lichst textnahe, interlineare bersetzung des bei Fauriel verzeichneten
Volkslieds in ber hundert Versen gibt und den Titel (Geschichte des Geor-
gis Skatoverga) beibehlt, der den kretischen Volkshelden mit dem trki-
schen Spottnamen Skatoverga (=Kotstange) belegt, rafft Chamisso in
dem 18-strophigen Gedicht deutlich die Handlung. Auch in diesem Fall
verzichtet er auf die in der Vorlage vorgegebene Sprecherrolle und setzt
unmittelbar mit der Figurenrede ein. Der Text beginnt wirksam mit dem
Rachevers des Georgis, der refrainartig immer wieder anzitiert und in
der elften Strophe wiederholt wird, bevor er leicht abgewandelt als
Schlustrophe wiederkehrt:
35
Georgis, Held Georgis, hast oft die Hnde rot
Gefrbt in Trkenblute, gieb Einem noch den Tod.
Erzhlt wird die Rachetat des kretischen Volkshelden Georgis an einem
trkischen Tyrannen, dem Mrder seiner Schwester und seines Vaters,
die bereits 1806 geschehen sein soll, in der philhellenischen Dichtung
aber unhinterfragt als zeitgenssisches Ereignis kolportiert wurde:
36
Nachdem der trkische Statthalter auf Kreta, Ariph Mochoglou, alle
Tchter der nicht-mohammedanischen Untertanen (Rajahs) zu sich ge-
beten hat, damit sie vor ihm tanzten, verweigert sich die Schwester des
Georgis den eindeutigen Annherungsversuchen des Trken und flieht
in ihr Vaterhaus, um der Schande einer Vergewaltigung zu entgehen:
Sie kam, und als am Abend er frei die Andern sprach,
Da hatt er sie erkoren zu seines Bettes Schmach.
Die Jungfrau, stark und tchtig, von aller Hlfe blo,
Entwand sich dem Versucher und rang von ihm sich los,
Im schnellen Lauf entflohen dem prunkenden Gemach,
Erreichte, fromm und zchtig, sie bald das heimsche Dach. (Z. 1217)
Damit zitiert das Gedicht jenes die philhellenische Literatur wie ein
roter Faden durchziehende lngst vor 1821 fest etablierte Motiv der
34
Fauriel, Claude: TPAIOAA PDMAKA. Neugriechische Volkslieder. Gesam-
melt und herausgegeben von C. Fauriel. bersetzt und mit des franzsischen
Herausgebers eigenen Erluterungen versehen von Wilhelm Mller. Zweiter Theil.
Leipzig 1825, S. 207213. S. hierzu den Beitrag von Sandrine Maufroy im vorlie-
genden Band.
35
Dieses Stilmittel bernahm Chamisso vom franzsischen Chansonnier Branger.
S. hierzu: Rieger, Dietmar: Die Nachtigall mit der Adlersklaue. Brangers Lieder in
deutschen bersetzungen (18221904). Tbingen 1993, S. 79.
36
Tardel: Studien zur Lyrik Chamissos, S. 29f.
Adelbert von Chamissos Griechendichtungen 245
Griechin, die in Gefahr steht, in trkische Sklaverei zu geraten:
37
Im vor-
liegenden Gedicht gelingt es der Christin sogar kurzzeitig, den auf sie im
eigenen Gemach eindringenden Trken zu entwaffnen die Rollen von
khnem Mann und furchtsamer Frau scheinen sich damit zu verkehren:
Die Tapferkeit der Griechin lt diese amazonenhaft-stark erscheinen,
whrend ihr Unterdrcker, nun den Waffen der Frau ausgeliefert, sein
wahres, feiges Gesicht zeigt:
Mit mannlichem Erkhnen greift selber sie ihn an,
Er liegt vor ihr entwaffnet, ein furchtsam feiger Mann. (Z. 2324)
Dieser Zustand verkehrt sich jedoch sofort umso drastischer in sein Ge-
genteil: Der Trke schwrt einen Eid die Griechin zu verschonen, wird
jedoch meineidig (auch dies ein Motiv, das die im Umkreis des Philhel-
lenismus angesiedelte Literatur cantus firmus-artig durchzieht), sobald
ihm diese die Waffen wieder ausgehndigt hat, und erdolcht sie hinter-
rcks:
Da schwur er beim Propheten ihr einen teuren Eid,
Er wrde nun und nimmer versuchen eine Maid;
Da gab sie dem Bezwungnen die Freiheit aufzustehn,
Und schenkt ihm seine Waffen, und hie hinaus ihn gehn.
Er aber zhneknirschend, der tiefen Schmach bewut,
Nach blutger Rache drstend, stt schnell in ihre Brust
Denselben Dolch, den eben ihm ihre Hand gereicht;
Sie sinkt zu seinen Fen, verblutet und erbleicht. (Z. 2532)
Wurde zuvor bereits durch Antithesen die plastische Gegenberstellung
gem gngiger Gendercodierungen vorbereitet (z. B. in der 5. Strophe:
Die Jungfrau sucht der Wilde, Gewalt ihr anzutun), wird diese Kenn-
zeichnung nun mit ethischen Valorisierungen verbunden: Die barm-
herzige und gndige Christin steht dem meineidigen und rachelsternen
37
Vgl. z. B. Chamisso Sophia Kondulimo und ihre Kinder (Smtliche Werke. Adel-
bert von Chamisso. Jost Perfahl (Red.), S. 361363, hier S. 362, Z. 29f.: Berittne
Haufen schweifen und stellen auf dem Plan, | sich Sklavinnen zu fangen, ein
Menschentreiben an. . Zu diesem Komplex s. Puchner, Walter: Die griechische
Revolution von 1821 auf dem deutschen Theater. Ein Kapitel brgerlicher Trivial-
dramatik und romantisch-exotischer Melodramatik im deutschen Vormrz, in:
Sdost-Forschungen. Internationale Zeitschrift fr Geschichte, Kultur und Landeskunde
Sdosteuropas 55/1996, S. 85127, hier S. 105f.; Harnisch, Antje: Der Harem in
den Familienblttern des 19. Jahrhunderts, koloniale Phantasien und nationale
Identitt, in: German Life and Letters 51/1998, S. 325341, sowie He: Zwischen
den Fronten, S. 371373.
246 Gilbert He
Trken, der anschlieend auch den heimkehrenden Vater niederstreckt,
gegenber. Unter diesem Vorzeichen erscheint auch die Rache des Ge-
orgis gerechtfertigt, der, nachdem er von dem Unheil gehrt hat, sich
seiner Sklavenbande auf einer Gallere in der Fremde entledigt und in die
Heimat zurckkehrt: Nach seiner Ankunft schneidet er aus dem Herzen
seines Vaters die tdliche Kugel heraus und ttet den Mrder von Vater
und Schwester mit derselben Kugel.
Insbesondere der natrliche Ton dieses Gedichts, der nicht nur durch
den gezielten Einsatz der durch Wilhelm Mller vorgeprgten Nibe-
lungenstrophe
38
evoziert wird, sondern zugleich durch Motive aus dem
Volkslied (z. B. Die Mwen bringen Kunde von Kretas heimschen
Strand, | Er hrt die Mwen, schttelt und sprengt sein Sklavenband,
Z. 44f. und Der Held sa berm Tische und trank den khlen Wein,
Z. 63, ein Motiv, das sich ebenso in der franzsischen, wie der deut-
schen Volkslieddichtung findet
39
) vermag zu erklren, wieso die fik-
tionale, sthetisierend-ideologische und folkloristische Deutung des
Kriegsgeschehens auf dem Balkan wirkungsvoller und fr das Publikum
akzeptabler war als die Erlebnisberichte von Kriegsfreiwilligen:
40
Durch
die Verwendung sangbarer, volksliedhafter Lyrik lie sich eine heroisie-
rend-balladeske Umdeutung eines schmutzigen und kaum zur Sympa-
thiegewinnung tauglichen Guerillakrieges in weiten Schichten der euro-
pischen Bevlkerung etablieren. Auch der auffllige Verzicht jeglicher
Situierung und Lokalisierung des Geschehens in einer geographisch
konkret bestimmbaren Landschaft drfte insofern bewutem Kalkl
entsprungen sein. Auf die in Mllers bersetzung deutliche Orientie-
rung an Wendungen aus der neugriechischen Volkspoesie, die Chamisso
in anderen Gedichten insbesondere bei den bersetzungen neugrie-
chischer Dichtung erkennen lt, wurde hierbei bewut verzichtet.
Die Formel, mit welcher der Racheakt des Georgis erzhlerisch vorberei-
tet wird:
Was whlt er stumm und grausig ein neugeschttet Grab,
Und strt die Leiche dessen, der ihm das Leben gab? (Z. 48f.)
38
S. hierzu Hartung, Gnter: Wilhelm Mllers Griechengedichte, in: Ute Brede-
meyer/Christiane Lange (Hrsg.): Kunst kann die Zeit nicht formen: 1. Internationale
Wilhelm-Mller-Konferenz Berlin 1994. Berlin 1996, S. 8699.
39
Unmittelbare Vorlage drfte Brangers Ma Rpublique gewesen sein: S. Chamisso,
Adelbert/Gaudy, Franz von (Hrsg.): Brangers Lieder. Auswahl in freier Bearbeitung.
Leipzig 1838, S. 4951.
40
Auf diese Tatsache verweist Scheitler, S. 190f. Siehe auch den Beitrag von Valerio
Furneri in diesem Band.
Adelbert von Chamissos Griechendichtungen 247
zeigt ebenso wie die detaillierte Schilderung des Grauens die flieenden
bergnge zu den Moden der zeitgenssischen Schauerliteratur der
schwarzen Romantik und damit die Anschlumglichkeiten an gnz-
lich anders gelagerte Kontexte. Hierin nur eine qualitative Schwche er-
blicken zu wollen,
41
greift jedoch zu kurz: Gegenber den vielfltigen
Deutungen, die der Befreiungkampf durch die journalistische Berichter-
stattung erfuhr, hatte die poetische Gestaltung vielmehr den Vorteil, im-
plizit und explizit an Verstehenstraditionen ankpfen zu knnen, die dem
Rezipienten aufgrund gattungsspezifischen Vorwissens gelufig waren.
Einen deutlich appellativen Charakter trgt Chamissos 1829 im Gesell-
schafter erschienenes, 17 Strophen umfassendes Gedicht Sophia Kundo-
lino und ihre Kinder,
42
das eine in Edward Blaquires Letters from
Greece verzeichnete Begebenheit literarisch verarbeitet.
43
In der Vorlage
wird der Realittsstatus des berichteten Geschehens etwas vage als well
authenticated anecdote bezeichnet:
44
Im Augenblick hchster Gefahr
veranlat die Gattin eines bei der Belagerung von Missolunghi gefalle-
nen Offiziers ihren noch jugendlichen Sohn dazu, seine eigene Schwe-
ster mit dem Revolver zu tten, damit diese der schmachvollen Behand-
lung durch die heranrckenden Trken entgeht:
,Nimm, Sohn, des Vaters Waffen, du gestern noch ein Kind,
Es spricht die Zeit dich mndig, nun sei, was Mnner sind!
Der Schande gilts zu wehren, die grlich uns bedroht,
Wir fliehen vor der Schande, wir frchten nicht den Tod;
Den letzten Schu verwahrst du auf meinen Wink bereit,
Ich werde dir bezeichnen da Ziel und auch die Zeit.
[]
Zu spt! Die Schmerzensreiche ermit, was kommen mu
Der Sohn, des Winks gewhrtig, bereitet sich zum Schu,
Und sie verhllt ihr Antlitz und ruft: ,Der Trke naht!
Dein Ziel der Schwester Busen! Geschehen ist die Tat.
45
(Z. 1520, 3336)
41
So der Tendenz nach Tardel: Studien, S. 30 und Feudel: Chamisso als politischer
Dichter, S. 105.
42
Smtliche Werke. Adelbert von Chamisso. Jost Perfahl (Red.), S. 361363; ED in:
Der Gesellschafter 13/1829, 14. Blatt, S. 65f. S. hierzu Tardel: Studien, S. 30f. und
Feudel: Chamisso als politischer Dichter, S. 106f.
43
Blaquire, Edward: Lettres from Greece with remarks on the treaty of intervention. Lon-
don 1828, S. 69.
44
Ebd., S. 6.
45
Smtliche Werke. Adelbert von Chamisso. Jost Perfahl (Red.), S. 361, Z. 1821;
Z. 3437.
248 Gilbert He
Auch der Sohn wird beim Ansturm der Trken verwundet und die Mut-
ter, die das verletzte Kind mit ihrem Krper schtzt, kann sich der S-
belhiebe des Feindes nur durch den couragierten Ausruf: Halt an: Und
siehest, Unmensch, du nicht, ich bin ein Weib!
46
erwehren. Gemein-
sam mit ihrem Sohn wird sie verschont und gert in trkische Gefangen-
schaft, aus der sie jedoch durch das internationale Griechenkomitee
bald befreit wird. Unter den zahlreichen weiteren Freigekauften findet
der genesene Sohn auch die totgeglaubte Schwester wieder, die als
schwerverwundete in trkischer Gefangenschaft berlebt hatte und
ebenfalls vom Griechenkomitee gerettet worden war. Diese wider jeg-
liche Logik angelegte Wendung der Handlung, bei der die zuvor erschos-
sene Protagonistin schlielich wieder unversehrt in Erscheinung tritt,
wird bereits in der Vorlage als most extraordinary part of the story ge-
kennzeichnet und mu durch den Erzhler mit dem Hinweis auf die
persnliche Bekanntschaft beglaubigt werden.
47
Chamisso betont diese
Unglaubwrdigkeit der Handlung und inszeniert das Wiedersehen als
sakralisierte, wundersame Erscheinung:
,Wer bist du, Licht der Jungfraun? O wre nicht geschehn,
Was selbst doch ich vollbrachte, ich dchte dich zu sehn;
O Schwester! ja du bist es, ja, meine Schwester du!
Nun fhr ich selbst der Mutter die Neugeborne zu! (Z. 6164)
Bereits bei Blaquire dient die Lebensgeschichte der Sophia Kondulimo
als offenkundige Werbung um Sympathie fr die insurgenten Griechen:
When such acts as the foregoing attend a struggle for freedom, how is
it possible to withhold our sympathy?,
48
so resmiert der Autor das
Berichtete. In Chamissos poetischer Umsetzung wird dieser appellative
Charakter durch sakralisierendes Vokabular noch deutlich verstrkt,
indem die mit marianischer Terminologie als Licht der Jungfraun apo-
strophierte Tochter als Neugeborne deutlich an die christliche Heils-
46
Ebd., Z. 47. Der Ausruf wurde nahezu wrtlich aus Blaquire bersetzt: Barba-
rian, do you not see that I am a woman! (Blaquire: Lettres from Greece, S. 7).
47
So schaltet sich der Erzhler in einer Funote ein, um die Authentizitt des
Geschehens zu beglaubigen: On my return to Corfu in June, I paid annother
visit to the mother of Cressula, and was glad to hear that both her son and her
daughter, had been placed in good situations, and were quite recovered from the
effect of their sufferings while in captivity. The mother was still supported together
with many other redeemed captives by the Philanthropic Society. Ferner versi-
chert der Autor, beim Griechenkommitee fr die Familie Kondulimo vorstellig
geworden zu sein. (Blaquire: Lettres from Greece, S. 7f., Anmerkungen).
48
Blaquire: Lettres from Greece, S. 7f.
Adelbert von Chamissos Griechendichtungen 249
geschichte gemahnt. Somit dient die durch ihre logischen Brche und
Mysterien gekennzeichnete Lebensgeschichte der Sophia Kondulimo
letztlich als Wunderzeichen, in dem sich die segensreiche Wirkung der
Griechenverbnde manifestiert. Im panegyrischen Ton, mit dem in der
letzten Strophe dem Genfer Bankier und Koordinator der europi-
schen Hilfleistungen fr Griechenland, Jean Gabriel Eynard,
49
gehuldigt
wird,
Eynard, du Freund der Menschheit, du segenreicher Mann,
Den auch der Dichter preisend nicht hher ehren kann,
Er beugt vor dir sich schweigsam und zollet dir gerhrt
Mit Thrnen frommer Ehrfurcht den Dank, der dir gebhrt. (Z. 6568)
wird diese segensspendende Funktion deutlich thematisiert. Diese Ho-
mage kommt somit im Sinne einer agitatorisch motivierten Philhelle-
nen-Dichtung ex post dem Aufruf zur Untersttzung der nationalen und
internationalen Griechenverbnde gleich, wobei die erhoffte finanzielle
Untersttzung, um die das Gedicht indirekt wirbt, zugleich als heils-
bringende Opfergabe interpretiert wird.
50
Chamissos 300 Verse umfassender Zyklus Chios
51
zeichnet sich durch
eine extensive und in der gesamten Philhellenenlyrik unerreichte Dra-
stik und Bildhaftigkeit aus: Das Gesamtarrangement dieser aus Pouque-
villes Historienwerk Geschichte des Aufstands von Griechenland
52
inspirier-
49
Zu diesem s. Rothpletz, Emil: Der Genfer Jean-Gabriel Eynard als Philhellene. Zrich
1900, sowie Bouvier-Bron, Michelle: Jean-Gabriel Eynard (17751863) et le philhell-
nisme genevois. Genf 1963.
50
Damit knpft Chamisso an eine in der philhellenischen Dichtung verbreitete
Argumentationsstrategie an, bei der die Untersttzung der Aufstndischen als
die auch die Dichtung verstanden wird als sakraler Akt zelebriert wird. Vgl. z. B.
Titel wie Brun, Friederike: Ein Scherflein fr Hellas niedergelegt auf den Altar
der Menschlichkeit, in: Friderike Brun (Hrsg.): Blthen aus Morgentrumen und
Idas sthetische Entwickelung. Aarau 1824, S. 271293; Richard-Schilling, Sophie:
Opferblumen. Basel 1823; Baumann, J.: Kleine Blten. Ein Opfer fr Hellas. Mnchen
1827.
51
Smtliche Werke. Adelbert von Chamisso. Jost Perfahl (Red.), S. 237363372. Erst-
druck in: von Chamisso, Adelbert: Gedichte. Leipzig 1831, S. 251266.
52
Pouqueville, Franois Charles Hugues Laurent: Voyage dans la Grce. Comprenant
la description ancienne et moderne de lpire, de lIllyrie grecque, de la Macdoine Cisa-
xienne, dune partie de la Triballie, de la Thessalie, de lAcarnanie, de ltolie ancienne et
pictte, de la Locride Hesprienne, de la Doride, et du Ploponse; avec des considerations
sur larchologie, la numismatique, les murs, les arts, lindustrie et le commerce des habi-
tants de ces provinces. 5 Bde. Paris 18201821. Die von Chamisso verarbeitetem Er-
eignisse finden sich im 3. Band, S. 478, 481, 484, 503 und S. 512.
250 Gilbert He
ten Folge trgt bildserielle Zge:
53
Die je fnfstrophigen Teilstcke: Der
Dichter, Die Brder, Die Mrtyrer, Die Geretteten, Die Leichen und Kanaris
perspektivieren im Stil einer Schauerballade die Geschehnisse, die sich
in den Jahren 1821 und 1822 auf der Insel Chios zugetragen hatten und
die wegen ihrer ungeheuren Brutalitt,
54
der hohen Opferzahl und der
spektakulren Vergeltungsmanahmen einen derart hohen Bekannt-
heitsgrad erlangten, da Chios neben Begriffen wie Missolunghi
oder Namen wie Bozzaris oder Byron zu einem feststehenden phil-
hellenischen Topos werden konnte, der unter zeitgenssischen Rezi-
pienten keinerlei weiterer Kontextinformationen mehr bedurfte.
55
Erffnet wird der Zyklus von dem Der Dichter berschriebenen Ein-
gangsgedicht, das am Beginn eine intim-zwischenmenschliche Situation
entwirft: Die Gattin weckt am Morgen zrtlich den von schrecklichen
Trumen geplagten Dichter, der ber der Lektre von Pouquevilles Ge-
schichtsbuch eingeschlafen war. In der folgenden, detaillierten Schilde-
rung entpuppt sich der Traum wie meist bei Chamisso nicht als
Phantasma,
56
sondern als Visualisierung der grausigen, unentrinnbaren
Wirklichkeit, so da die Eingangsverse:
53
S. hierzu, wie zur folgenden Interpretation auch Polaschegg, Andrea: Der andere
Orientalismus. Regeln deutsch-morgenlndischer Imagination im 19. Jahrhundert. Berlin,
New York 2005, S. 262.
54
S. hierzu Klber, Johann Ludwig: Pragmatische Geschichte der nationalen und poli-
tischen Wiedergeburt Griechenlands, bis zum Regierungsantritt des Knigs Otto. Frank-
furt a.M. 1835, S. 101f.
55
Die Insel Chios hatte sich anfangs nur zgernd dem griechischen Freiheitskampf
angeschlossen. Nachdem die osmanischen Befehlshaber mit Repressalien gegen
die Inselbewohner begannen, landete Lykurgis Logothetes mit Einwohnern von
Samos auf der Insel und zwang die trkische Besatzung zum Rckzug in die Zi-
tadelle. Den Gegenschlag des trkischen Groadmirals Ali Kara, der im April
1822 auf der Insel landete und ein furchtbares Blutbad anrichtete, indem er 23000
Einwohner niedermachen und 47000 in die Sklaverei verkaufen lie, konnten die
Griechen jedoch nicht verhindern.
In der Nacht vor dem 19. Juni 1822 gelang es dem griechischen Admiral Konstan-
tin Kanaris, das vor Chios ankernde Flaggschiff der osmanischen Flotte unter Be-
fehl Ali Karas mit 2000 Mann Besatzung in die Luft zu sprengen, indem er zwei
unbemannte, mit explosiven Materialen beladene Wasserfahrzeuge (Brander) auf
das Schiff zutreiben lie (s. Dakin, Douglas: The Greek struggle for independence
18211833. Berkely, Los Angeles 1973, S. 7274, sowie St. Clair: That Greece Might
Still Be Free, S. 79).
56
Zur Funktion des Traums im Werk Chamissos s. Ehrlich, Elisabeth: Das franzsi-
sche Element in der Lyrik Chamissos. Berlin 1902, S. 46, die darin eine Analogie zur
Dichtung Brangers sieht.
Adelbert von Chamissos Griechendichtungen 251
,Auf, wach auf! Entsetzlich mssen
Fiebertrume dich erschrecken,
Krampfhaft sthnst du [] (Z. 13)
als vergeblicher Versuch erscheinen, den Eindrcken grausiger Details
aus dem griechischen Freiheitskampf zu entrinnen. Der vertrauliche
Dank des Dichters an die ihn wachkssende Gattin dient somit letzlich
als effektsteigernder Kontrast nur dem Nachweis, da dem unausweich-
lichen (Alp-)Traum der Status von Realitt zukommt:
Dank dir, Weib; verscheuchst die bangen
Trume, hegst mich traut umfangen
Und noch starrt mein Haar empor;
Noch, wohin die Blicke schweifen,
Seh ich blutge Leichen schleifen,
Schwebt der Greuel Bild mir vor. (Z. 510)
In rckblickend-aktualisierendem Gestus inszeniert sich der Erzhler in
der 1829 erstmals edierten Ballade als Beobachter der geschilderten Er-
eignisse. Strme von Blut, Berge von Leichen und gequlten Krpern
beherrschen ber insgesamt 23 Strophen von je zehn Zeilen den bis
zum Bersten mit grausigen Details ausgefllten Imaginationsraum:
Chios, blhnder Friedensgarten,
Weh! du unterliegst dem harten,
Dem entmenschten Blutgericht;
Deine neunzigtausend Brger
Sind erwrgt, es zrnt der Wrger,
Da an Opfern es gebricht. (Z. 1520)
Die hypertrophe Reihung sterbender Krper bildet in diesem Eingangs-
gedicht des Zyklus eine Folie, die der Generierung von Empathie fr
die Aufstndischen dient. Vor diesem Hintergrund schlgt die beiende
Kritik an den westeuropischen Sldnern, die den Trken Schiffe zum
Transport von Sklaven leihen, in die unmittelbare politische Anklage
gegen den franzsischen Minister Jean Baptiste Comte de Villle um,
der als Vertreter der Restaurationsphase in Frankreich die Forderung der
Liberalen, den Sklavenhandel zu unterbinden, abgelehnt hatte:
57
Die dem Wterich zu Willen
Christensklaven hier verladen,
Schnden Goldes Durst zu stillen
57
S. hierzu den Kommentar von Volker Hoffmann in Smtliche Werke. Adelbert von
Chamisso. Jost Perfahl (Red.), S. 828, sowie Feudel: Chamisso als politischer Dichter,
S. 107f.
252 Gilbert He
Sich in Blut und Thrnen baden,
Die nach Stambul blutge Glieder
Liefern der erschlagnen Brder
Weh mir! sind o Schand und Spott!
Wagt mein Mund es auszusprechen?
Franken sind es, und die Frechen
Nennen Christum ihren Gott.
Und die Pairs von Frankreich haben
Eines hohen Rats gepflogen.
Solcher Schandthat, solchen Knaben
Recht und Strafe zugewogen.
Du Villele, sollst mir sagen,
Der den Rat zu unterschlagen
Du dich nicht entbldet hast:
Kennst du noch des Schlafes Mchte?
Nicht die Trume meiner Nchte
Tauscht ich gegen deine Rast! (Z. 4060)
Diese deutliche und namentliche Anklage, die auf Einflsse aus der fran-
zsischen Literatur zurckzufhren ist neben der Vorlage, Pouquevilles
Voyage dans la Grce, drfte ihn die beiende Kritik in Brangers politi-
schen Chansons inspiriert haben
58
ist in dieser Schrfe in der Philhelle-
nenlyrik von anderer Seite nicht mehr erreicht worden.
Da Chamisso in seiner Lyrik Elemente, die den Ton der politischen
Lieder und Bnkelsnge der Freiheitskriege oder der Balladen Uhlands
aufgreifen, mit der Drastik und Schrfe, die er den sozialkritischen Lie-
dern Brangers entnahm, verbinden, ist dem Einflu zweier Kulturen
geschuldet. Seine rege bersetzungs- und Nachdichtungsttigkeit lassen
ihn als Vertreter eines kulturellen Kosmopolitismus erscheinen, der
58
Mit dem franzsischen Lyriker und Verfasser bissiger Chansons stand Chamisso
in regem Briefkontakt, der auf eine Affinitt gesellschaftlich-politischer Anschau-
ungen, inbesondere hinsichtlich kosmopolitischer Vorstellungen zurckzufhren
ist. So schrieb Branger 1834 in einem Brief an Chamisso: Peut-tre aussi me
savez-vous gr davoir, le premier en France, prch lalliance des peuples. Ce doit
tre aussi l votre rve. (Boiteau, Paul: Correspondance de Pierre Jean de Branger.
Bd. 2. Paris 1860, S. 180f.). 1828 und 1833 hatte Chamisso vier Lieder Brangers
bersetzt und diesem bersandt. 1838 edierte Chamisso gemeinsam mit seinem
Schler und Freund Franz Freiherr von Gaudy eine Auswahl von 98 Liedern
Brangers (Chamisso/Gaudy: Brangers Lieder), wobei die im Vorwort geuerte
Absicht, keine strenge bersetzung vorzunehmen (Wir haben in dieser Hinsicht
unsern Autor oft mehr verdeutscht als bersetzt, ebd., Vorwort S. XI) weniger als
Dispens zur poetica licentia zu verstehen ist, sondern vielmehr den Versuch mar-
kiert, die bissige Politsatire trotz strenger deutscher Zensur mglichst adquat
zu bertragen. Vgl. hierzu Reiger: Nachtigall mit der Adlersklaue, S. 7182.
Adelbert von Chamissos Griechendichtungen 253
mageblich zum Kulturtransfer innerhalb Europas und weit darber
hinaus beigetragen hat.
59
Der Besuch von August Wilhelm Schlegels
Berliner Vorlesung ber romantische Poesie im Wintersemester 1803/04,
in der die Bedeutung einer gesamteuropischen kulturellen Tradition fr
die deutsche Dichtung dargelegt wurde, drfte ihn darin bestrkt ha-
ben.
60
Chamissos Mittelstellung zwischen den Kulturen erschpft sich
allerdings nicht in einer bloen Motivbernahme und Stilmischung.
Vielmehr mu seine Griechenlyrik als Austragungsort nationaler wie
europischer, sthetischer wie politischer Diskurse interpretiert wer-
den, deren Hierarchisierungen, Funktionsdifferenzen, Brechungen und
berschneidungen erst noch auszuloten sind.
Das fnfte, mit dem programmatischen Titel Die Leichen berschrie-
bene Gedicht des Zyklus Chios greift die in der ersten Strophe wirkmch-
tig inszenierte Kumulation sterbender Krper mit dem Bild im Meer trei-
bender Leichen auf, die das Geschehen noch ber den Zeitpunkt des
Massakers hinaus bevlkern und das Grauen damit perpetuieren:
61
Und aus finstrer Wolkenschichte
Bricht hervor des Mondes Scheibe;
Schaudernd sehn sie bei dem Lichte,
Da der Landwind Leichen treibe,
Leichen in gedrngten Scharen,
Raja-Leichen, die da waren
Alis grauses Siegesmal?
Angesplt wie von Gedanken,
Legen sie sich um die Flanken
Seines Schiffes sonder Zahl. (Z. 440450)
Das in Chamissos Chios vergossene Blut, die angehuften Leichen und
abgeschlagenen Kpfe erreichen tatschlich eine solche Quantitt, da
innerhalb des Textraumes ebensowenig Platz fr eine andere Semantik
bleibt wie innerhalb des erzeugten Imaginationsraumes fr andere Bil-
der.
62
Durch den berbordenden Einsatz rhetorischer Figuren (z. B.
gehuft auftretende Anadioplosen und Alitterationen) gesttzt, wird das
Geschehen weniger von einer narrativen Struktur getragen sondern eher
als kumulativer Gewaltexze imaginiert. Der Rezipient wird von dieser
59
S. hierzu: Feudel: Chamisso als Mittler, S. 753765, sowie Ehrlich: Das franz-
sische Element. Die Dissertation von Velder, Christian: Das Verhltnis Adelberts von
Chamisso zu Weltbrgertum und Weltliteratur. Berlin 1955, war mir nicht zugnglich.
60
Feudel: Adelbert von Chamisso, S. 32f.
61
S. hierzu auch Polaschegg: Der andere Orientalismus, S. 258.
62
Ebd.
254 Gilbert He
berflle frmlich erschlagen und sucht Halt in einzeln eingestreuten,
genreartigen Bildern, welche Einzelschicksale exemplarisch hervorheben.:
Vor der Wiege lieget blutig,
Jung und schn der Mann erschlagen,
Hat die schweren Wunden mutig
Vorn auf seiner Brust getragen;
Auf der Wiege selber lieget,
Angeklammert, angeschmieget,
Regungslos das zarte Weib,
Und den Sugling, welcher weinet
Und der Brust bedrftig scheinet,
Deckt sie starr mit ihrem Leib. (Z. 400410)
Diese Form der Gestaltung von Einzelszenen vergleichbar der Perspek-
tivierungstechnik in Delacroix Bildern, die, wie das 1824 entstandene
Monumentalgemlde Scnes des massacres de Scio; familles grecques atten-
dant la mort ou lesclavage
63
vor dem Hintergrund mordender Horden
Einzelschicksale exemplarisch hervorheben
64
kam Chamissos uerst
sparsamem Gebrauch von Abstraktionen und Formen der bildhaften
Rede
65
entgegen. Getragen wird diese bildserielle Folge von der allgegen-
wrtigen Deutung des Geschehens als Glaubenskrieg und einer Alteri-
sierung von West und Ost, von Christen und Antichristen, die das Ge-
schehen zu einem apokalyptischen Krieg am Ende der Zeiten gerinnen
lt:
Allah! ruft der Moslem, hauet
Greise nieder, Kinder, Frauen;
Christus! ruft der Raja, schauet
Himmelwrts mit Hochvertrauen;
Er begehrt die heilge Palme;
Menschen mhet der, wie Halme,
Jauchzet auf, ob Allahs Sieg.
Das ist zu des Himmels Rache,
Das ist fr die heilge Sache
Vlker- und Vernichtungskrieg! (Z. 3040)
63
Eugne Ferdinand Victor Delacroix: Scnes des massacres de Scio; familles grecques
attendant la mort ou lesclavage, l auf Holz, 419 354 cm, Paris, Muse du Louvre,
s. S. 138 in diesem Band.
64
S. hierzu auch den Katalog Constans, Claire u. a. (Hrsg.): La Grce en rvolte.
Delacroix et les peintres franais, 18151848. Paris 1996.
65
S. Mornin, Edward: Zur Behandlung fremdsprachiger Stoffe in den Gedichten
Adelbert von Chamissos, in: Eijro Iwasaki (Hrsg.): Begegnung mit dem ,Fremden.
Grenzen-Traditionen-Vergleiche, Bd. 10. (Akten des VIII. Internationalen Germani-
sten-Kongresses, Tokyo 1990). Mnchen 1991, S. 1522, hier: S. 15.
Adelbert von Chamissos Griechendichtungen 255
Der Gewaltexze findet hier seinen sthetischen Niederschlag in einer
teils bis ans Groteske reichenden Monumentalitt der Grausamkeit,
66
der sich zu einem Schlu- und Hhepunkt in der Tat des Konstantin
Kanaris aufgipfelt, dem es gelingt, zwei mit Sprengstoff beladene, unbe-
mannte Boote (sog. Brandner) in die Nhe des trkischen Admirals-
schiffs zu treiben und dieses mit dem Befehlshaber Kara Ali und 2000
Mann Besatzung in die Luft zu sprengen ein Motiv brigens, dessen
Inszenierung sich in allen Medien von der Oper bis zur Darstellung
auf Tafelgeschirr auerordentlicher Beliebtheit erfreute.
67
Die grau-
same Tat erscheint im lyrischen Kontext als gerechte Gottesstrafe, die
durch die Demutsgeste des Konstantin Kanaris, der sich nach vollbrach-
ter Tat vor dem Altar zu Boden wirft, als Erfllung des gttlichen Rat-
schlusses markiert wird:
Seht die Flaggen! Heil dem Sieger!
Heil dem Rcher! ihm zum Lohne,
Der erlegt den grimmen Tiger,
Lorbeer, winde dich zur Krone!
Und, sein Steuerruder tragend,
Landet, schreitet er entsagend
Durch die Haufen, stumm und taub,
Barhaupt, barfu zur Kapelle,
Und er wirft auf heilger Schwelle
Vor dem Kreuz sich in den Staub.
Chamissos philhellenische Dichtung bedient sich zahlreicher Verfah-
rensweisen, um eine Emotionalisierung auf Seiten des Rezipienten zu
erzielen und diese im Sinne einer agitativ-operativen Literatur zu instru-
mentalisieren: An der Schwelle zwischen der Romantik und dem Ende
der Kunstperiode angesiedelt
68
nutzt er einerseits uerst wirkungsvolle
Identifikations- und Alterisierungeffekte: Philhellenische Orient-Topoi,
kulturell-religise Oppositionsbeziehungen und Genderkonfigurationen
imaginieren mit zum Teil uerst drastischen Bildern einen apoka-
lyptischen Kampf zwischen gut und bse.
66
Polaschegg: Der andere Orientalismus, S. 257.
67
S. Puchner: Die griechische Revolution von 1821 auf dem deutschen Theater,
sowie Irmscher, Johannes: Die Berliner Presse und der Philhellenismus, in:
Evangelos Konstantinou (Hrsg.): Die europische philhellenische Presse bis zur 1. Hlfte
des 19. Jahrhunderts. Frankfurt a.M. 1994, S. 7792, hier: S. 88.
68
Vgl. ausgehend von Heines Charakterisierung Chamissos in der Romantischen
Schule: Miller: Chamissos Schweigen, S. 100102.
256 Gilbert He
Die hyperbolische Inszenierung von Gewaltexzessen
die Verwendung bildtechnischer Darstellungsweisen,
der Verzicht auf mythologische Motive und auf Ruinensentimentalitt,
die Verwendung metrischer, rhythmischer und motivischer Vorgaben
aus dem Bereich der Volkslieddichtung,
die Fokussierung auf Einzelschicksale durch phasenweise Ausblen-
dung des Kampfgeschehens,
die Verwendung von Bildlichkeiten und Argumentationsstrategien
aus dem sakral-religisen Bereich
und
die Adaptation literarischer Muster aus der zeitgenssischen Schauer-
und Schundliteratur
lassen Chamissos Griechenlyrik nicht nur als exemplarischen Fall der li-
terarischen Popularisierung politisch-historischer Ereignisse erscheinen.
Sie zeigen zugleich, da Chamisso die sthetisierung und literarische
Imagination des griechischen Befreiungskrieges als wirksame Waffen des
Dichters im angesichts der groen Konkurrenz philhellenischer Dich-
tung wtenden Krieg um die literarische ffentlichkeit eingesetzt hat,
der nur mit Hilfe einer literarischen Offensive zu gewinnen war.
Literaturverzeichnis
Quellen
Zeitschriften
Allgemeine Zeitung. Stuttgart: Cotta 17981898.
Berliner Conversations-Blatt fr Poesie, Literatur und Kritik. Berlin: Schlesinger
18271838.
Der Gesellschafter oder Bltter fr Geist und Herz. Berlin: Maurer 18171848.
Morgenblatt fr gebildete Stnde. Stuttgart, Tbingen: Cotta 18071837.
Bcher
Baumann, J.: Kleine Blten. Ein Opfer fr Hellas. Mnchen 1827.
Blaquire, Edward: Lettres from Greece with remarks on the treaty of intervention. London
1828.
Boiteau, Paul: Correspondance de Pierre Jean de Branger, Bd. 2. Paris 1860.
Brun, Friederike: Ein Scherflein fr Hellas niedergelegt auf den Altar der Mensch-
lichkeit, in: Friderike Brun (Hrsg.): Blthen aus Morgentrumen und Idas sthetische
Entwickelung. Aarau 1824, S. 271293.
Chamisso, Adelbert: Adellbert von Chamissos Werke. Briefe. Gedichte. Kleine Auf-
stze, Bd. 6: Leben, 3. Buch. Julius Eduard Hitzig (Hrsg.): Leipzig 1839.
Adelbert von Chamissos Griechendichtungen 257
: Smtliche Werke. Adelbert von Chamisso. Nach dem Text der Ausgaben letzter Hand
und den Handschriften. Bibliographie und Anmerkungen von Volker Hoffmann.
2 Bde. Jost Perfahl (Red.): Mnchen 1975.
: Smtliche Werke in zwei Bnden. Adelbert von Chamisso. 2 Bde. Werner Feudel
(Hrsg.): Mnchen 1982.
: Chamissos Werke. Erster Band. Hermann Tardel (Hrsg.): Leipzig, Wien 1907.
Chamisso, Adelbert/Gaudy, Franz von (Hrsg.): Brangers Lieder. Auswahl in freier
Bearbeitung. Leipzig 1838.
Fauriel, Claude: TPAIOAA PDMAKA. Neugriechische Volkslieder. Gesammelt und
herausgegeben von C. Fauriel. bersetzt und mit des franzsischen Herausgebers
eigenen Erluterungen versehen von Wilhelm Mller. Zweiter Theil. Leipzig 1825.
Klber, Johann Ludwig: Pragmatische Geschichte der nationalen und politischen Wieder-
geburt Griechenlands, bis zum Regierungsantritt des Knigs Otto. Frankfurt a.M. 1835.
Pouqueville, Franois Charles Hugues Laurent: Voyage dans la Grce. Comprenant la
description ancienne et moderne de lpire, de lIllyrie grecque, de la Macdoine Cisa-
xienne, dune partie de la Triballie, de la Thessalie, de lAcarnanie, de ltolie ancienne et
pictte, de la Locride Hesprienne, de la Doride, et du Ploponse; avec des considerations
sur larchologie, la numismatique, les murs, les arts, lindustrie et le commerce des habi-
tants de ces provinces. 5 Bde. Paris 18201821.
Richard-Schilling, Sophie: Opferblumen. Basel 1823.
Wilson, S[amuel]. S[heridan].: A narrative of the Greek mission, or sixteen years in Malta
and Greece: including tours in the Peloponnesus, in the Aegean and Ionian Isles. With
remarks on the religeous opinions, moral state, social habits, politics, language, history, and
lazarettos of Malta and Greece. London 1839.
Forschungsliteratur
Arnold, Robert F.: Der deutsche Philhellenismus. Kultur- und literarhistorische Un-
tersuchungen., in: Euphorion, Ergnzungsheft 2/1896, S. 71181.
Bouvier-Bron, Michelle: Jean-Gabriel Eynard (17751863) et le philhellnisme genevois.
Genf 1963.
Breil, Michaela: Die Allgemeine Zeitung, in: Helmut Gier/Johannes Janota
(Hrsg.): Augsburger Buchdruck und Verlagswesen. Von den Anfngen bis zur Gegenwart.
Wiesbaden 1997, S. 11191134.
Brueck, Martin: Antikenrezeption und frhromantischer Poesiebegriff: Studien zur ,Graecoma-
nie Friedrich Schlegels und ihrer Vorgeschichte seit J.J. Winckelmann. Diss. Konstanz 1981.
Constans, Claire u. a. (Hrsg.): La Grce en rvolte. Delacroix et les peintres franais,
18151848. Paris 1996.
Dakin, Douglas: The Greek struggle for independence 18211833. Berkely, Los Angeles
1973.
Ehrlich, Elisabeth: Das franzsische Element in der Lyrik Chamissos. Berlin 1902.
Feudel, Werner: Chamisso als politischer Dichter. Diss. Halle 1965.
: Adelbert von Chamisso. Leben und Werk. Leipzig 1971.
: Nachwort, in: Smtliche Werke in zwei Bnden. Adelbert von Chamisso. 2 Bde. Wer-
ner Feudel (Hrsg.): Mnchen 1982, S. 781809.
: Chamisso als Mittler zwischen franzsischer und deutscher Literatur, in: Wei-
marer Beitrge, 32/1986, S. 753765.
258 Gilbert He
Fischer, Robert: Adelbert von Chamisso. Weltbrger, Naturforscher und Dichter. Berlin
u. a. 1990.
Harnisch, Antje: Der Harem in den Familienblttern des 19. Jahrhunderts, kolo-
niale Phantasien und nationale Identitt, in: German Life and Letters, 51/1998,
S. 325341.
Hartung, Gnter: Wilhelm Mllers Griechengedichte., in: Ute Bredemeyer/Chri-
stiane Lange (Hrsg.): Kunst kann die Zeit nicht formen: 1. Internationale Wilhelm-Ml-
ler-Konferenz Berlin 1994. Berlin 1996, S. 8699.
He, Gilbert: Missolunghi. Gense, transformations multimdiales et fonctions
dun lieu identitaire du philhellnisme., in: Revue Germanique Internationale,
12/2005: Philhellnismes et transferts culturels dans lEurope du XIXe sicle. Paris 2005,
S. 77107.
: Zwischen den Fronten. Weibliche Rollenkonzepte in philhellenischen Erzhl-
texten, in: Evangelos Konstantinou (Hrsg.): Das Bild Griechenlands im Spiegel der
Vlker (17.20 Jh.). Bern u. a. 2008, S. 363383.
Heyer, Friedrich: Das philhellenische Argument: ,Europa verdankt den Griechen-
seine Kultur, also ist jetzt Solidaritt mit den Griechen Dankesschuld. , in: Evan-
gelos Konstantinou (Hrsg.): Die Rezeption der Antike und der europische Philhelenis-
mus. Frankfurt a.M. u. a. 1998, S. 7991.
Irmscher, Johannes: Die Berliner Presse und der Philhellenismus, in: Evangelos
Konstantinou (Hrsg.): Die europische philhellenische Presse bis zur 1. Hlfte des
19. Jahrhunderts. Frankfurt a.M. 1994, S. 7792.
Lahnstein, Peter: Adelbert von Chamisso. Der Preue aus Frankreich. Mnchen 1984.
Lbker, Friedgar: Antike Topoi in der deutschen Philhellenenliteratur: Untersuchungen
zur Antikerezeption in der Zeit des griechischen Unabhngigkeitskrieges (18211829).
Mnchen 2000.
Miller, Norbert: Chamissos Schweigen und die Krise der Berliner Romantik., in:
Aurora, 39/1979, S. 101119.
Mornin, Edward: Zur Behandlung fremdsprachiger Stoffe in den Gedichten Adel-
bert von Chamissos., in: Eijro Iwasaki (Hrsg.): Begegnung mit dem ,Fremden. Gren-
zen-Traditionen-Vergleiche, Bd. 10. (Akten des VIII. Internationalen Germanisten-
Kongresses, Tokyo 1990). Mnchen 1991, S. 1522.
Pille, Ren-Marc: Adelbert von Chamisso, in: Gunther E. Grimm/Frank Rainer
Max (Hrsg.): Deutsche Dichter. Leben und Werk deutschsprachiger Autoren.
Romantik, Bidermeier und Vormrz, Bd. 5. Stuttgart 1989, S. 218228.
Polaschegg, Andrea: Der andere Orientalismus. Regeln deutsch-morgenlndischer Imagina-
tion im 19. Jahrhundert. Berlin, New York 2005.
Puchner, Walter: Die griechische Revolution von 1821 auf dem deutschen The-
ater. Ein Kapitel brgerlicher Trivialdramatik und romantisch-exotischer
Melodramatik im deutschen Vormrz., in: Sdost-Forschungen. Internationale
Zeitschrift fr Geschichte, Kultur und Landeskunde Sdosteuropas, 55/1996, S. 85
127.
Rieger, Dietmar: Die Nachtigall mit der Adlersklaue. Brangers Lieder in deutschen berset-
zungen (18221904). Tbingen 1993.
Rothpletz, Emil: Der Genfer Jean-Gabriel Eynard als Philhellene. Zrich 1900.
Scheitler, Irmgard: Griechenlyrik (18211828). Literatur zwischen Ideal und Rea-
litt., in: Internationales Jahrbuch der Bettina von Arnim-Gesellschaft. Forum fr die
Erforschung von Romantik und Vormrz., 5/1993, S. 188234.
Adelbert von Chamissos Griechendichtungen 259
: Deutsche Philhellenenlyrik. Dichter, Verffentlichungsformen, Motive, in:
Evangelos Konstantinou (Hrsg.): Ausdrucksformen des Europischen und Internatio-
nalen Philhellenismus vom 17.19. Jahrhundert. Bern u. a. 2007, S. 7082.
Schneider, Reinhold: Chamissos Geschichtserfahrung., in: Reinhold Schneider,
gesammelte Werke. Reinhold Schneider: Dem lebendigen Geist, Bd. 6. Carsten Peter
Thiele (Hrsg.): Frankfurt a.M. 1980, S. 178190.
St. Clair, William: That Greece might still be free. The philhellenes in the war of Independence.
London, New York, Toronto 1972.
Stein, Peter: Operative Literatur., in: Gert Sautermeister/Ulrich Schmid (Hrsg.):
Zwischen Restauration und Revolution: 18151848. Mnchen 1998, S. 485504.
Tardel, Hermann: Studien zur Lyrik Chamissos. Bremen 1902.
Wiedenmann, Ursula: ,Der Gesellschafter als Quelle philhellenischer Publizistik.,
in: Evangelos Konstantinou (Hrsg.): Die europische philhellenische Presse bis zur
1. Hlfte des 19. Jahrhunderts. Frankfurt a.M. 1994. S. 255271.
260 Gilbert He
Fhlt, was Wahrheit ist und was Fiction. 261
Albert Meier
Fhlt, was Wahrheit ist und was Fiction.
Frst Hermann von Pckler-Muskaus
Griechische Leiden
Man glaubt in Nova Zembla zu seyn.
(II, S. 160)
Da Reisebeschreibungen nicht zu den Sachtexten zhlen, ist eine phi-
lologische Binsenweisheit. Im Fall des Sdstlichen Bildersaals
1
verbietet
sich das Vorhaben, den Reisebericht im strengeren Sinne aus den fik-
tiven Partien
2
herauszuschlen, jedoch nicht allein der generellen Ein-
sicht wegen, da der Begriff der ,Authentizitt keine literaturwissen-
schaftliche Kategorie sein kann. Vielmehr mte jeder Versuch, bei
Frst Hermann von Pckler-Muskau (17851871) einen faktischen ,Kern
von seiner unzuverlssigen Ummantelung zu unterscheiden, zuletzt
daran scheitern, da es keine aussagekrftigen Dokumente gibt, die zur
Gegenprobe auf historische Treue taugen. Die bekannten Briefe und
Tagebuch-Aufzeichnungen des reisenden Frsten enthalten jedenfalls
kein Datenmaterial, das seine Griechenland-Erlebnisse empirisch erden
wrde, und an verwertbaren Kommentaren Dritter fehlt es erst recht.
3
1
Sdstlicher Bildersaal. Erster Band. Stuttgart: Hallbergersche Verlagshandlung
1840. / Sdstlicher Bildersaal. Zweiter Band. Stuttgart: Hallbergersche Verlags-
handlung 1840. / Sdstlicher Bildersaal. Dritter Band. Stuttgart: Hallbergersche
Verlagshandlung 1841 (nur der Zweite und Dritte Band erzhlen unter dem Titel
Griechische Leiden von einer Griechenland-Reise, whrend sich der Erste Band
Der Vergngling auf einen Nordafrika-Aufenthalt bezieht). Aus den drei Bn-
den wird unter Angabe der rmischen Bandnummer und der arabischen Seiten-
zahl zitiert.
2
Just, Klaus Gnther: Nachwort des Herausgebers, in: Frst Hermann von Pck-
ler-Muskau: Sdstlicher Bildersaal. Griechische Leiden. Stuttgart 1968, S. 372384,
hier S. 383.
3
Die wenigen Erwhnungen Griechenlands bzw. der Griechischen Leiden in der von
Ludmilla Assing-Grimelli besorgten Sammlung Aus dem Nachla des Frsten Pck-
262 Albert Meier
Von Pckler-Muskaus tatschlicher Griechenland-Reise, die ihn
1835/36 aus Algier bzw. Tunis kommend via Malta von Patras ber
Athen bis nach Marathon und zurck ber Korinth durch die Pelopon-
nes bis nach Zakynthos, Kephalonia und Ithaka fhrte, bevor es nach
Kleinasien bzw. in die Trkei weiterging, wei man daher nur, was vier
Jahre spter unter dem Titel Griechische Leiden im Rahmen des dreiteili-
gen Sdstlichen Bildersaals verffentlicht wurde. Freilich entzieht sich
diese Publikation mit Nachdruck allen Realittsvermutungen auf Seiten
der Leser, weil eine mehrschichtige Schreiber- und Herausgeberfiktion
die gattungstypische Wirklichkeitsreferenz von Anfang an kappt und
dezidiert verhindert, das Erzhlte als Dokument beim Wort zu nehmen.
Nicht blo, da sich der Herausgeber unter der Maske des bereits erfolg-
reichen ,Verfassers der Briefe eines Verstorbenen anonymisiert und dar-
auf verweist, das seit mehr als drei Jahren druckfertige Buch sei zwi-
schenzeitlich veruntreut worden und habe sich lange Zeit in fremden
Hnden (I, S. 7) befunden schlimmer ist, da es sich beim ,Herrn von
Rosenberg, von dessen griechischen Reiserlebnissen berichtet wird,
um keinen lebenden Menschen handeln soll, sondern um ein tech-
nisch freilich hoch entwickeltes Automat: ein chter Vaucanson,
brigens von ganz eleganten Manieren, immer sehr anstndig, wenn
gleich zuweilen etwas barok, gekleidet, und im Ganzen von einem
passablen Charakter, ob wohl hie und da etwas zu leichtfertig in ihren
Aeuerungen, und keineswegs so tugendhaft, als es zu wnschen wre
(II, S. 3f.).
4
Man lge also gleich mehrfach falsch, wollte man die armen an-
spruchslosen Holzfiguren des Sdstlichen Bildersaals fr wirkliche,
leibhaftige Menschen und die gemalte Leinwand fr wirkliches Land
und Meer (II, S. 2) ansehen. Das Ganze hat sich anscheinend allein in
ler-Muskau. Briefe und Tagebcher des Frsten Hermann von Pckler-Muskau (Ham-
burg, Berlin 187376) sind unergiebig.
4
Ich soufflire zwar noch und fhre den Faden wie bisher, aber ich bin keineswegs
der Held des Stckes selbst. Diesen reprsentirt im Gegentheil nur (mit wenigen
Ausnahmen, die dem scharfsichtigen Leser nicht entgehen werden) der dermalige
Hauptakteur der Marionettenbude, welcher ich schon seit geraumer Zeit vorzu-
stehen die Ehre habe, und deren Werth und umfassenden Bereich ich besonders
dadurch zu begrnden suchte, da ich sie mit einem groen Guckkasten in Ver-
bindung setzte, dessen mannigfache Bilder, wie ich trotz der mir angeborenen
Bescheidenheit keck behaupten darf, uns schon hufig den gndigen Beifall der
ansehnlichsten Honoratioren in und auerhalb Deutschland zu Wege gebracht
haben (II, S. 1f.).
Fhlt, was Wahrheit ist und was Fiction. 263
der Marionettenbude (II, S. 1) des Herausgebers zugetragen, um den
es brigens nicht besser steht als um seinen hlzernen Hauptdarsteller:
Statt als Frst von Pckler-Muskau unterschreibt er sich in der Einlei-
tung als Wolf OGuardthee, | Holzinspektor und Puppendirektor. | Kan-
dia, in der letzten Woche des Rhamadan 1837 (II, S. 5). Zu allem ber-
flu ist der Reiseerzhlung auch noch ein einschlgiges Motto aus
Goethes Faust I vorangestellt, das imVorspiel auf dem Theater der ,Dichter
spricht: Ich hatte nichts und doch genug, | Den Drang nach Wahrheit
und die Lust am Trug (v. 193f.).
Statt mit einem faktengesttigten Reisebericht hat man es beim Sd-
stlichen Bildersaal also mit einer literarischen Fiktion zu tun, die ihre
Realien in ein neu poetisches Gewand (I, S. 11) hllt und letztlich von
einem Schreiber am Hof des Zauberers Phantasus stammt:
Mit dieses Zauberers Passe reis ich; der Sonne Auf= und Untergang wird mir ver-
schnt durch seine Nhe, und jede Landschaft seh ich durch sein Zauberglas,
und Mensch und Thier, das Gute wie das Bse, verklrt sein Licht, und lt mich
klarer dessen Tiefe schaun. (I, S. 11f.)
In der abschlieenden Nachschrift distanziert sich dann sogar noch ein
,Autor von der Figur seines ,Reisenden und lt die Leser mit der Auf-
gabe allein, sich im Text zurechtzufinden: Verwechselt mich nicht mit
meinem Doppelgnger, die unberlegte Leichtfertigkeit des Weltkin-
des nicht mit meiner innern Ueberzeugung. Fhlt, was Wahrheit ist und
was Fiction (III, S. 583).
Solange man diese ironische Selbstvernichtung des Reiseberichts
souvern ignoriert, lassen sich die Griechischen Leiden als durchaus ver-
nnftige Auseinandersetzung mit dem krzlich von der Trkenherr-
schaft befreiten und nunmehr bayerisch regierten Knigreich Griechen-
land lesen. Nimmt man sie aber als das Fantasie-Produkt, als das sie sich
ausgeben, dann sind sie im gnstigsten Fall von imagologischem Wert,
indem sie eine konventionalisierte Griechenland-Deutung gleicherma-
en fort- wie umschreiben. Allemal handelt es sich um ein charakte-
ristisches Gemlde fremder Zustnde in rhapsodischer, d. h. bewut
unsystematischer Gestalt,
5
bei dem gar nicht darauf ankommt, ob es tat-
schlich mit so unparteiischem, vorurtheilsfreiem Blick (III, S. 584)
entworfen ist, wie der Reisende fr sich behauptet die Aufrichtigkeit,
die Klaus Gnther Just in unseren Tagen dem als Verfasser unterstellten
5
Ich hoffe, es wird Niemand so unchristlich seyn, an die folgenden Rhapsodien
dieselben Ansprche, wie an ein schulgerechtes Werk ber Griechenland zu ma-
chen (II, S. 6).
264 Albert Meier
Frst Hermann von Pckler-Muskau zugesteht,
6
wre ohnehin nur ein
Verdienst der ,Herr von Rosenberg genannten Marionette.
Wollte man die Griechenland-Deutung des Sdstlichen Bildersaals
auf einen Punkt bringen, dann wre das die Tendenz, den Klassik-Topos
griechischer Heiterkeit ad absurdum zu fhren. 80 Jahre zuvor hatte
Winckelmann mit europaweitem Erfolg den sanften und reinen
7
Him-
mel ber Griechenland beschworen und dessen glckseelige Lage
8
hauptschlich durch gemigte Jahres-Zeiten
9
erklrt.
10
Demgegen-
ber ist in den beiden ersten Teilen der Griechischen Leiden bestndig vom
Frieren die Rede, zumal sich der Reisende als erste grere Unterneh-
mung auf eine Wintertour im Gebirge des Peloponnes begibt. Mgen die ent-
sprechenden Klte-Erfahrungen auch geografisch-jahreszeitlich bedingt
sein und damit auf Zufall beruhen, so ist das Resmee der Parnass-Be-
steigung doch sarkastisch auf Winckelmanns Idolatrie des klassischen
Griechenland gemnzt und konterkariert die lngst philistrs gewor-
dene Graecophilie:
Seine schroffen Abhnge und eisigen Gipfel fhrten meiner Phantasie die Musen
jetzt in Pelz gewickelt vor, und den armen griechischen Pegasus, wie er auf
schlechter Weide mhsam ein Krutlein aus dem Schnee hervorsucht, der des
Alterthums Herrlichkeiten bedeckt. (II, S. 23)
6
So vorurteilsfrei das Bild Griechenlands, das uns Pckler liefert, auch ist
nirgends verleugnet sich die Individualitt des Verfassers (Just: Nachwort, S. 374).
7
Winckelmann, Johann Joachim: Gedancken ber die Nachahmung der Griechi-
schen Wercke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst, in: Johann Joachim Winckel-
mann: Kleine Schriften Vorreden Entwrfe, mit einer Einleitung von Hellmut
Sichtermann. Walther Rehm (Hrsg.): Berlin 1968, S. 2759, hier S. 30.
8
Winckelmann, Johann Joachim: Erluterung der Gedanken von der Nach-
ahmung der griechischen Werke in der Malerey und Bildhauerkunst; und Beant-
wortung des Sendschreibens ber diese Gedanken, in: Johann Joachim Winckel-
mann: Kleine Schriften Vorreden Entwrfe, mit einer Einleitung von Hellmut
Sichtermann. Walther Rehm (Hrsg.): Berlin 1968, S. 97144, hier S. 99.
9
Winckelmann: Erluterung, S. 29.
10
Die Natur, nach dem sie stuffenweis durch Klte und Hitze gegangen, hat sich in
Griechenland, wo eine zwischen Winter und Sommer abgewogene Witterung ist,
wie in ihrem Mittelpuncte gesetzt, und je mehr sie sich demselben nhert, desto
heiterer und frhlicher wird sie [] (Johann Winckelmanns, Prsidentens
der Alterthmer zu Rom, und Scrittore der Vaticanischen Bibliothek, Mitglieds
der Knigl. Englischen Societt der Alterthmer zu London, der Maleracademie
von St. Luca zu Rom, und der Hetrurischen zu Cortona, Geschichte der Kunst des
Alterthums. Erster Theil. Mit Knigl. Pohlnisch= und Churfrstl. Schs. aller-
gndigsten Privilegio. Dresden, 1764. In der Waltherischen Hof=Buchhandlung,
S. 128f.).
Fhlt, was Wahrheit ist und was Fiction. 265
Whrend die deutschen Klassiker um 1800 auf die Reise nach Griechen-
land verzichtet haben, um dessen Kultur im Licht der Arkadien-Poesie
um so ungestrter idealisieren zu knnen, spielt der Sdstliche Bildersaal
das tatschliche Arkadien als Inbegriff der Ungemtlichkeit gegen die
literarischen Illusionen aus: ich kann doch mit Schillers Worten aus-
rufen: Auch ich bin in Arkadien gewesen! und gewi werde ich nie in
meinem Leben Schnee und Schmutz wiedersehen, ohne Arkadiens fr-
stelnd zu gedenken (II, S. 161).
11
Pckler-Muskaus ,Herr von Sonnen-
berg radikalisiert in dieser Hinsicht den klimatischen desengao, den der
Winckelmann-Schler Johann Hermann Riedesel erfuhr, als er 1768
Athen, die Kykladen und Kleinasien besuchte. Riedesels 1773 publi-
zierte Remarques dun voyageur moderne au Levant (deutsche bersetzung
1774), der einzige namhafte Bericht eines deutschen Griechenland-Rei-
senden im 18. Jahrhundert, falsifiziert Winckelmanns Ideologem an der
Empirie:
Jai t galement tromp sur le climat dAthnes, comme sur celui de tout le Le-
vant. Cette ville, quoiqu 38 dgrs de latitude, parait Ptersbourg en comparai-
son de Naples, qui est 40 dgrs. A mon arrive je supposais, quelle devrait
jour dun air plus dous & tempr que les autres parties de la Grce, parce quelle
est expose au Sud du cot de la mr, & pare des vents du cot du Nord par les
montagnes de Livadie, lancienne Attique. Mais ces mmes montagnes augmen-
tent la vigueur de ces Bores & ds quelles sont couvertes de neige, ce qui dure
pendant 8 mois de lanne, elle les rendent trs froids & piquant. Pour confirmer
ce que je viens de dire du climat de ce pas jajoute, qu mon arrive Athnes le
20 dAot 1768 on venait de moissonner, pendant que jai v couper les grains au
mois de Mai Catane en Sicile, & on ne vendenge quau mois dOctobre. Vers la
fin de Septembre il y fit des jours aussi froids quen Allemagne.
12
Auch in anderer Hinsicht deckt sich das Griechenland-Bild des Sdst-
lichen Bildersaals mit Riedesels Remarques. Knapp 70 Jahre spter ist das
jetzt freilich vom Trkenjoch befreite Griechenland noch immer von
11
Die Dekonstruktion der Griechenland-Topoi geschieht freilich auch in umgekehr-
ter Richtung und wertet das auf, was traditionell unterschtzt wird: Ohne Zweifel
ist der Gedanke an die spartanische Suppe daran Schuld, da nicht nur ich, son-
dern auch viele Andere, sich Sparta immer als ernst und de dachten; es ist aber
zugleich die lachendste und grandioseste Gegend Griechenlands (III, S. 204f.).
12
[Riedesel, Johann Hermann]: Remarques dun voyageur moderne au Levant. Amster-
dam 1773, S. 140142. Unter dem Datum des 6. April 1836 besttigt Pckler-
Muskau diese klimatische Beobachtung: Es gibt viele Reisebcher, die von dem
ewigen Frhling Attikas und der gesunden Luft Athens sprechen. Dies mu
sich sehr gendert haben; was mich betrifft, so finde ich bis jetzt hier eher einen
ewigen sdlichen Winter, mit Menschen, von welchen immer den Zehnten das
Fieber schttelt (III, S. 4f.).
266 Albert Meier
drastischer Unsauberkeit, Korruption, mangelndem Brgersinn und ka-
tastrophaler Infrastruktur geplagt. hnlich wie es schon in der Italien-
Literatur des 18. Jahrhunderts topisch war, werden diese bel stereotyp
dem Mnchsunwesen
13
angelastet:
Wer stark genug constituirt ist, um tglich 1012 Stunden zu Pferde, auf Maulthie-
ren oder zu Fu ohne Unbequemlichkeit zurckzulegen, und der glhendsten
Hitze, wie den unangenehmsten Wirkungen der Klte zu widerstehen [] wer fer-
ner weder die Gefahr halsbrechender Wege, noch gelegentlicher Ruberanflle
scheut; wer unempfindlich gegen den Aufenthalt in Wohnungen ohne Fenster mit
durchsichtigen Dache ist, und Myriaden von Wanzen, Lusen, Flhen und Mus-
kitos sich mit philosophischer Geduld hinzugeben vermag; wer zufrieden ist,
zuweilen nur Brod und Zwiebeln nebst lauem Wasser und geharztem Wein zur
Nahrung und zum Getrnk zu erhalten; wer Gestank und Schmutz nur mit che-
mischem Auge betrachtet, das in diesen Dingen nichts als Naturstoffe gleich
anderen sieht; wer allem diesen gewachsen ist und nichts dawider hat, obige Zu-
stnde dreimal theurer als europische Bequemlichkeiten zu bezahlen dem rathe
ich mit gutem Gewissen die Reise durch Griechenland an []. (III, S. 414f.)
Die Griechischen Leiden prsentieren sich insofern in der Hauptsache als
Kritik an Mistnden, die uralt sind und daher vom bayerisch dominier-
ten, d. h. modernen und aufgeklrten Staat nur unzulnglich bekmpft
werden knnen. Der Reisende konstatiert namentlich die ungemeine
Faulheit der niedern Classen und den gleichen Miggang der hheren:
Diese grenzenlose Trgheit hindert die Menschen auch allein, sich nur im gering-
sten Mae die Bequemlichkeiten der Civilisation zu verschaffen. Nichtsthun ist
ihr Hauptgenu! Haben sie den, so scheinen sie wenig nach allem Uebrigen zu
fragen. Der gemeine Mann ist so apathisch, da man nur mit unverhltnimi-
ger Belohnung ihn zu einiger Anstrengung bewegen kann. Ja, diese Faulheit ist
so gro, da man die Leute nicht einmal dazu zu bringen vermag, die Thren zu-
zumachen, durch welche sie gehen, und mehr wie fnfzig Mal habe ich, bei der
empfindlichen Klte diesen Dienst selbst fr sie verrichten mssen, um mir den
Zug in der Stube zu ersparen. (II, S. 230f.)
Solange die Regierung an derselben Schlfrigkeit leidet und sich nicht
energischer und thtiger zeigt, wird auch im Volke keine Besserung
eintreten, das vielleicht nur aus Verwhnung, aus Mangel an erwecktem
Industrie=Interesse, und namentlich durch die 170 Feiertage im Laufe
des Jahres eine solche traurige Richtung genommen hat (II, S. 231f.).
13
Die Geschichte lehrt uns leider, da bisher viele Religionen in ihrer Verkehrtheit
die rationelle Entwickelung des Menschengeschlechts mehr verhindert als be-
frdert haben, und fr die Griechen ist fast mit Gewiheit vorauszusehen, da,
wenn ihre Mnche und Feiertage nicht reformirt werden, sie nie weder ihre Faul-
heit noch Immoralitt los werden knnen (III, S. 121).
Fhlt, was Wahrheit ist und was Fiction. 267
Alles in allem erscheint das gegenwrtige Griechenland im Sdst-
lichen Bildersaal durchweg als philhellenischer Alptraum, in dem all das
noch gegenwrtig ist, was Reisende wie Patrick Brydone, Charles Dupaty
oder Friedrich Mnter im Jahrhundert zuvor schon an der Magna Grae-
cia (Sditalien und/oder Sizilien) bemngelt haben. Bezeichnender-
weise ist es ein bayerischer Soldat, der dem Reisenden von der Burg ber
Patras herab ein Griechenland zeigt, dem von seiner alten Pracht nicht
viel geblieben ist:
Nachdem ich die hchsten Zinnen des Thurms erstiegen, setzte ich mich, in mei-
nen Mantel gehllt, auf eine derselben nieder und berschaute die Gegend. Ein
brtiger deutscher Unteroffizier diente mir zum Fhrer, und es hatte etwas Son-
derbares, den ehrlichen Baier in seinem groben Jargon mir hier den Bergzug des
Parnassus, dort Ithaka u. s. f. anzeigen zu hren. Die weite Ebene unter mir, sonst
das Paradies von Patras genannt, die durchgngig mit Corinthen angebaut, jhr-
lich 3000 Tonnen dieser eintrglichen Beeren lieferte, wo, von hohen Platanen be-
schattet, die Landhuser und Lustgrten der reichen Trken und Griechen stan-
den, und auf der man ber 100,000 Oliven= und Fruchtbume zhlte ist jetzt
ein kaum absehbarer, meist versumpfter und wster Anger ohne einen einzigen
Baum, auf dem nur Unkraut wuchert. (II, S. 18f.)
Panorama-Szenen dieser Art wiederholen sich bei Pckler-Muskau viel-
fach. Mgen sie an anderer Stelle ganz einfach der Naturbeschreibung
dienen, um die Besonderheiten der griechischen Landschaft den Lesern
eindringlich vor Augen zu fhren, so unterstehen sie hier der Hauptab-
sicht, von einem erhobenen Standpunkt aus das Ganze in den Blick zu
nehmen und in der Betrachtung der Gegenwart eine melancholische
Stimmung zu erzeugen. Dieser Topos des historisch reflektierten Blicks
von oben geht in der Reiseliteratur zumindest bis auf Johann Hermann
Riedesels Reise durch Sicilien und Grogriechenland zurck, der seine tna-
Besteigung (1767) dazu nutzte, den Anblick einer enttuschenden Ge-
genwart mit der Erinnerung an einstige Gre zu konfrontieren und an-
gesichts des offensichtlichen Niedergangs zu trauern:
Hier hatte ich Ursache, ber den elenden Zustand des jetzigen Siciliens, in Ver-
gleichung des alten, zu seufzen; so viele Stdte, so viele verschiedene Vlker, so
viele Reichthmer sind vernichtet; kaum die ganze Insel hat so viele Einwohner
als Siracusa allein vor Zeiten hatte, 1,200,000. Menschen; so viele herrliche
Gegenden, welche Frucht brachten, sind wste aus Mangel der Arbeiter; so viele
geraume Seehafen ohne Schiffe, aus Mangel des Handels; so viele Menschen
mangeln Brod, weil die Edelleute und Mnche alle Gter besitzen!
14
14
[Riedesel, Johann Hermann]: Reise durch Sicilien und Grogriechenland. Zrich 1771,
S. 133f.
268 Albert Meier
Das Clima, der Boden des Landes, und die Frchte desselben sind noch so voll-
kommen als sie jemals gewesen; die Griechische gldene Freyheit aber, die Bevl-
kerung, die Macht, die Pracht und der gute Geschmack sind nicht mehr in dersel-
ben, so wi[e] vor Zeiten, zu finden; die jetzigen Einwohner mssen sagen:
Fuimus Troes.
15
Seit der zweiten Hlfte des 18. Jahrhunderts gehrt es zur narrativen
Grundausstattung von Reiseberichten, Berggipfel oder wenigstens her-
ausgehobene Punkte aufzusuchen, um von dort herab den sentimenta-
lischen Genu einer Dekadenz-Erfahrung zu suchen. Auch Pckler-
Muskaus Holzpuppe lt sich diese Poetisierungsstrategie nicht entge-
hen, verzichtet in der Mehrzahl der Flle
16
jedoch auf das Pathos eines
rousseauistisch getnten Geschichtspessimismus und hebt ihren Text
insofern von der Tradition des aufklrerischen Reiseberichts ab. Da die
Dekadenz-Melancholie jetzt nicht mehr ganz ernst zu nehmen ist, zeigt
sich vor allem beim ersten Blick auf Athen, der zunchst den Byron-
Topos des Tis Greece but living Greece no more
17
aufruft:
Sobald die erste kleine Anhhe erstiegen ist, wo einige Reste der Mauer sichtbar
werden, die sonst Athen mit dem Pyrus verband, erblickt man pltzlich die
ganze Ebene von Athen vor sich ausgebreitet, die Akropolis mit dem zierlichen
Parthenon in ihrer Mitte thronend, den spitzen Lykabettus dicht hinter ihr und
den ehrwrdigen Olivenwald um sie her gezogen, der farblos und halb abgestor-
ben seine drren Aeste gen Himmel streckt. Er pat zu der melancholischen
Stimmung, welcher Wenige sich zu erwehren im Stande seyn mchten, wenn zum
erstenmal in der Ferne jene erhabenen Ueberreste gefallener Gre, gleich trau-
ernden Geistern, vor ihnen aufdmmern, von allen jenen magischen Erinnerun-
gen des Alterthums umschwebt, die unserer Seele seit frhester Kindheit einge-
prgt sind. Auch die ganze brige Gegend erschien hiermit im Einklang; schne,
edle Formen, aber ohne Farbe, nur grau in grau gemalt, de, unfruchtbar und ver-
lassen. (II, S. 247f.)
Bei der berfahrt von Korinth hat freilich schon der Hund Francis fr
die klassische Umgebung einige Empfindung an den Tag gelegt, was
auch die menschliche Sehnsucht nach Athen in ein schiefes Licht rckt:
15
[Riedesel]: Sicilien und Grogriechenland, S. 178.
16
Eine Ausnahme stellt folgende Bemerkung zu Argos dar, die Johann Gottfried
Seumes zorniger Melancholie ob des Niedergangs von Syrakus sehr nahe kommt:
Argos selbst ist nur ein sehr kmmerlicher Ort dem ueren Ansehen nach, doch
soll ziemlich viel Wohlhabenheit darin herrschen. Es ist eine wahre Satyre auf alle
diese kleinen Nester mit erhabenen Namen, wenn man in der Mitte ihres Elends
den Pausanias oder Strabo in die Hand nimmt, und die Unzahl der Tempel und
Kunstwerke nachliest, welche sie alle einst so reichlich schmckten (III, S. 156).
17
Lord Byron, George Gordon Nol: The Giaour. A Fragment of a Turkish Tale,
V. 91.
Fhlt, was Wahrheit ist und was Fiction. 269
er stierte ohne Unterla auf Aeginas malerische Formen hin, bis wir bemerkten,
da ein Schpsenknochen, den Lorenzo am Ende seines Vesperbrodes ins Meer
hatte werfen wollen, sich in der Hhlung des untern Segels gefangen hatte, und
uns nun leider keinen Zweifel mehr brig lie, da er allein es war, der meines
allzu sinnlichen Lieblings Aufmerksamkeit so anhaltend fesselte. (II, S. 239f.)
Als noch weit illusionsstrender erweist sich anschlieend der Zoll, der
die Ankommenden zunchst nicht an Land gehen lt, woraufhin der
Reisende erkrankt: Ich blieb drei Tage krank im ungesunden Pyrus,
verdrielich und nur von Misere aller Art umgeben, im Bette liegen,
und hier war es, wo ich diesem Buche seinen Titel gab, den es von
Anfang bis heute redlich verdient hat (II, S. 244). Umso weniger ber-
rascht es, da die Ankunft in Athen kein Glcksgefhl auslst. Das be-
freite Athen prsentiert sich eben nicht als Triumph des Philhellenis-
mus, sondern als moderner Mischmasch:
Ein Viertheil antik, ein anderes trkisch, eins neugriechisch und das letzte baie-
risch; tausendjhrige und heutige Ruinen durcheinander gemengt, daneben nagel-
neue, grne, gelbe und weie Huser, im Geschmack der Nrnberger Spielsachen
aufgefhrt; alte abgebrochene Straen im grlichsten Chaos; breite, abgewin-
kelte neue, die aber in Ermangelung der Huser meistens nur durch Planken be-
zeichnet sind, berdies voller Unrath liegen, und oft in der Mitte noch einen tief
aufgeworfenen, bel dunstenden Graben haben; eine eben so lebendige und zahl-
reiche, als g[r]tentheils zerlumpte Menschenmenge, die in jenen Gassen wim-
melte, und sie mit einem andauernden Gesumme sechs bis sieben verschiedener
Sprachen erfllte; eine heie Sonne und ein kalter Wind, der das Ganze von Zeit
zu Zeit in die unbequemsten Staubwolken hllte das war die neue Athina, wel-
che ich hier mit wehmthigem Lcheln vor mir sah. (II, S. 252)
Die Freuden, die der Aufenthalt an einem Knigshof mit sich bringt,
gestalten sich denn auch weniger griechenlandspezifisch als zeitgens-
sisch:
In Athen erst werde ich wieder gewahr, da ich mich in Europa befinde; ich sehe
wieder die hergebrachten Formen eines civilisirten Hofes, und die eleganten Sa-
lons eines sehr ausgezeichneten diplomatischen Cirkels, spiele wieder Whist und
hre italienischen Gesang, und freue mich, das mir fast fremd gewordene Alte
einige Wochen wieder mit anzusehen. (II, S. 253)
Auch wenn der Zweite Teil der Griechischen Leiden der Billigkeit gem,
und namentlich fr den Aufenthalt in Athen, gesteht, da trotz jenes
ominsen Titels doch auch manche Sonnenblicke diese trben Tage
erhellten (III, S. 1), besttigt er die bisherige Einschtzung. Auch als
Knigreich ist Griechenland keineswegs schon in der Moderne ange-
kommen vielmehr steht der Uebergang von Jahrhunderte langer
Sklaverei der Massen und unbeschrnkter Despotie der Gebietenden zu
270 Albert Meier
einem Zustande, wie ihn das brige gebildete (und berbildete) Europa
verlangt, ja vielleicht bedarf (III, S. 6), noch in den Sternen. In dieser
Diagnose laufen die zahlreichen Auseinandersetzungen mit den politi-
schen Zustnden sowohl im Gesamtstaat als auch in den unterschied-
lichen Provinzen zusammen, die jeweils die jngste Geschichte mit
bedenken und die Gegenwart immer aus historischem Blickwinkel
reflektieren. Die Reisebeschreibung bleibt diesbezglich auffllig sach-
lich und verzichtet auf moralische Verdikte, ohne das Kritikwrdige zu
verschweigen:
Was nun die Nation selbst und ihren Charakter angeht, so darf man wohl mit
Recht sagen, da wenige Vlker, nach so langer Barbarei und Unterdrckung,
noch so viele gute Eigenschaften erhalten haben wrden. Ein lebhafter scharfer
Geist, Vaterlandsliebe, Tapferkeit, Migkeit, Hflichkeit, Geselligkeit, Gewandt-
heit und savoir faire wird ihnen Niemand absprechen knnen. Etwas Perfidie, et-
was noch brig gebliebener Sklavensinn, einige Tendenz zum Geiz, Interessirt-
heit, Unwissenheit, Unreinlichkeit und Faulheit, wo ihr Interesse noch nicht
erwacht ist, nebst einer heillosen Eifersucht unter sich selbst rcksichtsloser Rach-
sucht und einem sehr weiten Gewissen in Betreff des Mein und Dein, welches Gut
und Leben oft zugleich gefhrdet, das sind ihre Schattenseiten. Im Ganzen
erscheinen sie jedoch immer noch ehrlicher, als erwartet werden drfte, denn
sie rauben mehr gewaltsam, als sie heimlich stehlen []. Kriechend finde ich
sie eben so wenig, als hochmthig, und grausam erscheinen sie mir nur in Folge
so mannigfacher und tiefer Aufreizung, wie durch angenommene trkische Sitten
geworden zu seyn. (III, S. 10f.)
Als einem Volke, das auerdem so viel gesunden Mutterwitz, so viel
Nationalgefhl und einen so regen Ehrgeiz mit der leichten Entbehrung
fast aller Bedrfnisse verbindet, wird dem Griechen fr die Zukunft
immerhin Groes zugetraut, wenn man nur ein neues, ihm angemes-
senes, seinen Eigenschaften entsprechendes Leben und Interesse in
demselben hervorzurufen verstnde, und ihm dann auch die gehrige
Zeit liee, und die Mittel nicht vorenthielte, um zur Mndigkeit darin
zu erstarken (III, S. 11f.). Mehr als die Griechen selbst sind damit die
europischen Gromchte in die Pflicht genommen, die den neuen
Staat zur Unabhngigkeit gefhrt haben und deshalb in der Verantwor-
tung stehen, Griechenland zu stabilisieren.
18
18
Da inde die groen Mchte das hlflose Wesen, wenn nicht ganz selbst ge-
zeugt, doch wenigstens gemeinschaftlich accouchirt, und bei der Navariner
Feuer= und Wassertaufe zugleich Gevatter bei ihm gestanden haben, so sind
sie gewissermaen verpflichtet, es nun auch nicht Hungers sterben zu lassen
(III, S. 12).
Fhlt, was Wahrheit ist und was Fiction. 271
Abgesehen von konkreten Mngelrgen am Zuschnitt des knstlich
begrndeten Knigreichs,
19
mahnt die Reise-Erzhlung insgesamt wei-
sere Institutionen und ein krftigeres Gouvernement an, dessen Finan-
zierung wohl lange noch nur von auen herkommen kann (III, S. 12).
Als Generalba lt sich aus diesem Raisonnement heraushren, da
Griechenlands Zukunft eine wohlwollende, aber gerechte und uner-
bittliche Strenge voraussetzt: Unverstndige, in Schwche ausartende
Milde, Mangel aller Energie, kleinliche Intriguen und auswrtiger Ein-
flu sind ein bles Surrogat dafr (III, S. 62). Sollte diese Kultivierung
eine europische Resozialisierung gewissermaen la longue gelingen,
dann wre nach allen vorhergegangenen Prfungen darauf zu hoffen,
da
Griechenland doch endlich dahin kommen wird, die wahre Rolle zu spielen,
welche ihm die Vorsehung ganz besonders angewiesen zu haben scheint, nm-
lich: die Verschmelzung der Civilisationen des Orients und Occidents, durch
seine hierzu so geeignete Stellung vorzubereiten, und krftig zu vermitteln. (III,
S. 63f.)
Unparteilich ist dieses Resmee insofern, als es weder Griechen noch
Trken bevorzugt, sondern jeder Seite dort ihr Recht gibt, wo sie es ver-
dient. Auch in dieser Hinsicht decken sich die Griechischen Leiden im
Kern mit Riedesels Remarques dun voyageur moderne au Levant, der den
Trken bereits eine besser funktionierende Verwaltung und einen hhe-
ren hygienischen Standard attestiert hatte. Die Vertreibung der Trken
allein kann das Prosperieren des mit so wenig Glck von den europi-
schen Mchten extemporirten Staates (I, S. 16) daher nicht garantieren,
zumal der wichtigste politische Fhrer jetzt fehlt: Capo dIstrias Tod
war vielleicht das grte Unglck, welches das werdende Griechenland
treffen konnte, und ein noch greres fr dessen Ehre, da ein Grieche
der Mrder war! (II, S. 272).
20
19
Es ist brigens ein groes Unglck fr das neue Griechenland, und htte auf dem
an halben Maregeln so reichen Wiener Kongre kaum besser ausgedacht werden
knnen: da man auch hier nur zur Hlfte nahm und Thessalien und Epirus aus-
lie, was nothwendigerweise, wenigstens zum Theil, mit dem neuen Knigreich
vereinigt werden mute; denn sowie die Grenze jetzt beschaffen ist, mit allen
Ebenen im Besitz der Trken, wird es fast eine Sache der Unmglichkeit, den
durch das Meer vom brigen Continent des Reichs grtentheils geschiedenen,
durchaus gebirgigen Norden im Zaum zu halten, und bleibende Ordnung und
Ruhe darin herzustellen (III, S. 12f.).
20
Ioannis Antonios Graf Kapodistrias (17761831), 1828 von der Nationalver-
sammlung fr sieben Jahre zum ersten Gouverneur bzw. Prsidenten (Kybernetes)
272 Albert Meier
Das Gesamturteil ber Griechenland, das unter der Hand dem Osten
zugeschlagen wird, weil ,Sd- im Titel fr Nordafrika steht, ist im
Sdstlichen Bildersaal daher reichlich skeptisch grundiert: Es ist ein
trauriger Zustand in diesem Lande, wo trotz der vielen auslndischen
und inlndischen Truppen nirgends die geringste Ruhe herrscht, und
Rubereien, wie partielle Insurrectionen, an allen Enden an der Tages-
ordnung sind (III, S. 239). Philhellenistischem berschwang, in dem
der winckelmannsche Griechentraum nachwirkte, hat diese Anamnese
seinerzeit nicht zusagen knnen, weil Griechenland nicht an seiner gro-
en Vergangenheit, sondern an seiner Gegenwart gemessen wird, in der
das Pathos klassisch-schner Groartigkeit lngst den trivialeren Reali-
tten eines Vlkergemischs Platz gemacht hat:
21
Uebrigens finde ich in Allem, was ich noch hier von der griechischen Gesellschaft
gesehen, diese in ihren Manieren freundlich, zuvorkommend und ohne Prten-
sion, aber freilich an das Zeitalter der Aspasia und des Alcibiades darf man dabei
nicht mehr denken. Selbst die Zge der modernen Griechen verrathen meistens
weit mehr die Mischung mit dem Blute der Barbaren, die so lange hier hausten,
als den Urtypus der Hellenen, wenn berhaupt noch etwas von diesen hier vor-
handen ist. Gebogene Nasen sind an der Tagesordnung und die sogenannten grie-
chischen hchst selten, Augen und Haarwuchs aber gewhnlich der schnste
Theil bei Mnnern und Weibern. (III, S. 72f.)
Griechenlands gewhlt, ist 1831 vom Bruder und Sohn des rebellierenden Ma-
ni-Frsten Petros Mavromichalis, den er hatte verhaften lassen, in Nauplia er-
mordet worden. Pckler-Muskau schtzt Kapodistrias eben des Versuchs wegen,
Griechenland durch die Unterdrckung traditioneller Partikularinteressen zu
einigen.
21
Pckler-Muskau besttigt hier zumindest in der Tendenz die dem Philhellenismus
streng genommen allen historischen Boden entziehende These Jakob Philipp Fall-
merayers, bei den aktuellen Bewohnern Griechenlands knne von Hellenen nicht
die Rede sein: Das Geschlecht der Hellenen ist in Europa ausgerottet [] Denn
auch nicht ein Tropfen edlen und ungemischten Hellenenblutes flieet in den
Adern der christlichen Bevlkerung des heutigen Griechenlands (Fallmerayer,
Jakob Philipp: Geschichte der Halbinsel Morea whrend des Mittelalters. Ein histo-
rischer Versuch. Untergang der peloponnesischen Hellenen und Wiederbevlkerung des lee-
ren Bodens durch slavische Volksstmme, Theil 1. Stuttgart 1830, S. III f.). Zu dieser Dis-
kussion s. auch den Beitrag von Sandrine Maufroy in diesem Band, S. 347350.
Fhlt, was Wahrheit ist und was Fiction. 273
Literaturverzeichnis
Quellen
Lord Byron, George Gordon Nol: The Giaour. A Fragment of a Turkish Tale. Lord
Byron, in: Lord Byron, George Gordon Nol: The Complete Poetical Works, Bd. 3. Je-
rome McGann (Hrsg.): Oxford 1981.
[Riedesel, Johann Hermann]: Reise durch Sicilien und Grogriechenland. Zrich 1771.
: Remarques dun voyageur moderne au Levant. Amsterdam 1773.
von Pckler-Muskau, Frst Hermann: Sdstlicher Bildersaal. Erster Band. Stuttgart
1840.
: Sdstlicher Bildersaal. Zweiter Band. Stuttgart 1840.
: Sdstlicher Bildersaal. Dritter Band. Stuttgart 1841.
: Aus dem Nachla des Frsten Pckler-Muskau. Briefe und Tagebcher des Frsten Her-
mann von Pckler-Muskau. Ludmilla Assing-Grimelli (Hrsg.): Hamburg, Berlin
187376.
Winckelmann, Johann Joachim: Gedancken ber die Nachahmung der Griechi-
schen Wercke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst, in: Johann Joachim Winckel-
mann: Kleine Schriften Vorreden Entwrfe, mit einer Einleitung von Hellmut
Sichtermann.Walther Rehm (Hrsg.): Berlin 1968, S. 2759.
: Erluterung der Gedanken Von der Nachahmung der griechischen Werke in der
Malerey und Bildhauerkunst; und Beantwortung des Sendschreibens ber diese
Gedanken, in: Johann Joachim Winckelmann: Kleine Schriften Vorreden Entwrfe,
mit einer Einleitung von Hellmut Sichtermann. Walther Rehm (Hrsg.): Berlin
1968, S. 97144.
: Geschichte der Kunst des Alterthums. Erster Theil. Mit Knigl. Pohlnisch= und
Churfrstl. Schs. allergndigsten Privilegio. Dresden, 1764.
Forschungsliteratur
Just, Klaus Gnther: Nachwort des Herausgebers, in: Frst Hermann von Pckler-
Muskau: Sdstlicher Bildersaal. Griechische Leiden. Stuttgart 1968, S. 372384.
274 Albert Meier
Auf Hellenen! Zu den Waffen alle 275
Marie-Ange Maillet
Auf Hellenen! Zu den Waffen alle
Bemerkungen zur Rezeption der philhellenischen
Gedichte Ludwigs I.
Der bayerische Knig wurde schon von seinen Zeitgenossen als der er-
ste europische Philhellene gelobt und bildete als solcher unter den
deutschen Frsten lange Zeit eine Ausnahme. So schrieb im Jahre 1828
der Schweizer Bankier Jean-Gabriel Eynard, der den griechischen Kampf
aktiv untersttzte, an einen der Hauptakteure des deutschen Philhelle-
nismus, den in Mnchen ansssigen Philologen Friedrich Thiersch:
Le roi de Bavire est la personne en Europe qui a le plus fait pour la restauration
de la Grce; outre les sommes considrables quil a envoyes, le vertueux monar-
que, en permettant que son nom fut connu a ennobli cette cause de la religion et
de lhumanit.
1
Weniger geschtzt als sein politisches Engagement sind wohl die Ge-
dichte, durch die Ludwig I. seiner Griechenlandbegeisterung einen lite-
rarischen Ausdruck gab. Fr den Germanisten knnen die kniglichen
Verse vorwiegend als Zeugnisse einer epigonenhaften Dichtung betrach-
tet werden,
2
ansonsten sind sie aber von geringer knstlerischer Bedeu-
tung. Schon bei ihrer Verffentlichung interessierte die Rezensenten
nicht vorrangig die Qualitt der Poesie, sondern die Tatsache, da ein
1
Brief von Jean-Gabriel Eynard an Friedrich Thiersch, vom 11. 06. 1828, in: Thier-
schiana I, Mnchener Staatsbibliothek.
2
Zu den epigonenhaften Zgen der am Weimarer Klazzisismus orientierten Dich-
tung des bayerischen Knigs und dessen Abhngigkeit von anderen zeitgens-
sischen literarischen Modellen, siehe den Aufsatz von Wolfgang Frhwald: Der
Knig als Dichter. Zur Absicht und Wirkung der Gedichte Ludwigs des Ersten,
Knigs von Bayern, in: Deutsche Vierteljahrsschrift fr Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte 50/1976, S. 127157; speziell zu den Hellas-Gedichten, siehe Win-
fried Bauer: Die Hellas-Gedichte Ludwigs I., in: Wolf-Armin von Reitzenstein
(Hrsg.): Bayern und die Antike 150 Jahre Maximilians-Gymnasium in Mnchen.
Mnchen 1999, S. 2447 (enthlt eine Analyse zweier Hellas-Gedichte).
276 Marie-Ange Maillet
Knig der Autor war, und manche scheuten sich auch nicht, wenn auch
sehr diplomatisch, auf ihre stilistischen Mngel hinzuweisen. Fr die Be-
deutung Griechenlands in der Gedankenwelt des bayerischen Knigs ge-
ben sie aber wertvolle Hinweise. Die Interpretation charakteristischer
Motive dieser Gedichte soll hier die Beweggrnde des ludovizianischen
Philhellenismus hervorheben und dessen Besonderheit durch eine Ein-
ordnung in den zeitgenssischen politischen Kontext veranschaulichen.
1. Zur Entstehung und Verffentlichung
der Hellas-Gedichte Ludwigs I.
Die meisten Hellas-Gedichte Ludwigs I. entstanden in den Jahren des
griechischen Befreiungskampfs, zwischen 1821 und 1829 und sind ent-
sprechend engagierte, meist sehr rhythmische Gedichte, die zum Kampf
anspornen sollten. Mochte der Monarch in dem Gedicht An die Hellenen,
da ich Knig beteuern, seine Lyra sei bei seiner Thronbesteigung, im Jahre
1825 also, pltzlich verstummt, dieses bremste ihn kaum in seiner Ttig-
keit als dilettantischer Dichter. Daher wre es sicherlich verfehlt, in sei-
nen Dichtungen nur einen Trost fr seine geringe Handlungsfreiheit in
der Kronprinzenzeit sehen zu wollen, zumal die Griechenlanddichtung
Ludwigs I. nicht zeitgleich mit dem Freiheitskampf ein Ende fand. Wei-
tere Hellas-Gedichte werden nmlich in den whrend der dreiiger und
vierziger Jahre erschienenen Gedichtsbnden verzeichnet,
3
die aber von
einem melancholischen Grundton gekennzeichnet sind und in der Erin-
nerung an die schne aber unwiederbringliche Zeit des Aufblhens Grie-
chenlands die Anlehnung an Schillers Gedicht Die Gtter Griechenlands
verraten, den Ludwig I. sein Leben lang geradezu vergtterte.
21 Gedichte ber Griechenland befinden sich im 1829 erschienenen
zweiten Band der Gedichte Ludwigs des Ersten, Knigs von Bayern,
4
wh-
rend der im Jahre 1839 erschienene dritte Band sechs weitere Gedichte,
die auf der Reise des Knigs durch Griechenland 18351836 verfat
wurden, enthlt. Die Tatsache, da keines dieser Gedichte unmittelbar
zur Zeit seiner Entstehung verffentlicht wurde, ist v. a. fr die Rezep-
3
Siehe dazu die Liste im Anhang.
4
Eigentlich 23, wenn man zwei zustzliche Gedichte dazu zhlt, die sich weiterhin
in diesem Band befinden. In der zweiten Auflage des Bandes im selben Jahr wur-
den sie dem Zyklus der Hellas-Gedichte einverleibt. Die dritte Auflage von 1839
zhlt 24 Gedichte.
Auf Hellenen! Zu den Waffen alle 277
tionsgeschichte von Bedeutung. Die Gedichte des 1829 erschienenen
zweiten Bandes wurden nmlich in den zwanziger Jahren verfat und
waren von hchster Aktualitt, erschienen aber erst in den ersten Mona-
ten des Jahres 1829, als der Freiheitskampf beinahe beendet war.
5
Zwar
war Ludwig I. schon vor dem Erscheinen seiner beiden ersten Gedichts-
bnde 18281829 in der deutschen ffentlichkeit als frstlicher Gele-
genheitsdichter aufgetreten, jedoch gehrten die philhellenischen Ge-
dichte nicht zu dem Teil der Lyrik, der bereits zuvor publiziert worden
war.
6
Wenn also berhaupt von einer politischen oder propagandisti-
schen Funktion dieser Gedichte zu sprechen ist, dann im Sinne von
Wolfgang Frhwald, der in seinem grundlegenden Beitrag zur Absicht
und Wirkung dieser Gedichte
7
sehr berzeugend nachweist, da die
nachtrgliche Verffentlichung ein bewut politischer Akt mit dem
Ziel war, dem Knigsimage zu dienen und den Monarchen als einen
deutschen Brgerknig avant la lettre hervortreten zu lassen.
8
Sein
Wunsch, als Knig dargestellt zu werden, der seinem Volk nahe war, fin-
det in den Hellas-Gedichten einen literarischen Niederschlag. Dadurch
erhalten sie eine besondere Note. Der damalige Kronprinz Ludwig, der
wiederholt darauf hinweist, da die Griechen allein gelassen und isoliert
seien und der wie etwa Wilhelm Mller den europischen Staaten
ihre Schuld vor Augen stellt und auf ihre Verantwortung hinweist,
9
in-
5
Der Friedensvertrag von Adrianopel, der den griechischen Freiheitskampf be-
endete, wurde im September 1829 unterzeichnet. Dazu schrieb der Rezensent
Neumann in den Jahrbchern fr wissenschaftliche Kritik: Erfreuend wird es seyn fr
die Mit- und Nachwelt, da dem kniglichen Dichter der Lohn so edler Strebens,
die Erfllung so reiner Wnsche und Hofnungen in der sich nun vollendenden
Befreiung Griechenlands gerade jetzt gewhrt wird, wo diese seine Gefhle in
poetischer Gestaltung der Welt entgegenstreben. In: Jahrbcher fr wissenschaftliche
Kritik, Nr. 239 (1829), S. 826.
6
Dazu Goedeke, Karl: Grundri zur Geschichte der deutschen Dichtung, Bd. XII. Berlin
1957, S. 444.
7
Frhwald: Der Knig als Dichter.
8
Die politische Intention der Gedichte erkannte damals Friedrich Thiersch, der in
seiner Rezension schrieb: Schon sind jetzt diese Gedichte das Eigenthum des Vol-
kes geworden []. Ihre Erscheinung zeigt sich schon jetzo als eine weise Regenten-
handlung, denn der Knig wohnet durch sie heimischer und sicherer in den Herzen
seines Volkes. In: ber die Gedichte seiner Majestt des Knigs Ludwig von Bay-
ern, in: Inland Nr. 105 vom 15. 04. 29, S. 421 (Markierung durch M-A. M).
9
Siehe dazu z.B. das Gedicht Nach Ipsaras Fall: Und solltet, Helden, wirklich ihr erliegen |
Und sollten die Barbaren endlich siegen,| Wird euer aufgeschichtetes Gebein | Der fernen Nach-
welt bringen noch die Kunde|Von dem stillschweigend allgemeinen Bunde,| Ein Denkmal von
Europas Schande sein. In: Gedichte des Knigs Ludwigs I. von Bayern, 2. Theil, 1829, S. 30.
278 Marie-Ange Maillet
szeniert sich dort als Brger, der von dem traurigen Schicksal der Grie-
chen berhrt wird. Er stellt sich in Gegensatz zu den Herrschern Europas,
die ihnen jede Teilnahme verweigern und dadurch ihre Unmenschlich-
keit an den Tag legen:
Von den Mchtigen gemieden,
Ist Theilnahme uns beschieden
Von der Brger Menschlichkeit,
Fremd politischen Beschlssen,
Folgend des Gefhls Ergssen,
Mit der Tugend nicht entzweyt.
10
Die Verzgerung in der Verffentlichung fhrte dabei zu manchen ko-
mischen Effekten, z. B. als der Knig sich in einer Funote veranlasst
fhlte, ausdrcklich zu bemerken, da die auf Griechenland sich be-
ziehenden Gedichte frher geschrieben sind, als die Verwendung meh-
rerer groen Mchte fr dasselbe stattfand oder doch bekannt wurde.
11
Kronprinz Ludwig war sich aber seiner Sonderstellung bewut. Die Tat-
sache, da er in Gedichten wie An Hellas. Im dritten Frhling nach ihrer
Wiedergeburt oder An Hellas. Im vierten Jahre ihrer Befreyung Griechenland
als mein Hellas
12
apostrophiert und fr sich beansprucht, mu in die-
sen Zusammenhang gestellt und verstanden werden, mag man darin
auch ein Zeichen seiner Liebe zu diesem Land seiner Sehnsucht sehen.
Da der bayerische Monarch als der erste in Europa diese sehr populre,
den fhrenden Mchten der Heiligen Allianz hchst verdchtige Bewe-
gung nicht nur in Worten, sondern auch mit hohen Geldspenden unter-
sttzt hatte, wurde brigens von den damaligen Rezensenten der Ge-
dichte nicht selten unterstrichen. So schrieb Friedrich Thiersch, der den
Befreiungskampf schon in seinen Anfngen gefrdert hatte, dessen Ent-
wicklung sehr aufmerksam verfolgte und somit aus Erfahrung sprach:
Der Teilnahme der Groen ist er vorgegangen, die Verbindung der Mchte zur
Rettung von Griechenland ist ihm gefolgt, und wohl wird die Nachwelt es be-
stimmter erfahren, in welchem Geiste und wie entscheidend Er auf das Innere, auf
die eigentliche Treibkraft einer Verbindung eingewirkt, welche die Throne mit der
ffentlichen Meinung in Einklang gebracht.
13
10
Der Griechen Klage, Im Frhling 1826, in: Gedichte des Knigs Ludwigs I. von Bayern,
1. Theil, 1829, S. 3233. Zum Begriff der Brgertugend, siehe Frhwald: Der K-
nig als Dichter, S. 145.
11
In: Gedichte des Knigs Ludwigs I. von Bayern, 2. Theil, S. 35.
12
Ibidem, S. 3 und 16.
13
Siehe Thiersch, Friedrich: ber die Gedichte seiner Majestt des Knigs Ludwig
von Bayern, in: Das Inland, Nr. 84 vom 28. 03. 1829.
Auf Hellenen! Zu den Waffen alle 279
Und in noch berschwnglicherem Ton erklrte der Kritiker der Zeit-
schrift Flora:
Nur ein Herz schlug auf einem Throne, das den Schmerz empfand und theilte,
das die Brust aller Vlker durchschnitt; nur das Gemth Eines Frsten fhlte sich
angeregt von der Heiligkeit der Sache und ihrer groen Bedeutung im Fortschritte
des Jahrhunderts []; so darfst Du, o Bayern, mein Vaterland, voll warmen Ge-
fhles und eines gesunden Herzens, unter allen Nationen dieses Welttheiles in
freudigem Stolze hervortreten [].
14
Unter den damals erschienenen Besprechungen der Gedichte des K-
nigs gebhrte den Hellas-Gedichten das grte Lob, nicht nur, weil sie
stilistisch zu den gelungensten der Sammlung gezhlt wurden, sondern
auch, weil sie von dem Enthusiasmus eines edlen Herzen fr eine Sa-
che der Menschlichkeit zeugten.
Trotz ihres spten Erscheinungsjahres erschien es brigens man-
chen Freunden Griechenlands nicht unangebracht, die kniglichen
Erzeugnisse den Griechen selbst nahe zu bringen. So verffentlichte
noch im Jahre 1830 ein junger Philologe namens Friedrich Frankh, ein
Schler Thierschs, der 1832 von Ludwig I. zum Dolmetscher seines
Sohnes Otto bestellt werden sollte,
15
eine bersetzung von 22 Hellas-
Gedichten ins Altgriechische. Man darf sich dabei fragen, ob es sich
nicht um einen politischen Schachzug von Thierschs Schler han-
delte, um in der Zeit der Verhandlungen zur Wahl des neuen Knigs
Griechenlands noch einmal an die Verdienste Ludwigs I. zu erinnern.
An welches Publikum Frankh sich dabei wandte, zeigt schon das Deck-
blatt mit der lateinischen berschrift: Ludovici Bavarorum Regis Car-
mina ad Graecos in linguam Graecam convertit, Dr. Johannes Franzius,
Stuttgardtiaie, apud F.G. Frankh, 1830: Mochte auch in seiner Ein-
leitung der Herausgeber beteuern, diese bersetzungen seien fr
ganz Griechenland angefertigt worden, nur ein geringer Teil der Grie-
chen damals, d. h. die gebildetesten unter ihnen, konnte sie lesen.
16
14
Siehe Lautenbacher: Die Gedichte des Knigs Ludwig von Bayern, in: Flora,
Nr. 76 (16. 04. 1829)-Nr 81 (23. 04. 1829)
15
Dazu Baumstark, Reinhold (Hrsg.): Das neue Hellas. Griechen und Bayern zur Zeit
Ludwigs I. Mnchen 2000, S. 243.
16
Ein solcher Idealismus war damals natrlich kein Einzelfall, auch bei Ludwig I.
finden wir ihn in ausgeprgter Form, wenn er z. B. in dem Distichon An Homer
schreibt:
Freue Dich, alter Homer, denn frey ist wieder dein Hellas; | Nicht mehr liest der
Sklav, nur der Freye dich nun. In: Gedichte des Knigs Ludwigs I. von Bayern, 2. Theil,
S. 10.
280 Marie-Ange Maillet
Ins Neugriechische wurden allerdings nur wenige Gedichte ber-
tragen.
17
2. sthetischer Philhellenismus
als Voraussetzung des politischen Engagements
Der tiefgehende sthetische Philhellenismus, der dem politischen Enga-
gement des bayerischen Knigs zugrunde lag, wird durch die Hellas-
gedichte besonders deutlich. ber Ludwigs Auseinandersetzung mit der
griechischen Antike in seiner Jugend ist verhltnismig wenig be-
kannt.
18
Wenn der Kronprinz offenbar ziemlich frh mit den bekannte-
sten Schriften des gegen Ende des 18. Jahrhunderts aufblhenden Phil-
hellenismus bekannt gemacht wurde, wurde er erst whrend seines
ersten Italienaufenthalts in den Jahren 18041805 bei einem Besuch von
Paestum bei Neapel pltzlich mit der griechischen Antike konfrontiert
und erkannte von da an ihre berlegenheit ber die rmische Antike.
Damals begann der Kronprinz fr seine sptere Glyptothek Antiken zu
sammeln; er machte sich dann in dieser Eigenschaft als Kunstkenner
einen Namen, als er die Aeginetischen Giebelskulpturen erwarb, die die
Architekten Karl Haller von Hallerstein und Charles Robert Cockerell
im Jahre 1811 auf ihrer griechischen Expedition entdeckt hatten und
die damals viel Aufsehen erregten.
19
Er hatte neben Latein und Italie-
17
Siehe Kind, Theodor: Neugriechische bersetzung einiger Gedichte des Knigs Ludwigs
von Bayern, in: Zeitung fr die elegante Welt, 1830, 27. Bei den dort bersetzten
Gedichten (An die Hellenen, da ich Knig; an Homer, dessen Brustbild in einer meiner
Arbeitsstuben steht; die Drei Wnsche; Gymnasium) handelt es sich nicht ausschliess-
lich um Hellas-Gedichte. Die einzige andere Gesamtbersetzung der Hellas-
Gedichte war eine franzsische, in: Posies du roi Louis de Bavire. Paris 1829/1830,
2. vol., trad. de William Duckett. Bezeichnenderweise hatte William Duckett
(17681841), ein gebrtiger Ire, selbst im Jahre 1821 eine Ode mit dem Titel Gre-
cian liberty in Paris verffentlicht.
18
Dazu Gollwitzer, Heinz: Ludwig I. von Bayern, eine politische Biographie. Mnchen
1986, S. 472ff; Wnsche, Raimund: ,Lieber hellenischer Brger als Erbe des
Throns?? Knig Ludwig I. und Griechenland, in: Baumstark (Hrsg.): Das neue
Hellas. Griechen und Bayern zur Zeit Ludwigs I. Mnchen 2000, S. 120; Irmscher,
Johannes: Das Antikebild des deutschen Philhellenimus, in: Evangelos Kon-
stantinou (Hrsg.): Die Rezeption der Antike und der europische Philhellenismus. Frank-
furt a.M. u. a. 1998, S. 121138.
19
Dazu Seidl, Wolf: Bayern in Griechenland. Die Geburt des griechischen Nationalstaates
und die Regierung Knig Ottos. Mnchen 1981, S. 21ff.; Wnsche: ,Lieber helleni-
scher Brger als Erbe des Throns??, S. 7ff.
Auf Hellenen! Zu den Waffen alle 281
nisch auch Altgriechisch gelernt und Winckelmanns Werke mit groer
Aufmerksamkeit gelesen das Verstndnis der griechischen Kunst grn-
dete bei ihm also auf einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung.
Seine Griechenlandliebe war demnach keine einfache Schwrmerei. Was
es fr ihn bedeutete, Hellas als Ideal zu betrachten, drcken seine Ge-
dichte deutlich aus, etwa das Gedicht Paestum, das er auf seiner ersten
Italienreise verfasste und das man als sein erstes Hellas-Gedicht betrach-
ten darf:
Mit der Religion und dem Staat, dem Leben verwebet,
War den Hellenen die Kunst, welch ihr Wesen erfllt.
20
Eine solche Einheit aller Lebensbereiche erstrebte Ludwig spter als K-
nig, als er die bayerische Hauptstadt mit Hilfe des Architekten Leo von
Klenze zu einem Neuen Athen gestalten wollte 1829 war sie es erst
im Ansatz , bzw. zu einer Stadt, in der die Kunst, vom Monarchen
als ein Medium fr Politik und Religion aufgefasst, allgegenwrtig wer-
den sollte. Den sthetischen Philhellenismus Ludwigs I. mu man also
um so ernster nehmen, als der Monarch, der sich als einen Perikles der
Jetztzeit sah, seine ganze Wirkung als Knig am griechischen Modell
orientierte. So kann z. B. das sptere Gedicht In Hellas, das auf seiner
Reise durch Griechenland verfat wurde, als ein Bekenntnis zu seiner
Rolle als Monarch, Saat des Schnen fr die Zukunft [] streuen und
fr die Ewigkeit wirken, verstanden werden.
Ludwigs idealistische Wahrnehmung Griechenlands wird in den Hel-
lasgedichten durch zahlreiche, oft klischeehafte Beschreibungen des
antiken Hellas belegt; am deutlichsten ist dies in den Gedichten der
dreiiger Jahre. Da werden die Verdienste Griechenlands um die Kunst
und die Wissenschaft durch konkrete Beispiele heraufbeschworen: Ne-
ben Platon, Homer, Phidias und Sokrates werden Euripides, Perikles
und Aspasia, die in ihrer Person die Schnheit des Geistes mit allen
Reizen der Natur verband, als Zeugen dieser schnsten Zeit der Mensch-
heit herangezogen, in der Kunst und Wissenschaft und alles Schne/
Glnzten in Vollkommenheit zugleich (Hellas schnste Zeit). In den
Gedichten der zwanziger Jahre sollte vor allem an die glorreiche kriege-
rische Vergangenheit des antiken Hellas erinnert werden; diesem Ziel
dient die damals gngige Herausstellung der Kontinuitt zwischen
dem antiken und neuen Griechenland, zwischen antiken und neuen
20
In: Gedichte des Knigs Ludwigs I. von Bayern, 1. Theil, S. 32.
282 Marie-Ange Maillet
Helden wie Leonidas und Botzaris.
21
Jedoch wird das antike Griechen-
land auch dort wiederholt als [] der Thron der ewig unerreichten
Kunst,/ Ewig hohes Vorbild allen Welten, als [] der edlern Mensch-
heit treue Wiege gelobt (An Hellas. Im Frhling des 1821.sten Jahres), wo-
durch Ludwig I. sich wie seine Zeitgenossen berechtigt fhlte, als Euro-
per den unterjochten Griechen in ihrem Kampf gegen die Barbaren
zu helfen. Das Argument der Dankesschuld,
22
das im Gedicht Der Grie-
chen Klage ausdrcklich ausgesprochen wird, durchzieht alle Gedichte:
Habet mit dem Volk erbarmen,
Welchem ihr verdankt das Licht!
23
Dabei war Ludwig fr manche Unvollkommenheit der Griechen nicht
blind. Das veranschaulichen einige Gedichte, die nicht unbedingt zu
den Hellas-Gedichten zhlen. Whrend er z. B. in Ideal und Phantasie be-
merkt:
Zu dem Bltheleben der Hellenen
Senket sich das heisse, tiefe Sehnen,
[]
Ach! Uns trumt von nie gewesnen Glcke,
Sehn das Holde, nicht der Griechen Tcke,
24
weist er in einer Funote zum Gedicht Die antike Welt ablehnend auf die
Sklaverei in der Antike hin: [] die Millionen, die vielen Millionen
Sklaven, die blo als Sache betrachtet wurden, sind nicht zu vergessen;
sie allein schon bilden die Schattenseite.
25
Es handelt sich dabei um
einen Aspekt, der von den Zeitgenossen meist bersehen oder zumindest
verschwiegen wurde abgesehen von wenigen bemerkenswerten Ausnah-
men, man denke z. B. an Ernst Moritz Arndt,
26
dessen Werk zu den Lieb-
21
S. hierzu Lbker, Friedgar: Antike Topoi und Reminiszenzen in der deutschen Philhelle-
nenliteratur zur Zeit des griechischen Unabhngigkeitskrieges (18211829): Untersuchun-
gen zur Antikerezeption. Diss. Mnster 1998.
22
S. hierzu Heyer, Friedrich: Das philhellenische Argument: ,Europa verdankt den
Griechen seine Kultur, also ist jetzt Solidaritt mit den Griechen Dankesschuld?.
In: Evangelos Konstantinou (Hrsg.): Die Rezeption der Antike und der europische
Philhellenismus. Frankfurt a.M. u. a. 1998, S. 7991.
23
In: Gedichte des Knigs Ludwigs I. von Bayern, 2. Theil, S. 33.
24
In: Ebd., 1. Theil, S. 256257.
25
In: Ebd., 4. Theil, 1847, S. 40. Hinweis bei Erb, Andreas: ,Vergangenheit wird Gegen-
wart. Studien zum Geschichtsbild Ludwigs I. von Bayern. Mannheim 1999, S. 173.
26
Siehe Erb: ,Vergangenheit wird Gegenwart, und v. Hippel, Wolfgang: Das Land der
Griechen mit der Seele suchend? Das klassische Griechenland im Spiegel frh-
liberaler Weltanschauung, in: Reinhard Stupperich (Hrsg.): Lebendige Antike.
Auf Hellenen! Zu den Waffen alle 283
lingslektren des Monarchen gehrte. Seine Wahrnehmung Griechen-
lands erfuhr auch keine magebliche Vernderung, als der Traum von
Hellas zu einer Realitt wurde: weder als Ludwig I. 18351836 zum ersten
und letzten Mal nach Griechenland reiste und mit dem zerrtteten
Zustand des Landes konfrontiert wurde;
27
noch als sein Sohn Otto und
indirekt er selbst 1843 mit der Oktroyierung der Verfassung einen
schweren politischen Niederschlag erlebte. Da er bei dieser Gelegenheit
die Griechen, durch die er an die revolutionren Umtriebe im eigenen
Land Anfang der dreiiger Jahre erinnert wurde, mit den Pflzern ver-
glich,
28
entbehrt nicht einer gewissen Komik. Mag er sie aber im spten
Gedicht An Hellas im Jahre 1846 der Undankbarkeit bezichtigt haben, be-
wunderte er weiterhin diese an Mut ihren Vorfahren ebenbrtigen Hel-
den, und auch seine Bewunderung fr das alte Griechenland als Sitz der
Kunst und Wissenschaft blieb bestehen:
Fhlend was einstens sie war, fhlte frs jetzige ich;
Haben Hellenen sich gleich undankbar den Teutschen bewiesen,
Mindere aber darum unsre Teilnahme es nicht. []
Machen wir uns nicht selbst der Undankbarkeit schuldig,
Kam aus Hellas uns doch Kunst und Wissenschaft her;
Ja! Das Herrlichste alles, wir haben es Hellas zu danken.
Obgleich fleckenlos nicht, glnzet die Sonne doch hehr.
29
Rezeption der Antike in Politik, Kunst und Wissenschaft der Neuzeit. Mannheim 1995,
S. 153172.
27
Nicht nur legt Ludwig I. in manchen Gedichten, die auf Griechenland verfat
wurden, einen in Bezug auf den Wiederaufbau des Landes bemerkenswerten
Optimismus an den Tag, sondern diese Reise soll fr ihn auch eine Gelegenheit
gewesen sein, Vorurteile gegenber den Griechen zu korrigieren. S. hierzu Goll-
witzer: Ludwig I. von Bayern, eine politische Biographie, S. 484. ber diesen Aufent-
halt ist leider auer dem, was den Gedichten zu entnehmen ist und neben dem
Teilbericht eines Begleiters des Knigs wenig bekannt (Siehe Ross, Ludwig: Grie-
chische Knigsreisen, 1. Band. Reisen des Knigs Otto und der Knigin Amalia in Grie-
chenland. Halle 1848, S. 119142: 1836. Reise Seiner Majestt des Knigs Ludwig von
Bayern durch die Zykladen nach Argos und Korinth.). Ludwigs I. Tagebcher sind fr
die direkte Einsichtnahme gesperrt, was eine Analyse seiner Wahrnehmung der
Neugriechen erschwert.
28
Siehe Gollwitzer: Ludwig I. von Bayern, eine politische Biographie, S. 855.
29
In: Gedichte des Knigs Ludwigs I. von Bayern, 4. Theil, S. 327.
284 Marie-Ange Maillet
3. Patriotische und christlich-religise Motive
in den Hellas-Gedichten
Die Untersuchung der Hellas-Gedichte Ludwigs I. ist von besonderem
Interesse, weil sie die Beweggrnde seines politischen Philhellenismus
eindeutig dokumentieren und dadurch zu einem historische[n] Denk-
mal des Zeitgeistes
30
werden, wie ein damaliger Rezensent schrieb. Am
deutlichsten ist dabei ihre patriotische und christlich-religise Ausrich-
tung.
Es ist kein Geheimnis, da der bayerische Monarch von jeher ein lei-
denschaftlicher Patriot war ein Patriotismus, der in seinem frh ge-
weckten, durch seine Bekanntschaft mit dem Historiker Johannes von
Mller gefrderten Interesse fr die Geschichte grndete, sich aber auch
aus seinem Selbstverstndnis als Erbe einer alten Knigsfamilie und aus
dem Schicksal seines Vaterlandes speiste. Whrend sein Vater, der Knig
Maximilian I. Joseph, ein begeisterter Anhnger Napoleons war und
sich in Bayern in religisen und politischen Dingen am franzsischen
Modell zu orientieren suchte, wurde der Patriotismus des Kronprinzen
entscheidend durch seine Bekanntschaft mit Napoleon im Jahre 1806
gefrdert. Sein erzwungener Aufenthalt in der Pariser Hauptstadt, von
dem sich Maximilian I. Joseph erhoffte, er wrde seinen Sohn dem fran-
zsischen Kaiser nahe bringen, war ein regelrechtes Fiasko und diente le-
diglich dazu, ihm den Korsen, wie er Napoleon in seinen Gedichten
stndig nennt, noch verhater zu machen. Als die Koalitionskriege aus-
brachen, war Ludwig einer der ersten, der zum Kampf gegen Frankreich
aufforderte. Seine Haltung wird in vielen damals verfaten Gedichten
belegt, am bekanntesten sind wohl die ersten Zeilen des Gedichts An die
Teutschen, im Mrz 1807 mit den aufrttelnden Versen:
Auf, Ihr Teutschen! Auf, und sprengt die Ketten,
Die ein Corse euch hat angelegt!
Eure Freyheit knntet ihr noch retten,
Teutsche Kraft, sie ruhet unbewegt.
31
Wie viele seiner Zeitgenossen wurde der Kronprinz beim Ausbruch des
griechischen Aufstands an die deutschen Befreiungskriege erinnert: ein
unterdrcktes Volk, vereint im Gedanken an das Vaterland, stand gegen
30
Siehe Lautenbacher: Die Gedichte des Knigs Ludwig von Bayern, in: Flora,
Nr. 81 vom 23. 04. 1829.
31
In: Gedichte des Knigs Ludwigs I. von Bayern, 1. Theil, S. 46.
Auf Hellenen! Zu den Waffen alle 285
den Eroberer auf, um seine Freiheit zurck zu erlangen. Deshalb hatte
Ludwig die noch junge deutsche Geschichte im Sinne, als er in dem Ge-
dicht An Hellas. Im Frhling des 1821.sten Jahres ber den Konflikt zwi-
schen Trken und Griechen schrieb:
Nicht dem Korsen durft der Ruhm gebhren,
Dich aus deiner Sklaverey zu fhren,
Hellas, htt in neue dich gebannt.
32
Der Publizist Joseph Grres, der in der katholischen Eos eine lange Re-
zension der Gedichte des Knigs verffentlichte, machte selbst auf diese
Parallele aufmerksam, wobei er fr eine gewisse Griechenlandmode
nur bissige Worte brig hatte und heftig gegen die Wut der Deutschen
polemisierte, die der hellenische Freiheitskampf dazu gefhrt hatte,
den alten, ohnehin schon obsolet gewordenen Enthusiasmus mit
einem neuen zu stillen, den furor teutonicus in einen hellenischen fu-
rore umzuwandeln.
33
Jedoch galten die Worte des patriotisch gesinnten
Publizisten und frheren Herausgebers des Rheinischen Merkurs was
ihm den Namen eines vierten Alliierten im Kampfe gegen Napoleon
eingebracht hatte , nicht dem bayerischen Monarchen, dessen Grie-
chenlandliebe er in jener Rezension als eine hhere Form der Vater-
landsliebe auffasst; sie galten vielmehr einer als wankelmtig und leicht-
sinnig empfundenen deutschen ffentlichkeit, die in Grres Augen
einem groen Kind hnlich war, das an seiner Puppe kein Gefallen
mehr hatte und 1829 sich schon nach einer Neuen umsah.
In den Hellas-Gedichten wird vor allem ber die religise Thematik
die Parallele zwischen dem Schicksal der griechischen und der deut-
schen Nation hervorgehoben. Mit der vielsagenden Zeile: Der Teutsch-
land half, wird Hellas retten schliet die letzte Strophe des Gedichts
Zuruf an die Hellenen im Sommer 1822. Ansonsten wird diese hnlichkeit
zwischen der Lage beider Nationen zwar selten explizit thematisiert; be-
rcksichtigt man aber die textuelle Umgebung der Gedichte die nicht
als Einzelverffentlichung gedacht worden waren fallen die Parallelen
zwischen beiden Kriegen auf. Zu diesem Eindruck einander korrespon-
dierender Gedichte trgt auch nicht wenig die Tatsache bei, da in
manchen Italiengedichten der Gegensatz zwischen antikem Rom und
antikem Griechenland thematisiert wird und der Hervorhebung des Ge-
gensatzes zwischen Deutschland und dem franzsischen Kaiserreich
32
In: Ebd., 2. Theil, S. 2.
33
Grres, Joseph: Die Gedichte des Knigs Ludwig, in: Eos, Nr. 75 (11. 05.
1829)-Nr 90 (06. 06. 1829), hier Nr. 76 vom 13. 05. 1829.
286 Marie-Ange Maillet
dient.
34
Auch die Tatsache, da diese Verse eines dilettantischen Dichters
nicht selten Originalitt vermissen lassen und Wiederholungen kaum ver-
meiden, trgt dazu bei, da zwischen den Deutschland- und Griechen-
landgedichten viele wortwrtliche Anklnge zu finden sind, sei es im
Aufruf an die Griechen,
35
in der Anspielung auf die Schmach der Un-
terjochung, der Knechtschaft und der Sklaverey, sei es in dem Bezug auf
einen heiligen Krieg oder in der Feststellung, der freie Tod sei einem Le-
ben als Sklave vorzuziehen. Und wenn Ludwig I. im Gedicht Hellas schn-
ste Zeit, einen weiten Bogen spannend, von der Vaterlandsliebe, die die
Griechen einst dazu bewog, gemeinsam gegen den persischen Eroberer zu
kmpfen, zum grlich brudermrderische[n] Streit bergeht, der sp-
ter zwischen Sparta und Athen entbrannte und das Ende von Hellas
schnste[r] Zeit bedeutete, ist dies zwar als Warnung an die Neugriechen
gemeint, damit sie ihre schne Einigkeit bewahren, soll aber gleichzeitig
an die Geschichte Deutschlands erinnern. Das Wort brudermrderisch
wird brigens in einem spteren Gedicht, Lesend in Theodor Krners Leyer
und Schwert
36
wieder auftauchen, diesmal auf die deutschen Staaten be-
zogen. Aus all dem lt sich erklren, da Bezge auf andere Befreiungs-
kriege in den Gedichten des Knigs eher selten anzutreffen sind die ein-
zige Ausnahme bildet die Anspielung auf das Schicksal der antiken
keltiberischen Stadt Numantia und den heldenmtigen und verzweifelten
Widerstand ihrer Bewohner gegen den rmischen Eroberer im Jahre 133
v. Christus in dem Gedicht Nach Ipsaras Fall.
37
34
So wird z. B. in der vierten Syzilianische Elegie (Syrakus) das abtrnnige Verhalten
mancher deutscher Staaten in der napoleonischen Kaiserzeit am Beispiel Hie-
rons, des Knigs von Syrakus, der eine Verbindung mit Rom einging, angepran-
gert: In Hierons Benehmen gen Rom erscheinet uns jenes | Schon der Frsten in der Napo-
leonischen Zeit.| Syrakus fiel und fallen gemut auch htten die Frsten. In: Gedichte des
Knigs Ludwigs I. von Bayern, 2. Theil, S. 46.
35
Der Vers Auf, Hellenen! Zu den Waffen alle! in An Hellas. Im Frhling des
1821.sten Jahres scheint z. B. eine Antwort auf den schon zitierten Vers aus An die
Teutschen. Im Mrz 1807 (Auf, Ihr Teutschen! Auf ) zu sein.
36
In: Gedichte des Knigs Ludwigs I. von Bayern, 3. Theil, 1839, S. 229.
37
Ob diese Parallele von den spanischen Philhellenen der zwanziger Jahre als lite-
rarisches Motiv angewendet wurde, konnte nicht ermittelt werden. Interessant ist
dieser Bezug, insofern spanische Historiker von den dreiiger Jahren an Verbin-
dungen zwischen dem Heldentod der Keltiberiker und dem spanischen Befrei-
ungskampf gegen Napoleon hergestellt haben sollen. Die Frage bliebe also, ob
Ludwig I. den Widerstand der Keltiberiker schon in diesem Sinne gedeutet haben
knnte. Siehe dazu Brinkmann, Sren: Spanien, fr Freiheit, Gott und Knig,
in: Monika Flacke (Hrsg.): Mythen der Nationen: ein europisches Panorama. Mn-
chen 2001, S. 476501, hier S. 478.
Auf Hellenen! Zu den Waffen alle 287
Vor diesem Hintergrund versteht man Ludwigs Philhellenismus besser.
Den Kampf der Griechen untersttzte derjenige, der am liebsten selbst
das franzsische Joch htte abschtteln mgen, als patriotisch beding-
ten Kampf um die Freiheit aber auch der Christ, der seinen Brdern
in Christo, wie er sie 1826 im Aufruf des Zentral-Griechenvereins ge-
nannt hatte, Hilfe leisten wollte und dabei den griechischen Aufstand
buchstblich als heiligen Krieg auffasste. Tatschlich ist der Bezug auf
das Christentum in den Hellas-Gedichten keineswegs eine bloe For-
mel, sondern entspringt der tiefen Religiositt, die den bayerischen
Knig erneut im Gegensatz zu seinem Vater charakterisierte. In
kaum einem Hellas-Gedicht aus den zwanziger Jahren fehlt eine Anspie-
lung auf die Religion oder ein Bekenntnis zum Christentum: Whrend
in zahlreichen Gedichten Gottes Macht auf pathetische Weise beschwo-
ren wird,
38
wird die Mrtyrermetaphorik noch vor Missolunghis Fall
reichlich benutzt und der Triumph im Jenseits gegen die irdische Nie-
derlage ausgespielt, wie etwa in dem Gedicht Das Rothe Kreuz:
Und weil ihr auf das Irdische verzichtet,
So ward das Himmlische von euch errungen.
39
Neben gelegentlichen und eher grotesk klingenden Anspielungen auf
Hlle und Engel
40
wird Griechenland z. B. in Zuruf an die Hellenen
im Sommer 1822 durch den Bezug auf Paulus ausdrcklich als Wiege des
Christentums dargestellt, whrend im Gedicht Das Rothe Kreuz von der
frohe[n] Botschaft Gottes die Rede ist dem Evangelium, wie der
Dichter in einer Anmerkung erklrend hinzufgt. Und im ersten Gedicht
der Sammlung tritt der Knig sogar als Anhnger eines groen Griechen-
lands auf, der das Kreuz bis auf Sofias Spitze herrschen sehen mchte:
Und die alte Zeit wird wieder neu,
Von der Kunst und Wissenschaft die Sitze
Werdet ihr und von Sophias Spitze
Leucht das Kreuz auf Vlker, welche Frey!
41
38
Siehe etwa das Gedicht An die Hellenen: Dem, der geistestrunken | Glht von Himmels-
funken,| hat der Sieg gewunken,| dem nur, der vertraut.| Schmhlich endet prunken | Dess,
der auf sich baut.| Glaubet dem, der droben |In dem Himmel oben. In: Gedichte des Knigs
Ludwigs I. von Bayern, 2. Theil, S. 6.
39
Ibidem, S. 11.
40
Siehe das Gedicht Zuruf an die Hellenen: Die Hlle jauchzt, die Engel trauern,| Es
seufzt, gehemmt, die Menschheit mit,| Es jubelt in der Schlsser Mauern,| Weil Hellas der
Barbar zertritt. In: Gedichte des Knigs Ludwigs I. von Bayern, 2. Theil, S. 8.
41
An Hellas. Im Frhling des 1821.sten Jahres, in: Gedichte des Knigs Ludwigs I. von
Bayern, 2. Theil, S. 4.
288 Marie-Ange Maillet
Der Bezug auf das Christentum, als humanitre uerung verstanden,
42
dient auch bei Ludwig I. dem Appell an die Menschlichkeit seiner euro-
pischen Mitmenschen, um die Griechen vor der Barbarey des Erobe-
rers zu schtzen:
Ist dann Dankbarkeit verschwunden,
Wird kein Mitleid mehr empfunden,
Ist vertilgt der Christen Bund?
Wird Europa nicht genesen []?
43
Wie illusorisch eine solche Einigkeit aller Christenvlker war, ist be-
kannt, und wird durch die weitere Enwicklung der Geschichte Bayerns
in Griechenland veranschaulicht: whrend Ludwig I. im Jahre 1829, also
kurz vor Friedenschlu, dem Zaren Nikolaus I. ein begeistertes Gedicht
schrieb, in dem er ihn wiederholt als Sieger ber den Moslemtische[n]
Tiger und Befreier des Mohametamsche[n] Joch[s] bezeichnet, ja in
ihm einen Cherub mit dem heilgen Flammenschwerdte (!) sieht,
44
sollten 1832 im Zusammenhang mit den Verhandlungen ber Ottos
Konfession zwischen Bayern und Russland Zwistigkeiten offenkundig
werden, die bis in die vierziger Jahre hinein fr Polemik sorgten.
45
4. Schlubetrachtung:
Zur Deutung des ludovizianischen Philhellenimus
Nicht alle Rezensionen der Gedichte Ludwigs I., die 1829 verffentlicht
wurden, beschftigen sich ausfhrlich mit den Hellas-Gedichten und
nehmen Stellung zur Frage des Philhellenismus des bayerischen Knigs.
Die wenigen aber, die es tun, machen deutlich, wie sehr die Vielseitig-
keit seiner Motivation der Rezeption zugute kam und geeignet war, die
Gunst der verschiedensten Rezipientenkreise auf den Monarchen zu
lenken. Von besonderem Interesse sind in dieser Hinsicht die Bespre-
chungen zweier schon erwhnter und zu den Leitfiguren antagonisti-
42
Zu diesem und anderen gngigen Argumenten der philhellenischen Propaganda
in der Zeit der griechischen Befreiungskmpfe, siehe Irmscher: Das Antikebild
des deutschen Philhellenimus, S. 125.
43
Der Griechen Klage Im Frhling 1826, in: Gedichte des Knigs Ludwigs I. von Bayern
2. Theil, S. 32.
44
In: Gedichte des Knigs Ludwigs I. von Bayern, 3. Theil, S. 150.
45
Zu den Problemen um die Konfessionsfrage, siehe Gollwitzer: Ludwig I. von Bay-
ern, eine politische Biographie, S. 476477.
Auf Hellenen! Zu den Waffen alle 289
scher Lager zhlenden Persnlichkeiten, Friedrich Thiersch und Joseph
Grres. Neben seinem konkreten und publizistischen Einsatz fr die
Griechen war Friedrich Thiersch damals der Leiter des philologischen
Seminars und Anreger der humanistischen Reform der Mnchener Uni-
versitt; seinen Enthusiasmus fr den griechischen Befreiungskampf
teilte er mit anderen ebenso wie er gemigt-liberalen Persnlichkei-
ten der Mnchener Kulturszene, etwa dem Herausgeber Johann Fried-
rich, Cotta. Auf der anderen Seite war Joseph Grres, der selbst an der
Mnchener Universitt auf dem Lehrstuhl fr Geschichte wirkte und
dabei das Ziel verfolgte, die bayerische Hauptstadt zur Hauptstadt des
politischen Katholizismus in Deutschland zu machen. Er wurde neben
Persnlichkeiten wie dem spter berhmt gewordenen Theologen Ignaz
Dllinger der Opposition zugerechnet. Erst im Laufe der dreiiger und
vierziger Jahre, als Ludwig I. einen politisch hrteren Kurs einschlug und
Thiersch gezwungenerweise in den Rang der Opposition geriet, sollte
der Gegensatz zwischen beiden Fronten offensichtlich werden.
46
In den
zwanziger Jahren war er noch hauptschlich mit dem Thema Griechen-
land verbunden und dies sowohl in politischer als auch in sthetischer
Hinsicht, man denke z. B. an die Begeisterung der Mnchener Katholi-
ken fr die Kunst der Nazarener und ihre Ablehnung der grzisierenden
Kunststhetik Leo von Klenzes. Der Philhellenismus des Knigs bot
aber gengend Nhrstoff fr unterschiedliche Gesinnungen.
Schon im Mrz 1829 lie Thiersch seine Besprechung im Inland er-
scheinen, einer Zeitschrift, die, als halb-offizielles Organ konzipiert,
von den Publizisten des Cotta-Verlags redigiert wurde. Kurz zuvor hatte
brigens dieses Blatt wegen einer heftigen Polemik mit der katholischen
Zeitschrift Eos von sich hren lassen demselben Organ, in dem Grres
im Mai seine eigene Rezension verffentlichte. Interessant ist in diesem
Zusammenhang die Art, wie Thiersch und Grres in ihren Kritiken je-
weils den Philhellenimus Ludwigs I. besprechen. Obwohl in den knig-
lichen Gedichten der christlichen Thematik ein starkes Gewicht zu-
kommt und Thiersch in den Artikeln, die er in den ersten Jahren des
Freiheitskampfes verffentlicht hatte, das christliche Argument selbst
sehr geschickt zu benutzen gewut hatte,
47
lt er es hier kaum zur Gel-
46
Fr die Beschreibung des politischen und kulturellen Lebens in Mnchen zur
Zeit Ludwigs I., siehe Maillet, Marie-Ange: Heinrich Heine et Munich, CNRS-di-
tions. Paris 2004.
47
S. hierzu u. a. Karagiannis-Moser, Emmanuelle: Friedrich Thiersch et la question grec-
que. Nice 1999, S. 165 ff.
290 Marie-Ange Maillet
tung kommen, sondern rckt es deutlich in den Hintergrund zugunsten
einer ausfhrlichen Beschreibung der klassizistischen Anschauung, die
dem Philhellenismus des Monarchen zu Grunde liegt. So zeigt sich der
Philologe voll des Lobes fr Gedichte, denen Spuren der Liebe, der Be-
wunderung, der Verehrung des hellenischen Alterthums und seiner Vor-
trefflichkeit eingedrckt [sind], so wie das tiefste Gefhl der Teilnahme
am Geschick der Griechen. Das Gewicht wird hier also ganz bewut auf
Ludwigs sthetischen Philhellenismus und auf seinen praktischen Ein-
satz fr die Griechen verlegt wobei gleichzeitig strategisch die politi-
sche Harmlosigkeit der philhellenischen Bewegung unterstrichen wird:
Der Philhellenismus, schreibt Thiersch, wird das Glck, die Ruhe und
die Ehre von Europa fester grnden und bewahren.
48
Einen vllig anderen
Ton lt die Rezension Grres vernehmen, in der zum Teil die Stimme
konservativer Kreise, die der Griechenbegeisterung mitrauisch gegen-
berstehen, hrbar wird. So uert einer der Protagonisten des dort in-
szenierten fiktiven Gesprchs:
So gespannt und unsicher ist die Lage der gesellschaftlichen Verhltnisse durch
ganz Europa, so schlecht befestigt, ruht der Bau der Staaten auf seinen unterwhl-
ten Grundlagen [], da man dem Lebensgefhle in ihnen es nicht verargen kann,
wenn es bei jeder heftigen, raschen Bewegung, die irgendwo ausgeht, gleich mit in-
stinktartiger Befrchtung zusammenfhrt und blen Ausgang drohen sieht [].
49
Dadurch, da er den Philhellenismus des Knigs befrwortet, erkennt
zwar dieser Sprecher indirekt, da der Regent nichts Revolutionres
will; aber diese Befrwortung selbst ist darauf zurckzufhren, da er
ihn ausschlielich im Sinne eines christlichen Einsatzes gegen den Islam
deutet. So spielt er hier z. B. auf den Kampf zwischen Sarazenen und
Christen im alten Hispanien an, ja er greift sogar auf die vorchristliche
Zeit zurck, um die Gefahr zu unterstreichen, die mit dem Krieg zwi-
schen Rom und Karthago fr das christliche Europa verbunden war:
48
Thiersch: ber die Gedichte seiner Majestt des Knigs Ludwig von Bayern
(Markierung durch M-A. M.). In den Artikeln, die er im Jahre 1821 fr die Augs-
burger Allgemeine Zeitung geschrieben hatte, hatte sich Thiersch bereits bemht,
das Hauptargument der Gegner der philhellenischen Bewegung (an erster Stelle
Metternich und der russische Tsar Alexander I.), fr die der Griechenenthusias-
mus ein revolutionres Potenzial barg, zu entkrften, indem er den Zusammen-
hang zwischen griechischem Aufstand und italienischen Revolutionen zurck-
gewiesen und die griechischen Befreiungskriege mit der Befreiung der Russen
von den Mongolen verglichen hatte. Dazu Gollwitzer: Ludwig I. von Bayern, eine
politische Biographie, S. 473.
49
Grres: Die Gedichte des Knigs Ludwig in: Eos, Nr. 75 vom 11. 05. 1829.
Auf Hellenen! Zu den Waffen alle 291
Wissen wir doch alle recht wohl, was Europa und uns in ihm bevorstan-
den, htte Karthago in jenem blutigen Kampfe mit Rom gesiegt. Da
Grres die Schwrmerei seiner Landsleute nicht teilte, zeigt einerseits
die Fehde, die er in seiner Besprechung von einem weiteren Protagoni-
sten des Gesprchs mit den Griechenlandenthusiasten fhren lt ins-
besondere mit den Philologen, die an die Spitze des Zuges traten aber
mit Worten nur verkehren
50
und andererseits die Tatsache, da der
sthetische Philhellenismus des Knigs mit kaum einem Wort erwhnt
wird.
51
Wie Wolfgang Frhwald mit Recht betonte, kann dieser Aufsatz
schon allein durch Grres Besprechung der Philhellenismus-Frage
als ein kaum versteckter Appell des zur Opposition zugerechneten
Katholiken an den bayerischen Knig verstanden werden, von dem er
sich eine politische Annherung erhoffte. Schlielich sei eine andere, im
April zwischen Thierschs und Grres Rezension im Unterhaltungsblatt
Flora erschienene Besprechung erwhnt, die ihrerseits die eindeutig kon-
servative Einstellung des Verfassers erkennen und die christliche Fun-
dierung von Ludwigs Philhellenismus zur Geltung kommen lie: Der
Monarch wurde dort nmlich als ein Frst beschrieben, der die groe
Anregung seines Jahrhunderts begreift, den Keim des Gttlichen er-
kennt, der in den Gemthern der Vlker hervorbricht und mit der un-
widerstehlichen Kraft eines im Glauben erstarkten und geluterten Wil-
lens [] sich erhebt ber die eigenntzigen und kleinlichen Ansichten
50
Interessant an diesem erbitterten Feldzug gegen die Philologen (zu denen Thiersch
bekanntlich gehrte) ist nicht nur Grres Kritik am oft nur publizistischen Enga-
gement seiner Landsmnner, sondern auch die Tatsache, da er ihre Schwarz-
weimalerei der Trken und Griechen entschieden ablehnt: Da wurden nur
grimmige Blicke mit den Trken gewechselt und spitze Worte wie Lanzen auf sie
hingeworfen, mit Flchen und Verwnschungen wurden sie gebunden, und Ru-
nen in Stbe gegen sie geschnitten, und Nestel gegen sie geknpft. Den Griechen
aber wurde uneigenntzig mit allem Rathe beygesprungen, der uns zu Hause
berflig zurckgeblieben, weil wir keinen Gebrauch davon gemacht; Brosch-
ren ohne Zahl wurden ihnen zu Hilfe zugesendet, Osterprogramme wurden als
schwere Artillerie hinter ihnen aufgefahren. [] Aufs sorgfltigste wurden alle
Hellenen, deren man habhaft wurde, blank und wei gescheuert; den Trken aber
die schmutzige Brhe all ber dem Leib geschttelt, dass sie schwarz anliefen wie
die Neger aus dem Mohrenlande. In: Grres: Die Gedichte des Knigs Lud-
wig, in Eos, Nr. 76 vom 13. 05. 1829.
51
Zu Grres Haltung gegenber der philhellenischen Bewegung, siehe Hauser,
Hans-Christoph: Anfnge brgerlicher Organisation. Philhellenismus und Liberalismus
in Sddeutschland. Gttingen 1990, S. 223. Laut Hauser hat sich Grres im Jahre
18211822 geweigert, einen Hilfsausruf fr die Griechen zu verffentlichen.
292 Marie-Ange Maillet
einer ngstlichen Staatsklugheit.
52
Eine solche Betrachtungsweise
drfte im katholischen Mnchen viel Resonanz gefunden haben.
Natrlich wre es einerseits ein schweres Miverstndnis gewesen,
htte man in dem bayerischen Monarchen einen Revolutionr gesehen,
dessen Philhellenimus auf den Umsturz der europischen Ordnung
zielte. Sowohl Thiersch als auch Grres zeigen sich in ihren Rezensio-
nen bemht, diese Kritik zu entschrfen. Mochte sich der bayerische
Monarch fr die Freiheit der Griechen einsetzen, seine Gedichte zei-
gen deutlich, da er, der brigens ein treuer Anhnger des monarchisti-
schen Prinzips war, diese Freiheit lediglich als eine Befreiung von der
Tyrannei verstand.
53
Man darf andererseits aber auch nicht vergessen,
da Ludwig I. bis zur Wende der Julirevolution im Jahre 1830 fest
davon berzeugt war, da eine christliche Gesinnung, verbunden mit
einem autokratischen Bewutsein, sich durchaus mit einer gemigt
liberalen Gesinnung vertrug. Wenn er als tief glubiger Monarch nach
seiner Thronbesteigung bemht war, die neue Orientierung seiner Re-
gierung durch eine Reihe von symbolischen Manahmen zu bekunden
z. B. dadurch, da er die von seinem Vater durchgefhrte Skularisie-
rung zum Teil rckgngig machte und manche katholische Traditionen
wieder einfhrte , scheute er nicht davor, die Zensur partiell aufzuhe-
ben oder bei den Landtagssitzungen manche Priviligien des Adels anzu-
tasten. Auch hatte er sich frher als Kronprinz fr den Erla einer Ver-
fassung eingesetzt, die den Bayern mglichst viele Freiheiten gewhren
sollte, und gerade dies, wie sein Engagement in den Befreiungskriegen,
hatte ihn bei Metternich, der ihn als einen Anhnger turbulenter libe-
raler Grundstze
54
ansah, hchst unbeliebt gemacht. So autokratisch
und religis er auch sein mochte, er geno also in den ersten Jahren
nach seiner Thronbesteigung den Ruf eines liberalen Monarchen, den
52
Lautenbacher: Die Gedichte des Knigs Ludwig von Bayern, in: Flora, Nr. 81
vom 23. 04. 1829.
53
Das Problem der Deutung des griechischen Freiheitskampfs, bzw. die Frage, ob
man ihn als etwas Legitimes oder als Rebellion auffassen sollte, wurde in der phil-
hellenischen Propaganda der zwanziger Jahre immer wieder aufgegriffen. Dazu
siehe Hauser: Anfnge brgerlicher Organisation, S. 198199; oder Spaenle, Ludwig:
Der Philhellenismus in Bayern 18211832. Mnchen 1990, S. 158159.
54
Zitat in: Kraus, Andreas: Der liberale Kronprinz, in: Zeitschrift fr bayerische Lan-
desgeschichte 58/1995, S. 3979, hier S. 41. Zum Liberalismus des Knigs Ludwig I.,
siehe auch u. a. Gollwitzer [Anm. 18] S. 213ff. und Spindler, Max: Handbuch
der bayerischen Geschichte. Das neue Bayern 18001970, Bd. 4. Mnchen 1974,
S. 128ff.
Auf Hellenen! Zu den Waffen alle 293
seine Begeisterung fr den Aufstand der Griechen festigte, lie sie ihn
doch als Befrworter des nationalstaatlichen Gedanken erscheinen.
55
So
schrieb der franzsische Gesandte am Mnchener Hof im Jahre 1831,
nachdem Ludwig I. einen harten, eindeutig konservativen Kurs einge-
schlagen hatte:
Si lAllemagne et continu jouir du repos quelle gotait depuis dix ans, le roi
Louis et conserv sans doute une rputation de libralisme que son exaltation
Germanique, son enthousiasme pour les Grecs et ses petites luttes contre les pri-
vilgis lui avaient acquis si peu de frais.
56
Der Philhellenismus aber, wie Treitschke einmal treffend bemerkte, war
an sich eine Bewegung, in der sich fast alle Richtungen des deutschen
Lebens [fanden]: Der Freiheitsdrang der Liberalen, die Kreuzfahrer-
gesinnung der christlichen Teutomanen und die romantische Lust am
Fernen und Wunderbaren.
57
Und gerade die Tatsache, da alle diese
Tendenzen in dem bayerischen Knig bis zum Ende der zwanziger Jahre
problemlos nebeneinander bestehen durften, ist als ein typisches Kenn-
zeichen seines Philhellenismus anzusehen.
Literaturverzeichnis
Quellen
Ludwigs I. philhellenische Gedichte
Gedichte; 2. Theil, Mnchen 1829
1. An Hellas. Im Frhling des 1821sten. Jahres
2. An die Hellenen
3. Zuruf an die Hellenen. Im Sommer 1822
4. Auf den Regen (Distichon)
5. Die Namens- und Thatenbrder (ersetzt durch: Wunsch in der 2. und
3. Auflage) (Distichon)
55
Das lassen brigens die Hellas-Gedichte ahnen, in denen wiederholt betont wird,
da das griechische Volk sich selbst vom Eroberer befreien und keinem neuen
Staat unterjocht werden solle (siehe zum Beispiel die Gedichte An Hellas. Im Frh-
ling des 1821.sten Jahres; An die Hellenen; An die Hellenen. Im Frhling 1825; Herbstlied
an die Hellenen [])
56
In: Anton Chroust: Gesandtschaftsberichte aus Mnchen. Berichte der franzsischen
Gesandten. Mnchen 19351936, Brief vom 22. 07. 1831, Bd. 2, S. 433.
57
Heinrich von Treitschke, Zitat von Lampros Mygdalis: Ersatzweg Hellas, in:
Otto Borst (Hrsg.): Aufruhr und Entsagung: Vormrz 18151848 in Baden und Wrt-
temberg. Stuttgart 1992, S. 106127, hier S. 127.
294 Marie-Ange Maillet
6. An Homer, dessen Brustbild in einer meiner Arbeitsstuben steht (Distichon)
7. Das rothe Kreuz. XXXIII. Sonett
8. An Hellas. Im dritten Frhling ihrer Wiedergeburt
9. Herbstlied. An die Hellenen
10. An Hellas. Im vierten Jahr ihrer Befreyung
11. Nach Ipsaras Fall
12. An die Hellenen. Im Frhling 1825
13. Zuruf an die Hellenen, als Ibrahim Pascha in der Peloponnes eingedrungen
ist
14. Auf die Verbrennung trkischer Schiffe
15. Auf Navarinos Einnahme
16. Missolunghi nach abgeschlagenem Sturm
17. An die Hellenen, da ich Knig
18. Trost an die Hellenen. Im April 1826
19. Der Griechen Klage. Im Frhling 1826
20. Da sichs zeigte, da Missolunghis Erstrmung eine Lge war
21. Nachruf an Missolunghi
Weiterhin im Band enthaltene Gedichte, die in der 2. und 3. Auflage dem Zyklus einver-
leibt wurden:
22. Des Hellenischen Abzeichens Farbe (Distichon)
23. Hellas betreffend (Distichon)
24. Auf Missolunghis Eroberung durch die Hellenen im Jahre 1829 (erst in der
3. Auflage)
Gedichte, 3. Theil, Mnchen 1839
1. Hellas schnste Zeit
2. An Hellas nach geendigtem Kampf
3. Auf Athen
4. An Smyrna
5. In Hellas
6. Abschied von Athen
Gedichte, 4. Theil, Mnchen1847
1. An Hellas im Jahr 1846
Zeitschriften
Eos, eine Zeitschrift aus Baiern, zur Erheiterung und Belehrung. Mnchen 18181832.
Flora, ein Unterhaltungsblatt. Mnchen, 18201833.
Das Inland, ein Tagblatt fr das ffentliche Leben in Deutschland, mit vorzglicher Rcksicht
auf Bayern. Mnchen 18291831.
Jahrbcher fr wissenschaftliche Kritik, hrsg. von d. Societt fr Wissenschaftliche Kritik. Ber-
lin 18271846.
Zeitung fr die elegante Welt. Berlin 18011859.
Bcher
Ludwig I, Knig von Bayern: Gedichte des Knigs Ludwigs I. von Bayern. Mnchen, 1.
und 2. Theil, 1829 (1. und 2. Auflage) und 1839 (3. Auflage); 3. Theil, 1839; 4. Theil,
1847.
Ludwig I, Knig von Bayern: Posies du roi Louis de Bavire, trad. de William Duckett,
2. vol. Paris 1829/1830.
Auf Hellenen! Zu den Waffen alle 295
Ross, Ludwig: Griechische Knigsreisen, 1. Band. Reisen des Knigs Otto und der Knigin
Amalia in Griechenland. Halle 1848 (S. 119142: 1836. Reise Seiner Majestt des
Knigs Ludwig von Bayern durch die Zykladen nach Argos und Korinth).
Forschungsliteratur
Bauer, Winfried: Die Hellas-Gedichte Ludwigs I., in: Wolf-Armin von Reitzenstein
(Hrsg.): Bayern und die Antike 150 Jahre Maximilians-Gymnasium in Mnchen.
Mnchen 1999, S. 2447.
Baumstark, Reinhold (Hrsg.): Das neue Hellas. Griechen und Bayern zur Zeit Ludwigs I.
Mnchen 2000.
Brinkmann, Sren: Spanien, fr Freiheit, Gott und Knig, in: Monika Flacke
(Hrsg.): Mythen der Nationen: ein europisches Panorama. Mnchen 2001, S. 476501.
Chroust, Anton: Gesandtschaftsberichte aus Mnchen. Berichte der franzsischen Gesand-
ten. Mnchen 19351936.
Erb, Andreas: ,Vergangenheit wird Gegenwart. Studien zum Geschichtsbild Ludwigs I. von
Bayern. Mannheim 1999.
Frhwald, Wolfgang: Der Knig als Dichter. Zur Absicht und Wirkung der Gedichte
Ludwigs des Ersten, Knigs von Bayern, in: Deutsche Vierteljahrsschrift fr Litera-
turwissenschaft und Geistesgeschichte, 50/1976, S. 127157.
Goedeke, Karl: Grundri zur Geschichte der deutschen Dichtung, Bd. XII. Berlin 1957.
Gollwitzer, Heinz: Ludwig I. von Bayern, eine politische Biographie. Mnchen
1986.
Hauser, Hans-Christoph: Anfnge brgerlicher Organisation. Philhellenismus und Libera-
lismus in Sddeutschland. Gttingen 1990.
Heyer, Friedrich: Das philhellenische Argument: ,Europa verdankt den Griechen
seine Kultur, also ist jetzt Solidaritt mit den Griechen Dankesschuld., in: Evan-
gelos Konstantinou (Hrsg.): Die Rezeption der Antike und der europische Philhellenis-
mus. Frankfurt a.M. u. a. 1998, S. 7991.
v. Hippel, Wolfgang: Das Land der Griechen mit der Seele suchend? Das klassische
Griechenland im Spiegel frhliberaler Weltanschauung, in: Reinhard Stupperich
(Hrsg.): Lebendige Antike. Rezeption der Antike in Politik, Kunst und Wissenschaft der
Neuzeit. Mannheim 1995, S. 153172.
Irmscher, Johannes: Das Antikebild des deutschen Philhellenimus in: Evangelos
Konstantinou (Hrsg.): Die Rezeption der Antike und der europische Philhellenismus.
Frankfurt a.M. u. a. 1998, S. 121138.
Karagiannis-Moser, Emmanuelle: Friedrich Thiersch et la question grecque. Nice 1999.
Konstantinou, Evangelos (Hrsg.): Die Rezeption der Antike und der europische Philhelle-
nismus. Frankfurt a.M. u. a. 1998.
Kraus, Andreas: Der liberale Kronprinz, in: Zeitschrift fr bayerische Landesgeschichte,
58/1995, S. 3979.
Lbker, Friedgar: Antike Topoi und Reminiszenzen in der deutschen Philhellenenliteratur zur
Zeit des griechischen Unabhngigkeitskrieges (18211829): Untersuchungen zur Antikere-
zeption. Diss. Mnster 1998.
Maillet, Marie-Ange: Heinrich Heine et Munich, CNRS-ditions. Paris 2004.
Mygdalis, Lampros: Ersatzweg Hellas, in: Otto Borst (Hrsg.): Aufruhr und Entsa-
gung: Vormrz 18151848 in Baden und Wrttemberg. Stuttgart 1992, S. 106127.
296 Marie-Ange Maillet
Seidl, Wolf: Bayern in Griechenland. Die Geburt des griechischen Nationalstaates und die
Regierung Knig Ottos. Mnchen 1981.
Spaenle, Ludwig: Der Philhellenismus in Bayern 18211832. Mnchen 1990.
Spindler, Max: Handbuch der bayerischen Geschichte. Das neue Bayern 18001970,
Bd. 4. Mnchen 1974.
Wnsche, Raimund: ,Lieber hellenischer Brger als Erbe des Throns? Knig Lud-
wig I. und Griechenland, in: Reinhold Baumstark (Hrsg.): Das neue Hellas. Grie-
chen und Bayern zur Zeit Ludwigs I. Mnchen 2000, S. 120.
Auf Hellenen! Zu den Waffen alle 297
III. Philologische Annherungen
298 Marie-Ange Maillet
Das griechische Volkslied Charos 299
Chryssoula Kambas
Das griechische Volkslied Charos in Goethes
Version und sein Bild des neuen Griechenland.
Mit einem Ausblick auf die
Haxthausen-Manoussis-Sammlung
Claude Fauriels zweisprachige Sammlung griechischer Volkslieder, die
Chants populaires de la Grce moderne, erschienen 1824/25 in Paris, sind bis
auf weiteres die magebliche Quelle fr das griechische Volkslied in der
Vergleichenden Literaturwissenschaft wie der Neugriechischen Philolo-
gie.
1
Die bersetzungsaktivitt des franzsischen Fremdsprachenphilo-
logen ist als ein vorbergehender Akt des europischen Philhellenismus
zu bewerten, der aber spter keine wesentliche Fortsetzung in Form der
Lehre des Neugriechischen mehr folgte.
2
Dennoch hat Fauriel, in unab-
dingbarer Zusammenarbeit mit seinem muttersprachlichen Mit-ber-
setzer Moustoxidis, seinerseits gleichfalls ein bersetzer Manzonis, et-
was Grundlegendes und Bleibendes erschlossen, dessen literarische
Folgen weit ber den Philhellenismus hinausreichen.
Goethes Aktivitt ist demgegenber eher punktuell, obgleich von der
Ausstrahlung her zumindest fr den deutschen Sprachraum eben-
falls nicht unbetrchtlich. Er nahm in einem Heft seiner Zeitschrift ber
1
Ibrovac, Miodrag: Claude Fauriel et la fortune europenne des posies populaires grecque
et serbe, tude dhistoire romantique, suivie du cours de Fauriel (La Posie populaire des
Serbes et des Grecs, professe en Sorbonne (18311832), documents indites). Paris 1966.
Als eigenstndige einsprachig griechische Ausgabe erschien Fauriels Sammlung,
komplett und kritisch ediert, erst krzlich. Fauriel, Claude: |//qvto qorto
rootto. A. H ooq rot 18241825. (Griechische Volkslieder. Die Ausgabe
von 18241825). 2 Bde. Alexis Politis (Hrsg.): Iraklio 2000.
2
Bis auf die bei Ibrovac aufgenommene Vorlesung. Eine bersicht findet sich bei
Sgoff, Brigitte: Claude Fauriel und die Anfnge der romanischen Sprachwissenschaft.
Diss. Mnchen 1994, S. 12. Zu Fauriel als Philologe vgl. Espagne, Michel: Le
paradigme de ltranger. Les chaires de littrature trangre au XIX
e
sicle. Paris 1993,
S. 2528.
300 Chryssoula Kambas
Kunst und Altertum von 1823 sechs griechische Volkslieder auf, ein un-
verkennbar philhellenischer Akt, wie er es deutlich sein sollte. Aber war
Goethe Philhellene im strengen Sinn des Begriffs, bezogen auf die Un-
abhngigkeitskriege auf griechischem Boden ab 1821 mit ihrer ganzen
Problematik hinsichtlich des europischen Staatengleichgewichts der
monarchischen Restauration seit dem Wiener Kongre? Gegenber
Kanzler von Mller uerte er am 28. 3. 1830, er danke Gott, da er
kein Philhellene sei, sonst wrde er sich ber den Ausgang des Dramas
jmmerlich rgern.
3
Es soll im Folgenden das Bild des neuen Griechenland erschlossen
werden, wie es Goethe teils in editorischer Abwgung, teils in translato-
rischer Kontingenz, teils in sprachpolitischer Sicht realisierte. Da dabei
nicht erneut der Klassizismus des Dichters der Iphigenie auf Tauris wie des
Autobiographen der Italienischen Reise als Folie und unabdingbarer Aus-
gangspunkt des Interesses am Neugriechischen in Erinnerung gerufen
werden mu, versteht sich angesichts der breitest aufgearbeiteten Anti-
kenthematik in der Literatur zu Goethe.
4
Im Sinne der Klassikidolatrie
oder des Neuhumanismus wird die Bezeichnung Philhellenismus im fol-
genden von mir nicht benutzt, sondern ausschlielich fr die europi-
sche Vereinsbewegung, einschlielich deren intellektueller und literari-
scher Selbstverstndigung zugunsten der griechischen Sache.
5
Dieser
Bewegung mit ihren literarisch intellektuellen Aktivitten stand Goethe
sehr distanziert gegenber, nicht aber der Nationswerdung und der Er-
kundung der Kultur der modernen Griechen. Dennoch sollten ihn ge-
rade die Volkslieder, wie das breite philhellenische Echo darauf zeigt,
mit der Bewegung verbinden.
Segmentartig lassen sich einzelne kulturelle Auffassungen an Form
und Sprache erkennen, wie sie der bersetzer bzw. Bearbeiter im Lied
Charos whlte. Sie berhren die neuzeitliche Vorstellungswelt des zeitge-
nssischen Griechisch als Sprache, seine Kontinuitt zum oder den
Bruch mit dem Altgriechischen, die religis christliche oder alternativ
3
Zit. nach Boyle, Nicholas: Griechischer Befreiungskampf , in: Dietrich Dahn-
ke/Regine Otto (Hrsg.): Goethe-Handbuch, Bd. 4.1. Stuttgart 1998, S. 446448.
Boyles exakter knapper Umri enthlt die entscheidenden Angaben zum histori-
schen Kontext.
4
Zur neugriechischen Volksliteratur, gewissermaen in Folge der Antikenorientie-
rung aufgefasst, siehe Mller, Heidy Margrit: Goethe en Griekenland, in: Tetra-
dio. Tijdschrift van het Griekenlandcentrum, 1994, 3, S. 101130.
5
Quack-Eustathiadis, Regine: Der deutsche Philhellenismus whrend des griechischen
Freiheitskampfes 18211827. Mnchen 1984.
Das griechische Volkslied Charos 301
heidnische Vorstellungswelt mit Blick auf die Diesseits-Jenseits-Grenze
und den Tod. Auch Goethes Verhltnis zum Volkslied als Naturpoesie
geht in seine Bearbeitung ein. Das bersetzungskonzept, und in Zusam-
menhang damit seine sprachpolitische berlegung, die man im Refle-
xionskreis Weltliteratur sehen mu, lassen sich an seiner Bearbeitung
verdeutlichen. Schlielich soll auch die Umsetzung des Motivs im sp-
teren Malwettbewerb zu diesem Gedicht einbezogen werden.
1. Die Klephtenlieder in
ber Kunst und Altertum und Charos
Die sechs griechischen Volkslieder, die Goethe in ber Kunst und Alter-
tum vor Erscheinen der faurielschen Sammlung publizierte,
6
hatte er in
der Sprache des Originals sowie in franzsischer bersetzung von Jean-
Alexandre Buchon, dem fr den Pariser Constitutionnel fr das Ausland
verantwortlichen Redakteur, auf dessen selbstttige Initiative hin zuge-
sandt bekommen. Buchon berief sich auf den Philosophen Victor Cou-
sin
7
sowie Benjamin Constant als beiden gemeinsam persnlich be-
kannte Gewhrsmnner, um die Khnheit seiner Aufforderung dem
bedeutenden Weimaraner gegenber zu rechtfertigen. Er schrieb Goe-
the: Je vous envoie ceux qui me paraissent les plus dignes de votre at-
tention. Je les ai fait copier et traduire littralement par un grec pour
quils fussent plus lisibles.
8
Goethe hat diesem Brief nach Originale,
bersetzungen und zwei Artikel ber die Lieder erhalten.
Bei der bersetzerarbeit aus dem Franzsischen hat Goethe vermut-
lich auch die Originale zu einzelnen Stellen konsultiert, zusammen mit
6
In IV/1823, 1. Goethe, Johann Wolfgang: sthetische Schriften 18211824, in:
ber Kunst und Altertum IIIIV, hrsg. von Stefan Greif/Andrea Ruhlig, in: FA,
Bd. 21, Frankfurth a.M. 1998, S. 336340.
7
Den ausfhrlicheren Kommentar zu den bersetzungen aus dem Neugriechi-
schen in der Frankfurter Goethe-Ausgabe enthlt der Band 12. Hier ist der Ansto
zu bersetzung und Abdruck, der Brief Buchons vom 3. Februar, fr das Jahr
1821 aufgefhrt. Goethe, Johann Wolfgang: Bezge nach Auen, bersetzun-
gen II, Bearbeitungen hrsg. von Hans-Georg Drewitz, in: FA, Bd. 12. Frank-
furt a.M. 1999, S. 1314f.
8
Brief von Buchon an Goethe, Paris, 3. Februar 1822. In: Politis, Alexis: H ovo-
ouj tuv rtvtuv ojottuv toyouotuv. Hoo0rort, ooo0rtr
oi ojtouyio tj utj ouoyj. (Die Entdeckung der griechischen Volks-
lieder. Voraussetzungen, Bemhungen und die Schaffung der ersten Sammlung). Athen
1984, S. 407.
302 Chryssoula Kambas
Friedrich Wilhelm Riemer, seinem altphilologischen Berater. Die ins
Deutsche bertragenen sechs Lieder fallen unter die spter von Fauriel
gewhlte Bezeichnung der historischen Lieder. Als Klephtenlieder, d. h.
Banditenlieder, meint die Selbstbezeichnung das sozialrebellische Po-
tential der Klephten im Kontext des osmanischen Systems von Herr-
schaft und berwachung. Es sind jngere Lieder, die seit den Erhebun-
gen der Griechen gegen die osmanische Herrschaft vom Ausgang des
18. Jahrhunderts datieren. Nach ihrer Anfangszeile benannt heien die
einzelnen Sind Gefilde trkisch worden (I), Schwarzes Fahrzeug teilt die Welle
(II), Beuge Liakos, dem Pascha (III, Liacos), Welch Getse, wo entsteht es (IV,
Bucovallas), Ausgeherrschet hat die Sonne (V; La mort de lArmatolos) und
Der Olympos, der Kissavos (VI, Le mont Olympe).
9
Im Jahr 1822, dem Zeitpunkt der bertragungen Goethes, befand
sich der Philhellenismus als publizistische Aktivitt auf einem Hhe-
punkt.
10
Mit den eigenen bertragungen folgte Goethe somit schein-
bar der breiten Solidaritts- und Freiwilligen-Bewegung dieser Jahre,
eine Geste, die ihm zugleich seine Abneigung gegen die deutsche phil-
hellenische Gesinnungspoesie von Waiblinger, Uhland, Wilhelm Ml-
ler auszudrcken erlaubte. Am gedankenlosen Pathos der Gewalt
nahm er besonderen Ansto.
11
Arnold schreibt rckblickend dennoch
zu Recht, Goethe sei unabsichtlich zum Hauptfaktor des literarischen
Philhellenismus geworden. Vor allem dadurch, da er in Deutsch-
land mit seiner ganzen Autoritt auf das neugriechische Volkslied hin-
wies [].
12
Trotz Aufnahme der Klephtenlieder in ber Kunst und Altertum als
epirotische Heldenlieder bleibt im weiteren eine Zurckhaltung Goe-
thes gegen die authentisch griechische nationale Kampftendenz sprbar.
Im Rahmen seiner Zeitschrift aber zeigt sich zugleich ein Grund, nm-
lich sein besonderes Volksliedkonzept. Die griechischen Lieder stehen
9
Goethe: FA 21, S. 336340 und FA 12, S. 351355.
10
Quack-Eustathiadis: Der Deutsche Philhellenismus, S. 19f. (Traugott Krug) und 49f.
(Friedrich Thiersch).
11
Schlagt ihn tot, schlagt ihn tot! Lorbeeren her! Blut! Blut! Das ist doch keine
Poesie. Die uerung soll Wilhelm Mller gelten. Zit. nach Dieterich, Karl:
Goethe und die neugriechische Volksdichtung, in: Hellas-Jahrbuch. Organ
der deutsch-griechischen Gesellschaft und der griechisch-deutschen Gesellschaft 1/1929,
S. 6181, hier: S. 67.
12
Arnold, Robert F.: Der deutsche Philhellenismus. Kultur- und literarhistorische
Untersuchungen, in: Euphorion, Ergnzungsheft 2/1895 (Reprint Nendeln 1970),
S. 71181, hier S. 106.
Das griechische Volkslied Charos 303
einzeln fr sich als Texte, bleiben unkommentiert und sind in das Spek-
trum der weiteren Themen des Heftes ber das bildende Kulturleben der
Zeit Theaterauffhrung, Ausstellung, Bildbesprechung, Empfehlun-
gen, Bemerkungen und Erinnerungen Goethes zu eigenen bersetzun-
gen und solchen Dritter kaum hervorgehoben. Sie kommunizieren
innerhalb des Heftes mit dem Lied Das Struschen. Alt Bhmisch, das von
noch vorbewuter jugendlicher Sehnsucht erzhlt, und dem Klaggesang,
irisch. Vor allem der Brief Manzonis an Goethe und seine Ode auf den
Tod Napoleons am Schlu des Heftes bilden einen relativierenden Ak-
zent fr einen ,historischen Rohstoff wie die epirotischen Heldenlie-
der. Die Suggestion geht auf seine sthetische berhhung, auf Ver-
edelung des Stofflichen durch Auswahl und Kombination mit anderen
Textsorten.
In der editorisch mit Volksgesnge abermals empfohlen berschriebenen
Notiz desselben Heftes hlt Goethe sein Publikationskonzept von
Volksliedern programmatisch fest: sie sollen gemischt, nicht nach Natio-
nen getrennt, aber je einzeln fr die Eigenart der Vlker stehen. Diese
Charaktere sollen nach und nach in Publikationsfolge kenntlich wer-
den. Auerdem werde das historisch Stoffliche in Form einer kompak-
ten Sammlung doch monoton, da die Volkslieder es stets nach dem-
selben Muster gestalteten. Alle wahre National-Gedichte durchlaufen
einen kleinen Kreis, in welchem sie immer abgeschlossen wiederkehren;
deshalb werden sie in Massen monoton, indem sie immer nur einen
und denselben beschrnkten Zustand ausdrcken.
13
Dies ist als Rela-
tivierung eines rein sthetischen Mastabs gegenber dem Volkslied
zu verstehen, keineswegs als Aufforderung zur Vernachlssigung dieser
einfachen Poesien. 1806 hatte er begeistert Lied fr Lied der Samm-
lung Des Knaben Wunderhorn kommentiert. Auch darf die Bemerkung
ber Monotonie des historischen Gehalts in Volksliedern nicht mit
einem dictum gegen Volkslied-Sammlungen in toto gleichgesetzt werden.
Sammlungen zu erstellen aber ist Aufgabe anderer, nicht die des Dichters.
Elementar hingegen fr diesen ist Naturpoesie als Stoff, also vereinnah-
mende Adaption des Einzelliedes. Aber gerade dies erffnet, kritisch be-
trachtet, seine Art und Weise des Verstehenwollens. Fr den eigenen Pu-
blikationskreis whlte Goethe bestenfalls aus, adaptierte, bearbeitete. So
verfuhr er spter in ganz willkrlicher Bearbeitung mit Distichen aus der
Fauriel-Sammlung, die er seinem Werk mit der antikisierenden Gattungs-
13
Goethe: FA 21, S. 392.
304 Chryssoula Kambas
bezeichnung Liebes-Scholien eingliederte.
14
hnlich ging er bereits mit
dem Abdruck des Liedes Charos vor. Text und bersetzung mu er von
Werner von Haxthausen 1815 aus dessen Sammlung erhalten haben.
Unabkmmlichkeit und Dringlichkeit von Volkslieder-Sammlun-
gen bekundete Goethe schlielich mit der ffentlichen Aufforderung
im Heft von ber Kunst und Altertum, das die Heldenlieder enthlt,
an Werner von Haxthausen ohne dessen namentliche Nennung zur
baldigen Publikation seiner Sammlung neugriechischer Lieder:
15
[] so ersuchen wir schlielich den Freund, der uns im Sommer 1815 zu Wies-
baden neugriechische Lieder im Original und glcklich bersetzt vorlegte, einen
baldigen Abdruck, der uns aber nicht vorgekommen, zusagend, sich mit uns hier-
ber zu verstndigen und zu der ausgesprochenen lblichen Absicht mitzuwirken.
Diese seine Ermahnung fgte der Herausgeber dem Heft von ber Kunst
und Altertum ein, welche die Klephtenlieder enthlt. Dahinter stand, wie
sich zeigen wird, eine sprachpolitische Absicht.
Zu Goethes ,Verstehen des Fremden, oder besser: seiner bersetzung
als Kulturhermeneutik, ist das im Vergleich zu den historischen Liedern
von ihm weit hher geschtzte Charos-Lied ein geeigneter Zugang. In der
Erstfassung 1823 gab er ihm den Titel Charon. Auf indirekte Weise teilte
er, wohl als Vortragender dieses Liedes, zugleich etwas von einer tastenden
Neugier mit, wie denn die moderne griechische Vorstellungswelt beschaf-
fen sei. Das Lied erschien im Folgeheft der Klephtikapublikation. Ihm
sind, wie schon diesen, Volkslieder anderer Sprachen beigesellt. Analog
14
Goethe: FA 12, S. 358360. (zuerst Werke. Ausgabe letzter Hand 1827, Bd. 3.)
Sie sind im Tone der Grazie seines vielberufenen Altersstils gehalten, die nur je-
nen Volksliedern bel zu Gesichte stand, so Arnold (Philhellenismus, S. 111)
sehr zu recht. Demgegenber eine extensive apologetische Deutung bei Kedrotis,
Jorgos: `H rtoqooj ouo rjvtuv ojottuv toyouotuv 0 tv
Iottr. Htooj rjvruttj ooryytoj (Die bersetzung zweier griechi-
scher Volkslieder durch Goethe. Vorschlag zu einer hermeneutischen Annhe-
rung), in: N|A |lTIA, Heft 1721, Mrz 2000, S. 372391.
15
Goethe: FA 21, S. 896. Fr die Kommentare in den Goethe-Ausgaben wie fr die
zum Thema entstandene jngere Forschungsliteratur bleibt offen, wie die ber-
mittlung der Textgrundlage seit 1815 zu denken ist. Bis heute wird sogar ein letzter
Zweifel an der Benutzung des von Haxthausen verschrifteten Textes offen gelas-
sen, als Original wie als bersetzung. Es scheint, da Goethe hier den Haxthau-
senschen (wohl frher notierten) Text benutzt hat. Soyter, Gustav: Goethe und
das neugriechische Volkslied, in: Gymnasium. Zeitschrift fr Kultur der Antike und
humanistische Bildung 58/1951, S. 5571, hier: S. 62. Arnold hingegen sah dies
noch als unzweifelhaft an. Arnold: Philhellenismus, S. 109.
Das griechische Volkslied Charos 305
zum vorangegangen Heft findet sich erneut im Abstand von etwa fnfzig
Seiten eine kommentierende Notiz Zu Charon dem Neugriechischen:
16
Sooft ich das Gedicht vorlas, ereignete sich, was vorauszusehen war: es tat eine au-
erordentliche Wirkung; alle Seelen, Geist- und Gemtskrfte waren aufgeregt,
besonders aber die Einbildungskraft; denn niemand war, der es nicht gemalt zu
sehen verlangt htte, und ich ertappte mich selbst ber diesem Wunsch.
Goethe hatte den Text offenbar seit 1815 wiederholt selbst vorgelesen.
Fr 1822 kann dafr ein Zeugnis von Frderic Soret angefhrt werden,
die Erinnerung an einen Leseabend, an dem Goethe es gleich zwei Mal
vortrug: Diese Blicke, dieses Feuer, diese Stimme, abwechselnd don-
nernd und leise, diese deutliche Aussprache, diese Mannigfaltigkeit der
Betonung! Vielleicht entwickelte er zu viel Stimme fr den engen
Raum, in dem wir zusammengepfercht saen, aber an dem Vortrag war
nicht das geringste auszusetzen.
17
Mit der Notiz am Ende des Heftes lancierte Goethe, ohne dazu direkt
aufzurufen, das sptere Preisausschreiben zur Illustration des Liedes.
Ausgesprochen ,durch die Blume gab er den Hinweis, hiermit, wo die
hheren Kunstforderungen zu leisten seyn mchten
18
, gern in Erinne-
rung an die bis 1805 zusammen mit Schiller seitens der Weimarer Kunst-
freunde ausgelobten Aufgabenstellungen zur Illustration von Textstellen
der klassischen griechischen Literatur anknpfen zu wollen.
19
Die bild-
hafte Umsetzung, gleichsam als durch Goethe beglaubigtes Qualittskri-
terium, fhrte Wilhelm Mller in der bersetzung des Liedes aus der
Fauriel-Sammlung im Kommentar sogar als selbstredenden Qualitts-
nachweis an, obgleich eine Illustration seinerzeit noch nicht das Licht
der Welt erblickt hatte.
20
Noch 1828 schrieb Goethe in der Rezension zu
den Neugriechischen Volksliedern von Theodor Kind, [] da mir neuer-
lich keins vor die Seele getreten das sich an dichterischem Werth dem
Charon vergleichen knnte.
21
16
Goethe: FA 21, S. 491493.
17
Ebd., S. 953.
18
Ebd., S. 492.
19
Zu den Preisausschreiben vgl. Scheidig, Walter: Goethes Preisaufgaben fr bildende
Knstler 17991805. Weimar 1958.
20
Fauriel, Claude: Toyouoto Puoto (Neugriechische Volkslieder). Gesammelt und
herausgegeben von Claude Fauriel. bersetzt und mit des franzsischen Heraus-
gebers und eigenen Erluterungen versehen von Wilhelm Mller. Ersther Teil.
Leipzig 1825, S. 92.
21
Goethe: ber Kunst und Altertum VVI, in: FA 22, S. 462.
306 Chryssoula Kambas
Vor die Seele treten dies umschreibt gleichfalls die literarische
Wirkung gerade dieses Liedtextes. Fauriel unterstrich sie hnlich. Er be-
grndete seine Wertung aber nicht wie Goethe mit der Bildkraft der Ima-
gination, sondern mit Seelentnen, volkskundlich verallgemeinert.
Mge man auch zu Beginn ein Gefhl des Unangenehmen der Trauer
wegen verspren, so verwandle sich dies doch bald in Bewunderung:
Die unausdrckbare Trauer ber die, die geliebt werden, in der Stunde
der unausweichlichen Trennung zeigt umgekehrt auch die allmchtige
Freude ber die Existenz der menschlichen Wesen an.
22
Der Titel des
Liedes bei ihm lautet anders: O Xoo ot ot :o|, Charos und die See-
len. Unter dieser Bezeichnung ist es in die weitere griechische berliefe-
rung eingegangen.
Das Lied hat es im Kern mit der Figuration einer Todesvorstellung zu
tun. Diese Figuration ist in den Charos-Volksliedern, deren Zahl beacht-
lich ist, oftmals eine szenische. Sie kommt gleichfalls in den Rembetika
des 20. Jahrhunderts vor, wie sie sich ber das stdtische Submilieu aus
Smyrna nach Pirus verbreitet haben, und lebt in heutigen Vorstellungs-
welten vom Tod, genauer: von der Todesstunde, weiter. Sie rhrt von
der Kontinuitt der neugriechischen Sprache aus dem Griechisch der
Antike, wobei aber die Figur mit dem Namen Eigenschaften und Hand-
lungsweisen vollstndig gewandelt hat. Charos ist nicht Charon, der
stille Begleiter der Seelen ber den Acheron oder den Styx-Flu. Die
Umformung des Namens gibt ein Beispiel, wie ber den Erhalt des
Kernbestands der Sprache Rekurse auf antik-heidnische Reste mglich
sind und gnzlich anders denn als Bildungsbestand des Altgriechischen
fortleben. Sie fhren ein Eigenleben mitten in einer Gesellschaft von
christlicher Tradition. Fehl ginge gleichfalls, die auch in anderen euro-
pischen Sprachen vorkommende Vorstellung des Todes in Form der
Personifikation bzw. als Trope zu unterstellen. Charos lt sich nicht in
eine Allegorie des Todes auflsen. Er ist nicht dessen Personifikation. Er
bleibt eine imaginre Figur des Zwischenreiches, die in der Begegnung
mit dem noch Lebenden diesem das Leben nimmt.
23
22
Fauriel: |//qvto qorto rootto, Bd. 1, S. 288 (bers. von C. K.)
W. Mller hat diese, wie viele andere Kommentar-Seiten Fauriels, nicht in die
bersetzung aufgenommen.
23
Dazu auch die Erluterung von Politis, Nikolaos G.: '|/oo oo ro rootto
ro ///qvto /oo. (Auswahl aus den Liedern des griechischen Volkes.) Athen o. J.,
S. 221: Den Todeskampf imaginiert das griechische Volk als einen Kampf des
Das griechische Volkslied Charos 307
Die Todesvorstellung berhrt zentral das Bild des neuen Griechen-
land im Sinne einer zeitgenssischen und fremden Kultur. Diese Diffe-
renz der Vorstellungen, der Wortbildungen und Redewendungen wie
vor allem des Erzhlens bzw. Singens ber den Tod teilt sich in dem von
Goethe bearbeiteten Text gleichfalls mit. Er enthlt zugleich auch die
Differenz zur antiken Vorstellung vom Reich der Schatten. Obgleich
Goethe den antiken Namen Charon (Xouv) whlte, war ihm dieser
Unterschied deutlich. Und das Reizvolle dieses Liedes in Goethes Fas-
sung geht von den beiden Differenzen, derjenigen gegen die Antike und
der gegen das tropische Sprechen vom Tod, aus.
Was sucht Goethes bertragung, die auf mythologische wie psycho-
logisch volkskundliche Hinweise verzichtet, zu ermitteln, um das Neu-
griechische zu verstehen und im Deutschen wiederzugeben?
Der Text lautet in Goethes erster Fassung:
24
Charon. Neugriechisch
Die Bergeshhn warum so schwarz?
Woher die Wolkenwoge?
Ist es der Sturm der droben kmpft,
Der Regen, Gipfel peitschend?
Nicht ists der Sturm, der droben kmpft.
Nicht Regen, Gipfel peitschend;
Nein, Charon ists, er saust einher,
Entfhret die Verblichnen;
Die Jungen treibt er vor sich hin,
Schleppt hinter sich die Alten;
Die Jngsten aber, Suglinge,
In Reih gehenkt am Sattel.
Da riefen ihm die Greise zu,
Die Jnglinge sie knieeten:
O Charon, halt! Halt am Geheg,
Halt an beim khlen Brunnen!
Die Alten da erquicken sich,
Die Jugend schleudert Steine,
Die Knaben zart zerstreuen sich
Und pflcken bunte Blmchen.
,Nicht am Gehege halt ich still,
Ich halte nicht am Brunnen;
Sterbenden gegen Charos, woher auch die Redewendung ,er kmpft mit Charos
(ooo/rtrt) fr die gebruchlich ist, die ihre Seele aufgeben.
24
Goethe: FA 12, S. 356. Die kaum verschiedene zweite Fassung Charos (ebd.,
S. 357) ist in ber Kunst und Altertum anlsslich der Mitteilung ber den Sieger des
Illustrationswettbewerbs drei Jahre spter gedruckt worden.
308 Chryssoula Kambas
Zu schpfen kommen Weiber an,
Erkennen ihre Kinder,
Die Mnner auch erkennen sie,
Das Trennen wird unmglich.
In der nicht unbeachtlichen Rezeption dieser Fassung erfolgten unmit-
telbar Hinweise auf bersetzungsfehler. Gravierend falsch z. B. ist,
ut (chorio) mit Gehege anstatt mit Dorf , oder ovoyuvo
(androgyno) mit Weiber zu bersetzen, anstatt mit Ehepaar. Wil-
helm Mller schrieb in der Vorrede der deutschen Fauriel-Sammlung
mit Blick auf alle in ber Kunst und Altertum erschienenen griechischen
Lieder, selbst eine minder als halbe Kenntnis der neugriechischen Volks-
sprache knne die bersetzungsfehler nicht entschuldigen. Wir ms-
sen also annehmen, da sie nach sehr mangelhaften und verdorbenen
Originalen gearbeitet sind,
25
schliet er diplomatisch. Im einzelnen wer-
den die Sinnentstellungen aller Goetheschen bersetzungsfehler in den
griechischen Volksliedern dann von der spteren Generation der Goe-
the-philologisch geschulten Neogrzisten angefhrt.
26
Iken verbesserte 1825 bereits in der Leukothea den Namen zu Cha-
ros.
27
Diesen bedeutungsvollen Unterschied zwischen dem alt- und dem
neumythologischen Namen hat Goethe beim Zweitabdruck als einzigen
korrigierend kenntlich gemacht,
28
ansonsten aber so gut wie nichts ver-
ndert, bis auf den zweiten Stropheneinschnitt. Htte er der berset-
zung Haxthausens strker vertraut, wren Sinnentstellungen nicht ge-
schehen. Auf der anderen Seite aber sind gerade sie auch Teil von
Goethes planvoller kultureller Angleichung, Teil seiner Arbeit der Ann-
herung an die neugriechische Kultur. Das ist mein Gesichtspunkt fr
den folgenden bersetzungskritischen Vergleich.
Hier zunchst die bersetzung Haxthausens:
29
25
Fauriel: Toyo uoto Puoto, Vorrede, S. VII.
26
Zu Charos im einzelnen Dieterich: Goethe und die neugriechische Volksdich-
tung, S. 79; vgl. auch Soyter: Neugriechisches Volkslied, S. 63.
27
Iken, Carl (Hrsg.): Leukothea. Eine Sammlung von Briefen eines geborenen Griechen
ber Staatswesen, Literatur und Dichtkunst des neueren Griechenlands, Bd. 1. Leipzig
1825, S. 190.
28
Goethe: FA 12, S. 1337. Beim Zweitabdruck 1826 begrndete Riemer die Abnde-
rung: Im Neugriechischen heit der Tod zwar Charos (Xoo), nicht Charon
(Xouv); allein jene Form ist nur eine gewhnliche Umbildung in eine gewhn-
lichere Endung []. Was als grammatische Begrndung wegen des Wechsels von
Omikron zu Omega nicht berzeugt.
29
Neugriechische Volkslieder gesammelt von Werner von Haxthausen. Urtext und berset-
zung. Karl Schulte-Kemminghausen/Gustav Soyter (Hrsg.): Mnster 1935, S. 83.
Das griechische Volkslied Charos 309
Charos
Wie gar so schwarz die Berge sind und stehn so welk und traurig!
Ists wohl der Wind, der sie bekriegt? Ists Regen, der sie peitschet?
s ist nicht der Wind, der sie bekriegt, nicht Regen, der sie peitschet,
Der Charon [sic!, C.K] ists, der geht vorbei, mit den verstorbnen Seinen.
Er fhrt die Jungen vor sich her, die Alten nach sich ziehend
Und dann die kleinen Kinderchen, am Sattel festgebunden.
Es flehen ihn die Alten an, und all die Jungen knieen:
Mein Charos nun kehr ein im Ort, kehr ein am khlen Quelle,
Da trinken die Alten aus der Flut, die Jungen mit Steinen spielen,
Und dann die kleinen Kinderchen aufsammeln sich die Blmchen!
Und nicht im Orte kehr ich ein und nicht am khlen Quelle,
Am Wasser kmen die Mtter her, erkennten ihre Kinder,
Es kennten Eheleute sich, und Scheidung gb es nimmer.
Der griechische Text zum Vergleich:
O Xoo
T ti `vot o0o to pouvo o otrouv pouurvo;
Mjv` vro to or 0. jvo po to orvrt;
Kt o0o` vro to or 0 t o0o po to orvrt
Mvr otopoivrt o Xoovto tou 0o0orvou,
lrvrt tou vrou 0` oooto, tou yrovto ott
Ko to to otoouo ot or` 0yoptoorvo.
Hoooo0v ol yrovtr ` ol vrot yovoti,ouv
Xor `, yto vrr o` ut, vrr o` uo puot,
No to0v ol yrovtr vr ` ol vrot vo t0oioouv
Ko to to otoouo vo ooouv to ououoto.
Kt o0o o` ut ovruu `y t o0o o uo puot
`Iovt` ol ovvr yto vr, yvui,ouv to ototo tou
Ivui,ovtot t` 0voyuvo, rutov ov rrt.
30
30
Haxthausen: Volkslieder, S. 82. In der Fauriel-Ausgabe von Politis gibt es wenige
Abweichungen, davon eine wesentliche: 0optoorvo (Z. 6). In der bersetzung
durch Wilhelm Mller lautet der Text: Charon und die Seelen. | Was sind die
Berge doch so schwarz und stehn in Trauerkleidern? | Ists, weil der Sturmwind sie
bekmpft? Weil sie zerschlgt ein Regen? | Nein, es bekmpft kein Sturmwind sie,
zerschlgt sie auch kein Regen: | Der Charon zieht darber hin mit einer Schaar
von Todten. | Er treibt die Jungen vor sich her und hinterdrein die Greise, | Und
an dem Sattel angereiht hat er die zarten Kinder. | Es bitten ihn die Greise wohl, es
flehen ihn die Jungen: | Oh, lieber Charon, halt am Dorf, halt an der khlen
Quelle, | Auf dass die Greise trinken gehn, die Jungen Steine werfen, | Und dass
die kleinen Kindelein sich schne Blumen pflcken. | Und ich halt an dem
Dorfe nicht, nicht an der khlen Quelle. | Die Mtter, die nach Wasser gehn, er-
kennten ihre Kinder, | Und Mann und Weib erkennten sich und wollten sich
nicht trennen. Fauriel, Toyo uoto Puoto, S. 9.
310 Chryssoula Kambas
Wegen der Fehler, so meinen Schulte Kemminghausen und Soyter
schlieen zu drfen, knne Haxthausens bersetzung Goethe fr die
Publikation nicht vorgelegen haben. Falls doch, habe er sie nicht be-
nutzt.
31
Eine Bearbeitung halte ich fr das Wahrscheinliche, zumal dies
mit Goethes Naturpoesie-Vorstellung harmoniert, und bei den grbsten
Fehlern sogar aus der deutschen Vorlage miterklrt werden kann. Dem
Kreis zeitgenssischer aktiv philhellenischer Rezipienten war die Grund-
lage allenthalben gewrtig. Beispielsweise Friedrich Thiersch erwhnte
in einem Vortrag 1828 Haxthausens Sammlung, und da Gthe, dem
Proben daraus in Uebersetzungen zukamen, [] sie fr die besten
Volkslieder, die ihm bekannt wren erklrt habe.
32
Und Mller unter-
stellte ja fr alle sieben in ber Kunst und Altertum erschienenen Lieder,
sie stammten aus der Sammlung jenes ,jungen Deutschen.
33
Haxthausen hielt sich in allen bersetzten Liedern an den vorgegebe-
nen Vers. Es ist umgekehrt das aufflligste durchgehende Merkmal in den
Bearbeitungen Goethes, die fr das neugriechische Volkslied ausdrucks-
volle und charakteristische Langzeile des Dekapentesyllabos, des Fnf-
zehnsilbers, aufzulsen. Die Prosodie erfolgt unbetont-betont, analog zur
deutschen Prosodie, und nicht wie im Altgriechischen nach Quantitt. In
der ersten Halbzeile mu entweder die 6. oder 8. Silbe, in der zweiten
Halbzeile immer die 14. Silbe den Akzent tragen.
34
Ansonsten herrscht
Freiheit, und es gibt auch trochische Auftakte. Durch diese metrischen
Freiheiten klingt der politische Vers im Griechischen nicht so monoton
wie in deutschen Nachbildungen mit strenger Einhaltung des Jambus.
Goethe hat durch die Vershalbierungen und bis auf Charos die
Wahl des Trochus den politischen Vers der deutschen Volksliedstrophe
nach Verslnge und Prosodie hin anverwandelt, soda das Lied den be-
liebten Wechsel von vier- und dreihebigem Jambus aufweist. Damit ver-
ndert sich der Vortrag vom Gesang einmal abgesehen betrchtlich.
Vor allem der Rhythmus der Zeilen, der vom variierenden Verhltnis
zwischen Zsuren und Betonungen gebildet wird, verliert im Deutschen
die Dynamik und wirkt zu lieblich. Diese Prosodie der griechischen
31
Haxthausen: Volkslieder (Einleitung), S. 7, Anm. 4.
32
Thiersch, Friedrich: Ueber die neugriechische Poesie, besonders ber ihr rhythmisches und
dichterisches Verhltnis zur altgriechischen. Vorgelesen in einer ffentlichen Sitzung
der k. Akademie der Wissenschaften zu Mnchen am 28. Mrz 1828 zur Feyer
ihres 69. Stiftungs-Tages. Mnchen 1828, S. 11f.
33
Fauriel: Toyo uoto Puoto, Vorrede, S. VII.
34
Graphisch: xXxXxXxX xXxXxXx. Instruktiv zum politischen Vers Arnold: Phil-
hellenismus, S. 110f. und S. 131.
Das griechische Volkslied Charos 311
Langzeile gibt Haxthausens bersetzung recht authentisch wieder.
35
Zu-
gleich ist sie um sinnquivalente ,Treue bemht.
Der folgende bersetzungsvergleich will zunchst zwischen Goethes
Text und dem griechischen die Bildwelt-Differenzen herausarbeiten.
Aus ihnen nmlich entsteht die kulturelle Angleichung der Vorstellungs-
welten, das, was im einzelnen vor die Seele tritt. Die Figur Charos soll
anschlieend, der neugriechischen Mythologie gem, an weiteren figu-
rativen Imaginationen erlutert werden.
In Zeile 1 heit to pouvo otrouv pouurvo wrtlich die
Berge stehn trbe da; wre vom Menschen die Rede, mte die Parti-
zipform desselben Verbs durch mit Trnen in den Augen wiedergege-
ben werden. So bersetzt Haxthausen die Berge [] stehn so welk und
traurig, was den passiv leidenden Zustand problemlos ausdrckt. Statt
die Berge heit es bei Goethe Bergeshhn (Z1), dann Gipfel (Z4),
und entsprechend kmpft der Sturm (Z5) droben (Z 5). In Zeile 9
werden Ort und Bewegung auf den einhersausenden Charos bertra-
gen. Die Vorstellung des Oben konnotiert Goethes so mit der Geschwin-
digkeit, und diese bezieht er auf Charos als Ursache. Dem gegenber
Haxthausen: Charos geht vorbei (4); durchquert (otopoivrt) sollte
es wrtlich heien, im Sinne von ,durch einen Ort hindurch gehen. Die
Vorstellung des Originals ist also viel ruhiger und entspricht dem Vor-
gang einer Passage, wobei die ganze Szenerie und die Negation, da es
nicht Wind und Regengu sind, die tiefe Trauer seitens der Natur als
Subjekt zum Ausdruck bringen. Bis auf das otopoivrt gibt es im grie-
chischen Wortfeld nur die Negation der Aktion, der Geschwindigkeit:
Bekmpft etwa der Wind, schlgt etwa der Regen []? Nein, kein Wind
kmpft []. Statt Sturm alt- u. neugriechisch: 0uro ist auch
Wind bei Haxthausen adquater gewhlt.
36
35
Auf wenige Sinnabweichungen mag verwiesen sein: Zeile 4 tou 0o-
0orvou / mit den verstorbnen Seinen ist im Deutschen strker: die Toten
sind in den Besitz des Charos bergegangen. Im Griechischen: mit den Gestor-
benen. Zeile 12: `Iovt` ol ovvr yto vr / Am Wasser kmen die Mt-
ter her; wrtlich: [Zum Brunnen (Quelle)] kommen die Mtter, um Wasser zu
holen. Goethes zu schpfen ist eine elegante, gehobene Lsung nach Sinn und
Krze.
36
Am saust nahm auch Wilhelm Mller Ansto und whlte zieht drber hin.
Hierbei aber ist er, ohne es zu merken, von der Zwei-Welten-Konstruktion Goe-
thes beeinflusst, die auch bis in die jngsten Stellenkommentare machgewiesen
werden kann: In der neugriechischen Volkssage als Charos oder Charontes der
Tod, der auf schwarzem Rappen die Toten aus der Gemeinschaft der Lebenden
hinwegfhrt. Goethe: FA 12, S. 1335.
312 Chryssoula Kambas
Goethes Wortfeld schafft ein Oben; komplementr lokalisiert es den
Sprecher oder Hrer unten. Das Original kennt solches Oben und Un-
ten nicht. Die Berge hier sind Teil der Landschaft bzw. des Ortes des wei-
teren Geschehens. Mit dem oben sausenden Charos hat sich bei Goethe
die ganze Gruppe der Seelen schon weit aus dem Ort bzw. Dorf ent-
fernt, sie befindet sich darber. Haxthausen hatte sich nun mit der Wort-
wahl (Z 8 und 11) kehr ein im Ort, das ovruu, (Quartier nehmen),
wiedergibt, mit einer Mehrdeutigkeit aus der Affre gezogen. Man kann
es in Vers 11 als Weigerung von Seiten des Charos verstehen, berhaupt
ins Dorf hinein zu gehen oder dort verweilen, bernachten, zu wollen.
Die Bildwelt des Originals legt das Sein der Seelen noch in ihrer ge-
wohnten Umgebung nahe, und Charos geht am Rande des Dorfes vor-
bei (Haxthausen, Z 4) oder gar durch es hindurch, otopoivrt im Ge-
gensatz zum Geschehen in den Lften bei Goethe.
Der weitere bersetzungsfehler Gehege fr ut erklrt sich
gleichfalls aus Haxthausens bersetzung Ort (Z 8) fr Dorf. Im Deut-
schen kann ja Ort mit Dorf synonym sein. Ort bleibt doppelsinnig
hnlich wie einkehren fr ovruu. Goethe will Ort im Zusam-
menhang mit seiner Verlagerung des Geschehens konkret und poetisch-
idyllisch bezeichnen und whlt Gehege, ein schn klingendes Wort
und zudem traditioneller locus amoenus fr den analogen unteren Be-
reich; auch hier wieder dramatisierend mit Alliteration, stabreimartig
sogar mit den 4 H-Lauten: O Charon halt! halt am Geheg. Das hat
Konsequenzen fr die Imagination des Raumes.
Es entsteht eine Zweiweltenkonstruktion symbolischer Art, die im
Original nicht angelegt, geschweige ihm quivalent ist. Die Raum-
Teilung wird sich dann spter auch sehr deutlich in der siegreichen Illu-
stration abbilden, der Zeichnung des Stuttgarter Portrtmalers Carl Jakob
Theodor Leybold (vgl. Abb.1) und des nach ihr gearbeiteten lbilds.
Aufgerufen hatte zum Malwettbewerb das Morgenblatt
37
. Goethe be-
grndet seine Entscheidung zugunsten Leybolds dann mit dessen deut-
licher Zweiebenengestaltung, und darber hinaus damit, da Krper-
und Kopfhaltung des Charos mit Michelangelos Fresko Gottvater in
37
Der Stuttgarter Redakteur Carl Ludwig Schorn nahm Goethes Wink eigenstndig
auf. Das Preisausschreiben erschien im Kunstblatt, einer Beilage des Morgenblatts,
am 19. 1. 1824; Anfang Mai 1825 wurden von Stuttgart aus die eingegangenen
Zeichnungen nach Weimar geschickt, und Goethe beurteilte sie zusammen mit
Meyer. Vgl. Goethe: FA 22, S. 1469. Die Begrndung fr den an Leybold gegan-
genen Preis erschien imKunstblatt (6. 2. 1826) und in ber Kunst und Altertum (vgl.
Goethe: FA 22, S. 746).
Das griechische Volkslied Charos 313
der Sixtinischen Kapelle hnlichkeit habe. Die sprachlich in der Bear-
beitung Goethes aufgebaute Bildwelt evoziert eine Allegorie des mittel-
alterlichen Todesreiters, von Leybold sptromantisch vershnlicht und
mit klassizistischer Reminiszenz versehen. Charos erhlt etwas von der
Wrde des Allmchtigen, die im Kontext der buerlichen Welt mit der
das Leben raubenden Gewalt des Schwarzen nicht verbunden wird.
Diese Gewaltsamkeit des Charos hatte sich Goethe durchaus mitgeteilt,
und er lobte an Leybold, er habe das Dstere und Unangenehme ange-
nehm gemacht.
38
Bereits mit dem Erstdruck streute Goethe 1823 in Zu Charon dem Neu-
griechischen an einen ganz hypothetischen Maler lenkende Direktiven;
sie decken sich zum Teil mit den Raumvorstellungen in der Faktur seiner
Lied-Bearbeitung, gehen aber in manchem in ganz andere Richtungen.
Dabei unterstreichen sie schon, was ihm so am Herzen lag, die sturmar-
tige Bewegtheit des Geschehens. Es ist mglich, da in folgender Notiz,
38
Brief Goethes an Boissere vom 14. 9. 1825,in: Goethe, Johann Wolfgang: Die
letzten Jahre, in: Briefe, Tagebcher und Gesprche von 1823 bis zu Goethes Tod, Teil I.
Horst Fleig (Hrsg.), in: FA 10, S. 305.
Abb. 1: Charon. Zeichnung von Leybold im Kunstblatt 1826, 36
314 Chryssoula Kambas
die ein Zeugnis sowohl der frhesten Rezeption sowie auch der Lenkung
bildknstlerischer Phantasie darstellt, weitere Gesichtspunkte aus Aus-
sprachen mit Zuhrern eingeflossen sind:
39
Wenn es nun seltsam scheinen wollte, das Allflchtigste, in hchster Wildheit
vorber Eilende vor den Augen festhalten zu wollen, so erinnerte man sich, dass
von jeher die bildende Kunst auch eins ihrer schnsten Vorrechte im gegenwrti-
gen Momente den vergangenen und den knftigen und also ganz eigentlich die
Bewegung auszudrcken, niemals aufgegeben habe. Auch im genannten Falle be-
hauptete man, sey ein hoher Preis zu erringen, weil nicht leicht eine reichere,
mannigfaltigere Darstellung zu denken sey: die Jnglinge, die sich niederwerfen,
das Pferd, das einen Augenblick stutzt und sich bumt, um ber sie, wie der Sieger
ber Besiegte, hinauszusetzen; die Alten, die gerade diese Pause benutzen, um
heran zu kommen; der Unerbittliche, Tartar- und Baschkiren-hnliche, der sie
schilt und das Pferd anzutreiben scheint. Die Kinder am Sattel wollte man zier-
lich und natrlich angeschnallt wissen.
Man dachte sich die Bewegung von der rechten zur Linken, und in dem Raume
rechts, den die Vorberstrmenden soeben offen lassen, wollte man das Geheg,
den Brunnen, Wasser holende Frauen, welche den vorbey eilenden Sturm, der in
ihren Haaren saust, schreckhaft gewahren, in einer symbolischen Handlung an-
gedeutet sehen.
Goethes Transzendenz erffnende Auffassung des Volksliedes, angelegt in
sprachlichen Bildkonventionen, weiter akzentuiert in der schlielichen
bildknstlerischen Umsetzung, wirft Licht auf sein Bild neugriechischer
Kultur. Das eigentlich macht die bersetzung im Sinne kultureller Anglei-
chung der volksmythologischen Figur an den westchristlichen Todesge-
danken aus. Den eher balladenhaften Vorgang hat er in die Allegorese
berfhrt, die wiederum das Relikt des antiken Namens mit der an der
Antike orientierten Formensprache der Renaissance im Bild eines Gtt-
lichen zusammenfhrt. Charos Gottvater-Zge bei Leybold berzeugten
schlielich mehr als die offenbar spontanere, frhere Vision eines reiten-
den Tartaren. Der auer Konkurrenz eingereichte Scherenschnitt der
Luise Duttenhofer setzte, dem Volkslied sehr angemessen, die Zweiwel-
tenkonstruktion reigenhnlich um (s. Abb.2).
Bemerkenswert ist, wie Goethe von 1815 bis zum Zweitdruck 1826
an dieser seinen einen Charos-Gestalt festhlt: ein Reiter im Sturm.
So, als gebe es die Figur nur mit den in diesem Gedicht erfassbaren
Merkmalen. Wenn er Haxthausens weitere Charos-Volkslieder viel-
leicht nicht kennen konnte, so htten ihm solche sptestens 1825
bei Fauriel auffallen mssen. In keiner der Notizen oder Besprechun-
gen zum weiteren Thema gibt es die Andeutung eines Hinweises dar-
39
Goethe: FA 21, S. 492.
Das griechische Volkslied Charos 315
auf. Bereits Boissere hatte von dem schon erwhnten Gesprch mit
Goethe im September 1815 notiert, was sich bis heute tradiert: Cha-
ron ein Reuter welcher die Seelen hinten an den Schweif des Rosses
bindet, die der Kinder an den Sattel.
40
Zeitlich nach dem Druck
fhrte Iken in der Leukothea fr seine volkskundliche Erklrung zum
Charos im Kontext des kretischen Versromans Erotokritos als Beleg-
stelle Goethes bersetzung an:
Die Neugriechen stellen sich ihn auf einem Pferde schnell reitend vor, indem zu
beiden Seiten des wilden Rosses die Leichen der Verstorbenen hngen: so jagt
er mit ihnen in vollem Gallopp davon. Die alte mythologische Idee hat sich ganz in
die moderne christliche Vorstellung verwandelt und mit dieser sich verschmolzen.
41
Die Stilisierung des Charos als Reiter ist bei den Zeitgenossen durch-
schlagend wie dauerhaft gewesen. Dabei weist Iken schon auf die An-
dersgestaltigkeit hin. In der Altertumswissenschaft des spten 19. Jahr-
hunderts und der nun beginnenden Byzantinistik wird eben dieses
Problem von Bruch oder Kontinuitt zum graeco-italischen Fhrmann
40
Goethe: SW, Bd. 12, S. 1314.
41
Iken: Leukothea, S. 190.
Abb. 2: Luise Duttenhofer. Scherenschnitt-Illustration zu Goethes Gedicht Charon
316 Chryssoula Kambas
der Unterwelt auch aus frher nachweisbaren Vorstellungen eines reiten-
den Todesgottes und von Charos als Jger verfolgt.
42
Sptestens mit der Benutzung der Fauriel-Sammlung htte Goethe
ein weiterer Charos ohne Pferd bemerkbar werden mssen. Bedenkt
man auerdem, da die Vorstellung vom reitenden Charos im Lied
allein vom Wort oro, Sattel, herrhrt, dann mu eine Variante bei
Haxthausen zu Zeile 6 herangezogenen werden. Sie bezieht sich auf das
fr die Publikation magebliche Manuskript C, das sein Informant
Theodoros Manoussis angefertigt hat. Haxthausen fgt in sein Manu-
skript ein: To tuqro otoouo ot ro` 0ootoorvo Dieser
Vers ist offenbar der richtige.
43
[] die zarten Kinderchen in die Mitte
eingereiht. Diese Korrektur hat einen Charos ohne Pferd zur Folge, der
mit dem Zug der Seelen Verstorbener, ohne anzuhalten, unerbittlich das
Dorf passiert. An dieser Stelle vermerken die Herausgeber, sie wichen
vom Grundsatz der Mageblichkeit dieses Manuskriptes ab, wegen der
anderweitigen von Goethe und Haxthausen der bersetzung zugrunde
gelegten Variante. Generell ist damit die Problematik der Gltigkeit ein-
mal publizierter Volksliedfassungen berhrt, die, selbst wenn sie verdor-
ben sind, ihre Eigendynamik in der Rezeption gewinnen.
Nur weniges sei an dieser Stelle zur Vielfalt der Charos-Figur nachge-
tragen: In O ooo o o Xoo, Der Hirte und Charos aus der Fauriel-
Sammlung in Mllers bersetzung Der Schfer und Charos erscheint
unvermutet Charos dem krftigen jungen Hirten, der Frau und Kinder
hat, als er vom Berg kommt und nach Hause will. Charos treibt den
jungen Mann in eine enge Gasse, doch der beginnt eine Art Ringkampf
mit ihm, nachdem alles Argumentieren nichts fruchtet. Als Charos aber
nicht locker lt, sagt er ihm: Mein Charos, wenn Du einmal beschlos-
sen hast, mich mitzunehmen, dann la uns auf der marmornen Tenne
weiter kmpfen. Wenn du mich besiegst, nimmst du meine Seele mit,
und wenn ich wieder siege, dann gehe nur ruhig davon. Das Ende: Sie
kmpfen den ganzen Tag ber und Charos siegt.
42
Die zentrale kritikvergleichende Studie dazu ist Hesseling, Dirk Christiaan: Cha-
ros. Ein Beitrag zur Kenntniss des neugriechischen Volksglaubens. Leiden o. J. [1897].
Eine direkte, das Problem aufgreifende Antwort, verfate der bedeutende Sprach-
wissenschaftler Ioannis Psycharis: Charos cheval (Psycharis, Ioannis: Quelques
travaux de linguistique, de philologie et de littrature hellniques: 18841928, Bd. 1. Paris
1930, S. 448451). Ich danke Alexis Politis (Universitt Rethymno) fr grozgige
Hilfen und Hinweise.
43
Haxthausen: Volkslieder, S. 159f. In D am Rand die Bemerkung: ,Dieser Vers ist
auszustreichen und an seine Stelle der unter der Linie stehende zu schreiben.
Das griechische Volkslied Charos 317
Hier zeigen sich allgemein signifikante Eigenschaften des Charos.
Er ist ein unerbittlicher, gewaltsamer und zuletzt unbesiegbarer Ru-
ber. Sein Erscheinen signalisiert: es gibt kein Zurck mehr. Von solcher
Unerbittlichkeit erzhlt dieses Lied. Auch tendiert der Erzhlvor-
gang dazu, die Unwiderrufbarkeit des Todes in dessen Unvorhersehbar-
keit zu individualisieren. Dies ist meines Wissens eine sehr entschei-
dende modern griechische Einstellung zum Tod, die nicht aus der Dif-
ferenz christlicher Dogmatiken erklrt werden kann, vielmehr aus der
sprachlichen Doppelfunktion, auf die Psycharis verweist: Elle na rien
dtrange, quand on songe que Xoo est aujourdhui nom commun,
en mme temps que nom propre, et en est venu signifier simplement:
la mort.
44
Da der Lebende ihm begegnet oder im Gesprch zwi-
schen Charos und seiner Mutter an Lebende gedacht wird, macht ihn
zu einer irdischen, nicht-transzendenten Gestalt. Entsprechend gehrt
er, statt zu Lften und Himmel, durchgehend zur unteren Welt, gedacht
als Erdboden. Die Variett vor allem nach Szenen ist in der neumytho-
logischen Figur konstitutiv gegeben, wobei Charos ein heidnisches Re-
likt bleibt, wenn er auch gerade im oben erwhnten Lied sagt: Kt
rvo ` rotrt` o Gr vo ou tjv ujv oou / und mich schickte
Gott, deine Seele zu nehmen.
45
Das aber genau wird im Zeichen von
Charos nicht der Allmacht Gottes zugeschrieben, sondern als Verbre-
chen am heiligen Leben gesehen, wie es nur ein Gottloser begehen
kann.
46
So wird Charos, eine schwarze Figur menschlicher Gestalt,
schlielich ber balladenartiges Erzhlen realistisch bzw. phantastisch verge-
genwrtigt. Er wird als Brigant, Seeruber, Plnderer vorgestellt; auch
hat er gelegentlich eine Frau und eine Mutter, die dem Unerbittlichen
gegenber mitleidig ber die in die Totenwelt Eintretenden oder ihre
zurckbleibenden Angehrigen sprechen. Die personifizierte Erde, die
die Leichname aufnimmt, ist bei ihm zu Gast und er erscheint als
44
Psycharis: Charos cheval, S. 449.
45
Fauriel: |//qvto qorto rootto, Bd. 1, S. 244. Vgl. zu Charos als See-
len-Nehmer Politis, Nikolaos G.: Nro//qvt :0o/o|o (Neugriechische Mytho-
logie). Athen 1877, S. 239.
46
S. hierzu Mitsou, Marilisa: Alte und neue Unterweltmotive im griechischen
Volkslied, S. 5 (unverffentlichtes Typosskript, dt.): Der Totenbereich wird so
einer brutalen Welt gleichgesetzt, in der vllige Ungerechtigkeit, wenn nicht
nackter Terror herrscht. Charos raubt den Verstorbenen die Schnheit und die Ju-
gend; sie werden schwarz, genauso wie er und wie die Erde, die sie deckt. Dies.:
.Ho0 rrt vo ototrrt? otro oto yto to toyouoto to0 Kotu
Koou, in: N|A |lTIA, Dezember 2003, Heft 1762, S. 828836.
318 Chryssoula Kambas
Schiffer, dessen Barke hnlichkeit mit dem sklavenbeladenen Piraten-
schiff hat.
47
In der volksmythologischen Erzhlung geht es um die Flle des Irdi-
schen. Antipodisch dazu stehen Allegorien wie die vom Schnitter, wei-
ter dem Knochenmann oder mit modifizierender Berhrung zwischen
den Traditionen der Todesreiter.
48
Sie grnden im Vanitasgedanken,
der auf das Leben nach dem Tode verweist. Der Tod in allegorischer Ge-
stalt prgt die Vorstellung im Christentum der Westkirchen bzw. der
abendlndischen literarischen und ikonographischen Tradition von
der Last des Irdischen. Die oben ausgefhrten Perspektiven auf Charos
hat Goethe selbstverstndlich nicht haben knnen. Fauriel wohl dank
seines Informanten Andreas Moustoxidis hat sie intuitiv formuliert.
49
2. Weltliteratur und Markt der Sprachen,
Volksliteratur und Probleme der Verschriftlichung
Der Stellenwert von Goethes ,bersetzungen aus dem Neugriechi-
schen, bezogen auf die Tradierung im Griechischen wie in den anderen
europischen Sprachen, ist eher gering einzuschtzen.
50
Bei allem Ein-
satz fr eine deutsche Sammlung der griechischen Volkslieder konnte
und wollte Goethe selbst nur eine Geste der Protektion geben. Deren
Bedeutung erschliet sich aus seinen weitergehenden sprachpolitischen
berlegungen. Sie sind in einer Besprechung zu Jakob Grimms Einlei-
tung zu den serbischen Volksliedern der Sammlung Karadzic festgehal-
ten. Zeitlich und sachlich ist darin berhaupt das Problem von berset-
zungen aus kleinen Sprachen, vorbrgerlichen Kulturen und dialektaler
Sprachstufe benannt. Dazu entfaltete Goethe folgende bersetzungs-
theoretische Alternative: Auf der einen Seite gebe es Bedarf an sorgfltig
philologisch gearbeiteten Sammlungen und, in Versma und Sinn,
treuen bersetzungen von Forschern, zugleich ist die freieste dichteri-
sche Bearbeitung aber eben nur durch Dichter erlaubt. Beides sei n-
tig und grnde in der, wie er meint, besonderen Anschlufhigkeit der
deutschen Sprache an fremde Sprachstrukturen:
47
Aridas, Georgios: Nachwort, in: Ders. (Hrsg.): Vierzig Pallikaren, die ziehn zur
Stadt hinaus. Neugriechische Volkslieder. Leipzig 1987, S. 225.
48
Psycharis: Charos cheval, S. 450.
49
Vgl. oben angefhrtes Zitat zu Anm. 22.
50
A. Politis: H ovoouj, S. 118 u. S. 186.
Das griechische Volkslied Charos 319
[] sie schliet sich an die Idiome smmtlich mit Leichtigkeit an; sie entsagt
allem Eigensinn und frchtet nicht da man ihr Ungewhnliches, Unzulssiges
vorwerfe; sie wei sich in Worte, Wortbildungen, Wortfgungen, Redewendun-
gen und was alles zur Grammatik und Rhetorik gehren mag, so wohl zu finden,
da [] man ihr doch vorgeben wird, sie drfe sich bei bersetzung dem Origi-
nal in jedem Sinne nahe halten.
51
Auf dem doppelten bersetzungskonzept Treue des Philologen, Will-
kr des Dichters grndete Goethe seine Hoffnung auf Verbreitung des
Deutschen als Sprache, und im weiteren darber der deutschen Literatur.
Weil dann Fremde auch das Ausheimische bei uns zu suchen haben.
Wenn uns eine solche Annherung ohne Affectation wie bisher nach
mehrern Seiten hin gelingt, so wird der Ausheimische in kurzer Zeit bey
uns zu Markte gehen mssen, und die Waaren, die er aus der ersten Hand
zu nehmen beschwerlich fnde, durch unsere Vermittelung empfangen.
52
Eine solch sprachpolitisch bedeutsamere Rolle des Deutschen als inter-
nationaler Bildungs- und Dichtungssprache, als Mittlerin der fremden
Poesien, die zur Frderung von bersetzungen aus kleinen Sprachen
ins Deutsche motiviert, wrde also das Deutsche umgekehrt gerade fr
Schriftsteller fremder Sprachen insgesamt interessant machen. Sucht
man vor dem Hintergrund der kulturellen Angleichung im bersetzten
Charos-Lied und zusammen mit der sprachpolitisch weiten Perspektive
Goethes Einladung an die Griechen, auf dem Markt der deutschen Spra-
che ihre Waaren nicht nur abzusetzen, vielmehr andere deutsche und
weitere fremde dort erwerben zu knnen, so wird die kulturpolitische
Einstellung als diejenige eines gemigten Philhellenen erkennbar:
Goethes bersetzungsttigkeit erscheint somit zwischen Kulturprotek-
tionismus und Fremdverstehen angesiedelt zu sein, so da er sozusagen
als ,Entwicklungshelfer aus dem vorbrgerlichen Stand der Bildung her-
aus wirkte. Zugleich erklrt sich daraus aber auch die Zurckhaltung
gegenber dem Kriegsgeschrei, dessen Fronten, wie sie Goethe bekannt
wurden, von Ferne geradezu unberschaubar waren.
53
51
Goethe: FA 22, S. 134: Serbische Lieder, Kunst und Altertum V.2 (1825).
52
Ebd., S. 135.
53
Zu den Weimarer Gesprchen mit Kapodistrias 1822 und 1827 vgl. Boyle: Griechi-
scher Befreiungskampf . Auf seine politisch gezielt auswhlende, internationale
Lektre von Griechenland-Reiseberichten ist zum Teil eingegangen von Hennig,
John: Die literarischen Grundlagen von Goethes Kenntnis des zeitgenssischen
Griechenlands, in: Ders.(Hrsg.): Goethes Europakunde. Goethes Kenntnis des nicht-
deutschsprachigen Europas. Ausgewhlte Aufstze. Amsterdam 1987, S. 335341.
320 Chryssoula Kambas
Naturpoesie, ein Begriff, der von ihm geprgt wurde wie einst von
Herder der Begriff ,Volkslied , bedeutet im Unterschied zu National-
literatur bei Goethe den Austausch der Sprachen in der Weltliteratur.
In diesem Sinne bildet fr Goethe volksliterarische ,Naturdichtung die
Grundlage von ,Weltliteratur.
54
Fr den Sammler stellt sich das Problem der Verschriftung, der An-
lage einer Sammlung und die Rolle des muttersprachlichen Informan-
ten, sofern, wie dies im Neugriechischen der Fall war, noch keine voran-
gehenden Liedsammlungen vorliegen. Ermessen lt sich daran, von
welch herausragender Bedeutung der bersetzungsvorgang in Verbin-
dung mit der Erstellung einer Sammlung ist: Mit der Verschriftung der
Volkslieder, die auf Initiative zur bersetzung hin begann, wurde das
erkannten die Dimotizisten um 1900
55
eine Sule fr die weitere
neugriechische Literatur in der Volkssprache errichtet. Und in diesem
Kontext ist die in Kommentaren wie Forschungsliteratur stereotyp be-
handelte Rolle Werners von Haxthausen neu aufzugreifen und in Bezug
zur Fauriel-Ausgabe zu stellen. Alle Goethe-Kommentare zum griechi-
schen Volkslied begngen sich mit einer Schelte wegen seines Zgerns
aus zu hohen Ansprchen, weswegen ,Deutschland seine Chance ver-
schlafen habe.
56
54
Dazu, mit entscheidenden Verweisen auf das Volkslied, von Albrecht, Michael:
Folkore und Weltliteratur: Brcken zwischen Knsten, Gesellschaftsschichten,
Vlkern. Goethe und das Volkslied, in: Ders. (Hrsg.): Literatur als Brcke. Studien
zur Rezeptionsgeschichte und Komparatistik. Hildesheim 2003, S. 263325, hier:
S. 286f.
55
Zum Problem zwischen Katharevoussa, der antikisierenden verbindlichen
Schriftsprache, und Dimotiki, gesprochener Sprache, s. unten Anm. 72.
56
Der nationalistische Unterton findet sich bei Arnold: Philhellenismus, S. 113:
Goethe habe das Erscheinen wie eine nationale Niederlage der Deutschen emp-
funden. Subtilere Wendungen dann in den Goethe-Aufstzen der Neogrzisten
Dieterich und Soyter.
Solche stereotype Klage geht auf folgende Aussage Goethes in einem Brief an
Therese von Jakob am 2. 8. 1824 zurck. Sie ist in mehrfacher Hinsicht aufschlu-
reich. Denn aus ihr geht auch hervor, da Haxthausens langer, konzeptioneller
Antwortbrief auf Goethes ffentlichen Aufruf, verffentlicht im Vorwort der
posthum herausgegebenen Sammlung 1935, diesen auerordentlich berzeugt
hat: Die griechischen Gedichte hat mir Hr. von Haxthausen im Jahre 1815 in
Wiesbaden zum Teil vorgelesen, wo ich ihn denn zur Herausgabe sehr ermun-
terte, und Teil zu nehmen versprach. Da er mir in der Folge ganz aus den Augen
kam rief ich ihn wieder auf K.u.A.IV.T.168. S. worauf er sich wieder hren lie,
und zwar in einem Briefe worin er sich ganz als Herausgeber solcher Gedichte le-
gitimiert und qualifiziert; auch war die Rede davon da sie zu Michael vorigen
Das griechische Volkslied Charos 321
Goethe publizierte 1823 die 7 griechischen Volkslieder in ber Kunst und
Altertum unter anderem aus philhellenischem Interesse, aus Anteil-
nahme an der griechischen Nationswerdung und um damit mit Blick
auf die Sammlung Fauriels eine deutsche Initiative zu bekunden.
Chants populaires de la Grce moderne, par Fauriel, ist auch erschie-
nen und so sind die Nachbarn uns zuvorgekommen, da wir Deutschen
schon seit Jahren daran herum tasten, hatte Goethe bereits zuvor er-
whnt.
57
Sollte dies tatschlich als deutsch-franzsische Konkurrenz in
Sachen griechisches Volkslied zu lesen sein? Mir scheint dies eine zu eng
nationalistische Fehllektre angesichts Goethes weltlufigen Umgangs
mit dem intellektuellen Frankreich bezglich Griechenland Cousin,
Buchon, Benjamin Constant und angesichts seiner eigenen Lektren
und bersetzungen aus dem Franzsischen. Im Hintergrund stehen
vielmehr die berlegungen zu bersetzung und Weltliteratur.
War Haxthausen der Sumige? Vor dem Hintergrund der Demago-
genverfolgungen und seiner Klner Stellung als preuischer Beamter
mgen ihn bereits die ffentlichen Aufrufe seitens des Historikers
von Niebuhr und seitens des Klassischen Philologen und exponierten
Philhellenen Friedrich Thiersch berhrt haben. Und in der Tat zeigt
Haxthausens Brief auch: er hatte zumal als Einzelunternehmen ein
nicht erfllbares Programm von sprach- und musikwissenschaftlichen
zudem nach Regionen gegliederten, vlkerkundlichen Dimensionen.
Ein Programm, das bestens durchreflektiert erscheint.
Wie sah der Stand der Sammlung von griechischen Volksliedern vor
1823 aus?
Zuvor ins Deutsche bersetzte Volkslieder finden sich vereinzelt in
Zeitschriften und Zeitungen oder in einem der frhesten originr deutsch-
Jahrs bei Cotta herauskommen und der franzsischen Ausgabe den Schritt abge-
winnen sollten. Jedoch dies geschah nicht und die Erklrung des Rtsels scheint
mir in der Unentschlossenheit des werten Mannes zu liegen; ihm schwebt zu vie-
les vor, er wei in seiner Forderung sich nicht zu beschrnken und so deut ich
mir ein Zaudern das uns um diese bedeutende (sic) Lieder zu einer Zeit gebracht,
wo sie zu ihrem innern Wert noch einen uern gefunden, zu ihrer poetischen
Wirkung noch eine leidenschaftliche wrden erregt haben. (Goethe: FA 12,
S. 1317). Aus Haxthausens Brief (in: Schulte/Kemminghausen, Vorwort zu:
Haxthausen, Volkslieder, S. 2433.) geht gleichfalls hervor, da es die Grimms wa-
ren, die ihm geraten hatten, sich an Goethe zu wenden, und da dieser stets nur
ein begleitendes Vorwort in Aussicht gestellt hatte, um die Publikation auf dem
Markt hervorzuheben und damit zu untersttzen.
57
Brief an Therese von Jakob vom 10. 7. 1824. Zit. nach Goethe: FA 12, S. 1316f.
322 Chryssoula Kambas
sprachigen Reiseberichte ber Griechenland, dem von Bartholdy,
58
der
seinerseits aus englischen und franzsischen Reiseberichten schpft.
Die als griechisch ausgewiesenen Lieder in Herders Stimmen der Vlker in
Liedern (1778/79) sind hingegen durchweg dem sptantiken Artvo-
ooqtoro| von Athenaios entnommen.
Von den in der Diaspora lebenden Griechen gab es keine eigene, ro-
mantische Motivation zu einer Verschriftung der auch dialektal sehr un-
terschiedlichen Lieder. Als Lehrstoffsammlung lassen sich aber wenige
Drucke der Zeit vor 1820 nennen, die Volkslieder wegen ihres sprach-
vermittelnden Werts der aktuellen, in verschiedenen Regionen gespro-
chenen Sprache aufnahmen, so Konstantinos Asopios Mo0qoro
rq |ottq |/cooq to ro oo/r|ov rmv /v Trorq or-
otqvmv |otmv, Lehrkapitel der griechischen Sprache fr das Studium
der in Triest wohnenden Griechen, erschienen in Venedig 1818; oder der in
Wien 1818 von Zisis Daoutis herausgegebene Volkskalender Atoqoo
q0to o| oorr|o orto:qoro, Verschiedene Bruche und humorvolle
Verse, der viele Distichen enthlt.
59
Unter ganz analogem Vorzeichen mu das Zustandekommen der
Sammlung Haxthausen im Kontext des Wiener Kongresses gedacht wer-
den. hnlich wie Fauriel enge Kontakte zu deutschen Philologen hielt
und eine entsprechende, nach deutschem Muster klassisch-philologi-
sche Vorbildung hatte,
60
ist der aus altem westflischen Geschlecht stam-
mende Haxthausen in einem deutsch-franzsischen Netzwerk von Ori-
entalisten zu sehen. Man findet ihn um 1808 als Schler von Sismondi,
den zum Stal-Kreis gehrenden Orientalisten, und bei dem Historiker
Johannes von Mller in der Schweiz, in den Kreisen der Grimms, wo er
zusammen mit seinem Bruder Karl zu deren Mrchen-Informanten ge-
hrt, und der Brder Boissere, von Grres, spter auch in der Nhe des
Freiherrn vom Stein. Verwandtschaftlich gesehen ist er ein Onkel der
Anette von Droste-Hlshoff. Er hat sich als Philhellene ab 1814 in Wien
aufgehalten, wo das Interesse an den Griechen im Kontext des Wiener
Kongresses wegen der Philomouso Etairia und Kapodistrias geweckt war.
61
58
Bartholdy, Jakob Ludwig Salomo: Bruchstcke zur nhern Kenntnis des heutigen Grie-
chenlands gesammelt auf einer Reise im Jahre 18031804. Berlin 1805.
59
Hier wie im Anschlieenden folge ich Politis: H ovoouj, S. 147.
60
Espagne, Michel: Le philhellnisme entre philologie et politique. Un transfert
franco-allemand, in: Revue Germanique Internationale 12/2005: Philhellnismes et
transferts culturels dans lEurope du XIX
e
sicle. Paris 2005, S. 6176, hier S. 67.
61
Clogg, Richard: Geschichte Griechenlands im 19. und 20. Jahrhundert. Ein Abri. Kln
1997, S. 51. Diese 1814 gegrndete Geheimgesellschaft (auch dt/tq |rot|o),
Das griechische Volkslied Charos 323
Haxthausen wurde Mitglied der Philomouso Etairia, erscheint aber
erst bei der zweiten Zhlung 1815.
62
Wann genau um 1814/15 Theodoros
Manoussis der Lehrer und Gesprchspartner von Haxthausen wurde,
mu offen bleiben. Manoussis, 1814 einundzwanzig Jahre alt, abknftig
aus Makedonien, lebte seit 1808 in Wien, und war zuvor von einem
Pester Lehrer, Zaviras, erzogen worden. Zum Zeitpunkt der Arbeit
mit Haxthausen war er bereits Autor eines Artikels ber Universal-
geschichte (Hr| o0o/tq |oro|o), der sich stark an Herder
anlehnte oder ihn gar paraphrasiert. Manoussis, nach 1837 Professor
fr Geschichte an der neugegrndeten Athener Universitt, war seit
1813 Mitherausgeber der in Form eines aufklrerischen Almanachs
herausgegebenen Zeitschrift der Wiener Griechen |q o Aoto
(Hermes, der Gelehrte). Dem Titel darf man das Bekenntnis zur Kauf-
mannschaft entnehmen.
Beim Spracherwerb haben in dieser ,frhen Zeit ohne ein ein-
ziges ausreichendes Wrterbuch der modern-griechischen Sprache
die Volkslieder das Beispiel der gesprochenen Gegenwartssprache, sozusagen
von oraler Fixierung, geben knnen. Dieses Motiv seitens des Lehrers
stand, weil der Schler danach verlangte,
63
am Beginn der Verschrift-
lichung, nicht die Absicht auf eine Sammlung. Der griechische Text der
Sammlung Haxthausen, der als Manuskript mehrfach kopiert wurde,
ist eine Handschrift von Manoussis. Dessen Manuskript C liegt ma-
geblich der Haxthausenschen Sammlung zugrunde.
64
Die eigentliche
Informantin jedoch, der Manoussis seine Erinnerung verdankte, als er
die Lieder niederschrieb, war seine Gromutter Alexandra.
65
Politis un-
terstreicht das Ergebnis seiner Archivforschungen: Die erste Sammlung,
hatte zum Ziel, mit Hilfe der Konspiration eine bewaffnete, koordinierte Revolte
gegen die osmanische Herrschaft zu richten. Kapodistrias, ein von der Insel Korfu
abknftiger Adeliger und gewandter Diplomat, der ab 1816 Auenminister des
Zaren Alexander werden sollte, trug man die Fhrerschaft an, die er aber ablehnte
ohne die Konspiration zu verraten. Ihm zufolge sollte ein Aufstand lieber als Ne-
benschauplatz bei bevorstehenden russisch-trkischen Kriegen erfolgen. Erst ab
1818 wuchs die Zahl der Mitglieder auf ca. 1000, die meisten von ihnen in den
Zentren der Diaspora (Wien, Jassy, Odessa, Paris).
62
A. Politis: H ovoouj, S. 116.
63
A. Politis zitiert einen langen Abschnitt aus dem |q o Aoto von 1816,
S. 401, worin dies als anonymisiert publizierte Nachricht mitgeteilt und das bal-
dige Erscheinen einer Sammlung von 50 Liedern in bersetzung angekndigt ist
(ebd., S. 113).
64
Schulte-Kemminghausen: Vorwort, in: Haxthausen: Volkslieder, S. 6.
65
A. Politis: H ovoouj, S. 117; vgl. Variante in Haxthausen: Volkslieder, S. 157.
324 Chryssoula Kambas
die sich in einer recht fortgeschrittenen und integralen Form nachweisen
lt, ist die von Haxthausen.
66
Weiter ist auffllig, da bei Fauriel ein Teilcorpus zur Haxthausen-Ma-
noussis-Sammlung identischer Texte erscheint, in der Grenordnung
von etwa einem Viertel. Manoussis, vertraut man seinem Nekrologen,
schickte schon im November 1816 ber Alexandros Vassiliou eine Ab-
schrift seiner Sammlung an den berhmten, in Paris lebenden griechi-
schen Gelehrten Adamantios Korais. Der aber mu die Unterlagen igno-
riert haben. Spter schrieb Manoussis erneut wegen der Publikation an
den Pariser Griechen Nikolaos Pikkolos. Pikkolos war ab 1823 Grie-
chischlehrer von Fauriel und sprach diesen auf die ihm von Korais ber-
mittelte Liedsammlung an, da er von einem generellen Interesse Fauriels
an der altprovencalischen Liedberlieferung wute. Gemeinsam wand-
ten sie sich erneut an Manoussis, um von diesem Abschriften mit weite-
ren Liedern zu erhalten.
67
Fauriel allerdings geht im Vorwort zu seiner
Sammlung anders vor. Er prsentiert sie so, als stamme der Grundstock
von dem berhmten Korais, den ein gewisser Herr Pikkolos dann ber-
mittelt habe. Politis kommt auf der Basis seiner Manuskriptstudien in den
Archiven Fauriel und Victor Cousin zu dem Ergebnis, von einer Pariser
Abschrift Manoussis-Haxthausen
68
zu sprechen. Diese Sammlung sei
durch die Hnde von Korais, Klonaris, Pikkolos und Fauriel gegangen.
Nur wenige der gebildeten Griechen hielten die Volkslieder fr wert,
verschriftet zu werden; zumal es auch sehr ,unmoralische (orouoto),
vergleichbar den von Brentano und Arnim aus dem Wunderhorn ausge-
sonderten ,Schundliedern, in beachtlicher Anzahl gibt. Der westliche
Naturpoesie-Enthusiasmus nach Herder und den weiteren Herausge-
bern der Romantik traf mit dem zeitgleich andersgerichteten griechi-
schen Bemhen zusammen, die gesprochene Volkssprache mit Hilfe des
Altgriechischen zu einer knstlichen Schriftsprache umzubauen. Korais
etwa, der ein kritisches Bemhen um die Entstehung der Katharevoussa
verfolgte, stand den Volksliedern entsprechend fern. Insofern gingen
Tatkraft und Initiative zu den Liedsammlungen von Neugriechisch lernen-
den Philhellenen und Philologen (Sprachlehrern) als bersetzern aus. Und ihnen,
den Philhellenen und ihren Griechischlehrern, so Politis, gebhre auch
das Verdienst um diese Grundlage der neugriechischen Literatur. Denn
ein ursprnglich literarisches Interesse daran seitens der Lehrer und In-
66
A. Politis: H ovoouj, S. 146.
67
Ebd., S. 295f.
68
Ebd., S. 296.
Das griechische Volkslied Charos 325
formanten Manoussis und Moustoxidis war nur von kurzer Dauer, also
wenig originr. So zeigten sie nach 1825 berhaupt kein weiteres Bem-
hen, die zunchst nur rudimentre Ausgangslage zu erweitern oder etwa
das Vorhandene fr Leser in Griechenland zugnglich zu machen.
Was zeigt das Ineinandergreifen des Bestandes beider Sammlungen,
der deutschen und der franzsischen? 1. Manoussis gebhrt eine ent-
scheidende Beachtung mit Blick auf die Fauriel-Sammlung. 2. Haxthau-
sen, der bei dem Druck-Angebot von Cotta 1823 zuvor Fauriel Abglei-
chung und wechselseitigen Austausch anbot, wute offenbar von
vorherigen Initiativen von Seiten Manoussis in Frankreich nichts. Sollte
er von der Sachlage daraufhin erfahren haben, erklrt auch dies das Auf-
geben seines Vorhabens. Die Sammlung lie sich fr ihn dann eher nur als
Stoff fr weitergehende ethnologisch-sprachlich-empirische Aufgaben
begreifen. 3. Was den hartnckigen Goethe-Kommentar-Mythos von
der geburtshelferischen Rolle des Wiener Bibliothekars und Slawisten
Kopitar betrifft, der sich um Vuk Karidzic Sammlung Verdienste er-
warb, so drfte dieser ausschlielich auf Kopitar selbst als Hauptquelle
zurckzufhren sein. Er behauptete in einem Brief an Therese von Ja-
kob 1824, er habe 1814 dem Baron von Haxthausen 100 griechische
wrtlich bersetzte Volkslieder zum Zwecke der Publikation mit Goethe
berreicht.
69
Laut der Rekonstruktionen von Politis wute Kopitar ver-
mutlich von der Existenz der Manoussis-Haxthausen-Sammlung, doch
weilte er zum Zeitpunkt ihres Entstehens im Frhjahr 1815 selbst in Pa-
ris.
70
Kopitar hat, so schliet Politis, keinen Anteil am Text-Entstehen,
auch nicht dem der bersetzungen.
Fauriels Sammlung ist bis heute grundlegend, nicht allein fr den
Lied- bzw. Gedichttypus neugriechisches Volkslied. Sie ist, bis in die
Kategorien hinein, das Vorbild, nach dem weit spter erst umfassende
eigene neugriechische Volkslieder-Sammlungen erstellt wurden. Von
wirklicher Bedeutung als eigenstndige griechische Sammlung wurde
69
Schulte-Kemminghausen, in: Haxthausen, Volkslieder S. 5f. Diese Formulierung
stammt aus dem Brief von Therese von Jakob an Goethe (23. 7. 1824): [] so
schreibt mir Herr von Kopitar []: Es seyen dem Hofr. Haxthausen, im Jahre
1814 100 griechische Lieder, wrtlich bersetzt, zur Herausgabe mit Ihnen, Hoch-
verehrtester! anvertraut worden. Der Eindruck entstand bis 1935, Kopitar habe
die Sammlung nach griechischer Seite hin irgendwie angeregt und untersttzt, bis
hin zur wrtlichen bersetzung, fr Versifikation und Herausgabe sollte dann
Haxthausen zusammen mit Goethe sorgen. Die Festschreibung dieser Sicht er-
folgt bis heute: FA 21, S. 896.
70
Politis: H ovoouj, S. 116.
326 Chryssoula Kambas
erst die dreibndige Ausgabe von Nikolaos Politis, gut hundert Jahre
nach Haxthausen.
71
Das hat seinen Grund in der erst spten Durchset-
zung der gesprochenen Volkssprache als Literatursprache und im
Sprachzustand wie in den Sprachkmpfen bereits um 1820, ber die
auch Haxthausen Goethe gegenber Andeutungen machte und die um
1900 erst, mit der Durchsetzung der Dimotiki u. a. mit Hilfe der grie-
chischen Volksliedforschung fr die Literatursprache, lngst noch
nicht fr die Wissenschaftssprache, einen gewissen Abschlu fanden.
72
Die Sammlungen der Philhellenen spiegeln strker die romantisch-
philologischen Ambitionen der deutschen und franzsischen nachklas-
sischen Literatur als den Weg der Griechen zu ihrer eigenen. Aller rela-
tiven Geringfgigkeit von Goethes Beitrag zum Trotz wirkte er publizi-
stisch als eine eindruckweckende, einladende Geste fr die kleinen
Lieder gegenber einer Leserschaft, die ber den Philhellenismus hin-
ausreichte.
Siglenverzeichnis
Goethe FA
FA 10: Goethe, Johann Wolfgang: Johann Wolfgang Goethe. Smtliche Werke, Briefe,
Tagebcher und Gesprche. 40 Bde.hrsg. von Hendrik Birus. Abt. II: Briefe, Tage-
bcher und Gesprche; Bd. 10: Die letzten Jahre: Briefe, Tagebcher und Gesprche von
1823 bis zu Goethes Tod. Teil 1: Von 1823 bis zum Tode Carl Augusts 1828. Horst
Fleig (Hrsg.): Frankfurt a.M. 1993.
FA 12: Goethe, Johann Wolfgang: Bezge nach Auen, bersetzungen II, Bear-
beitungen, hrsg. von Hans-Georg Drewitz, in: Johann Wolfgang Goethe Smtliche
Werke, Briefe, Tagebcher, Gesprche. 40 Bde. Friedmar Apel u. a. (Hrsg.), Abt. I,
Bd. 12: Frankfurt a.M. 1999.
FA 21: Goethe, Johann Wolfgang: sthetische Schriften 18211824, in: Goethe,
ber Kunst und Altertum III IV, Abt. I, Bd. 21. Stefan Greif/ Andrea Ruhlig
(Hrsg.): Frankfurt a.M. 1998.
FA 22: Goethe, Johann Wolfgang: sthetische Schriften 18241832, in: Goe-
the, ber Kunst und Altertum VVI, Abt. I, Bd. 22. Anne Bohnenkamp (Hrsg.):
Frankfurt a.M. 1999.
71
Die handlichere Fassung der Auswahl fr das breite Publikum ist bis heute ein-
schlgig. Politis, Nikolaos G.: '|/oo oo ro rootto ro ///qvto /oo.
72
Dazu Kambas, Chryssoula/Mitsou, Marilisa: Zum Ort des Neugriechischen:
Sprache, Literatur-Sprache, Philologie-Transfer, in: Christoph Knig (Hrsg.): Das
Potential europischer Philologien. Geschichte Leistung Funktion. Im Druck.
Das griechische Volkslied Charos 327
Literaturverzeichnis
Quellen
Aridas, Georgios: Vierzig Pallikaren, die ziehn zur Stadt hinaus. Neugriechische Volks-
lieder. Leipzig 1987.
Bartholdy, Jakob Ludwig Salomo: Bruchstcke zur nhern Kenntnis des heutigen Griechen-
lands gesammelt auf einer Reise im Jahre 18031804. Berlin 1805.
Fauriel, Claude: |//qvto qorto rootto (Griechische Volkslieder). A H
ooq rot 18241825. 2 Bde. Alexis Politis (Hrsg.): Iraklio 2000.
: Toyo uoto Puoto. Gesammelt und herausgegeben von Claude Fauriel. ber-
setzt und mit des franzsischen Herausgebers und eigenen Erluterungen verse-
hen von Wilhelm Mller. Ersther Teil. Leipzig 1825.
Haxthausen, Werner von: Neugriechische Volkslieder gesammelt von Werner von Haxthau-
sen. Urtext und bersetzung. Karl Schulte-Kemminghausen/Gustav Soyter (Hrsg.).
Mnster 1935.
Herder, Johann G.: Stimmen der Vlker in Liedern. Leipzig 1978.
Iken, Carl (Hrsg.): Leukothea. Eine Sammlung von Briefen eines geborenen Griechen
ber Staatswesen, Literatur und Dichtkunst des neueren Griechenlands, 1. Bd. Leipzig
1825.
Thiersch, Friedrich: Ueber die neugriechische Poesie, besonders ber ihr rhythmisches und
dichterisches Verhltnis zur altgriechischen. Vorgelesen in einer ffentlichen Sitzung
der k. Akademie der Wissenschaften zu Mnchen am 28. Mrz 1828 zur Feyer ih-
res 69. Stiftungs-Tages. Mnchen 1828.
Forschungsliteratur
Albrecht, Michael von: Folkore und Weltliteratur: Brcken zwischen Knsten, Ge-
sellschaftsschichten, Vlkern. Goethe und das Volkslied, in: Ders. (Hrsg.): Lite-
ratur als Brcke. Studien zur Rezeptionsgeschichte und Komparatistik. Hildesheim
2003, S. 263325.
Arnold, Robert F.: Der deutsche Philhellenismus. Kultur- und literarhistorische Untersuchun-
gen. Mitteilungen aus der Literatur des 19. Jahrhunderts und ihrer Geschichte. Ergn-
zungsheft zu Euphorion, Bd. 2. Bamberg 1895 (Reprint Nendeln 1970).
Boyle, Nicholas: Griechischer Befreiungskampf , in: Dietrich Dahnke/Regine Otto
(Hrsg): Goethe-Handbuch, Bd. 4.1. Stuttgart 1998, S. 446448.
Clogg, Richard: Geschichte Griechenlands im 19. und 20. Jahrhundert. Ein Abri. Kln
1997.
Dieterich, Karl: Goethe und die neugriechische Volksdichtung., in: Hellas-Jahrbuch.
Organ der deutsch-griechischen Gesellschaft und der griechisch-deutschen Gesellschaft,
1/1929, S. 6181.
Espagne, Michel: Le paradigme de ltranger. Les chaires de littrature trangre au XIX
e
si-
cle. Paris 1993.
: Le philhellnisme entre philologie et politique. Un transfert franco-allemand.,
in: Revue Germanique Internationale, 12/2005: Philhellnismes et transferts cultu-
rels dans lEurope du XIX
e
sicle. Paris 2005, S. 6176.
328 Chryssoula Kambas
Hennig, John: Die literarischen Grundlagen von Goethes Kenntnis des zeitgenssi-
schen Griechenlands., in: Ders.(Hrsg.): Goethes Europakunde. Goethes Kenntnis des
nichtdeutschsprachigen Europas. Ausgewhlte Aufstze. Amsterdam 1987, S. 335341.
Hesseling, Dirk Christiaan: Charos. Ein Beitrag zur Kenntniss des neugriechischen Volks-
glaubens. Leiden o. J. [1897].
Mller, Heidy Margrit: Goethe en Griekenland., in: Tetradio. Tijdschrift van het Grie-
kenlandcentrum, 1994, 3, S. 101130.
Ibrovac, Miodrag: Claude Fauriel et la fortune europenne des posies populaires grecque et
serbe, tude dhistoire romantique, suvie du cours de Fauriel (La Posie populaire des Serbes
et des Grecs, professe en Sorbonne (18311832), documents indites). Paris 1966.
Kambas, Chryssoula/Mitsou, Marilisa: Zum Ort des Neugriechischen: Sprache,
Literatur-Sprache, Philologie-Transfer, in: Christoph Knig (Hrsg.): Das Potential
europischer Philologien. Geschichte Leistung Funktion. Im Druck.
Kedrotis, Jorgos: `H rtoqooj ouo rjvtuv ojottuv toyouotuv 0 tv
Iottr. Htooj rjvruttj ooryytoj (Die bersetzung zweier griechi-
scher Volkslieder durch Goethe. Vorschlag zu einer hermeneutischen Annhe-
rung.), in: N|A |lTIA, Heft 1721, Mrz 2000, S. 372391.
Mitsou, Marilisa: Alte und neue Unterweltmotive im griechischen Volkslied,
(unverffentlichtes Typosskript).
: ,Ho0 rrt vo ototrrt? otro oto yto to toyouoto to0 Kotu
Koou.(,Wohin wirst du scheiden? Weitere Aufzeichnungen zu den Unter-
welt-Liedern.), in: N|A |lTIA, Dezember 2003, Heft 1762, S. 828836.
Politis, Alexis: H ovoouj tuv rjvtuv ojottuv toyouotuv. Ho-
o0rort, ooo0rtr oi ojtouyio tj utj ouoyj. (Die Entdek-
kung der griechischen Volkslieder. Voraussetzungen, Bemhungen und die Schaf-
fung der ersten Sammlung). Athen 1984.
Politis, Nikolaos G.: Nror//qvtq :0o/o|o (Neugriechische Mythologie). Athen 1877.
: '|/oo oo ro rootto rot ///qvto /oo. (Auswahl aus den Liedern des
griechischen Volkes). Athen o.J [1914].
Psycharis, Ioannis: Quelques travaux de linguistique, de philologie et de littrature hellni-
ques: 18841928, Bd. 1. Paris 1930.
Quack-Eustathiadis, Regine: Der deutsche Philhellenismus whrend des griechischen Frei-
heitskampfes 18211827. Mnchen 1984.
Scheidig, Walter: Goethes Preisaufgaben fr bildende Knstler 17991805. Weimar 1958.
Sgoff, Brigitte: Claude Fauriel und die Anfnge der romanischen Sprachwissenschaft. Diss.
Mnchen 1994.
Soyter, Gustav: Goethe und das neugriechische Volkslied, in: Gymnasium. Zeit-
schrift fr Kultur der Antike und humanistische Bildung, 58/1951, S. 5571.
Die Stimme des griechischen Volkes 329
Sandrine Maufroy
Die Stimme des griechischen Volkes:
Sammlungen neugriechischer Volkslieder in
Deutschland und Frankreich
Volkslieder sind Stimmen der Vlker. Und so mge auch die kraftvolle, aus tief-
ster Brust empor klingende Stimme des griechischen Volkes in die Ohren derer
tnen, die Ohren haben zu hren. Wer aber seine Sinne durch trkisches Opium
umnebelt und erschlafft hat, der schone seines Trommelfelles. Es mchte diesen
Stentor wohl nicht ertragen knnen.
1
Mit diesen Worten schliet Wilhelm Mller die Vorrede zu seiner ber-
setzung der 182425 erschienenen Chants populaires de la Grce moderne
von Claude-Charles Fauriel.
2
Dieser herausfordernden Anrede an den
Leser, in der die sthetische Wirkung der neugriechischen Lieder und
ihre politische Tragweite eng miteinander verbunden sind, liegt die Auf-
fassung zugrunde, die griechischen Volkslieder seien der unmittelbare
Ausdruck der griechischen Volksseele und knnten direkt rezipiert
und (zumindest in sthetischer Hinsicht) verstanden werden. Da Wil-
helm Mller sich aber auf Herder
3
und auf das Matthusevangelium be-
1
Mller, Wilhelm: Neugriechische Volkslieder. Gesammelt und herausgegeben von
C. Fauriel. bersetzt und mit des franzsischen Herausgebers und eigenen Erluterungen
versehen von Wilhelm Mller. Erster Theil. Leipzig 1825, S. XII.
2
Fauriel, Claude: Chants populaires de la Grce moderne, recueillis et publis, avec une tra-
duction franaise, des claircissements et des notes, par C. Fauriel. Tome 1
er
. Chants histo-
riques. Tome 2. Chants historiques, romanesques et domestiques. Paris 18241825.
3
In seiner Schrift Adrastea hatte Herder erklrt, da er eine neue, palingenisirte
Sammlung von Volksliedern, vermehrt, nach Lndern, Zeiten, Sprachen,
Nationen geordnet und aus ihnen erklrt, als eine lebendige Stimme der Vlker, ja
der Menschheit selbst vorbereite (Herder, Johann Gottfried: Adrastea, in: Herders
Smmtliche Werke. Adrastea, Bd. 24, hrsg. von Bernhard Suphan. Berlin 1886,
S. 266). Nach Herders Tod bearbeiteten Johannes von Mller und Caroline Her-
der eine Sammlung, die sie 1807 unter dem Titel Stimmen der Vlker in Liedern
herausgaben. Diese Vulgatausgabe von Herders Volksliedersammlung spielte
fr die Rezeption eine viel grere Rolle als die von Herder selbst bearbeiteten
330 Sandrine Maufroy
zieht,
4
verrt, da diese postulierte Unmittelbarkeit eine Illusion ist.
Und wenn man bedenkt, da die Leser Wilhelm Mllers die deutsche
bersetzung einer franzsischen Sammlung von ursprnglich mndlich
tradierten griechischen Liedern vor sich hatten, so liegt die Vermutung
nahe, da selbst der Begriff neugriechische Volkslieder ein Konstrukt
und das Ergebnis vielfacher kultureller Transfers ist.
5
Man kann folglich
die Hypothese aufstellen, da im interkulturellen Dialog ein Diskurs
ber die neugriechischen Volkslieder entstand, der auf Elemente des
philhellenischen Diskurses und des allgemeinen Diskurses ber die
Volkslieder zurckgriff, diese aber zugleich umformte.
6
Ziel unserer Un-
tersuchung ist es, zur Analyse dieses Diskurses beizutragen, wobei der
Schwerpunkt auf der Rolle deutsch-franzsischer Transfers liegt. Zu die-
sem Zweck konzentrieren wir uns auf die Paratexte (Vorworte, Kommen-
tare zu einzelnen Liedern, Anhnge) zu Fauriels Chants populaires de la
Grce moderne und zu den deutschen und franzsischen Sammlungen,
die in den beiden Jahrzehnten nach Erscheinen dieses Werks verffent-
licht wurden.
Sammlungen (Alte Volkslieder, 1773; Volkslieder, 177879). Der Plural im Titel
(Stimmen), der Herders synthetischer Absicht nicht gerecht wird, sttzt sich
wohl auf eine Skizze, die Caroline Herder unter Herders Papieren gefunden ha-
ben will. Vgl. Redlich, Carl: Einleitung, in: Herders Smmtliche Werke. Herders
Poetische Werke, Bd. 25, hrsg. von Bernhard Suphan. Berlin 1885, S. IXXI; Gaier,
Ulrich: Kommentar, in: Johann Gottfried Herder. Werke in zehn Bnden.
Johann Gottfried Herder. Volkslieder. bertragungen. Dichtungen, Bd. 60, hrsg. von
Martin Bollacker. Frankfurt a.M. 1990, S. 903909 und 924.
4
Der Ausdruck Ohren haben zu hren verweist auf Matthus 11, 15, wo es heit:
Wer Ohren hat zu hren, der hre!.
5
Zum Begriff der kulturellen Transfers vgl. u. a. Espagne, Michel: Les Transferts cul-
turels franco-allemands. Paris 1999; Espagne, Michel/Werner, Michael: Deutsch-
franzsischer Kulturtransfer als Forschungsgegenstand. Eine Problemskizze, in:
dies. (Hrsg.): Transferts. Les Relations interculturelles dans lespace franco-allemand
(XVIII
e
et XIX
e
sicle). Paris 1988, S. 1134.
6
Bei der Verwendung des Diskursbegriffs orientieren wir uns an Michel Foucaults
Analysen. Vgl. Foucault, Michel: Larchologie du savoir. Paris 1969; Foucault, Mi-
chel: Lordre du discours. Paris 1971.
Die Stimme des griechischen Volkes 331
1. Die Nachfolger Fauriels (18251850er Jahre)
Fauriels Sammlung ist bekanntlich die erste ihrer Art.
7
Der Kontext ih-
rer Entstehung zeigt, da eine solche Sammlung neugriechischer Volks-
lieder sowohl von den deutschen als auch von den griechischen und
franzsischen Gelehrten erwnscht war.
8
Auerdem war Fauriel einer
der bedeutendsten Vermittler zwischen Deutschland und Frankreich,
der auch deutsches Gedankengut in seine Sammlung aufnahm. Es ist
deshalb nicht erstaunlich, da Fauriels Sammlung im gesamteuropi-
schen Vergleich bei den franzsischen Lesern und beim deutschen Lese-
publikum die strkste Rezeption erfuhr.
9
Schon im Jahr 1825, d. h. kurz
nach Erscheinen des zweiten Bandes, wurden zwei voneinander unab-
hngige deutsche bersetzungen der Sammlung verffentlicht. Die er-
ste bersetzung ist eine Gemeinschaftsarbeit, bei der u. a. der Philologe
Johann Peter Pauls, der Naturwissenschaftler Christian Gottfried Nees
von Esenbeck (17761858) und dessen Sohn Karl mitwirkten.
10
Sie ent-
7
ber Fauriel, seine Rolle als deutsch-franzsischer Vermittler und seinen Beitrag
zum Philhellenismus vgl. Galley, Jean-Baptiste: Claude Fauriel, membre de lInstitut.
17721843. Saint-Etienne 1909; Espagne, Michel: Claude Fauriel en qute dune
mthode, ou lIdologie lcoute de lAllemagne, in: Romantisme. Revue de la
Socit des tudes romantiques et dix-neuvimistes 21/1991, 73, S. 718; Espagne,
Michel: Le paradigme de ltranger. Les chaires de littrature trangre au XIX
me
sicle.
Paris 1993; Espagne, Michel: Le philhellnisme entre philologie et politique. Un
transfert franco-allemand, in: ders./Gilles Pcout (Hrsg.): Philhellnismes et trans-
ferts culturels dans lEurope du XIX
e
sicle. Revue germanique internationale 2005, 12,
S. 6175. ber Fauriels Sammlung neugriechischer Volkslieder vgl. Ibrovac, Mio-
drag: Claude Fauriel et la fortune europenne des posies populaires grecque et serbe. Etude
dhistoire romantique suivie du Cours de Fauriel profess en Sorbonne (18311832). Paris
1966; Politis, Alexis: I anakalypsi ton ellinikon dimotikon tragoudion. Athen 1984.
8
Noch bevor Fauriel anfing, Texte zu sammeln, beschftigten sich andere Gelehrte
mit neugriechischen Volksliedern. Sismondi kam nicht ber die ersten Anstze
hinaus, aber dem Franzosen Jean-Alexandre Buchon (17911846) und dem West-
falen Werner von Haxthausen (17821842) gelang es, vollstndige Textsammlun-
gen zusammenzustellen und Muster ihrer bersetzungen zu verffentlichen. Vgl.
hierzu Politis: I anakalypsi, S. 85197. Haxthausens Sammlung wurde 1935 heraus-
gegeben: Schulte-Kemminghausen, Karl/Soyter, Gustav (Hrsg.): Neugriechische
Volkslieder gesammelt von Werner von Haxthausen. Urtext und bersetzung. Mn-
ster i. W. 1935.
9
ber die Rezeption von Fauriels Sammlung in Europa vgl. Ibrovac: Claude Fau-
riel, S. 153237.
10
Mittheilungen aus der Geschichte und Dichtung der Neu-Griechen. Erster Band. Histori-
sche Volksgesnge der Neu-Griechen nach C. Fauriel. Erste Abtheilung. Fauriels Einlei-
tung zur Geschichte der Neu-Griechischen Volkspoesie. Aus dem Franzsischen. Koblenz
332 Sandrine Maufroy
hlt den gesamten Discours prliminaire Fauriels, aber nur den ersten
Teil der Lieder, nmlich die historischen Lieder. Vollstndiger, be-
kannter und verbreiteter war die bersetzung Wilhelm Mllers.
11
Dieser
stellte der Sammlung seine eigene Vorrede voran, nahm einige nde-
rungen in den erluternden Teilen des Werkes vor und erklrte, seine
bertragung der gesammelten Lieder richte sich sowohl an Laien als
auch an Kenner der griechischen Sprache.
Fauriels Sammlung und insbesondere sein Discours prliminaire
wurden zum Nachschlagewerk fr jeden, der sich fr die neugriechische
Volksdichtung und fr Griechenland im Allgemeinen interessierte. So
schrieb Karl Theodor Kind 1827:
Uebrigens giebt Fauriels discours prliminaire im Allgemeinen ber die poetischen
Vorzge der neugriechischen Volkspoesie und ihrer einzelnen Gattungen man-
chen Aufschlu, und aus mehr als einem Grunde ist es nothwendig, da derje-
nige, welcher die neugriechische Volksdichtkunst kennen lernen und mit Nutzen
neugriechische Volkslieder lesen will, jenen discours kenne, um nach dem Allge-
meinen das Einzelne beurtheilen und wrdigen zu knnen.
12
1825; Mittheilungen aus der Geschichte und Dichtung der Neu-Griechen. Zweiter Band.
Historische Volksgesnge der Neu-Griechen nach C. Fauriel. Zweite Abtheilung. Klephti-
sche und andere historische Gesnge, dann Lieder vom Suliotenkrieg. Mit Fauriels Einlei-
tungen. Koblenz 1825. Die bertragungen aus dem Neugriechischen, die Goethe
1823 in seiner Zeitschrift ber Kunst und Altertum verffentlicht hatte, wurden in
unvernderter Form bernommen, obwohl sie auf Buchons Vorlagen beruhten
und von Fauriels Text abwichen. Der Briefwechsel zwischen Christian Gottfried
Nees von Esenbeck und Goethes Mitarbeiter Johann Peter Eckermann gibt Auf-
schlu ber die Entstehung dieser deutschen Ausgabe von Fauriels Sammlung.
Vgl. Nees von Esenbeck, Christian Gottfried: Briefwechsel mit Johann Wolfgang von
Goethe nebst ergnzenden Schreiben. Kai Torsten Kanz (Hrsg.): Halle 2003, S. 365397.
11
Mller, Wilhelm: Neugriechische Volkslieder. Gesammelt und herausgegeben von C. Fau-
riel. bersetzt und mit des franzsischen Herausgebers und eigenen Erluterungen versehen
von Wilhelm Mller. Erster Theil. Geschichtliche Lieder. Zweiter Theil. Romantische und
husliche Lieder nebst Anhang. Leipzig 1825.
12
Kind, Karl Theodor: Eunomia. Dritter Band. Enthaltend: Neugriechische Volkslieder
im Originale und mit deutscher Uebersetzung, nebst Sach- und Worterklrungen. Ders.
(Hrsg.): Grimma 1827, S. IXX. Vgl. auch Kind, Karl Theodor: Neugriechische Poe-
sieen, ungedruckte und gedruckte, mit Einleitung und sowohl Sach- als Wort-Erklrungen.
Ders. (Hrsg.): Leipzig 1833, S. XXI: Von dieser Sammlung Fauriels, namentlich
auch in Betreff des voranstehenden Discours prliminaire, mu ein Jeder ausgehen,
der die neugriechische Volkspoesie kennen lernen will, da nur sie die Grundlage
ist, auf welcher sich die Auffassung der inneren Eigenthmlichkeiten und die
Kenntni des Wesens derselben mit sicherem Erfolge erlangen lt. Inde war
und ist jene Sammlung nicht erschpfend, und sie machte vielmehr eben so das
Verlangen nach Vermehrung der uns durch sie gewordenen Schtze rege, als auch
Die Stimme des griechischen Volkes 333
Im selben Werk aber uerte Karl Theodor Kind auch ein differenzier-
teres Urteil ber Fauriels Leistung:
[] so ist doch berhaupt nicht zu verkennen, da Fauriel mit seiner Sammlung
nur einen Anfang gemacht, da er uns vielmehr auf das, was wir von einer nhern
Kenntni der neugriechischen Volkspoesie erwarten knnten, nur hingewiesen,
als die Sache erschpft habe. Das konnte inde kaum anders seyn, und Fauriel
verdient immer Dank fr das Gegebene und fr die Art, wie er es gegeben (beson-
ders auch fr den discours prliminaire und die arguments), auch insofern er dem In-
teresse an der neugriechischen Volkspoesie dadurch Ansto gegeben hat.
13
Diese uerung ist charakteristisch fr die Rezeption von Fauriels
Sammlung durch deutsche und franzsische Leser. Man begngte sich
nicht damit, die Lieder zu lesen und Informationen aus den Kommen-
taren des Herausgebers zu schpfen, sondern man lie sich von ihnen
inspirieren. Fauriels Sammlung erschien als ein erster Ansatz, den man
fortsetzen mute. Erstens gab man sich mit Fauriels wrtlichen, in Prosa
verfaten bersetzungen nicht zufrieden: Deutsche und franzsische
Dichter wie Johann Wolfgang von Goethe (17491832),
14
Wilhelm Ml-
zugleich die Mglichkeit klar, sie fr die einzelnen Klassen der Volkspoesie der
Neugriechen, welche die Sammlung selbst nach inneren Grnden aufstellt, auch
wirklich vermehren zu knnen. Der erste Band der Chants populaire de la Grce
moderne hatte in Frankreich so viel Erfolg, da Fauriel eine zweite Auflage plante
(vgl.Ibrovac: Claude Fauriel, S. 137).
13
Kind: Eunomia, S. VII.
14
Noch bevor Fauriel seine Sammlung verffentlichte, gab Goethe sechs Neugrie-
chisch-epirotische Heldenlieder und das Gedicht Charon in seiner Zeitschrift
ber Kunst und Alterthum (1823, Bd. 4,1, S. 5464 und Bd. 4,2, S. 4950) heraus
(vgl. von Goethe, Johann Wolfgang: Neugriechisch-epirotische Heldenlieder,
in: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Groherzogin Sophie von
Sachsen. Gedichte. Dritter Theil, Bd. 3. Weimar 1890, S. 213221). Diese berset-
zungen beruhten auf Texten, die Alexandre Buchon und Werner von Haxthausen
ihm mitgeteilt hatten. Spter inspirierten ihn die Chants populaires de la Grce mo-
derne zu neuen bersetzungen (vgl. Goethe, Johann Wolfgang von: Neugriechi-
sche Liebeskolien, in: Goethes Werke. Gedichte. Dritter Theil, Bd. 3, S. 222226).
ber Goethes bersetzungen von neugriechischen Volksliedern vgl. Mller,
Heidy Margrit: Goethe, collectionneur et traducteur de chants populaires grecs
modernes, in: Jean-Marie Valentin (Hrsg.): Goethe. LUn, lAutre et le Tout. Paris
2000, S. 91112; Dieterich, Karl: Goethe und die neugriechische Volksdich-
tung, in: Hellas-Jahrbuch, 1929, S. 6181; Soyter, Gustav: Die Quellen zu Goe-
thes bertragungen aus dem Neugriechischen, in: Hellas-Jahrbuch, 1936,
S. 6773; Irmscher, Johannes: Goethe und die neugriechische Literatur, in: Goe-
the-Jahrbuch 98/1981, S. 4348. S. hierzu ferner den Beitrag von Chryssoula Kam-
bas im vorliegenden Band.
334 Sandrine Maufroy
ler (17941827),
15
Johann Heinrich Schlosser (17801851),
16
Conrad
Friedrich von Schmidt-Phiseldeck (17701832),
17
Adelbert von Cha-
misso (17811838),
18
Npomucne Lemercier (17711840)
19
und Louise
Swanton-Belloc (17961881)
20
setzten sie in Verse. Diese bersetzungen
bercksichtigen wir hier nicht, denn sie sind einer eigenen Untersu-
chung wert, die uns zu weit fhren wrde.
Zweitens wurde Fauriels Leistung von einem philologischen Stand-
punkt aus kritisiert. In der Vorrede zu seiner bersetzung erklrte Wil-
helm Mller, da Fauriel sozusagen nur der Zwischentrger seiner
griechischen Informanten gewesen sei, wobei er zugab, da der Mangel
an literarischen Hlfsmitteln keine andere Methode zulie, als die
Griechen zu befragen.
21
Aber auch Fauriels editorische Prinzipien schie-
15
Auer seiner vollstndigen bersetzung von Fauriels Sammlung verffentlichte
Wilhelm Mller freie Bearbeitungen griechischer Distichen in verschiedenen
Zeitschriften: vgl. Mller, Wilhelm: Reime aus den Inseln des Archipelagus, in:
Wilhelm Mller. Werke. Tagebcher. Briefe. Mit einer Einleitung von Bernd
Leistner. Wilhelm Mller. Gedichte 2, Bd. 2. Maria-Verena Leistner: Berlin 1994,
S. 3040. ber Wilhelm Mllers bertragungen neugriechischer Lieder und Di-
stichen vgl. Caminade, Gaston: Les Chants des Grecs et le philhellnisme de Wilhelm
Mller. Paris 1913, S. 147159.
16
[Schlosser, Johann Heinrich Friedrich:] Neugriechische Volkslieder. [Frankfurt a.M.]
1825 [als Manuscript fr Freunde gedruckt]. Nach Schlossers Tod gab Sophie
Schlosser diese Gedichte in folgender Sammlung heraus: Wanderfrchte. Sammlung
auserlesener Poesien aller Zeiten in Uebertragungen, von Johann Friedrich Heinrich Schlos-
ser. Aus dessen Nachla herausgegeben von Sophie Schlosser. Mainz 1856.
17
Von Schmidt-Phiseldeck, Conrad Friedrich: Auswahl Neugriechischer Volkspoesien,
in Deutsche Dichtungen umgebildet von C.F. v. Schmidt-Phiseldeck. Braunschweig 1827.
18
Von Chamisso, Adelbert: Verratene Liebe, Georgis, Die schne Sngerin,
Das Mdchen und das Rebhuhn, in: Adelbert von Chamisso. Smtliche Werke
in zwei Bnden. Nach dem Text der Ausgaben letzter Hand und den Handschrif-
ten. Textredaktion: Jost Perfahl. Bibliographie und Anmerkungen von Volker
Hoffmann. Prosa. Dramatisches. Gedichte. Nachlese der Gedichte, Bd. 1. Jost Perfahl/
Volker Hoffmann (Hrsg.): Mnchen 1975, S. 230231, S. 357360, S. 723725.
S. hierzu den Beitrag von Gilbert He im vorliegenden Band.
19
Lemercier, Npomucne: Chants hroques des montagnards et matelots grecs, Traduits
en vers franais Par M. Npomucne L. Lemercier, de lInstitut Royal de France (Acadmie
Franaise). Paris 1824; Lemercier, Npomucne: Suite des chants hroques et populai-
res des soldats et matelots grecs; Traduits en vers franais Par M. Npomucne L. Lemercier,
de lInstitut Royal de France (Acadmie Franaise). Paris 1825.
20
Swanton-Belloc, Louise: Bonaparte et les Grecs, par Madame Louise Sw.-Belloc, suivi
dun tableau de la Grce, en 1825, par le Comte Pecchio. Paris 1826.
21
Wilhelm Mller schrieb nmlich, da wir fast sagen mchten: Herr Fauriel sei
nur der Zwischentrger jener gewesen, um ihr Werk dem franzsischen Publikum
in die Hnde zu liefern. Damit wollen wir jedoch seinem Verdienst nicht zu nahe
Die Stimme des griechischen Volkes 335
nen unbefriedigend: Karl Theodor Kind nahm besonders die Ortho-
graphie ins Visier, und erwhnte das Unternehmen des Prof. Schultze
in Liegnitz, den neugriechischen Text Fauriels nach den Grundstzen,
ber welche er sich ausfhrlich aussprechen wird, verbessert (bei Teub-
ner in Leipzig) herauszugeben.
22
Charakteristischerweise stammen all
diese Einwnde von deutschen Rezipienten. Diese fhlten sich wohl
von Fauriels Werk herausgefordert, und zwar zum einen wegen der ho-
hen Mastbe und des guten Rufs der deutschen Philologie, und zum
andern weil sie sich als Deutsche einer besonderen Nhe zu den Grie-
chen rhmten.
23
Drittens schien es wichtig, Fauriels Werk als Herausgeber fortzuset-
zen und seine theoretischen Gedanken zu entwickeln, indem man un-
bekannte Lieder oder auch neue Versionen der von Fauriel mitgeteilten
Texte verffentlichte. Dabei war die Grenze zwischen der Erstausgabe
ungedruckter Quellen und der Kompilation aus zuvor erschienenen
Sammlungen, Reiseberichten und anderen Werken flieend. Alle
Sammlungen, die zwischen 1825 und den 1850er Jahren erschienen, ent-
treten. Wo fast alle literarische Hlfsmittel fehlen, wie bei der besprochenen
Arbeit, da bleibt nur dieser Weg brig, sie zu Stande zu bringen, und wir verken-
nen gewiss die umstndliche Mhe nicht, welche es gekostet haben mag, ge-
schichtliche, topographische und sprachliche Erkundigungen aus der Fremde ein-
zuziehen, und selbst das Befragen eines Nahestehenden ist nicht bequemer, als
ein Buch aufzuschlagen. (Mller, Wilhelm: Neugriechische Volkslieder [] Erster
Theil. Geschichtliche Lieder, S. VIIIIX).
22
Kind: Eunomia, S. VII. Karl Theodor Kind erwhnt auch die Verbesserungen, die
von einem mit ihm befreundeten Griechen aus Smyrna vorgeschlagen wurden
(ebd., S. XXXXI).
23
Da den Deutschen eine besondere Aufgabe zukomme, wird u. a. von Karl Theo-
dor Kind zum Ausdruck gebracht: Deutschland, das universelle Deutschland, ist
es sich selbst und ist es dem neuen Griechenland, mit welchem es durch innere
und uere Bande nher verwandt ist, als irgend ein anderes Volk, auch nur um so
mehr schuldig, dessen neubegonnenes Fortschreiten auf der Bahn des geistigen
Lebens, und also auch dessen Entwickelungsversuche [sic] auf dem Gebiete
der Poesie nicht lnger unbeachtet zu lassen. (Kind, Karl Theodor: Neugriechische
Anthologie. Original und Uebersetzung. Theodor Kind (Hrsg.): Leipzig 1844, S. III).
Vgl. auch Kind, Karl Theodor: Neugriechische Poesieen, ungedruckte und gedruckte,
mit Einleitung und sowohl Sach- als Wort-Erklrungen. Theodor Kind (Hrsg.): Leipzig
1833, S. VIIIIX: Durch das erwachte politische Leben in Griechenland selbst,
und durch die Verbindung, welche von nun an, zumal unter den bestehenden u-
eren politischen Verhltnissen, zwischen Deutschland und dem neuen griechi-
schen Staate nothwendig Statt finden wird, mu auch das geistige Leben der grie-
chischen Nation zu einem Gegenstande der Beachtung, und zugleich auch der
Veredelung, fr die Deutschen werden [].
336 Sandrine Maufroy
halten Texte, die schon frher verffentlicht worden waren, wobei Fau-
riels Sammlung selbstverstndlich eine der meist zitierten Quellen ist.
Einer der ersten und ttigsten Herausgeber neugriechischer Volkslieder
war der Leipziger Jurist und Philhellene Karl Theodor Kind (17991868).
Zwischen 1827 und 1849 verffentlichte er fnf Sammlungen und
Anthologien, von denen zwei nur Originaltexte und drei auch Werke
bekannter Dichter enthalten.
24
Als Herausgeber neugriechischer Volks-
lieder sind auch Daniel Sanders (18191897) und Johann Matthias
Firmenich-Richartz (18081889) zu erwhnen. Sanders Sammlungen er-
schienen 1842 und 1844: Die erste enthlt ausschlielich bersetzungen
aus Texten, die er teils gedruckten Quellen, teils mndlichen Mitthei-
lungen entnahm,
25
whrend die zweite aus Originaltexten und ber-
setzungen besteht und mit zwei Abhandlungen endet.
26
Firmenich-Ri-
chartz verffentlichte, bevor er 1867 seine eigene Sammlung herausgab,
1840 ein Werk, das der Form nach zwischen Abhandlung und Samm-
lung steht. Seine Neugriechischen Volksgesnge sind aus Fauriels Samm-
lung entnommen und in eine Argumentation eingebettet, die beweisen
soll, da die Neugriechen Abkmmlinge der Altgriechen sind.
27
Bis zu den 1860er Jahren wurde Fauriels Werk hauptschlich von Deut-
schen fortgesetzt. In Frankreich entstand nur eine wirklich neue Samm-
lung, diejenige nmlich, die Graf Marcellus (17951865) 1851 herausgab.
28
24
Kind: Eunomia; Kind: Neugriechische Poesieen; Kind, Karl Theodor: Neugriechische
Chrestomathie, mit grammatischen Erluterungen und einem Wrterbuche. Prosa und
Poesie. Theodor Kind (Hrsg.): Leipzig 1835; Kind: Neugriechische Anthologie.;
Kind, Karl Theodor: Mnimosynon. Neugriechische Volkslieder in den Originalen und
mit deutscher bersetzung. Theodor Kind (Hrsg.): Leipzig 1849.
25
Sanders, Daniel: Volks- und Freiheitslieder. Zum Besten der unglcklichen Kandioten.
Grnberg, Leipzig 1842, S. 112.
26
Sanders, Daniel: Das Volksleben der Neugriechen dargestellt und erklrt aus Liedern,
Sprichwrtern, Kunstgedichten, nebst einem Anhange von Musikbeilagen und zwei kriti-
schen Abhandlungen von Dr. D.H. Sanders. Mannheim 1844.
27
Firmenich-Richartz, Johann Matthias: Tragoudia Romaka. Neugriechische Volksge-
snge. Original und Uebersetzung. In Zusammenstellung mit den uns aufbewahrten alt-
griechischen Volksliedern. Von Dr. J. M. Firmenich. Berlin 1840. Die Sammlung, die
Firmenich-Richartz 1867 herausgab, trgt den Titel: Firmenich-Richartz, Johan-
nes Matthias: Volksdichtungen Nord- und Sdeuropischer Vlker alter und neuer Zeit.
Tragoudia Romaka. Neugriechische Volksgesnge. Zweiter Theil.Urtext und bersetzung.
Von Johannes Matthias Firmenich-Richartz, Professor u. s. w. Berlin 1867.
28
Marcellus, Marie-Louis-Jean-Andr-Charles Demartin du Tirac, comte de: Chants
du peuple en Grce, par M. de Marcellus, ancien Ministre plnipotentiaire, auteur des Sou-
venirs de lOrient et des Vingt jours en Sicile. 2 Bde. Paris 1851. Marcellus gab 1860
eine zweite Sammlung heraus: Marcellus, Marie-Louis-Jean-Andr-Charles Dem-
Die Stimme des griechischen Volkes 337
Sie ist dadurch gekennzeichnet, da Marcellus seine Quellen nicht zi-
tiert und den Leser glauben macht, er selbst habe die Lieder in Griechen-
land gehrt und gesammelt. In etwas verchtlichem Ton erklrt Marcel-
lus, da er seinem Vorgnger Fauriel und den deutschen Denkern
die Aufgabe berlt, gelehrte und politische Bemerkungen zu den Lie-
dern zu machen.
29
Damit huldigt er dem franzsischen Paradigma der
Belles-Lettres, das im Gegensatz zur deutschen Philologie stand.
30
Umgekehrt verzichten Theodor Kind und Wilhelm Mller ausdrcklich
auf Bemerkungen ber die literarische Schnheit der Lieder und ber-
lassen sie den franzsischen Autoren.
31
Die neugriechischen Volkslieder
artin du Tirac, comte de: Chants populaires de la Grce moderne runis, classs et tra-
duits par le Cte de Marcellus, ancien Ministre plnipotentiaire. Paris 1860.
29
Marcellus: Chants du peuple en Grce, Bd. 1, S. XXII: Mais, je le dclare, duss-je
passer pour un crivain superficiel, jai refus obstinment mon opuscule lorne-
ment dune de ces longues introductions historiques dj toutes faites, ainsi que
laccessoire des rflexions sur les constitutions nouvelles, avec accompagnement
oblig de prophties politiques, si souvent dmenties. [] Jai supprim toute dis-
cussion scientifique sur la versification et sur la prosodie imparfaitement transmi-
ses la posie hellnique par sa sur ane, ou par ses voisines de lEurope. Jai
mme retranch les considrations thoriques sur le gnie des nations, tel quil res-
sort de leurs chants habituels. Jai cru devoir laisser cette tche, importante sans
doute, mais presque politique, soit mon devancier, soit ces nombreux penseurs
allemands qui, surtout depuis lirruption des Bavarois, ont savamment dissqu le
cadavre des villes et des populations grecques, pour parler comme Sulpitius, le c-
lbre consolateur de Cicron. Chacun de mes lecteurs fera en lui-mme, sil en a le
got, cette opration, dont je me suis dispens pour ne pas alourdir mes rcits.
30
ber den Gegensatz zwischen der franzsischen Tradition der Belles-Lettres
und der deutschen Philologie vgl. u. a. Judet de la Combe, Pierre: Philologie clas-
sique et lgitimit. Quelques questions sur un ,modle , in: Michel Espagne/Mi-
chael Werner (Hrsg.): Philologiques I. Contribution lhistoire des disciplines littraires
en France et en Allemagne au XIX
e
sicle. Paris 1990, S. 2342; Espagne, Michel: La
rfrence allemande dans la fondation dune philologie franaise, in: ders./Mi-
chael Werner (Hrsg.): Philologiques I. Contribution lhistoire des disciplines littraires
en France et en Allemagne au XIX
e
sicle. Paris 1990, S. 135158.
31
Mller, Wilhelm: Neugriechische Volkslieder, S. XI: Die Erluterungen des Herrn Fau-
riel sind, dem Wesentlichen ihres Inhalts nach, jedoch mit Zusammenziehung ihres
Vortrags und Weglassung alles sthetischen Rsonnements, wiedergegeben worden,
und unsre eigenen Zustze beziehen sich vorzglich auf das Geographische und To-
pographische, worber unser Vorarbeiter nicht immer gengende Auskunft gegeben
hat. Kind: Eunomia, S. IX: Ueber die poetischen Schnheiten der Tragdia habe
ich Nichts gesagt und Etwas zu sagen, htte ich es auch vermocht, nicht fr nthig
erachtet, da ich denke, da Jeder, der sie mit Aufmerksamkeit und poetischem Sinne
liest, von selbst die Naivetten und Reize, von denen Montagne [sic, d. h. Montai-
gne] in Bezug auf eine jede Volkspoesie spricht, finden werde und andern Lesern
338 Sandrine Maufroy
dienen somit deutschen und franzsischen Verfassern nebenbei dazu,
sich vom entgegengesetzten literarisch-wissenschaftlichen Modell zu di-
stanzieren und sich in ihrer eigenen Position zu behaupten.
2. Apologetische Absichten
Weiteren Aufschlu ber die Funktion der Sammlungen neugriechi-
scher Volkslieder und das Verhltnis zwischen dem Diskurs ber die
griechischen Lieder und dem philhellenischen Diskurs gibt die Analyse
der expliziten Absichten der Herausgeber und ihrer rhetorischen Strate-
gien. Ihnen gemeinsam ist nmlich eine apologetische Intention. Gleich
am Anfang seines Discours prliminaire erklrt Fauriel, da er durch
seine Sammlung dazu beitragen mchte, da die ffentlichkeit, und
insbesondere die Gelehrten, die Neugriechen mit mehr Gerechtigkeit
beurteilen. Fauriel tritt den Behauptungen der Reisenden entgegen, die
sich nur fr die letzten Spuren des antiken Griechenlands interessierten
und die modernen Bewohner des Landes als verworfenes und entarte-
tes Geschlecht verleumdeten; er hofft seine Leser davon zu berzeu-
gen, da nicht nur die antike Dichtung, sondern auch die neugriechi-
sche Literatur Beachtung verdiene.
32
Die herausgegebenen Texte erfllen
wrden solche Hindeutungen berhaupt wohl wenig helfen. Uebrigens giebt Fau-
riels discours prliminaire im Allgemeinen ber die poetischen Vorzge der neugrie-
chischen Volkspoesie und ihrer einzelnen Gattungen manchen Aufschlu [].
32
Fauriel: Chants populaires, S. vij-viij: Jai pens quun recueil de chants populaires
de la Grce moderne, mme sans tre accompagn de tous les claircissements quil
pourrait exiger, fournirait quelques donnes nouvelles pour apprcier avec plus
dexactitude et de justice quon ne le fait communment, les murs, le caractre
et le gnie des Grecs de nos jours. Cest l le principal motif qui ma dtermin
prsenter celui-ci au public. Voil plus de quatre sicles que les rudits de lEurope
ne parlent de la Grce que pour dplorer la perte de son ancienne civilisation, ne
la parcourent que pour y chercher les dbris, je dirais presque la poussire de ses
villes et de ses temples, dcids davance sextasier sur les vestiges les plus dou-
teux de ce quelle fut il y a deux ou trois mille ans. Quant aux sept ou huit mil-
lions dhommes, restes certains, restes vivants de lancien peuple de cette terre
idoltre, il en est bien autrement. Les rudits nen ont point tenu compte, ou sils
en ont parl, ce na gure t quen passant, et pour les signaler comme une race
abjecte, dchue au point de ne mriter que le mpris ou la piti des hommes cul-
tivs. On serait tent, prendre au srieux les tmoignages de la plupart de ces
rudits, de regarder les Grecs modernes comme un accident disparate et profane
jet mal--propos au milieu des ruines sacres de la vieille Grce, pour en gter le
spectacle et leffet aux doctes adorateurs qui les visitent de temps autre.
Die Stimme des griechischen Volkes 339
folglich u. a. die Funktion von Zeugnissen und Argumenten im Dienste
einer Beweisfhrung, die im Discours prliminaire beginnt und sich in
den Kommentaren zu den einzelnen Liedern fortsetzt.
Die apologetische Absicht und das Bedauern, das Interesse am anti-
ken Griechenland sei strker ausgeprgt als die Kenntnis der zeitgens-
sischen Griechen, sind auch bei den Lesern und Nachfolgern Fauriels zu
finden. In diesem Zusammenhang appellieren die deutschen Epigonen
Fauriels an das Gefhl der Scham und des Nationalstolzes ihrer Lands-
leute. So whlt Theodor Kind folgendes Zitat des Martin Crusius als
Motto seiner 1835 erschienenen Sammlung: Es ist meiner Ansicht nach
sonderbar, wenn man das Alte versteht, von Dem aber, was die Gegen-
wart giebt, beinahe keine Kenntni hat.
33
Noch charakteristischer ist
Firmenichs Anspielung auf die hervorragenden Leistungen der deut-
schen Altphilologen und die besondere Stellung der griechischen Stu-
dien im deutschen Bildungsmodell:
Die anonyme deutsche bersetzung lautet folgendermaen: Ich habe ge-
glaubt, da eine Sammlung Neugriechischer Volksgesnge auch ohne vollstndigen
erluternden Commentar in den Stand setzen knne, ber die Sitten, den Cha-
rakter und den Geist der heutigen Griechen mit Bestimmtheit und Billigkeit zu
urtheilen, als es gewhnlich zu geschehen pflegt, und diese Betrachtung allein hat
mich bestimmt, die folgende Arbeit dem Drucke zu bergeben. Seit mehr als vier
Jahrhunderten hrt man die Gelehrten Europas nur von Griechenland reden, um
den Verlust seiner frheren Civilisation zu bejammern; sie durchreisen dasselbe
nur, um den Trmmern, ich mchte fast sagen, dem Staube seiner Stdte und
Tempel nachzuspren, und sind schon im Voraus entschlossen, sich begeistert
und entzckt zu fhlen, selbst bei den ungewissesten Spuren dessen, was Grie-
chenland vor zwei oder drei tausend Jahren gewesen ist. Ganz anders ist es in Hin-
sicht der unbezweifelten, der lebenden Reste des alten Griechenlands, der sieben
bis acht Millionen Nachkommen der alten Bewohner dieses hochgefeierten Lan-
des. Die Gelehrten haben entweder gar keine Kenntniss davon genommen, oder,
wenn sie derselben erwhnen, so geschieht es nur gelegentlich, um sie als ein ver-
worfenes, entartetes Geschlecht zu bezeichnen, das nur die Verachtung oder das
Mitleid gebildeter Menschen zu erregen verdiene. Wollte man die Zeugnisse oder
Aussagen der meisten dieser Gelehrten ernstlich nehmen, so knnte man sich ver-
sucht fhlen, die heutigen Griechen fr eine fremdartige und verchtliche Menge
zu halten, welche zu unglcklicher Stunde mitten unter die heiligen Trmmer des
alten Griechenlands geworfen worden, in der Absicht, den gelehrten Bewunde-
rern, die von Zeit zu Zeit zum Besuche dort eintreffen, den Anblick und den Ein-
druck derselben zu verderben. (Mittheilungen aus der Geschichte [] Erste Abthei-
lung. Fauriels Einleitung [], S. 34).
33
Kind: Neugriechische Chrestomathie, S. II. Diesen Satz hatte er schon 1833 zitiert
(Kind: Neugriechische Poesieen, S. XXV).
340 Sandrine Maufroy
Es ist wirklich zu bedauern, da in unserm gelehrten und in dieser Hinsicht so
rhrigen Deutschland, wo die Kenntni und Wrdigung der Literatur der Altgrie-
chen die hchste Stufe erreicht, den Enkeln der Letztern im Allgemeinen so we-
nig Aufmerksamkeit geschenkt wird.
34
Um die zeitgenssischen Griechen zu rehabilitieren und die Kenntnisse
ber die griechische Kultur zu frdern, wenden sich Fauriel und seine
Nachfolger dem zu, was sie Volkslieder nennen. Diese Wahl mssen
sie aber rechtfertigen, und damit wird die Apologie eine doppelte: nicht
nur eine Apologie der modernen Griechen, sondern auch des Volkslieds
im Allgemeinen. Das Bedrfnis, die Leser von dem Wert der Volkslie-
der zu berzeugen, lt sich bei allen Herausgebern und bersetzern
spren und wird fast zum Topos.
35
3. Der Begriff Volkslied
Bemerkenswert ist, da keiner der Herausgeber und bersetzer von neu-
griechischen Volksliedern eine przise Definition vom Volkslied gibt.
Seit die Wrter Volkslied, Volksdichtung und Volkspoesie durch Herder
ihre Prgung erhalten haben, handelt es sich um einen wandelbaren Be-
griff
36
, der oft beim selben Autor verschiedene Konnotationen, aber
keine feste Bedeutung hat.
37
Was die neugriechischen Volkslieder be-
trifft, werden sie hauptschlich dadurch beschrieben und gekennzeich-
net, da sie anderen Formen der Dichtung gegenbergestellt werden.
Die Aufzhlung ihrer besonderen Merkmale enthlt auch fast immer
eine Bewertung derselben. So erklrt Fauriel von Anfang an, die heuti-
gen Griechen htten, wie fast alle Vlker Europas:
34
Firmenich-Richartz: Tragoudia Romaka, S. 27.
35
Fast 80 Jahren nach Herders Volkslieder schrieb Firmenich-Richartz: Jeder Ge-
schichtsforscher und Philosoph wird die Ansicht theilen, da das Gebiet der
Volkspoesie im Allgemeinen von unseren Gelehrten allzu sehr vernachlssigt
wird (ebd., S. 1).
36
Dieser Ausdruck wird von Cornelis Brouwer verwendet. Vgl. Brouwer, Cornelis:
Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland. Untersuchungen ber die
Auffassung des Begriffes. ber die traditionellen Zeilen, die Zahlen-, Blumen- und Farben-
symbolik. Groningen, Den Haag 1930, S. 8.
37
Vgl. zum Begriff Volkslied Brouwer: Das Volkslied; Bausinger, Hermann: Formen
der ,Volkspoesie. Berlin 1968; Linder-Beroud, Waltraud: Von der Mndlichkeit zur
Schriftlichkeit? Untersuchungen zur Interdependenz von Individualdichtung und Kollek-
tivlied. Frankfurt a.M., Bern, New York, Paris 1989.
Die Stimme des griechischen Volkes 341
zwei Gattungen, man knnte fast sagen, zwei Grade von Poesie: die eine, durch-
aus eigenthmlich und ursprnglich, volksgemss in Wesen und Form, durch
mndliche Sage fortgepflanzt: die andere, in der Schrift bewahrt, worauf Studium
und Kunst, Nachahmung und Gelehrsamkeit, mehr oder weniger und nach Zeit,
Ort und Individuen gnstiger oder ungnstiger eingewirkt haben.
38
Am Ende seines Discours prliminaire kommt Fauriel auf diese Unter-
scheidung zurck: Indem er Natur- und Kunstpoesie gegenberstellt,
bernimmt er den Begriff der Naturpoesie, der durch Jacob und Wil-
helm Grimm seine strkste Prgung erhalten hat.
39
Aber wenn auch Fau-
riel die Gleichung wieder aufnimmt, die die Grimms eingefhrt hatten
und nach der Volkspoesie, Naturpoesie und Nationalpoesie identisch
seien,
40
so verzichtet er jedoch auf das wichtigste Merkmal der Natur-
poesie bei diesen Autoren, nmlich auf die nichtindividuelle Entste-
hung der Volkslieder.
41
Im Gegensatz zu den Grimms und den deut-
schen Romantikern, die das geheimnisvolle Hervorgehen der Lieder aus
der schaffenden Volksseele betonten, vertritt Fauriel die Ansicht, die
Volkslieder seien von einzelnen Dichtern und Dichterinnen geschaffen
worden. Diese seien immer unbekannt, weil sie nicht eitel seien und nur
ihre Empfindungen spontan ausdrcken wollten.
38
Hier zitieren wir die anonyme bersetzung (Mittheilungen aus der Geschichte []
Erste Abtheilung. Fauriels Einleitung [], S. 7). Fauriels Text lautet folgenderma-
en: Comme toutes ou presque toutes les autres nations europennes, les Grecs
modernes ont deux sortes, on pourrait dire deux degrs de posie; lune de tout
point originale et spontane, populaire dans sa substance et dans ses formes, tra-
ditionnelle et non crite; lautre crite, o ltude et lart, limitation et le savoir
ont eu plus ou moins de part, et une part plus ou moins heureuse, selon les temps,
les lieux et les individus. (Fauriel: Chants populaires, S. X).
39
Ebd., S. cxxvij: Ces rflexions auxquelles je regrette de ne pouvoir donner le d-
veloppement dont elles auraient besoin, sappliquent directement la posie po-
pulaire, la posie de la nature, par opposition la posie de lart, pourvu quelle
soit lexpression de quelque chose de vrai, de srieux et de senti. Die anonyme
bersetzung lautet folgendermaen: Diese Bemerkungen, die ich hier leider
nicht so ausfhrlich, wie ich wnschte, entwickeln kann, finden ihre unmittelbare
Anwendung auf die Volkspoesie, auf die Poesie der Natur, im Gegensatze mit der
Poesie der Kunst, insofern erstere wirklich der Ausdruck des Wahren, des Tchti-
gen und tief Empfundenen ist. (Mittheilungen aus der Geschichte [] Erste Abthei-
lung. Fauriels Einleitung [], S. 193). ber den Begriff der Naturpoesie bei Jacob
und Wilhelm Grimm vgl. Bausinger: Formen der ,Volkspoesie, S. 1727.
40
Fauriel verwendet die Ausdrcke nationale Dichtungen und nationale Lieder
(Fauriel: Chants populaires, S. cxxvij (chansons nationales), S. xxxvij (posies
nationales).
41
ber Wilhelm und Jacob Grimms Auffassung einer nichtindividuellen Entste-
hung der Volkslieder vgl. Bausinger: Formen der ,Volkspoesie, S. 18.
342 Sandrine Maufroy
Fauriel zieht keine scharfe Grenze zwischen Volkspoesie und Kunst-
poesie. Bei ihm ist das Wort populaire (volksgemss bzw. volks-
mssig in der anonymen bersetzung) oft durch ein Adverb nher be-
stimmt: So behauptet er, da die schriftlichen Werke des Mittelalters,
die im Neugriechischen verfat wurden, mehr oder weniger volksge-
mss waren, weil sie nicht auf Altgriechisch geschrieben waren und
Themen behandelten, die die Nation mehr oder weniger angehen
oder auch an Neugier und Phantasie des Publikums appellierten.
42
Die
Themen dieser Werke und die Tatsache, da sie schriftlich waren, unter-
scheiden sie jedoch von der eigentlichen Volkspoesie der Griechen,
die den unmittelbaren und wahrhaften Ausdruck des Charakters und
Geistes dieses Volks darstellt,
die jeder Grieche versteht und der er mit Liebe anhngt, schon darum, weil er ein
Grieche ist, und den Boden Griechenlands bewohnt und seine Luft athmet, eine
Poesie endlich, welche nicht in Bchern ein knstliches, oft nur scheinbares, son-
dern in dem Volke selbst ein wirkliches Leben lebt, und sein eigentliches Lebens-
princip ist.
43
42
Fauriel: Chants populaires, S. xxiij: Les monuments dont je viens dindiquer lexi-
stence sont tous plus ou moins populaires, en ce sens que tous sont crits en grec
vulgaire, bien quavec des prtentions assez diverses; ils le sont aussi et plus en-
core, en ce quils roulent ou sur des faits rels dun intrt plus ou moins national,
ou sur des fictions faites alors pour piquer la curiosit et pour captiver limagina-
tion. In den Mittheilungen aus der Geschichte [] Erste Abtheilung. Fauriels Einlei-
tung [], S. 2829, steht folgende bersetzung: Die Denkmale, deren Vorhan-
denseyn ich hier nachgewiesen habe, sind alle mehr oder weniger volksgemss,
wenigstens in dem Sinne, dass sie in neugriechischer Sprache geschrieben sind;
doch sind sie an innerem Werthe sehr verschieden. Auch darin sind sie volksms-
sig, und zwar vorzglich darin, dass sie entweder wirkliche Begebenheiten, welche
die Nation mehr oder weniger angehen, beschreiben, oder dass sie Dichtungen
enthalten, wodurch die Neugierde gereitzt [sic], und die Einbildungskraft lange
hingehalten wird.
43
Mittheilungen aus der Geschichte [] Erste Abtheilung. Fauriels [], S. 31: Ausser
der, in dem vorhergehenden Abschnitte geschilderten, haben die Neu-Griechen
nun noch eine andere Gattung von Poesie, eine Nationalpoesie in jeder Hin-
sicht und in der ganzen Bedeutung des Worts den unmittelbaren und wahr-
haften Ausdruck des Charakters und Geistes dieses Volks, die jeder Grieche
versteht und der er mit Liebe anhngt, schon darum, weil er ein Grieche ist, und
den Boden Griechenlands bewohnt und seine Luft athmet, eine Poesie endlich,
welche nicht in Bchern ein knstliches, oft nur scheinbares, sondern in dem
Volke selbst ein wirkliches Leben lebt, und sein eigentliches Lebensprincip ist.
Diese Poesie besteht einzig und allein aus Gesngen, wie wir sie in der folgen-
den Sammlung kennen lernen. Fauriel: Chants populaires, S. xxv: Les Grecs
modernes ont une autre posie que celle dont je viens de parler, une posie po-
Die Stimme des griechischen Volkes 343
Es handelt sich um Lieder, die fr das Volk, zu einem volksmssigen
Zweck, und nach dem entsprechenden Geschmack gedichtet worden
seien, wobei das Wort Volk (wie auch bei Herder) zugleich eine eth-
nisch-nationale, eine soziale und eine kulturelle Bedeutung hat.
44
Wenn man auch nicht genau wei, welche Bcher Fauriel las und wel-
che Gesprche er mit seinen deutschen Bekanntschaften, z. B. mit Au-
gust Wilhelm Schlegel oder Jacob Grimm, fhrte, so ist doch der Rck-
griff auf deutsches Gedankengut unverkennbar. Diese Begriffe und
Theorien wurden dann von Fauriels Nachfolgern immer wieder ber-
nommen und abgewandelt. Alle Autoren stellen Volkspoesie und Kunst-
poesie gegeneinander, wenngleich sie andere Ausdrcke wie z. B.
hhere Literatur (Firmenich)
45
oder knstliche Poesie (Kind)
46
be-
nutzen. Die deutschen Herausgeber heben das Verhltnis zwischen
Volk, Sprache und (volkstmlicher) Dichtung besonders hervor und
bringen ihre Auffassung durch zwei Metaphern zum Ausdruck: In Be-
zug auf Herder beschreiben sie erstens die Volkslieder als spontane
Stimme des Volkes und als lebendigen Naturlaut,
47
d. h. als sponta-
nen Ausdruck der Volksseele, und zweitens erklren sie die Lieder zum
Spiegel des griechischen Lebens (Sanders) und der neugriechischen
pulaire dans tous les sens et toute la force de ce mot, expression directe et vraie
du caractre et de lesprit national, que tout Grec comprend et sent avec amour,
par cela seul quil est Grec, quil habite le sol et respire lair de la Grce; une
posie enfin qui vit, non dans les livres, dune vie factice et qui nest souvent
quapparente, mais dans le peuple lui-mme, et de toute la vie du peuple. Cette
posie consiste entirement en chansons du genre de celles contenues dans ce
recueil.
44
Ebd., S. cj: des chants composs pour le peuple, dans un but populaire, et dans
le got convenable ce but. ber die verschiedenen Bedeutungen des Wortes
Volkslied bei Herder vgl. Bausinger: Formen der Volkspoesie, S. 1113; Gaier
Kommentar, S. 848925.
45
Firmenich-Richartz: Tragoudia Romaka, S. 1: Jeder Geschichtforscher und Phi-
losoph wird die Ansicht theilen, da das Gebiet der Volkspoesie im Allgemeinen
von unseren Gelehrten allzu sehr vernachlssigt wird. Es ist diese Vornehmthuerei
um so auffallender und unerklrlicher, da es doch schwerlich zu lugnen ist, da
gerade jene es ist, welche uns, im Gegensatz zur hhern Literatur der verschiede-
nen Vlker, die mehr oder minder kosmopolitisch genannt werden kann, gleich-
sam an den Familienheerd der Vlker versetzt und uns die geheimsten Gefhle
und Gesinnungen derselben in ihrer scharf ausgeprgten nationalen Eigenthm-
lichkeit vertraut und offenbart.
46
Kind: Neugriechische Chrestomathie, S. XV.
47
Ebd., S. XVI.
344 Sandrine Maufroy
Nationalitt (Kind).
48
Eine Stelle aus Theodor Kinds Vorwort zu seinen
Neugriechischen Poesieen (1833) vereinigt die Hauptmerkmale der griechi-
schen Volkslieder, wie sie von Deutschen und Franzosen beschrieben
werden:
Ausgegangen von diesem [d. h. vom Volke] auf wunderbare Weise, sind diese
Volkslieder schon in ihrem Ursprunge das Eigenthum der Nation, da sie nur aus
dem inneren Leben derselben, nur aus ihrer Gedanken- und Gefhlswelt, wie aus
dem knstlerisch, wenn gleich natrlich und kunstlos, schaffenden Geiste des
Volkes sich entwickeln und nur aus diesen Elementen sich bilden, um dann auch
uerlich von dem Volke in sich selbst wieder aufgenommen zu werden. Denn
eben in der Lebendigkeit und Natrlichkeit, in dem fortschreitenden, fast drama-
tisch sich gestaltenden Leben, in der gemthlichen, oft ironisch-spttischen, oft
ernsthaft-sentimentalen Auffassung der Gegenstnde der Natur und des Lebens,
in der wilden und oft rauhen Kraft der Gesinnung und des Strebens nach Auen,
wodurch sich die Volkspoesie der Neugriechen charakterisirt, reprsentirt sich zu-
gleich die neugriechische Nationalitt in ihren Hauptzgen, und jene ist insofern
nur ein Spiegel dieser, in welchem sie sich selbst und unmittelbar abspiegelt.
49
Diese Stelle zeigt, wie problematisch und vage diese Schilderungen der
neugriechischen Volkslieder sind. Denn dieselben Eigenschaften dienen
in gleicher Weise der allgemeinen Charakterisierung von Volksliedern,
wie sie speziell als Kennzeichen der griechischen Gesnge behauptet
werden. Sollte man daraus schlufolgern, da das griechische Volk als
Inbegriff eines Volkes schlechthin zu gelten habe? Die Topoi, die dem
gelufigen allgemeinen Diskurs ber die Volkslieder entnommen sind,
dienen hier auf jeden Fall dazu, ein neues Bild der Griechen zu entwer-
fen und den philhellenischen Diskurs zu bereichern und zu erneuern.
48
S. z. B. Sanders, Daniel: Das Volksleben der Neugriechen dargestellt und erklrt aus Lie-
dern, Sprichwrtern, Kunstgedichten, nebst einem Anhange von Musikbeilagen und zwei
kritischen Abhandlungen von Dr. D.H. Sanders. Mannheim 1844, S. VI: So weit es
in meiner Macht stand, habe ich selbst fr diese Belebung gesorgt durch die Mu-
sikbeilagen und selbst die Anmerkungen sollen das Verstndni und somit die Le-
bendigkeit der Anschauung befrdern und den Leser in griechisches Leben ein-
fhrend, ber die Lieder Klarheit verbreiten, wie umgekehrt in den Liedern das
griechische Leben am reinsten sich spiegelt und am klarsten erkannt wird.
49
Kind: Neugriechische Poesieen, S. XII.
Die Stimme des griechischen Volkes 345
4. Die Volkslieder als Geschichte und
Gemlde Griechenlands. Die Klephten
Wenn die Volkspoesie zugleich Nationalpoesie ist, wenn ihre Themen
die nationale Geschichte des Volkes betreffen und als Ausdruck seiner in-
timsten Gefhle zu verstehen sind, dann bilden die Volkslieder eine un-
schtzbare Quelle fr die ltere und neuere Geschichte dieses Volkes, was
im Falle der Griechen fr die Philhellenen von besonderem Interesse war.
Herder hatte die Volksgesnge als Archiv des Volks bezeichnet,
50
und
Fauriel erklrte, da eine vollstndige Sammlung aller neugriechischen
Lieder zugleich die wahre Nationalgeschichte des modernen Griechen-
lands und das treueste Gemlde der Sitten seiner Bewohner sei.
51
Diese
Behauptung wird hufig von Fauriels Nachfolgern wiederholt. So
wnscht sich Theodor Kind, mit seiner 1844 erschienenen Anthologie
zugleich einen Beitrag zur Kenntni des griechischen Volkes unserer
Tage, dessen ueren und inneren Lebens der Gegenwart und der Vergan-
genheit, so wie zur Kenntni gewisser Seiten der Geschichte desselben
und einzelner interessanter Details, die das Charakteristische des Volkes
und seines ganzen Wesens ausmachen, zu gewhren,
52
und Firmenich
sieht die Volksdichter als Geschichtschreiber [sic] der Nation an.
53
Diese Behauptungen betreffen insbesondere die von Fauriel defi-
nierte (und von seinen Nachfolgern wieder aufgenommene) Gattung der
historischen Lieder, wobei die klephtischen Lieder eine besondere
Stellung einnehmen.
54
Fauriel widmet ihnen einen groen Teil seines
50
Herder, Johann Gottfried, Von hnlichkeit der mittlern englischen und deut-
schen Dichtkunst, nebst Verschiednem, das daraus folget, in: Herders Smmtliche
Werke, Bd. 9. Bernhard Suphan: Berlin 1893, S. 532.
51
Fauriel: Chants populaires, S. XXV: Un tel recueil, sil tait complet, serait la fois
et la vritable histoire nationale de la Grce moderne, et le tableau le plus fidle
des murs de ses habitants. In den Mittheilungen aus der Geschichte [] Erste
Abtheilung. Fauriels Einleitung [], S. 3132, lautet die bersetzung folgender-
maen: Eine vollstndige Sammlung dieser Lieder wrde das treffendste Bild
der Sitten des heutigen Griechenlands, und zugleich die wahrhafteste Geschichte
seines Volks darstellen.
52
Kind: Neugriechische Anthologie, S. VIII.
53
Firmenich-Richartz: Tragoudia Romaka, S. 16.
54
Fauriel unterscheidet zwischen den huslichen, den historischen und den idealen
oder romantischen Liedern: A raison de la diversit de leur sujet, toutes les chan-
sons populaires des Grecs pourraient, je crois, tre partages, comme celles de ce
recueil, en trois classes principales; je veux dire, en chansons domestiques, en
chansons historiques, et en chansons romanesques ou idales. (Fauriel: Chants
populaires, S. xxvj).
346 Sandrine Maufroy
Discours prliminaire. Seine Erklrungen zu den Klephten, die er als
die eigentlichen Helden des griechischen Freiheitskampfes beschreibt,
werden von Sammlung zu Sammlung wiederholt. Immer wieder werden
die Klephten als tapfere, heldenmtige Ruber beschrieben, deren rohe
Sitten in direkter Verbindung mit ihrer ungewhnlichen Freiheitsliebe
und ihren echten Tugenden stehen, und deren Lebensstil an den der alten
Spartaner erinnert. Dieselben zahlreichen Details ber ihre Klei-
dung, ihre Leibesbungen, ihr sittliches Verhalten und ihre berhmten
Taten werden immer wieder erwhnt. Fauriels Discours prliminaire
erscheint folglich als ein Nachschlagewerk, in dem man Informationen
suchte, und das dazu beitrug, Topoi und imaginre Vorstellungen ber
den griechischen Freiheitskampf zu verbreiten.
5. Die neugriechischen Volkslieder
und die griechische Sprache
Nicht nur ber Geschichte, Sitten und Gebruche der Griechen geben
die Volkslieder Auskunft: In seiner Prface du traducteur-diteur zeigt
sich Fauriel davon berzeugt, da eine Sammlung neugriechischer
Volkslieder das beste klassische Buch fr das Studium des Neugriechi-
schen wre.
55
Theodor Kind bernimmt diesen Gedanken und setzt
sich in allen seinen Sammlungen zum Ziel, seinen Lesern die neue
Sprache [] in neugriechischen Dichtungen [] vorzufhren;
56
da er
bei seinen Lesern die Kenntnis des Altgriechischen voraussetzt, enthal-
ten zwei seiner Sammlungen keine bersetzungen,
57
und viele seiner er-
klrenden Anmerkungen dienen dem Verstndnis der neuen Sprache,
die nach dem Altgriechischen leicht [zu] erlernen sei.
58
Ihm liegt am
Herzen zu zeigen, da die neugriechische Sprache [] keine neue
Sprache ist,
59
und die neugriechischen Volkslieder helfen ihm, die kon-
troversen Thesen von Johann Michael Heilmaier zu widerlegen.
60
Nach
55
Fauriel: Chants populaires, S. ij-iij: Persuad quun tel recueil serait le meilleur
livre classique pour ltude du grec moderne, je nai rien nglig pour que le texte
en ft aussi correct que possible.
56
Kind: Neugriechische Poesieen, S. V.
57
Es handelt sich um folgende Sammlungen: Kind: Neugriechische Poesieen; Kind:
Neugriechische Chrestomathie.
58
Ders.: Neugriechische Poesieen, S. XXIII.
59
Ders.: Neugriechische Anthologie, S. IX.
60
Ders.: Neugriechische Chrestomathie, S. VII, Funote 1.
Die Stimme des griechischen Volkes 347
Theodor Kind ist die neugriechische Sprache eine Verschlechterung des
Altgriechischen
61
, deren Ursache die Nachlssigkeit ist, und eine Aus-
artung, eine theilweise Verkrppelung und Entstellung der griechi-
schen Sprache durch fremdartige Zustze. Aber ihre Verwandtschaft
mit dem Altgriechischen zeigt, da sie der Veredelung und Verbesse-
rung [] fhig ist und da man sie reinigen kann.
62
Theodor Kind
benutzt also die griechischen Volkslieder nicht nur als Lehrmittel zum
Studium des Neugriechischen. Er sttzt sich auch auf die Lieder, um in
der Debatte ber die Zukunft der griechischen Sprache Stellung zu neh-
men, vergleicht die verschiedenen Auffassungen der griechischen Ge-
lehrten und ergreift Partei fr Adamantios Korais, dessen Mittelweg
ihm am geeignetsten erscheint.
6. Die Kontinuitt zwischen Alt- und Neugriechen
Die Frage nach Einheit und Entwicklung der griechischen Sprache
hngt mit der Frage der Geschichte und der gewnschten Wieder-
geburt des griechischen Volkes zusammen. Theodor Kind zieht eine
Parallele zwischen der griechischen Sprache und dem griechischen Volk
selbst, das wenngleich entartet, dennoch in seinen nationalen Eigent-
hmlichkeiten, welche der Druck der Jahrhunderte nicht zu vertilgen
vermocht hat, die Verwandtschaft mit den alten Griechen offen dar-
legt,
63
und Wilhelm Mller schreibt: Wie das Volk, so seine Sprache.
In aller Entartung, Vermischung, Verderbung und Verwirrung seit so vie-
len Jahrhunderten, doch noch unverkennbar griechisch!
64
Entschiedener als Fauriel beschreiben Theodor Kind und Wilhelm
Mller die Geschichte der Griechen und ihrer Sprache als Verfall. Ihrer
Ansicht nach beweist die Verwandtschaft zwischen alt- und neugrie-
chischer Sprache allerdings, da sowohl eine politische als auch eine
moralisch-geistige Wiedergeburt mglich ist.
65
In dieser Hinsicht
nimmt das Motiv der Kontinuitt zwischen Alt- und Neugriechen eine
besondere Stellung ein. Dieser Topos, der in philhellenischen Flug-
schriften und Gedichten immer wieder aufgegriffen wird, steht im Mit-
61
Ders.: Eunomia, S. XXVII.
62
Ders.: Neugriechische Poesieen, S. XVI.
63
Ebd., S. XVII.
64
Mller: Neugriechische Volkslieder [] Erster Theil. Geschichtliche Lieder, S. XIII.
65
Kind: Neugriechische Poesieen, S. VIII.
348 Sandrine Maufroy
telpunkt von Fauriels Discours prliminaire. Dabei spielt ob explizit
oder eher subtil der Vergleich als Methode und Argument eine groe
Rolle: Fauriel vergleicht nicht nur die Klephten mit den alten Sparta-
nern, sondern beschreibt auch die Volksdichter als blinde Rhapsoden,
d. h. als Nachfolger Homers, sucht Spuren von antikem Aberglauben in
den Sitten und Gebruchen, die mit den Liedern zusammenhngen,
und vergleicht alt- und neugriechische Poesie, um gemeinsame Motive
und Formen zu finden.
66
Aber Fauriel bleibt nicht beim Vergleich: Er
ergnzt diese Methode durch eine geschichtliche Untersuchung und
versucht, die chronologische Entwicklung der neugriechischen Sprache
und Dichtung anhand von Zeugnissen zu rekonstruieren.
67
Fauriels Au-
genmerk gilt nicht nur den Gemeinsamkeiten und der Kontinuitt, son-
dern auch den geschichtlichen Entwicklungen und Brchen, und seine
Argumentation steht in engem Zusammenhang mit seinen Gedanken
ber die Entstehung der Epen und seiner Fortfhrung der Theorien von
Friedrich August Wolf.
68
Fauriels Nachfolger nehmen das Motiv der Kontinuitt wieder auf
und setzen seine Vergleiche fort. Die Frage nach der Verwandtschaft
zwischen Alt- und Neugriechen gewinnt besonders seit dem Erscheinen
von Fallmerayers Geschichte der Halbinsel Morea whrend des Mittelalters
im Jahre 1830 an Brisanz.
69
In diesem Kontext verffentlicht Firme-
nich-Richartz 1840 Neugriechische Volksgesnge. Es handelt sich dabei um
eine deutsche bersetzung von Liedern, die aus Fauriels Sammlung
entnommen und in eine Argumentation eingefgt sind. Systematischer
als Fauriel sucht Firmenich Parallelen zu den Volksliedern in der anti-
ken Literatur, um [] die Volkspoesieen der Neugriechen [] zu be-
leuchten, aber auch (und hauptschlich) durch literarische Parallelen
zu beweisen, da die Neugriechen keine Abkmmlinge der Slaven,
sondern direkte Nachkommen der Altgriechen sind.
70
Im Anhang sei-
ner 1844 erschienenen Sammlung spottet Daniel Sanders ber solche
Argumentationen: Griechen und Philhellenen handelten so, als seien
66
Fauriel: Chants populaires, S. lviij, lxviij, S. xcxcvij, S. xcvij-cxv.
67
Ebd., S. xj-xxiv.
68
Fauriels Nachla enthlt Notizen zu F. A. Wolfs Prolegomena ad Homerum, und
Fauriel widmete Wolfs Theorien einen bedeutenden Teil seiner Vorlesungen an
der Sorbonne. ber Fauriels Lehre an der Sorbonne vgl. Espagne: Le paradigme de
ltranger, S. 2534.
69
Fallmerayer, Jakob Philipp: Geschichte der Halbinsel Morea whrend des Mittelalters.
Stuttgart 18301836.
70
Firmernich-Richartz: Tragoudia Romaka, S. 2, S. 23.
Die Stimme des griechischen Volkes 349
die heutigen Griechen, wenn nur Abkmmlinge der alten Hellenen, eo
ipso gut, und eben so schlecht, wenn slawischer Abstammung;
71
er ver-
sucht sowohl sine studio als auch sine ira die Frage nach dem Einflu
fremder Vlker auf die Volkspoesie und den Aberglauben der Neugrie-
chen zu beantworten, wobei auch er den Vergleich als Methode anwen-
det. Obwohl Marcellus sich mit der Frage der Verwandtschaft zwischen
Alt- und Neugriechen nicht systematisch befat, zieht er doch Paralle-
len zwischen alt- und neugriechischer Literatur; in einem Nachwort er-
klrt er, da er (vergeblich) versucht habe, Volkslieder in byzantini-
schen Werken und Bindeglieder zwischen Antike und moderner Zeit zu
finden.
72
In den verschiedenen Sammlungen werden dieselben Verglei-
che und Zitate immer wieder verwendet. Sie bilden eine Art gemein-
same philhellenische Sprache, die sowohl in Deutschland als auch in
Frankreich verstanden wird. Diese Vergleiche werden aber auf unter-
schiedliche Weise instrumentalisiert: Whrend sich Fauriel und Marcel-
lus mehr fr literaturgeschichtliche Fragen interessieren, steht die Frage
nach dem Wesen eines Volks fr Firmenich und Sanders im Vorder-
grund.
In den Paratexten zu deutschen und franzsischen Sammlungen neu-
griechischer Volkslieder lassen sich Elemente eines gemeinsamen Dis-
kurses erkennen. Gemeinsame rhetorische Strategien, Methoden und
Topoi wurden immer wieder bernommen und abgewandelt. Fauriel
griff auf deutsches Gedankengut zurck, und dies erklrt vielleicht,
warum in den Jahren 182560 hauptschlich deutsche Philologen sein
Werk fortfhrten. Die Herausgeber griechischer Volkslieder bernah-
men Fauriels Gedanken zum Wesen des Volkslieds, zur neugriechischen
Sprache und zur Kontinuitt zwischen Alt- und Neugriechen; sie ent-
wickelten diese auf ihre eigene Weise und paten sie ihren eigenen
Zwecken an. So ging Theodor Kind von Fauriels Gedanken aus, um die
Volkslieder als Quelle zum Studium des Neugriechischen zu verwen-
den; dies fhrte ihn dazu, seine Auffassung der griechischen Sprache
durch den Rckgriff auf Adamantios Korais Thesen zu przisieren, wo-
bei er hoffte, selbst die zuknftige Entwicklung der griechischen Spra-
che und Literatur beeinflussen zu knnen.
Indem sie Elemente eines weitverbreiteten Diskurses ber die Volks-
lieder im Allgemeinen herausgriffen, trugen die Herausgeber griechi-
71
Sanders: Das Volksleben der Neugriechen, S. 302.
72
Marcellus: Chants du peuple en Grce, Bd. 2, S. 486488.
350 Sandrine Maufroy
scher Volkslieder dazu bei, das Bild der Griechen und den philhelleni-
schen Diskurs zu transformieren oder zumindest die Aufmerksamkeit
des Lesepublikums auf bestimmte angebliche Eigenschaften der Grie-
chen wie z. B. ihre Lebendigkeit zu lenken. Man griff aber auch auf To-
poi des philhellenischen Diskurses zurck: So wurden die griechischen
Volkslieder dazu instrumentalisiert, die Kontinuitt zwischen Alt- und
Neugriechen zu beweisen. Fauriels Thesen und Methoden wurden dabei
systematischer weiterentwickelt, sie dienten den Herausgebern griechi-
scher Lieder dazu, Stellung in aktuellen Debatten zu nehmen. Die Hef-
tigkeit dieser Debatten lt vermuten, da es sich um mehr als um rein
wissenschaftliche Fragen handelte. Es galt vielmehr, das philhellenische
Engagement, ja sogar ein ganzes Bildungsmodell zu legitimieren, aber
auch, die Frage danach zu beantworten, worin das Wesen eines Volkes
bestehe, und schlielich die Integration Griechenlands ins westliche Eu-
ropa voranzutreiben.
Literaturverzeichnis
Quellen
Mittheilungen aus der Geschichte und Dichtung der Neu-Griechen. Erster Band. Historische
Volksgesnge der Neu-Griechen nach C. Fauriel. Erste Abtheilung. Fauriels Einleitung
zur Geschichte der Neu-Griechischen Volkspoesie. Aus dem Franzsischen. Koblenz
1825.
Mittheilungen aus der Geschichte und Dichtung der Neu-Griechen. Zweiter Band. Historische
Volksgesnge der Neu-Griechen nach C. Fauriel. Zweite Abtheilung. Klephtische und
andere historische Gesnge, dann Lieder vom Suliotenkrieg. Mit Fauriels Einleitungen.
Koblenz 1825.
Von Chamisso, Adelbert: Verratene Liebe, Georgis, Die schne Sngerin,
Das Mdchen und das Rebhuhn, in: Adelbert von Chamisso. Smtliche
Werke in zwei Bnden. Nach dem Text der Ausgaben letzter Hand und den
Handschriften. Textredaktion: Jost Perfahl. Bibliographie und Anmerkungen
von Volker Hoffmann. Prosa. Dramatisches. Gedichte. Nachlese der Gedichte, Bd. 1.
Jost Perfahl/Volker Hoffmann (Hrsg.): Mnchen 1975, S. 230231, S. 357360,
S. 723725.
Fallmerayer, Jakob Philipp: Geschichte der Halbinsel Morea whrend des Mittelalters.
Stuttgart 18301836.
Fauriel, Claude: Chants populaires de la Grce moderne, recueillis et publis, avec une tra-
duction franaise, des claircissements et des notes, par C. Fauriel. Tome 1
er
. Chants histo-
riques. Tome 2. Chants historiques, romanesques et domestiques. Paris 18241825.
Firmenich-Richartz, Johann Matthias: Tragoudia Romaka. Neugriechische Volksgesnge.
Original und Uebersetzung. In Zusammenstellung mit den uns aufbewahrten altgriechi-
schen Volksliedern. Von Dr. J. M. Firmenich. Berlin 1840.
Die Stimme des griechischen Volkes 351
: Volksdichtungen Nord- und Sdeuropischer Vlker alter und neuer Zeit. Tragoudia Ro-
maka. Neugriechische Volksgesnge. Zweiter Theil. Urtext und bersetzung. Von Johan-
nes Matthias Firmenich-Richartz, Professor u. s. w. Berlin 1867.
Von Goethe, Johann Wolfgang: Neugriechisch-epirotische Heldenlieder, in: Goe-
thes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Groherzogin Sophie von Sachsen.
Gedichte. Dritter Theil, Bd. 3. Weimar 1890, S. 213221.
: Neugriechische Liebeskolien, in: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage
der Groherzogin Sophie von Sachsen. Gedichte. Dritter Theil, Bd. 3. Weimar 1890,
S. 222226.
Herder, Johann Gottfried: Von hnlichkeit der mittlern englischen und deutschen
Dichtkunst, nebst Verschiednem, das daraus folget, in: Herders Smmtliche Werke,
Bd. 9. Bernhard Suphan (Hrsg.): Berlin 1893, S. 532.
: Adrastea, in: Herders Smmtliche Werke. Adrastea, Bd. 24. Bernhard Suphan
(Hrsg.): Berlin 1886.
Kind, Karl Theodor: Eunomia. Dritter Band. Enthaltend: Neugriechische Volkslieder im
Originale und mit deutscher Uebersetzung, nebst Sach- und Worterklrungen. Ders.
(Hrsg.): Grimma 1827.
: Neugriechische Poesieen, ungedruckte und gedruckte, mit Einleitung und sowohl Sach- als
Wort-Erklrungen. Ders. (Hrsg.): Leipzig 1833.
: Neugriechische Chrestomathie, mit grammatischen Erluterungen und einem Wrterbuche.
Prosa und Poesie. Ders. (Hrsg.): Leipzig 1835.
: Neugriechische Anthologie. Original und Uebersetzung. Ders. (Hrsg.): Leipzig 1844.
: Mnimosynon. Neugriechische Volkslieder in den Originalen und mit deutscher berset-
zung. Ders. (Hrsg.): Leipzig 1849.
Lemercier, Npomucne: Chants hroques des montagnards et matelots grecs, Traduits en
vers franais Par M. Npomucne L. Lemercier, de lInstitut Royal de France (Acadmie
Franaise). Paris 1824.
: Suite des chants hroques et populaires des soldats et matelots grecs; Traduits en vers fran-
ais Par M. Npomucne L. Lemercier, de lInstitut Royal de France (Acadmie Fran-
aise). Paris 1825.
Marcellus, Marie-Louis-Jean-Andr-Charles Demartin du Tirac, comte de: Chants du
peuple en Grce, par M. de Marcellus, ancien Ministre plnipotentiaire, auteur des Souve-
nirs de lOrient et des Vingt jours en Sicile. 2 Bde. Paris 1851.
: Chants populaires de la Grce moderne runis, classs et traduits par le Cte de Marcellus,
ancien Ministre plnipotentiaire. Paris 1860.
Mller, Wilhelm: Neugriechische Volkslieder. Gesammelt und herausgegeben von C. Fauriel.
bersetzt und mit des franzsischen Herausgebers und eigenen Erluterungen versehen von
Wilhelm Mller. Erster Theil. Geschichtliche Lieder. Leipzig 1825.
: Neugriechische Volkslieder. Gesammelt und herausgegeben von C. Fauriel. bersetzt und
mit des franzsischen Herausgebers und eigenen Erluterungen versehen von Wilhelm
Mller. Zweiter Theil. Romantische und husliche Lieder nebst Anhang. Leipzig 1825.
: Reime aus den Inseln des Archipelagus, in: Wilhelm Mller. Werke. Tagebcher.
Briefe. Mit einer Einleitung von Bernd Leistner. Wilhelm Mller. Gedichte 2, Bd. 2.
Maria-Verena Leistner (Hrsg.): Berlin 1994, S. 3040.
Nees von Esenbeck, Christian Gottfried: Briefwechsel mit Johann Wolfgang von Goethe
nebst ergnzenden Schreiben. Kai Torsten Kanz (Hrsg.): Halle 2003.
Sanders, Daniel: Volks- und Freiheitslieder. Zum Besten der unglcklichen Kandioten.
Grnberg, Leipzig 1842.
352 Sandrine Maufroy
: Das Volksleben der Neugriechen dargestellt und erklrt aus Liedern, Sprichwrtern, Kunst-
gedichten, nebst einem Anhange von Musikbeilagen und zwei kritischen Abhandlungen
von Dr. D. H. Sanders. Mannheim 1844.
[Schlosser, Johann Heinrich Friedrich:] Neugriechische Volkslieder. [Frankfurt a.M.]
1825 [als Manuscript fr Freunde gedruckt].
: Wanderfrchte. Sammlung auserlesener Poesien aller Zeiten in Uebertragungen, von Jo-
hann Friedrich Heinrich Schlosser. Aus dessen Nachla herausgegeben von Sophie Schlos-
ser. Mainz 1856.
Von Schmidt-Phiseldeck, Conrad Friedrich: Auswahl Neugriechischer Volkspoesien,
in Deutsche Dichtungen umgebildet von C.F. v. Schmidt-Phiseldeck. Braunschweig
1827.
Schulte Kemminghausen, Karl/Soyter, Gustav (Hrsg.): Neugriechische Volkslieder ge-
sammelt von Werner von Haxthausen. Urtext und bersetzung. Mnster i. W. 1935.
Swanton-Belloc, Louise: Bonaparte et les Grecs, par Madame Louise Sw.-Belloc, suivi dun
tableau de la Grce, en 1825, par le Comte Pecchio. Paris 1826.
Forschungsliteratur
Bausinger, Hermann: Formen der ,Volkspoesie. Berlin 1968.
Brouwer, Cornelis: Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland. Unter-
suchungen ber die Auffassung des Begriffes. ber die traditionellen Zeilen, die Zahlen-,
Blumen- und Farbensymbolik. Groningen, Den Haag 1930.
Caminade, Gaston: Les Chants des Grecs et le philhellnisme de Wilhelm Mller. Paris 1913.
Dieterich, Karl: Goethe und die neugriechische Volksdichtung, in: Hellas-Jahrbuch,
1929, S. 6181.
Espagne, Michel/Werner, Michael: Deutsch-franzsischer Kulturtransfer als For-
schungsgegenstand. Eine Problemskizze, in: dies. (Hrsg.): Transferts. Les Relations
interculturelles dans lespace franco-allemand (XVIII
e
et XIX
e
sicle). Paris 1988,
S. 1134.
Espagne, Michel: La rfrence allemande dans la fondation dune philologie fran-
aise, in: ders./Michael Werner (Hrsg.): Philologiques I. Contribution lhistoire des
disciplines littraires en France et en Allemagne au XIX
e
sicle. Paris 1990, S. 135158.
: Claude Fauriel en qute dune mthode, ou lIdologie lcoute de lAllema-
gne, in: Romantisme. Revue de la Socit des tudes romantiques et dix-neuvimistes,
21/1991, 73, S. 718.: Le paradigme de ltranger. Les chaires de littrature trangre au
XIXme sicle. Paris 1993.
: Les Transferts culturels franco-allemands. Paris 1999.
: Le philhellnisme entre philologie et politique. Un transfert franco-allemand,
in: ders./Gilles Pcout (Hrsg.): Philhellnismes et transferts culturels dans lEurope du
XIX
e
sicle. Revue germanique internationale, 2005, 12, S. 6175.
Foucault, Michel: Larchologie du savoir. Paris 1969.
: Lordre du discours. Paris 1971.
Gaier, Ulrich: Kommentar, in: Johann Gottfried Herder. Werke in zehn Bnden.Jo-
hann Gottfried Herder. Volkslieder. bertragungen. Dichtungen, hrsg. von Ulrich Gaier.
Martin Bollacker (Hrsg.), Bd. 60: Frankfurt a.M. 1990, S. 839927.
Galley, Jean-Baptiste: Claude Fauriel, membre de lInstitut. 17721843. Saint-Etienne
1909.
Die Stimme des griechischen Volkes 353
Ibrovac, Miodrag: Claude Fauriel et la fortune europenne des posies populaires grecque et
serbe. Etude dhistoire romantique suivie du Cours de Fauriel profess en Sorbonne
(18311832). Paris 1966.
Irmscher, Johannes: Goethe und die neugriechische Literatur, in: Goethe-Jahrbuch,
98/1981, S. 4348.
Judet de la Combe, Pierre: Philologie classique et lgitimit. Quelques questions sur
un ,modle, in: Michel Espagne/Michael Werner (Hrsg.): Philologiques I. Contri-
bution lhistoire des disciplines littraires en France et en Allemagne au XIX
e
sicle. Paris
1990, S. 2342.
Linder-Beroud, Waltraud: Von der Mndlichkeit zur Schriftlichkeit? Untersuchungen zur
Interdependenz von Individualdichtung und Kollektivlied. Frankfurt a.M., Bern, New
York, Paris 1989.
Mller, Heidy Margrit: Goethe, collectionneur et traducteur de chants populaires
grecs modernes, in: Jean-Marie Valentin (Hrsg.): Goethe. LUn, lAutre et le Tout.
Paris 2000, S. 91112.
Politis, Alexis: I anakalypsi ton ellinikon dimotikon tragoudion. Athen 1984.
Redlich, Carl: Einleitung, in: Herders Smmtliche Werke.Herders Poetische Werke,
hrsg. von Carl Redlich. Bernhard Suphan (Hrsg.), Bd. 25: Berlin 1885, S. IXXI.
Soyter, Gustav: Die Quellen zu Goethes bertragungen aus dem Neugriechischen,
in: Hellas-Jahrbuch, 1936, S. 6773.
354 Sandrine Maufroy
Abbildungsverzeichnis 355
Abbildungsverzeichnis
Zum Beitrag von Elisabeth Dcultot: Winckelmanns Konstruktion der griechischen
Nation
Abb. 1: Winckelmanns Exzerpte aus Buffon: Histoire naturelle gnrale & particulire
(Bd. 3, Paris 1749), in: Winckelmann, Pariser Nachlass, BN All., Bd. 64, fol. 1
Abb. 2.: Winckelmanns Exzerpte aus: Jean-Baptiste Du Bos: Rflexions critiques sur la
posie et sur la peinture, in: BN All., Bd. 61, fol. 48 r
Abb. 3: Winckelmanns Exzerpte aus: Caylus: Recueil dantiquits gyptiennes, trusques,
grecques et romaines, in: BN All., Bd. 67, fol. 46 r
Abb. 4: Winckelmanns Exzerpte aus: Caylus: Recueil dantiquits gyptiennes, trusques,
grecques et romaines, in: BN All., Bd. 67, fol. 46 v
Zum Beitrag von Ekaterini Kepetzis: Familien im Krieg Zum griechischen Frei-
heitskampf in der franzsischen Malerei der 1820er Jahre:
Abb. 1: Eugne Delacroix: Das Massaker von Chios, 1824, Paris, Louvre
Abb. 2: Michel Philibert Genod: Der Schwur des jungen Kmpfers, 1825, Privat-
sammlung
Abb. 3: Jacqume: Abschied eines Freiwilligen, 1837, Athen, Privatsammlung
Abb. 4: Ary Scheffer: Junger Grieche verteidigt seinen Vater, 1827, Athen, Benaki-
Museum
Abb. 5: Franois-mile de Lansac: Szene aus dem Auszug von Missolonghi, 1828,
Missolonghi, Pinakothek
Abb. 6: Pierre-Narcisse Gurin: Die Rckkehr des Marcus Sextus, 1799, Paris, Louvre
Abb. 7: Auguste Jean-Baptiste Vinchon: Modernes griechisches Thema Nach dem
Massaker von Samothrake, 1827, Paris, Louvre
Zum Beitrag von Chryssoula Kambas: Das griechische Volkslied Charos in Goethes
Version und sein Bild des neuen Griechenland. Mit einem Ausblick auf die Haxthau-
sen-Manoussis-Sammlung:
Abb. 1: Zeichnung des Stuttgarter Portrtmalers Carl Jakob Theodor Leybold, aus
Karl Dietrich: Goethe und die neugriechische Volksdichtung, S. 80.
Abb. 2: Luise Duttenhofer. Scherenschnitt-Illustration zu Goethes Gedicht Cha-
ron, aus: Manfred Koschlig: Die Schatten der Luise Duttenhofer. Eine Auswahl
von 147 Scherenschnitten. Schiller-Nationalmuseum Marbach a.N. 1968, Abb. 55.
356 Abbildungsverzeichnis
Autorinnen und Autoren 357
Autorinnen und Autoren
Prof.ssa Elena Agazzi, Universitt Bergamo
Prof. Arnaldo di Benedetto, Universitt Turin
Prof.ssa Gabriella Catalano, Universitt Rom 2
Prof. Dr. Elisabeth Dcultot, Ecole Normale Suprieure Paris
Valerio Furneri, Universit di Bergamo
Ass. Prof. Dr. Constanze Gthenke, Princeton University
Dr. Gilbert He, Georg-August-Universitt Gttingen
Prof. Dr. Chryssoula Kambas, Universitt Osnabrck
PD Dr. Ekaterini Kepetzis, Ruhr-Universitt Bochum
Dr. Marie-Ange Maillet, Ecole Normale Suprieure Paris
Sandrine Maufroy, Ecole Normale Suprieure Paris
Prof. Dr. Albert Meier, Christian-Albrechts-Universitt zu Kiel
Prof. Dr. Helmut Pfotenhauer, Bayerische Julius-Maximilians-Universitt Wrzburg
Prof. Dr. Diego Saglia, Universit degli Studi di Parma
Prof. Dr. Alain Schnapp, Universit Paris 1
PD Dr. Christian Scholl, Georg-August-Universitt Gttingen
Dr. Kerstin Schwedes, Georg-August-Universitt Gttingen
358 Autorinnen und Autoren
Personenregister 359
Baudelaire, Charles 173
Bauer, Johannes 103
Bauer, Winfried 275
Baumann, J. 249
Bausinger, Hermann 340f., 343
Beccaria, Cesare 175
van Beethoven, Ludwig XIII
Begemann, Christian 101, 111
Belon, Pierre 26, 50
Bendemann, Eduard 78
Bnzit, Emmanuel 155
de Branger, Pierre Jean 244, 246, 250,
252
Braud, Anthony 133, 158
Berchet, Giovanni 174
Berlioz, Hector XIII
Bernini, Gian Lorenzo 64
Bertoncini, Giancarlo 176, 178ff.
Bianchini, Francesco 20
de Bifve, Eduard 79
Biondo, Flavio/ Blondus, Flavius 3, 6, 9
Blanchard, Alastair 228
Blaquire, Edward 247f.
Blome, Peter 81
Blouet, Abel 34
Blhm, Andreas 62, 72
Boissere, Sulpiz 314, 322
Boiteau, Paul 252
de Boitaill, Hurault 26
von Bollmann, Ludwig 127
Bonaparte, Napolon 33f., 150, 153f.,
284f., 286, 303
Borbein, Adolf H. 103
Borchmeyer, Dieter 105
Bordes, Philippe 155
Bordichon, Jean 10
von Bormann, Alexander XV
Bory de Saint-Vincent,
Jean Baptiste 34f.
Abramowicz, Andrzej 4
Achill 176
Agamamnon 238
Albrecht, Michael 319
Alexander I, Zar 186, 290
Alfier, Vittorio 181
Almaric, Jean 16
Althofer, Heinz 104
Amerbach, Basilius 13
Ares 239
Argan, Giulio Carlo 63
Aridas, Georgios 317
Aris, Philippe 161ff.
Arndt, Ernst Moritz 282
Arnim, Achim von 324
Arnold, Robert F. XII, 236, 302, 304,
310, 320
Arundel, Thomas Howard, Lord
of 2325, 27
Arzt, Ingo 164
Asopios, Konstantinos 322
Aspasia 281
Assmann, Aleida 99, 111
Athanassoglou-Kallmyer, Nina XIII,
134, 139f., 154
Aubrey, John 18f.
Augustinos, Olga 200
Auhagen, Ulrike 3
Bacon, Francis 3
Bajou, Valrie 134
Balzac, Honor de 101
Bandmann, Gnter 62
Bartholdy, Jakob Ludwig Salomo 190,
321
Bartolomus von Glanville 4f., 9
Bartolommei, Giovan Paolo 178
von Basenheim, Anthon 8, 11
Batchelor, David 81
Personenregister
360 Personenregister
Bothe, Rolf 87
Botzaris (Bozzaris), Marcos 135, 158,
250
Boulanger, Nicolas Antoine 22
Bouvier-Bron, Michelle 249
Boyle, Nicholas 300, 319
Bracken, Catherine Philippa 33
Brandi, Cesare 107
Bredekamp, Horst 7
Breil, Michaela XI, 242
Brendel, Thomas XV
Brentano, Clemens 101, 324
de Brves, Savary 26
Brinkmann, Sren 286
Brinkmann, Vinzenz 61f., 69, 81
Brizzolara, Anna Maria 3
Brofferio, Angelo 206
Bronfen, Elizabeth 222
Brouwer, Cornelius 340
Brown, Roy H. 137
Bruch, Max 236
Brueck, Martin 238
Bres, Eva 95
Brun, Friederike 249
Bruno, Giordano 10
de Bry, Theodor 10
Brydone, Patrick 267
Buchon, Alexandre 301, 321, 331ff
Bud, Guilleaume 14
Bufalini, Leonardo 9
de Buffon, Georges Louis Leclerc 42f.
Bujok, Elke 7
Buonarroti, Michelangelo 312
Butler, E. May XIII
Byron, George Gordon, Lord XV,
XIXf., 105, 173, 176, 178f., 182,
199217, 219223, 227f., 230, 239,
242, 250, 268
Cain, Hans-Ulrich 77, 103
Callot, Jacques 149
Calvi, Pietro 75
Calvo, Marco Fabio 9
Camden, William 11, 15, 23, 25, 28, 31
Caminade, Gaston 334
Canat, Ren XII
Canova, Antonio 6365, 67, 75
Carducci, Giosue 183
Carrey, Jacques 27
Catalano, Gabriella XVII
comte de Caylus, Anne Claude Philippe
de Tubires 22, 32, 39, 40f., 53f.,
56f.
Chalandritsainos, Lukas 221
von Chamisso, Adelbert 235256, 334
Chamisso, Hyppolite 238
Chateaubriand, Franois Ren
Viscomte de XIV, 199, 173
Chaudonneret, Marie-Claude 134, 140
Cheeke, Stephen 206
Choiseul-Goffier, Fauvel 33
Chon, Paulette 149
Chroust, Anton 293
Cicero, Marcus Tullius 47, 53
Clavuot, Ottavio 6
Clogg, Richard 322
Clver, Philipp 17
Cockerell, Charles Robert 20, 62, 280
Constant, Benjamin 301, 321
Constantine, David 28f., 33
Conter, Claude D. XIII, 134
Conti, Alessandro 102
Corrieri, Susanna 175
de Cosca Vayo, Estanislao 206
de Cosimo, Piero 10
Cotta, Johann Friedrich 289
de Coureil, Giovanni Salvatore 176f.
Cousin, Victor 301, 321, 324
Cranach, Lukas 10
Crow, Thomas 152
Crusius, Martin 339
Cupido 238
Cyriacus von Ancona 23
dAlembert, Jean Baptiste le Rond 175
dAnnunzio, Gabriele 173
Dakin, Douglas XII, 250
David, Jacques-Louis 134, 137, 144,
154f., 157
Davis, Whitney 228
Dcultot, Elisabeth XVI, 71
Delacroix, Eugne 133ff., 137, 138f.,
144, 146, 148, 151, 154ff., 158, 161,
212215
Delavigne, Casimir 210
Demata, Massimiliano 203, 204
Personenregister 361
Derks, Paul 228
Di Benedetto, Arnaldo XII, XIV, XIX,
200
Diderot, Denis 153, 175
Dieterich, Karl 302, 308, 320, 333
Dimakis, Jean XIII
Dionisotti, Carlo 176
Dix, Otto 164
Dllinger, Ignaz 289
Dring, Thomas 76
Drost, Wolfgang 62
von Droste-Hlshoff, Anette 322
Droulia, Loukia XIII
Drumann, Wilhelm 190
Du Bos, Jean-Baptiste 47ff.
Dubois, Lon Joseph 34
Dcker, Burckhard 224
Duncan, Carol 161f.
Dupaty, Charles 267
Duttenhofer, Luise 314
Ehrlich, Elisabeth 250, 253
von Eichendorff, Joseph Freiherr 101
Elfenbein, Andrew 221
Earl of Elgin, Thomas Bruce 33
Erb, Andreas 282
von Esenbeck, Christian Gottfried
Nees 331f.
Eser, Friedrich 223, 227, 232
Espagne, Michel XIII, 299, 322, 330f.,
337, 348
Estve, Edmond 208
Euripides 281
Ewals, Leo 144
Eynard, Jean Gabriel 119, 249, 275
Faller, Stefan 3
Fallmerayer, Jakob Philipp 272, 348
Fancelli, Maria 102
Fantastici Rosellini, Massimina XIX,
182
Fantastici, Fortunata Sulgher 182
Fauriel, Claude XIX, XXII, 174, 205,
244, 299, 301ff., 305f., 308, 310,
314, 316ff., 320325, 329343,
345350
Fechner, Gustav Theodor 63, 73, 74
Feddersen, Martin 77
Fernow, Carl Ludwig 73, 7477
Feudel, Werner 236240, 242f., 247,
251, 253
Firmenich-Richartz, Johann Mat-
thias 336, 339f., 343, 345, 348f.
Fischer, Robert 237
Forssman, Erik 86f., 89
Foscolo, Ugo 174, 199, 207
Foucault, Michel 330
Fourmont, Michel 31f., 191
Franke, Thomas 42
Frankh, Friedrich 279
Franklin, Caroline 203
Fraser, Elisabeth A. 135, 139, 144, 146,
154, 161
Friedrich, Caspar David 172
Frhwald, Wolfgang 275, 277f., 291
Furneri, Valerio XVIII, 246
Furtwngler, Adolf 62
Gaehtgens, Thomas W. 137
Gaier, Ulrich 330, 343
Galba, Lucius Livius Ocella Servius
Sulpicius 8
Galitz, Kathryn Calley 159
Gallait, Louis 79
Galland, Antoine 27, 30
Galley, Jean-Baptiste 331
Garnier 62
Gassendi, Pierre 24, 33
von Gaudy, Franz Freiherr 246, 252
Genf 242
Genod, Michel Philibert 140142, 144
Geoffrey von Monmouth 4
Gerster, Ulrich 136
Gilles, Pierre 26
Gestrich, Andreas 159f., 162
Glck, Friedrich 223
Goedeke, Karl 277
Goethe, Johann Wolfgang 86, 103, 109,
112, 120, 172ff., 207, 224, 230, 263,
299316, 318321, 325f., 332f.
Gollwitzer, Heinz 280, 290, 292
Gorani, Giuseppe 173
Grres, Joseph 285, 28992, 322
Gould, Steve J. 25
Gourgouris, Statis X
de Goya, Francisco 148, 150, 152
362 Personenregister
Gregor von Tours 4
Greuze, Jean Baptiste 143f., 153, 160
Grieg, Edward 236
Grimm, Gerhard 154
Grimm, Jacob 318, 321f., 343
Brder Grimm 341
Grosz, George 164
Gurin, Pierre-Narcisse 144, 155ff.
Guerrazzi, Francesco Domenico 175
Gthenke, Constanze XX, 240
Habermas, Jrgen 152
Hajnal, John 160
Haller von Hallerstein, Carl 33, 280
Hammer-Schenk, Harold 88
Hamon, Philippe 107
Hargrove, June 72
Harms, Wolfgang 14
Harnisch, Antje 245
Hartung, Gnter 246
Hatfield, Henry Caraway 40
Haus, Andreas 89
Hauser, Christoph XI, 122, 152, 291,
292
von Haxthausen, Werner 299, 304,
308312, 314, 316, 320325, 331, 333
Hayez, Francesco 174
de Heere, Lucas 10
Hegel, Georg Friedrich Wilhelm 67, 72,
74, 109f.
Heilmaier, Johann Michael 346
Heinse, Wilhelm 232
Hektor 176
Helbing, Regine 136
Hennig, John 319
Herder, Johann Gottfried 57, 63f., 6669,
74, 228, 323f., 329f., 340, 343, 345
Hermann Fiore, Kristina 106
Herodot 3, 13, 44, 52, 68
Herzfeld, Michael 219, 232
He, Gilbert XV, XX, XXIII, 135, 157,
163
Hesseling, Dirk Christiaan 315
Hettche, Walter 100, 110
Heyer, Friedrich 122, 240, 282
Heynig, Johann Gottlob 120
von Hippel, Wolfgang 282
Hippokrates 42, 44, 47
Hirt, Alois 88, 89, 93
Hittorff, Jakob Ignaz 62
Hoffmann, E.T.A. XIX, 185188,
190195
Hofmann, Werner 136
Hlderlin, Friedrich 120, 199, 224
Homer 112, 238, 281, 348
Hooke, Robert 22
Hotho, Heinrich Gustav 79
Howarth, David 23f.
Hugo, Victor 239
von Humboldt, Wilhelm X
Hurka, Florian 3
Ibrovac, Miodag 299, 331, 333
Iken, Carl 308, 315
Ingres, J.A.D 213
Irmscher, Johannes 255, 280, 288
Ivinski, Patricia R. 159
Jacqume, A. 142ff.
Jaeckel, Katja 209
Jaff, Hans C. L. 86
Jger, Michael 67
Jal, Auguste 141, 142, 146, 154
Janse, Mark 188
Janzing, Godehard 150, 157
Jean Paul ( Jean Paul Ludwig Richter)
XIX, 185192, 195f.
Jefferson, Thomas 21f.
Joannides, Paul 213
Johnson, Lee 214
Judet de la Combe, Pierre 337
Jungmair, Otto 104
Jupiter 238
Just, Klaus Gnther 261, 263f.
Kambas, Chryssoula XXII
Kammel, Frank Matthias 77
Kampmann, Sabine 165
Kanaris, Constantin 255
Kanduth, Erika XIV
Kant, Immanuel 120
Kapodistrias, Ioannis Antonios 271,
272
Kara Ali 255
Karagiannis-Moser, Emmanuelle 289
Karl X., Knig von England 154
Personenregister 363
Katharina II, Zarin von Ruland 173,
180
Keats, John 199f.
Kedrotis, Jorgos 304
Keller, Thomas 111
Kepetzis, Ekaterini XVIII, 243
Kessler, Eckhard 3
Kiderlen, Moritz 76
Kiefer, Heinrich Joseph 125
Kind, Karl Theodor 305, 332f.,
335337, 339, 343347, 349
King, Shelley 229
von Klenze, Leo 281, 289
Klopstock, Friedrich Gottlieb 238
Klber, Johann Ludwig 250
Kockel, Valentin 102
Kohle, Hubertus 142
Kolb, Martin 214
Komnenos, Graf Alessio 173
Kontos, Yannis 164
Kppen, Manuel 136f., 148, 164
Korais, Adamantios 347, 349
Koschnick, Leonore 71
Koschorke, Albrecht 111
Koselleck, Reinhard IX, 111
von Kotsch, Maximilian 129
von Kotzebue, August XIII
Kramer, Dieter XIf.
Kraus, Andreas 292
Kreisler, Johann 192
Kreta 246
Krug, Wilhelm Traugott 121f.
Krger, Johann Gottlob 42
Kugler, Franz 63, 68-72, 74, 7881
Kundolino, Sophia 247
La Peyrre, Isaac 19
Laarmann, Frauke K. 135
Lachinger, Johann 105
Lagner, Beatrix 237
Lahnstein, Peter 237
de Lamartine, Alphonse 177, 210212
Landfester, Manfred XIII
de Lansac, Franois-mile 146f.
Laugier, Jean-Nicolas 155
Laugier, Marc-Antoine 87
Laurens, Henri 34
Lautenbacher 279, 284, 292
Le Brun, Corneille 50
Le Moine 10
Leask, Nigel 200
Leclerc de Buffon, George Louis
22, 35
Lehmann, Marco 188
Lemaire de Belges, Jean 13
Lemercier, Npomucne 334
Leopardi, Giacomo 174f.
Lepenies, Wolf 42
von Leybold, Carl Jakob Theodor
312314
Ligorio, Pirro 9
Linder-Beroud, Waltraud 340
Lipp, Wilfried 104
Lbker, Friedgar 239, 282
Logothes, Lykurgos 250
Lorenz, Angelika 136
Lschburg, Winfried 152
von Lbtow, Adolf 126128
Ludwig I. von Wittelsbach, Knig von
Bayern 172, 275293
Ludwig XIV, Knig von Frankreich 27
Luhmann, Niklas 230f.
Ltgens, Annelie 165
MacCarthy, Fiona 220f.
MacNamidhe, Margaret 137
Mahon, Denis 67
Maillet, Marie-Ange XXI
Manoussis, Theodoros 323
Manzoni, Alessandro XIX, 172ff., 177,
180f., 299, 303
Marcellus, Marie-Louis-Jean-Andr-
Charles Demartin du Tirac,
comte de 336, 337, 349
Marchand, Suzanne XIII
Maria 249
Mariette, Pierre-Jean 57
Martin, Catherine 134, 155
Mastellone, Salvo XIV
Matt, Gerald 136
Maufroy Sandrine XXII
Mavromichalis, Petros 272
von Maxen, Haug 7
Maximilian I von Habsburg, Kaiser
6f.
Mayer, Enrico 175
364 Personenregister
Maza, Sarah 161
Meier, Albert X, XX
Meisterlin, Sigismund 6
Melanchton, Philipp 12
Melchiori, Giorgio 207
Menzel, Mathias 164
Metternich, Klemens Wenzel Lothar,
Frst von 153, 292
Migliorini, Luigi Mascilli XIV
Miller, Norbert 236, 238, 255
Mitford, William 190
Mitsou, Marilisa 317, 326
Mochoglou, Ariph 244
Molik, Witold 154
Montani, Giuseppe 176, 179f.
Montesquieu, Charles de Secondat,
Baron de 47
de Montfaucon, Bernard 22, 3032
Mornin, Edward 254
Moser, Stephanie 9, 10
Moustoxidi, Andrea XIX, 174, 183, 299,
318, 325
Muecke, Frances 229
von Mller, Johannes 284, 322
Mller, Gottfried 126f.
Mller, Heidy Margrit 300, 333
Mller, Urs 40
Mller, Wilhelm 188, 194, 206,
236, 244, 246, 277, 302, 305f.,
308310, 311, 316, 329f., 332, 334f.,
337, 347
Mnter, Friedrich 267
Mushard, Martin 21
Musil, Robert 103
Myers, Donald 62
Mygdalis, Lampros 223, 293
Napoleon f Bonaparte
Nelisteros (D.i.Karl Emil
Rosenstiel) 130
Neumann, Gerhard 110, 230
von Niebuhr, Carsten 321
Nievo, Ippolito 181
Nikolaus I. Pawlowitsch, Zar 288
Nipperdey, Thomas X
Marquis de Nointel, Charles Marie
Franois Olier 23, 2730
Nnningh, Jodocus Hermann 21
Oesterle, Gnter 109
Olaus Magnus (Bischof von Uppsa-
la) 11f., 15
Omont, Henri 2629, 31
Ortelius, Abraham 11
Owen, George 15
Paganel, Camille 135, 158
Palli Bartolommei, Angelica 171,
175181, 206
Palm, Godehart 136, 151
Paracelsus (Philippus Theophrastus
Aureolus Bombastus von Hohen-
heim) 10
Parra, Anton Ranieri 176
Pascoli, Giovanni 183
Paul, Gerhard 136, 148
Pauls, Johann Peter 331
Pausanias 68
de Pauw, Cornelius 121
Payne, Harry C. 159
Peiresc, Nicolas-Claude Fabri 23f.,
2628, 33
Pellicier, Guillaume 26
Perikles 46, 281
Peruzzi, Emilia 177
Peschken, Goerd 86, 89f., 92f., 95
Petau, Paul 15
Peter, Klaus XV
Petrarca 3, 6
Petty, William 24f.
Pfotenhauer, Helmut 100, 109
Phidias 52, 281
Picasso, Pablo 164
Pigott, Stuart 10f.
Pikkolos, Nikolaos 324
Pille, Ren-Marc 240
Pitt-Rivers, A.L.F. 22
Platon 281
Plinius 18
Poe, Edgar Allen 173
Polaschegg, Andrea 186, 250, 253,
255
Politis, Alexis 301, 318, 322ff., 331
Politis, Nikolaos G. 306, 317
Polybios, Lukian 47
Pomian, Krzysztof 7, 102
Popkin, Richard Henry 20
Personenregister 365
Potts, Alex 64f., 89, 228
Pouqueville, Franois Charles Hugues
Laurent 207, 210, 249f., 252
del Pozzo, Cassiano 30
Praet, Danny 188
Prater, Andreas 62, 109
Primavesi, Oliver 61
Protopsaltis, E.G. 203
Psicharis, Ioannis 316ff.
Puchner, Walter XIII, 245, 255
von Pckler-Muskau, Hermann
Frst 261265, 267f., 272
Puppo, Mario XII
Quack-Eustathiades/ Quack-
Manoussakis, Regine 121, 123f.,
127f., 129f., 300, 302
Rabelais, Franois 11
Raizis, Marius Byron 200
von Rantzau, Heinrich 17
Rave, Paul Ortwin 86, 88, 92
Reber, Franz 65, 80
Redlich, Carl 330
Reuterswrd, Patrik 61
Revett, Nicholas 32
Rhode, Christian Detlev 21
Richard-Schilling, Sophie 249
de Richelieu, Armand-Jean I.
du Plessis 26
Richter, Friedrich f Jean Paul
Riedesel, Johann Hermann 265, 267f.
271
Rieger, Dietmar 244
Riemer, Friedrich Wilhelm 302, 308
Robinson Crusoe 171
Roe, Sir Thomas 24
Roessel, David XV, 199, 216, 219
Roger, Jacques 42
Roli, Maria Luisa 99
Rosen, Fred XV
Rosinus, Johannes 9, 17
Ross, Ludwig 283
de Rossi di Pomarolo, Annibale
Santorre, Graf von Santarosa 179
Rossi, Paolo 20
Rossini, Gioachino XIII
Rothpletz, Emil 249
Rousseau, Jean Jacques 159, 238, 268
Rovani, Giuseppe 207
Rubens, Peter Paul 65, 137, 148f., 152
Rubin, James Henry 155, 157
Rudbeck, Olof 20f.
Ruge, Arnold 78
Rutschky, Katharina 163
Saglia, Diego XIX
Sambucus, Johannes 14
de Sanctis, Francesco 178
Sanders, Daniel 336, 343f., 348f.
van de Sandt, Udolpho 141
de Saucy, Harlay 26
Schasler, Max 63, 7376
Scheffer, Ary 144ff., 150, 155, 214
Scheidig, Walter 305
Scheitler, Irmgard 129, 190, 236f., 242,
246
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 66
Schiller, Friedrich X, 108, 128, 186, 265,
276, 305
Schinkel, Karl Friedrich 8596
Schlegel, August Wilhelm 237, 253, 343
Schlegel, Friedrich 235, 238
Schlegel August Wilhelm 253
Schlosser, Johann Heinrich Fried-
rich 334
von Schmidt-Phiseldeck,
Conrad Friedrich 334
Schnapp, Alain XVI
Schneider, Reinhold 237
Scholl XVII
Schll, Gustav Adolph 78
Schopenhauer, Arthur 72
Schulte-Kemminghausen, Carl 308f.,
323, 325
Schulz, Gerhard 186
Schumann, Robert 236
Schwab, Gustav 122, 242
Schwedes, Kerstin XVII
Schweizer, Stefan X
Seeba, Hinrich C. 40
Segebrecht, Wulf 185, 188
Seidl, Wolf 280
Semper, Gottfried 61, 63, 6673, 76f.,
79, 81
Sendtner, Jacob XI
366 Personenregister
Settis, Salvatore 70, 81
Seume, Johann Gottfried 268
Sevin, Franois 31
Sgoff, Brigitte 299
Sharafuddin, Mohammed 200
Shelley, Percy Bysshe 199f.
Shorter, Edward 162f.
Sismondi, Simonde de 322
Sjgren, Christine Oertel 99
Skatoverga, Georgis 244
Sloman, Susan 162
Sokrates 281
Sonnini de Manoncourt,
Charles Nicolas Sigisbert 190
Sontag, Susan 151
Soret, Frderic 305
Ssemann, Bernd XI
Southey, Robert 205
Soyter, Gustav 331, 333, 304, 308f., 320,
325
Spaenle, Ludwig 292
Spencer, Terence 199201
Spindler, Max 292
Spohr, Ludwig 236
Spon, Jacques 25ff., 30, 32
St Clair, William 208, 242, 250, 254
von Stackelberg, Otto Magnus 33
de Stal, Anne Louise Germaine, Baro-
nin 237, 322
Stauf, Renate XIII
vom und zum Stein, Heinrich Friedrich
Karl Freiherr 322
Stein, Peter 163, 237
Stendhal (Marie-Henry Beyle) 173, 230
Stenon, Nicolas 20f.
Stiegler, Bernd 111
Stifter, Adalbert 99113
Stoneman, Richard 23, 31ff.
Stuart, James 32
Studion, Simon 13f.
Stukeley, William 21
Snderhauf, Esther Sophia 40
Swanton-Belloc, Louise 334
Tacitus 3
Tardel, Hermann 235f., 244, 247
Themistokles 186, 190
Thvet, Andr 26
Thiersch, Friedrich 122, 277ff., 289,
290ff., 302, 310, 321
Thorvaldsen, Bertel 65, 75
Thukydides 3
van Tieghem, Paul 200
Todorova, Maria 160
Tommaseo, Niccol 174
von Treitschke, Heinrich 293
Treu, Georg 76f.
Tsigakou, Fani-Maria X, 200, 203, 214
Trr, Katharina 72f.
Uhland, Ludwig 122, 252, 302
Unger, Manasse 79ff.
Ussher, James 25
von Vagedes, Adolph 95
Vandal, Albert 27
Velder, Christian 253
Velestinls, Rigas 183
Venturi, Franco 173f.
Vick, Brian X
Viesseux, Giovan Pietro 174f., 178
de Vigny, Alfred 209
Villle, Jean Baptiste, Comte de 251f.
Vinchon, Auguste Jean-Baptiste 133,
157
Vischer, Friedrich 79
Vitellius, Aulus 8
Vogl, Joseph 100
Vogt, Adolf Max 86
Vogtherr, Christoph Martin 88
Voltaire (Franois Maire Arouet) 173
Vo, Johann Heinrich IX
von Vo, Julius 121
Vokamp, Wilhelm 109
Wagner, Johann Martin 66, 68
Wagner, Richard 171f.
Waiblinger, Wilhelm XX, 22328, 232,
302
Wall, Richard 160
Webb, Timothy 200
Weber-Kellermann, Ingeborg 135f.
Weiss, Roberto 6, 9
Werner, Michael 330
Westhoff-Krummacher, Hildegard 159
White, John 10
Personenregister 367
Whiteley, John 141, 155
Wiedenmann, Ursula 239
Wiesner, Joseph 42
Wilson, Samuel Sheridan 242
Winckelmann, Johann Joachim IXf.,
XIIIf., XVII, XXI, 33, 3947, 62f.,
70f., 80f., 120, 140, 188f., 222,
227229, 264f., 272, 281
Wircker, Erdmann 85
Wittich, Elke Katharina 89
Wolf, Friedrich August 348
Wolfzettel, Friedrich 26
Worm, Ole 1719
Wrigley, Richard 154
Wnsche, Raimund 280
Wrttemberg, Herzogtum 242
Xenokles 158
Yarrington, Alison 72
Ypsilantis, Alexandros XIII, 121, 172
Zachariades, Georg Elias 23
Zelter, Karl Friedrich 86
368 Sachregister
Abstraktion 66, 74, 109f, 254
Alitteration 253
Altar 104, 186, 209, 255
Alterisierungstechniken XX, 254f.
Anadioplose 253
Anatoliko 242
Antagonismus Trken/Griechen XIX,
XXI, XXIII, 179, 181, 186, 194, 201,
204, 229, 239, 241, 265267, 272,
281f., 283, 288, 338, 344
Antichrist 254
Antike XI-XIII, XVI-XVIII, XXI,
3118, 120f, 127, 130, 135, 140142,
164, 171, 186188, 227229, 231,
237, 238f., 240, 275, 280282, 285,
288, 300, 304, 306f., 314, 321,
338f., 348f.
Antiken-Utopie 80f.
Appell, Appellationscharakter XVIII,
XXI, 135, 144, 146, 149152, 163, 174,
204, 247, 288, 291, 339, 342
Archologie XVI, 335, 88, 110
Architektur, Architekturtheorie XVII,
4, 19, 23, 34, 62, 66, 68, 69f., 72, 75,
80, 8698, 107f.
sthetisierung XX, 256
thiopien 9
Aufklrer, Aufklrung 22, 26, 46, 101,
120, 141, 153, 159, 162, 268, 323
Augsburger Allgemeine Zeitung 242, 256,
290
Authentizitt XIX, 165, 216f., 243, 247,
248, 262f, 310
Autorschaft 25, 52, 158, 187, 188f.,
191194, 196
Balkan 160, 246
Ballade 10, 235, 246, 250252, 314,
317
Bnkelsnge 252
Barbarei XIX, 70, 140, 179, 181, 193, 195,
270
Barock 1420, 87
Befreiungskampf, griechischer 123, 137,
171, 175, 185, 192f., 194, 196, 256,
276, 278, 288, 289, 290, 300, 319
Befreiungskampf, spanischer gegen
Napoleon 286
Befreiungskriege, deutsche 85, 195, 284,
292
Beglaubigungsstrategien 243
Berliner Conversations-Blatt fr Poesie,
Literatur und Kritik, Zeitschrift 230,
243, 256
Bibel 12
Bild der Familie, Familienstruktur,
-darstellung, -konzept 133170,
135, 153, 159161
Bildungsideal, klassisches XVII, 54, 50,
95f., 238, 240, 339, 350
Bildungsbrgertum 235
Brandner 250, 251, 255
Buchmarkt 260
Brgertum 153, 163, 235f.
Chios 133, 137, 138 Abb., 156, 158f.,
236, 249253
Christen, Christentum X-XII, 12, 140,
142, 180, 186, 189f., 251, 254, 287f.,
318
Conversations-Blatt fr Poesie, Literatur
und Kritik, Zeitschrift 230, 243, 256
Dnemark 12, 17
Dankesschuld, Argument der 122, 240,
277, 282
Darstellungsmittel, gattungsad-
quate 63
Sachregister
Sachregister 369
Degeneration, Verfall 66, 70, 73, 230,
267, 268, 347
Desillusion 221
Deutschland XIII-XVI, XXIf., 9, 17, 21,
32, 61f., 71, 80, 102, 119122, 126f.,
172, 192, 235, 238, 262, 285f., 289,
302, 320, 329, 331, 335, 340, 349
Dichtung, philhellenische XX, 172,
236, 239f., 244, 249, 252f., 255f.,
276
Dreiigjhriger Krieg 149
Einheit, nationale 120, 148
Emblem 14f.
Emotionalisierung 241, 243, 255
England f Grobritannien
Englnder 22, 49, 119f., 172, 182f.
Epigraphik 13, 26
Epiphanie 99, 107, 112
Epos, homerisches 238
Erotik, Homoerotik 228
Erzhlebenen 101, 243
Exotik 212, 227, 240
Farbrekonstruktion 61f., 69, 80
Fiktionalisierungsstrategien in phil-
hellenischer Literatur 237, 243
Formideal XVII, 64, 67, 80, 85
Frankreich XIIXV, XXIf., 27, 33, 135,
137, 153, 163, 173, 176, 180, 208f.,
237, 251f., 284, 321, 325, 331, 333,
336, 349
Franzsisch XIII, XVI, XVIII, XXIII,
26, 119f., 133f., 144, 150, 153ff., 155,
161, 163, 181, 237f., 246, 252, 284f.,
287, 321f., 326, 330f., 333, 337, 344,
349
Franzsische Revolution 120, 153, 154,
161
Freiheit der (alten) Griechen 46, 186,
188
Freiheit, knstlerische 75, 188, 194, 310
Freiheit oder Tod 146, 221
Freiheitskampf, griechischer /
griechischer Traum von der ~ XI,
44f., 119, 121f., 134, 137, 140, 160,
172, 188, 195, 206, 221, 239, 242, 276,
289
~ internat.Untersttzung/
Befrwortung/Darstellung d.
griechischen XII, XVI, 121f., 134f.,
137, 140, 142, 144, 146, 150153, 156,
161f., 164, 178, 187, 195, 236, 239,
277, 292, 346
~ Opfer fr den~ 124, 242
Freiwilligenbegeisterung 119, 126, 128,
130, 195, 225, 302
Gelegenheitsdichtung 236, 277
Gendercodierung XX, 221, 230, 245,
255
Geschichtsverstndnis,
dynamisches 89f., 95
Geschlechterrollen, Rollenvertei-
lung XX, 135, 144, 146, 153, 159, 161,
186, 232, 245
Der Gesellschafter oder Bltter fr Geist
und Herz, Zeitschrift 239, 247, 256
Gewalt, Gewaltexze 66, 124, 126,
149ff., 161, 193, 221f., 253, 255f.,
302, 313, 316
Gips/-abdruck XVII, 71, 102f., 106,
110
Gottesstrafe 255
Gtter, Geist der griechischen 186,
189
Gttliche, das 188, 255, 291, 314
Grausamkeit 121, 181f., 193, 255, 270
Griechenkomitee 248, f Eynard,
Jean Gabriel
Griechenland 23, 26, 3035, 105, 120,
129, 173, 199, 201, 202, 203205, 207,
214, 216f., 240, 261, 264, 267, 276,
332,
~ als Ideal XVII, 50, 57, 86, 125, 238,
281
~ Begriff altes ~/neues ~ 186, 191, 193,
285, 293, 300
~, Bild von ~/ Deutung von ~ IX,
XVI, XX, 39, 51, 125, 194, 240,
253, 263ff., 272, 283, 300, 306, 344,
350
~ Personifikation 21921, 203, 223,
231
Griechentum, falsches 238f., 264,
267, 272, 339
370 Sachregister
Griechentum, franzsisches 238
Griechenvereine, Hilfslieferun-
gen 122f., 126, 151, 175f., 249, 287,
300 f Eynard, Jean Gabriel
Griechische Revolution 119, 121, 144,
171 f Befreiungskampf, griechischer
Griechische vs.rmische Antike 280,
285
Grobritannien XVI, 9, 11, 15, 17, 21,
24, 27, 32f., 62, 163, 182
Guerillakrieg 125, 246
Hadrianswall 23
Heilige Schrift 12
Heimatlosigkeit 237
Heldenlied 243, 302ff.
Hellas-Kult 237f.
Historienbilder 78, 137, 141, 152, 154,
Historienmalerei 78f.
Humanistische Ideale, Wieder-
erweckung 238, 289
Idealismus 110, 238, 279, 281
Identifikationsstrategien/-raum XVIII,
108, 255
Illusionismus 63, 68f., 71
Imagination, literarische XX, 256
Industrielle Revolution 160
Islam XI, XV, XXII, 134, 140, 142, 203,
288, 290
Italien XII, XIV, XVI, 6, 17f, 20, 23, 30,
32, 65, 67, 86, 102, 119, 127, 171184,
223, 266f, 269, 280f., 285, 290, 300
Kalokagatia 243
Kelten 15
Kindheit 137, 159, 162f., 172, 268
Klassik XVII, 183, 264, 300
Klassizismus IX, XVII, 174, 187, 290,
300, 312,
Klima (-zonen, -theorien) 41f., 4547,
49, 128, 188, 265
Kolonialismus, koloniale Phan-
tasien 35, 135, 245
Kosmopolitismus 175, 252, 343
Kreuz 126, 140, 142, 144, 191, 255, 287,
293
Krieg, Dreiigjhriger 149
Krieg, Ikonographie des~ XVIII,
133170
Kriegsdarstellung 137, 148, 151
Kriegsfreiwillige XVIII, 127, 173, 246
Kulturtransfer XV, 252
Kunstkonzept 63, 72, 80f.
Kunstperiode 255
Kunstpoesie 237, 341ff.
Kunstreligion 237
Liedform 238
Lyrik XXf., 173, 195, 221, 224f., 235f.,
240, 242, 246, 249, 252f., 256, 277
Malerei 28, 64, 66, 7376, 7881, 106,
133170
Maria, Ikonographie 241, 248
Marmor XVIIf., 14, 24, 28, 31, 33, 61,
64f., 67f., 72, 99102, 106113, 316
Megalith 4, 11f., 1517, 19f.
Meineid als Motiv 245
Merlin 4
Messolongi/Missolunghi/Misso-
longhi 134, 146f., 152, 158, 204,
206f., 215, 221, 239, 243, 247, 287
Metapher 113, 243, 254
Metonymie 254
Mittelalter 4ff., 13, 19, 104f., 154, 231,
312, 342
Mittwochsgesellschaft, Berliner 237
Moderne IX, XVIf., XX, 17, 39, 64f.,
76f., 79ff., 94, 96, 105, 107, 110, 113,
122, 135, 155, 159, 163, 172, 174, 176,
187, 192, 207, 239, 243, 266, 269, 300,
321, 338, 340, 349
Monolith 91
Monumentalgemlde 254 f Delacroix
Morgenblatt fr gebildete Stnde,
Zeitung 242f., 256, 312
Muster, literarische 256
Nation/Nationalbewutsein/ Nations-
werdung / Nationalstaat XIV, XVI,
35, 40f., 57, 148, 153, 230, 232, 270,
293, 300, 321
Nationalgefhl, nationale Identitt/
Identittsfindung IX, XIV, 39, 57,
153, 237, 270, 293
Sachregister 371
Nationalliteratur vs Weltliteratur XXII,
319ff.
Nationsbegriff 40, 51f., 105, 120, 270
Naturhnlichkeit, Naturnach-
ahmung 63, 6769, 72, 76
Naturpoesie 301, 303, 309, 319, 324,
341
Nationalpoesie 341, 345
Navarino, Seeschlacht von ~ 124, 151,
163, 239
Neubelebung der Antike 228
Nibelungen / ~strophe/ ~ring 172,
246
Nordsternbund 237
Numantia 286
Okzident 120, 134, 271
Ode 41, 178, 238, 303
ffentlich/privat 162, 163
Oper XIII, 255
Operative Literatur 237, 255
Orient, Orientalismus IX, XV,
XIXff., 5, 13, 27, 30f., 134, 154, 193,
200, 204f., 212f., 227, 255, 271, 322
Osmanen f Trken
Palikaren 241
Paradigma des Griechischen 237
Passivitt 137, 230
Perspektivierungstechnik 254
Plastik XVII, 61, 64, 68, 71, 7477, 80,
107, 109
Popularisierung XVII, XX, 256
Pyramiden 4, 11f.
Rajah 244
Reformation 6, 11f.
Reiseliteratur, -beschreibung, -be-
richt XXI, 30, 50, 120, 129, 190, 223,
261, 263, 265, 267f., 270f., 319, 321,
335
Renaissance XI, XVI, 3, 5f., 13, 32, 35,
314
Risorgimento XIV, 178, 180f., 183
Romantik XI, XIII, XVf., 120, 183, 230,
237f., 247, 253, 255, 312, 324, 341
Romantik, franzsische 238
Romantik, schwarze/Schauer- XX, 247
Ruinen, Ruinensentimentalitt 29, 134,
256, 269
Runen 12, 17, 291
Ruland 163, 173
Skularisierung 292
Sakralisierung 242, 248
Sammeln/Sammlung 6, 7, 8f., 22, 26f.,
112, 163, 280, 309, 331
Schundlieder/-literatur 256, 324
Schauerballade 250
Schpfung XIV, 67, 70, 102, 226
Schwertbergabe 241
Sehnsucht, romantische XX, 127, 224,
226, 229, 232, 238, 278, 303
Selbstopfer 239241
Selbstverstndnis, nationales 44f., 50,
205f., 214, 339, 342, 345
Sittlichkeit, sthetische 237
Skandinavien XVI, 9, 12, 15, 17f., 32
Sklaven, Sklaverei, Sklavenhan-
del 188f., 245f., 251f., 269f., 282,
285f., 317
Stonehenge 4, 11, 15
Sturm und Drang 224
Synekdoche 254
Tafelgeschirr XIII, 255
Tektonik XVII, 9195
Tendenzdichtung 236
Tiger 189, 255, 288
Traum 120, 185195, 228, 242,
250253, 272, 282f.
Traum, Alptraum XXI, 251, 267
~ Funktion in der Lyrik Chamissos
250
Trken, Trkenbild XI, XIX, 120126,
130, 133, 135, 137, 139, 151, 158,
173182, 185f., 190, 193, 195f., 201,
241-244, 248, 250-255, 263, 265271,
282, 302, 322
Trkei 23, 31, 182, 190, 262
bersetzung XXII, 12, 174, 244,
246, 252, 279, 299, 301, 303ff.,
308312, 314316, 318322,
325, 329334, 339, 342, 345f.,
348
372 Sachregister
Unabhngigkeit, Traum von der
griechischen ~ 187
Urmensch 10
Urnenfelder 5, 16
Ursprung der Menschheit 9, 10
Vanitas 318
Volkslied 174, 183, 243f., 246, 256,
299304, 306, 318, 329
Volksdichtung/-poesie XXIIf., 246, ~
332, 340
Volkspoesie XXIIf., 246, 332f., 338,
340345, 348f.
Vlkergemeinschaft, internationale/
Solidargemeinschaft, bernationale
XV, 151f., 183, 230
Vorwissen, gattungsspezifisches 247
Wachsfigur 29, 68, 72, 75ff.
Ypsilanti-Walzer XVII, 172
Zeitentrckung 105
Zivilisation 10, 12, 15, 135, 140, 176,
193
Das könnte Ihnen auch gefallen
- (Sammlung Metzler) Peter Hess (Auth.) - Epigramm (1989, J.B. Metzler)Dokument190 Seiten(Sammlung Metzler) Peter Hess (Auth.) - Epigramm (1989, J.B. Metzler)Tamás GortvaNoch keine Bewertungen
- Jan Urbich (Editor), Jörg Zimmer (Editor) - Handbuch Ontologie-J.B. Metzler (2020)Dokument557 SeitenJan Urbich (Editor), Jörg Zimmer (Editor) - Handbuch Ontologie-J.B. Metzler (2020)Karl BäucherNoch keine Bewertungen
- 1-2 (1976, N. Walter) Frag. Jüdisch-Hellenistischer Historiker.Dokument81 Seiten1-2 (1976, N. Walter) Frag. Jüdisch-Hellenistischer Historiker.sevasteNoch keine Bewertungen
- Otto Kaiser - Gott, Mensch Und GeschichteDokument520 SeitenOtto Kaiser - Gott, Mensch Und Geschichtelhi04Noch keine Bewertungen
- Liber de causis. Das Buch von den Ursachen: Zweisprachige AusgabeVon EverandLiber de causis. Das Buch von den Ursachen: Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Das römische Kaiserreich: Aufstieg und Fall einer WeltmachtVon EverandDas römische Kaiserreich: Aufstieg und Fall einer WeltmachtNoch keine Bewertungen
- Apocolocyntosis. Die Verkür...Dokument96 SeitenApocolocyntosis. Die Verkür...Leandro HernánNoch keine Bewertungen
- I - Kommentar (2009) PDFDokument230 SeitenI - Kommentar (2009) PDFCamila Belelli100% (1)
- SkriptDokument215 SeitenSkriptMarie GrünterNoch keine Bewertungen
- Horaz HolzbergDokument241 SeitenHoraz Holzbergyanmaes100% (1)
- GÃ Nther Klaffenbach Griechische Epigraphik 1957Dokument108 SeitenGÃ Nther Klaffenbach Griechische Epigraphik 1957Alin M-escuNoch keine Bewertungen
- Texte Und Untersuchungen Zur Geschichte Der Altchristlichen Literatur. 1883. Volume 8.Dokument1.114 SeitenTexte Und Untersuchungen Zur Geschichte Der Altchristlichen Literatur. 1883. Volume 8.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNoch keine Bewertungen
- Über den Lehrer: De magistro. Zweisprachige AusgabeVon EverandÜber den Lehrer: De magistro. Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Agnostos Theos - NordenDokument436 SeitenAgnostos Theos - NordenChristian Bull100% (2)
- Seele – Geist – Eines: Enneade IV 8, V 4, V 1, V 6 und V 3. Zweisprachige AusgabeVon EverandSeele – Geist – Eines: Enneade IV 8, V 4, V 1, V 6 und V 3. Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Die Homerische Frage Und Das Problem Der Mündlichen Überlieferung Aus Volkskundlicher SichtDokument21 SeitenDie Homerische Frage Und Das Problem Der Mündlichen Überlieferung Aus Volkskundlicher SichtSoundlevigaNoch keine Bewertungen
- Schriften. Band II: Die Schriften 22-29 der chronologischen Reihenfolge (Text und Übersetzung). Zweisprachige AusgabeVon EverandSchriften. Band II: Die Schriften 22-29 der chronologischen Reihenfolge (Text und Übersetzung). Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Die Maschine Mensch: Zweisprachige AusgabeVon EverandDie Maschine Mensch: Zweisprachige AusgabeBewertung: 3.5 von 5 Sternen3.5/5 (18)
- Über die Würde des Menschen: Zweisprachige AusgabeVon EverandÜber die Würde des Menschen: Zweisprachige AusgabeBewertung: 3.5 von 5 Sternen3.5/5 (47)
- Eine Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen von Schönheit und Tugend. Über moralisch Gutes und SchlechtesVon EverandEine Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen von Schönheit und Tugend. Über moralisch Gutes und SchlechtesNoch keine Bewertungen
- Der Einfluss Der Germanischen Sprachen Auf Das VulgärlateinDokument224 SeitenDer Einfluss Der Germanischen Sprachen Auf Das VulgärlateinlugalabandaNoch keine Bewertungen
- M. Bauk-Zur Kulturgeshichte Der Scham.p.1-15Dokument15 SeitenM. Bauk-Zur Kulturgeshichte Der Scham.p.1-15ramajaya100% (1)
- De coniecturis. Mutmaßungen: Zweisprachige Ausgabe (lateinisch-deutsche Parallelausgabe, Heft 17)Von EverandDe coniecturis. Mutmaßungen: Zweisprachige Ausgabe (lateinisch-deutsche Parallelausgabe, Heft 17)Noch keine Bewertungen
- Lachawitz Gunter Einfuhrung in Die Griechische SpracheDokument73 SeitenLachawitz Gunter Einfuhrung in Die Griechische SpracheRand Erscheinung100% (1)
- Logik. Drittes Buch. Vom Erkennen: MethodologieVon EverandLogik. Drittes Buch. Vom Erkennen: MethodologieNoch keine Bewertungen
- Aristoteles - Werk Und Wirkung (Paul Moraux Gewidmet) by Jürgen Wiesner (HG.)Dokument1.380 SeitenAristoteles - Werk Und Wirkung (Paul Moraux Gewidmet) by Jürgen Wiesner (HG.)Serban NicolauNoch keine Bewertungen
- Bruno oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge: Ein GesprächVon EverandBruno oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge: Ein GesprächNoch keine Bewertungen
- Das Dictum Des Simonides: Der Vergleich Von Dichtung Und MalereiDokument34 SeitenDas Dictum Des Simonides: Der Vergleich Von Dichtung Und MalereiMax ElskampNoch keine Bewertungen
- Die Fragmente Der 001 TextDokument515 SeitenDie Fragmente Der 001 TextOsíris Moura100% (1)
- (Laura Gemelli Marciano) Die Vorsokratiker, Band 3 PDFDokument637 Seiten(Laura Gemelli Marciano) Die Vorsokratiker, Band 3 PDFPedropedroagustin100% (2)
- Geist – Ideen – Freiheit: Enneade V 9 und VI 8. Zweisprachige AusgabeVon EverandGeist – Ideen – Freiheit: Enneade V 9 und VI 8. Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Der k.u.k-Soldat bei Arthur Schnitzler: Figurationen fremdbestimmter IdentitätenVon EverandDer k.u.k-Soldat bei Arthur Schnitzler: Figurationen fremdbestimmter IdentitätenNoch keine Bewertungen
- Der Platz des "Platzes": Gestalt- und raumtheoretische Kontextualisierungen zu Hubert Fichtes Roman "Der Platz der Gehenkten"Von EverandDer Platz des "Platzes": Gestalt- und raumtheoretische Kontextualisierungen zu Hubert Fichtes Roman "Der Platz der Gehenkten"Noch keine Bewertungen
- Wouter Goris-Absolute Beginners - Der Mittelalterliche Beitrag Zu Einem Ausgang Vom Unbedingten (Studien Und Texte Zur Geistesgeschichte Des Mittelalters) - Brill Academic Pub (2007)Dokument317 SeitenWouter Goris-Absolute Beginners - Der Mittelalterliche Beitrag Zu Einem Ausgang Vom Unbedingten (Studien Und Texte Zur Geistesgeschichte Des Mittelalters) - Brill Academic Pub (2007)Creomatus DaboschNoch keine Bewertungen
- Die Skythen Beck WissenDokument133 SeitenDie Skythen Beck Wissenstoyanoj67% (3)
- Historische Personen Griechische AntikeDokument154 SeitenHistorische Personen Griechische AntikeRoman Maurer100% (1)
- Kroll, Wilhelm - Catull - Lateinischer Text Mit Deutschsprachigen Anmerkungen-De Gruyter (1989)Dokument330 SeitenKroll, Wilhelm - Catull - Lateinischer Text Mit Deutschsprachigen Anmerkungen-De Gruyter (1989)Petr OzerskyNoch keine Bewertungen
- Klassisches Liederbuch: Griechische Lyriker + Römische Elegien und Oden (Sappho + Solon + Alkman + Anakreon + Alkäos + Virgil + Ovid + Horaz + Stesichoros + Mimnermos + Äschylos und viel mehr)Von EverandKlassisches Liederbuch: Griechische Lyriker + Römische Elegien und Oden (Sappho + Solon + Alkman + Anakreon + Alkäos + Virgil + Ovid + Horaz + Stesichoros + Mimnermos + Äschylos und viel mehr)Noch keine Bewertungen
- Book JAKOBI - Der Einfluss Ovids Auf Den Tragiker Seneca (1988)Dokument246 SeitenBook JAKOBI - Der Einfluss Ovids Auf Den Tragiker Seneca (1988)VelveretNoch keine Bewertungen
- ANRW, 2. Principat Bd. 16 (2. Teilband) - Geschichte Und Kultur Roms Im Spiegel Der Neueren ForschungDokument988 SeitenANRW, 2. Principat Bd. 16 (2. Teilband) - Geschichte Und Kultur Roms Im Spiegel Der Neueren ForschungFilipFilippini100% (4)
- Holzberg - Ovids Metamorphosen Beck Wissen PDFDokument129 SeitenHolzberg - Ovids Metamorphosen Beck Wissen PDFMarcus Annaeus Lucanus100% (2)
- Aufbruch in den Abgrund: Deutsche Science Fiction zwischen Demokratie und DiktaturVon EverandAufbruch in den Abgrund: Deutsche Science Fiction zwischen Demokratie und DiktaturNoch keine Bewertungen
- Einführung in Die Klassische PhilologieDokument243 SeitenEinführung in Die Klassische Philologiepetitepik100% (3)
- De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis: Über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Geisteswelt. Zweisprachige AusgabeVon EverandDe mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis: Über die Form und die Prinzipien der Sinnen- und Geisteswelt. Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Schriften. Band IV: Die Schriften 39-45 der chronologischen Reihenfolge (Anmerkungen). Zweisprachige AusgabeVon EverandSchriften. Band IV: Die Schriften 39-45 der chronologischen Reihenfolge (Anmerkungen). Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Averil Cameron - Das Späte Rom 284 430 N CHRDokument439 SeitenAveril Cameron - Das Späte Rom 284 430 N CHRsoNtyp100% (1)
- Die Griechen: Kultur und Geschichte in archaischer und klassischer ZeitVon EverandDie Griechen: Kultur und Geschichte in archaischer und klassischer ZeitNoch keine Bewertungen
- Euripides Hekabe - Edition Und Kommentar - Matthiessen PDFDokument467 SeitenEuripides Hekabe - Edition Und Kommentar - Matthiessen PDFDiana Alejandra Trujillo Martínez100% (1)
- Physik. Vorlesung über Natur. Zweiter Halbband: Bücher V-VIII. Zweisprachige AusgabeVon EverandPhysik. Vorlesung über Natur. Zweiter Halbband: Bücher V-VIII. Zweisprachige AusgabeBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (2)
- Amazonen Zwischen Griechen Und SkythenDokument353 SeitenAmazonen Zwischen Griechen Und SkythenKurt37100% (1)
- Menschen, die Geschichte schrieben: Die RenaissanceVon EverandMenschen, die Geschichte schrieben: Die RenaissanceNoch keine Bewertungen
- Der Ursprung der Geschichte: Herodot und Thukydides: Historien + Geschichte des peloponnesischen KriegsVon EverandDer Ursprung der Geschichte: Herodot und Thukydides: Historien + Geschichte des peloponnesischen KriegsNoch keine Bewertungen
- Gaiser Platons Ugeschriebene Lehre II PDFDokument100 SeitenGaiser Platons Ugeschriebene Lehre II PDFCiril CohNoch keine Bewertungen
- Was ist ein Original?: Eine Begriffsbestimmung jenseits genieästhetischer StereotypeVon EverandWas ist ein Original?: Eine Begriffsbestimmung jenseits genieästhetischer StereotypeNoch keine Bewertungen
- Zur Bedeutung Des Codex Cusani Fuer Die Ueberlieferung Von Ciceros Rede in PisonemDokument19 SeitenZur Bedeutung Des Codex Cusani Fuer Die Ueberlieferung Von Ciceros Rede in PisonembrysonruNoch keine Bewertungen
- Thomas Alexander SzlezГЎk Das HГ¶hlengleichnis Buch VII 514aвЂ"521b und 539dвЂ"541b 0Dokument24 SeitenThomas Alexander SzlezГЎk Das HГ¶hlengleichnis Buch VII 514aвЂ"521b und 539dвЂ"541b 0brysonruNoch keine Bewertungen
- Zur Auffassung Von Seele Und Geist Bei Platon, Mittelplatonikern, PlotinDokument30 SeitenZur Auffassung Von Seele Und Geist Bei Platon, Mittelplatonikern, PlotinbrysonruNoch keine Bewertungen
- Meerwasserentsalzung Nach AristotelesDokument11 SeitenMeerwasserentsalzung Nach AristotelesbrysonruNoch keine Bewertungen
- Zu Cicero Epist. V 12Dokument3 SeitenZu Cicero Epist. V 12brysonruNoch keine Bewertungen
- Empedokles Physika IDokument99 SeitenEmpedokles Physika Ibrysonru100% (1)
- Die Personenbezeichnungen in Ciceros TusculanenDokument4 SeitenDie Personenbezeichnungen in Ciceros TusculanenbrysonruNoch keine Bewertungen
- HeracliteumDokument4 SeitenHeracliteumbrysonruNoch keine Bewertungen
- Homas Untersuchungen Zur Gestaltung Und Zum Historischen Stoff Der Johannis Coripps Untersuchungen Zur Antiken Literatur Und Geschichte 2008Dokument145 SeitenHomas Untersuchungen Zur Gestaltung Und Zum Historischen Stoff Der Johannis Coripps Untersuchungen Zur Antiken Literatur Und Geschichte 2008brysonruNoch keine Bewertungen
- Philipp BrГјllmann Die Theorie Des Guten in Aristoteles Nikomachischer Ethik 2011Dokument211 SeitenPhilipp BrГјllmann Die Theorie Des Guten in Aristoteles Nikomachischer Ethik 2011brysonruNoch keine Bewertungen
- Zur Bedeutung Des Codex Cusani Fuer Die Ueberlieferung Von Ciceros Rede in PisonemDokument19 SeitenZur Bedeutung Des Codex Cusani Fuer Die Ueberlieferung Von Ciceros Rede in PisonembrysonruNoch keine Bewertungen
- Ntention Des Dichters Und Die Zwecke Der Interpreten Zu Theorie Und Praxis Der Dichterauslegung in Den Platonischen Dialogen Quellen Und StudieDokument345 SeitenNtention Des Dichters Und Die Zwecke Der Interpreten Zu Theorie Und Praxis Der Dichterauslegung in Den Platonischen Dialogen Quellen Und StudiebrysonruNoch keine Bewertungen
- Zu Cicero Epist. V 12Dokument3 SeitenZu Cicero Epist. V 12brysonruNoch keine Bewertungen
- Eberhard Heck, Antonie Wlosok (Trans.) Lactantius Divine InstitutesDokument229 SeitenEberhard Heck, Antonie Wlosok (Trans.) Lactantius Divine Institutesaolimpi8033Noch keine Bewertungen
- Pages From Cicero de Natura Deorum 1.48-9 (Quasi Corpus - )Dokument4 SeitenPages From Cicero de Natura Deorum 1.48-9 (Quasi Corpus - )brysonruNoch keine Bewertungen
- Die Komposition Der Invektive Gegen CiceroDokument21 SeitenDie Komposition Der Invektive Gegen CicerobrysonruNoch keine Bewertungen
- HADRIANS NOYΣDokument15 SeitenHADRIANS NOYΣbrysonruNoch keine Bewertungen
- Gregor Maurach Interpretation Lateinischer Texte. Ein Lehrbuch Zum Selbstunterricht 2007Dokument191 SeitenGregor Maurach Interpretation Lateinischer Texte. Ein Lehrbuch Zum Selbstunterricht 2007brysonru100% (3)
- Lukrez Und ThucydidesDokument40 SeitenLukrez Und ThucydidesbrysonruNoch keine Bewertungen
- Ein Unstoischer Beweisgang in Cicero, de Finibus 3,27Dokument5 SeitenEin Unstoischer Beweisgang in Cicero, de Finibus 3,27brysonruNoch keine Bewertungen
- Zur Wegmetaphorik Beim Goldblättchen Aus Hipponion Und Dem ProömiumDokument23 SeitenZur Wegmetaphorik Beim Goldblättchen Aus Hipponion Und Dem ProömiumbrysonruNoch keine Bewertungen
- Epigraphische MiszellenDokument5 SeitenEpigraphische MiszellenbrysonruNoch keine Bewertungen
- Zu Den Neuen Goldblättchen Aus ThessalienDokument3 SeitenZu Den Neuen Goldblättchen Aus ThessalienbrysonruNoch keine Bewertungen
- Wie Sicher Ist Die Datierung Des Archontats Des PhilokratesDokument3 SeitenWie Sicher Ist Die Datierung Des Archontats Des PhilokratesbrysonruNoch keine Bewertungen
- Pages From Cicero de Natura Deorum 1.48-9 (Quasi Corpus - )Dokument4 SeitenPages From Cicero de Natura Deorum 1.48-9 (Quasi Corpus - )brysonruNoch keine Bewertungen
- Amelios Und SosikratesDokument16 SeitenAmelios Und SosikratesbrysonruNoch keine Bewertungen
- I. Einleitung: Tylos Beschäftigten, Obwohl Viele - Wie Zahlreiche Beiläufige AnmerDokument14 SeitenI. Einleitung: Tylos Beschäftigten, Obwohl Viele - Wie Zahlreiche Beiläufige AnmerbrysonruNoch keine Bewertungen
- Herculanensische Lukrez PapyriDokument23 SeitenHerculanensische Lukrez PapyribrysonruNoch keine Bewertungen
- 70) Brunk (2016) Vachinius Luzoensis EB - 111 - 2015 - 005-010 - 02-BrunkDokument6 Seiten70) Brunk (2016) Vachinius Luzoensis EB - 111 - 2015 - 005-010 - 02-BrunkIngo Brunk0% (1)
- ZIS Bremen - Weiterbildungsprogramm 2013Dokument42 SeitenZIS Bremen - Weiterbildungsprogramm 2013Jörn RabeneckNoch keine Bewertungen
- Herbert Marcuse-Repressive ToleranzDokument23 SeitenHerbert Marcuse-Repressive ToleranzhuhurobertNoch keine Bewertungen
- ProtokollDokument2 SeitenProtokollkatonamariNoch keine Bewertungen
- ZahlensytemeDokument7 SeitenZahlensytemeChristian Bartl - bartlweb.netNoch keine Bewertungen