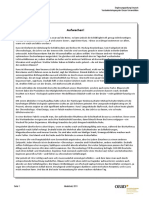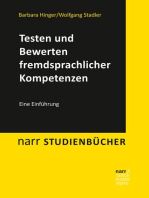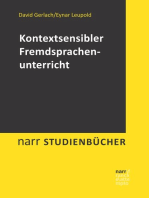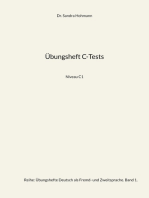Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Infoblatt EPD 7 7 17 PDF
Infoblatt EPD 7 7 17 PDF
Hochgeladen von
A. AlitiOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Infoblatt EPD 7 7 17 PDF
Infoblatt EPD 7 7 17 PDF
Hochgeladen von
A. AlitiCopyright:
Verfügbare Formate
INFORMATIONEN ZUR ERGÄNZUNGSPRÜFUNG AUS DEUTSCH
(gemäß § 63 Abs. 10 u. 11 Universitätsstudiengesetz 2002)
AM VORSTUDIENLEHRGANG DER WIENER UNIVERSITÄTEN (VWU)
1150 Wien, Sechshauser Straße 33A, http://www.vwu.at/
Mit dem Ablegen der vorgeschriebenen Ergänzungsprüfungen erhalten Sie die
Berechtigung, als ordentlicher Studierender/ordentliche Studierende ein Hochschulstudium
aufzunehmen. Ihre Deutschkenntnisse sollen Ihnen helfen, den Einstieg ins Studium
möglichst problemlos und effizient zu gestalten. Die Prüfung besteht aus einem
schriftlichen und einem mündlichen Teil.
Nur wenn Ihre schriftliche Prüfungsarbeit positiv ist, werden Sie zur mündlichen Prüfung
zugelassen. Es werden sechs Prüfungstermine im Jahr angeboten. Man muss sich zur
Prüfung anmelden (Prüfungsgebühr für Deutsch, Englisch und Mathematik je € 50,- und für
alle anderen Fächer je € 35,-). Die Prüfungsordnung ist im VWU-Statut § 6
„Ergänzungsprüfungen“ festgelegt (siehe www.vwu.at > Ergänzungsprüfungen).
Bei der Ergänzungsprüfung aus Deutsch werden folgende Fähigkeiten geprüft:
Bei der schriftlichen Prüfung:
a) Lesen und Verstehen
b) Schreiben
Ein Prüfungsmuster ist im Sekretariat erhältlich.
Bei der mündlichen Prüfung:
c) Hören und Verstehen
d) Sprechen
SCHRIFTLICHE PRÜFUNG:
A) GRAMMATIK: Sie sollen zeigen, dass Sie auch kompliziertere grammatikalische
Strukturen verstehen und diese richtig verändern oder ergänzen können.
B) FREIE STELLUNGNAHME ZU EINEM THEMA: Bei der Prüfung können Sie aus zwei
Themen eines wählen. Zu jedem Thema gibt es ein Zitat, eine Aussage oder Fragen, die
Ihnen helfen sollen, Ihre eigenen Argumente zu diesem Thema zu entwickeln. Sie sollen bei
dieser Aufgabe zeigen, dass Sie selbstständig einen Text verfassen können (auswendig
Gelerntes wird nicht akzeptiert!).
C) LESEVERSTÄNDNIS: Sie bekommen zwei oder drei Texte und verschiedene Typen von
Verstehensaufgaben dazu. Sie sollen zeigen, dass Sie den Inhalt der Texte verstanden
haben.
Die Arbeitszeit für die schriftliche Ergänzungsprüfung aus Deutsch beträgt 180 Minuten. Sie
können ein einsprachiges Wörterbuch (deutsch / deutsch) benutzen. Das Ergebnis der
schriftlichen Prüfung wird ausgehängt. Wenn Ihre Arbeit positiv ist (Note 1 bis 4), finden Sie
Ihren Namen auf einer Liste mit Zeit und Ort (Raumnummer) Ihrer mündlichen Prüfung.
Wenn Ihre Prüfungsarbeit negativ ist (Note 5), können Sie zu einem späteren Termin wieder
VWU, Stand: Juli 2017 1/4
antreten. Insgesamt können Sie die Prüfung viermal wiederholen. Informieren Sie sich bitte
über die Prüfungstermine und über die Anmeldezeiten.
MÜNDLICHE PRÜFUNG:
Sie bekommen zu Beginn der Vorbereitungszeit zwei Aufgaben (z.B. in Zusammenhang mit
einer Graphik, einer Statistik, einem kurzen Lesetext etc.) zu zwei Themenbereichen
vorgelegt. Sie wählen eine der zwei Aufgaben, um darüber eine Kurzpräsentation
vorzubereiten. Sie haben dafür etwa 20 Minuten Zeit. Dabei dürfen Sie ein vom VWU zur
Verfügung gestelltes einsprachiges Wörterbuch verwenden. Sie können sich Notizen
machen (Stichwörter), damit Sie bei der Präsentation, die ca. 5 Minuten dauern sollte, nichts
vergessen. Sie sollen frei sprechen und das Aufgeschriebene nicht vorlesen.
Eine weitere Aufgabe erhalten Sie erst im Anschluss an Ihre Präsentation, d.h. während der
Prüfung. Es handelt sich um einen Impuls (z.B. ein Bild, eine Schlagzeile, ein Zitat etc.), über
den Sie spontan mit der/dem Prüfenden ein etwa 5-minütiges Gespräch führen sollen.
Die Prüfungskommission besteht aus drei Personen: Ihrer Prüferin/Ihrem Prüfer, einer
weiteren Lehrerin/einem weiteren Lehrer des VWU und einer Vertreterin/einem Vertreter der
Universität.
Worüber wird bei den Prüfungen gesprochen und geschrieben (über welche
THEMEN)?
Es sind allgemeine Themen (siehe Themenliste). In den meisten Lehrbüchern finden Sie zu
den Themen Texte, Vokabeln und die nötige Grammatik.
Die Themen können sich überschneiden, das heißt, wenn man über das Thema „Verkehr“
spricht, hat das zum Beispiel auch mit Umwelt, Stadt – Land, mit Energiefragen etc. zu tun.
Konsumgesellschaft kann mit Ernährung, mit Werbung, dem Abfallproblem usw.
zusammenhängen.
Als Vorbereitung (zusätzlich zum Kursbesuch) können Sie Zeitungsartikel lesen, Sendungen
im Fernsehen ansehen, Programme und Nachrichten im Rundfunk hören und mit Personen
sprechen, die selbst die deutsche Sprache gut beherrschen. Auf keinem dieser Gebiete
(Themen) müssen Sie Experte / Expertin sein! Nicht Ihr Wissen, sondern Ihre
Deutschkenntnisse werden geprüft!
Was genügt nicht?
• Wenn Sie mit wenigen Vokabeln nur kurze, fehlerhafte Sätze bilden können.
• Wenn Sie auswendig gelernte Sätze oder Texte nur mechanisch (Wort für Wort) sprechen
oder schreiben können.
Was sollen Sie bei der Prüfung zeigen?
• Dass Sie Gelerntes sinnvoll so verwenden, wie es eine Aufgabe oder die Situation im
Gespräch verlangt.
• Dass Sie die Fragen und Gesprächsbeiträge der Prüfer / der Prüferinnen (Vorsitzenden)
verstehen und darauf reagieren können.
• Dass Sie klarmachen können,
dass Sie etwas nicht verstanden haben,
dass Sie eine andere Meinung als die Prüfenden vertreten,
dass Sie zu einem Thema keinen Bezug (kein besonderes Wissen) haben.
VWU, Stand: Juli 2017 2/4
• Dass Sie mit Hilfe der Prüfenden Ihre sprachlichen Fehler verbessern können.
• Dass Sie die erforderlichen Sprachmittel gelernt haben und damit arbeiten können.
• Dass man ohne Mühe und Missverständnisse versteht, was Sie sagen wollen.
Was ist nicht notwendig?
Dass Sie perfekt oder fehlerfrei sprechen bzw. schreiben. Je besser Ihre Kenntnisse sind,
umso besser wird Ihre Note sein. 1 („Sehr gut“) ist die beste Note und 5 („Nicht genügend“)
heißt, dass Ihre Leistung negativ ist. Die Note 4 („Genügend“) zeigt, dass Ihre Leistung
schwach, aber doch noch positiv ist.
Zur Vorbereitung überlegen Sie zu jedem Thema folgende Punkte:
• Ob Sie die eigene Meinung darstellen und begründen können
• Ob Sie über mögliche Probleme, ihre Ursachen / Folgen sprechen können
• Ob Sie über mögliche Vorteile und Nachteile bzw. Pro- und. Kontra-Argumente sprechen
können
• Ob Sie die Situation in Ihrer Heimat / in Österreich oder in anderen europäischen Ländern
beschreiben oder vergleichen können.
Themenliste für die Ergänzungsprüfung (schriftlich und mündlich):
Die folgenden Leitpunkte zu den Themen sind nur Impulse für Ihre Vorbereitung.
Arbeitswelt und Wirtschaft: Arbeitsbedingungen, Veränderung der Arbeitswelt (z.B. neue
Technologien, Flexibilisierung, globalisierter Arbeitsmarkt), Arbeitslosigkeit, Berufsbilder
Tourismus − Reisen: Verschiedene Arten des Reisens, Vor- und Nachteile des
Massentourismus (Wirtschaft, Umwelt, Verkehr, Infrastruktur), alternative Formen des
Reisens
Verschiedene Kulturen und Wertvorstellungen: Herkunftskultur und Traditionen in der
Heimat, Vergleich mit österreichischer Kultur und anderen Kulturen, Vorurteile, Toleranz,
multikulturelle Gesellschaft
Lernen − Bildung: Ausbildung, Schulsysteme im Vergleich, Weiterbildung, Sprachen lernen,
Lern- und Studiertechniken
Studium: Voraussetzungen, Studieren in der Heimat – im Ausland, Finanzierung des
Studiums, Gründe für Studienwahl, Arbeitschancen für AkademikerInnen
Globalisierung: Chancen und Gefahren (Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Mobilität, Information,
Umwelt), Verlierer und Gewinner, Nord-Süd Thematik, Alternative Wirtschaftsmodelle (Fair-
Trade, Mikrokredite), Menschenrechte
Gesellschaft und soziales Engagement: sprachliche − religiöse − ethnische Minderheiten,
MigrantInnen, soziale Benachteiligung, soziale Randgruppen, Engagement z.B. ehrenamtliche
Tätigkeit
Zwischenmenschliche Beziehungen: Formen des Zusammenlebens innerhalb und
außerhalb der Familie (Klein-, Großfamilie, Lebensgemeinschaft, Single), Freundschaft,
Kollegialität
Gleichberechtigung von Mann und Frau: Ausbildung, Beruf, Haushalt (Rollenbilder);
Situation in Österreich / in der Heimat / in den Industrieländern, Stadt − Land − Gegensatz
VWU, Stand: Juli 2017 3/4
Generationen: Jugend − Alter (staatliche / private Versorgung, Familienbeziehungen,
Generationskonflikt)
Wohnen: Wohnformen, Wohnungsmarkt, Wohnqualität, Infrastruktur (in der Stadt / auf dem
Land)
Gesundheit − Krankheit: Gesundes Leben (Ernährung, Sport und Bewegung),
medizinische Versorgung, Zivilisationskrankheiten, Gentechnik
Abhängigkeiten: Formen von Suchtverhalten (z.B. Drogen, Rauchen, Internetsucht),
Ursachen und Folgen, mögliche Hilfe für Abhängige, Verhalten der Gesellschaft
Ernährung: Ernährungsgewohnheiten, gesunde/ungesunde Ernährung, Überfluss und
Mangel an Nahrungsmitteln
Konsumgesellschaft: Einkaufsverhalten, Konsum und Freizeit, Liberalisierung der
Öffnungszeiten im Handel, Einkaufen über Internet, Rolle der Werbung
Medien: Computer, Internet, Mobiltelefon – (Soziale Netzwerke), Fernsehen, Radio,
Printmedien; öffentliche und private Medien, Aufgaben, Funktion (z. B. Freizeitgestaltung),
Inhalte/Programme, Einflüsse auf die Gesellschaft
Verkehr: Öffentlicher Verkehr − Individualverkehr, Verkehrsprobleme und alternative
Lösungsmöglichkeiten, Umweltbelastung, Verkehrsplanung
Umwelt: Belastung durch Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, private Haushalte, Müll und
Entsorgung, alternative Energieformen, Klimaveränderung, Umweltengagement
VWU, Stand: Juli 2017 4/4
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Epd Test 2Dokument9 SeitenEpd Test 2Ogie Jargal100% (9)
- Modell EPD PDFDokument18 SeitenModell EPD PDFBuyanjargal Batsukh100% (2)
- Übungen Für Die EPD - Umformungen Und SatzfortsetzungenDokument3 SeitenÜbungen Für Die EPD - Umformungen Und SatzfortsetzungenYamen Ayedi100% (2)
- EPD (Erganzung Prufung Deutsch)Dokument11 SeitenEPD (Erganzung Prufung Deutsch)Karim Saleh86% (7)
- EPM Exam VWU MusterDokument3 SeitenEPM Exam VWU Mustertaylin.comNoch keine Bewertungen
- Modell EPDDokument18 SeitenModell EPDMara Lugonjic17% (6)
- Grammatik Nominalisierung 1Dokument3 SeitenGrammatik Nominalisierung 1Camilo PachecoNoch keine Bewertungen
- EPD Übungssatz 05 COMMUNITY MANAGER - RICHTIG KONZENTRIERENDokument11 SeitenEPD Übungssatz 05 COMMUNITY MANAGER - RICHTIG KONZENTRIERENDanijel RajicNoch keine Bewertungen
- Erpd 3.Dokument9 SeitenErpd 3.Ogie Jargal100% (4)
- EPD Modell September 2020Dokument23 SeitenEPD Modell September 2020Ewald100% (7)
- Epd PDFDokument22 SeitenEpd PDFMaria ValishinaNoch keine Bewertungen
- EPD Beispiel GrazDokument9 SeitenEPD Beispiel Grazfrancisconicolas17Noch keine Bewertungen
- EPD UebungenDokument6 SeitenEPD UebungenTökmindegy MitírokNoch keine Bewertungen
- dEPD Modell Mai 2020Dokument8 SeitendEPD Modell Mai 2020Zahra Najafi50% (2)
- 11 07 2022 13 08 50 591855 AvbpDokument4 Seiten11 07 2022 13 08 50 591855 AvbpKirillNoch keine Bewertungen
- EPD от УрсулыDokument11 SeitenEPD от УрсулыKirill KrupenkovNoch keine Bewertungen
- DSH Muster 2Dokument26 SeitenDSH Muster 2Oksana KovalNoch keine Bewertungen
- EPD Informationen Homepage 2016Dokument1 SeiteEPD Informationen Homepage 2016Soufiane El BrahimiNoch keine Bewertungen
- Epd Vgu 2011 Modellsatz HomepageDokument9 SeitenEpd Vgu 2011 Modellsatz Homepagewish_iNoch keine Bewertungen
- EPD ModellsatzDokument11 SeitenEPD ModellsatzKarim Saleh100% (2)
- DSH Beispiel Leseverstehen Grammatik Loesungen PDFDokument9 SeitenDSH Beispiel Leseverstehen Grammatik Loesungen PDFbehnamatgNoch keine Bewertungen
- NominalisierungDokument1 SeiteNominalisierungDocuy Archivos100% (2)
- Ösd c1Dokument6 SeitenÖsd c1maraya208100% (3)
- Nominalisierung ÜbungenDokument2 SeitenNominalisierung ÜbungenbuhlteufelNoch keine Bewertungen
- DSH Beispiel TP TextDokument1 SeiteDSH Beispiel TP TextEduardo LimaNoch keine Bewertungen
- Integration durch Integrationskurse? Eine Verlaufsstudie bei iranischen Migrantinnen und MigrantenVon EverandIntegration durch Integrationskurse? Eine Verlaufsstudie bei iranischen Migrantinnen und MigrantenNoch keine Bewertungen
- Testen und Bewerten fremdsprachlicher Kompetenzen: Eine EinführungVon EverandTesten und Bewerten fremdsprachlicher Kompetenzen: Eine EinführungBewertung: 1 von 5 Sternen1/5 (1)
- Scaffolding im Fremdsprachenunterricht: Unterrichtseinheiten Englisch für authentisches LernenVon EverandScaffolding im Fremdsprachenunterricht: Unterrichtseinheiten Englisch für authentisches LernenNoch keine Bewertungen
- Epd TemeDokument1 SeiteEpd TemeAdrijanaMarinkovicNoch keine Bewertungen
- EPD от УрсулыDokument11 SeitenEPD от УрсулыKirill KrupenkovNoch keine Bewertungen
- EPD VGUH Modellsatz NEU Freunde Vom Sueden LernenDokument11 SeitenEPD VGUH Modellsatz NEU Freunde Vom Sueden LernenMiruna MironNoch keine Bewertungen
- Fernsehen: InternetDokument3 SeitenFernsehen: InternetSheidaHaNoch keine Bewertungen
- EPD Modellsatz Schluessel Homepage Adaption 2012Dokument1 SeiteEPD Modellsatz Schluessel Homepage Adaption 2012kurniati084Noch keine Bewertungen
- Epd 1 PDFDokument11 SeitenEpd 1 PDFmirzacamic100% (2)
- Der Offene BriefDokument3 SeitenDer Offene BriefIvana KnezevicNoch keine Bewertungen
- EPD VGUH Modellsatz NEU Freunde Vom Sueden Lernen UEA Feb 2020 2Dokument11 SeitenEPD VGUH Modellsatz NEU Freunde Vom Sueden Lernen UEA Feb 2020 2Kirill KrupenkovNoch keine Bewertungen
- Ergebnis OSA PDFDokument18 SeitenErgebnis OSA PDFJakob WeberNoch keine Bewertungen
- Leseverstehen TextDokument5 SeitenLeseverstehen Textஅந்தோணி சாமிNoch keine Bewertungen
- Nominalisierung Und VerbalisierungDokument7 SeitenNominalisierung Und VerbalisierungJuan Camilo Gómez67% (3)
- Grammatik Indirekte Fragesätze EVDokument4 SeitenGrammatik Indirekte Fragesätze EVAlise GreyNoch keine Bewertungen
- EPD Informationen Homepage UEA Feb. 2020 2Dokument1 SeiteEPD Informationen Homepage UEA Feb. 2020 2Sima RezaNoch keine Bewertungen
- Probeprüfung An 1.zwischentestDokument7 SeitenProbeprüfung An 1.zwischentestOleg Pavlushenko100% (1)
- B Grammatik ÜbungsgrammsDokument2 SeitenB Grammatik ÜbungsgrammsFirasNajarNoch keine Bewertungen
- Textproduktion Mobile Games 2017-2018 PDFDokument4 SeitenTextproduktion Mobile Games 2017-2018 PDFMarwen BoNoch keine Bewertungen
- VWU Angebot Mit Ueberschrift Und Erlaeuterungen Dez2016Dokument1 SeiteVWU Angebot Mit Ueberschrift Und Erlaeuterungen Dez2016Goran KosticNoch keine Bewertungen
- DaF C1 Nominalisierung Und Verbalisierung Uebung 1Dokument2 SeitenDaF C1 Nominalisierung Und Verbalisierung Uebung 1Vân Anh Nguyễn CửuNoch keine Bewertungen
- A2 Kauf Nix Tag 2Dokument3 SeitenA2 Kauf Nix Tag 2Danijel RajicNoch keine Bewertungen
- DSH 04 Uni DortmundDokument10 SeitenDSH 04 Uni DortmunddominikusradityaNoch keine Bewertungen
- DSHDokument13 SeitenDSHstuarnt100% (3)
- C1 OberstufeDokument21 SeitenC1 OberstufeKevin DENoch keine Bewertungen
- Modelltest PDFDokument8 SeitenModelltest PDFfajkovic_raskaNoch keine Bewertungen
- Zur Standardisierung der DSH-Prüfungen: Bestandsaufnahme und Perspektiven des Online-AngebotesVon EverandZur Standardisierung der DSH-Prüfungen: Bestandsaufnahme und Perspektiven des Online-AngebotesNoch keine Bewertungen
- Mut zur Lücke: Was jede/r von uns tun kann, damit die Flucht ein gutes Ende nimmtVon EverandMut zur Lücke: Was jede/r von uns tun kann, damit die Flucht ein gutes Ende nimmtNoch keine Bewertungen
- Die 35 häufigsten Fehler im Deutschen: Wie man sie vermeidetVon EverandDie 35 häufigsten Fehler im Deutschen: Wie man sie vermeidetNoch keine Bewertungen
- Förderung Der SchreibkompetenzDokument18 SeitenFörderung Der SchreibkompetenzTrần Diễm Ngọc HuyềnNoch keine Bewertungen
- Mündliche Prüfung Deutsch C1 Hochschule und C1 * Mit Schablonen Lernen: Sowie 60 Themen für die Präsentation und 90 Zitaten übersetzt ins Englische, Türkische, Persische, Ukrainische und RussischeVon EverandMündliche Prüfung Deutsch C1 Hochschule und C1 * Mit Schablonen Lernen: Sowie 60 Themen für die Präsentation und 90 Zitaten übersetzt ins Englische, Türkische, Persische, Ukrainische und RussischeNoch keine Bewertungen
- Herbert Blumer Und Die Chicagoer SchuleDokument18 SeitenHerbert Blumer Und Die Chicagoer SchuleSebastian ThielkeNoch keine Bewertungen
- Anlage 145 Vorschulze VerWG 20161213Dokument33 SeitenAnlage 145 Vorschulze VerWG 20161213Mac OBarroidNoch keine Bewertungen
- Konjugation PDFDokument39 SeitenKonjugation PDFMazidur RahmanNoch keine Bewertungen
- PR SituatedBody ProgrammDokument15 SeitenPR SituatedBody ProgrammnighbNoch keine Bewertungen
- Schule ST D B1 UBDokument2 SeitenSchule ST D B1 UBОлінька СтецюкNoch keine Bewertungen