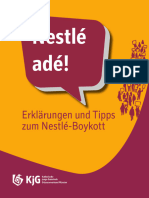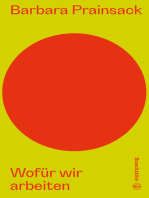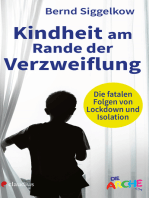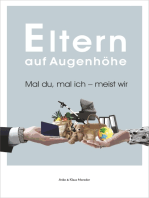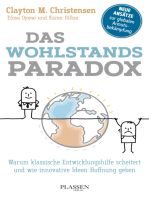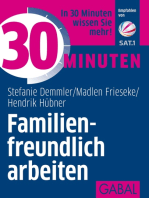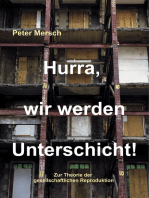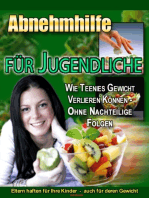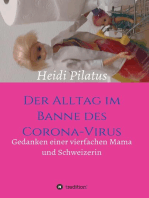Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Seminararbeit Unterpunkt Ausformuliert Trabajo Infantil en La Agricultura
Hochgeladen von
Manuel Schöpfer0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
90 Ansichten5 Seitenespanol
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
DOCX, PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenespanol
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als DOCX, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
90 Ansichten5 SeitenSeminararbeit Unterpunkt Ausformuliert Trabajo Infantil en La Agricultura
Hochgeladen von
Manuel Schöpferespanol
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als DOCX, PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 5
3.
Sectores y areas de trabajo
3.1. Trabajo infantil en la agricultura
El Salvador, Guatemala und Nicaragua sind drei der Länder in Lateinamerika, in denen
Kinderarbeit in der Landwirtschaft an der Tagesordnung ist und allgemein akzeptiert ist.
Haupterwerbszweig der meisten Kinder in diesen beiden Ländern ist die Arbeit auf den
dortigen Zuckerrohrplantagen, woraus vor allem Bioethanol als Ausgangsstoff für
Biokraftstoffe gewonnen wird, um als ‚sauberere‘ Alternative für das stetig schneller zur
Neige gehende Erdöl zu dienen. Viele Kinder arbeiten schon im zarten Alter von
beispielsweise zwölf Jahren bereits seit mehreren Jahren dort, da sie oftmals mit zum
Unterhalt der Familie beitragen müssen. Häufig sieht die familiäre Situation so aus, dass die
Mutter alleinerziehend ist und der Vater die Familie schon vor Jahren verlassen hat. Somit
sind diese Familien auf sich gestellt und die Mutter muss die ganze Familie versorgen. Die
Arbeit der Mutter reicht jedoch in vielen Fällen nicht aus, um das finanzielle Überleben der
Familie zu gewährleisten. Somit sind die Kinder gezwungen zu arbeiten oder tun es häufig
auch einfach freiwillig, da die Kinder in Lateinamerika schon sehr früh zu viel
Selbstständigkeit mit einem hohen Maß an Autonomie erzogen werden.
Viele Eltern würden ihre Kinder gerne in die Schule schicken, um ihnen eine gute Bildung und
dadurch später einmal eine gute Arbeit zu ermöglichen. Auf der anderen Seite ist dies aber
in vielen Fällen nicht möglich, da die Eltern auch sehen, dass wenn die Kinder keinen Beitrag
zum Haushaltseinkommen leisten, sie sich weder Kleidung noch Essen kaufen können. Somit
sind die Kinder gezwungen unter oftmals harten, sowie gesundheitsschädlichen
Bedingungen zu arbeiten. Die Plantagenbesitzer beuten diese dann auch in den meisten
Fällen aus und zahlen ihnen verhältnismäßig extrem niedrige Löhne, die nicht einmal
ansatzweise ausreichen, um eine Familie zu ernähren. Die Kinder leiden oftmals aus den
schweren Arbeitsbedingungen resultierend unter gesundheitlichen Problemen, werden
jedoch trotzdem gezwungen ohne Pause weiter zu arbeiten. Beispielsweise werden auf den
Plantagen kurz vor dem Schlagen der Zuckerrohre die Felder abgefackelt, um die Asche als
Dünger zu benutzen, welcher die Ernte extrem beschleunigt. Diese Asche atmen die Kinder
dann jedoch ein, was zu vielfältigen gesundheitlichen Folgeschäden bei einem Kind führen
kann. Aus diesem Grund wird diese Arbeit auch von der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) als gefährlich eingestuft, da darüber hinaus auch noch Macheten zum Einsatz kommen,
mit welchen sich die Kinder schwerwiegende Verletzungen zuziehen können. Werden die
Plantagenbesitzer dann von offizieller Seite gefragt, ob sie Kinderarbeiter beschäftigen,
leugnen sie dies, da dies nicht gut für ihren Ruf oder ihre Reputation wäre, falls dies an die
Öffentlichkeit gelangen würde.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HWRS) sorgte für eine groß
angelegte Debatte und einer ersten ernsthaften Auseinandersetzung der Weltöffentlichkeit
mit der Situation der Kinder in El Salvador, als sie 2004 den 139-seitigen Bericht “Turning a
Blind Eye: Hazardous Child Labor in El Salvador’s Sugarcane Cultivation” veröffentlichte,
demzufolge salvadorianische Zuckerrohrplantagenbesitzer die Kinder auf ihren Plantagen
ausbeuten würden. Ein ehemaliger Arbeitsinspektor von Human Rights Watch erklärte die
Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen zur „gefährlichsten aller landwirtschaftlichen
Tätigkeiten“. Als Reaktion darauf drohte beispielsweise Kanada, der zweitgrößte Importeur
von Zuckerrohr weltweit, seine Zuckerrohrimporte aus dem kleinen lateinamerikanischen
Land komplett einzustellen, sofern nicht die Arbeitsbedingungen der Kinder auf den
Plantagen massiv verbessert werden würden. Dies und der wachsende öffentliche Druck auf
die salvadorianische Regierung führte schließlich dazu, dass der Vorsitzende des
Zuckerverbandes von El Salvador (AAES), Julio César Arroyo, öffentlich dazu Stellung bezog
und sagte, man „fürchte einen Dominoeffekt und den Verlust der für die Bauern so dringend
benötigten Einnahmen“. Sowas hätte der Wirtschaft des kleinen Staates, die ohnehin seit
Jahren durch Misswirtschaft und Korruption geprägt ist, einen zusätzlichen Schlag verpasst
und sie noch tiefer in die ‚Abwärtsspirale‘ getrieben. Um dies zu verhindern beschloss der
salvadorianische Rat der Zucker-Agroindustrie, indem die Regierung, die
Zuckerrohrproduzenten und die Zuckerrohrpflanzer zusammengeschlossen sind, eine Klausel
in das Gesetz einzuführen, welche Kinderarbeit ächtet. Dies und weitere Maßnahmen haben
dazu geführt, dass die Zahl der Kinderarbeiter in El Salvador seither kontinuierlich gesunken
ist. Dies bestätigt auch eine Umfrage aus dem Jahr 2013, wonach die Zahl der Kinderarbeiter
um 11,9% im Vergleich zum Vorjahr gesunken sei. Dieser positive Trend ist jedoch leider
nicht in jedem lateinamerikanischen Land zu verzeichnen, womit El Salvador in dieser Region
somit ehr eine Ausnahmeerscheinung bleibt.
Ein weiterer Bereich, indem viele Kinder in Lateinamerika und vor allem auch in Guatemala
beschäftigt sind, ist die Kaffeeernte. Über 30 Prozent der Kaffeeernte in Guatemala wird
durch die Hände von Kindern gewonnen. Oftmals sind dies Kinder von Tagelöhnern und auch
die Eltern sind gezwungen auf den Kaffeeplantagen zu arbeiten. Jedoch können sich diese
Familien nicht einmal die Grundversorgung an Lebensmitteln leisten, wodurch auch die
Kinder zum Einkommen beitragen müssen. Auch der Diplom-Soziologe Andreas Boueke, der
jeweils 6 Monate eines Jahres in Deutschland und die anderen 6 Monate in Guatemala lebt,
beobachtet die Situation der dortigen Kinderarbeiter seit Jahren mit großer Besorgnis und
setzt sich für deren Rechte ein. Als exemplarisches Beispiel für die schlimme Situation der
Kinder auf den Kaffeeplantagen in Guatemala stellt er uns in einem Artikel der
Mitteldeutschen Kirchenzeitung das Schicksal des achtjährigen Miguel vor, der auf der Finca
San Jaime im Osten des kleinen mittelamerikanischen Landes unter der Aufsicht des
Plantagenbesitzers Don Bonifaz täglich viele Stunden, ohne dass auf ihn Rücksicht
genommen würde, in der tropischen Hitze arbeiten muss. Selbst wenn die Eltern und ihre
Kinder im Akkord arbeiten, verdienen sie auch unter optimalen Erntebedingungen nicht
genügend Geld, um sich genug Nahrung leisten zu können. Aus diesem Grund müssen Eltern
und ihre Kinder hungern und ihnen wird vom Plantagenbesitzer nicht einmal der in
Guatemala gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn gezahlt. Jedoch liefern genau diese
Plantagen häufig auch an große, nahmhafte westliche Kaffeeproduzenten, wie
beispielsweise Nespresso. In einer Kooperation des Fernsehsenders ARD mit 3Sat entstand
die Dokumentation ‚Kinderschinder- Der Preis für eine Tasse Kaffee‘, in der die Journalisten
eine Kaffeeplantage besuchen, die an einen großen deutschen Kaffeeproduzenten liefert. Sie
werden von ihrem Besitzer dazu eingeladen, die Kaffeebauern bei ihrer täglichen Arbeit zu
filmen. Während ihrer Fahrt über die Kaffeeplantage sehen sie auch immer wieder kleine
Kinder beim Lasten schleppen und Kaffeebohnen pflücken. Darunter befinden sich auch viele
unter 15-jährige Kinder, was laut der Definition der ILO von Kinderarbeit eindeutig als solche
aufzufassen ist. Von Nespresso wird im Nachhinein geleugnet, dass der Plantagenbesitzer an
sie liefern würde, um das Bild der Nachhaltigkeit nicht zu gefährden. Solche Plantagen gibt
es jedoch nicht nur in Guatemala, sondern auch in vielen anderen mittelamerikanischen
Staaten, wie Honduras, Nicaragua oder Panama, sowie auch in der Dominikanischen
Republik und Kolumbien. In all diesen Staaten wird durch die Hände von Kindern unser
Kaffee erzeugt, den wir tagtäglich trinken. Eine Tasse Kaffee kostet bei uns nicht einmal 5
Cent und für Kaffees in Spitzenqualität wie beispielsweise die ‚Grand Crus‘ von Nespresso
sind es nicht einmal 30 Cent pro Tasse. Bei diesen Preisen ist es auch nicht weiter
verwunderlich, wenn den Kindern und ihren Eltern wie bereits oben angesprochen nicht
einmal genügend Geld für die tägliche Grundnahrungsmittelversorgung bleibt. Vor allem in
diesen Ländern wird immer wieder von der Regierung geleugnet, dass es überhaupt
Kinderarbeit gibt oder sie ist bereits offiziell durch ein Gesetz verboten. Dies ist
beispielsweise in Nicaragua seit 2002 der Fall, jedoch sind laut Schätzungen der US-
amerikanischen Kaffeekampagne nach wie vor mehr als 250.000 Kinder auf den
Kaffeeplantagen Nicaraguas beschäftigt. Das US-Arbeitsministerium kritisiert schon seit
langem die Arbeitsbedingungen der Kinder in all diesen Ländern. Jedoch tragen die USA, wie
auch alle anderen Staaten der westlichen Hemisphäre eine Mitverantwortung und auch
jeder von uns, die Arbeitsbedingungen der Kinder in diesen Ländern zu verbessern.
Ebenso hart und ausbeuterisch ist die Arbeit vieler Kinder auf den Baumwollplantagen. Zu
den Hauptanbauländern gehören Indien, China, die Vereinigten Staaten und in
Lateinamerika vor allem die Staaten Brasilien und Guatemala. Von den Klamotten, die wir
tagtäglich tragen, werden die meisten aus Baumwolle hergestellt. Global gesehen sind es
nahezu 50 % aller Textilien, die aus Baumwolle hergestellt werden. Einen Nutzen von
Kinderarbeitern auf Baumwollfeldern haben vor allem die Endverbraucher der Textilien. Da
Baumwolle vor allem in Monokulturen angepflanzt wird, ist es vor allem in den
Sommermonaten und dem tropischen Klima in den Anbaugebieten wie Brasilien oder
Guatemala besonders anfällig für Ungeziefer. Aus diesem Grund muss vor allem während
der Haupterntesaison sehr viel Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Auch wurden
Untersuchungen an Klamotten von vielen großen Modegiganten durchgeführt, bei denen
immer wieder zahlreiche Rückstände an gesundheitsschädlichen Stoffen, wie Pestiziden
festgestellt werden. Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben
jährlich weltweit in den Anbauländern von Baumwolle zusammengerechnet über 20.000
Menschen. Vor allem Kinder sind äußerst gefährdet, durch die Pestizide gesundheitliche
Folgeschäden davonzutragen, da der Körper eines Kindes noch nicht vollständig entwickelt
ist und somit anfälliger für Beeinträchtigungen ist als der Körper eines Erwachsenen. Die
Organe von Kindern können die Schadstoffe wesentlich langsamer abbauen als ein
Erwachsener zusätzlich gelangen die Schadstoffe durch die dünnere Haut bei Kindern
schneller in den Organismus. Selbst bei ausreichender Schutzkleidung bei der Arbeit, die in
den wenigsten Fällen vorhanden ist, gelangen Pestizidrückstände durch die Haut in den
Organismus der Kinder und macht sie langfristig gesehen krank. Jedoch wird in diesen
Ländern kaum Rücksicht auf die Arbeitsbedingungen der Kinder gelegt, da der Profit der
Plantagenbesitzer in den meisten Fällen über allem steht. Diese kaufen sich dann Luxusvillen
auf Kosten der Arbeiter, während diese krank werden und oftmals nicht einmal genug Geld
für Nahrung besitzen.
Ein sehr ähnliches Beispiel wie der Baumwollanbau mit seinen verheerenden Folgeschäden
für die Gesundheit der Kinder ist der Tabakanbau in vielen Regionen Lateinamerikas.
Haupanbaugebiet für Tabak in Lateinamerika ist vor allem Brasilien. Während dem Putzen,
Sähen oder Ernten der Tabakblätter nehmen die Kinder bei der Arbeit teilweise bis zu 54
Milligramm Nikotin täglich auf. Das entspricht etwa einem ungefähren Konsum von 50
Zigaretten. Folgen sind Symptome wie Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen oder Brechreiz.
Dies alles sind Symptome der als im Volksmund bekannten ‚grünen Tabakkrankheit‘, einem
Fall akuter Tabakvergiftung. Dies stellt jedoch nicht die einzige Gefahr für die Kinder dar.
Ebenfalls wie bei der Baumwollernte werden auch in der Tabakindustrie jährlich Millionen
Tonnen an Pestiziden eingesetzt. Diese teils erbgutverändernden Substanzen brennen sich
dann bei der Arbeit in die Haut der Kinder ein und haben die oben bereits genannten
verheerenden gesundheitlichen Folgeschäden. Die harmlosesten Symptome dabei sind noch
der beschleunigte Herzschlag oder gelegentlichen Schwindelanfälle der Kinder. Viele andere
Krankheiten resultieren aus der gefährlichen Kombination des aufgenommenen Nikotins und
der Pestizide. Dies sind zum Beispiel diverse Krebsarten, unter der viele ehemalige
Kinderarbeiter dann als Erwachsene als Spätfolgen leiden. Ebenso können sie Lungen- oder
Leberschäden davontragen. Doch die Kinder ertragen trotzdem drückende Hitze, schlechte
Behandlung durch die Aufseher oder nehmen sogar die bereits erwähnten
Gesundheitsschäden in Kauf, da ihnen meist keine andere Wahl bleibt und sie sich sonst
beispielsweise weder Schuhe, Nahrung oder Kleidung leisten könnten. In vielen Fällen sind
die Kinder einfach gezwungen die schlechte ökonomische Situation ihrer Familien
mitzutragen. Viele Mütter wollen nicht einmal, dass ihre Kinder arbeiten müssen und
würden diesen sogar wie bereits oben angesprochen eine gute Schulbildung ermöglichen.
Jedoch ist dies in den meisten Fällen nicht möglich, da es in den Anbauländern, die sich zur
Mehrheit in den Ländern der sogenannten 3.Welt befinden vor allem um das sprichwörtlich
‚nackte Überleben‘ geht es den Familien häufig an den grundlegendsten Dingen mangelt, die
eine normale Existenz ermöglichen würden.
Um dem ganzen Abhilfe zu schaffen und die Situation der Kinder nachhaltig zu verbessern
kann man schon mit kleinen Dingen anfangen. Eines dieser Dinge ist vor allem bei unserem
täglichen Einkauf auf nachhaltig hergestellte Produkte zurückzugreifen, bei denen man auch
nachvollziehen kann, unter welchen Bedingungen sie wo hergestellt wurden. Im Fall von
Kaffee gibt es das allgemein anerkannte Fairtrade-Siegel, dass gewährleistet, dass der Kaffee
nur von Plantagen mit nachhaltigem Anbau bezogen wird, der Kinderarbeit automatisch
ausschließt. Dieser Kaffee ist im Normalfall in allen handelsüblichen Supermärkten zu
erhalten. Ein ähnliches Siegel gibt es auch im Falle der Baumwolle seit 2007 in Deutschland
das Fairtrade Certified Cotton Siegel, das gewährleistet, dass die Klamotten nicht mit
ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt wurden. Im Falle von Tabak rät Fairtrade
Deutschland dazu, gar keinen Tabak zu kaufen, da Tabak „weder aus sozialer, noch
gesundheitlicher oder ökologischer Sicht als ethisch vertretbares Produkt bezeichnet werden
könne und deshalb für Fairtrade grundsätzlich nicht in Frage komme.“ Das wichtigste ist die
Bereitschaft des Verbrauchers offen und aktiv sich zu informieren und auch einmal ein paar
Euro mehr für Produkte auszugeben, wo sich die Importeure bemühen, Kinderarbeit bei der
Herstellung auszuschließen. Was sich überaus schädigend auf die Situation der Kinder dieser
Länder auswirkt, wäre zu beschließen, keine Produkte mehr aus diesen Herkunftsländern zu
kaufen. Dies hat jedoch dann häufig einen gegenteiligen Effekt und verschlechtert die
Situation der Kinder ehr noch, als dass diese Maßnahme des Boykotts weiterhelfen würde.
Verminderte Nachfrage der Konsumenten nach den Produkten führt schließlich bei den
Unternehmen dazu, um Gewinnverluste auszugleichen, größere Mengen des jeweiligen
Produktes zu immer niedrigeren Preisen einzukaufen, was dazu führt, dass auch die Löhne
der Arbeiter sinken. Jedoch sind die Kinder in diesen Ländern darauf angewiesen zu arbeiten,
da sie sonst nicht überleben können. Als Konsequenz daraus ergibt sich dann, dass sie sich
beispielsweise prostituieren und somit noch mehr ausgebeutet werden. Es geht
grundsätzlich nicht darum Kinderarbeit zu verbieten, da dies laut dem Pressesprecher von
UNICEF Deutschland, Rudi Tarnenden, dazu führen würde, dass die Kinder ehr noch „bestraft
würden“, als dass ihnen dadurch geholfen werden würde. Das wichtigste sei vor allem,
„Schutzgesetzte zu schaffen“, sowie „die tiefer liegenden Ursachen, wie Armut,
Unwissenheit oder Diskriminierung zu bekämpfen“. Das wichtigste ist, den Teufelskreis zu
durchbrechen und konstruktive Lösungsansätze zu verfolgen, die das Problem auch
nachhaltig lösen. Dies wird vor allem dadurch geschehen, wenn sich der Verbraucher ein
Bewusstsein dafür schafft und sich bei seinem täglichen Einkauf informiert oder sich
gegebenenfalls sogar direkt an die Unternehmen wendet. Verändert sich das Bewusstsein
der Öffentlichkeit, werden die Unternehmen auch mit der Zeit nachziehen. Als prominentes
Beispiel kann beispielsweise Tchibo genannt werden, das bereits 10 Prozent seines
gesamten Kaffee nachhaltig produzieren lässt. Dies kann als ein erster Erfolg im Kampf gegen
ausbeuterische Kinderarbeit angesehen werden.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Fact-Sheet Die Wertschöpfungskette Von SchokoladeDokument4 SeitenFact-Sheet Die Wertschöpfungskette Von SchokoladeInstitutSuedwindNoch keine Bewertungen
- KinderarbeitDokument1 SeiteKinderarbeitMomi MatiNoch keine Bewertungen
- Fact-Sheet: Die Wertschöpfungskette Von BananenDokument4 SeitenFact-Sheet: Die Wertschöpfungskette Von BananenInstitutSuedwindNoch keine Bewertungen
- 21 0526 Factsheet Allgemein WEB MitlinksDokument2 Seiten21 0526 Factsheet Allgemein WEB MitlinksKatherine KatherineNoch keine Bewertungen
- BFDW GlobalLernen KinderarbeitDokument1 SeiteBFDW GlobalLernen KinderarbeitJohanna WittigNoch keine Bewertungen
- النموذج الثامن ألغماينDokument16 Seitenالنموذج الثامن ألغماينDalw WhatNoch keine Bewertungen
- Wichtige ThemenDokument8 SeitenWichtige Themenqilong xiaNoch keine Bewertungen
- Chancen Fur NeuesDokument2 SeitenChancen Fur NeuesFernando AntezanaNoch keine Bewertungen
- Familie Und BerufDokument1 SeiteFamilie Und BerufGyevnar GergoNoch keine Bewertungen
- 1 - 导言练习+例子 beispielDokument6 Seiten1 - 导言练习+例子 beispielliyansong1999Noch keine Bewertungen
- Gibba Gambke ReligionDokument2 SeitenGibba Gambke ReligiongambketobiasNoch keine Bewertungen
- Familie Und KarriereDokument2 SeitenFamilie Und Karriereivona0mati0Noch keine Bewertungen
- Broschuere Nestle-Ade v2 0Dokument24 SeitenBroschuere Nestle-Ade v2 06xdp7kbrmmNoch keine Bewertungen
- MuttermilchDokument2 SeitenMuttermilchMarei KünickeNoch keine Bewertungen
- OralDokument5 SeitenOralAlba RNoch keine Bewertungen
- Von Der Staude Bis Zum Konsumenten. Die Wertschöpfungskette Von BananenDokument20 SeitenVon Der Staude Bis Zum Konsumenten. Die Wertschöpfungskette Von BananenInstitutSuedwindNoch keine Bewertungen
- NestlèDokument3 SeitenNestlèRadouane ChefaouiNoch keine Bewertungen
- Lesen 01122022Dokument8 SeitenLesen 01122022LoanTitNoch keine Bewertungen
- Das Krumme Ding Mit Der BananeDokument48 SeitenDas Krumme Ding Mit Der BananeInstitutSuedwindNoch keine Bewertungen
- Der Food-Plan: Richtig einkaufen für eine bessere WeltVon EverandDer Food-Plan: Richtig einkaufen für eine bessere WeltNoch keine Bewertungen
- Zu viel für diese Welt: Wege aus der doppelten ÜberbevölkerungVon EverandZu viel für diese Welt: Wege aus der doppelten ÜberbevölkerungNoch keine Bewertungen
- Staatsdiener rauben uns aus: Systematische Unterdrückung der HerrscherVon EverandStaatsdiener rauben uns aus: Systematische Unterdrückung der HerrscherNoch keine Bewertungen
- Kindheit am Rande der Verzweiflung: Die fatalen Folgen von Lockdown und IsolationVon EverandKindheit am Rande der Verzweiflung: Die fatalen Folgen von Lockdown und IsolationNoch keine Bewertungen
- c1 ThemenDokument9 Seitenc1 ThemenAnikó Pekárovičová87% (31)
- Die ModeindustrieDokument1 SeiteDie ModeindustrieKatarinaNoch keine Bewertungen
- HaiNguyen Schreiben2Dokument2 SeitenHaiNguyen Schreiben2Hải NguyễnNoch keine Bewertungen
- Einführung in Die Familienkost - LeseprobeDokument22 SeitenEinführung in Die Familienkost - Leseprobepraktikant9808Noch keine Bewertungen
- Mini-Farming für Einsteiger: Eine Anleitung für Anfänger zum Aufbau einer Mini-FarmVon EverandMini-Farming für Einsteiger: Eine Anleitung für Anfänger zum Aufbau einer Mini-FarmNoch keine Bewertungen
- FamilienformenDokument6 SeitenFamilienformenluka zurabauliNoch keine Bewertungen
- Schreiben 2Dokument1 SeiteSchreiben 2Dóra PappNoch keine Bewertungen
- Rezension: Maria Rollinger "Milch Besser Nicht"Dokument4 SeitenRezension: Maria Rollinger "Milch Besser Nicht"Elisabeth Rieping (1950 - 2009)Noch keine Bewertungen
- YyyyDokument2 SeitenYyyyJuan David ArangoNoch keine Bewertungen
- Das Wohlstandsparadox: Warum klassische Entwicklungshilfe scheitert und wie innovative Ideen Hoffnung gebenVon EverandDas Wohlstandsparadox: Warum klassische Entwicklungshilfe scheitert und wie innovative Ideen Hoffnung gebenNoch keine Bewertungen
- Bausteine Der ErnaehrungDokument9 SeitenBausteine Der Ernaehrungsagich nichtNoch keine Bewertungen
- Vom Kakaobaum Bis Zum Konsumenten. Die Wertschöpfungskette Von SchokoladeDokument38 SeitenVom Kakaobaum Bis Zum Konsumenten. Die Wertschöpfungskette Von SchokoladeInstitutSuedwindNoch keine Bewertungen
- DSH LV Armut Macht Krank Text AufgabenDokument9 SeitenDSH LV Armut Macht Krank Text AufgabenWael MrabetNoch keine Bewertungen
- Schreiben 1Dokument31 SeitenSchreiben 1ismail souhili100% (1)
- UntitledDokument5 SeitenUntitledYijie HuangNoch keine Bewertungen
- Konzerne unter Beobachtung: Was NGO-Kampagnen bewirken könnenVon EverandKonzerne unter Beobachtung: Was NGO-Kampagnen bewirken könnenNoch keine Bewertungen
- Hurra, wir werden Unterschicht!: Zur Theorie der gesellschaftlichen ReproduktionVon EverandHurra, wir werden Unterschicht!: Zur Theorie der gesellschaftlichen ReproduktionNoch keine Bewertungen
- Slowgerman - Der KindergartenDokument2 SeitenSlowgerman - Der KindergartenZaïnab AlfarajNoch keine Bewertungen
- SA testdafthema常考学业,社会话题语料,整理自德国原版资料Dokument10 SeitenSA testdafthema常考学业,社会话题语料,整理自德国原版资料SophieNoch keine Bewertungen
- Abnehmhilfe für Jugendliche: Wie Teenies Gewicht verlieren können - ohne nachteilige FolgenVon EverandAbnehmhilfe für Jugendliche: Wie Teenies Gewicht verlieren können - ohne nachteilige FolgenNoch keine Bewertungen
- HV-Nahrungsmittel Essen Statt WegwerfenDokument3 SeitenHV-Nahrungsmittel Essen Statt WegwerfenrazanNoch keine Bewertungen
- Reiches Deutschland LösungDokument1 SeiteReiches Deutschland LösungMehdi Hafdi0% (1)
- Vorsicht, Fisch kann Gräten enthalten: Bürokratischer Wahnsinn in Deutschland und EuropaVon EverandVorsicht, Fisch kann Gräten enthalten: Bürokratischer Wahnsinn in Deutschland und EuropaNoch keine Bewertungen
- Der Reichtum Geht, Die Armut BleibtDokument7 SeitenDer Reichtum Geht, Die Armut BleibtNicole Daphne MaronNoch keine Bewertungen
- Der Alltag im Banne des Corona-Virus: Gedanken einer vierfachen Mama und SchweizerinVon EverandDer Alltag im Banne des Corona-Virus: Gedanken einer vierfachen Mama und SchweizerinNoch keine Bewertungen
- Block Myhten A4 2021 RZ EmailDokument2 SeitenBlock Myhten A4 2021 RZ EmailblaNoch keine Bewertungen
- Brennpunkt Kinderzimmer: Die gefährliche Entwicklung der KleinstenVon EverandBrennpunkt Kinderzimmer: Die gefährliche Entwicklung der KleinstenBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Memorandum Geburtenrückgang: Der Stachel in unserem Herzen: Sozialisation, Isolation und der 'Abschied vom Kind'. Was wir wissen, wie wir handeln sollten.Von EverandMemorandum Geburtenrückgang: Der Stachel in unserem Herzen: Sozialisation, Isolation und der 'Abschied vom Kind'. Was wir wissen, wie wir handeln sollten.Noch keine Bewertungen
- Malaysischer LebensmittelsektorDokument8 SeitenMalaysischer LebensmittelsektorMP KamizoNoch keine Bewertungen
- Wie man Pasta Madre herstellt: Auszug aus dem Buch "Backen mit Pasta Madre"Von EverandWie man Pasta Madre herstellt: Auszug aus dem Buch "Backen mit Pasta Madre"Noch keine Bewertungen
- Island Flagge AustauschDokument1 SeiteIsland Flagge AustauschManuel SchöpferNoch keine Bewertungen
- Maurice Maeterlinck Referat DeutschDokument2 SeitenMaurice Maeterlinck Referat DeutschManuel SchöpferNoch keine Bewertungen
- Debatte Argumente DienstagDokument19 SeitenDebatte Argumente DienstagManuel SchöpferNoch keine Bewertungen
- Übungsaufsatz Textgebundene Erörterung Text BevölkerungsexplosionDokument2 SeitenÜbungsaufsatz Textgebundene Erörterung Text BevölkerungsexplosionManuel SchöpferNoch keine Bewertungen
- Kalter KriegDokument1 SeiteKalter KriegManuel SchöpferNoch keine Bewertungen
- Bioklausur Q11Dokument6 SeitenBioklausur Q11Manuel Schöpfer100% (1)
- Deutsch Referat Exilliteratur HandoutDokument3 SeitenDeutsch Referat Exilliteratur HandoutManuel SchöpferNoch keine Bewertungen
- Deutsch Referat ExilliteraturDokument3 SeitenDeutsch Referat ExilliteraturManuel SchöpferNoch keine Bewertungen
- Bev Ö Lke Rungs ExplosionDokument11 SeitenBev Ö Lke Rungs ExplosionManuel SchöpferNoch keine Bewertungen
- Debatte Argumente Themen 27-XyzDokument3 SeitenDebatte Argumente Themen 27-XyzManuel Schöpfer100% (1)
- By Geografie 2015 Klausur I LoesungDokument5 SeitenBy Geografie 2015 Klausur I LoesungManuel SchöpferNoch keine Bewertungen
- Das Parfum Motive Duft, Gestank, TodDokument6 SeitenDas Parfum Motive Duft, Gestank, TodManuel Schöpfer100% (1)
- Erörterung Cannabis LegalisierungDokument3 SeitenErörterung Cannabis LegalisierungManuel Schöpfer55% (11)
- Hessischer Landbote Referat DeutschDokument13 SeitenHessischer Landbote Referat DeutschManuel SchöpferNoch keine Bewertungen
- Botho Strauß - Der Schmelzling HandoutDokument2 SeitenBotho Strauß - Der Schmelzling HandoutManuel Schöpfer0% (1)
- Botho Strauß Der Schmelzling Referat DeutschDokument7 SeitenBotho Strauß Der Schmelzling Referat DeutschManuel SchöpferNoch keine Bewertungen
- Chicago JazzDokument2 SeitenChicago JazzManuel Schöpfer0% (1)