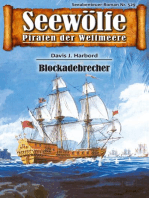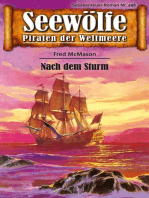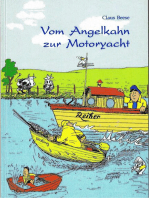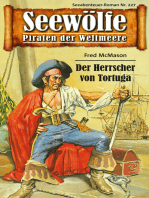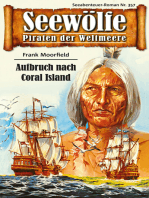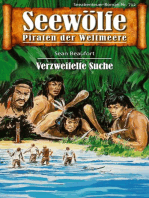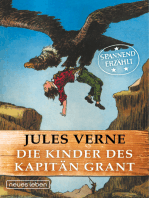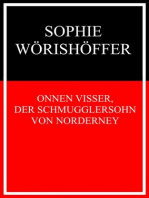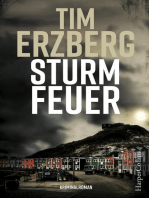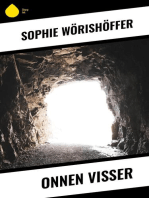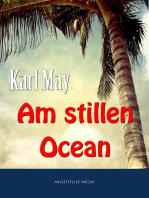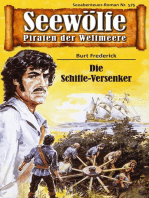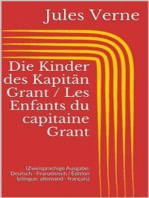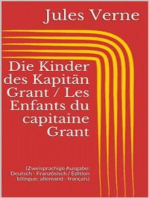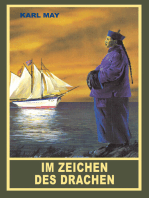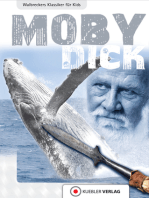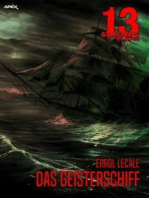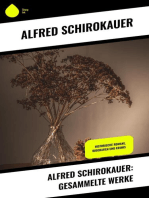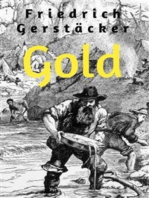Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Das Neue Abenteuer 039 - Rudolf Daumann - Freiheit Oder Bananen
Hochgeladen von
Thussard0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
105 Ansichten72 SeitenDas Neue Abenteuer 039 - Rudolf Daumann - Freiheit Oder Bananen
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenDas Neue Abenteuer 039 - Rudolf Daumann - Freiheit Oder Bananen
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
105 Ansichten72 SeitenDas Neue Abenteuer 039 - Rudolf Daumann - Freiheit Oder Bananen
Hochgeladen von
ThussardDas Neue Abenteuer 039 - Rudolf Daumann - Freiheit Oder Bananen
Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 72
RUDOLF DAUMANN
Freiheit
oder
Bananen
VERLAG NEUES LEBEN BERLIN
1954
Alle Rechte vorbehalten Lizenz Nr. 303 (305-106/54)
Urnschlagzeichnung: Fritz Ahlers, Prieros (Mark}
Gestaltung und Typographie: Kollektiv Neues Leben
Druck: Karl-Marx-Werk, Pößneck, V15/SO
Als das einfache Fischerboot mit dem geflickten Mat-
tensegel die Ausfahrt aus der Chetumal-Bai, nördlich
von Britisch-Honduras gelegen, gewinnen konnte,
heulte die Sirene des Polizeikutters haltgebietend
dreimal auf. Der junge bronzefarbene Indio ließ die
Segelleine fahren; dem Alten, der am Heck kauerte
und mit der Ruderpaddel das Boot am Wind hielt, fiel
mit einer mutlosen Gebärde der Kopf auf die Brust.
Sein Atem ging schwer.
Der junge Mann fragte: „Will dir die Luft heute nicht
bekommen, Vater? Sieh, wie der Morgen lacht!“ ,
Ein müdes Lächeln spielte über das geschwollene Ge-
sicht des Alten: „Die Seeluft ist wie ein Heiltrunk aus
dem heiligen Nopalkaktus. Doch der Sergeant Morgan
von der Küstenpolizei preßt mir die Brust zusammen.“
Er wies auf das Motorboot, das sich mit schäumender
Bugwelle näherte. An der Reling stand ein breitschult-
riger Mann in weißer Tropenuniform; die linke Hand
hatte er auf einen Bootshaken gestützt, die rechte hob
das Megaphon. „Seid ihr nicht die Perlenfischer, die
Ferrentes, aus Payo Nabisco, der alte Juan und der jun-
ge Teokal?“ erklang seine Stimme. „Macht klar zur
Kontrolle!“
Der junge Ferrente warf die strähnige schwarze
Haarmähne aus der Stirn und schrie zurück: „Unser
Boot kontrollieren? In der Nußschale kann man wohl
viel verstecken! Macht Euch nicht lächerlich, Sergeant
Morgan!“ Sein Englisch war einwandfrei, als hätte er
es auf der Universität Oxford gelernt. „Halt dein Maul,
Bürschlein! Komme euch schon auf eure verdammten
Schliche!“ Der Bootshaken packte die Bordkante des
Fischernachens und holte ihn längsseits. Schwerfällig
stieg Morgan über. „Jüngelchen, bilde dir keine
Schwachheiten ein, weil du das Eingeborenen-College
Ihrer Majestät Kronkolonie Britisch-Honduras in Beli-
ze besucht hast! – Ihr fahrt auf Perlenfischerei?“
Der alte Ferrente nickte: „Selbstverständlich, Mister
Morgan! Wir Perlenfischer… Hier Registriermarke!“
„Quatsch mich nicht an, alte Braunhaut!“ knurrte der
Sergeant. „Habt ihr Tauchhilfsmittel an Bord?“
Teokal schüttelte den Kopf: „Seitdem sie verboten
sind, fischen wir wieder wie unsere Vorfahren, die
weisen Mayas… springen nackt ins Wasser und bre-
chen mit unseren Händen die reifen Muscheln aus den
Bänken. Eine lebensgefährliche Arbeit, Sir!“
Der Polizist warf mit der Stiefelspitze die armseligen
Mattenbündel auf dem Bootsboden auseinander. „Der
junge Mann sehnt sich also wieder nach einem beque-
men Taucheranzug? Gibt es nicht mehr! Höchste Zeit,
daß man euch das verboten hat, sonst wären wohl bald
die letzten Perlmuscheln aus dem Golf von Honduras
verschwunden. Perlmuschelschutzgesetz… ein sehr
weises Gesetz des Hohen Rates unserer Kronkolonie!“
Der alte Ferrente atmete noch schwerer. In seinem
unbeholfenen Englisch begann er: „Wir unsere Mu-
schelbänke schonen… immer nur die reifen Muscheln
nehmen… schon 500… 600 Jahre lang. Noch ehe wei-
ße Männer hierhergekommen. Wir schonen mit Tau-
cherhelm und ohne.“
Und sein Sohn setzte hitzig hinzu: „Ein ungerechtes
Gesetz! Es will den Perlenhändlern einen hohen Preis
sichern. Uns Perlenfischern aber kostet es die Gesund-
heit. Seht meinen Vater an! – Lungenerweiterung! Die
hat er sich geholt, seitdem er wieder ohne Taucheran-
zug auf dem Meeresboden arbeiten muß…“
Der Sergeant bückte sich und hielt dann eine dicke
Glasscheibe hoch, die von einem breiten Gummiwulst
eingefaßt war: „Hallo, Juan, und was ist das?“
Der alte Perlenfischer griff danach: „Nur Sichtschei-
be, Mister!“
„Also eine Tauchhilfe! Das Gesetz verbietet jegliches
Gerät, das geeignet ist, den Aufenthalt unter Wasser zu
erleichtern. Beschlagnahmt!“, und er warf die Sicht-
scheibe in das Motorboot hinüber. Der Sohn protestier-
te: „Sichtscheiben sind nie und nimmer durch das
Perlmuschelgesetz verboten worden.“
Morgan schwang sich bereits wieder in den Polizei-
kutter. „Kannst dich ja beim obersten Kronrichter, Sir
Townsbridge, über mich beschweren, Braunhaut! Ver-
schwindet! Seid froh, daß ich euer verdammtes Kari-
benboot nicht beschlagnahme!“
Das Polizeifahrzeug drehte ab und schoß über die
blaue Flut der großen Chetumal-Bai auf den Küsten-
streifen zu. Teokal hatte die Fäuste geballt und starrte
dem davonjagenden Kutter nach. Sein Vater saß zu-
sammengesunken auf der Heckbank und atmete müh-
sam. „Laß deinen Zorn, Teokal! Die Weißen haben
ihre Freude daran, uns zu beleidigen und zu erniedri-
gen. Wir wollen Kurs auf Ambergrins nehmen, zur
alten Muschelbank. Vielleicht beschert sie uns heute
das große Glück!“
Zwei Stunden später legten die beiden Ferrentes ihr
Boot mit Steinankern über dem Fischgrund fest. Teo-
kal warf die teerige Schifferhose und das billige Kat-
tunhemd ab. Sorgsam schnallte er den breiten Gurt mit
dem scharfen Dolch und dem meißelartigen Muschel-
brecher um die schmalen Hüften. Der Vater band ihm
den Sammelkorb vor die Brust und suchte selbst den
geeignetsten Tauchstein aus, der den schlanken Jüng-
lingskörper zwanzig Meter tief auf den Grund ziehen
sollte. Er schlang das Gleitseil in die Öse und ordnete
nochmals vorsichtig die Seilwindungen. Nun warf der
alte Ferrente die Kleidung ab und begann seinen Kör-
per mit Palmfett zu salben, denn das Wasser auf dem
Grunde ist kühl, und viele Male muß ein Taucher zu
den Muschelbänken hinunter, um die Beute zu bergen.
Teokal unterbrach seine Atemübungen. „Du wirst heu-
te nicht tauchen, Vater! Du hast es mir versprochen.“
Der nickte, fuhr aber in seiner Tätigkeit fort. „Mein
Wort gilt; aber ich will bereit sein, wenn dir eine Ge-
fahr droht. Jahrelang waren wir nicht auf dieser Bank.
Es könnten sich Kraken eingenistet haben; Haie lauern
immer…“
Der Sohn ermahnte ihn noch. „Aber nicht tauchen!“
Dann ergriff er den schwersten Tauchstein und ließ
sich über Bord gleiten. Rasch zog ihn das große Ge-
wicht in die Tiefe. Schon hatte er das warme Oberflä-
chenwasser durchmessen, jetzt umspülte ihn das kühle
Tiefenwasser. Der Druck der auf ihm lastenden Was-
sersäule nahm von Meter zu Meter zu. Es knackte in
den Trommelfellen; der Brustkorb wurde zusammen
gepreßt. Die Augen schmerzten immer mehr, während
die Muschelbank, am Rande einer unterseeischen
Schlucht gelegen, näher und näher kam.
Teokal griff nach dem Muschelbrecher, dann schlang
er die Tauchleine um das rechte Bein, um nicht vom
Auftrieb emporgerissen zu werden. Jede Bewegung
fiel ihm maßlos schwer. Er krallte sich an den Felsen
der Bank fest, brach die größten Muscheln los und
stopfte sie in den Korb. Als er acht Stück gesammelt
hatte, glaubte er, der Kopf würde ihm zerspringen. Er
langte nach der Leine und ließ sich hinaufgleiten, vor-
sichtig, um den Wasserdruck nicht zu schnell zu ver-
mindern. Dabei blies er den Atem aus, und lustig perl-
ten die Luftbläschen durch die blaue Flut.
Fast zwei Minuten war er unter Wasser geblieben.
Heftig nach Luft schnappend, hing er nun am Boots-
rande, und der Vater half ihm, sich über die Bordkante
zu schwingen. Dann wurde der Stein heraufgehievt.
Der Vater nahm die Muscheln aus dem Korb, klopfte
dem Sohn anerkennend auf die Schultern und seufzte:
„Schwer… sehr schwer für dich! Aber gute Mu-
scheln… sehr schöne Muscheln!“
Wieder und wieder ließ sich Teokal in die Tiefe glei-
ten. Der alte Juan sprühte Öl auf die Wasserfläche, um
das Wellengekräusel zu glätten. So konnte er in dem
klaren Wasser jede Bewegung des Tauchers genau ver-
folgen. Sorgsam beobachtete er die Umgebung, in der
sich sein Sohn befand.
Zum zehnten Male wurde der Korb geleert. Teokal
saß, mit den Zähnen klappernd und am ganzen Körper
zitternd, auf der Heckbank und zählte die Muscheln.
„Hundert!“ stellte er fest. „Noch einmal!“
Juan sah, wie sein Sohn drunten mit dem Muschel-
brecher arbeitete. Da erblickte er plötzlich einen
schwarzen Schatten, der sich aus den dunklen tieferen
Gründen löste, breit wie ein Teppich, mit zuckendem
Dornschwanz und einer wahren Satansfratze.
„Teufelsrochen!“ brüllte der Vater. Den schwersten
Tauchstein mit seinen braunen Händen packend,
sprang er über Bord. Das Herz des Kranken schlug
zum Zerspringen, als er einige Schwimmstöße im Nie-
dertauchen wagte. Jetzt hing er in fünfzehn Meter Tie-
fe genau über den zittrig flatternden Flanken des See-
ungetüms und ließ den Stein los. Im Sog des Auftriebs
sah er noch, wie die Gespensterfratze des Stachelro-
chens getroffen wurde. Mit jähem Schwung ver-
schwand die Bestie aus seinem Blickfeld. Dann kam
die Dunkelheit einer Ohnmacht über ihn.
Als er erwachte, lag er auf den Bündeln zwischen den
Bootsspanten. Das Rauschen der Bugwelle kündete
von schneller Fahrt. Er war ein wenig verwundert, als
er die Stimme seines Sohnes hörte: „Und nun bist du
doch getaucht, Vater… getaucht, um mich zu retten.
Ich sah den Teufelsrochen zu spät. Wenn mich die gif-
tigen Stacheln getroffen hätten! Bleibe ganz ruhig lie-
gen. Wir haben günstigen Rückenwind und sind bereits
in der Chetumal-Bai.“
Der Alte konnte sich schon wieder ein wenig aufrich-
ten. Er flüsterte: „Und die Muscheln? Wenn der Ha-
lunke, der Morgan, wieder kontrolliert?“ Das Sche-
rensegel fiel zusammen; neben ihm kniete Teokal.
„Götterfreund“ bedeutet dieser Name.
„Wie weise ist mein Vater. Wir wollen gleich unseren
Fang untersuchen!“
Der Vater sah mit kritischen Augen, wie der Sohn die
Haltebänder der Muscheln durchschnitt, die regenbo-
genfarbenen Schalen auseinanderklappte und sorgsam
das Weichtier untersuchte. „Nichts!“ hörte er immer
wieder. „Nichts… nur gutes Perlmutt!“ Es mochte die
dreißigste Muschel sein, da griff Teokal vorsichtig mit
zwei Fingern in die schleimigen Organe und holte ei-
nen birnenförmigen Körper heraus, größer als eine
schwarze Bohne. Er steckte ihn in den Mund und
schlürfte den anhaftenden Schleim. Dann hielt er eine
vollendet geformte Perle zwischen den Fingern und
rief begeistert: „Pirula… ein Wunderbirnchen! Vater,
schau und vergiß den Kummer! Eine Prachtperle…
keinen einzigen Fehler können meine Augen finden.
Sicherlich 50 Gran, wenn nicht mehr. Hast du jemals
ein so schönes Stück gesehen?“
Juan Ferrente richtete sich ächzend auf und nahm das
Wunder der Natur vorsichtig zwischen Daumen und
Zeigefinger. „Ohne jeden Makel und von bestem
Glanz! Nie sahen meine Augen eine so schöne Perle…
Ich wärme sie unter meiner Zunge, damit sie nichts
von ihrem Schimmer einbüßt. Und schweige, schwei-
ge! In Belize… 100 Pfund haben sie schon gemordet…
Dieses Stück ist mindestens 3000 wert!“
Teokal setzte wieder das Segel. Durch das Rauschen
der Wellen hörte der Vater die Worte seines Sohnes,
als wären sie ein Jubellied: „Die Perle… das ist das
Motorboot für die Genossenschaft, das Glück der Fi-
scher von Payo Nabisco… das ist der Arzt für dich…
Gute Perle… schöne Perle!“
Als Sergeant Morgan das heimkehrende Boot stoppen
hieß und Auskunft über den Fang verlangte, wies Teo-
kal auf die geöffneten und ungeöffneten Muscheln:
„Unsere ganze Beute! Mein Vater kann nicht sprechen,
weil ihm der Wasserdruck das Blut in die Luftröhre
getrieben hat. Verflucht sei euer Gesetz!“
Morgan schätzte die kümmerliche Ausbeute und ließ
den Kutter abdrehen. „Euer Glück, daß es nicht mehr
Muscheln sind! Ich werde euch schon Gehorsam ge-
genüber dem Gesetz beibringen!“
„Ein scheußliches Nest, dieses Belize!“ knurrte der
hagere Mann mit dem rostroten Haar, während er sich
in dem weichen Sessel rekelte. Er sprach das Englisch
gaumig, so daß man sofort den Yankee erkannte. „Be-
lize, Hauptstadt von Britisch-Honduras… britisch so
lange, wie es dem Hohen Senat und dem Weißen Haus
in Washington gefällt! Mister Kronrichter, wie konntet
Ihr es hier an der verdammten Küste des lausigen Ka-
ribischen Meeres schon sechs Jahre aushalten?“
Der kleine Mann mit dem rosigen rundlichen Gesicht
hinter dem breiten Schreibtisch lächelte seinem Gast
vergnügt zu: „Ich brauche nicht mehr auszuhalten…
Meine Vertragszeit ist abgelaufen. Nur diese Gerichts-
sitzungen nehme ich noch wahr, Mister Grebb. Mein
Nachfolger ist schon auf der Reise hierher. Hoffentlich
wird er das Recht ebenso sprechen wie ich: unpartei-
isch und unbestechlich, wie es die geheiligte Überliefe-
rung des britischen Empires von seinen Kronrichtern
verlangt.“
Grebb grinste unverschämt. „Was Ihr immer für
Sprüche wißt! Ich wette, daß Ihr neun Zehntel Eures
beachtlichen Bankkontos der Tätigkeit für die United
Fruit-Company verdankt! Und die Vereinigte Frucht-
Gesellschaft ist eine amerikanische Gesellschaft.
Könntet Euer Guthaben noch etwas abrunden, wenn
Ihr Euch mir gefällig erweisen würdet. Die UFC zahlt
gut und schnell.“
Der Kronrichter Townsbridge kniff die Augen zu-
sammen: „Meint Ihr Payo Nabisco? Ein heißes Eisen
die Sache, seitdem Beschwerde gegen Euren Länder-
kauf dort eingelegt worden ist. Muß es denn ausge-
rechnet das Ufer der Chetumal-Bai sein?“
Der Yankee sprang erregt auf: „Natürlich, sonst wür-
den wir uns wahrhaftig nicht darauf versteifen Die
United Fruit hat die lange Küstenzone zwischen Belize
und Benque Viejo in eine einzige Bananenplantage
verwandelt, in der 20 000 Schwarze, Rote und Braune
kaum genug Hände haben, die Früchte zu bergen. Aber
wir brauchen neues Land, unausgesogen, verkehrsgün-
stig gelegen und vor allem mit arbeitswilligen und ge-
nügsamen Eingeborenen. An der Chetumal-Bai gibt es
Zehntausende von Hektar, die unseren Zwecken dienen
könnten.“
„Aber nicht zu haben!“ meinte der Kronrichter. „Bo-
denverkäufe dürfen die Gerichte nur registrieren, wenn
die Vorstände der Dorfgenossenschaften zugestimmt
haben. Die guten Zeiten der United Fruit, als sie die
Quadratmeile Boden für zwei Flaschen Niggerrum und
einen Dollar kaufen konnte, sind vorbei. Payo Nabisco
kommt Euch nicht so billig!“
Grebb stieß einige Flüche aus, die selbst bei einem
hartgesottenen Gangster von der Seeseite Chikagos
Aufsehen erregt hätten. „Diese höllenverdammten Fer-
rentes! Nicht einmal ihre Kaziken, ihre Priesterhäupt-
linge, wollen sie anerkennen. Mit dem ewig besoffenen
Kaziken Chinchano von Payo Nabisco war ich einig.
Er unterschrieb alles, was ich ihm vorlegte, wenn ich
ihm nur den notwendigen Schnaps auf Lebenszeit ver-
sprach. Doch dann nimmt ein Krongericht Kenntnis
von dem Einspruch eines Teokal Ferrente, der dem
Kaziken jedes Recht abspricht, im Namen der Bewoh-
ner von Payo zu verhandeln und zu verkaufen. Warum
hört Ihr eigentlich auf diesen Ferrente?“
„Weil er ein kluger und gebildeter Indio ist, dessen
Meinung in ganz Honduras viel gilt!“ behauptete
Townsbridge. „Ich möchte in den letzten Monaten
meiner Amtstätigkeit keinen Aufstand erleben.“ Er
ging zum Fenster und blickte durch die spiegelnden
Scheiben hinaus auf die sonnenübergossenen Parkan-
lagen und das unwirklich blaue Meer.
„Freund Houston, Euch ist es wohl am meisten um
willige Arbeitskräfte zu tun? Kann ich mir denken.
Unsere Arbeitslosen leben lieber von Seeigeln und
Strandkrabben, als daß sie bei Euch Arbeit suchen. Die
Bewohner von Payo Nabisco sind sanfte Mayas, Nach-
kommen des großen Kulturvolkes Mittelamerikas, die
richtigen Opfer für die United Fruit. Also, wenn der
Einspruch nicht wäre… Ich gebe Euch einen guten
Rat: Dort unter der großen Fächerpalme vor dem Ein-
geborenenhospital sitzen gerade Eure beiden Gegner in
dem Streitfall. Ja, die Ferrentes! Sorgt dafür, daß sie
nicht persönlich vor Gericht erscheinen, wenn über den
Einspruch verhandelt wird. Wer kann dann den Kron-
richter hindern, Euren Vertrag mit dem Kaziken für
rechtskräftig zu erklären?“
Houston Grebb griff nach dem Tropenhelm, stülpte
ihn auf seinen eiförmigen Schädel und sagte, schon im
Gehen: „Danke Euch! Könnt Euch jetzt schon um 1000
Dollar reicher fühlen, Townsbridge! Will mir mal die
Rothäute näher beschauen!“
Er schob frischen Kaugummi zwischen seine Zähne
und schlenderte über die prunkvolle Freitreppe des
Krongerichtes hinab in die gepflegten Anlagen, wo die
beiden Ferrentes auf einer Bank ausruhten. Sie trugen
ihre Festtagskleidung: blaue Baumwollhemden und
Zwillichhosen, die mit dem blutroten Saft der Coche-
nillelaus gefärbt waren. Der Vater starrte mit angstge-
weiteten Augen in das Grün und Gold des Vormittags,
verzweifelt nach Atem ringend. Teokal klopfte behut-
sam seine Schultern, um ihm Erleichterung zu schaf-
fen. Grebb heuchelte Anteilnahme und blieb stehen.
„Wohl stockbesoffen schon am frühen Morgen?“ frag-
te er.
Teokals kupferfarbenes Gesicht wurde noch dunkler.
„O nein, Herr! Mein Vater leidet an der Taucherkrank-
heit… Lungenerweiterung… drückt aufs Herz!“
Der Yankee riet: „Geht zu Doktor Clarkson! Der
spritzt euch den Teufel aus dem Kadaver. Taucher-
krankheit? Muß der Alte eben seinen Beruf aufgeben.
Ihr seid doch die Ferrentes aus Payo Nabisco?“
„Wir sind geehrt, daß der Herr unseren bescheidenen
Namen kennt“, erwiderte Teokal voller Vertrauen. „Ich
wollte meinen Vater in das Eingeborenenhospital füh-
ren… Unterwegs packte ihn der Anfall, die Atemnot.“
Grebb zog seine Stirn kraus: „Das Farbigenhospital?
Was werden sie schon mit dem Alten machen? Jod auf
die Rippen, Brechpulver in den Magen und Rhabarber
für den Darm. Unsinn! Geht zu Clarkson! Nennt mei-
nen Namen: Houston Grebb von der United Fruit.
Wird euch keinen Cent kosten. Nehme das aus Mitleid
mit dem Alten auf mein Konto.“
Teokal war einen Schritt zurückgewichen: „Mister
Grebb von der UFC? Haben Sie nicht den Vertrag mit
dem Kaziken Chinchano abgeschlossen?“
Der Yankee ließ sich auf der Bank neben dem stöh-
nenden Juan nieder, legte seinen rechten Arm stützend
um die Schultern des Leidenden und versuchte weiter
den Harmlosen zu spielen: „Natürlich, Houston Grebb,
wie er leibt und lebt. Bin auf euren versoffenen Prie-
sterhäuptling elend hereingefallen. Hätte ich gewußt,
daß ihr Ferrentes in Payo das Heft in der Hand habt,
wäret ihr meine Vertragspartner geworden. Ihr seid
doch sozusagen die Chefs an den Ufern der Chetumal-
Bai!“
Juan Ferrente schien den Anfall überwunden zu ha-
ben. Der Atem ging noch schwer, doch konnte er
schon einige Worte sprechen: „Nicht Chef… Vorsteher
von Dorfgenossenschaft. Sehr arm in Payo Nabisco…
Fischer und Bauern… schlechter Mais, wenig Fische.
Tortillas knapp, Enchilladas… Ihr wissen, gefüllt mit
Fischfleisch… wenig, sehr wenig.“
Grebb nickte zu dieser Feststellung und meinte sal-
bungsvoll: „Arme und Reiche hat es nach Gottes Wil-
len immer gegeben. Das kann man nicht ändern. Im-
merhin könnte ich mir vorstellen, daß wenigstens die
Ferrentes in eurem dämlichen Kaff zu Macht und
Reichtum aufsteigen könnten. Ich liebe nicht viele
Worte. Kurz: Bestätigt die Verträge der UFC, ge-
schlossen mit dem Kaziken, eurem Chinchano, und ihr
seid Vormänner für Payo Nabisco, ja mehr… für die
lange Küste der Chetumal-Bai. Vormann für die Uni-
ted Fruit, das bringt jedem von euch tausend Dollar
Überschuß im Jahre…“
„… und Hunger den Dorfgenossen, Verzweiflung den
Frauen und Verkommenheit unseren Mädchen!“ brau-
ste Teokal auf. „Ich weiß, was Ihr zwischen Belize und
Benque Viejo aus fleißigen Negern und fröhlichen In-
dios gemacht habt. Ihr sagt Fortschritt und meint Ba-
nanen. Wir wollen Freiheit und nicht Bananen für die
UFC. Können wir uns da verstehen?“
Der Yankee stand kopfschüttelnd auf: „Blödsinn, mit
solchen Mauleseln erst zu reden! Ihr wollt also Kampf?
Bitte, könnt ihr haben, bis zur Entscheidung! Die Fer-
rentes und die UFC! Kinder, das ist zum Lachen! Aber
bitte, wie, ihr wollt!“ Und er schritt von dannen, ohne
den beiden Indios den Weg zu dem Wunderdoktor
Clarkson gewiesen zu haben.
Juan blickte ihm erschrocken nach: „Teokal, der
Hauptmacher der UFC! Jetzt geht er und wirbt Tot-
schläger. Es ist sehr gefährlich, den Herrn Grebb zum
Feind zu haben.“
Sein Sohn lächelte: „Vater, wer im Recht ist, darf
keine Furcht haben. Und dann bedenke, wenn erst das
Gericht gesprochen hat, kann die UFC sich nicht mehr
auf den verräterischen Kaziken berufen.“
„Dieser Schurke! Er verrät das Volk, wenn er nur ge-
nug Schnaps bekommt! Wir hätten ihn nicht nur hi-
naustreiben, ins Meer hätten wir ihn stürzen sollen!“
Juan ballte die Fäuste. „Blutsauger findet zu Blutsau-
ger: die Briten, die Amerikaner, die Verräter aus unse-
rem Volke… Wer wird uns von diesem Geschmeiß
befreien?“
„Wenn wir es nicht selber tun…!“ Teokal stützte sei-
nen Vater und geleitete ihn zur Pforte des Spitals. „Wir
brauchen nicht zu verzagen. Neue und gute Gedanken
entflammen die Herzen aller Gequälten und Geknech-
teten in der ganzen Welt. Seit mehr als 400 Jahren sind
wir Mayas rechtlose Sklaven der weißen Ausbeuter.
Nun aber ist die Zeit gekommen, da wir selbst darüber
entscheiden werden, was gut ist und was uns nützt.
Jetzt brauchen wir Mut und müssen alle Furcht able-
gen!“
Der Vater schüttelte zwar leicht den Kopf, aber im
stillen freute er sich doch über den Sohn, der mit dieser
Gewißheit von dem besseren Leben der Indios in naher
Zukunft sprechen konnte. Und als der grobe Kranken-
wärter im Eingeborenenspital den Alten warten ließ,
ermahnte dieser ihn: „Du solltest freundlicher mit dei-
nen Brüdern umgehen. Wenn du auch ein Mestize bist,
das Blut deiner indianischen Mutter macht dich doch
zu unserem Bruder!“
Die anderen wartenden Eingeborenen klatschten die-
ser Feststellung lächelnd Beifall, so daß der gestrenge
Wärter selbst fröhlich wurde und mit heiterer Miene
das Krankenbuch aufschlug, um die neuen Fälle einzu-
tragen: „Kommt her, Brüder und Schwestern! Alter, du
hast recht! Was kümmert mich der brummige Arzt?
Euer Wohl steht meinem Herzen am nächsten!“
Houston Grebb war inzwischen in das Hafenviertel
hinabgestiegen. In einer schmutzigen Gasse trat er
durch die schmale Tür in das lärmerfüllte Innere einer
Rumschenke. Ohne Gruß durchschritt er den Vorraum
und ließ sich im Hinterzimmer in einen Schaukelstuhl
sinken. Dem eifrig herbeieilenden Wirt gab er den kur-
zen Befehl: „Schafft mir Kururu, den Mann mit der
Machete, hierher! Schnell, ich habe nicht lange Zeit!“
„Kururu?“ Der Schankwirt, seiner Farbe nach ein
echter Jamaikaneger, wischte sich verzweifelt die
Handflächen an der Sackschürze ab. „Euer Gnaden,
Kururu wurde gestern von den Polizeimännern in Haft
genommen… von der Hafenpolizei… weil… weil er
Streit mit einem Maschinisten von einem Bananen-
dampfer hatte, einen blutigen Streit, Herr. Zwangsar-
beit ist ihm sicher….“
„Wo sitzt er?“ fragte Grebb.
„Noch in der Wache des Hafenbezirks. Das Polizeige-
richt tagt erst am Nachmittag.“
Der Yankee stülpte sich den Tropenhelm auf und ging
ohne Gruß und Wort.
Die diensttuenden Beamten in der Polizeiwache
sprangen auf, als er den Raum betrat. Er knurrte etwas,
was wohl einen Gruß bedeuten sollte, und wandte sich
einer Tür im Hintergrunde zu. „Muß den Chef spre-
chen!“ Ohne zu klopfen, trat er durch die Milchglastür.
Der dicke Polizeihauptmann rekelte sich aus seinem
Klubsessel empor. „Welche Ehre!“ begrüßte er den
Eintretenden. „Houston Grebb persönlich?! Womit
kann ich dienen?“
Der Chefagent der UFC winkte ab, als ein Klubsessel
für ihn zurechtgerückt wurde. „Keine Zeit, Cormick!
Ich brauche auf der Stelle Kururu. Soll in Eure Fang-
arme geraten sein. Paßt aber durchaus nicht zu meinen
Plänen. Muß außer Verfolgung gesetzt werden!’’
„Sir, der Mann mit der Machete hat einem Eurer Ma-
schineningenieure das linke Ohr mit seiner verdamm-
ten Machete abgesäbelt, rein aus Vergnügen sozusa-
gen, weil ihm das Gesicht des Mannes nicht gefiel!“
„Ist Strafantrag gestellt? Nein? Na also, die Beruhi-
gung des Maschinenkulis nehme ich auf meine Rech-
nung. Schnell, Mann, schafft mir Kururu hierher. Cor-
mick, es dürfte nicht Euer Schade sein, wenn der Mann
mit der Machete freigelassen und außer Verfolgung
gesetzt wird.“
Keine fünf Minuten waren vergangen, da führten
zwei Polizisten den Häftling herein. Er trug noch die
„stählerne Acht“, die Handfesseln; und stemmte sich
mit aller Gewalt gegen die beiden, die ihn vor den Po-
lizeihauptmann stellen wollten. Dabei fluchte er in
sämtlichen Sprachen, die an der Küste von Britisch-
Honduras gesprochen wurden: Englisch, Spanisch,
Maya, Karibisch, sie alle durcheinandermischend und
verstümmelnd. Er behauptete, seiner Abstammung
nach ein Casco zu sein, also der Sohn einer Mulattin
und eines Mulatten, die wieder Abkömmlinge von
Weißen und Negern sind. Doch auch das Blut von wei-
sen Mayas und abenteuerlichen Kariben mußte in sei-
nem Körper kreisen, wie seine Gesichtszüge verrieten.
Er war eines jener unglücklichen Geschöpfe, wie man
sie überall findet, wo seit Jahrhunderten der weiße
Mann die Urbevölkerung unterdrückt, und die nicht
wissen, ob sie sich zu den Beherrschern oder zu den
Entrechteten zählen sollen.
Kururu war ein Muskelriese. Er galt an der Küste von
Belize als der wildeste Faustkämpfer. Dort werden bei
einem Kampf über 12 Runden keine gepolsterten Box-
handschuhe umgeschnallt. Mit den felsenharten Knö-
cheln und dem eisernen Handrücken versucht man, den
Gegner k. o. zu schlagen, und keine Vorschrift gibt es,
die einen Treffer unter der Gürtellinie verbietet.
Wenn Kururu aber betrunken war – und das war er
sehr häufig – , dann zeigte er seine Künste mit der Ma-
chete, mit dem meterlangen Buschmesser, das jeder
Waldarbeiter der Mahagoni-Exportgesellschaft trug,
um zu zeigen, daß er nicht zu den sanften Bananenbau-
ern gehöre. Es war ein offenes Geheimnis in Belize,
daß Kururu mit der Machete nicht nur die in die Luft
geworfenen Orangen oder Bananen zerteilen konnte.
Wenn ein Eingeborener mit einer furchtbaren Hals-
wunde tot aufgefunden oder aus dem Wasser gezogen
wurde, dann flüsterte man scheu: „Das war der Mann
mit der Machete!“ Niemand hätte es jedoch gewagt,
Kururu diese Beschuldigung ins Gesicht zu sagen.
Als er den wartenden Grebb erblickte, zuckte der Rie-
se zusammen, als hätte ihn ein Peitschenhieb getroffen.
Plötzlich wurde er ganz still.
Der Amerikaner fuhr ihn an: „Verdammtes Vieh,
hältst du so deine Versprechen? Bezahlen läßt du dich,
aber wenn du gebraucht wirst, hast du dich feige in das
Gefängnis verdrückt! Wenn ich meine Hand von dir
abziehe, sind dir zwanzig Jahre Zwangsarbeit sicher…
oder der Strang!“
„Kleiner Spaß nur!“ gurgelte Kururu. „Nicht böse ge-
dacht…“ Seine Augen unter den dicken Brauenwülsten
wurden vor Staunen starr, als die „Acht“ aufgeschlos-
sen wurde und seine Hände frei waren. Verlegen rieb
er seine geschwollenen Gelenke.
Grebb stand schon an der Tür: „In einer Viertelstunde
bei Seymour. Kommst du nicht, weißt du, was dir
blüht!“
Kururu war pünktlich in der Rumschenke. Grebb lud
ihn nicht zum Sitzen ein. Er fragte: „Du kennst die
Ferrentes, Juan und Teokal, aus Payo Nabisco?… Gut!
Du hast mit deiner Bande dafür zu sorgen, daß mir die
beiden Braunhäute nicht mehr vor die Augen kommen,
weder hier noch am Ufer der Chetumal-Bai. Wie, das
ist deine Sache. Hier…“ Er riß einen Hundert-Dollar-
Schein mitten durch, gab Kururu die eine Hälfte: „Die
andere bekommst du, wenn ich erfahre, wohin die Fer-
rentes verschwunden sind.“ Der Mann mit der Machete
sah dem Davonhastenden mit bösem Blick nach, ehe er
sich über die Flasche hermachte, die Grebb unangebro-
chen stehengelassen hatte.
Teokal hatte es erreicht, daß der Arzt den Vater
gründlich untersuchte; aber dann gab es doch nur
Ratschläge über Schonung und Ruhe und einen harm-
losen Hustensaft. „Heilen, junger Mann? Vielleicht in
einem Sanatorium, wenn man das Geld dazu hat. Wie
alt ist der Vater? 48 Jahre? Allerhand! Durchschnittlich
leben die Farbigen hier in diesem gottgesegneten Lan-
de nur 38 Jahre. Warum das so ist? Das weiß unsere
Statistik nicht. Mangelnde Körperpflege, meinen wir
Ärzte, wozu wir auch Nahrung, Kleidung und Wohn-
unterkunft gerechnet wissen wollen. Die weiße Bevöl-
kerung erreicht trotz des höllischen Klimas ein Durch-
schnittsalter von 58 Jahren. – Ob es Spritzen für den
Alten gibt? Gewiß, aber das Stück kostet ein Pfund.
Und zur Grundkur gehören dreißig…“
Der alte Kolonialarzt war nicht wenig verwundert, als
Teokal zehn Pfundnoten auf den Tisch zählte und bat:
„Helft meinem Vater, Sir! Wir haben Perlmutt ver-
kauft, und ehe es dunkelt, lege ich auch die fehlende
Summe in Eure Hand. Soll mein Vater gleich im Spital
bleiben?“
Der Arzt feilte bereits an dem Hals einer Ampulle,
um die nickelblinkende Wunderspritze zu füllen:
„Nicht notwendig! Ich gebe heute versuchsweise ein
Präparat. Übermorgen kommt ihr in der Mittagsstunde
wieder und erzählt mir, wie es ihm bekommen ist.
Müßt mächtig Geld verdienen in Payo Nabisco! Solche
Patienten habe ich gern.“
Nach der Behandlung mußte der Kranke noch einige
Stunden ruhen, und erst als nach der lähmenden Mit-
tagshitze das Leben in den Straßen von Belize wieder
erwachte, schritten die beiden Ferrentes hinab zur
Stadt. Der alte Juan freute sich: „Das Herz springt
nicht mehr wie ein junges Böcklein, es geht ruhig wie
die Dünung bei Ambergris, und der Druck ist mir von
der Lunge genommen. Dank sei der großen Kunst der
weißen Ärzte!“
„Wenn sie nur nicht so teuer wäre!“ warf Teokal ein.
„Doch wir wollen nicht klagen. Die Perle wird genug
Geld bringen, um dich gesund zu machen.“
Der Perlenhändler Constantin Simonides hatte gerade
hohen Besuch, als die beiden Indios sein Büro betraten,
um ihm den kostbaren Fund anzubieten. Ärgerlich wies
er auf eine Bank an der Wand und hieß sie warten.
Dann wandte er sich wieder seinem Gaste zu:
„Sehr erfreulich, Sir Equester, daß die Kollegen vom
Strand in London so viel von mir erwarten. Ausge-
rechnet der Simonides in Belize soll für die junge Kö-
nigin das Schaustück, die Wunderperle, die Krönungs-
perle beschaffen! Lachen könnte man, wenn man nicht
weinen müßte! Ich kaufe Registrierware, das ist
schlechter Durchschnitt. Was gut und besser ist, das
sichern sich die amerikanischen Gangster, die ohne
Konzession ihren Perlenhandel betreiben. Eine Perle
von 50 oder mehr Gran? Wo hätte man in den letzten
50 Jahren jemals so einen Fang gemacht? Schlagt Euch
den Gedanken aus dem Kopf, ausgerechnet in Belize
dieses Prunkstück zu finden.“
„Jeden Preis für ein fehlerloses Stück von 50 Gran.
Ihr könnt dabei verdienen… sagen wir einmal…“
Da stand Teokal an dem Tisch mit der Feinwaage und
den Durchleuchtungseinrichtungen und sagte: „Wir
haben gefunden, sind registrierte Perlenfischer, möch-
ten Euer Gnaden anbieten…“
Aus einem weichen Lederbeutel rollte die große Perle
auf den schwarzen Samt der Prüfschale.
Simonides ließ zwei kräftige elektrische Strahler auf-
blinken, faßte mit zitternder Hand nach den Pinzetten
und stieß dann einen Schrei der Überraschung aus.
„Equester, kein Wort mehr über Preise… wir zahlen,
was verlangt…“ Mehr brachte er nicht aus seiner trok-
kenen Kehle heraus. Er legte die Perle auf die Waage,
stellte ein Gewicht von 84 Gran fest, schraubte sie vor-
sichtig in die Halter des Durchleuchtungsgerätes und
sagte nach langem Schauen und Prüfen: „Beste Natur-
ware… sehr kräftiger Mantel! Wird sich jahrhunderte-
lang tragen lassen!“ Er reichte das Gerät dem Gast, der
lange durch das Prismenrohr starrte und endlich fest-
stellte: „Ich wußte doch, daß ich bei Simonides in Be-
lize die Ware finden würde. Gemacht?“
Stumm schlug der Perlenhändler in die dargebotene
flache Hand ein und wandte sich dann zu den beiden
Ferrentes: „Eine ausgefallene Sache, Freunde! Wird
gar nicht mehr gefragt, so ein Riesenknollen. Was habt
ihr euch als Preis gedacht, Brüder aus Nabisco?“
Teokal zögerte einen Augenblick, dann sagte er fest:
„5000 Pfund, ohne zu handeln! Mister Simonides, Ihr
wollt verdienen, der Herr dort will verdienen. Uns Per-
lenfischern wird jedoch, obgleich wir Tausende sind,
nur einmal in 50 Jahren so ein Prachtstück geschenkt.
5000 Pfund für die Fischereigenossenschaft Payo Na-
bisco.“
Der Perlenhändler wollte eben zu handeln beginnen,
da sah er, wie der Gast aus London leicht den Kopf
schüttelte und dann zehn Finger hob. Er seufzte: „Prei-
se fordert Ihr Ferrentes, Preise! Aber gut, der Tag ist
heute so schön, und ein lieber Gast ist gekommen…
sollt das Geld haben! Hier ist der Scheck, holt euch das
Geld bei der Überseebank ab. Sie schließt in einer
Stunde! Also hopp!“
Als die beiden Indios, verwundert über den kurzen
Handel, den Raum verlassen hatten, schob Simonides
dem Londoner Geschäftsfreund die Wunderperle hin:
„Gemacht für 10 000 Pfund! Oder sollte ich Euch
falsch verstanden haben, Sir Equester? Und trotzdem
werde ich mich betrogen fühlen… unter 20 000 gebt
Ihr doch das Prunkstück nicht aus Eurem Tresor!“
„Das ist meine Sache, Simonides! Handeln heißt ver-
dienen und verdienen lassen. Wann geht das Flugzeug
nach Jamaika? Morgen erst? Dann schweigt bis nach
meinem Abflug von unserem Geschäft. Mit einer sol-
chen Perle in der Tasche fühle ich mich selbst im Hau-
se des Gouverneurs von Britisch - Honduras nicht
sicher .“
Die beiden Ferrentes achteten auf dem Wege zur
Bank kaum auf die Menschen, die ihnen begegneten –
Braune, Schwarze und Weiße. Vater Juan machte Plä-
ne: „Teokal, wir kaufen sofort den Motorkutter bei
dem Ford-Vertreter. Das ist der Anteil, den die Genos-
senschaft zu erhalten hat. 3000 Pfund will er haben…
Aber wir zahlen den Preis nur, wenn er das Boot
nochmals gründlich überholen läßt!“ forderte Teokal.
„Jago Savedra, der Schiffsbauer, wird dann an der Pro-
befahrt teilnehmen. Er ist ein ehrlicher Mann und wird
uns sagen, welche Mängel noch beseitigt werden müs-
sen.“
„Und wo lassen wir das viele Geld inzwischen“, frag-
te Juan.
„Auf der Bank! Wir nehmen nur soviel, wie wir
brauchen: für den Arzt, für die Einkäufe, für den Be-
triebsstoff… 200 Pfund werden reichen. Den Motor-
kutter bezahlen wir mit einem Scheck…“
Der Vater sagte stolz: „Wie du alles kennst. Ja, wenn
ich auch schreiben könnte. Ein Wunder wahrhaftig,
daß es dir gelungen ist, mich lesen zu lehren.“
Auf der Übersee-Bank hatten die beiden Mayas ein
wahres Verhör zu bestehen, ehe ihnen ein Konto einge-
richtet wurde. Erst als Teokal erklärte, die Westindia-
Bank liege ja nur um die Ecke, und die würde froh
sein, neue Kunden mit so ansehnlichen Geldmitteln zu
bekommen, wurde ihm ein Scheckheft ausgehändigt.
Als der Kassierer umständlich den Gebrauch erklären
wollte, füllte der junge Ferrentes bereits ein Formular
aus und ließ sich 200 Pfund auszahlen. „Sie werden
sich daran gewöhnen müssen, Sir, daß auch wir Einge-
borenen Ihre Kunden werden. Auf die Besonderheiten
des britischen Scheckrechtes brauchen Sie mich nicht
hinzuweisen.“
Vor der Bank stellte sich den beiden Indios ein zehn-
jähriger Junge in den Weg, nur mit einem ärmellosen
Hemd und einem Hüfttuch bekleidet. Das schmale,
abgezehrte Gesicht erzählte noch mehr von seinem
Elend als die Fetzen, die seine Kleidung darstellten.
Juan rief überrascht aus: „Da schau, Pablo Chinchano!
Deine Freunde in Payo Nabisco sehnen sich nach dir.
Warum kehrst du nicht in deine Heimat zurück?“
„Ich kann den Großvater nicht allein lassen!“ erklärte
der Junge. „Und daheim würde man auf mich mit Fin-
gern zeigen, weil ich aus dem Geschlecht der Kaziken
stamme. Wenn er stirbt… vielleicht kehr’ ich dann
zurück. O Teokal, keine glückliche Stunde habe ich
gehabt, seit ich von den blauen Fluten der Chetumal-
Bai Abschied nahm.“ Er wollte die Geldscheine nicht
nehmen, die ihm der junge Ferrente in die Hand drück-
te. „Wozu? Damit sie der Großvater vertrinkt? Hat er
gewußt, daß ihr in der Stadt seid? Er hat mich ausge-
schickt, euch zu suchen. Aber ich sollte mich nicht von
euch erblicken lassen. Kennt ihr Kururu, den Mann mit
der Machete?“
Die beiden Mayas schüttelten den Kopf. Der kleine
Chinchano fuhr fort: „Ein böser Mensch! Er steht dort
drüben an der Wappensäule, dahinter hat sich Großva-
ter versteckt. Sie haben gesagt, ich soll euch über den
Gouverneursplatz führen, damit Kururu die Spur auf-
nehmen kann. Geht nicht dorthin. Der Mann mit der
Machete denkt schlimm und tut schlecht.“
Sie standen dort, wo sich die Hauptstraße zum zwei-
ten Hauptplatz verbreitert. Teokal spähte durch das
Menschengewühl zu der hohen Säule hinüber, vor der
ein Springbrunnen seine Wasser in die heiße Luft warf.
„Entspring, kleiner Freund Pablo! Sage, du hättest uns
nicht gefunden. Ist der Mulatte dort der böse Kuru-
ru?… Ein Casco will er sein? Höre, erlausche, was der
Bursche vorhat. Du triffst uns eine Stunde nach Son-
nenuntergang im Speisehaus ,Göttlicher Mais’ in der
Entrada. Überlege dir inzwischen, ob du nicht mit uns
nach Payo zurückkehren willst. Wir kaufen heute das
schönste Motorboot an der ganzen Küste, und einen
fleißigen Decksboy könnte die Fischereigenossenschaft
noch gebrauchen!“
Ein dankbares Aufleuchten in den sanften Schwarz-
augen, dann war der kleine Kerl im Menschengedränge
verschwunden.
„Er wird Schläge ernten!“ sagte Juan bekümmert.
„Hier macht man Kinder zu schlechten Menschen. Da,
schau hin, jetzt kriecht der alte Chinchano aus seinem
Versteck, und nun schlagen sie den schwachen Pablo.
Noch nie hat man gehört, daß ein Maya ein Kind prü-
gelte. Sollen die Jungen nicht besser werden als die
Alten? Armer Pablo!“
Kopfschüttelnd schritt er neben seinem Sohne Teokal
her, der einen Umweg einschlug, um die prunkvollen
Geschäftsräume der Ford-Vertretung am Gouverneurs-
platz zu erreichen.
Sie waren hier keine Unbekannten. Ein schlaksiger
Yankee winkte ihnen herablassend zu und quetschte
neben seiner Frage nach Wohlbefinden und Ge-
schäftsaussichten das Angebot heraus: „Der Kutter mit
dem schweren Motor also, meine Freunde? Immer
noch zu haben, für rund 3000 Pfund, bei Barzahlung,
versteht sich!“
„Werdet auch mit zweieinhalb zufrieden sein, Mister
Armour!“ begann Teokal sehr kühl die Verhandlung.
„Wir möchten aber endlich zum Ziel kommen. Für
3000 ist das Motorboot hier in Belize nie und nimmer
an den Mann zu bringen. Für die feine Gesellschaft
entwickelt es zu geringe Geschwindigkeit, macht zu-
viel Lärm und stinkt zu sehr nach Schweröl. Die Fi-
schereigenossenschaft Payo Nabisco aber würde über
diese Mängel, auch über die im Bau, hinwegsehen,
wenn sie es mit 2500 Pfund kaufen könnte. 2500 Pfund
heute noch bar auf den Tisch, wenn Ihr Euch verpflich-
tet, die Kosten der Generalüberholung zu übernehmen.
Jago Savedra soll als Treuhänder feststellen, was ver-
bessert werden muß.“
„2500 Pfund bar auf den Tisch?“ Der Ford-Vertreter
kniff seine wasserblauen Augen zu schmalen Schlitzen
zusammen. „Das müßte ich erst einmal sehen! Oder
habt ihr an den Ufern der Chetumal-Bai den Schatz der
Mayas gefunden?“
Teokal legte das Scheckbuch auf den Tisch, füllte die
Anweisung aus und setzte schwungvoll seinen vollen
Namen darunter. „Rufen Sie die Obersee-Bank an, ob
er Deckung hat. Unseren ehrlichen braunen Gesichtern
glauben Sie ja doch nicht. Und dann haben wir noch
eine Stunde Zeit, um vor Sonnenuntergang die Probe-
fahrt durchzuführen. Bitte, 2500 Pfund… wenn Sie
nicht wollen, fahren wir morgen nach Yzabal in Gua-
temala. Dort können wir für denselben Preis einen bes-
seren Seekutter bekommen.“
„Moment!“ stotterte der Vertreter, und nachdem er
vom Telephon zurückgekommen war, wurde das Ge-
schäft abgeschlossen. „Aber halbe-halbe bei der Über-
holung. Mehr als 100 Pfund werden wir nicht teilen
müssen.“
Ehe noch die Sonne sank, war in dem Städtchen Beli-
ze der Kauf des Seekutters das Gespräch des Tages.
Als die beiden Ferrentes das Speisehaus „Göttlicher
Mais“ beiraten, blickten sich alle Gäste nach ihnen um,
weil sie neugierig waren, die Männer zu sehen, die
über so viel Geld verfügen konnten. Nur Indios und
Mestizen verkehrten hier, wo es die besten Tortillas
und Enchilladas in Belize gab.
Juan Ferrente trank einen Krug Fruchtpunsch dazu,
dem er selbst ein Glas Rum beigefügt hatte. Teokal
hatte sich an der Sodafontäne ein Getränk aus eisge-
kühltem Bananenbrei und Selterswasser mischen las-
sen. Zwischen den einzelnen Bissen nahm er sparsame
Schlucke und schüttelte den Kopf zu den Empfehlun-
gen des diensteifrigen Kellners, der nicht genug Wun-
derwässer anbieten konnte.
„Reiche Leute müssen auf ihren Verstand achten,
Freund!“ sagte er. „Weder Rum noch Gin, noch Bran-
dy werden jemals meine Lippen befeuchten. Auch
Maisbier oder Pulque will ich nicht haben. Eure En-
chilladas sind herrlich, der Trank ist labend und küh-
lend. Warum sollte ich mehr begehren?“
Der Besitzer des Speisehauses, kam selbst an den
Tisch und sagte vertraulich: „Man spricht von großem
Glück beim Perlentauchen. Ich würde keinem alkoho-
lisches Getränk aus Agavensaft das Glück mehr gön-
nen als euch. Doch euer Reichtum erweckt den Neid
und die Begierden…“
Teokal lachte über die Bedenken: „Gerüchte, Freund!
Wir haben Perlmutt und kleines Pinkperlenzeug ver-
kauft, und das Geld ist schon wieder weitergewandert.
Wenn ein Indio sich bei dir ein einziges Mal im ganzen
Jahr Enchilladas leisten kann, dann halten ihn die
Schwätzer von Belize für unermeßlich reich. Du kannst
uns aber noch eine Platte backen lassen. Wir bekom-
men Besuch!“
Der Enkel des Kaziken war durch die Hintertür einge-
treten und sah sich suchend um. „He, Pablo, komm und
nimm an unserer Mahlzeit teil!“ Sie schoben ihm Be-
cher und Teller hin; doch obgleich die Augen begehr-
lich aufleuchteten, wollte er nicht Platz nehmen. Er
flüsterte: „Der Kazike und Kururu sind auf dem Wege
hierher. Großvater weiß doch, wo die Männer aus Payo
Nabisco einkehren, wenn sie nach Belize kommen.
Könnt ihr von hier nicht verschwinden?“
Juan Ferrente lachte: „Du bist ängstlich wie ein Gek-
ko im Hüttendach! Kann ich mit unserem früheren Ka-
ziken nicht mehr in derselben Hütte sitzen? Und mit
Kururu haben wir nichts zu schaffen!“
Der Kleine sah sich scheu um: „Sie haben Böses vor,
die beiden. Sie haben von eurem Reichtum gehört…
die ganze Stadt spricht davon. Laßt sie kein Geld se-
hen!“ Dann eilte er von dannen.
Juan seufzte: „Wenn wir nur erst wieder in Payo Na-
bisco wären! Oder ob sich Pablo einen Spaß mit uns
macht?“
Sein Sohn schüttelte den Kopf. „Er scherzt nicht. – In
drei Tagen soll erst das Motorboot fertig werden? Wir
sollten nicht in Belize bleiben. Vater, du willst doch
schon lange deinen Bruder in Tikal besuchen. Wenn
wir morgen mit dem ersten Autobus bis Oranje Walk
fahren, dann könnten wir vor dem Abenddämmern in
Tikal sein. Die Jaguare in den großen Wäldern sind
nicht so gefährlich wie die Banditen in Belize.“
„Du hast recht, mein Sohn. Mein Bruder Carlos hat
nie wegen meiner Schuld gedrängt. Er wird das Geld
aber gebrauchen können, um neues Land zu kaufen.
Drüben in Guatemala hat die United Fruit-Company
alles Land an den Staat zurückgeben müssen, das sie
nicht selbst bebaut.“
„Weil unsere Brüder sich auf ihre eigene Kraft, be-
sannen. Fast 100 000 Hektar können nun an die landlo-
sen und landarmen Bauern verteilt werden. Ich möchte
gern das neue Leben in Tikal kennenlernen.“
„So fahren wir morgen bei Sonnenaufgang. Die gute
Luft in den Bergen wird mir Erleichterung schaffen.“
Der alte Juan nahm eine neue Enchillada von der Platte
und wollte sie zum Munde führen. Da blitzte es plötz-
lich silbern vor seinen Augen, und genau in der Mitte
getroffen, fiel ein Teil des Backwerkes auf den Tisch
zurück. Verblüfft starrte er auf das Stück, das er noch
in der Hand hielt. Ein schallendes Gelächter ließ ihn
aufblicken. Vor ihm stand Kururu und schwang seine
meterlange Machete wirbelnd über seinem Haupte.
„Gut getroffen, alter Ferrente!“ lachte der Casco. „Da
staunt ihr Leute aus Nabisco! Soll ich dir eine Haar-
strähne vom Kopfe säbeln, ohne deine verdammte
Kopfhaut zu ritzen?“
Teokal stellte sich vor seinen Vater: „Laß die Scher-
ze, Mann mit der Machete! Sonst könnte leicht der Fall
eintreten, daß du zum letzten Male mit dem Buschmes-
ser herumgefuchtelt hast.“
„Kururu macht, was er will!“ höhnte der Bandit.
„Deine Nase gefällt mir nicht, kleiner Teokal. Soll ich
dir ein klein winzig bißchen wegschnippeln? Vielleicht
wird sie dann hübscher!“ Die Machete wirbelte jetzt
dicht vor dem Gesicht des jungen Ferrente. Da duckte
sich der junge Mann blitzschnell, seine Hände faßten
den rechten Arm des Zudringlichen, ein kurzer Ruck,
und aufschreiend stürzte Kururu zu Boden. Die Mache-
te entfiel der kraftlos gewordenen Hand. Von den an-
deren Tischen stürzten jetzt Indios herbei, packten den
Friedensstörer und schleppten ihn zum Ausgang. Teo-
kal rief dem Schreienden nach: „Ich habe dir nur den
Arm ausgerenkt, Kururu! Willst du mich aber noch
einmal mit deiner Machete erschrecken, dann breche
ich deinen Arm zweimal, über der Handwurzel und
über dem Ellenbogen, damit dir für alle Zeiten das Ge-
fuchtel mit dem Buschmesser vergeht. Betrunkene und
Feiglinge kannst du mit deinen Künsten erschrecken,
aber keinen Maya, der die alten Ringergriffe kennt!“
Vater Juan freute sich: „Man sieht es deinen Händen
nicht an, wie sie zupacken können. Man hört den Kerl
noch draußen auf der Straße brüllen. Nun, es wird sich
schon ein Barmherziger finden, der ihm den ausgeku-
gelten Arm wieder in Ordnung bringt. Aber zehn Tage
wird er friedliche Menschen nicht belästigen können. –
Ob das nur Scherz war?“
„Er wollte Streit suchen. Jetzt wird ihm die Lust ver-
gangen sein. Mit dem Kaziken hätte ich noch gern ein
ernstes Wort gesprochen. Aber er verschwand wie der
Blitz, als der Bandit die Erde küßte.“
Der Gastwirt schlich mit hängendem Kopf herbei.
„Schnell greift die Jugend zu!’’ sagte er kopfschüt-
telnd. „Eigentlich hat der Casco ja nur einen Scherz
gemacht. Vielleicht wäre er wieder gegangen, ohne
daß etwas geschehen wäre. Nun aber werden die Ban-
didos kommen und Kururu rächen… Er hat viele
Freunde, der Mann mit der Machete, große und mäch-
tige darunter, die ihre Hände über ihn halten, damit
kein Polizist an ihn heran kann. Wenn ihr hier bleibt,
wird heute noch Blut fließen!“
Vom Nebentisch riefen einige Gäste: „Du bist ein
Feigling, Jago! Dankbar mußt du dem jungen Ferrente
sein, weil er den Banditen so schnell auf die Diele ge-
legt hat. Seine Freunde sollen sich nur hierher wagen!
Wir Holzschläger aus den Kordilleren werden sie
heimschicken, daß sie das Wiederkommen vergessen!“
„Und dabei geht die Einrichtung meines Gasthauses
zu Bruch, wenn sie nicht gar Feuer in die Grasdächer
werfen“, jammerte der Besitzer des „Göttlichen Mais“
„Ihr wollt uns also loswerden?“ fragte Teokal. „Gut,
macht die Rechnung fertig. Aber laßt es Euch gesagt
sein: Es ist eine Schande für ganz Belize, daß ehrliche
Menschen vor Banditen weichen müssen!“
„Bravo!“ schrie es vom Nebentisch herüber. „Wo die
Ferrentes nicht erwünscht sind, wollen wir auch nicht
bleiben. Ihr Freunde aus Payo Nabisco, kommt mit
uns! Nach Oranje Walk wollt ihr? Dahin müssen wir
auch. Unser Lastwagen steht vor der Tür. Also fahren
wir!“
Es war ein großes Opfer, das ihnen die Holzfäller aus
den Kordilleren an der Grenze zwischen Britisch-
Honduras und Guatemala brachten. Sie fällten dort in
den kaum zugänglichen Bergwäldern für die britische
Mahagoni-Gesellschaft die tropischen Edelhölzer und
kamen nur alle Vierteljahre einmal nach Belize. Wenn
sie jetzt ihren Aufenthalt in der Hauptstadt verkürzten,
so verzichteten sie auf vieles, was sie oben in den Ber-
gen niemals finden konnten. Doch die Indios, Neger
und Mulatten lachten nur, als Teokal sie bat zu bleiben.
„Wir haben genug von Belize, und außerdem geht un-
ser bißchen Geld zu Ende. An den Holzschlägerfeuern
hat man erzählt, wie tapfer ein Ferrente für die Rechte
aller Farbigen gegen die weißen Herren eingetreten ist.
Wir helfen uns selbst, wenn wir euch helfen!“
Der Lastwagen war ein jämmerlicher Rumpelkasten.
Doch er setzte sich nach einigen donnernden Fehlzün-
dungen in Bewegung und schwankte mit der fröhlichen
Fracht auf der Ladepritsche die Straße hinauf, gerade
in dem Augenblick, als ein tobender Haufe aus einem
Seitengäßchen gegen das Gasthaus „Göttlicher Mais“
hervorbrach.
„Höchste Zeit!“ brummte ein untersetzter Indio. „Die
Bandidos von Belize sind schon mobil. Da scheinen
gewichtigere Leute als der freche Kururu am Werke zu
sein. Dem Jago vom ,Göttlichen Mais’ wird alle Feig-
heit nichts nützen!“
Und damit hatte er recht. Nicht einmal die Sodafontä-
ne im Speisehaus blieb verschont, und erst als die Ban-
diten erfahren hatten, wo die Ferrentes geblieben wa-
ren, verließen sie die Trümmerstätte, um die Verfol-
gung aufzunehmen.
Davon ahnte die Reisegesellschaft auf dem alten
Lastwagen nichts, als dieser durch die eintönigen Ba-
nanen- und Pampelmusenkulturen des Tieflandes roll-
te. Große Geschwindigkeit gab der Motor auf der holp-
rigen Straße nicht her, und als die ersten Kurven in den
Vorbergen durchfahren waren, dampfte der Kühler,
und aus dem Verschluß zischte es in langen Strahlen.
„Bis Wipers Row noch!“ schrie der Chauffeur aus
dem Fahrerkasten. „Dann müssen wir Pause machen,
am besten wohl bei dem alten Mironda. Der hat be-
stimmt noch etwas für uns Holzschläger und ist nicht
böse, wenn wir ihn aus dem Schlaf klopfen!“
Wipers Row war eine kleine Indiosiedlung am Fuße
der Grenzkordilleren. Hier regierte weder die Fruit-
noch die Mahagoni-Gesellschaft. An dem aus-
gebeuteten Buschwalde hatten beide kein Interesse,
und so konnte hier unbehindert eine kleine Dorfgenos-
senschaft ihren Mais und ihre Bataten bauen. Vorsteher
war Mironda, der sich der Herkunft von kühnen karibi-
schen Seefahrern rühmte, obgleich er jetzt zwischen
dem Tiefland und den Bergen ein einfaches Gasthaus
betrieb. Die Briten glaubten, in ihm einen ergebenen
Untertanen der Kolonialherrschaft gefunden zu haben.
Die Bewohner der unwegsamen Grenzgebirge und die
ausgebeuteten Arbeiter der Bananenplantagen wußten
aber, daß sie dem Alten voll und ganz vertrauen konn-
ten.
Als der Lastwagen keuchend und polternd vor Miron-
das Hütte hielt, kam der Wirt aus dem Patio, dem Hof,
herbeigeschlurft und stellte zunächst einmal, mit den
Augen blinzelnd, fest, wer seine späten Gäste sind.
Er krächzte: „Eingetreten, liebe Freunde! Soeben er-
hielt ich Botschaft von eurem Kommen. Ihr habt gute
Menschen mitgebracht, ihr Holzwürmer von der Ma-
hagoni? Recht so, die tapferen Ferrentes wollte ich
schon lange kennenlernen. Seid willkommen, Juan und
Teokal Ferrente!“
Der alte Perlenfischer fragte überrascht: „Aber woher
weißt du, wertester Mironda, daß wir mit den Freunden
Holzschlägern gefahren sind?“ Er sah sich aufmerksam
um. „Ich sehe keinen Draht, der zu dieser Hütte führt.
Also kann keiner über ihn zu dir gesprochen haben.“
„Was brauchen wir die Künste der Weißen, wenn wir
andere besitzen!“ erwiderte der alte Indio. „Rühmt ihr
Ferrentes euch nicht der Herkunft von den weisen
Mayas? Habt ihr nie etwas von dem Kambarysu ge-
hört, von dem Geheimnis des Trommelschalls, der –
unhörbar dem Uneingeweihten – dem Wissenden ver-
kündet, was in der Ferne geschieht?“
Teokal rief verwundert aus: „Steht hier ein Kambary-
su? Ich weiß, wie er gebaut wird. Aber ich habe noch
keinen in Tätigkeit gesehen. Die große Kunst ist bei
uns in Payo Nabisco verlorengegangen.“
„Dann wird es Zeit, daß ihr sie wieder lernt!“ Der alte
Karibe winkte den beiden Ferrentes, ihm zu folgen. Zu
den Holzschlägern sagte er: „Ihr wißt, wo ihr Labe für
euer schweres Leben findet. Bedient euch und folgt
uns in den Patio, ohne Lärm zu machen. Ich erwarte
neue Botschaft über Kururu und seine Bande. Vorläu-
fig grölen sie noch besoffen in Belize, weil sie zuviel
im ,Göttlichen Mais’ getrunken haben. Der geheime
Kambarysu meines Freundes Telteke in Belize will mir
genau die Stunde der Abfahrt melden.“
„Sie wollen uns in die Kordilleren folgen?“ fragte Ju-
an erschrocken.
„Gern tun sie es nicht!“ berichtete Mironda. „Nur die
allerschlimmsten Banditen von Belize hat der Mann
mit der Machete für das Abenteuer werben können.
Warum hast du dem Lumpen nicht die Knochen gebro-
chen? Er kann zwar mit seiner Rechten nicht mehr die
Machete schwingen, aber die Mäquina, die Pistole,
regiert er mit der Linken. Zertreten soll man solches
Gewürm wie den giftigen Tausendfuß. Junger Teokal,
hast du das noch nicht gelernt?“
Sie hatten inzwischen den Hof des Rasthauses er-
reicht. Schwaches Licht fiel von Mond und Sternen
herab. Mironda hob von dem Brunnenaufsatz eine Le-
derdecke ab, schraubte schnell die Wasserröhre aus
und hockte sich dann am Rande des Beckens nieder.
„Ich muß meinen Kambarysu vor den Augen der Spä-
her verbergen. Am Tage fließt hier das kühle Bergwas-
ser in die Brunnenschale. Doch nachts bringt mir der
klingende Baum die Nachrichten aus Belize und den
Kordilleren, aus Britisch-Honduras und Guatemala.
Hundert wohl sitzen im Verborgenen am Kambarysu
und geben Botschaft. Und wie also baut man den
Kambarysu?“ wandte er sich an Teokal.
Der berichtete eifrig: „Eine Erdgrube muß man aus-
heben, deren Seiten genau nach den Himmelsrichtun-
gen weisen, zwei Meter tief, bis man auf den gewach-
senen Grund stößt. Dann füllt man in Schichten Kiesel,
zerstoßene Knochen, Tierhaare – die vom Jaguar sind
die besten –, roten Pfeifenton, feinen Bachsand und
angeglühte Holzkohle um einen ausgehöhlten
Stamm…“
„Von welchem Baume?“ fragte der Wirt.
„Die Briten nennen ihn Eisenholz… wir Kambarysu!“
„Gut, mein Sohn! Vergiß aber nicht, daß die tönenden
Stämme gleichaltrig sein müssen. - Schweig! Er be-
ginnt zu sprechen.“
Sie neigten alle drei die Köpfe über die Grube, und da
vernahmen sie ein tönendes Summen und leises Klop-
fen, wie aus einer Geisterwelt zu ihnen dringend. Mi-
ronda legte einen seiner löffelförmigen Schläger an
den ausgehöhlten Stamm und schien jetzt mit den Fin-
gern zu fühlen, welche Nachricht übermittelt wurde.
Ab und zu trommelte er kurze Wirbel auf das tönende
Holz, wenn eine Pause in der Übermittlung eintrat
Dann ließ er seine Hände in den Schoß sinken und
übersetzte die Botschaft aus Belize.
„Die Banditen von Belize haben von der United Fruit
einen großen Lastwagen erhalten. Sie streiten sich
noch um den Kopfpreis für euch beide… Eine wunder-
bare Perle soll in eurem Besitz sein, Brüder… Houston
Grebb verspricht sie dem Lumpengesindel… Kururu
macht trotz seiner Schmerzen den Spürhund… Die
Hafenpolizeiwache hat den Banditen Maschinenpisto-
len und Handgranaten übergeben… Betrunken wie die
Schweine in einer Rumfabrik sind sie jetzt abgefah-
ren… Richtung Wipers Row… In einer Stunde viel-
leicht können wir sie erwarten.“
Leise waren die Holzschläger näher getreten und hat-
ten mitgehört. Der untersetzte Indio bat: „Mironda, gib
Nachricht an unsere Brüder in den Kordilleren. Sie
möchten bereitstehen in den engen Straßenkehren von
Oranje Walk, nicht mit den schweren Äxten, nur mit
den Blasrohren und den Eisenholzbogen. Wir wollen
die Totschläger der United Fruit-Company gebührend
empfangen!“
„Wacht ihr endlich auf?“ rief der alte Wirt vergnügt.
„Macht ganze Arbeit, Brüder! Erst die Banditen aus
Belize, dann die Bluthunde der United Fruit und end-
lich die Rotröcke des britischen Gouvernements…
Dann sind wir sie los, die Blutsauger, und wir gründen
einen karibischen Freistaat, wo Recht nicht mehr Un-
recht heißt!“
Während Mironda auf dem tönenden Stamm zu
trommeln begann, um seine Nachrichten den lauschen-
den Freunden in der Nähe und in der Ferne zu über-
mitteln, fragte Teokal leise: „Werden sie hören?“
„Aufflammen wie das Feuer in den Glutbergen der
Kordilleren werden sie, wenn sie erfahren, daß es ge-
gen die Pest unseres Landes, gegen die United Fruit
geht. Da ist doch keiner in den Bergen, der nicht aus
der Sklaverei der UFC geflohen ist, Freund. Freiheit
oder Bananen! Heißt so nicht euer Losungswort? Dro-
ben in den Urwäldern der Kordilleren haben sie es
übersetzt: Freiheit oder Mahagoni… und Freiheit oder
Chicle. Die Holzschläger und die Chiclesucher werden
für Teokal Ferrente einstehen, als wenn es ihr Bluts-
bruder wäre, weil er es gewagt hat, den Kampf mit den
Dieben unseres Reichtums aufzunehmen.“
„Lobt mich nicht zu sehr!“ warf Teokal bescheiden
ein. „Ich habe nur das Recht unserer Dorfgenossen-
schaft zu verteidigen.“
„Aber du warst der erste, der nicht wie ein räudiger
Hund kuschte… Still… der Kambarysu sagt, die Ban-
diten haben Belize verlassen… Hinter ihnen her jagt
ein Wagen der Rotröcke, der Honduras-Polizei. Nein,
nicht um sie zurückzuholen. Der Polizeicaptain hat
befohlen: ,Die Empörer Vernichten! Zur größeren Ehre
Ihrer Majestät!’ Ich würde euch raten, aufzubrechen!“
Doch es dauerte lange, bis der Motor wieder an-
sprang. Als sie die ersten Kehren der Bergstraße über-
wunden hatten, sahen sie, wie sich die leuchtenden
Scheinwerfer zweier Wagen Wipers Row schnell nä-
herten. „Der Teufel soll den Karren holen!“ fluchte der
Fahrer. „Sie kriegen uns, noch ehe wir das erste Holz-
schlägerlager im Urwald erreicht haben. Companieros,
steht dort nicht Stahldorn am Hang?“
Als er bremste, schwangen sich bereits fünf Fäller
über die Seitenbretter, und der klirrende Axtschlag
verriet, wie sie dem Stahldorn zu Leibe gingen. Mit
blutenden Händen schleppten sie die Äste herbei, zer-
hackten sie und versenkten sie so in den Straßensand,
daß nur die Spitzen der eisenfesten Dornen aus den
Fahrspuren hervorragten.
„Fahr langsam!“ befahl einer. „Wenn sie ihr Wild so
nahe sehen, dann legen sie noch drei Zähne drauf, um
uns zu kriegen. Und das übrige werden die Stahldornen
besorgen.“
Der Fahrer erwiderte: „Laß deine klugen Ratschläge!
Der Karren will sowieso nicht mehr. Zweitausend Yard
schafft er vielleicht noch… aber dann sind wir mitten
im Urwald. Sollen uns dort erst einmal finden!“
Eine weitere Unterhaltung war nicht mehr möglich.
Der Motor dröhnte, als wollten sich jeden Augenblick
Kolben und Zylinder voneinander trennen. Pfeifend
schoß der Dampf aus dem Einfüllstutzen des Kühlers.
Einen Augenblick blieb das Fahrzeug in einer Spitz-
kehre stehen. Ein Indio rief: „Sie halten unten bei Mi-
ronda. Los! Bis zur Abzweigung nach Oranje Walk
wird es die ,Kaffeemühle’ wohl noch schaffen. Dann
fährst du geradeaus, und wir schlagen uns in den
Wald!“
„Wenn sie über die Stahldornsperre hinwegkommen!“
knurrte der Fahrer und trat noch einmal auf die Kupp-
lung.
Juan Ferrente bat: „Laßt uns aussteigen! Euch werden
die Lumpen nichts tun!“
„Uns nur die Knochen zerschlagen, wenn wir nicht
sagen, wo ihr geblieben seid“, schrie einer der Holzfäl-
ler. „Ihr Ferrentes, wir bleiben zusammen, und wir
werden die Banditen und die Polizisten heimschicken,
daß sie das Wiederkommen vergessen!“
Der Lastwagen keuchte weiter durch die Spitzkehren.
„Sie kommen!“ rief der Fahrer. „Über Mirondas Hüt-
tendach schlagen Flammen empor! O ihr verdammten
Hunde!“
„Rache für Vater Mironda!“ gellte es durch die Nacht.
„Die Brandbombe soll euch teuer zu stehen kommen!“
„Runter von der Ladepritsche!“ befahl der Chauffeur.
Er neigte sich weit aus der Kabine und starrte in die
Tiefe, wo die Lohe des Brandes immer höher schlug.
„Verdammte Hunde! Von Hunden gezeugt… nicht
wert, Menschengesicht zu tragen! – Alte Blechliese…
nur noch bis zur nächsten Spitzkehre!“ Das war an
seinen Wagen gerichtet. Ächzend und knatternd hol-
perte er die Steigung weiter hinauf, zum Kamm der
Kordilleren.
Die Holzfäller und die beiden Perlenfischer standen in
einer Lichtung und schauten hinab auf das Schlangen-
band der Bergstraße, das geisterhaft von dem zucken-
den Brande in Wipers Row beleuchtet wurde. Durch
die Kurven schossen die Lichter der beiden verfolgen-
den Kraftwagen. Ihnen schien die Steigung wenig aus-
zumachen. Nur in den Kehren wurde die rasende Hast
etwas gestoppt. Und mit 40 Meilen Geschwindigkeit
raste der vordere Wagen in die Zone, die mit den har-
ten Spitzen des Stahldorns verseucht war.
Die Beobachter sahen, wie der Wagen – durch die
platzenden Pneus – nach rechts und links geschleudert
wurde, vom gähnenden Schlund links weggerissen,
rechts gegen die Böschung prallte und sich langsam im
Lichtkegel der Scheinwerfer des folgenden Fahrzeuges
auf die Seite legte. Dann schoß eine grelle Stichflam-
me auf und beleuchtete ein Gewimmel von Körpern,
die sich über die Seitenbretter des Ladekastens
schwangen. „Fressen soll sie das Feuer!“ Ein Indio
schrie es durch die Nacht.
Juan Ferrente sagte leise: „Wenn es nach unseren
Wünschen gehen würde!“
Ein anderer setzte hinzu: „Brüder, nur eine Pause!
Der zweite Wagen hält vor der Sperre… Sie machen
die Straße frei. Daß ihnen die Hände verdorren möch-
ten! – Brüder, wir müssen gehen. Ob wir unsere
Freunde finden werden?“
Sie schritten im Indianermarsch, einer hinter dem an-
deren, den vernachlässigten Fahrweg hinauf, der hier
von der Hauptroute abzweigte. Über ihnen schloß sich
dicht das Gewölbe der riesigen Urwaldbäume, durch
deren Geäst kaum ein Mondstrahl dringen konnte.
Teokal verhielt den Schritt und lauschte: „Brüllaffen
schon hier an den Hängen der Kordilleren?“
Der Obmann der Holzschläger lachte auf: „Kleiner
Ferrente, du magst die Stimmen des Meeres kennen.
Von denen des Waldes verstehst du nichts. Sie sind
nahe, unsere Helfer, die besten, die wir uns denken
können… Waldindios; freie Männer im wilden Ge-
strüpp. Mironda hat sie mit dem Kambarysu gerufen.
Ich antworte!“
Er legte beide Hände zu einer Muschel vor dem Mund
zusammen und schrie unverständliche Worte hinein.
Der Schall brach sich unter den Wipfeln der Baumrie-
sen, und das Getön klang weit die Hänge empor.
„Schneller!“ mahnte der Obmann. „Unser Wagen hat
keine Fahrt mehr. Geklapper und Ächzen sind ver-
stummt. Nun brummt der Feind die letzte Kehre her-
auf. Die Götter des Waldes sollen ihn mit Blindheit
schlagen!“
Wie Trauben hingen rechts und links an dem Alarm-
wagen der Belizer Polizei die Gefährten Kururus, die
nach der Havarie ihres Fahrzeuges noch kampffähig
waren. Der Casco, der neben dem Fahrer saß, fluchte
aus Leibeskräften über die unwillkommene Überra-
schung. „Drei Armbrüche und ein Schenkel kaputt!
Wer bezahlt mir den Schaden, den meine Bande erlit-
ten hat? Die Ferrentes etwa? Hier beginnt der Urwald,
und wenn sie ausgestiegen sind, dann können wir sie
suchen, bis – halt! Bremse schneller, Schurke von Po-
lizist! Zurück den Wagen bis… hierher!“
Er sprang aus dem Fahrerhaus und beugte sich stöh-
nend zur Erde. „Da, eine Machete, wie sie die Holzfäl-
ler gebrauchen… und hier sind viele Stapfen im Sand!
Die Narren wollen uns irreführen? Wenn ihr auch Ku-
rurus Schulter verrenkt habt, seine Augen habt ihr
nicht stumpf gemacht. Dort, den Weg am Hang hinauf
haben sie genommen. Sie stecken in der Falle. Über
die Schlucht bei den Wasserfällen von Walk-River
kommen sie nicht mehr hinaus. Macht die Mäquinas
klar und schießt jeden zum Sieb, der im Scheinwerfer-
licht zu erkennen ist!“
Mit wildem Geheul begrüßten seine Gefährten die
Weisung. Langsam rollte der Wagen in den düsteren
Tunnel, den die Urwaldbäume bildeten. Tausend Yard
waren erst zurückgelegt, da zog der Fahrer die Brem-
sen und erklärte: „Aus mit der Tour! Das Gestrüpp
wickelt sich um die Achsen, die Fahrbahn wird sump-
fig. Möchte nicht tausend Fuß seitwärts abrutschen.
Raus mit euch, Burschen. Hier kommt man nur noch
zu Fuß vorwärts!“
„Feigling!“ keifte Kururu. „Wenn ihr Rotröcke nicht
wollt, werden wir euch mal zeigen, wie der Wolf die
Schäflein aus dem Walde holt!“
Die Polizisten blieben sitzen. Die Banditen machten
ihre Pistolen und Maschinenpistolen schußfertig und
folgten Kururu, der wie ein Spürhund den Fährten –
deutlich gekennzeichnet durch umgetretene Gräser und
geknickte Schößlinge – nachging. „Nicht zögern…
sofort schießen, wenn ihr ein Ziel seht!“ wies er die
Mitglieder seiner Bande an. „Keine Furcht! Was wer-
den sie schon haben? Einen verrosteten Colt oder al-
lenfalls eine Pistole mit sieben Patronen. Gefährlich
werden können uns nur die Macheten. Daher knallt ab,
was ihr auf dem Wege seht!“ Er lauschte und fuhr fort:
„Sie haben die Brüllaffen aufgescheucht, kreischen wie
Satanas im Schwefelbade. Die verdammten Söhne der
Hündinnen werden bald selber so schreien, wenn sie
fünf Lot Blei im Bauche haben! Was hast du, Pargan?“
Ein riesiger Schwarzer neben ihm schrie, als sei ihm
ein Spieß durch den Leib gerannt worden. Der Casco
ließ seine Stableuchte aufflammen. Im Oberschenkel
seines Gefährten steckte ein meterlanger Pfeil, mit
Geierfedern geschäftet, der das Bein fast durchbohrt
hatte. Während Kururu noch verblüfft auf die Wunde
starrte, aus der stoßweise das Blut drang, brüllte bereits
ein zweiter Bandit auf. Ein Pfeil hatte sich in seine
rechte Schulter gebohrt Die Widerhaken saßen fest,
und das Geschoß ließ sich nicht entfernen, so sehr auch
der Getroffene an dem Schaft rüttelte und zog.
„Schießt!“ schrie Kururu mit überkippender Stimme.
„Waldindios… Zerschmettert die Burschen!“ Die Ma-
schinenpistolen knatterten, einige Wurfgranaten flogen
in die pechschwarze Finsternis des Unterholzes, zer-
sprangen donnernd, und ein morscher Urwaldriese
brach prasselnd und dröhnend zusammen. Aus den
Baumwipfeln höhnten aufgeregte Brüllaffen.
„Vorwärts, drauf auf die Lumpen!“ befahl Kururu. Er
hatte sich vorsichtig in den Hintergrund zurückgezo-
gen. Als er aber jetzt seine grelle Stableuchte aufflam-
men ließ, sah er, daß alle seine Helfer Deckung hinter
den Stämmen oder in dem dichten Gebüsch gesucht
hatten. Und da klangen neue Schmerzensschreie auf.
Ein Bandit brach zusammen, von einem Pfeil mitten in
die Brust getroffen; einem anderen wurde von dem
lautlosen Geschoß die Wange aufgerissen.
Schnell knipste Kururu seine Leuchte aus; aber die
unsichtbaren Schützen hatten ihn schon erspäht. Er
hörte ein leises Sirren und verspürte einen leichten
Schlag gegen den dicken Schulterverband, der das aus-
gekugelte Gelenk schützte. Als er mit zitternden Hän-
den dorthin tastete, fühlte er einen halbspannenlangen
Holzsplitter, dessen Ende ein kleines Federbündel um-
gab. Dem Mann mit der Machete lief es kalt über den
Rücken. Das war ein Geschoß aus einem Blasrohr,
sicher vergiftet mit dem todbringenden Harz, das die
Waldindianer aus den Giftbäumen der Kordilleren zu
gewinnen verstanden. Er hob seine Pistole und schoß
sinnlos das ganze Magazin leer; denn in der lastenden
Dunkelheit war kein Ziel zu erkennen. Dann rannte er
geduckt zurück, dahin, wo er den Polizeiwagen wußte.
Immer wieder glaubte er das unheimliche Sirren win-
ziger Geschosse zu hören. Er war froh, als er die
Scheinwerfer hinter der Bergnase aufleuchten sah.
Es waren mehr geworden. Ein zweiter Alarmwagen
der Honduras-Polizei hatte sich hinzugesellt, und zwi-
schen beiden stand – zusammen mit dem Polizei-
hauptmann – Mister Houston Grebb, der sich von dem
bisherigen Verlauf der Jagd berichten ließ. Sein Wagen
hatte Pech gehabt. Er war an einer Sumpfstelle des
Weges bis über die Achsen eingesunken. Fluchende
Rotröcke bemühten sich, ihn wieder herauszuziehen.
Houston Grebb hatte das Knallen der Pistolen und das
Krachen der Wurfgranaten gehört Er schien mit dem
Verlauf nicht einverstanden zu sein. „Da vorn wider-
setzt man sich offenkundig unseren Hilfskräften. Ich
kalkuliere, nun müßte Ihrer Majestät Honduras-Polizei
an die Front, um den letzten Widerstand zu brechen.“
„Es sind zwanzig Schwerbewaffnete bei Kururu. Die
werden wohl mit den paar Holzschlägern und den bei-
den Ferrentes fertig werden“, erwiderte der Polizei-
hauptmann. „Aber da kommt ja… natürlich… Kururu!
He, Bursche, was habt ihr da vorn wie wild zu knal-
len?!“
Der Mann mit der Machete lehnte schwer atmend an
dem ersten Wagen. Die Wartenden sahen, daß sein
Gesicht aschgrau war. Mühsam formte er die Antwort:
„Waldteufel gegen uns… hier…“, und er hielt den
Weißen den winzigen Blasrohrpfeil entgegen. „Schaut
nach, ob meine Haut geritzt ist!“ Wild zerrte er an den
Binden des Verbandes. „Hier traf es mich…“
Er hatte Glück gehabt. Keine Ritzstelle war auf der
Geschwulst zu erkennen. Mit größerer Fassung berich-
tete er weiter: „Pfeile aus dem Walde… aber kein Bo-
genschütze zu erkennen. Jetzt kommen sie noch mit
Blasrohren… Haut ab, wenn euch euer Leben lieb ist!“
Der Polizeihauptmann machte ein ernstes Gesicht:
„Suchscheinwerfer einschalten!“ befahl er. „Aus-
schwärmen! Feuer auf alles, was sich im Walde zeigt!“
Dann wandte er sich zu Grebb: „Ein verdammter Zau-
ber, in den wir hineingeraten sind. Eisenholzbogen und
Blasrohre sind im Urwald gefährlicher als Maschinen-
gewehre und Haubitzen: kein Abschuß zu hören, kein
Schütze sichtbar. Viele Verluste da vorn?“ wandte er
sich an Kururu.
„Sie fallen wie die Fliegen!“ ächzte der Casco.
„Schickt Unterstützung… oder ihr werdet keinen Mann
aus meiner Bande mehr wiedersehen!“
„Was das schon für ein Schaden wäre!“ höhnte der
Polizeihauptmann. Er hielt das winzige Giftgeschoß
zwischen seinen Fingern. „Auch ein Segen der United
Fruit, Mister Grebb! Eure Kontraktarbeiter aus Brasili-
en haben diese Kunst hierher nach Britisch-Honduras
gebracht. Eine Spur von dem Pfeilgift im Blut, und
schon beginnt die Muskelstarre, bis endlich das Herz
ergriffen wird. He, Boys! Stellt endlich den Wagen
wieder auf die Räder, damit wir zurück können. Und
wenn es nicht anders geht, schmeißt ihn den Steilhang
hinab. Jetzt geht es um das bißchen Leben, Jungs!“
Gerade in diesem Augenblick kamen die Gefährten
Kururus, die sich noch auf den Beinen halten konnten,
in wilder Flucht den Pfad zurückgestürmt.
„Tausend Teufel im Busch!“ schrie einer. „Schießt…
sie sind uns auf den Fersen!“
Das Maschinengewehr auf dem Verdeck des Wagens
legte mit einer Garbe die letzten Flüchtenden um, als
sie die schützende Felsnase umgangen hatten. Aber es
zeigten sich keine Verfolger im grellen Lichte der
Suchscheinwerfer. Krachend kippte jetzt der zweite
Wagen den Hang hinab, der vorderste fuhr langsam
und vorsichtig im Rückwärtsgang um das Sumpfloch.
Die ausgeschwärmten Polizisten folgten ihm, immer
wieder kurze Feuerstöße in den dunkel drohenden
Wald hineinjagend. Aber ehe sie noch die Hauptstraße
erreicht hatten, fuhr einem Rotrock ein meterlanger
Pfeil durch den Halskragen, und ein anderer winselte
erbärmlich um Hilfe, nachdem er aus den feisten Ge-
nickfalten einen winzigen Federpfeil gerissen hatte.
Grebb hatte den Kragen seines Mantels trotz der dun-
stenden Schwüle im Walde aufgerichtet, den breitran-
digen Hut bis über die Ohren gezogen und versuchte in
den langsam zurückrollenden Wagen einzusteigen.
Aufschreiend flüchtete er, als plötzlich ein langer Pfeil
zischend den Verdeckbezug durchbohrte. „Sie schie-
ßen auf die Polizei, auf Ihrer Majestät Polizei!“
kreischte er. „Feuer aus allen Rohren auf das Gesin-
del!“
„Funkt um Hilfe! Funkt um Hilfe!“ befahl der Poli-
zeihauptmann. Der Fahrer kurbelte die Seitenscheibe
herab: „Schon geschehen! Verstärkung wird in zwei
Stunden hier sein!“
„Dann nichts als abhauen!“ Ein Pfeil blieb mit zit-
terndem Schaft in der Wagenspur stecken. „Sie müssen
uns verdammt nahe auf dem Pelz sein… und nichts zu
sehen… Endlich, da ist die Hauptstraße!“
Schrille Signalpfiffe riefen die Polizisten herbei. Hou-
ston Grebb war zufrieden, daß er noch einen Stehplatz
zwischen den Bänken bekommen konnte. Auch Kururu
hatte sieh in das Wageninnere gedrängt. Die Mitglieder
seiner Bande aber wurden roh zurückgestoßen, und die
Pistolenkolben hieben auf ihre Fingerknöchel ein, bis
sie die hölzerne Wagenklappe losließen und in den
Sand der Straße taumelten. Das Fahrzeug hatte gewen-
det und schoß die Bergstraße hinab. Verzweifelnd,
jammernd oder wütend heulend, stürmten ihm die
Banditen nach, um sich so schnell wie möglich aus der
Reichweite der stummen Schützen zu retten.
Es verging eine lange Zeit, bis die ersten Holzschlä-
ger die breite Höhenstraße betraten. Die beiden Ferren-
tes folgten ihnen, begleitet von zehn mit großen Bogen
und langen Blasrohren bewaffneten Waldindios. Teo-
kal wies auf den davonjagenden Polizeiwagen, der in
wilder Hast die Kehren durchbrauste: „Das waren au-
ßer den zwanzig Banditen Kururus gut vierzig Polizi-
sten, die vor sieben Eisenholzbogen und drei Blasroh-
ren geflüchtet sind! Dank euch, Brüder, daß ihr gleich
dem Hilferuf des Kambarysus gefolgt seid. Aber nun
kommt mit uns über den Grenzkamm nach Guatemala;
denn morgen früh wird es hier von Honduras-
Polizisten wimmeln. Die mögen dann die Verwundeten
auflesen. Sie werden Wunderdinge über die Schlacht
im Urwald berichten. Um so sicherer könnt ihr nach
einigen Wochen wieder eure Jagdzüge durch die Kor-
dilleren aufnehmen. Die Polizei und die Belizer Bandi-
ten werden sie meiden wie die Pest!“
Einer der Holzschläger lachte: „Ich wollte mir immer
eine schwere Pistole kaufen; aber nun übe ich mich im
Bogenschießen und ziele mit dem Blasrohr! Ihr wollt
den Klettersteig über den Grenzkamm einschlagen?
Gut, wir suchen unseren Wagen. Weit wird er mit dem
überanstrengten Motor nicht gekommen sein. Was wir
der Polizei sagen werden? Nichts! Wir haben von der
ganzen Geschichte nichts gesehen. Aber in Honduras
und Guatemala wird man über die Flucht der Polizisten
so lachen, daß sie schamrot werden wie ihre Röcke.
Freund Teokal, in dieser Nacht haben wir bewiesen,
was einige entschlossene Männer gegen unsere Unter-
drücker ausrichten können. Die Vereinigte Frucht-und
die Vereinigte Mahagoni-Gesellschaft werden es bald
merken, daß ein anderer Wind von den Bergen zum
Karibischen Meer bläst!“
Obgleich die Polizisten zu strengstem Stillschweigen
verpflichtet waren – die Banditen hatten auf ihrem
mühsamen Fluchtmarsch Belize noch gar nicht erreicht
– , wußte in den frühen Morgenstunden bereits jeder
der 20 000 Einwohner Belizes, was geschehen war.
Houston Grebb schimpfte sich im Hause des Kron-
richters die Wut über die erlittene Niederlage gründlich
vom Herzen. Obgleich sich sein Kammerdiener alle
Mühe gegeben hatte, sah der Yankee wie ein zerrupfter
Seerabe aus.
„Auf mich zu schießen!“ fauchte er. „Keinen Zoll von
meinem Kopfe entfernt fuhr der Mordpfeil durch das
Wagenverdeck. Das sollen mir die Ferrentes büßen!
Sie müssen sofort Anklage erheben, Townsbridge!
Wegen Mord, Aufruhr, Hochverrat… Auf jedem steht
der Strang! An den Galgen mit den Schurken!“
Der Kronrichter versuchte, ihn zu beruhigen: „Aber
warten Sie doch erst einmal das Ergebnis der Untersu-
chung dieses sehr, sehr bedauerlichen Zwischenfalles
ab. Die Hälfte unserer gesamten Streitmacht ist augen-
blicklich auf dem Wege zum Kampfplatz, um diese
unverschämten Empörer gegen Ihrer Majestät Obrig-
keit in Haft zu nehmen. Bis jetzt wissen wir noch nicht,
ob die Ferrentes überhaupt an dem Aufstandsversuch
teilgenommen haben.“
„Natürlich haben sie!“ brüllte Grebb los. „Kururu
kann Ihnen sagen…“
„… daß er niemanden im finsteren Urwald gesehen
hat! Das hat er im Kreuzverhör bereits zugegeben. Die
Ferrentes befinden sich in Tikal, jenseits der Grenze,
wie wir eben durch ein Telegramm erfahren haben. Sie
wollen von nichts wissen. Die Holzschläger sitzen in
ihren weltverlorenen Waldlagern und behaupten, keine
Ahnung von der Schlacht im Bergwalde zu haben.
„Und schon zwei Stunden vor Sonnenaufgang erzähl-
ten unsere Kontraktarbeiter im Hafen die Geschichte
mit allen Einzelheiten: daß die Gefährten Kururas
überfallen wurden, die Honduras-Polizisten unter Zu-
rücklassung eines Alarmwagens flüchteten und die
Maschinengewehre und Maschinenpistolen der be-
waffneten Kolonialkräfte machtlos waren gegen die
verdammten Eingeborenen mit ihren Eisenholzbogen
und Blasrohren. Eine Schande für die Regierung der
Kronkolonie Honduras, sage ich Ihnen, Townsbridge!
Wenn ihr die Ferrentes nicht zum abschreckenden Bei-
spiel vor der britischen Wappensäule henkt, dann
könnt ihr in Belize einpacken, Sir Kronrichter! Das
sage ich euch, Houston Grebb, der verdammt gut weiß,
wie Aufstände gemacht werden!“ Wütend stülpte er
seinen breitrandigen Filz auf und stürmte aus dem
Zimmer. Draußen erwartete ihn seine Leibgarde, vier
Männer, die nicht nur mit den Fäusten gut umzugehen
wußten. Die schiefsitzenden Leinenjacken verrieten
allzugut, wo sie die untergeschnallten schweren Pisto-
len trugen. „Würde mich heute nicht allzuviel in Belize
zeigen, Chef!“ knurrte der eine, während sie zu dem
vor dem Portal parkenden Rolls-Royce schritten.
„Werden gefrotzelt, wo wir uns sehen lassen. Die Far-
bigen werden frech!“
„Dann schlagt dazwischen!“ Grebb zog seinen Hut
tief in die Stirn, als er sich in die Polster des Wagens
warf. „Wofür bekommt ihr eigentlich euren Lohn,
Boys? Gestern abend wart ihr nicht aufzufinden…“
„Waren zu Besuch auf ,Lonny VIII’, dem Bananen-
dampfer, nachdem der Dienst erledigt war. Wollen
auch mal privat sein!“ maulte einer.
„Das hört jetzt auf!“ befahl der Beauftragte der Uni-
ted Fruit. „Ich kalkuliere, es kommen schwere Tage für
mich.“ Der Wagen rollte bereits über den Marktplatz.
In einer Ecke hatte sich eine große Menschenmenge
versammelt. Auf einigen zusammengeschobenen Ti-
schen standen dort vier Musikanten, zwei bliesen die
langen Nasenflöten, zwei schlugen die Handtrommeln.
Die Umstehenden sangen zu der seltsamen Melodie so
andächtig, als sei es ein Kirchenpsalm.
„Halten!“ befahl Grebb. „Was haben die zu krähen?“
Es war kein gutes Englisch, es war das eigentümliche
Sprachgemisch, das von den Eingeborenen und den
Kontraktarbeitern in Belize gesprochen wurde. Aber
die Amerikaner verstanden die Worte gut: „Einmal
werden wir jagen die Schurken der UFC. Vorbei dann
die tausend Plagen und unser schlimmes Weh… Und
im Sturm voran unsre Fahnen… Freiheit oder Bana-
nen!. Freiheit oder Bananen! Nieder mit der UFC!“
„Das ist doch…“ rief der Yankee.
„… das verbotene Lied!“ ergänzte einer seiner Be-
gleiter. „Schönen Zug habt ihr in der Kolonne, Mister
Grebb! Das sind alles Kontraktarbeiter von der United
Fruit, die da singen. Hört mal, neuer Vers wohl?“
Begeistert sangen die Versammelten: „Einer ist schon
gelaufen, Mister Grebb von der UFC… Gelaufen ohne
verschnaufen, von den Bergen bis Belize… gelaufen
vor unseren Fahnen… Freiheit oder Bananen… Frei-
heit oder Bananen!… Nieder mit der UFC!“
„Auseinander! Auseinandergehen!“ brüllte Grebb,
während die Musikanten die Überleitung zu einer neu-
en Liedstrophe spielten. Da hatten viele der Sänger
schon den Wagen erkannt. Faule Bananen und ange-
schimmelte Pampelmusen schleuderten sie gegen den
Rolls-Royce. Der Fahrer gab Vollgas und raste die
Parkavenue hinunter. Er minderte das Tempo erst, als
er in den mauerumwehrten Sitz der UFC-Direktion
abbiegen konnte.
„Tor schließen und Wachen auf die Mauern!“ keuchte
Grebb, als er sich aus dem Wagen schob. Dann stürmte
er in sein Büro und rief den Kronrichter an: „Eure ver-
dammte Vertrauensseligkeit! Wollt ihr Briten dadurch
auch noch diese Kolonie verlieren? Der Aufstand ist
schon im Gange! Schlachtkreuzer müssen her, und
Schnellfeuer aus Siebenzollrohren auf die Revolutionä-
re! – Was geschehen ist, Townsbridge? Sie singen auf
dem Markte am hellen Tage das verbotene Lied über
die UFC! Wie bitte?… Ihr hättet das nicht verboten?
Nur unsere Generaldirektion?… Ja, zum Donnerwetter,
ist das etwa nicht dasselbe?… Und außerdem, irgend
so ein hondurenischer Wald- und Wiesendichter hat
neue Spottverse über mich, jawohl, über Houston
Grebb von der UFC verbrochen, und die grölen sie
nun, was die Kehlen hergeben. Mit faulen Bananen
und Pampelmusen haben sie nach mir geworfen!… Sir,
das sind keine gefährlichen Waffen? Tausend Pfund
unseres Abfalls auf Ihren Kopf, dann werden Sie an-
ders denken!… Der Auflauf ist schon zerstreut? Was
nützt das mir? Sicherheit will ich, hundertprozentige
Sicherheit! Und die wird mir erst dann garantiert, wenn
die Ferrentes hängen! – Ja, wenn sie auch in Tikal sind,
die geistigen Urheber bleiben sie doch!“
Von all diesen Vorgängen ahnten Juan und Teokal
nichts, als sie nach drei Tagen wieder nach Belize zu-
rückkehrten, um das Motorboot zu übernehmen. Sie
verließen schon in Wipers Row den klapprigen Omni-
bus, um den alten Mironda aufzusuchen und ihm für
seine Hilfe Dank zu sagen. Sie glaubten, eine verkohlte
Brandstätte vorzufinden. Um so erstaunter waren sie,
als sie sahen, wie fleißige Hände gerade die letzten
Riedbündel auf dem neu gerichteten Dachfirst festban-
den.
Der Beherrscher des Kambarysus musterte eben eini-
ge neue, kunstvoll geflochtene Grasmatten. „Seid mir
gegrüßt, ihr Ferrentes!“ lachte er ihnen entgegen.
„Schaut, wer anderen hilft, hilft sich selbst! Brüder, ich
wollte schon lange ein neues Haus bauen. Als die
Freunde in den Plantagen und in den Kordilleren hör-
ten, was mir geschehen war, kamen sie in Scharen her-
bei, und nun steht schon die neue Hütte, größer und
schöner als die alte Rauchkate. Trotzdem aber habe ich
Klage erhoben, gegen Kururu und seine Banditen. So
sehr auch der Polizeimeister um Schönwetter bittet,
hinter meiner Klage stehen alle, die nach Freiheit ru-
fen.“
„Wir sind sehr in deiner Schuld!“ Teokal verneigte
sich tief vor dem klugen Mironda. „Wenn dein Kamba-
rysu nicht die Helfer gerufen hätte…“ . „Rede nicht
über Selbstverständlichkeiten! Wollt ihr heute nach
Belize?“
„Ja, das Motorboot abholen und dann zurück nach
Payo Nabisco!“
„Reichlich leichtsinnig, ihr Ferrentes! In Belize haust
ein gewisser Kururu, der seit dem Abenteuer im Walde
allen Kredit verloren hat. Schade, daß ihm kein Pfeil
durch die Kehle gefahren ist! Und seine Banditen? Von
denen nimmt jetzt auch kein Hund mehr ein Stück Tor-
tilla. Meint ihr, die werden euch mit Blumenkränzen
begrüßen? Gar nicht zu reden von einem Master
Grebb, der vor Wut zu schreien beginnt, wenn er nur
den Namen Ferrente hört. Und endlich, daß die ruhm-
volle Honduras-Polizei an euch ihre Schlappe droben
in den Kordilleren auswetzen möchte, muß ich das
noch besonders erwähnen? Ich ginge lieber mit bloßen
Füßen in ein Schlangennest, als mich nach Belize zu
wagen!“
Dann schlug er vor, durch einen zuverlässigen Mann,
vielleicht durch den Schiffsbauer Jago Savedra, das
Motorboot abholen zu lassen. „Von Wipers Row könnt
ihr leicht die Küste erreichen, ohne in die Nähe von
Belize zu kommen. Wie, der Arzt wartet auch? Ihr Fer-
rentes, laßt euch gesagt sein, in eurer Lage kann das
beste Heilmittel zum schlimmsten Gift werden. Aber
wir wollen einmal hören, was in Belize los ist!“
Bald saßen die drei um den Kambarysu, der erst zu
sprechen begann, nachdem Mironda seine Fragen auf
den hohlen Stamm getrommelt hatte.
„Der Klang der Schläge dringt nicht über deinen Hof
hinaus!“ stellte Teokal fest, während sie auf die Ant-
wort warteten. „Wie kann sie dein Freund in Belize auf
seinem Kambarysu hören?“
„Der hohle Stamm verstärkt den schwachen Schall…
vielleicht leitet ihn auch die gute Erde. Was weiß ich!
Aber ich höre meinen Freund in Belize und er mich,
genau so wie vor 500 Jahren die Diener am Kambary-
su, als die weisen Mayas Botschaften von Uxmal an
der Nordküste Yukatans bis nach Tikal in Guatemala
in Stundenfrist sandten. Still jetzt, Belize spricht!“
Er schüttelte den Kopf, als er das Kambarysugespräch
beendet hatte. „Seid froh, daß ihr nicht sofort nach Be-
lize gefahren seid! Alle, die in die Stadt hinein wollen,
werden einer strengen Kontrolle durch die Polizei un-
terzogen. Nun sagt noch, daß euch eure Dankbarkeit
keinen Gewinn eingebracht hätte! Wäret ihr nicht zum
alten Mironda gekommen, säßet ihr jetzt schon in Poli-
zeihaft!“
„Sie haben aber doch keinerlei Beweise gegen uns?
Tatsache ist auch, daß wir an dem Kampf im Walde
überhaupt nicht beteiligt waren“, erklärte Juan.
Mironda lachte: „Um eure Unschuld wird sich die Po-
lizei viel kümmern. Sie sperrt euch zunächst mal ein,
wochen-, monatelang. Inzwischen wird der Kontrakt
zwischen Chinchano und Grebb als rechtsgültig er-
klärt, und Payo Nabisco gehört mit allen Menschen der
UFC. Wollt ihr das?“
Teokal schüttelte den Kopf: „Nie und nimmer darf
das geschehen. Du bist sehr klug, Bruder Mironda! Wir
folgen deinen Ratschlägen.“
Gegen Mitternacht übernahm Jago Savedra die beiden
Flüchtlinge in einer kleinen Bucht südlich von Belize
auf das starke Motorboot. In weitem Bogen umfuhren
sie die Leuchtfeuer der Hafenstadt und brausten dann,
noch ehe sich das erste Morgenrot zeigte, der Einfahrt
in die Chetumal-Bai entgegen. Als sich die Sonne aus
den märchenhaft blauen Fluten der Karibischen See
erhob, sahen sie unter Palmen die bescheidenen Hütten
ihres Heimatdorfes auftauchen.
Jago Savedra kroch mit Teokal nochmals in den Mo-
torenschacht und klopfte anerkennend auf den Getrie-
bekasten: „Ein schmuckes Maschinchen! Da seid ihr
nicht betrogen worden. Registriert ist es auch für die
Fischereigenossenschaft Payo Nabisco, und ich kann
mir nichts Schöneres denken,, als drei Wochen bei
euch zu bleiben, um gute Kutterführer auszubilden.
Zwei Barrels Treibstoff habe ich geladen, und die
Tanks sind noch voll. Was ihr mir schuldig seid? Im-
mer langsam mit den jungen Mulas… Die Rechnung
lege ich euch schon noch vor; denn von der erquicken-
den Seebrise allein kann Jago Savedra wirklich nicht
leben!“
Als sie das Motorboot an den wackligen Bootssteg
heranmanövrierten, erklärte der Schiffsbauer: „Und
dann habe ich von Mironda noch einen ganz be-
sonderen Auftrag: Ich soll für Payo Nabisco einen
Kambarysu bauen und einen gewissen Teokal Ferrente
wenigstens mit den einfachsten Regeln der Nach-
richtenübermittlung vertraut machen. Schau mich nicht
so verwundert an, Junge! Auch ich gehöre zu den Ver-
schworenen, die wissen, warum ihr Kampfruf ,Freiheit
oder Bananen!’ heißt. In Payo Sierra steht ein Kamba-
rysu, in Payo Obispo drüben im Mexikanischen ein
anderer, keiner weiter als fünf Meilen von eurem Dorf.
Da könnt ihr jede Nachricht schnell erhalten und auch
einen Hilferuf weitergeben, wenn er notwendig wird.
Hoffen wir, daß ihr dies niemals zu tun braucht!“
Doch dieser Zeitpunkt kam schneller, als Savedra
dachte. Zuerst tauchte in Payo Nabisco der alte Kazike
Chinchano auf und wies eine Verfügung des Kronge-
richtes vor, daß seine Ausweisung aus dem Dorfe zu
Unrecht erfolgt sei. Er nahm wieder Besitz von seiner
Hütte und bedrohte alle seine Gegner mit dem Zorn der
Götter. Sein Enkel kam weinend zu Teokal: „Hütet
euch vor ihm! Mit Master Grebb und Kururu hat er
immer zusammengesessen, und Unheil ist gesponnen
worden für alle, die in Payo Nabisco leben. Ich muß
euch warnen vor dem, dessen Blut in meinem fließt.“
Teokal fragte: „Und er schlug dich, ein unmündiges
Kind?“
Der Kleine nickte: „Alle Tage, auch jetzt hier… und
er wird mir die Zunge ausreißen, wenn er hört, daß ich
zu euch Ferrentes gegangen bin.“
Der alte Juan klagte: „So verderben sie unser Volk!
Niemals hätte ein Maya ein Kind geschlagen, wenn er
nicht schlechte Beispiele vor Augen gehabt hätte.
Und dieses Untier will Kazike sein! Den Haifischen
sollten wir ihn vorwerfen!“
„Damit könntet ihr den Briten und den Yankees den
größten Gefallen tun!“ meinte der Schiffsbauer.
„Unser neuer Kambarysu spricht bereits. Er meldet,
daß Kururu sich neue Banditen aus Jamaika und von
den Bahia-Inseln heranholt. Die Belizer Tagediebe
wollen nichts mehr mit dem Machetenmann zu tun
haben; denn allzu gründlich haben die Arbeiter der
UFC und der Mahagoni-Company sie darüber belehrt,
daß sie in der Hauptstadt von Britisch-Honduras keine
Verbrecher mehr sehen wollen. Auf einem alten Hulk,
einem abgetakelten Schiff, sammelte Kururu seine
Helfershelfer, denen er das Blaue vom Himmel ver-
sprechen mußte, um sie für den Raubzug nach Payo
Nabisco zu gewinnen.“
„Perlen, pfundweise, haben die Fischer von Nabisco
in ihren Mattentaschen… und die Mädchen aus dem
Nest, die Schönsten an den Küsten der Karibischen
See… Ich garantiere dafür, kein Mann von der Hondu-
ras-Polizei wird sich darum kümmern, welchen Zauber
wir in dem gottverfluchten Nest anstellen!“ prahlte der
Casco, der seinen rechten Arm schon wieder ein wenig
gebrauchen konnte. „Woher ich das weiß? He, ihr
Lumpenhunde, ist der Kazike von Payo Nabisco nicht
unser Verbündeter? Der Priesterhäuptling wird dafür
sorgen, daß wir machen können, was wir wollen.
Hauptsache ist, daß wir fort sind, ehe die Polizei sich
darauf besinnt, daß sie für Ruhe und Ordnung zu sor-
gen hat!“
Ganz getraute sich das Raubgesindel auf dem schnau-
fenden Küstendampfer nicht an die Küste von Payo
Nabisco heran. Sergeant Morgan, der Seepolizist, hatte
von seinem Wachkutter aus dem Kapitän allerhand
Warnungen zugeschrien, als sie die Fluten der Chetu-
mal-Bai durchquerten: „Rammen euch glattweg in den
Grund, die Fischer von Nabisco. Haben ein tolles
Schnellboot gekauft… natürlich aus dem Gewinn ihrer
Perlenfänge. Strotzt da jeder Bursche mit mindestens
1000 Pfund im Portemonnaie. Wer die ausbeuteln
kann, der hat das große Glück gefunden.“
Nach „dieser Mitteilung landeten die Banditen etwa
drei Wegstunden von dem kleinen Fischerort entfernt.
Sie hatten dichten Urwald zu durchschreiten, der sich
von den Kordilleren bis zum Meeresstrand hinzog.
Aber da ging eine alte Mayastraße, und sie glaubten,
auf diesem Wege die Fischer und Bauern von Payo
Nabisco überraschen zu können. Erst stärkten sie sich
einmal gründlich an den mitgenommenen Vorräten,
und da der üble Fuselrum nicht der kleinste Teil davon
war, sanken sie in den Schlaf, ehe sie noch den Vor-
marsch angetreten hatten.
Houston Grebb tobte nicht wenig, als er seine Hilfs-
truppe drei Stunden vor Sonnenuntergang noch an der
Landungsstelle traf, die ihm der Küstenkapitän gewie-
sen hatte. „Verdammter Brüllaffe!“ schrie er Kururu
an. „Ich komme, um aus der Hand von Chinchano die
Bestätigung entgegenzunehmen, daß Payo Nabisco
nichts mehr gegen die Kontrakte mit der UFC einzu-
wenden hat… Und ihr vertrödelt hier die kostbare
Zeit? Meint ihr, die Braunhäute werden euch Verbre-
chergesindel mit Jubelgeheul empfangen? Denke an
den Urwald zwischen Wipers Row und Oranje Walk!
Auf und vorwärts! In Belize ist der Teufel los, weil der
ganze Plan verraten ist. Morgen früh liegt der Küsten-
aviso vor Payo Nabisco und wird euch mit blauen
Bohnen füttern, wenn der versoffene Chinchano nicht
sein Wort für euch in die Waagschale werfen kann.
Und das kann er nur, wenn die Ferrentes und ihre
Freunde nicht mehr ,gicks’ sagen können. Hundert
Dollar dem, der zuerst die Brandröhre in die Hütte der
Ferrentes schleudert!“
Johlend klaubten die Banditen die Waffen zusammen
und drangen, noch taumelnd von den Folgen des Rau-
sches, in das grüne Dämmern des Urwaldes ein. Grebb
folgte dem lärmenden Zug mit seinen vier Leibwäch-
tern, nachdem sie ihre schweren Pistolen aus den un-
tergeschnallten Koppeln gelöst und schuß fertig ge-
macht hatten.
Während die wilde Bande unter den Lianengehängen
vorwärts marschierte, riefen die Kambarysus von Payo
Nabisco, Sierra und Obispo immer noch um Hilfe. Fast
einhundert Mann, alle gut bewaffnet, hatte Kururu im
Auftrage Grebbs gegen das kleine Küstendorf aufgebo-
ten, wo nur einige Macheten zur Verteidigung geschlif-
fen werden konnten. Doch die Fischer und Bauern wa-
ren entschlossen, den Kampf um ihre Heimat aufzu-
nehmen. Frauen und Kinder hatten den Hausrat in
Bündeln zusammengeschnürt und waren landeinwärts
gewandert, als die Späher die Landung der Banditen
gemeldet hatten. In einer der vielen alten Ruinenstädte
der Mayas, an den Hängen der Küstenkordilleren, fan-
den sie Zuflucht, und dort trafen sie schon auf die er-
sten Helfer, die herbeieilten, um den verbrecherischen
Anschlag auf den friedlichen Fischerort abzuwehren.
Es waren Holzschläger mit ihren wuchtigen Äxten
und Waldindios mit mannshohen Eisenholzbogen und
zwei Meter langen Blasrohren. Auf geheimen Wald-
pfaden rannten sie wie die schlanken Wapitihirsche der
Hochebene und wiesen an den Ausblicken auf die
blaue Fläche der Chetumal-Bai, über die schlanke Ka-
ribenboote auf Payo Nabisco zuschossen. Die Männer
scherzten mit den verängstigten Frauen: „Bereitet das
Siegesmal! Schlachtet eure fettesten Schweine und
stellt die vollen Kalebassen kühl. Die ganze Küste bis
hinüber nach Mexiko ist alarmiert. Wollen mal mit
dem bösen Kururu und seiner Bande Schluß machen!“
Die Fischer und Bauern von Payo Nabisco waren in-
zwischen nicht untätig. Sie hatten die Mayastraße mit
Astverhauen gesperrt und dazwischen geschickt die
giftigen Schwanzstacheln des Teufelsrochens verbor-
gen. Als die lärmende Kolonne der Banditen sich dem
ersten Hindernis näherte, wichen die Verteidiger um
den bergenden Hangrist zurück und bauten ein neues
Hindernis.
Kururu hielt sich wohlweislich im Hintergrund. Als
die Spitzenleute seiner Bande schrien, daß Äste den
Weg versperren, brüllte er: „Schmeißt den Dreck über
den Hang hinab! Zugepackt und den Pfad freige-
macht!“
Doch da schrie schon der erste Mann auf: „Dornen im
Verhau… nein… Rochenstacheln!“ Und dann ver-
fluchte er Tag und Stunde, als er sich für den Raubzug
hatte anwerben lassen, verfluchte Kururu und den
Yankee, die UFC und ganz Honduras. Geifer stand ihm
vor dem Munde, als er sich mit geschwungener Ma-
chete Bahn brach durch die Reihen seiner Gefährten.
Doch ehe er dem Casco an den Kragen gehen konnte,
brach er in Krämpfen zusammen.
„Wut und Angst erwürgten ihn!“ stellte Grebb fest.
„Lächerlich, vor Rochenstacheln Furcht zu haben.“
Doch er mußte eine Sonderbelohnung aussetzen, ehe
die Buschmesser wieder in den Verhau fuhren. Es dau-
erte lange, ehe der Weg frei wurde. Das verfilzte Un-
terholz machte ein Umgehen der Sperre unmöglich.
Außerdem getraute sich keiner in das Dickicht hinein;
denn nun war es allen klar geworden, daß ihnen die
Fischer von Payo Nabisco einen heißen Empfang be-
reiten würden.
Als sie den Bergrist umgangen hatten, sahen sie eine
neue Astsperre, quer über den Weg errichtet. Ein
schlanker Knabe eilte, gewandt von Stamm zu Stamm
springend, den Hang hinauf. Aus zehn Pistolen wurde
auf ihn – es mochte ein Späher sein – das Feuer eröff-
net. Doch schon hatte ihn die grüne Dämmerung ver-
schluckt, und ein gellender Warnschrei klang aus dem
Gestrüpp.
„Vorwärts! Wir haben keine Zeit zu verlieren, sonst
überrascht uns die Nacht im Wald!“ feuerte Grebb sei-
ne Schar an. Seine weiteren Worte blieben ihm im Hal-
se stecken, als ein weißgefiederter Pfeil zu seinen Fü-
ßen niederfiel.
„Bogenschützen oben am Hang!“ schrie einer seiner
Leibgardisten. Kururu brüllte: „Da unten, Waldindia-
ner!“ Schüsse peitschten hinauf und hinab, obwohl
keiner einen Gegner sehen konnte. Nur eine aufge-
scheuchte Horde Brüllaffen schwang sich keifend und
jammernd durch die Lianen zu ihren Häupten. Doch
die Gegner waren da. In der Spitzengruppe der Bandi-
ten, die dicht vor dem Verhau stand, brachen zwei
Mann zusammen, getroffen von schwirrenden Pfeilen,
die irgendwo aus der grünen Hölle geflogen kamen.
Das Schreien der Verwundeten genügte, die ganze
Bande von dem Verhau zurückzuscheuchen. Doch die
unsichtbaren Verteidiger schienen überall zu sein.
Während Grebb die Zurückweichenden noch anfeuerte,
traf einen seiner Leibwächter ein Pfeil in den Rücken,
und ein anderer zog mit verdutztem Gesicht einen fe-
derbesetzten Bambussplitter aus der blutenden Wange.
„Giftpfeile aus Blasrohren!“ brüllte Kururu auf und
wandte sich zur Flucht. Er kam nicht weit. Genau über
der Gürtelschärpe traf ihn der Pfeil, und gurgelnd
wälzte er sich auf dem Moddergrund. Grebb schlug um
sich, als wolle er einen wildgewordenen Bienen-
schwarm abwehren, während er den Weg zurücklief.
Das war das Signal zur allgemeinen Flucht, und die
Banditen erwiesen sich als bessere Läufer. Grebb stol-
perte und fiel, raffte sich wieder auf, schrie verzweifelt
nach seinen Leibwächtern und taumelte auf einknik-
kenden Knien weiter den Mayapfad entlang, bis sich
endlich der Wald öffnete und vor ihm die See lag, auf-
leuchtend in den letzten Strahlen der Abendsonne.
Doch vergeblich suchte er sein Motorboot. Es war
verschwunden wie der Küstendampfer. Nur zwei dunk-
le Punkte waren in der Enge von Ambergris zu erken-
nen, und am Ufer standen etwa fünfzig Banditen und
zeigten nach Osten: „Abgehauen, die Feiglinge! Los,
weiter die Küstenstraße, sonst holt uns alle noch der
Teufel! Wir sind blind in eine Falle gegangen!“
Unheimlich gellte vom Waldrande das Kriegsgeschrei
der Bergindios herüber, und zischende Pfeile fuhren
zwischen das Raubgesindel. Grebb lief zuerst am
Strande entlang, dann aber zwang ihn ein steiler Fels
wieder in den Wald. Einige der Banditen versuchten
die Felsen zu überklettern. Doch das unterspülte Ge-
stein gab nach, und auf die mit dem Wasser ringenden
Menschen schossen hochgestellte Dreiecksflossen zu.
„Haie!“ gurgelte neben Grebb ein Mulatte aus Jamai-
ka. „Massenhaft Haie in der verfluchten See. Und un-
sichtbare Geisterschützen im Walde…“ Der Yankee
beschwor ihn, bei ihm zu bleiben. „Hundert Dollar…
tausend!“ bot er. Doch der Mann rannte, ohne sich um
die Angebote zu kümmern, den schmalen Fußpfad wei-
ter, als seien ihm die Schreckgespenster aller Urwälder
auf den Fersen.
Was sich in dieser Nacht noch alles ereignete, das
wollte später sogar die Kolonialpolizei nicht wissen.
Kururu, der Mann mit der Machete, wurde in Belize
nie mehr gesehen. Von seiner Bande tauchten wohl
einige Mitglieder auf; aber sie machten sich schnell auf
und davon; denn wo sie sich blicken ließen, da sahen
sie geballte Fäuste und hörten handfeste Drohungen.
Der Kronrichter, Sir Townsbridge, erkundigte sich je-
den Tag, ob man von Houston Grebb noch keine Nach-
richt habe. Eine ganze Woche verstrich, da wurde er
von der Hafenstation angerufen.
„Eines unserer Patrouillenboote hat am Strande zehn
Meilen nördlich von Belize einen furchtbar herunter-
gekommenen Weißen aufgelesen. Sergeant Morgan
behauptet, das könne nur Mister Grebb von der UFC
sein. Warum wir ihn nicht fragen? – Sir Kronrichter,
der Mann ist nicht bei Sinnen… nein, nicht ohnmäch-
tig. Tropenkoller oder so etwas, sagen wir schon ganz
klar: verrückt! Seine Taschen revidieren? Seit wann
haben nackte Menschen Taschen? – Ja, splitterfaser-
nackt! Nein, verwundet ist er nicht, abgesehen von
Dornenkratzern und Insektenstichen. – Was er macht?
Er döst oder singt… Ulkiges Lied, sage ich Ihnen.
Geht so: ,Einer ist schon gelaufen… Mister Grebb von
der UFC…’ Und dann lacht er wie ein Blödsinniger…
Gut, halte das ,Fundstück’ bereit, bis Sie hier sind!“
Es war Houston Grebb, wie Townsbridge feststellen
mußte: abgemagert, zerschunden, geistesabwesend zur
Decke starrend und auf keine Frage antwortend. Der
alte Arzt aus dem Spital hatte ihn bereits einer gründli-
chen Untersuchung unterzogen. „Körperlich fehlt ihm
nicht viel. Hat vielleicht einen kleinen Sonnenstich
gehabt, wird wohl auszukurieren sein. Aber davon
kommt der Blödsinn nicht. Sir Townsbridge, kennen
Sie die alten schottischen Sagen vom Wirrkraut und
Taumelbrot? Ist viel Wahres drin, jawohl. Es gibt hier
an der Küste des Karibischen Meeres viele Wirrkräu-
ter, höllenverdammte Früchte und Wurzeln, die den
Menschen um den Verstand bringen. Ob er davon ge-
gessen haben mag?“
„Keine Pfeilwunde?“ wollte der Kronrichter wissen.
„Sie meinen Giftpfeile? Muß ich nach bestem Wissen
und Gewissen verneinen. Die Pfeilgifte führen zu
Lähmung und Muskelstarre; aber der Mann da ist, ab-
gesehen von seinem geistigen Defekt, quicklebendig
und beweglich. Wenn es nicht Grebb wäre, würde ich
sagen, das Gewissen, die Einsicht in sein schandbares
Tun, hat ihn um den Verstand gebracht. Und die
Furcht! Muß doch verdammt viel auf dem Kerbholz
haben…“
Townsbridge schüttelte den Kopf: „Vollkommen ver-
nehmungsunfähig also? Peinlich für die UFC. Grebb
persönlich hat Einspruch gegen die Beschwerde der
Dorfgenossenschaft Payo Nabisco erhoben. Wird wohl
kaum verhandlungsfähig sein, wenn der Fall behandelt
wird. Mit dem haltlosen Säufer, dem Kaziken Chin-
chano, will ich lieber nichts zu schaffen haben. Wirr-
kräuter hier in Britisch-Honduras? Ernsthaft? Na, dann
bin ich froh, daß ich in vierzehn Tagen dieses unheim-
liche Land verlassen kann. Mag sich mein Nachfolger
um die Aufklärung des Falles Grebb kümmern.“
Der Arzt begleitete ihn über den Kai zu seinem Wa-
gen, nachdem er die Überführung des Kranken in das
Regierungshospital angeordnet hatte. Gerade bog ein
starkes Motorboot in den Bootshafen ein, das am Heck
die englische Flagge trug. Am Bug aber flatterte eine
rote Fahne mit einem silbernen Stern. Der Kronrichter
betrachtete sie augenzwinkernd: „Von der Weißen-
Stern-Linie? Die Hausflagge sieht doch ganz anders
aus!“
Der Doktor sah ihn verwundert an: „Aber Sir Towns-
bridge, haben Sie die neuesten Zeitungen noch nicht
gelesen? Das ist die Fahne der Hondurenischen Volks-
partei, die Sie selbst vor Wochen konzessioniert haben.
Und das Boot da bringt die Ferrentes und ihre Mitver-
schworenen aus Payo Nabisco hierher, zur ersten De-
legiertenkonferenz. Der Teokal Ferrente wird bei der
nächsten Wahl für unser ulkiges Scheinparlament kan-
didieren. Ist mächtig populär, der junge Mann. Da
singt ja das ganze Hafenvolk los…“
Auf den Verladestegen und an den Kairampen stan-
den Neger, Indios, Mulatten und Mestizen dicht ge-
drängt und schwenkten bunte Blumenbüsche im la-
chenden Sonnenschein. Alle sangen das verbotene
Lied, als ob es keine Polizei Ihrer Majestät mehr gäbe.
Es war wieder eine neue Strophe:
Hoch lebet, ihr Arbeitsleute,
in den Bergen und an der See!
Wir sind nicht mehr wehrlose Beute
für die Schurken der UFC!
Freiheit oder Bananen!
Und der Stern auf unseren Fahnen
sagt „Freiheit“ und nicht „Bananen“!
Fort mit der UFC!
„Sieht nach allerhand Unwetter aus!“ meinte der alte
Doktor, als er sich in den Wagen schob. „Zu klar der
Himmel, Sir Kronrichter? Eben deshalb! Genau des-
wegen! Ich kenne doch mein Belize!“
W. Pollatschek PHILIPP MÜLLER-HELD DER NATI-
ON
2. überarbeitete Auflage illustriert 160 Seiten Halb-
leinen 1,40 DM
Dieses für alle Jungen und Mädchen bedeutungsvolle
Buch erzählt aus dem Leben unseres tapferen, vorbild-
lichen Freundes, der am 11. Mai 1952 in Essen hinter-
rücks erschossen wurde.
VERLAG NEUES LEBEN . BERLIN W 8
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Seewölfe - Piraten der Weltmeere 529: BlockadebrecherVon EverandSeewölfe - Piraten der Weltmeere 529: BlockadebrecherNoch keine Bewertungen
- Seewölfe - Piraten der Weltmeere 727: Das Grauen der NachtVon EverandSeewölfe - Piraten der Weltmeere 727: Das Grauen der NachtNoch keine Bewertungen
- Friedrich Gerstecker: Reise in die Südsee: Band 143 in der maritimen gelben BuchreiheVon EverandFriedrich Gerstecker: Reise in die Südsee: Band 143 in der maritimen gelben BuchreiheNoch keine Bewertungen
- Onnen Visser, der Schmugglersohn von Norderney: Historischer RomanVon EverandOnnen Visser, der Schmugglersohn von Norderney: Historischer RomanNoch keine Bewertungen
- Onnen Visser: Der Schmugglersohn von Norderney (Historischer Abenteuerroman): Klassiker der JugendliteraturVon EverandOnnen Visser: Der Schmugglersohn von Norderney (Historischer Abenteuerroman): Klassiker der JugendliteraturNoch keine Bewertungen
- Vom Angelkahn zur Motoryacht: Aufstieg und Elend eines FreizeitskippersVon EverandVom Angelkahn zur Motoryacht: Aufstieg und Elend eines FreizeitskippersNoch keine Bewertungen
- Seewölfe - Piraten der Weltmeere 227: Der Herrscher von TortugaVon EverandSeewölfe - Piraten der Weltmeere 227: Der Herrscher von TortugaNoch keine Bewertungen
- Der König der Miami (Wildwest-Abenteuerroman): Nikunthas, Der Schnelle FalkeVon EverandDer König der Miami (Wildwest-Abenteuerroman): Nikunthas, Der Schnelle FalkeNoch keine Bewertungen
- Seewölfe - Piraten der Weltmeere 357: Aufbruch nach Coral IslandVon EverandSeewölfe - Piraten der Weltmeere 357: Aufbruch nach Coral IslandNoch keine Bewertungen
- Seewölfe - Piraten der Weltmeere 73: Am Auge der GötterVon EverandSeewölfe - Piraten der Weltmeere 73: Am Auge der GötterNoch keine Bewertungen
- Am Stillen Ozean: Reiseerzählungen, Band 11 der Gesammelten WerkeVon EverandAm Stillen Ozean: Reiseerzählungen, Band 11 der Gesammelten WerkeNoch keine Bewertungen
- Seewölfe - Piraten der Weltmeere 712: Verzweifelte SucheVon EverandSeewölfe - Piraten der Weltmeere 712: Verzweifelte SucheNoch keine Bewertungen
- Fantastische Reise V: Reise in den Spreewald und das Geheimnis der LutkisVon EverandFantastische Reise V: Reise in den Spreewald und das Geheimnis der LutkisNoch keine Bewertungen
- Seewölfe - Piraten der Weltmeere 732: Jagd auf das SilberschiffVon EverandSeewölfe - Piraten der Weltmeere 732: Jagd auf das SilberschiffNoch keine Bewertungen
- Onnen Visser (Historischer Roman): Klassiker der Jugendliteratur - Der Schmugglersohn von NorderneyVon EverandOnnen Visser (Historischer Roman): Klassiker der Jugendliteratur - Der Schmugglersohn von NorderneyNoch keine Bewertungen
- Seewölfe - Piraten der Weltmeere 90: Rebellion am SilberstrandVon EverandSeewölfe - Piraten der Weltmeere 90: Rebellion am SilberstrandNoch keine Bewertungen
- Seewölfe - Piraten der Weltmeere 718: Der tödliche FluchVon EverandSeewölfe - Piraten der Weltmeere 718: Der tödliche FluchNoch keine Bewertungen
- Meermädchen und Sternensegler. Geschichten zwischen Traum und WirklichkeitVon EverandMeermädchen und Sternensegler. Geschichten zwischen Traum und WirklichkeitNoch keine Bewertungen
- Seewölfe - Piraten der Weltmeere 575: Die Schiffe-VersenkerVon EverandSeewölfe - Piraten der Weltmeere 575: Die Schiffe-VersenkerNoch keine Bewertungen
- Die Kinder des Kapitän Grant / Les Enfants du capitaine Grant (Zweisprachige Ausgabe: Deutsch - Französisch / Édition bilingue: allemand - français)Von EverandDie Kinder des Kapitän Grant / Les Enfants du capitaine Grant (Zweisprachige Ausgabe: Deutsch - Französisch / Édition bilingue: allemand - français)Noch keine Bewertungen
- Abenteuer des Kapitän Hatteras / Les aventures du capitaine Hatteras (Zweisprachige Ausgabe: Deutsch - Französisch / Édition bilingue: allemand - français)Von EverandAbenteuer des Kapitän Hatteras / Les aventures du capitaine Hatteras (Zweisprachige Ausgabe: Deutsch - Französisch / Édition bilingue: allemand - français)Noch keine Bewertungen
- Im Zeichen des Drachen: Erzählung aus "Am Stillen Ozean", Band 11 der Gesammelten WerkeVon EverandIm Zeichen des Drachen: Erzählung aus "Am Stillen Ozean", Band 11 der Gesammelten WerkeNoch keine Bewertungen
- Seewölfe - Piraten der Weltmeere 741: Die Spur in den WellenVon EverandSeewölfe - Piraten der Weltmeere 741: Die Spur in den WellenNoch keine Bewertungen
- 13 SHADOWS, Band 36: DAS GEISTERSCHIFF: Horror aus dem Apex-Verlag!Von Everand13 SHADOWS, Band 36: DAS GEISTERSCHIFF: Horror aus dem Apex-Verlag!Noch keine Bewertungen
- Seewölfe - Piraten der Weltmeere 266: Auf gefährlichem KursVon EverandSeewölfe - Piraten der Weltmeere 266: Auf gefährlichem KursNoch keine Bewertungen
- Alfred Schirokauer: Gesammelte Werke: Historische Romane, Biografien und KrimisVon EverandAlfred Schirokauer: Gesammelte Werke: Historische Romane, Biografien und KrimisNoch keine Bewertungen
- Ein Jahr in Neuseeland: Reise in den AlltagVon EverandEin Jahr in Neuseeland: Reise in den AlltagBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (1)
- Gesammelte Werke: Historische Romane, Biografien und KrimisVon EverandGesammelte Werke: Historische Romane, Biografien und KrimisNoch keine Bewertungen
- Hemingway Ernest Der Alte Mann Und Das MeerDokument66 SeitenHemingway Ernest Der Alte Mann Und Das MeerPetronela RoșcaNoch keine Bewertungen
- Daniela Sauer - Kreativ Tipp - Wie Zeichne Ich Bäume PDFDokument4 SeitenDaniela Sauer - Kreativ Tipp - Wie Zeichne Ich Bäume PDFThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 039 - Rudolf Daumann - Freiheit Oder BananenDokument72 SeitenDas Neue Abenteuer 039 - Rudolf Daumann - Freiheit Oder BananenThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 038 - Otto Bonhoff - 20000 Für FrancasalDokument55 SeitenDas Neue Abenteuer 038 - Otto Bonhoff - 20000 Für FrancasalThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 489 - Peter Müller - Nach Der HavarieDokument55 SeitenDas Neue Abenteuer 489 - Peter Müller - Nach Der HavarieThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 491 - E. T. A. Hoffmann - Die Marquise de La PivardiereDokument49 SeitenDas Neue Abenteuer 491 - E. T. A. Hoffmann - Die Marquise de La PivardiereThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 040 - Paul Schmidt-Elgers - Gold Im UrwaldDokument36 SeitenDas Neue Abenteuer 040 - Paul Schmidt-Elgers - Gold Im UrwaldThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 492 - Horst Czerny - Sturm Auf Den SüdpolDokument53 SeitenDas Neue Abenteuer 492 - Horst Czerny - Sturm Auf Den SüdpolThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 498 - Heinz Beck - Montags SchließtagDokument59 SeitenDas Neue Abenteuer 498 - Heinz Beck - Montags SchließtagThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 494 - Hans Siebe - Gastspiel in DabentinDokument54 SeitenDas Neue Abenteuer 494 - Hans Siebe - Gastspiel in DabentinThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 493 - Paul Heyse - Die Schöne AbigailDokument45 SeitenDas Neue Abenteuer 493 - Paul Heyse - Die Schöne AbigailThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 496 - Helmut Bürger - Feuer Backbord VorausDokument55 SeitenDas Neue Abenteuer 496 - Helmut Bürger - Feuer Backbord VorausThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 497 - Lew Tolstoi - Der SchneesturmDokument53 SeitenDas Neue Abenteuer 497 - Lew Tolstoi - Der SchneesturmThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 495 - Wladimir Tendrjakow - Drei-Sieben-AsDokument66 SeitenDas Neue Abenteuer 495 - Wladimir Tendrjakow - Drei-Sieben-AsThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 499 - Anatoli Schalin - Das ComputerparadiesDokument47 SeitenDas Neue Abenteuer 499 - Anatoli Schalin - Das ComputerparadiesThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 501 - O. W. Förster - Die Kleinen Grünen MännerDokument36 SeitenDas Neue Abenteuer 501 - O. W. Förster - Die Kleinen Grünen MännerThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 509 - Horst Czerny - SOS Aus Dem EisDokument46 SeitenDas Neue Abenteuer 509 - Horst Czerny - SOS Aus Dem EisThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 504 - Hans-Peter Höschel - Perfekte KontrolleDokument36 SeitenDas Neue Abenteuer 504 - Hans-Peter Höschel - Perfekte KontrolleThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 507 - Juri Trifonow - Der Doktor, Der Student Und MitjaDokument58 SeitenDas Neue Abenteuer 507 - Juri Trifonow - Der Doktor, Der Student Und MitjaThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 503 - Kerstin Schuhknecht - Der Lange Weg Nach SelbuDokument57 SeitenDas Neue Abenteuer 503 - Kerstin Schuhknecht - Der Lange Weg Nach SelbuThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 506 - Leonelo Abello Mesa - Bis Ins Kleinste DetailDokument50 SeitenDas Neue Abenteuer 506 - Leonelo Abello Mesa - Bis Ins Kleinste DetailThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 506 - Leonelo Abello Mesa - Bis Ins Kleinste DetailDokument50 SeitenDas Neue Abenteuer 506 - Leonelo Abello Mesa - Bis Ins Kleinste DetailThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 508 - Joseph Conrad - Amy FosterDokument46 SeitenDas Neue Abenteuer 508 - Joseph Conrad - Amy FosterThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 515 - Maryse Condé - Tod Auf GuadeloupeDokument66 SeitenDas Neue Abenteuer 515 - Maryse Condé - Tod Auf GuadeloupeThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 510 - Peter Mueller - Die SilikatenDokument36 SeitenDas Neue Abenteuer 510 - Peter Mueller - Die SilikatenThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 512 - Iwan Frolow - Menschen Ohne VergangenheitDokument36 SeitenDas Neue Abenteuer 512 - Iwan Frolow - Menschen Ohne VergangenheitThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 514 - Rolf Krohn - Hannibals RacheDokument54 SeitenDas Neue Abenteuer 514 - Rolf Krohn - Hannibals RacheThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 518 - Hans Ahner - Wettlauf Am HimmelDokument57 SeitenDas Neue Abenteuer 518 - Hans Ahner - Wettlauf Am HimmelThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 517 - Alexej Tolstoi - Die Familie Des VampirsDokument48 SeitenDas Neue Abenteuer 517 - Alexej Tolstoi - Die Familie Des VampirsThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 516 - Klaus Kießling - ZeitalterDokument36 SeitenDas Neue Abenteuer 516 - Klaus Kießling - ZeitalterThussardNoch keine Bewertungen
- Das Neue Abenteuer 519 - Jaroslav Veis - Das Jackson-SyndromDokument60 SeitenDas Neue Abenteuer 519 - Jaroslav Veis - Das Jackson-SyndromThussardNoch keine Bewertungen