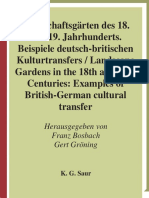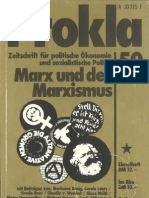Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Wolfgang Essbach-Die Junghegelianer Soziologie Einer Intellektuellengruppe-Fink, Wilhelm (1988)
Hochgeladen von
István DrimálOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Wolfgang Essbach-Die Junghegelianer Soziologie Einer Intellektuellengruppe-Fink, Wilhelm (1988)
Hochgeladen von
István DrimálCopyright:
Verfügbare Formate
bergnge
Texte und Studien zu
Handlung, Sprache und Lebenswelt
herausgegeben von
Richard Grathoff
ernhard !aldenfels
and "#
Wolfgang Ebach
Die Junghegelianer
Soziologie einer Intellektuellengruppe
Wilhelm Fink Verlag
Als Habilitationsschrift auf Empfehlung
des Fachbereichs Sozialwissenschaften der Georg-August Universitt Gttingen
gedruckt mit Untersttzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
ISBN 3-7705-2434-9
1988 Wilhelm Fink Verlag Mnchen
Gesamtherstellung: Ferdinand Schningh, Paderborn
Umschlagentwurf; Heinz Dieter Mayer
Inhalt
Abkrzungen
Einleitung ................................................................................................ 11
1. Fragestellung der Untersuchung............................................................. 12
5. Geistige Tatsachen - gesellschaftliche Bedingungen............................. 12
6. Soziologie der Intelligenz .................................................................. 14
7. bersicht ber den Aufbau der Untersuchung .................................. 24
8. Hinweise zum Umgang mit den Quellen............................................... 21
2. Zur Definition von Intellektuellengruppen im Kontext der vormrzlichen
Gesellschaft ........................................................................................ 29
9. Publizistische Antizipationen ............................................................. 29
10. Hintergrund und Diskrepanzerfahrung................................................. 35
11. bersicht ber den junghegelianischen Gruppenzusammenhang . . 40
3. Methodologisch-theoretische Fragen .................................................. 43
12. Bemerkungen zur Gruppensoziologie.................................................... 43
13. Interaktionistischer und diskursanalytischer Zugang ......................... 46
14. Zum Problem heterologer Zugnge .................................................... 50
4. Forschungen zum Junghegelianismus.................................................... 52
1. Philosophische Schule ......................................................................... 89
15. Zum Begriff >Schule<.............................................................................. 89
16. Das Bndnis der Schule mit dem modernen Staat .............................. 99
17. Beamtete Intelligenz............................................................................... 103
18. Philosophen unter sich........................................................................... 108
19. Die Polemik........................................................................................... 110
20. Selbstdefinition der Schule.................................................................... 112
21. Aufgaben der Schule............................................................................. 116
22. Erwartungen.......................................................................................... 117
23. Die Entlassung der Philosophie aus dem Staatsdienst............................ 124
24. Positionenstreit und Schulspaltung .................................................... 131
5
5
II. Politische Partei ................................................................................. 157
1. Politik als Schauspiel.............................................................................. 157
a) Das Hegeische Erbe ........................................................................ 157
b)Philosophischer Dialog als theatralische Politik.................................. 161
2 Das bergangsproblem ........................................................................ 165
3. Die praktische Konsequenz bei Feuerbach und B. Bauer........................ 169
a) Philosophie und Leben bei Feuerbach............................................... 169
b)Philosophie ohne Fessel (Bruno Bauer) ........................................... 173
4. Zum Begriff politische Partei<.............................................................. 177
5. Die Verfassungsfrage .......................................................................... 183
a) Vom Absolutismus zur konstitutionellen Monarchie ..................... 183
b) Die Widersprche des Konstitutionalismus....................................... 187
c) Liberale Partei, radikale Partei........................................................... 192
d) Demokratischer Monismus und Abschaffung des Staates.................. 197
6. Die junghegelianische Partei und die liberale Opposition .................. 204
a) Die Serenade fr Theodor Welcker und das Verhltnis
zum sddeutschen Liberalismus............................................. 206
b) Berlin und Knigsberg....................................................................... 210
c) DieJungehelianerunddie>RheinischeZeitung<................................. 212
7. Die Spaltung der Partei ...................................................................... 214
a) Vorspiel zur Spaltung: die >Freien<.................................................... 215
b) Herweghs Reise ............................................................................. 219
8. Stimmen von Zeitgenossen zum Scheitern der
jungehegelianischen Partei..................................................................... 226
III. Journalistische Boheme ...................................................................... 249
1 Beamtenkritik und Distribution der Vernunft .................................... 250
2 Pressefreiheit und Zensur........................................................................ 256
3 Der Zensor als Partner -
Kommunikationsgemeinschaft und Politik ..................................... 263
4 Theorie und Masse.................................................................................. 270
5 Theorie statt Masse ............................................................................. 280
6 Das Treiben der Boheme .................................................................... 290
a) Skandalpraxis..................................................................................... 290
b) Literarische Darstellungen................................................................... 295
c) Zum Begriff >Boheme< ...................................................................... 302
6
7
Abkrzungen
ADB Allgemeine deutsche Biographie
AfS Archiv fr Sozialgeschichte
AKG Archiv fr Kulturgeschichte
ALZ Allgemeine Literatur-Zeitung
An Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie und Publicistik
Annali Annali delT Istituto Giangiacomo Feltrinelli
Ath Athenum
BM Berliner Monatsschrift
BW Briefwechsel
DJ Deutsche Jahrbcher fr Wissenschaft und Kunst
DVjs Deutsche Vierteljahrsschrift
EB Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz
EE Der Einzige und sein Eigentum von Max Stirner
EKZ Evangelische Kirchen-Zeitung
GG Geschichte und Gesellschaft
GS Gesammelte Schriften
Hg Herausgeber
HJ Hallische Jahrbcher fr deutsche Wissenschaft und Kunst
HW G.W.F. Hegel. Werke in zwanzig Bnden
HZ Historische Zeitschrift
IRSH International Review of Social History
IWK Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung
JG Jahrbcher der Gegenwart
JWK Jahrbcher fr wissenschaftliche Kritik
KISchr Kleinere Schriften von Max Stirner
Korr Korrespondenz
KZfSS Klner Zeitschrift fr Soziologie und Sozialpsychologie
LAZfB Leipziger Allgemeine Zeitung fr Buchhandel und Bcherkunde
LFB Ausgewhlte Briefe von und an Ludwig Feuerbach
LFW Ludwig Feuerbach Werke in sechs Bnden
MEGA Karl Marx und Friedrich Engels, Historisch-kritische Gesamtaus-
gabe
MEW Karl Marx und Friedrich Engels Werke
NB Norddeutsche Bltter fr Kritik, Literatur und Unterhaltung
NDB Neue deutsche Biographie
NZSyThRPh Neue Zeitschrift fr systematische Theologie und Religionsphiloso-
phie
RhZ Rheinische Zeitung fr Politik, Handel und Gewerbe
SA Sozialistische Aufstze von Moses He
SW Smtliche Werke
WD Das Westphlische Dampfboot
8
WVjs Wigands Vierteljahrsschrift
ZfG Zeitschrift fr Geschichtswissenschaft
ZfP Zeitschrift fr Politik
ZfRGG Zeitschrift fr Religions- und Geistesgeschichte
ZPsT Zeitschrift fr Philosophie und spekulative Theologie
Vorbemerkung zur Zitierweise
Die Orthographie in lteren Zitaten wurde stillschweigend modernisiert. Hervor-
hebungen in Zitaten wurden - wenn nicht besonders vermerkt - aus dem Original
bernommen. (!) ist eine Einfgung des Verfassers. Auslassungen im Zitat werden
durch ( . . . ) gekennzeichnet. Zitierte Satzteile werden mit, oder . abgeschlossen.
Zitierte Stze dagegen werden mit . abgeschlossen. Erscheint ein Verfassername
in Klammern gesetzt, so ist die entsprechende Schrift anonym erschienen.
Die im Literaturverzeichnis als Primrliteratur aufgefhrten Quellen und Quel-
lensammlungen werden in den Anmerkungen zitiert: Autor, Kurztitel, ggf. Zeit-
schriften-Sigle und Bandangabe, Jahreszahl, Seitenangabe.
Die im Literaturverzeichnis als Sekundrliteratur aufgefhrten Arbeiten werden
in den Anmerkungen zitiert: Autor (Jahreszahl) Seitenangabe.
9
Einleitung
L'esprit abhorre les groupements. Fr den Soziologen sind diese Worte Paul
Valerys eine Herausforderung. Wem zur Gewohnheit geworden ist, menschliche
Phnomene aus der Perspektive der sozialen Beziehungen zu analysieren, der fhlt
sich gekrnkt, ein so hoch geschtztes menschliches Vermgen wie >Fesprit< in
einen unvershnlichen Gegensatz zur Gegebenheit von sozialen Gruppen gesetzt
zu sehen. Der Soziologe kann sich nun der Krnkung erwehren, indem er nach-
weist, da gerade Valerys Diktum typisch sei fr einen Intellektuellen, der die
Beziehungen zu seiner Herkunftsschicht gelockert hat, der aber sein Credo der
Unabhngigkeit von Gruppen bestimmten allgemeineren sozialen Verhltnissen
verdankt, die es ihm erlauben, die Rolle eines Einzelgngers zu spielen und auszu-
statten. Erst dort, wo eine bestimmte soziale Form, nmlich Konkurrenz auf dem
Gebiete des Geistigen, gegeben ist, hat dieser Intellektuellentyp eine Chance. Und
zur Illustration dieses Sachverhaltes bedient sich auch A. v. Martin des Valry-
schen Diktums.
1
Es fehlte also nicht an Mitteln, den Einzelgnger Valery gleichsam soziologisch
wieder einzufangen. Denn es handelt sich hier um eine Haltung, die Valery mit vie-
len anderen modernen Intellektuellen teilt, die ihrer Verachtung der Zwnge von
Gruppen aller Art Ausdruck verleihen. Nach den sozialen Bedingungen von intel-
lektuellen Produktionen zu fragen, diese Perspektive schliet zumindest eine Rela-
tivierung des Valeryschen Diktums ein. Aber der Dichter Valery hat seine Heraus-
forderung durch einen eigenartigen Einsatz erhht. Es sei daran erinnert, da
Valery nach der Publikation von Une soiree avec Monsieur Teste (1895), seine
Position verstrkend, zwanzig Jahre als Dichter schwieg. Auch dies knnte ein
Soziologe erklren und verstehen. Aber er mte sich auf die Erfahrung einlassen,
um die der Valerysche Text, der dem Schweigen vorangeht, sich zentriert: das
Erschrecken vor dieser ungeheuren Ttigkeit (. . .), die man intellektuellnennt.
2
Diese Arbeit handelt von einer Intellektuellengruppe, die gleichsam spiegelver-
kehrt das Valerysche Problem durchlebt hat. Auch diese Intellektuellen lsen sich
von ihren Herkunftsschichten ab, aber sie wollen als Intellektuelle eine Gruppe
bleiben und suchen nach einer sozialen Definition, einer Definition ihrer Beziehun-
gen untereinander und ihrer Beziehungen >nach auen<. Im Unterschied zu Valery,
der zwanzig Jahre als Dichter schwieg, haben sie mehr als sieben Jahre mit einem
intellektuellen Aufwand und mit einer Intensitt miteinander diskutiert, die in der
Geschichte intellektueller Gruppenbildungen selten anzutreffen sind.
L'esprit abhorre les groupements? Der Analyse der Intellektuellengruppe der
Junghegelianer sei Valerys Diktum als Frage vorangestellt.
11
1. Fragestellung der Untersuchung
a) Geistige Tatsachen - gesellschaftliche Bedingungen
Soziologische Theorien halten verschiedene Mglichkeiten bereit, den Zusammen-
hang von >Geist< und sozialen Formen zu interpretieren. Da ein Zusammenhang
bestehen mu, steht fr den Soziologen auer Frage. Er ist gleichsam professionell
herausgefordert, wo ein nicht sozial vermittelter >Geist< sein Existenzrecht behaup-
ten wollte. Gegen eine rein geisteswissenschaftliche Betrachtungsweise geistiger
Tatsachen hat sich in der Soziologie - insbesondere unter dem Einflu des Marx-
schen Ideologiebegriffs und der Mannheimschen Wissenssoziologie - als zentrale
und spezifisch soziologische Fragestellung diejenige nach der sozio-konomischen
und sozialen Bedingtheit geistiger Inhalte weitgehend durchgesetzt.
In der Marxschen oder marxistisch inspirierten Ideologiekritik richtet sich der
Blick darauf, welche sozialen Interessen sich in dem, was gedacht, gesagt und
geschrieben wird, ausdrcken. Ideologiekritik hat es leicht, wenn sich das soziale
Interesse unverhllt zeigt, wenn etwa die Lebensinteressen und die Lebensformen
einer Klasse verklrt, die der anderen Klasse miachtet werden. Wo in den Ideen
der Aristokratie die Verachtung brgerlichen Geschftssinnes, in den Ideen der
Brger die Legitimation des Privateigentums, in den Ideen der Arbeiter das Inter-
esse an einer sozialen Reform oder Revolution sich ausspricht, hat der Ideologiekri-
tiker keine theoretischen Probleme, weil hier seine Perspektive sich ungebrochen
bewhrt.
Probleme entstehen in den Abweichungen. Der Adelige, der sich fr die Not der
Arbeiter interessiert, und der Arbeiter, dessen >objektives Interesse< in seinen
Gedanken keinen Niederschlag findet, Gestalten, die ihre soziale Lage nicht
erkennbar widerspiegeln - der grobschlchtige Ideologiekritiker wird sie margina-
lisieren, der differenziertere Ideologiekritiker wird sein Instrumentarium verfei-
nern mssen, um vielleicht doch Latentes zu entdecken, was auf ein soziales Inter-
esse hinweist: vielleicht ein vorpolitisches, schchternes Unbehagen des Arbeiters,
Keime eines Klassenbewutseins, oder eine Krise der sozialen Stellung bestimmter
Adeliger, die den Horizont ihres festgefgten sozialen Interesses erweitert und sie
befhigt, ber ihren sozialen Schatten zu springen.
Im Gegenzug zur marxistischen Ideologiekritik hat K. Mannheim in seinen wis-
senssoziologischen Arbeiten versucht, zwischen beiden Ebenen: soziale Trger-
schaft und bestimmte Ideen, verschiedene umwegartige Vermittlungsinstanzen zu
schieben. Das soziale Interesse, das Ideologiekritik entlarve, sei nicht die einzig
mgliche Beziehung zwischen geistigen Gehalten und sozialem Sein. Vielmehr
sei das mittelbare Engagiertsein an bestimmte geistige Gehalte (. . .) die umfas-
sendste Kategorie der Funktionalittsbeziehungen zwischen geistigen Gehalten
und sozialem Sein.
3
Zwischenglieder seien umfassendere Weltbilder, Denkstile,
geistige Schichten, die eine relative Quasi-Autonomie besitzen.
Der Preis der Mannheimschen Konstruktion, daraufhaben seine Kritiker hinge-
wiesen, besteht darin, da mit der Typisierung von Zwischengliedern beide Seiten,
die es zu verbinden gilt, zunehmend verschwimmen: sozialstrukturelle Bestimmun-
gen werden zu einer allgemeinen Seinsverbundenheit, und Ideen unterliegen einem
12
genereDen Ideologieverdacht, in dem die Differenz von Theorie und Ideologie
nicht mehr auszumachen ist.
4
Ideologiekritik und Wissenssoziologie, so sehr beide Anstze sich auch befehden
mgen, der Verdacht liegt nahe, da hier theoretische Schwachstellen hin- und her-
geschoben werden. Denn die Grenze der Ideologiekritik: der Fall, in dem ein sozia-
les Interesse, das die Theorie als objektiv gegeben annimmt, nicht zu einem adqua-
ten bewutseins- oder wissensmigen Ausdruck gelangt, - diesen Fall knnte der
Wissenssoziologe erklren, indem er den Inadquatheiten nachgehend die Bre-
chungen und Verwerfungen von Weltbildern, Denkstilen und geistigen Schich-
ten nachzeichnet. Allerdings reichte die Erklrung nur bis zur Grenze der Wis-
senssoziologie, eine allgemeine Seinsverbundenheit des Denkens zu umschreiben.
Ideologiekritik und Wissenssoziologie gehen beide vom Gedanken einer letztin-
stanzlichen Homologie bzw. eines Parallelismus der sozialen Lage von Individuen
und ihren geistigen Produktionen aus. Dieser Gedanke hat eine groartige Evi-
denz, der sich niemand leicht entziehen kann. Aber ebenso evident ist, da die
Beziehung von je spezifischer sozialer Lage, sobald sie ausdifferenzierter in den
Blick gert, und geistigen Tatsachen, sobald diese mit ihrer immanenten Mehrdi-
mensionalitt entfaltet werden, ein solches Ma an berkomplexitt gewinnt, da
sich der Gedanke einer letztinstanzlichen Homologie der sozialen Lage von Indivi-
duen und ihren geistigen Produktionen im Rahmen eines Forschungsprogramms
kaum realisieren lt.
Erinnert sei an die Zweifel, die Th. Geiger gegenber dem Homologieansatz in
einem nachgelassenen Text geuert hat. Zusammenhnge zwischen Realbasis
und in Kollektiven vorherrschenden Denkweisen seien zwar aufweisbar, aber:
Soziologische Interpretation ist freilich vielfach gar zu flott im Aufweis von Entsprechun-
gen. Das alles sind doch Verstehensversuche expost. Wrde man - Hand aufs Herz! - ohne
vorheriges Wissen um die Gleichzeitigkeit von Frhkapitalismus und Renaissance beide ein-
ander zuordnen und zusammendatieren? Wrde, wenn die Kultur einer Zeit ganz anders
ausgesehen htte als es der Fall ist, unser Verstndnis- und Deutungsdrang nicht auch hier
plausible Entsprechungen aufdecken? Riecht das alles nicht ein bichen nach Rationalisie-
rung von Fakten - so etwa wie ein Historiker scherzhaft definiert hat: Geschichte ist die Wis-
senschaft, die hintennach beweisen kann, da es kommen mute, wie es wirklich kam.
3
Geigers Zweifel sind schwer von der Hand zu weisen, insbesondere wenn man
daran denkt, da die Tatsachen gesellschaftlicher und konomischer Abhngigkeit
und Verflechtung sich so tief in das Bewutsein des modernen Menschen einge-
prgt haben, da kaum noch eine Denkmglichkeit zu bestehen scheint, dem Bann
totaler Sozialvermitteltheit zu entgehen. Es ist allerdings die Frage zu stellen, wie
lange sich die groartige Evidenz einer Homologie von sozialer Lage und geistigen
Produktionen noch als tragfhig erweisen wird. F. Tenbrucks Urteil: im ganzen
hat die Soziologie niemals ein Verhltnis zu den geistigen Tatsachen des gesell-
schaftlichen Lebens gewonnen
6
, ist sicher provokativ, aber es ist gerechtfertigt
angesichts der kaum noch reflektierten Gewohnheit, die soziologische Perspektive
gegenber geistigen Tatsachen allein in der Frage nach ihrer sozialen Bedingtheit
zu sehen.
Fr marxistische Theoretiker wie O. Negt und A. Kluge ist schon auf einer
erkenntnistheoretischen Ebene der klassische Widerspiegelungsansatz nicht mehr
13
akzeptabel: die Widerspiegelungstheorie wre zutreffend, wenn wir davon ausge-
hen knnten, da sowohl das Objekt wie das Subjekt eine fertige Gestalt gewonnen
htten. Davon aber kann geschichtlich keine Rede sein.
7
Rehabilitiert wird die
strikte Unglubigkeit gegenber der vorgeblichen Materialitt der so beschaffe-
nen Wirklichkeit, und im konsequenten Idealismus entdecken sie ein Protest-
potential, das es in den Marxismus einzubringen gelte.
8
Das Modell eines Dualis-
mus von sozialer Lage und Bewutsein ist bei Negt und Kluge weitgehend aufge-
sprengt. Es gibt keinen zuverlssigen oder privilegierten sozialen Ort mehr fr
>richtiges< oder >falsches Bewutsein^ erst in der Auflsung je definierter sozialer
Lagen, d. h. an der Konfrontationsstelle verschiedener Erfahrungsbereiche
9
besteht eine Chance fr ein Ereignis von Bewutseinsarbeit, das nicht auf Entspre-
chung beruht, sondern Nichtentsprechungen entspringt.
Geistige Tatsachen - soziale Bedingungen, in dieser Arbeit versuche ich, mich
ein Stck weit von dieser Vorlage zu entfernen. Sicherlich bleibt es eine Aufgabe,
nach der sozialen Bedingtheit geistiger Tatsachen zu fragen, aber es kann sich nicht
um die einzige Aufgabe handeln. Vor allem gilt es, deutlich zu machen, da sich
soziologisches Denken nicht in dieser einen Frage erschpft, wenn es um eine
Soziologie geistiger Produktionen geht.
b) Soziologie der Intelligenz
So relativ unangefochten sich der Homologieansatz in der Soziologie ausgebreitet
hat, wo es um das Bewutsein und die geistigen Produktionen sozialer Schichten
oder Klassen geht, so kontrovers ist die Rede von der Homologie, wo es um diejeni-
gen geht, die zur Intelligenzschicht gerechnet werden knnten. Gem der Ent-
sprechungslogik ist auch der Soziologe als Teil der Intelligenz Ideenproduzent aus
einer sozialen Lage heraus. Der selbstreflexiven Sogwirkung der Entsprechungslo-
gik ist kaum zu entgehen. Wer mit Mannheim wissenssoziologisch jeder intellektu-
ellen uerung qua Seinsverbundenheit Ideologiehaftigkeit zuspricht, mu dies
traurige Los auch fr seine eigenen Arbeiten auf sich nehmen. Wer umgekehrt auf
der Trennung von Ideologie und wahrer Theorie insistiert, mu seine Wahrheit in
sozialen Kontexten bewhren. Er hat zu entscheiden, wo er die Anerkennung sei-
ner Wahrheit suchen will, und er mu einen gesellschaftlichen Kontext von Intelli-
genz mitreflektieren. Es gibt keinen Selbstausweis des wahren Bewutseins in sei-
nem eigenen Element, daran ist mit H. Plessner festzuhalten.
10
Die selbstreflexive Sogwirkung kann gebremst werden, wenn es um die Rekon-
struktion des Alltagswissens geht, an dem auch der Soziologe partizipiert. Aber
auch A. Schtz trennt sorgsam zwischen der Selbstinterpretation innerhalb der
sozialen Realitt und der theoretischen und philosophischen Behandlung des Pro-
blems.
11
Die Regeln, die innerhalb der Erkenntnisgemeinschaft wirksam sind,
soziologisch zu reflektieren, ein derartiges Unternehmen bringt den, der es ver-
sucht, zwangslufig in eine problematische Lage, weil er nicht mehr nur mit dem
erwarteten ganzen Herzen Mitglied der Gemeinschaft ist, sondern diese zugleich
mit ihrem Grund in Frage stellt. Die Reaktion von Teilen der Zunft auf den Mann-
heimschen totalen Ideologieverdacht knnte als ein soziologisches Exempel dafr
dienen.
14
Mehr als die Frage nach dem Verhltnis von Ideologie und Wahrheit, die im Rah-
men einer erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Debatte zu errtern wre,
steht im Zentrum dieser Arbeit das Problem einer Soziologie der Intelligenz, die
sich nher an einem abgrenzbaren historischen Phnomen orientiert. Aber auch die
Soziologie der Intelligenz ist berschattet von der Frage, wie Intellektuelle in den
Kontext der sozialen Interessen verschiedener grerer Gesellschaftsschichten
oder Hassen zu stellen sind. Sind sie Ideologen oder Theoretiker einer Klasse oder
sind sie eine eigene Schicht, deren kleine Interessen nicht in den groen sozialen
Interessen aufgehen und die sich z. T. davon distanzieren?
Auch diese Fragen sind von ihrem selbstreflexiven Bezug kaum zu trennen, und
sie kristallisieren sich immer wieder um jene Intellektuelle, die in hohem Mae tra-
ditions- und stilbildend fr die europische Intelligenz gewesen sind. Ohne Zweifel
sind hier an erster Stelle die italienischen Humanisten zu nennen. Nicht nur, weil es
sich um die erste grere Gruppe gebildeter Laien seit der Antike handelt, sondern
mehr noch, weil die hier ausgebildeten Formen einer intellektuellen Kultur mit
dem Selbstbewutsein der europischen Intelligenz innig verwachsen sind.
Aber die nobilitas literaria, welche sozialen Interessen knnte sie ausgedrckt
haben? Ihre Verachtung znftiger Handarbeit und der grobrgerlichen
Fixierung
auf den Reichtum, ihre nie ganz gesicherte Loyalitt der politischen Herrschaft
gegenber - wenn sie etwas ausdrcken, war es nicht die Behauptung eines eigenen
Interesses an Distanz zu sozialen Interessen?
12
Oder war ihr Insistieren auf Tugend
und Vernunft gegen stndische Herkunft tief verwoben mit dem Interesse der
auf-
steigenden brgerlichen Klasse?
13
Die ersten Intellektuellengruppe der Neuzeit,
bestand sie aus Ideologen einer Klasse, oder ist sie jenem gesellschaftlichen Unort
zuzurechnen, den Mannheim mit dem Begriff freischwebend umschrieben
hat?
14
Geht man den einschlgigen Forschungen in der Sache nach, so wird man Belege
fr beide Thesen finden. Aber es bleibt zu fragen, ob nicht trotz aller Relativierung
und Abschwchungen, die die zugespitzten Thesen erfahren wrden, wenn man
die Ideen der humanistischen Intellektuellen genauer sozial verorten wollte, der
soziologischen Analyse ein zentraler Gesichtspunkt verloren ginge.
Diesen Gesichtspunkt findet man am ehesten, wenn man das berhmte Fresco
von Raffael Die Schule von Athen (1509/10) betrachtet. (Vergleiche Abbil-
dung)
15
In unserem Zusammenhang interessiert nicht die Symbolik der 59 Gestal-
ten, die verschiedene philosophische Orientierungen darstellen. Soziologisch
bedeutsam ist zunchst, da sie nicht als kompakte Menge dargestellt sind, sondern
in einer Weise, da einzelne Personen und Teil-Gruppen flieend ineinander ber-
gehen. Was die Gre und Sorgfalt der Darstellung angeht, so hat jede Person ihre
unvergleichlich individuellen Zge. Die Personen sind zwar symbolisch plaziert,
aber ihre Bewegungen zeigen, da sie nicht an ihre Pltze gefesselt sind, sie knnen
einen anderen >Standpunkt< einnehmen, sich abwenden oder zuwenden. Die Skala
der Ttigkeiten reicht von meditativer Versunkenheit ber den beilufigenSeiten-
blick, die distanzierte Beobachtung zur intensiven Lektre und dem aufmerksamen
Gesprch.
Die Bewegungen der einzelnen Personen divergieren und konvergieren zugleich.
Die Spannung der Szene findet keine eindeutige Auflsung, auch nicht in den bei-
15
16
den Figuren der Bildmitte, die Piaton und Aristoteles darstellen. Sie gehen Seite an
Seite, harmonieren in den Gesten ihrer linken Hnde, die ein Buch halten, und sie
divergieren dramatisch in den Gesten ihrer rechten Hnde: Piaton verweist auf den
Himmel, Aristoteles ber die Erde. Das Erkennen der himmlischen Vernunft und
das Erkennen der Weltordnung - nicht durch hierarchische Setzung ist diese Alter-
native zu entscheiden, sondern nur im Dialog. Beide Protagonisten konkurrieren in
einem buchstblichen Sinne, sie gehen zusammen aus der vielleicht zeitlich zu deu-
tenden Tiefe des Raumes in die Versammlung der Intellektuellen hinein und auf
den Betrachter zu. Der Raum der Versammlung ist abgegrenzt und offen zugleich.
Es ist ein eigener Raum, aber diesen Bildraum kann der Betrachter betreten, wenn
er im Raum des Frescos in der Stanza della Segnatura sich der Szene zuwendet.
Wenn man will, ist dieser Raum historisch und systematisch offen. Systematisch in
der bildlichen Horizontalen, auf der die verschiedenen Intellektuellen synchron
versammelt sind, und historisch in der bildlichen Vertikalen, die durch den Blick
des Betrachters und die Schrittbewegung der Protagonisten gebildet wird.
Man knnte nun ideologiekritisch die synchron versammelten Intellektuellen
nach ihren unterschiedlichen Standpunkten gliedern und sie den sozialen Interes-
sen attachieren, die auerhalb des Raumes in der stdtischen Renaissancegesell-
schaft miteinander im Streit lagen. Man knnte auch wissenssoziologisch die ver-
schiedenen objektiv-geistigen Strukturzusammenhnge, den Streit der verschie-
denen Weltwollungen herausarbeiten, um Typen ihres mittelbaren Engagiert-
seins zu przisieren.
16
So legitim diese Perspektiven sind, es besteht die Gefahr,
da etwas soziologisch Naheliegendes bersehen wird: Raffaels Fresco zeigt schon
eine soziale Situation, auch ohne da die soziologische Perspektive erst umstnd-
lich von auen eingefhrt werden mte.
Das Soziale von Intelligenz besteht nicht nur darin, da sie eine gesellschaftliche
Schicht, ob nun abhngig oder >freischwebend<, in Beziehung auf andere gesell-
schaftliche Schichten oder Klassen sind, sondern zuerst schon darin, da sie gerade
in ihrer fr die europische Geschichte stilbildendsten Epoche selbst >Gesellschaft<
sind.
Der sowjetische Historiker L. Batkin, dessen Renaissancebuch mir ber die
Interpretation von Raffaels >Schule von Athen< hinaus wichtige Anregungen fr
meine Arbeit gegeben hat, macht darauf aufmerksam, da die humanistischen
Intellektuellen schon deshalb keine ideologische Gruppe sein knnen, weil ihr
Menschen unterschiedlicher ideologischer Anschauungen angehren. Batkin
spricht von einer kulturellen Gruppe, deren soziale Leistungsfhigkeit darin
bestand, da sie die gesellschaftlichen Widersprche als eigene innere Widerspr-
che deutete
17
.
Sie bilden die gesellschaftlichen Interessen nicht einfach ab, wie dies Ideologie-
kritik und Wissenssoziologie im Kern nahelegen, sondern sie bilden eine soziale
Situation, in der die gesellschaftlichen Widersprche, die divergierenden sozialen
Interessen in einer anderen Weise erscheinen und erscheinen mssen, weil die Ver-
sammlung der Intelligenz selbst eine soziale Tatsache ist. Die sozialen Interessen
werden in der Gruppe nicht verdoppelt oder reprsentiert, auch nicht auf eine
hhere Stufe gehoben, sondern der soziale Seite-an-Seite-Dialog der Intellektuellen
mit sich die zur Sprache kommenden Bedrfnisse, Interessen, Anschauungen und
17
Begrndungen an. Als einzelne mgen sich die humanistischen Intellektuellen
sozialen Interessen mehr oder weniger angepat haben. Aber als Gruppe haben sie
soziale Interessen wie Seinsgebundenheiten aller Art ihrer spezifischen sozialen
Interaktion angepat. Batkin formuliert treffend: die humanistische Intelligenz
versetzt die Gesellschaft in Erstaunen und in Bestrzung, we sie nicht ihr >ant-
wortet<, sondern sich selbst.
18
Der in dieser Arbeit gemachte Versuch einer soziologischen Analyse der Intellek-
tuellengruppe der Junghegelianer orientiert sich methodisch in erster Linie daran,
da das >Soziale< von Intelligenz ausgehend von der Gegebenheit einer Gruppe von
Intellektuellen untersucht wird. Ihren Ideen wird nicht vorab im Zusammenhang
mit den groen sozialen Interessen von Gesellschaftsschichten oder Klassen nach-
gegangen, nicht eine makrosoziologische Perspektive bildet den Ausgangspunkt,
sondern ich versuche in erster Linie, von dem kleineren sozialen Zusammenhang,
den die Junghegelianer untereinander gebildet haben, auszugehen, um von dort aus
zu analysieren, wie sie sich als Gruppe im Hinblick auf ihr gesellschaftliches
Umfeld, auf gesellschaftliche Institutionen wie den Staat, auf soziale Bewegungen
und soziale Interessen hin definiert haben.
Diesen Ansatz kann man natrlich auf zahllose Intellektuellengruppen anwen-
den. Warum soll gerade die Gruppe der Junghegelianer zum Gegenstand einer
Soziologie von Intellektuellengruppen gemacht werden? In der europischen
Geschichte sind zwar viele Intellektuellengruppen anzutreffen, aber sie sind nicht
alle gleich >bedeutsam<. Ein wichtiges Auswahlkriterium ist, ob eine Intellektuel-
lengruppe zu einem ber ihre Zeit hinauswirkenden Bezugspunkt der Selbstrefle-
xion der Intelligenz geworden ist oder sinnvollerweise gemacht werden kann.
Fr die italienischen Humanisten trifft dies ohne Zweifel zu. Der Stil und die
Normen intellektuellen Umgangs untereinander, den sie erfunden haben, ist fr die
nachfolgenden Intellektuellengruppen ber lange Zeit Muster und selbstreflexiver
Bezugspunkt gewesen. Das humanistische Modell der intellektuellen Gruppenbil-
dung hat Pate gestanden bei den Akademien und gelehrten Sozietten, die im 16.
und 17. Jahrhundert in Europa entstehen und die bis in das 18. Jahrhundert hinein
zu den aktiven Elementen der entstehenden brgerlichen ffentlichkeit werden.
19
In der revolutionren Epoche von 1789 bis 1848 verliert das humanistische
Modell intellektueller Gruppenbildung seine Bindekraft. Neben der Vera-nobili-
tas-literaria-Idee, die noch einmal in Humboldts Universittsreformideen ihren
Ausdruck findet, macht sich auch eine breiter werdende Unzufriedenheit bei Intel-
lektuellen mit dem traditionellen Soziettsmodell der Intelligenz bemerkbar. Die
Gruppe der Junghegelianer bewegt sich in diesem bergangsstadium. Sie sind
zunchst noch philosophische Schule, dem groen Muster von Raffaels >Schule von
Athen< verpflichtet. Aber dieses Muster reicht ihnen nicht mehr, und sie beginnen,
ihre soziale Situation als Gruppe umzudefinieren. In ihren Reihen kristallisieren
sich die neuen Definitionen fr das Verhltnis der Intelligenz zur eigenen Sozialitt
und der Gesellschaft >drauen<, neue Definitionen, die schon als Spektrum der
modernen Intelligenz ankndigen: sei es der Typ des sich in den Massenbewegun-
gen auflsen wollenden Intellektuellen, der Typ des randstndigen, in subkulturel-
len Gruppen sich bewegenden Intellektuellen oder der Typ, der mit Paul Valery
sagen wrde: L'esprit abhorre les groupements. Diese >offene Lage< der Gruppe
18
der Junghegelianer in der historischen Entwicklung von Intellektuellengruppen
rechtfertigt eine besondere Beschftigung mit ihnen.
20
Die Rede von der >offenen Lage< bedarf einiger Przisierungen im Hinblick auf
das Verhltnis geschichtswissenschaftlicher und soziologischer Zugangsweisen zu
historischen Phnomenen. Die wissenschaftsgeschichtlich berlieferte Abgren-
zung zwischen Soziologie und Geschichte, derzufolge im Sinne von Max Weber die
Soziologie Typenbegriffe bildet und generelle Regeln des Geschehens sucht,
die Geschichte dagegen die kausale Analyse und Zurechnung individueller, kul-
turwichtiger Handlungen, Gebilde, Persnlichkeiten erstrebt
21
, ist heute in mehr-
facher Hinsicht kaum haltbar. Nicht nur hat die Geschichtsforschung in groem
Mae, insbesondere im Bereich sozialgeschichtlicher Forschung, Typenbildung
und generelle Geschehensregeln in der Weise in ihr Denken aufgenommen, da sie
mit historischen Typen arbeitet und im Hinblick auf ber lngere Zeitrume kon-
stant bleibenden konomischen und sozialstrukturellen Gegebenheiten relativ
generelle Geschehensregeln annimmt. Auf der anderen Seite ist dort, wo Soziologie
ber die Beschftigung mit der Gegenwartsgesellschaft hinaus sich historischen
Phnomenen zuwendet - insbesondere natrlich im Bereich mehr oder weniger
marxistisch inspirierter Soziologie - die Tendenz zur Bildung von umstandslos auf
alle historischen Epochen anzuwendenden Typen und Geschehensregeln insoweit
gebrochen, als mit historischer Spezifitt zumindest gerechnet wird.
Aber trotz aller fruchtbaren berlappungen von soziologischen Theorien der
gesellschaftlichen Entwicklung und einer Geschichtsforschung, die sich als histo-
rische Sozialwissenschaft< versteht, ist das theoretische Problem, die Eigenart eines
historischen Phnomens und die nur typisch zu fassende Regelhaftigkeit sozialen
Geschehens in bestimmten Zeitrumen in eine Balance zu bringen, nicht ver-
schwunden. Es ist ein Soziologie und Geschichtswissenschaft gemeinsames Pro-
blem geworden.
Es mu aber auch darauf hingewiesen werden, da insbesondere in den letzten
beiden Jahrzehnten zwei Zugangsweisen zu historischen Phnomenen die Diskus-
sion bestimmt haben, die beide dazu geeignet waren, den Gedanken an die Ereig-
nisqualitt historischer Phnomene an den Rand zu drngen. Zu nennen ist hier
einmal die Perspektive der Kontinuitt der geschichtlichen Entwicklung.
22
Sie wird
aus vielen Quellen gespeist: dem Entwicklungsgedanken der deutschen Klassik
ebenso wie dem Bestreben, sich gerade der Kontinuitt der deutschen Geschichte
zu vergewissern. Auch die >kritische Geschichtswissenschaft zehrt von dieser Kon-
tinuittsperspektive, wenn sie sich durchhaltende obrigkeitsstaatliche und antide-
mokratische Traditionen freilegt. Zu nennen ist zum anderen die der Soziologie
entstammende strukturanalytische Perspektive. Sie fragt vorrangig nach dem syste-
matischen Charakter sozialen Geschehens und nach Funktionsbeziehungen zwi-
schen konomischen, politischen und kulturellen Sektoren. Es ist gerade diese Per-
spektive gewesen, die fr die Analyse historischer Phnomene bevorzugt genutzt
wurde.
23
Unter der doppelten Patenschaft von geschichtswissenschaftlicher Konti-
nuittszentrierung und soziologischer Gesellschaftsstrukturanalyse ist wederPlatz
fr das Verstndnis der Eigensinnigkeit historischer Phnomene noch fr eine
Soziologie des Ereignisses.
19
Die Rede von der >offenen Lage< zielt zum einen auf die Rehabilitierung der
Eigensinnigkeit des historischen Phnomens der Junghegelianer, zum anderen ver-
weist sie auf die in diesem Fall methodisch gegebene Chance, das Verhltnis von
Typenbildung und Ereignis aus einem anderen Blickwinkel zu untersuchen.
Die vorherrschende Perspektive, wonach soziologische Reflexion gerade vom
historisch Einmaligen zu abstrahieren habe, mag ihren Sinn dort haben, wo es blo
darum geht, die chaotische Mannigfaltigkeit von historischem Geschehen ordnend
zu bewltigen. Entscheidend fr die Wahl dieses Einzelfalles, der Intellektuellen-
gruppe der Junghegelianer, ist nun aber nicht gewesen, da es sich um eine Erschei-
nung handelt, die in einem direkten Sinn reprsentativ oder exemplarisch fr viele
andere Intellektuellengruppen stehen knnte. Man wird auch noch einen Schritt
weitergehen mssen und sagen: die Junghegelianer sind nicht nur nicht exempla-
risch-reprsentativ zu betrachten, sie sind auch in einem gewissen Sinne eine unty-
pische Intellektuellengruppe.
Das Untypische der Junghegelianer ist darin zu sehen, da diese Gruppe ver-
schiedene Typen intellektueller Gruppenbildungen an sich selbst experimentiert.
Das den Soziologen Herausfordernde an gerade dieser Gruppe ist, da sie in unty-
pischer Weise gleich mehrere zentrale Gruppentypen >reprsentiert<. Die Frage,
um was fr einen Gruppentypus es sich bei den Junghegelianern handelt, erhlt in
dieser Arbeit vier verschiedene Antworten: Die Junghegelianer sind eine philosophi-
sche Schule, eine politische Partei, eine journalistische Boheme und eine atheistische
Sekte. Whrend man gemeinhin davon ausgeht, da unter einen begrifflichen
Typus verschiedene empirische Gruppen zu versammeln sind, haben wir es bei die-
ser Gruppe mit dem Phnomen zu tun, da unter verschiedenen Typen eine
Gruppe anzutreffen ist.
Der sich anbietende verlegene Begriff >Mischtypus< ist viel zu ungenau, um den
Sachverhalt zu treffen. Die Eigensinnigkeit des historischen Phnomens der Jung-
hegelianer besteht gerade darin, da sich in ihren Debatten und Aktionen Typisie-
rungen herausbilden, die den spezifischen Rahmen von Selbstdefinitionsmglich-
keiten der Intelligenz in der Moderne umreien. Die historisch >offene Lage<
knnte so beschrieben werden, da sie sich in den Zwischenrumen bewegt, die
zwischen den Typisierungen liegen. Dabei sind die genannten vier Gruppentypen
nicht Kategorien, die vom Forscher erst an die Gruppe herangetragen werden
mten, vielmehr hat die Gruppe selbst in ihren Diskussionen zu einem betrchtli-
chen Teil die Arbeit der Typendefinition geleistet. Und es handelt sich dabei um
Typisierungen, die nicht zuletzt in die soziologische Begriffsbildung eingegangen
sind.
Soziologisch-historisch ist diese Arbeit in einem mehrfach verschrnkten Sinne.
Es handelt sich um die gruppensoziologische Analyse eines historischen Einzelfal-
les, dessen strategische Bedeutung darin besteht, da in der Entwicklung dieser
Gruppe soziologische Typen konturiert werden, denen als Definitionen fr kollek-
tive Verhaltensmglichkeiten von Intelligenz in der Moderne eine systematische
Bedeutung zukommt.
Die Mglichkeiten einer kollektiven oder solitren Existenz moderner Intelli-
genz, die sie ausgelotet haben, das Spektrum der Konzeptuasierungen, das sie ent-
worfen haben, kann als eine Enzyklopdie der Seinsweisen moderner Intelligenz
20
gelesen werden. Als eine besondere Gruppe haben die Junghegelianer Allgemein-
heiten produziert, an die anzuschlieen oder sie auszudifferenzieren, sie zu verwer-
fen oder apologetisch zu strken sich Generationen von Intellektuellen nach 1848
bemht haben. Die Problemlagen der staatsorientierten wie der antietatistischen
Intellektuellen, der Bewegungsintellektuellen wie der einsamen Gestalten, die Pro-
blemlagen der sthetisierenden wie der politisierenden Intelligenz von der zweiten
Hlfte des 19. Jahrhunderts bis zu neuesten Linken und denen, die im Verdacht
stehen, Verrter an irgendeiner guten Sache zu sein, finden sich mutatis mutandis
in den Debatten der Junghegelianer wieder.
Die Krise von Intelligenz in der revolutionren Epoche, die im Phnomen des
Junghegelianismus gebndelt zu beobachten ist, wirkt bis in die Gegenwart hinein.
Sie wird noch greifbar, wenn es darum geht, die Begriffe >Intelligenz< und >Intellek-
tuelle< soziologisch sinnvoll zu definieren. In der Nachkriegs-Kontroverse zwi-
schen Geiger und Schumpeter z. B. geht es im Kern darum, ob man mit Schumpe-
ter den Begriff >Intellektueller< definiert als den eines sozialen Typus, der sich des
geschriebenen und gesprochenen Wortes, ohne direkte Verantwortung fr prakti-
sche Dinge, bedient, als irgendwo auerhalb stehender Zuschauer oder als ein
sozialer Strfaktor,
24
- oder ob man mit Geiger >Intellektuelle< definiert als jene, die
im weitesten Sinne geistige Arbeit ausfhren, sei es als Arzt, Ingenieur oder Richter,
und hiervon kultursoziologisch jene >Intelligenz< unterscheidet, deren Angehrige
zwar auch Intellektuelle sind, die aber in einem engeren Sinne Schpfer von
Bestnden der reprsentativen Kultur sind, d. h. denen eine kreative gesellschaft-
liche Funktion< zukommt, die nicht in einer Rolle als >Strfaktor< aufgeht.
25
Geigers Definitionsstrategie zielte darauf ab, den Begriff >Intellektueller< von sei-
nem zweifelhaften Beigeschmack zu befreien, ein Beigeschmack, den Schumpeter
ausspielt und der in der Krise der Intelligenz, die uns anhand der Gruppe der Jung-
hegelianer beschftigen wird, mitentstanden ist. Mit seinem Begriff von >Intelli-
genz< dagegen versuchte Geiger, unter dem Funktionsaspekt das Aufspringen von
Dimensionen zu beruhigen, die als kreatives Potential in geistiger Arbeit liegen
knnen.
Die Ambivalenz des in der Soziologie verwendeten Intellektuellenbegriffs hat
H. Schelsky auf die Formel gebracht: Die Intellektuellen sind von den Selbstbe-
hauptungsinteressen der Gesellschaft her gesehen funktional ebenso unentbehrlich
wie gefhrlich.
26
Schelskys umstrittene These von einer heute heraufziehenden
priesterlichen Klassenherrschaft der Intellektuellen erinnert nicht nur in aufflliger
Weise an die ngste einiger Zeitgenossen der Junghegelianer, die von diesen hnli-
ches befrchteten. Die Junghegelianer selbst haben sich - wie zu zeigen sein wird -
am gegenseitigen Vorwurf, eine neue Religion zu verknden, aufgetrieben.
In diametralen Gegensatz zu Schelsky hat M. Foucault fr die heutige Intelligenz
das Verschwinden des Typs eines universellen Intellektuellen als eines allgemeinen
Sinnvermittlers prognostiziert, gleichsam das Ende groer Weltdeutungen, die sich
in prominenten Anwlten der Emanzipation des Menschengeschlechts verkr-
pern.
27
Auch diese These erinnert an einen junghegelianischen Gestus, nmlich an
die Rede vom Ende der Philosophie, das erreicht sei und zu neuen Orientierungen
zwinge.
21
Die wrdige, kreative Intelligenz im Sinne Geigers, der verdchtige Strfaktor
Intelligenz im Sinne Schumpeters, die Priesterherrschaftsbestrebungen der Intel-
lektuellen Schelskys und das Ende der universellen Intellektuellen Foucaults - sie
alle reflektieren bis heute die Krise der Intelligenz, die seit der Irritation des huma-
nistischen Modells intellektueller Selbstdefinition in der revolutionren Epoche
aufgetreten ist. Die Junghegelianer, die beamtete Sinnvermittler werden wollen,
aber zu Strfaktoren ihrer Gesellschaft geraten, die heute in einigen ihrer Gestalten
als Schpfer von Bestnden reprsentativer Kultur anerkannt sind, einer Kultur
freilich, die ber ihr >posthistoire< rtselt, - die Junghegelianer, sie bndeln das
moderne Problem der Definition von Intellektuellen und Intelligenz.
Von ihnen gibt es kein Bild, das nach Mastben knstlerischer Qualitt Raffaels
>Schule von Athen< vergleichbar wre. berliefert ist lediglich eine karikaturisti-
sche Gelegenheitsskizze des jungen Friedrich Engels, die eine bestimmte Gruppen-
situation (10. 11. 1842) darstellt, auf die wir im Laufe der Arbeit noch zu sprechen
kommen werden. An dieser Stelle interessiert der allgemeinere Inhalt der Szene
und ihre inhaltliche Differenz zur Schule von Athen<. (Vergleiche Abbildung)
28
Der Raum ist keine feierlich-behagliche Halle, die von harmonischen Bgen
begrenzt wird, sondern eine enge Weinstube in Berlin. Die Horizonte der Gruppe
sind zweifach symbolisiert: das Eichhrnchen verweist auf den preuischen Kul-
tusminister Eichhorn und damit auf den politischen Rahmen, in dem sich die
Gruppe bewegen mu. Die Guillotine symbolisiert den >Terrorismus der Ver-
nunft<, den Rahmen, den die Gruppe sich selbst gesetzt hat. Unter beiden Symbo-
len die Protagonisten der Szene: Arnold Rge und Bruno Bauer. Sie gehen nicht,
wie die Protagonisten bei Raffael, Seite an Seite in die Gruppe, sie gehen drohend
einander entgegen. Ihre Gesten verweisen nicht sich kreuzend und ergnzend auf
die himmlische Vernunft und die irdische Weltordnung, sie verweisen auch nicht
auf die dargestellten Symbole, sondern ihre Gesten sind fast gleichartige Kampfge-
sten von Angriff und Abwehr. Ihre Schriften halten sie nicht mehr in den Hnden,
sie sind zu Boden gefallen, in einer Turbulenz des Aufbruchs, durch den ber-
gnge zu neuen Mglichkeiten der Vernunfterhaltung gewonnen werden sollen.
Zusammengefat lautet das Programm der vorliegenden Untersuchung: Ange-
sichts der weithin anerkannten geistesgeschichtlichen Bedeutung der Junghegelia-
ner und ihrer offenen Lage< in der historischen Entwicklung von Intellektuellen-
gruppen in Deutschland sollen soziologische Zugnge entwickelt und erprobt wer-
den, die die traditionelle wissenssoziologische und ideologiekritische Vorlage
(sozialstrukturelle Bedingtheit geistiger Tatsachen) zu berschreiten suchen. Die
Junghegelianer werden als eine soziale Gruppe von Intellektuellen begriffen, die
sich im Medium der Diskussion ber das verstndigt, was der Grund ihrer Grup-
penexistenz ist. Die Diskussion wird methodisch als ein insularer Ereignisraum auf-
gefat, der berraschungen birgt, die den berraschungen, die die soziale Umwelt
der Gruppe bereitet, in nichts nachstehen.
Die Definitionen, die die Gruppe fr ihre Existenz findet, verdanken sich ebenso
der Verarbeitung ihrer Erfahrungen mit der Umwelt wie sie Antworten auf ihre
eigenen Fragen darstellen. In ihrem Streit, was es bedeutet, eine philosophische
Schule, eine politische Partei, eine journalistische Boheme oder eine atheistische
Sekte zu sein, entwirft und experimentiert die Gruppe mit den differenten Selbst-
22
23
deutungen zugleich differente gesellschaftliche Funktionen. Um gerade sie zu reali-
sieren, bedarf es jedoch nicht nur gnstiger sozialstruktureller und politischer
Bedingungen, sondern zustzlich des Zerfalls des insularen Ereignisraumes der
Diskussion. Wo dieser Zerfall stattfindet, kann von einer kulturellen Gruppe im
strengen Sinne nicht mehr gesprochen werden.
c) bersicht ber den Aufbau der Untersuchung
Zunchst einige Erluterungen zu den Junghegelianern. In dieser Arbeit wird nicht
das Gesamtfeld des Junghegelianismus untersucht, sondern ein bestimmter Aus-
schnitt. Die Untersuchung ist auf die preuischen Junghegelianer konzentriert. Auf
die schwbischen Junghegelianer,
29
d. h. die Tbinger Philosophen Strau, Vischer,
Zeller, Schwegler wird nur dort eingegangen, wo ihre Beitrge fr die Debatten der
preuischen Junghegelianer von Bedeutung sind oder wo sie Urteile ber diese
abgegeben haben, die deren Probleme erhellen. Ausgeklammert werden die
schweizerischen Junghegelianer,
i0
d. h. radikale Intellektuelle wie Dleke, Standau
und Marr, die die Diskussion der preuischen Junghegelianer rezipierten und in
Fraktionskmpfe mit den schweizerischen Frhsozialisten verwickelt waren. Wenn
in dieser Arbeit von den Junghegelianern gesprochen wird, so sind damit die preu-
ischen Junghegelianer gemeint.
In der Darstellung der Untersuchungsergebnisse dieser Arbeit habe ich versucht,
den >insularen< Aspekt der Gruppendiskussion, den Aspekt >Umwelt< der Gruppe
und den Aspekt situationsbergreifender Reflexion der jeweiligen Gruppendefi-
nitionen miteinander zu verzahnen.
Die vier zentralen Gruppendefinitionen, die die Junghegelianer an sich auspro-
bieren: philosophische Schule, politische Partei, journalistische Boheme und athei-
stische Sekte werden in den Kapiteln I-FV systematisch getrennt voneinander
untersucht. Innerhalb dieser vier Kapitel werden jeweils in einzelnen Abschnitten
- bergreifende systematische und historische Zusammenhnge, die den jeweili-
gen Gruppentypus betreffen, diskutiert.
- auf die die Gruppe umgebende soziale und politische >Landschaft< speziell in
den Ausschnitten eingegangen, die fr den Problemdruck von Bedeutung sind,
der auf die Gruppe in Korrespondenz zu ihrer jeweiligen Definition zukommt,
- die Verflechtung der Diskussion und die Modi der Selbstdeutung dargestellt und
auf ihre sozialen Effekte fr die Gruppe hin interpretiert.
Fr die Reihenfolge dieser Darstellungsebenen innerhalb der Kapitel waren
jeweils kompositorische Gesichtspunkte ausschlaggebend, um den Leser ange-
sichts der Verflechtung des Materials nicht mit unerquicklichen Redundanzen zu
langweilen.
Im zweiten Abschnitt der Einleitung erfolgt eine erste Annherung an Probleme
der junghegelianischen Gruppenbildung anhand der Frage, inwieweit in der vor-
mrzlichen Gesellschaft in Deutschland bestimmte Gruppentypen fr die Intelli-
genz gleichsam in der Luft liegen und in welchem Zusammenhang die publizisti-
sche Antizipation von Gruppenbildungen mit existierenden sozialen Verdichtun-
gen steht. Eine orientierende bersicht ber die in diese Arbeit aufgenommenen
Junghegelianer, ber die lokalen Teilgruppen und aus Spaltungen hervorgegan-
gene Brudergruppen schliet diesen Abschnitt ab.
24
Im dritten Abschnitt der Einleitung werden theoretische Przisierungen zum
Gruppenbegriff vorgenommen. Darber hinaus werden ein interaktionistischer
und ein diskursanalytischer Zugang fr die Analyse diskutierender Gruppen skiz-
ziert und das theoretische Problem der Heterologie dieser beiden Anstze errtert.
Im vierten Abschnitt der Einleitung gebe ich eine bersicht ber die bisherigen
Forschungen zu einzelnen Junghegelianern und zum Gesamtkomplex des Junghe-
gelianismus.
Die Untersuchung bezieht sich - abgesehen von den Errterungen, die soziolo-
gisch-historische Fragen zu einzelnen Gruppentypen betreffen - auf den kurzen
Zeitraum von ca. sieben Jahren. Von 1838 bis 1845/46 hat ein junghegeliani-
scher Gruppenzusammenhang bestanden, in dem die vier verschiedenen Selbstde-
finitionen der Gruppe durchdiskutiert und experimentiert wurden. Die Reihen-
folge der vier Kapitel dieser Untersuchung darf jedoch nicht einfach als >historische
Entwicklung< miverstanden werden.
Zu diesem wichtigen Punkt sind einige Erluterungen notwendig. Wollte man in
einem klassisch historiographischen Sinne die Geschichte der Junghegelianer
erzhlen, so mte man mit der philosophischen Schule und der atheistischen
Sekte beginnen und die politische Partei und journalistische Boheme anschlieen.
Aber bei dieser Reihenfolge entstnden schon gravierende Verzerrungen. Die phi-
losophische Schule bildet zwar einen Ausgangspunkt, auf den sich die Negationen,
nicht mehr nur Philosoph sein zu wollen, sondern zur Praxis berzugehen, bezie-
hen, aber im bergang bleibt auch ein Kontinuum philosophischer Schulreflexion
erhalten. Ebenso bildet der Streit um einen gemeinsamen Atheismus einen Aus-
gangspunkt, der jedoch die Gruppe nicht verlassen wird, sondern sie bis zu ihrem
Ende begleitet.
Die junghegelianischen Formeln von der Philosophie, die Partei ergreift, und der
Philosophie, die zum blasphemischen Skandal ermutigt, weisen den Gruppende-
finitionen politische Partei und journalistische Boheme jeweils eine zweite Stelle
der Entwicklung zu. Aber untereinander sind sie austauschbar: sei es, da die dro-
hende Randstndigkeit einer Bohemeexistenz den bergang zur Partei herausfor-
dert oder das Scheitern der Partei zur Boheme fhrt.
Die Geschichte der Junghegelianer mte, wollte man sie erzhlen, als ein En-
semble von mehreren Entwicklungen in den Blick geraten, denn was diese Gruppe
konstituiert, ist neben ihren bergngen zugleich ein >vibrierendes< Feld von
Simultaneitten. Dieser Umstand bringt erhebliche Darstellungsprobleme mit sich,
da es im Medium der Schrift nicht mglich ist, auf vier verschiedenen Monitoren
vier >Gruppenprogramme< gleichzeitig abzuspielen.
Mit der schlielich gewhlten Reihenfolge der Darstellung der Gruppentypen
wurde mehreren Gesichtspunkten Rechnung getragen. Die darin implizierten
theoretischen Entscheidungen seien an dieser Stelle offengelegt.
1. Von den beiden sich anbietenden Ausgangspunkten wurde die philosophische
Schule gewhlt, weil sie in der Gruppe als ein unumstrittener Ausgangspunkt
gilt. Auch nach dem Zerfall der Gruppe herrscht Einigkeit darber, da sie
ihren Anfang als philosophische Schule genommen hat.
2. Der zweite Ausgangspunkt, die Frage nach einem gemeinsamen Atheismus, ist
zwar ebenso wie die philosophische Schule vom Beginn bis zum Zerfall der
25
Gruppe gegenwrtig, aber es handelt sich um einen umstrittenen Ausgangs-
punkt. Das Problem, aus der Kritik der Religion eine gemeinsame Sache zu
machen, ist der entscheidende Destabilisator der Gruppenbeziehungen. Daher
steht die Darstellung der Gruppendefinition atheistische Sekte am Ende der
Untersuchung.
1. Von den beiden mglichen Konsequenzen, die aus der Negation der philosophi-
schen Schule gezogen werden, wird zuerst die politische Partei und anschlie-
end die journalistische Boheme dargestellt. Magebend fr diese Entschei-
dung ist die These, da die kulturelle Gruppe der Junghegelianer strukturell
politikunfhig gewesen ist. Sie haben zwar wichtige und traditionsbildende Sze-
narien von Politik entworfen, aber ihr Versuch, sich als politische Partei zu ver-
halten, ist nicht nur aus Grnden staatlicher Repression gescheitert.
2. Von dem Punkt des Scheiterns der Parteiversuche ausgehend wird die Grup-
pendefinition der journalistischen Boheme als ein Bndel von Konsequenzen
diskutiert, unterhalb der politischen Ebene und in Verbindung mit einer Kritik
der Politik die Verbreitung und die Existenz von >Geist< in der Gesellschaft zu
sichern. Die Spaltung der Junghegelianer in sich befehdende Brudergruppen,
die sich im politischen Bereich entzndet, erfhrt ihre wesentlichen argumen-
tativen Ausdeutungen im antipolitischen, politikkritischen Bereich der Frage
nach einer massenhaften, minoritren oder solitren Existenz von Vernunft und
Kritik in der Gesellschaft.
Mit der gewhlten Reihenfolge habe ich mich entschieden, aus dem Feld der
Simultaneitten einige bergnge zu privilegieren. Zugleich stellt der Aufbau der
Arbeit den Versuch dar, der eigentmlichen Kreisbewegung Rechnung zu tragen,
in deren Bann die Junghegelianer trotz all ihrer Fortschritte, ihrer berwindun-
gen und ihrer Konsequenzen, die sie ber alles geschtzt haben und von denen
zu reden sie nicht aufhren, sich bewegten, solange sie einen Gruppenzusammen-
hang gebildet haben.
Im Unterschied zu den vier Gruppendefinitionen bieten die zentralen geschicht-
lichen Erfahrungen der Gruppe eine Folge, die weniger kompliziert ist. Zu nennen
sind:
3. Die Erwartung des Jahres 1840 und die Enttuschung ber die Politik des neuen
Knigs Friedrich Wilhelm IV., die mit der Entlassung Bruno Bauers aus der
Universitt 1842 besiegelt wird. Der Umgang der Gruppe mit diesen Erfahrun-
gen ist in das Kapitel Philosophische Schule aufgenommen.
4. Das Scheitern der junghegelianischen Parteiversuche, das sich zur Jahreswende
1842/43 abzeichnet, bildet den Abschlu des Kapitels Politische Partei.
5. Die Erfahrung der Zeitungsverbote 1843, die Enttuschung ber die politischen
Mglichkeiten in Deutschland und ihre Aufarbeitungsformen werden im
Zusammenhang des Kapitels Journalistische Boheme diskutiert.
6. Die Konfrontation der Junghegelianer mit den religisen Bewegungen des Vor-
mrz, die in den Jahren 1844/45 kulminieren, wird im Zusammenhang des Kapi-
tels Atheistische Sekte errtert.
Die Reihe der geschichtlichen Erfahrungen der Gruppe geht somit als ein erzh-
lerisches Band in die Darstellung der Kapitel ein, die sich in der Hauptsachenach
den Konturierungserfordernissen der jeweiligen Gruppendefinition richtet.
26
d) Hinweise zum Umgang mit den Quellen
Aus dem bisher Gesagten ergeben sich Konsequenzen fr die Vorgehensweise die-
ser Arbeit. Wo es etwa um die soziologische Analyse grerer historischer Zeit-
rume geht, kann und mu sich der Soziologe in weiten Strecken auf die historische
Forschung beziehen, und nur in der geringeren Zahl der Flle wird er historische
Quellen selbst aufarbeiten. Im Falle dieser Arbeit war ein eigenes historisches
Quellenstudium unersetzlich.
Es galt, das zu sichern, was man den ersten soziologischen Blick auf das Material
nennen kann. Wie in dieser Intellektuellengruppe interagiert wurde, wie sie ihren
Diskurs entgrenzt und begrenzt haben, dies wird oft an Stellen deutlich, die fr die
Ideengeschichte wie fr Historiographie, weil sie etwas anderes suchen, unbedeu-
tend sind. Die Gruppendefinitionen, die in dieser Gruppe diskutiert werden, fin-
den sich nicht schon separiert in der Weise in den Quellen, da sie unter einer
Rubrik >innere Angelegenheiten< der Gruppe aufzufinden wren. Vielmehr sind sie
eng verzahnt mit dem, was man die Sachdiskussion der Gruppe nennen kann.
Hauptquellen dieser Arbeit sind die junghegelianischen Schriften, ihre Bcher,
Broschren und Zeitschriften. Mit ihnen stellt sich die Gruppe nach auen dar,
und zugleich markieren die einzlnen Gruppenmitglieder ihren Beitrag fr die
Gruppe, indem sie etwas vorlegen. Die Briefe, die sie untereinander gewechselt
haben, geben darber hinaus zustzliche Hinweise etwa auf Weichenstellungen der
Diskussion und auf Sympathien und Antipathien untereinander. Zu den Quellen,
die mitherangezogen wurden, gehren auch Urteile von Zeitgenossen ber die
Gruppe, die dann besonders wertvoll sind, wenn sie aus einer erkennbaren Nhe
heraus abgegeben werden. Von den mndlichen Diskussionen ist zum Teil berlie-
fert, wo und wann sie regelmig stattgefunden haben und wie die Zeugen das
>Klima< oder den >Ton< junghegelianischer Debatten erlebt haben. Noch zu Zeiten
der Existenz der Gruppe sind die Junghegelianer Gegenstand zeitgenssischer lite-
rarischer Darstellungen geworden.
Auf der Basis dieses Quellenmaterials wird der Versuch unternommen, die
Gruppendiskussion und die Transformationen der Selbstdefinition der Gruppe zu
rekonstruieren. Es handelt sich um eine von mir vorgenommene Rekonstruktion,
weil Diskussionsprotokolle nicht berliefert sind. Ich behandle die junghegeliani-
schen Texte gleichsam als archologische Reste, aus denen die Debatte wieder
zusammengesetzt wird. Die Theorien und Thesen der Junghegelianer interpretiere
ich, indem ich vorrangig nach dem Diskussionswert einer argumentativen Folge
frage, d. h. nach den mglichen Verwendungen im Kontext der Gruppendiskus-
sion. Eine These z. B. ber die Aufgabe der Philosophie oder ber die Form des
Staates oder ber das Wesen der Religion analysiere ich nicht primr unter der Per-
spektive einer Adquanz von Wrtern und Gegenstnden, sondern unter der Per-
spektive, wie diese These die Gruppenbeziehungen und Gruppendefinitionen ver-
ndern oder determinieren wrde, wenn sie unwidersprochen bliebe oder wenn sie
eine spezifische Korrektur oder Widerlegung erfahren wrde - kurz: ich frage
danach, wie die Gruppe als ein soziales Phnomen mit ihren Thesen leben kann.
Mein Bestreben ist, die Gruppe von einem Standort zu betrachten, der innerhalb
der Gruppe liegt, weil erst von einem derartigen Punkt aus eine sinnverstehende
27
Kommunikation mit dem Gegenstand, der in den Humanwissenschaften ein
Gegenspieler ist, denkbar ist. Da solches Sichversetzen in eine vergangene Situa-
tion mglich ist, beruht auf der menschlichen Fhigkeit zur Empathie. Ob ich nun,
an die phnomenologische Tradition anknpfend, >Intersubjektivitt< als kulturell
und zeitlich nicht beschrnkte Gegebenheit annehme, die es mir ermglicht, die
Welt mit den Augen des andern zu sehen,
31
oder ob ich mit Gadamer histori-
sches Sinnverstehen als Verschmelzung von historischen Horizonten mit dem der
Gegenwart begreife
32
- ohne eine methodisch kontrollierte Empathie sind Aussa-
gen ber Denken und Handeln von geschichtlichen Individuen nicht mglich.
Kontrolliert wird dieses >Sich-Versetzen< durch zwei Bewegungen. Einmal gilt
es, die imaginative Selbstbertragung
33
zu frdern, indem soziologische Phanta-
sie dort dem Gegenspieler/Gegenstand zuarbeitet, wo er sich >sprde< zeigt. Zum
anderen fordert die Kommunikation mit gegenspielerischem Material den For-
scher auf, seine Tendenz zu berwltigenden Kommentaren zu bremsen. Er mu
seinem >Partner< auch die Chance geben, selbst zu Wort zu kommen.
Die Aufnahme von historischen Zeugnissen in den eigenen Text geht - darauf
mu gerade im Zusammenhang dieser Arbeit hingewiesen werden - nicht auf in der
Funktion, als Belege fr die eigenen Thesen zu gelten. Das historische Zeugnis, so
sehr es auch >herangezogen< wird, verweist immer auch noch auf andere Kommuni-
kationsmglichkeiten als die gerade von mir intendierten. Schon von kleineren For-
mulierungen, mehr noch von mittleren Sequenzen junghegelianischer Texte, die als
Belege >dienen< sollen, geht eine eigenartige Wirkung aus, die zu umfassenden Ant-
worten auffordert. Das Gefhl, zur junghegelianischen Rede nicht selbst alles dazu-
gesagt zu haben, was ntig wre, hat mich beim Schreiben dieser Arbeit selten ver-
lassen.
Das generelle Problem des Umgangs mit der Tendenz, das Material kommentie-
rend zu berwltigen, stellt sich besonders scharf, wo es sich um eine intensive
Gruppendiskussion handelt, die untersucht wird. Eine Arbeit ber die Junghege-
lianer, in der nicht vom Ansatz her auch immer die Rede- und Streitlust dieser
Gruppe mitdokumentiert wrde, liefe Gefahr, ihren Gegenstand zu verfehlen. Auf
der anderen Seite ist vermehrt soziologische Phantasie dort vonnten, wo es um ein
imaginres Entwerfen von Handlungs- und Reaktionsmglichkeiten der Gruppe
angesichts eines selbsterzeugten oder von auen einwirkenden Problemdrucks
geht.
Die Gruppe von einem Standpunkt zu betrachten, der innerhalb der Gruppe
liegt, diese Perspektive mu sich der Grenzen bewut werden, die der >insulare<
Aspekt mit sich bringt. Zwar gleicht die Gruppe einer Reisegesellschaft, die sich mit
ihren Ausrstungen auf den Weg macht, aber von dem Gelnde, das sie durch-
quert, hat der heutige Forscher eine andere Ansicht als die historische Gruppe. Er
kann zwar mitverfolgen, wie die Gruppe auf die berraschungen reagiert, die
ihnen die Geschichte bereitet hat, er kann mitempfinden, wo ihre hochfliegenden
Plne scheitern, er kann die Not ermessen, die ihnen die Modifikationen ihres
Gruppenselbstverstndnisses bereitet hat, aber der Forscher kann nicht davon
abstrahieren, da er den Ausgang kennt. Die Erklrungen, die er fr das Gesche-
hen findet, die strukturellen Zusammenhnge, die er beschreibt, berschreiten die
Selbstreflexion der Zeitgenossen.
28
2. Zur Definition von Intellektuellengruppen im Kontext
der vormrzlichen Gesellschaft
a) Publizistische Antizipationen
Im Juni 1842 erscheint in der >Knigsberger Zeitung< eine Berliner Korrespondenz,
die von der bevorstehenden Grndung eines Vereins der Freien in Berlin berich-
tet.
Es habe sich eine bedeutende Anzahl von Mnnern zusammengefunden, die alle mit der
neuesten philosophischen Bewegung fortgeschritten seien. Die Freien wollten eine hn-
liche Tendenz wie der holsteinische Philaleten-Verein vertreten. Es handele sich darum,
die Grundberzeugung der modernen Philosophie, einesteils, da alle angeblichen Offen-
barungen, aufweiche sich die positiven Religionen berufen, erdichtet seien, andernteils, da
der menschliche Geist allein im Stande ist, uns in Beziehung auf bersinnliche Gegenstnde
die richtige Belehrung zu verschaffen - diese berzeugung aus der begrenzten Sphre der
Wissenschaft auch in die weiteren Kreise des Lebens einzufhren und daselbst geltend zu
machen. Der Verein verwerfe die Bibel als Quelle der Wahrheit, kein bestimmtes Glau-
bensbekenntnis werde an die Stelle der Tradition gesetzt, keine positiven Glaubensstze
aufgestellt, einzig und allein die Autonomie des Geistes als Fahne erhoben.
Whrend die Philaleten sich blo innerlich von der Kirche lossagen wollten, sei der Berli-
ner Verein der Freien jedoch entschlossen, von Anfang an entschiedener hervorzutre-
ten. Man beabsichtige als ersten Schritt, den Austritt aus der Kirche ffentlich und mit
Namensunterschrift aller seiner Mitgleider zu erklren. berlieferungen, die ihnen lngst
fremd geworden, seien ffentlich zu desavouiren. Man wolle sich Verpflichtungen ent-
ziehen, die man mit guten Gewissen nicht erfllen knne, bloes passives Verhalten nhre
den Verdacht der Heuchelei, den man um jeden Preis vermeiden wolle, die Parteien
mten sich jetzt bestimmt gruppieren.
34
Die Nachricht ber den geplanten Verein der Freien gibt eine erste Auskunft
ber die Muster von Gruppendefinitionen, die im vormrzlichen Deutschland >in
der Luft liegen<: es ist die Rede von Bewegung, Verein und Partei, Verglei-
che zu geheimen Gesellschaften werden gezogen und dagegen ffentliche Demon-
stration, die in der Nhe des Skandals liegt, befrwortet, auf philosophische Zirkel
wird angespielt, die sich als eine atheistische Gruppe bekennen wollen.
Bevor wir jedoch diesem Problembndel nachgehen, mu daran erinnert wer-
den, da sich die Nachricht ber den geplanten Verein der Freien rasch als eine
Falschmeldung herausstellte. Bruno Bauer wird die Freien spter das Gespenst
jenes Jahres (1842) nennen.
35
Wurde in Berlin tatschlich der Versuch einer Ver-
einsgrndung unternommen? Ist die Nachricht eine gezielte oder vorlaute Indis-
kretion gewesen? Die Idee eines ffentlichen Austritts aus der Kirche taucht schon
Anfang des Jahres in der junghegelianischen Presse auf.
36
Wurde die Vereinsgrn-
dung wegen der heftigen Pressediskussion und aus Rcksicht auf mgliche Bnd-
nispartner wieder abgeblasen? Oder handelte es sich um eine erfundene Denunzia-
tion, vielleicht gar nur um eine Zeitungsente? Wir wissen es bis heute nicht, die
Junghegelianerforschung ist auf Spekulationen verwiesen.
37
Greifbarer ist der publizistische Diskurs, der sich um die Freien bildet. Ein
Korrespondent der >Leipziger Allgemeinen Zeitung< bestreitet die Existenz der
Freien. Das >Frankfurter Journal< insistiert dagegen auf der Existenz dieses Vereins
29
und kann seinen Lesern sogar ein Glaubensbekenntnis jener Sektierer, die eine
neuchristliche Kirche grnden wollten, bieten, das jedoch bald dementiert wird.
Im ausufernden Streit der Korrespondenten kann auch die Interpretation aus Ber-
lin keine Sicherheit bringen, die Max Stirner liefert: der Verein existiere zwar,
aber es ist ein Verein, dem man im materiellen Sinne diesen Namen streitig
machen kann; es ist ein geistiger, kein brgerlich konstituierter, kein statutenmi-
ger, ein Verein, von dem sich nicht sagen lt, er sei hier oder dort; seine Mitglieder
sind aller Orten, und ich stehe nicht dafr, da, wenn ich mich in die nchste beste
Gesellschaft begebe, ich mich nicht in der Mitte von Vereinsmitgliedern
befinde.
38
Und die Philaleten? Sollte es eine Verbindung zu der 1773 in Paris gegrnde-
ten Freimaurer-Loge Les Philaletes geben?
39
Arnold Ruge, der ber seinen
Freund Theodor Olshausen von Philaleten wei, schreibt an Marx: die Freien
und die Philaleten, beide existieren nicht.
40
Das wichtigste Resultat der zweifelhaften Meldung ber die Vereinsgrndung
war die ffentliche Existenz des Namens der Freien als einer Gruppenbezeichnung.
Entscheidend fr einen ersten Zugang zum Problem der Gruppenbildung im
Bereich des Junghegelianismus ist, da die Definition der Gruppe der Freien
durch die ffentliche Diskussion einer zweifelhaften Meldung gleichsam von auen
zustande kommt. Es steht auer Zweifel, da in Berlin ein Gruppenzusammenhang
von Junghegelianern tatschlich existiert hat, aber die Definition der Gruppe voll-
zieht sich in einem wuchernden Diskurs journalistischer Stellungnahmen, in denen
ber die Freien oder auch nur ber die Mglichkeit eines Vereins, wie ihn die
Freien gebildet haben sollen, gestritten wird, und an diesem Metadiskurs beteili-
gen sich auch diejenigen, die man vielleicht zu den Freien rechnen knnte. Von
den einen ebenso bestimmt gelugnet wie von andern bekrftigt, schreibt
R. Prutz rckblickend, glich der Verein selbst einer jener Mythen, von denen er
angeblich das religise Bewutsein des Volks befreien wollte.
41
Von dem Bltterrauschen des Jahres 1842 ausgehend hat der Name der Freien
einen festen Platz auch in der wissenschaftlichen Literatur bekommen. Die Grup-
penbezeichnung hat sich als praktikabel erwiesen, obwohl es sich um einen Mythos
handelt. Teils werden alle im fraglichen Zeitraum in Berlin weilenden Junghegelia-
ner als Freie bezeichnet, teils nur einige und in unterschiedlichen Zusammenstel-
lungen.
42
Es bestnde auch kein Grund, an die zweifelhafte Genese des Namens zu
erinnern, wenn die hier dargestellte Definition einer Gruppe ber einen wuchern-
den journalistischen Diskurs im Bereich des Junghegelianismus ein singulres Ph-
nomen wre.
1838 erscheint die Broschre Die Hegelingen. Autor ist der konservative Hal-
lenser Professor Heinrich Leo.
43
Er dokumentiert eine Reihe von Auszgen aus den
Schriften von Hegelschlern, die seine Anklage gegen die junghegelsche Partei
belegen sollen.
Seine Thesen lauten zusammengefat: 1. Diese Partei leugne jeden Gott, der eine Person ist,
d. h. sie lehre den Atheismus; 2. sie lehre, da das Evangelium Mythologie sei; 3. sie leugne
die Unsterblichkeit und lehre eine Religion des alleinigen Diesseits; 4. sie verhlle ihre Lehre
durch eine nicht gemeinverstndliche Phraseologie und gebe sich den Anschein, eine christ-
liche Partei zu sein.
44
30
Um Belege fr diese Anklage zu finden, brauche man heut zu Tage nicht erst Philosophie zu
studieren; man begegnet ihnen in jedem Kaffeehause. Die Schriften dieser Partei seien
zwar in jedem Buchladen zu haben und wrden auf allen Wegen und Straen diskutiert,
aber die Stellen, in denen sich der Frevel offenbare, seien nicht leicht zu finden. Toleranz
sei vielleicht am Platze, wo sie allein stehen, und nur fr ihre Seelen verantwortlich sind,
aber es handele sich um Lehrer auf Universitten und Gymnasien, die der deutschen
Nation Kinder einmauern in den Grund des Turmes heidnischer Vorstellungen. Und Leo
weist prventiv schon daraufhin, da es ihm nicht um eine niedrige Denunziation gehe.
45
Im Kontext des vormrzlichen Deutschland handelt es sich natrlich um eine
Denunziationsschrift - auf diesen Aspekt werde ich noch zu sprechen kommen -;
wichtig ist zunchst, da Leo mit dieser Schrift den Namen junghegelsche Partei
publik macht. Geht man den Inhalten der Denunziation unter dem Gesichtspunkt
der Gruppendefinition nach, so handelt es sich um ein Konglomerat von Defi-
nitionsanstzen. Einmal ist es eine Sekte
46
von Atheisten, die aber als bestallte
Philosophen und Lehrer mit unverstndlich verklausulierter Phraseologie ketzeri-
sche Lehren uern, zum anderen hat diese Philosophie ihren Ort in jedem Kaf-
feehaus, schlielich handele es sich um eine in breiter ffentlichkeit diskutierte
Angelegenheit. Philosophische Schule, Partei, Boheme, Sekte - alle Gruppendefi-
nitionen sind prsent in dieser Denunziationsschrift, die wie die vier Jahre spter
kursierende Nachricht ber den Verein der Freien zu einer Flut von publizisti-
schen Stellungnahmen fhrt.
47
Gemeinsam an den geschilderten Vorgngen der Jahre 1838 und 1842 ist, da
wir es mit einer fr die vormrzliche Situation in Deutschland typischen publizisti-
schen Antizipation von Gruppendefinitionen zu tun haben.
48
Wie im Berlin des
Jahres 1842 junghegelianische Gruppen existiert haben, so haben auch 1838 Grup-
penzusammenhnge bestanden, aber als was diese Gruppen anzusehen sind, was
ihr Name ist, was ihre Kontur in Abgrenzung von anderen Gruppen ausmacht, dar-
ber entscheidet die publizistische Antizipation, sei es durch zweifelhafte Meldun-
gen oder Denunziationen, die einen wuchernden Diskurs hervorbringen.
Definitionen von auen beherrschen die Szene, und dem entziehen sich diejeni-
gen, die damit gemeint sind, nur im ersten Moment, um dann selbst die im Auen
der Gruppe erzeugten Definitionen zu bernehmen. So schreibt Ruge im August
1842: die Freien existieren nicht, wenige Monate spter hat er den Gruppenna-
men fr die Berliner Junghegelianer wie selbstverstndlich aufgenommen.
49
So
weist der Berliner Junghegelianer Eduard Meyen 1838 den Titel Junghegelianer
entschieden zurck und schreibt, da der ganze Unterschied zwischen Alt- und
Junghegeltum ein gemachter, ein erlogener ist.
50
Meyens Schrift ist im Titel
bewut Allen Schlern Hegels gewidmet, und er interpretiert Leos Denunzia-
tion als Angriff auf Hegel, die Philosophie und Wissenschaft schlechthin. Aber die
publizistische Antizipation setzt sich durch, die Rede von den Junghegelianern
geht in die Sprache der Gruppe ein. 1841 nimmt Bruno Bauer den Begriff Junghe-
gelianer in die zentrale junghegelianische Hegelinterpretation Die Posaune des
jngsten Gerichts auf, um seine revolutionre Hegelinterpretation gegen die ver-
mittelnde der Althegelianer abzugrenzen.
51
Bauers anonym erschienene Posaune ist zum erheblichen Teil inhaltlich und
formal der Denunziationsschrift Leos nachgebildet.
52
Sie ist eine Selbstdenunzia-
31
tionsschrift, denn Bauer versteckt sich hinter der Maske eines orthodoxen Neupie-
tisten, um Anklagen gegen den junghegelianischen Hegel zu formulieren. Auch
jene in margine gedruckten Hnde, die Leo an besonders verdchtige Stellen seiner
Hegelingen-Zitate hatte anbringen lassen und die die Zeitgenossen so ausfhr-
lich beschftigt haben, fehlen bei Bauer nicht. Leo selbst wird in der Vorrede als
Vorgnger besonders hervorgehoben:
Jeder, der es unternimmt, den Atheismus des Hegelschen Systems aufzudecken und anzu-
klagen, mu des Mannes gedenken, der zuerst den Mut hatte, gegen diese gottlose Philoso-
phie ffentlich aufzutreten, sie frmlich anzuklagen und die christlich gesinnten Regierun-
gen auf die dringende Gefahr aufmerksam zu machen, welche von dieser Philosophie aus
dem Staat, der Kirche und aller Sittlichkeit droht. Es ist Leo! Wir geben ihm aufrichtig die
Ehre und erkennen es vollkommen an, da er uns den Weg gebahnt hat, auch dann, wenn
wir weiter vorwrts dringen, und da er uns selbst den glcklicheren Angriff, wenn wir
glcklicher sind, mglich gemacht hat. Sein Name ist ehrenvoll in die Geschichte dieser
schmhlichen Schule verwickelt.
53
Es ist nicht leicht, die schillernde Ironie dieser Stze aufzulsen, denn in der Tat
sind die Denunziationen des Jahres 1838 drei Jahre spter in der Form der Selbst-
denunziation zu Selbstdefinitionen geworden. Und auch der Name Junghegelia-
ner, den ich im Einklang mit der Forschung in dieser Arbeit verwende, verdankt
sich der Denunziation des Jahres 1838.
54
Wie kommt es nun zu den publizistischen Antizipationen? Woher stammen die
Muster von Gruppendefinitionen, die antizipiert werden?
Die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts in Preuen sind K. Mannheim
zufolge ein soziologisches Experiment dafr, was dann geschieht, wenn Ideen, die
genuin aus einem entwickelteren Gesellschaftszustande erwachsen sind, in einen
sozial unentwickelten, geistig aber hochstehenden Lebensraum einflieen.
55
Es
sind die Ideen der Franzsischen Revolution von 1789, die in die preuische
Gesellschaft einflieen. Dieses soziologische Experiment hat verschiedene
Phasen, als deren letzte die vormrzliche Zeit gelten kann.
Es handelt sich bei diesem Einflieen um ein Geflecht uerst komplexer Vor-
gnge. Zunchst knnte davon ausgegangen werden, da die publizistische Antizi-
pation von Gruppendefinitionen eine ihrer Quellen in der verbreiteten Revolu-
tionsfurcht konservativer Kreise habe.
So prophezeit das konservative Berliner >Politische Wochenblatt<im Juli 1838,
man habe eine preuische Revolution von der junghegelschen Rotte zu erwar-
ten. Wie in Frankreich die philosophischen Theorien der Aufklrung Ursache der
Revolution gewesen seien, so wrden die junghegelschen Journalisten und
Schriftsteller Ursache der Revolution in Preuen werden. Ruge mokiert sich in sei-
ner Verteidigung, das Politische Wochenblatts habe so viele Jahre eine Revolu-
tion in Aussicht gestellt, und es wurde immer nichts daraus. Revolutionen wr-
den nicht projektiert, sie trten nur ein, wenn Entwicklungen gehemmt wrden, da
aber in Preuen der Staat das reformierende Prinzip verkrpere, so gibt es
keine Notwendigkeit, ja nicht einmal die Mglichkeit der Revolution. Und diese
Ansicht soll revolutionr sein?
36
Es handelt sich bei Ruge keineswegs um eine tak-
tische Erklrung, auch nicht um eine, die blo Rcksicht auf die Zensur nhme,
32
vielmehr ist es zu diesem Zeitpunkt die berzeugung der verdchtigten Junghege-
lianer, da eine Revolution in Preuen nicht wnschenswert ist.
So plausibel es auf den ersten Blick erscheinen mag, die publizistische Antizipa-
tion von Gruppendefinitionen auf das Drama zwischen republikanisch-revolutio-
nren-linken und restaurativ-konservativen-rechten Krften zu projizieren - in
wichtigen Bereichen greift dieses Modell nicht. Weder die Anklger der Junghege-
lianer noch diese selbst halten eine Revolution fr wnschenswert. Trotzdem mu
darber debattiert werden, und dies in einer seltsam vertauschten Perspektive: die
Rechte erwartet eine Revolution, die Linke sieht nicht einmal die Mglichkeit
dafr. Es mu hier auch daran erinnert werden, da die >Technik< des politischen
Verdachts, der sich in sozialen Beziehungen ausbreitet und Gruppierungen konsti-
tuiert, eine Erfindung der Franzsischen Revolution gewesen ist. Dieser politische
Verdacht ist genetisch ein revolutionres Instrument und rhrt von der jakobini-
schen Schreckensherrschaft her, aber es wird rasch ein gemeinsames Muster, das
>Linke< wie >Rechte< handhaben.
57
Um dem Phnomen der publizistischen Antizipation von Gruppendefimtionen
nherzukommen, ist es ntig, sich ein Stck weit von der >Rechts-Links-Vorlage< zu
lsen. So sehr sie das Denken der damaligen Zeitgenossen dominiert hat und so
sehr sie auch bis heute ein machtvolles Sortierschema geblieben ist, das jedoch
angesichts thermonuklearer Bedrohungen und kologischer Krise an berzeu-
gungskraft zu verlieren scheint - die Rechts-Links-Bipolaritt verdeckt die Tatsa-
che, da es sich auf beiden Seiten um einen gemeinsamen Erwartungshorizont han-
delt. Die Restauration ist nicht einfach nur der Gegenpol radikaler Bestrebun-
gen, wie es die zeitgenssischen Parteibegriffe nahelegen, auf beiden >Seiten< geht
es um bernahme und Antwort auf die Resultate der >Revolution<. Sie gilt allen als
das zentrale Deutungsmuster fr politische, religise und soziale Entwicklungen.
>Die Revolution^ das ist zunchst die von 1789, es ist aber auch die sich erneu-
ernde Revolution bis 1830. Man knnte sagen, fr Rechte und Linke wiederholt
sich die Revolution, wie man von einem >Zeitalter der Revolutionen spricht. Przi-
ser wre es zu sagen, da es sich nach dem Sturz Napoleons ineins um ein revolutio-
nres wie postrevolutionres Zeitalter handelt. Denn eine Wiederholung der Revo-
lution gibt es nur im Sinne der zyklischen Zeit der Mode-Struktur, wie sie J. Bau-
drillard charakterisiert hat.
58
Postrevolutionr ist die Perspektive, weil die Zeitgenossen auf den Verlauf der
Franzsischen Revolution zurckblicken knnen. Dies hat Konsequenzen fr
Rechte und Linke, weil nicht mehr nur die >Ideen< der Franzsischen Revolution in
die Diskurse eingehen, sondern auch Thesen ber ihren Ursprung, die Typizitt
ihres Verlaufs und ihr napoleonisches Ende.
Auf beiden Seiten wei man aus postrevolutionrer Perspektive um den Zusam-
menhang von philosophischen Zirkeln und Revolution, von atheistischen Gruppen
und Revolution, von Parteien in der Revolution, von der Volksbewegung in der
Revolution und von der Tugend und der Frivolitt in den neuen Gruppen, die
die Revolutionsszene beherrscht haben. Die Franzsische Revolution ist nicht das
exklusive Thema der Linken, sondern das gemeinsame Wrterbuch, aus dem
Rechte wie Linke zitieren.
Revolutionr ist die Perspektive, weil die vergangene Franzsische Revolution
33
eine Dimension erffnet hat, die auf eine europische Revolution verweist, in deren
Zentrum sich alle Beteiligten fhlen. Die gemeinsame Frage der >Radikalen< wie der
>Reaktionre< ist die nach dem Abschlu der Revolution - ein Abschlu, der von
den einen als Ende der Revolution, von den anderen als Vollendung erwartet wird.
Die Verschrnkung von postrevolutionrer und revolutionrer Perspektive tritt
besonders bei der Generation hervor, die nach der Revolution des Jahres 1830 das
gesellschaftliche Leben gestaltet. Die Julirevolution 1830 hat bei vielen Zeitgenos-
sen das Erlebnis einer Zsur provoziert. Ein scharfsinniger Beobachter wie Her-
mann Marggraff spricht von der Sonne der Julitage, die die Literatur blendend
in die Augen gestochen habe. In der Tat, man fing die Dinge an zu sehen, nicht
wie sie waren, sondern wie man sie sehen wollte; Mastab wurde die Tendenzen-
elle, die kurze und lange, die aus politischem Holze geschnitten oder aus dem zar-
ten Elfenbein sozialer Fragen gedrechselt war.
59
Die Rede von der Tendenzenelle signalisiert nicht nur ein erneutes Stadium, in
dem das Wrterbuch der Revolution wieder aufgeschlagen wird, vielmehr wird
gerade die Koexistenz von postrevolutionrer und revolutionrer Perspektive greif-
barer. Das gemeinsame Kennzeichen der neuen Generation ist, wie R. Koselleck
schreibt, da die groe Revolution fr sie bereits zur Geschichte gehrte, deren
>Vollstreckung< und >Lenkung< sie als ihre Mission betrachteten.
60
Die Revolution
ist ein historisches Ereignis, ebenso wie ein Zeitraum, auf dessen Abschlu es sich
zu konzentrieren gilt. Diese spezifische Zeiterfahrung drckt sich in bipolaren
Modellen aus: Ancien Regime/moderner Staat; Fortschritt/Restauration; alt/jung
etc. Das Netzwerk sozialer Handlungen wird mit Hilfe des Modells eines Prinzi-
pienkampfes quasi neu strukturiert. Selbstdefinition und Fremddefinition erfolgt
nach Magabe von allgemeinen Prinzipien, denen gleichsam automatisch Kollek-
tive nachgeordnet werden.
Ideen sind nicht einfach Gedanken oder berlegungen, sondern Ideen sind
virtuelle Strmungen, Tendenzen, Bewegungen. Hierin ist schon ein
Moment der Beschleunigung von Vorgngen und Ereignissen angelegt. Das Auf-
treten einer Idee verlangt geradezu nach einer Bewegung, d. h. der Antizipa-
tion eines Kollektivs, das >hinter< der Idee steht. (Spter wid Marx lapidar als sozia-
les Verhltnis das bezeichnen, was die Philosophen eine Idee nennen.
61
)
Ideenbewegung und Bewegungsideen rcken ganz nahe zusammen, im Bewut-
sein der Zeitgenossen tauschen sie sich gegenseitig aus. Soziale Zusammenhnge
geraten unter den Druck, Ideenzusammenhnge zu werden, und umgekehrt.
Die publizistische Antizipation, die nach diesem Schema funktioniert, wei
immer schon sehr frh von dem, was auf die Gesellschaft zukommen kann. >Ihrer
Zeit voraus< ist nicht nur die Linke, sondern die Rechte ebenso, denn der revolutio-
nre Kanon von Tendenzen ist geschlossen. 1838, vor Erscheinen der Hegelin-
gen, schreibt Leo ber die, die er im Auge hat:
Noch ist es gar nicht bis zu dem Punkte gekommen, wo diese liberal-revolutionre Gattung
von Leuten als irgendeine wirkliche Partei angesehen werden knnte, und ist weit eher zu
frchten, da sich in nicht zu langer Zeit in der Form einer philosophischenSchule, in deren
Terminologie die derzeitige Studiosengeneration auf einer Anzahl der bedeutendsten Uni-
versitten, ja! schon die Gymnasiasten fast berall einexerziert werden, wirklich eine neue
Partei mchtig etablieren drfte - denn die Terminologie geht nicht ohne die Begriffe auf
34
Tausende ber, und die eigentmliche Scheidung und Verbindung der Begriffe in den Kp-
fen ist allein schon hinreichend, eine neue Denkweise zu schaffen, die sofort als Macht im
Leben auftritt, wo sie in dem gleichgebildeten Ausdruck der gebildeten Stnde oder auch
nur der greren Masse in denselben eine Sttze findet.
62
b) Hintergrund und Diskrepanzerfahrung
In der Tat sind die publizistischen Antizipationen von Bewegungen und Par-
teien ihrer Zeit weit voraus. Getragen wird der publizistische Diskurs von einer
gesamtgesellschaftlich gesehen relativ kleinen Schicht. Preuen ist noch nach der
Revolution von 1848 allen Bewegungen zum Trotz ein Land, in dem der agrarische
Sektor quantitativ dominiert. 73 % der 16,3 Millionen Einwohner leben auf dem
Lande, der Rest lebt in 970 Stdten, von denen nur 300 mehr als 3.500 Einwohner
haben.
63
Diese Zahlen sind jedoch schon ein Resultat der Binnenwanderungen und
des demographischen Zuwachses der ersten Hlfte des 19. Jahrhunderts. Von
1800-1850/51 steigt die Einwohnerzahl von Berlin von 172.000 auf 419.000, die
von Kln von 50.000 auf 97.000, die von Knigsberg von 55.000 (1802) auf 73.000,
um drei Stdte zu nennen, die im Zusammenhang des Junghegelianismus wichtig
sind.
64
Befragt man Dieterici, den Direktor des preuischen statistischen Bros, der
1848/49 aufgrund einer Berufsstatistik aller ber 24 Jahre alten Mnner steuerstati-
stische Schichtungsangaben gemacht hat, so stellen die Wohlhabenden: Ritter-
gutsbesitzer, Rentiers, Offiziere, hhere Beamte sowie ein groer Teil des Wirt-
schafts- und Bildungsbrgertums alle mit mehr als 500 Taler Jahresverdienst insge-
samt 150.000 erwachsene Mnner, mit ihren Familien 3 % der Bevlkerung. Ihnen
folgt eine Mittelschicht, die im Jahr 150-500 Taler verdient und die den grten
Teil der Handwerksmeister und Krmer, die Mittelbauern sowie die untere Beam-
tenschaft umfat. In dieser Schicht zhlt Dieterici 1 Million Mnner, mit ihren
Familien etwa 30 % der Bevlkerung. Die unterste Schicht von zwei Dritteln der
Bevlkerung besteht aus Handwerksgesellen, Fabrikarbeitern, Bergleuten, Klein-
bauern, Handarbeitern, Dienstpersonal.
65
Auch dieses Bild ist schon ein Resultat verschiedener Verschiebungen im gesell-
schaftlichen Schichtaufbau: der Entstehung einer kleinen Industriellenschicht, der
Verarmung im Handwerk und - was im Zusammenhang dieser Arbeit hervorgeho-
ben werden mu - des sozialen Aufstiegs durch Bildung. Die Zahl der Gymnasia-
sten nimmt in Preuen von 1816-1846 um 73 % zu, die Zahl der Gymnasiallehrer
um 69 %. Die Zahl der Studenten im spteren Reichsgebiet steigt von 1800-1830
von etwa 6.000 auf 16.000 und pendelt sich in den 40er Jahren auf knapp 12.000
ein. Wichtig ist, da neben den Studenten aus Akademikerfamilien, die etwa die
Hlfte der Studenten ausmachen, 25-30 % Shne von Handwerkern, kleinen
Kaufleuten, kleinen Beamten und Volksschullehrern sind.
66
Zahlen wie diese knnen nur ein grobes, unzureichendes Bild geben. Lediglich
von den extremen Punkten her gesehen lassen sich zwei Beobachtungen ableiten.
Einmal finden in den genannten Bereichen der Verstdterung und der Bildung in
diesen Zeitrumen erhebliche Umschichtungen statt, aber zugleich bleibt das Bild
einer Gesellschaft, deren brgerlicher Anteil minoritr ist. Zwischen den vormrz-
lichen Antizipationen, die dem Muster der Revolution entstammen, und dem
35
gesellschaftlichen Hintergrund klafft eine betrchtliche Lcke. Allerdings erhalten
die Antizipationen Nahrung von den Verschiebungen, die in den minoritren br-
gerlichen Kreisen stattfinden. Die Uneindeutigkeit der Gruppendefinitionen, die
abstrakte Bipolaritt des Denkens resultieren zu einem erheblichen Teil aus der
Diskrepanz zwischen Antizipationen, die nicht mit Realitt gesttigt sind, und einer
weithin sehr geringen gesellschaftlichen Organisationsdichte.
Sucht man nach existierenden organisatorischen Verdichtungen im nicht-agrari-
schen Bereich der vormrzlichen Gesellschaft, so zeigen sich diese zunchst in
einem bergangsstadium. Die traditionellen Bindungen der stndischen Gesell-
schaft verlieren an Kohrenz, und strenger definierte neue Typen des sozialen und
politischen Zusammenhangs sind noch in der Experimentierphase.
An erster Stelle sind organisatorische Verdichtungen zu nennen, die im Bereich
des Bildungsbrgertums anzutreffen sind.
67
Um die Universitten bildeten sich seit
dem ausgehenden 18. Jahrhundert eine Vielzahl von organisatorischen Zusammen-
hngen, die ber die lteren korporativen Bindungen des Gelehrtenstandes hin-
ausgehend den Kreis mglicher Verbindungen auf die gebildeten Stnde aus-
dehnten. Freimaurerlogen und Clubs ebenso wie Lesegesellschaften knnen als
organisatorische Verflechtungen betrachtet werden, in die kooptiert zu werden
oder einzutreten Abstammung oder spezielle berufsstndische Herkunft weniger
wichtig waren als das allgemeine Merkmal Bildung.
68
Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert ist eine kontinuierliche Ausbreitung von
Gesellschaften, Clubs, Kreisen, Assoziationen, Vereinen aus dem bil-
dungsbrgerlichen Milieu heraus festzustellen, in denen man mit Th. Nipperdey
einen spezifischen Typus sozialer Organisation sehen kann.
69
Diese Vereine entste-
hen durch freien Zusammenschlu von Personen, deren rechtlicher Status durch
die Vereinsmitgliedschaft nicht tangiert wird. Der Vereinstypus ermglicht eine
Verdopplung der gesellschaftlichen Bindungen, die beides bedeuten kann: Ersatz
fr die brchiger werdenden korporativen Bindungen und zugleich Kreation einer
Verbindung, die eine Sphre frei verfgbarer Zwecksetzungen darstellt. Die Ver-
dopplung der gesellschaftlichen Bindungen ermglicht den Individuen, gleichsam
noch >mit einem Beim im traditionellen Bereich zu stehen, die Rechte und Begren-
zungen zu erfahren, die mit Herkunft und Beruf verbunden sind. Die Teilnahme
am Verein bedeutet keinen Bruch, sie ist ein Medium des bergangs. Erst wenn die
Verdopplung der gesellschaftlichen Bindungen in den Blick gert, wird die spezifi-
sche Struktur des Vereinsmodells deutlich.
Es handelt sich um eine generative Struktur, die virtuell jeden Zweck produzie-
ren oder sich aneignen kann (vielleicht mit Ausnahme eines Zweckes: die Aufhe-
bung der Verdopplung der gesellschaftlichen Bindungen). Die generative Struktur
des Vereinstypus ermglicht auch die Ausbildung gegenlufiger Zielsetzungen:
Spezialisierungen wie Musikvereine oder Vereine, die der Differenzierung der Wis-
senschaften folgen, sind ebenso mglich, wie Vereine, die gerade die berwindung
der Einseitigkeit zum Zweck haben. Vom Bau der Menschheit bis zum Kartoffel-
anbau reichen die Mglichkeiten des Vereinstypus, und diese seltsame Elastizitt,
diese virtuelle Ubiquitt von Verein hat insbesondere die Zeitgenossen der 40er
Jahre enorm fasziniert.
70
36
Der Vereinstypus, der, vom Bildungsbrgertum ausgehend, langsam, vor allem
in den 40er Jahren, auch andere Schichten berhrt, ist den organisatorischen Ver-
dichtungen, die z. B. im Bereich des Handwerks existieren, schlielich berlegen.
Das Handwerk verfgt ber eine lange Tradition zunftmiger Organisationsfor-
men. Mit dem demographischen Zuwachs und der berfllung der Handwerksbe-
rufe geraten die traditionellen Organisationsformen unter einen erheblichen
Druck; in der Folge entsteht eine handwerkliche, teils schon frhindustrielle
Unterschicht. Aus ihr rekrutieren sich die geheimen Handwerkerbnde, in die das
ausgereifte Organisationswissen der Handwerkskultur Eingang findet. Zum tradi-
tionellen Bestand gehren komplexe Initiationsriten, Techniken der Esoterisierung
des Berufswissens, Verfahren der Diskriminierung von Nichtdazugehrigen vor
allem auch im Bereich der berregionalen Kontakte, die angesichts der hohen und
ja auch institutionalisierten Mobilitt den organisatorischen Bestand sichern.
71
So hoch entwickelt das Organisationswissen im Bereich des Handwerks auch ist,
erst in dem Mae, in dem die Handwerkerbnde eine den Zunftcharakter ber-
schreitende Vereinsform gewinnen und sich z. B. zu verschriftlichen beginnen, ent-
stehen Chancen, da auch Angehrige anderer Gesellschaftsschichten, die ihre tra-
ditionellen Bindungen lockern, Zugang zu diesen Bnden gewinnen. He' und
Marx' Kontakte zum Handwerkerkommunismus stehen beispielhaft fr diese Ent-
wicklung.
Auf der anderen Seite tangiert der Vereinstypus in besonderem Mae die staatli-
che Organisation. Das Verhltnis von Verein und Staat ist in der ersten Hlfte des
19. Jahrhunderts ambivalent. Auf der einen Seite besetzen Vereine die Handlungs-
felder, die gleichsam staatsfrei, privat sind, auf der anderen Seite wollen Vereine in
den staatlichen Handlungsfeldern untersttzend wirken, wo sie meinen, da etwas
getan werden mu, oder der Staat selbst initiiert oder frdert Vereine. Es mu dar-
auf hingewiesen werden, da der Vereinstypus, bezogen auf den Dualismus von
Staat und Gesellschaft, nicht quasi automatisch dem Bereich >Gesellschaft< zuge-
schlagen werden darf.
72
Zum Bildungsbrgertum gehrt auch ein groer Teil der Staatsbeamten, die ihre
im Vereinswesen erlernten Formen der geselligen Kommunikation, der Errterung
von Zielen und Mitteln auch in der Verwaltung praktizieren.
73
Seitdem es insbeson-
dere zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Phase der ffnung des Staates fr das Bil-
dungsbrgertum gegeben hatte, verschmelzen die organisatorischen Verdichtun-
gen im Bereich des Vereinswesens zu einem Teil mit denen der Verwaltung.
So ermglicht etwa die Institutionalisierung des Kollegialittsprinzips die Dis-
kussion aller wichtigen Gesetzesentwrfe, eine Diskussion, von der die zur Libe-
ralitt angehaltenen und z. T. sehr selbstbewuten Beamten auch ausgiebig
Gebrauch machten.
74
Sucht man in der ersten Hlfte des 19. Jahrhunderts in Preu-
en nach dem, was J. Habermas das rsonierende Brgertum nennt, das sich kol-
lektiv ber politische und gesellschaftliche Fragen verstndigt, so wird man auch
auf die preuische Verwaltung stoen, fr die eine grndliche Errterung Vorrang
vor einer schnellen Exekution hatte. Viele Gesetze bedurften gleichsam dreier
Legislaturperioden, manchmal Jahrzehnte, bevor sie durchgefhrt wurden. Die
Diskussion artete - auf dem Umweg ber die Schriftlichkeit - allzusehr in eine stn-
dige gegenseitige Belehrung aus. Die sich dauernd belehrende Beamtenschaft
37
brachte ein professorales Element hervor, das den Innenaspekt bietet einer Verwal-
tung, die nach auen den Erziehungsstaat verkrperte.
75
Erst von der ambivalenten Stellung des Vereinstypus her, einer Stellung, die teils
im staatsfreien Raum, teils als Bindeglied oder Vermittlungsform zwischen den
individualisierenden Tendenzen der brgerlichen Wirtschaftsgesellschaft und dem
politischen Staat und teils als halbpolitisches Element des Staates selbst zu sehen
ist, lassen sich jene Uneindeutigkeiten erklren, die fr Gruppenbildungen in die-
ser Zeit charakteristisch sind. Vereine, die sich vereindeutigen lieen, indem man
etwa auf eine Vertretung von Gruppeninteressen im modernen Sinne abstellte,
wird man eher in der zweiten Hlfte des 19. Jahrhunderts finden. Der vormrzliche
Verein ist dagegen ein Amalgam von freier Geselligkeit, Bildungsdrang und Ver-
breitung von aufgeklrten Grundstzen.
Es ist dieses bildungsbrgerliche Netzwerk von Organisationskernen, das sich
seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert in den Stdten ausgebildet hat, das nach
1819 zunehmend unter den Verdacht der Revolution gert.
76
Aus dieser Perspek-
tive erscheinen die Vereine als prpolitische oder kryptopolitische Organisationen.
Der Verdacht vereindeutigt den ambivalenten Charakter der Vereine. Zeitgenos-
sen haben diese Tendenz aufmerksam registriert. Man redet in den Gesellschaf-
ten davon, da die Geselligkeit anfinge zu stocken, da die kleinen Gesprche in
den Fensternischen, das Geflster zu Zweien und Dreien Mode wrde.
77
Die 40er
Jahre stehen im Zeichen einer zunehmenden Politisierung der Vereine. Die junghe-
gelianische Gruppenbildung hat ihren Ausgangspunkt im Kreuzungsbereich von
akademischen Zirkelwesen und Verein, die beide auf eine Verbindung zu aufge-
klrter Verwaltung hin angelegt sind. An der Politisierung dieses Komplexes neh-
men die Junghegelianer regen Anteil.
Es ist blich geworden, davon zu sprechen, da es sich beim bildungsbrgerli-
chen Vereinswesen des Vormrz um eine Art Ersatzpolitik gehandelt habe. Dies
trifft sicher zu. Aber die Rede von der Ersatzpolitik bedarf einer wichtigen Ergn-
zung. Fr weite Kreise des Bildungsbrgertums war der Verein ebensosehr Ersatz-
gemeinde. Es mu daran erinnert werden, da es im Unterschied zur angelschsi-
schen Entwicklung im nachreformatorischen Deutschland nicht zur Ausbildung
eines staatsunabhngigen kirchlichen Gemeindelebens gekommen ist.
78
Sowohl das landesherrliche Kirchenregiment wie die inneren Auswirkungen von
Luthers Kirchenbegriff, der den Akzent auf die unsichtbare Kirche gelegt und
die ueren Einrichtungen nur als einen Not-bau betrachtet hatte, blockierten die
Entwicklung von kirchlichen Einrichtungen, in denen sich religise Bedrfnisse
wirksam htten artikulieren knnen. Auch die einzig relevante Gegenbewegung
zur lutherischen Orthodoxie, der Pietismus, zielte mehr auf eine Strkung der
Frmmigkeit als auf die Ausbildung von ueren Formen kirchlichen Lebens,
obschon gerade vom Pietismus indirekt wichtige Impulse zur Gemeinschaftsbil-
dung ausgingen. Fr die bildungsbrgerliche Intelligenz um 1800 ist die protestan-
tische Kirche wenig attraktiv. Eher schliet sich ein aufgeklrter Pfarrer einem
geselligen Verein an, als da die, die er dort trifft, in die Kirche gehen.
Selbst in den Reformen, die nach 1806 begonnen wurden, kommt es - worauf
H. Holborn hinweist - nirgends ( . . . ) zu einer Ersetzung des landesherrlichen
Kirchenregiments durch volkstmliche Kirchenverfassungen. (. . .) Die protestan-
38
tischen Kirchen blieben zwar Volkskirchen in dem oberflchlichen Sinne, da jedes
Volksmitglied in sie hineingeboren wurde, aber nicht in dem Sinne, da die Kirche
eine volkstmliche Leitung erhielt, noch da sie sich der Vielzahl derjenigen
Lebensprobleme des Volkes widmete, die religis von gleicher Bedeutung waren
wie die Theologie des Bekenntnisses.
79
In den 40er Jahren wird das bildungsbr-
gerliche Vereinswesen nicht nur von einer Welle der Politisierung, sondern ebenso
von einer Welle der Religiositt erfat.
80
Zusammengefat mu festgestellt werden, da die wichtigsten organisatorischen
Verdichtungen im vormrzlichen Preuen im Bereich des bildungsbrgerlichen
Vereinswesens anzutreffen sind. So dramatisch es sich auch in den 40er Jahren ent-
wickelt, es darf nicht bersehen werden, da es sich gesamtgesellschaftlich gesehen
um >minoritre< Organisationszusammenhnge handelt. Diese Organisationskerne
sind die >Basis<, von denen die publizistische Antizipation von Gruppendefinitio-
nen, die dem Muster der Revolution folgen, ausgeht.
81
Die Antizipation und imaginative Beschleunigung geht jedoch auch einher mit
der Erfahrung der Diskrepanz. Die Diskrepanz von geringer gesellschaftlicher
Organisationsdichte und der publizistischen Imagination von Organisiertheit, die
dem Muster der Revolution abgelesen ist, durchzieht alle vormrzlichen Debatten
um Gruppenbildungen. In den Texten der radikalen Zeitgenossen kommt diese
Diskrepanz als ein Defiziterlebnis zum Ausdruck.
Fr Marx stehen die deutschen Zustnde unter dem Niveau der Geschichte,
und er vergleicht das Deutschland von 1843 mit dem Frankreich von 1789.
82
Feo-
dor Wehl klagt in seinen >Berliner Wespen<: Berlin hat keine ffentlichkeit wie
London und Paris, wo die Politik ihre Stimmen erheben und ihre geheimsten Tie-
fen offenbaren kann. (. . .) Welche Daten fehlten in der Historie, wenn Paris und
London fehlten? Berlin kann man streichen und keine Jahreszahl geht ihr verloren.
Berlin ist nur die Stadt, wo die Weltgeschichte sich zur Ruhe setzt.
83
R. Prutz mu sich noch 1847 mit den Zweifeln auseinandersetzen, ob, wo und
wie denn berhaupt eine Opposition bei uns existiert. Sein Bild der Opposition
ist England und Frankreich abgelesen, er denkt an Gruppierungen, die sich kei-
neswegs in den Kreisen der sogenannten Gebildeten, einer geringen Anzahl von
Deputierten und Abgeordneten, einer Handvoll Schriftsteller abschlieen: viel-
mehr durch alle Stnde, alle Klassen der Gesellschaft, durch die ganze Nation
erstrecken. Solche Gruppierungen existieren in Deutschland nicht, denn man
habe es berhaupt noch nicht mit einem wirklichen Staat, sondern mit einem
abstrakten, illusorischen Staat zu tun. So seien Staat und Opposition beides
Schattengebilde. Wir setzen Abstraktion gegen Abstraktion, Formalismus
gegen Formalismus, Schatten gegen Schatten; es ist eine Geisterschlacht.
84
Zwischen publizistischer Antizipation und der Wirklichkeit der Gruppen, zwi-
schen der Erwartung von Tendenzen und Bewegungen, ber die man schon eine
genaue Vorstellung hat, und dem Defiziterleben besteht ein Geflle, das kaum
noch auszugleichen ist. Geisterschlacht ist ein Ausdruck, der die Auseinander-
setzungen um die junghegelsche Partei und den Verein der Freien przise
trifft.
Leider ist es kein soziologischer Begriff. Er knnte vielleicht eine soziologische
39
Qualitt gewinnen, wenn man daran erinnert, da es gerade der Junghegelianer
Marx war, der Geisterschlachten in den Bereich des berbaus verbannte, der
eine theoretische Weichenstellung vollzog, die in der vormrzlichen Diskrepanzer-
fahrung ihren Ausgangspunkt hatte. Die Anerkennung der Geisterschlacht als
eines Phnomens, von dem auszugehen ist, und die Depotenzierung des Phno-
mens als berbau folgen einer gemeinsamen Struktur, die von der Frage nach dem
Ort und Grund von >Geist< beherrscht ist. Vor den Antworten auf diese Fragen lie-
gen aber Erfahrungen, die diese Frage zur Frage werden lassen.
Auszugehen ist von der Diskrepanzerfahrung, sie lt den Ort und den Grund
von >Geist< extrem unsicher erscheinen. Orientiert am englischen und franzsi-
schen Beispiel wei man schon, da Ideen fr Bewegungen stehen, aber im
eigenen Lande ist man sich nicht sicher, ob hinter den Ideen - das Bildungsbr-
gertum in Deutschland zweifelt nicht im mindesten daran, da es selbst voller
Ideen steckt - auch das zu finden ist, was eine bloe Idee zu einer wirklichen
Idee macht. Daher sind nicht nur die Ideen abstrakt, sondern auch die Wirk-
lichkeit. Im Verein haben zwar die Ideen ihren Ort und ihren Grund, aber der
Vereinstyp ist ambivalent. Er steht zwischen Staat und Gesellschaft, er geht nicht
auf in den Interessen der brgerlichen Wirtschaftswelt, und er steht nur im Traum
vom Verein freier Menschen fr den Staat. Und schlielich bringt die Verdopp-
lung der sozialen Beziehungen im Verein ein neues Moment der Unsicherheit her-
ein. Seine generative Struktur, die Vielzahl mglicher Zwecke - macht sie nicht
gerade das feste Band zu einem gefhrlichen imaginren?
Intellektuellengruppen im Vormrz bewegen sich in einem seltsamen Zwischen-
reich von Idealitt und Realitt. Diese Ausgangslage gilt es gegenber voreili-
gen Vereindeutigungen, zu denen jede Forschung neigt, zu affirmieren. Die Diskre-
panzerfahrung ist, genau genommen, nicht einfach die Erfahrung eines Geflles
zwischen dem, was erwartet wird, und dem, was ist. Die buchhalterische Sicherheit
des Soll und Haben gewinnt die bildungsbrgerliche Intelligenz erst nach
1848.
85
Diskrepanzerfahrung ist vielmehr die Erfahrung des Fallens und der
Bodenlosigkeit, des Abstrakt-Seins der Geister-Schlacht.
c) bersicht ber den junghegelianischen Gruppenzusammenhang
An dieser Stelle mchte ich eine orientierende bersicht ber den junghegeliani-
schen Gruppenzusammenhang geben, um die Personen, deren Handeln in dieser
Arbeit untersucht wird, vorzustellen und ihren Ort im Netzwerk der Gruppenbe-
ziehungen aufzuzeigen. Biographische Kurzinformationen werden in den Anmer-
kungen gegeben.
Etwa um 1837 sind junghegelianische Gruppen - abgesehen von Tbingen - in
Berlin und in Halle nachweisbar. Anfang der 40er Jahre haben sich in Kln sowie in
Knigsberg Gruppenzusammenhnge herausgebildet, die junghegelianisch
genannt werden knnen.
In Halle entsteht 1837 in einem Kreis junger Privatdozenten, Professoren und
Lehrer um Arnold Ruge die Idee einer Zeitschrift, die sich als Gegenprojekt zu den
von Hegel gegrndeten Berliner Jahrbchern (JWK) versteht. Wichtig fr die
Gruppenkonstitution ist, da Ruge eine Werbereise unternimmt, d. h. gleich auf
40
einen berregionalen Zusammenhang zielt, den er als Herausgeber der >Hallischen
Jahrbcher< (HJ) organisatorisch mit zusammenhlt. - In Berlin ist in dieser Zeit
ein philosophischer Schulzusammenhang von Hegelschlern vorhanden, aus dem
sich eine Gruppe, der berhmte Doktorclub, in dem der junge Marx sich
bewegte, herauslst. Durch Wohnortswechsel bzw. Reisettigkeit werden Grup-
penzusammenhnge im Rheinland (besonders Kln) und Knigsberg initiiert oder
lokale Anstze gefrdert. Die Zusammenhnge an verschiedenen Orten mssen
deshalb als Gruppen bezeichnet werden, weil sie ber lngere Zeit sich in regelm-
igen Treffen und Diskussionen ber gemeinsame Ziele realisieren. Diese regiona-
len Teilgruppen bilden insofern miteinander einen berregionalen Zusammen-
hang, als durch Reisen, Briefe und persnliche Freundschaften eine Kommunika-
tion hergestellt wird, die die fortlaufende gegenseitige Rezeption der Verffentli-
chungen der Gruppenmitglieder erleichert. Im Hinblick auf die in dieser Arbeit
genannten Junghegelianer stellt sich der regionale wie berregionale Gruppenzu-
sammenhang so dar:
A. Ruges
86
Kreis in Halle steht in Verbindung und Differenz mit den hegeliani-
schen Universittsmitgliedern, insbesondere mit den Althegelianern Friedrich W.
Hinrichs
87
und Julius Schallet
88
; zum Rugekreis sind der Junghegelianer Robert
Prutz
89
und der Mitherausgeber der Jahrbcher Theodor Echtermeter
90
zu rech-
nen.
91
1841 bersiedelt Ruge nach Dresden und befreundet sich dort mit Michail
Bakunin
92
, der sich zuvor in Berliner Junghegelianerkreisen bewegt hatte. Ruge
sucht schon frh den Kontakt zu Feuerbach
93
, der gesellige Zusammenhnge mei-
det, dafr aber durch seine Schriften und Briefe mit der Gruppe verflochten ist.
Ebenso besteht eine Verbindung zwischen Ruge und Karl Theodor Bayrhoffer
94
in
Marburg. Der Kontakt ins Rheinland luft ber Georg Jung
95
, der dort zusammen
mit Moses Hess
96
das Projekt der >Rheinischen Zeitung<
97
initiiert, zu dem auch Karl
Heinzen
98
stt.
In Berlin gehren dem Doktorklub
99
1837 Bruno Bauer
100
, Adolf Rutenberg
101
Karl Friedrich Kppen
102
und Marx
103
an, vielleicht auch schon Edgar Bauer
104
und
Mitglieder, die 1841 die Zeitschrift >Athenum<
105
tragen, u. a.: Karl Riedel
106
, Edu-
ard Meyen
107
, Karl Nauwerck
108
, Ludwig Buhl
109
und Friedrich Engels
110
. Wann Stir-
ner
111
zu diesem Kreis stt, ist unbekannt, mit Engels verband ihn eine Duz-
freundschaft. Von den lteren Berliner Hegelschlern, die engere Beziehungen zu
den Junghegelianern haben, sind Eduard Gans
112
und Karl Ludwig Michelet
113
zu
nennen. - Zwischen Berlin und dem Rheinland bestehen enge Verbindungen nicht
nur durch die Wohnortswechsel von Bauer, Marx und Rutenberg, sondern auch,
weil die Athenenser zu regelmigen Mitarbeitern der >Rheinischen Zeitung<
(RhZ) werden.
In Knigsberg
114
lehrt der Freund Ruges und Althegelianer Karl Rosenkranz
115
.
Zu den Knigsberger Junghegelianem gehren Rudolf GottschaU
116
, Wilhelm
Jordan
117
, August Witt
118
, Karl Reinhold Jachmann
119
und Eduard Flottwell
120
, der
sowohl engen Kontakt zu Berlin wie zum Rheinland besitzt.
Ein wichtiges >Zentrum< fr Gruppenverdichtungen wie fr den Umschlag von
Schriften und Ideen ist das Ausland gewesen: insbesondere die Orte Zrich
121
,
Paris
122
und Brssel
123
. Herwegh
124
und Venedey
125
gehren mit zu den Emigranten,
die fr die Junghegelianer Bedeutung gewinnen, bevor einige von ihnen selbst
Exilerfahrungen machen mssen.
41
Neben der regionalen Gliederung sind fr das Entstehen von Teilgruppen Spal-
tungsprozesse magebend. Sie lassen sich am ehesten in Berlin verfolgen. In den
Jahren 1843-1846 existieren, wenn man die krglichen Quellenhinweise heranzieht
und die entsprechenden theoretischen Positionen bercksichtigt, in Berlin drei
Gruppenkerne, wobei Doppelnennungen die berlappungen zeigen:
- Eirr Gruppenkern um Rutenberg, Nauwerck, Meyen, der Positionen eines sozial-
kritisch getnten republikanischen Radikalismus vertritt;
126
- ein zweiter Gruppenkern um Buhl, Stirner, Jordan, Meyen, Kppen und
E. Bauer, der einen parteikritischen antiautoritren Radikalismus vertritt;
127
- ein dritter Gruppenkern, der sich um die von B. Bauer herausgegebene >Allge-
meine Literaturzeitung< (ALZ) und die >Norddeutschen Bltter< (NB) kristalli-
siert und dem neben B. Bauer u. a. Ernst Jungnitz
128
Julius Taucher
129
, Szeliga
130
,
E. Bauer und Karl Schmidt
131
angehren. Diese Junghegelianer knnen mit der
>reinen Kritik< in Verbindung gebracht werden. Kontakte bestehen zu der seit
Beginn der 40er Jahre in Kthen existierenden >Kellergesellschaft<
132
. (Erwhnt
sei, da dieser Gruppenzusammenhang mit einer Leipziger Dependance um
Gustav Julius
133
in Verbindung gebracht wird.)
Regionale Differenzen und Gruppenspaltungen drfen nicht darber hinweg-
tuschen, da es sich bei der junghegelianischen Gruppenbildung um ein kohren-
tes Phnomen handelt. Der gemeinsame Ausgangspunkt ist theoretisch dieHegel-
sche Philosophie
134
und sozial die Hegelsche Schule
135
. Der Junghegelianismus ist
nicht einfach eine geistige Strmung, deren Rnder zerflieen, sondern ein
begrenzter Gruppenzusammenhang. Zu den Junghegelianern werden in dieser
Arbeit diejenigen gerechnet, die ausgehend von der Spaltung der Hegelschule sich
in einem eigenstndigen Gruppenzusammenhang konstituieren, indem sie ihre
Ausdeutung der Hegelschen Philosophie nicht als einzelne denkerische Initiativen,
sondern als einen neuen Diskussionsrahmen setzen. Wer in diesen Kreis eintritt,
mu sich gleichsam auf den Boden der junghegelianischen Hegelinterpretation
stellen. Das Zentrum dieser Interpretation ist die Erweiterung der philosophischen
Reflexion um die Frage nach der Verwirklichung der Philosophie.
Der Begriff >ideologische Gruppe< soll hier nicht verwendet werden, da er in
erster Linie an modernen Erscheinungen: wie z. B. den ideologischen Eliten oder
an parteipolitischen Fraktionierungen orientiert ist.
136
Zwar wird man sagen kn-
nen, da in den junghegelianischen Gruppenspaltungen das moderne Phnomen
ideologischer Gruppen sich auftut, da es sich, so gesehen, um protoideologische
Gruppen handelt, aber eher zutreffend ist der Begriff der >kulturellen Gruppe<.
Denn die Gruppenmitglieder vertreten nicht nur divergierende >Ideologien<, viel-
mehr besteht gerade das >Wir< der Gruppe darin, da sie im Medium der Sprache
und des Dialogs ihre Intentionen aneinander bilden und korrigieren. Dies tun sie
im Bewutsein, mit der Hegeischen Philosophie zugleich das kulturelle Erbe des
Abendlandes anzutreten. Dies kann man ihnen natrlich streitig machen, aber dazu
mu man das tun, was sie auch getan haben: in einer kulturellen Gruppe diskutie-
42
3. Methodologisch-theoretische Fragen
a) Bemerkungen zur Gruppensoziologie
Ein fr den Soziologen meist untrgliches Merkmal von bergangszeit ist die Kon-
junktur von Gruppen. Dies gilt fr den Vormrz ebenso wie fr die Gegenwart. In
Zeiten sprbareren sozialen Wandels - mag er sich nun mehr im sozialstrukturellen
oder im normativ-kulturellen Bereich vollziehen - machen die Individuen in ver-
mehrtem Mae Gebrauch von ihrer Fhigkeit, ber die gegebenen sozialen Ver-
flechtungen hinaus Gruppen zu bilden. So hat auch das Wort >Gruppe< in den
Sozialwissenschaften in den letzten Jahren eine modische Konjunktur erfahren, die
es erforderlich macht, den Begriff >Gruppe< prziser zu definieren.
137
Der offen-
sichtliche Nachteil des Begriffs >Gruppe< ist, da er nahezu ubiquitr zu verwenden
ist. Aber diese miliche Unscharfe, verweist sie nicht auf Verunsicherungen, denen
das Denken ber Gesellschaft ebenso wie die soziale Selbstverortung der Indivi-
duen ausgesetzt ist? Von Gruppen zu reden, dies signalisiert zwar ein Gesellschaft-
liches, aber weniger mit der Schwerkraft, die Begriffe wie etwa >Klasse< oder Insti-
tution mit sich fhren, als vielmehr mit einer Art zukunftsgerichteter Tnung, die
mehr auf die Mglichkeit von Gesellschaft sich richtet. >Gruppe< ist im doppelten
Sinn ein leichtsinniger Begriff. Er zielt mehr auf die Kreation von sozialen Bezie-
hungen, als auf >angestammte< soziale Bindungen.
Um dem Begriff der sozialen Gruppe einen przisen Sinn zu geben, ist es nicht
sinnvoll, ihn als bloes Substitut fr scheinbar >unpassende< andere Begriffe zu nut-
zen. Wenn in dieser Arbeit von einer Intellektuellengruppe die Rede ist, so ist damit
der Begriff der Intelligenzschicht nicht einfach aufgelst, denn nur dort, wo soziale
Beziehungen zwischen Intellektuellen existieren, kann berlegt werden, ob es sich
um eine Gruppe handelt.
138
Viele Mitglieder der Intelligenzschicht sind eben nicht
zugleich Mitglieder in Intellektuellengruppen. Auch reicht das Bestehen von sozia-
len Beziehungen nicht aus, um von einer Intellektuellengruppe zu reden. So tritt
zwar jeder Autor, der etwas publiziert, in eine soziale Beziehung zu seinen Kolle-
gen, die seine Leser sein knnten. Dennoch wre es verfehlt, diese eine Gruppenbe-
ziehung zu nennen. Soziale Beziehungen zwischen Gruppenmitgliedern sind noch
einmal von besonderer Art.
J. P. Sartre hat in der Gruppe eine Negation des Kollektivs gesehen.
139
Kollek-
tive Ansammlungen, die in oder um gegenstndliche Substrate wie Fabriken, Stra-
en, Wohnkomplexe, Fernsehempfnger usw. anzutreffen sind, stellen Pluralit-
ten dar, zwischen denen der Beziehungstyp der Serie anzutreffen ist. Zwischen den
einzelnen einer Serie bestehen auch soziale Beziehungen, seien es funktionelle
Arbeitsteilungen oder seien es identische Interessen (etwa einen Film in einem ganz
bestimmten Lokal sehen zu wollen), aber diese Beziehungen werden durch Alteri-
ttsverhaltensweisen hergestellt, d. h. jeder ist fr jeden nur der Andere, mit dem
ich mich um einen kollektiven Gegenstand vereinigt finde.
140
Die Serialittsstruktur ist der grundlegende Typ des Sozialen. Sie ist es, die von
der Gruppe negiert wird, aber zugleich ist die Gruppe auch Rckabsorptionsten-
denzen der Serialitt ausgesetzt, denen sie als sterbende Gruppe noch vor ihrem
43
Sartre hat als entscheidende Verbindung der Glieder der Serie die Ohnmacht
herausgestellt. Weil jeder fr jeden der Serie ein nur Anderer ist, ist die Handlung,
auch wenn sie das Gefge der Serie verndert, doch immer nur eine isolierte Hand-
lung.
142
Erst in der Negation der Serie, d. h. in dem Moment, in dem die Vermitt-
lungen durch Gegenstnde und die Alteritt der Beziehungen bersprungen wer-
den, entsteht eine Gruppe. In ihr habe ich mich ebenso wie der vormals blo
Andere in einen Dritten verwandelt. In der Negation der Serialitt konstituiert sich
die Gruppe als eine Beziehung von Dritten. Jeder ist der Dritte, ich sehe nicht den
Anderen zur Gruppe kommen, ich sehe mich in ihm zur Gruppe kommen, (. . .).
In der fusionierenden Gruppe ist der Dritte meine verinnerte Objektivitt. Ich fasse
sie in ihm nicht als Andere auf, sondern als die meine.
143
Sartres Gruppe von Dritten entspricht der Sache nach dem, was gemeinhin das
>Wir< der Gruppe genannt wird, wobei Sartres Begrifflichkeit deutlich macht, da
erst durch einen Sprung, durch eine markante Verrckung des wahrgenommenen
Realittsfeldes eine Gruppe sich konstituiert. Sartres Insistieren auf dem Akt der
Negation verweist auf eine Philosophie der Freiheit, die nur schwer vom Gruppen-
begriff zu trennen ist. Zufallsgemeinschaften oder Zwangsverbnde sind nicht not-
wendigerweise soziale Gruppen, sie knnen es werden, wenn sie aus der wie auch
immer gelagerten Not ihres Zusammenseins eine wie auch immer geartete Tugend
machen.
Mit der Verrckung des Realittsfeldes entsteht zugleich eine Zeitdimension, in
der die Gruppe sich bewegen wird. Blo situative Koalitionen, die nur aufblitzen,
um gleich wieder in die Serialitt zurckzufallen, sind keine sozialen Gruppen.
Andererseits knnen sich, der Erfahrung nach, Gruppen nur dann dauerhaft ver-
stetigen, wenn sie Zge von Institutionen annehmen, d. h. langsam in die Serialitt
eingehen. Viele Religionsgemeinschaften sind aus Gruppen hervorgegangen und
zu Institutionen geworden. Die Zeitdimension von sozialen Gruppen ist begrenzt,
sei es durch eine Auflsung in Form des Verschwindens oder in Form vermehrter
Institutionalisierung. Wo eine mittlere Zeitdauer, die zwischen situativer Koalition
und Institutionalisierung liegt, vorhanden ist, kann von sozialen Gruppen gespro-
chen werden.
Ebenso sinnvoll wie die Begrenzung des Begriffs Gruppe in zeitlicher Hinsicht
ist die quantitative Begrenzung. Bei einer Anzahl von drei bis ca. fnfundzwanzig
Individuen wird man von einer >kleinen Gruppe< sprechen. Handelt es sich um
Zusammenhnge grerer Art, etwa von fnfundzwanzig bis hundert Individuen,
so mu von einer >groen Gruppe< gesprochen werden. Wo in noch greren
Dimensionen von Gruppe gesprochen wird, verliert der Begriff zunehmend seine
Przision bzw. mu stark formalisiert werden, um eine Abgrenzung zu Verband,
Anstalt, Gemeinde etc. zu ermglichen. Am ehesten knnte man von Gruppenver-
bnden sprechen, die ihre Verbindung ber Delegation, aufgestockte Vertretergre-
mien, Fhrungsstbe etc. herstellen, wenn es um Grenordnungen von500-l.000
Personen geht.
144
Sowohl was den Zeitraum wie, was den Umfang angeht - der Begriff der sozialen
Gruppe kann nur dort sinnvoll verwandt werden, wo es sich um Zwischengren
handelt, die durch andere Begriffe nicht abgedeckt werden. Da ein betrchtlicher
Rest von Vagheit dem Gruppenbegriff anhaftet, steht auer Frage, aber ich sehe
44
hierin keinen Mangel. Denn es sind ja nicht zuletzt die unsicheren Fragen: Wann
knnen wir uns eine Gruppe nennen? Wie lange werden wir zusammenhalten?
Was wird, wenn wir zusammenschrumpfen oder uns vergrern?, die Gruppen
beschftigen. Diese Vagheiten definitorisch einfach tilgen zu wollen, knnte zur
Folge haben, sich Erkenntniszugnge zum Phnomen sozialer Gruppen zu ver-
bauen.
Wenn im Begriff der sozialen Gruppe immer auch der Gedanke an ein auf Auto-
nomie gerichtetes Streben mitschwingt, so ist zugleich daran zu erinnern, da sich
die Gruppe, die die Serialitt negiert, zugleich in einem spezifischen Spannungsfeld
von Autonomie und Zwang bewegt.
Dies bersieht Ciaessens, wenn er in seiner Gruppentheorie einseitig die Zwnge
herausstellt, denen sich die Gruppenmitglieder nicht entziehen knnen, wie etwa:
1. den Zwang zur Selbstdarstellung - fr jedes einzelne Mitglied; 2. den
Zwang, den anderen - eben in dessen Selbstdarstellung - registrieren zu mssen;
3. den Zwang zur Bildung eines Binnemelbstverstndnisses der gesamten Gruppe;
und 4. den Zwang zur Auendarstellung der Gruppe gegenber der >Umwelt<.
143
Betrachtet man diesen Katalog, so fllt auf, da sich die genannten Zwnge ebenso-
sehr als Potentialitten reformulieren lassen. Als eine besondere Mglichkeit zur
Selbstdarstellung, die anderswo nicht gegeben ist, als Chance, den anderen mehr
registrieren zu knnen als gewhnlich etc.
Weder eine Fundamentalisierung des Aspekts gesellschaftlicher Zwangslufig-
keit noch eine Verklrung des gemeinsamen Konstitutionsaktes fhrt in der Dis-
kussion um eine Theorie der Gruppe weiter. Das Mysterium von Gruppenprozes-
sen liegt in gleichsam infinitesimalen Differenzbewegungen, die jedes Gruppenmit-
glied vollzieht, Differenzbewegungen, mit denen das >Hier in der Gruppe< als von
anderen Lebensbereichen unterschieden bewertet wird. Jedes Gruppenmitglied
differenziert fortlaufend zwischen dem, was als serielle Verstreuung erscheint, und
dem, was als >Wir< der Gruppe gilt.
Diese Differenzbewegungen verlaufen nicht synchron, und sie sind aller Grup-
pen-Programmatik zum Trotz nicht synchronisierbar. Meine Unterscheidung von
Serialitt und >Wir< wird - abgesehen vielleicht von euphorischen, >heien< Grup-
penzustnden, die ihrer Natur nach nur sehr kurz sind - in der Regel nicht mit der
Unterscheidung von Serialitt und >Wir< zusammenfallen, die du machst. Die
unterschiedlichen Differenzbewegungen, die in letzter Instanz verschiedenen Ant-
worten, die wir geben, trennen uns jedoch nicht - wie man auf den ersten Blick
annehmen knnte - vielmehr verbinden sie uns. Ob wir uns nach auen darstellen
mssen oder wollen, ob meine oder deine Selbstdarstellung in der Gruppe dem
Druck oder der Freiheit geschuldet ist - die verschiedenen Antworten, die wir ein-
ander geben oder vor einander zurckhalten, verbinden uns, weil sie nicht zusam-
menfallen.
In jeder Situation kann jedem die >Tugend<, die er als Gruppenmitglied wnscht
und will, zur Last werden, deren Zwangscharakter er sich doch entziehen wollte.
Weil die Spaltung mehr oder weniger jeden betrifft, hlt die Gruppe zusammen.
Erst wenn eine wechselseitige Sicherheit entsteht, im Verhalten des Anderen nur
noch serielle Betriebsamkeit, einen Verrat an den Zielen, ein ungeschichtliches
Festhalten am Mythos der Gruppe oder ein Erkalten des Interesses zu sehen,
45
schwindet die Bindekraft des Gruppenzusammenhangs. Alle diese negativen Ele-
mente sind als Differenzbewegungen immer schon in der Gruppe vorhanden.
Solange aber Unsicherheit darber besteht, wo sich diese Differenzen festmachen
lassen, lebt die Gruppe. Wenn dagegen die Gruppe sich einig geworden ist, wie
sich Zwang und Autonomie genau verteilen, gibt es nichts mehr zu sagen. Die
gemeinsamen Ziele vereinzeln sich. Entweder einzelne verlassen die Gruppe, oder
die Gruppe implodiert, oder sie spaltet sich in Brudergruppen, die neue Kohren-
zen ausbilden. Austritte, Auflsungen und Spaltungen gehren ebenso mit zum
Gruppengeschehen wie ihre Kontinuitten. Oft scheint in diesen Prozessen das
auf, was die Gruppe zusammengehalten hat. Wo ein sozialer Zusammenhalt >sang-
und klanglos< verschwindet, hat es sich wahrscheinlich kaum um eine soziale
Gruppe gehandelt.
b) Interaktionistischer und diskursanalytischer Zugang
Die Junghegelianer sind eine diskutierende Gruppe. Die Debatte, der theoretische
Streit, der Austausch von Argumenten ist das Lebenselement dieser Gruppe. Wie
aber lt sich ein soziologischer Zugang zu dem auf den ersten Blick einfachen Ph-
nomen einer diskutierenden Gruppe finden?
Die Zugangsweise, der zunchst nachzugehen ist, beginnt mit der Frage, inwie-
weit das, was einer in der Gruppe sagt, abhngig ist, von dem, was andere zuvor
gesagt haben. Offensichtlich handelt es sich bei Diskussionen um Interaktionen
von Individuen, deren Meinungen, Anschauungen, Ideen aus der sozialen Interak-
tion entspringen und in ihr abgendert werden.
Meine Frage hat nicht allein einen Grund in mir, sondern ebenso einen Grund
im anderen, den ich frage. Meine Antwort bezieht sich zwar auf die Frage des ande-
ren, aber ebenso antworte ich mir selbst, indem ich die Frage des anderen meinem
Grund zufhre. Reziprok gehe ich davon aus, da es sich beim anderen ebenso ver-
hlt. Seine wie meine Auffassungen entspringen aus unserer Interaktion, bzw. die
Auffassungen, die jeder von uns mitbringt, sind in der Vergangenheit aus im Kern
verwandten Interaktionen mit anderen entsprungen. Fr den interaktionistischen
Zugang entspringt die Bedeutung, die ein Gegenstand gewinnt, nicht aus der
>Natur der Sache< und auch nicht aus den der Sache zustrmenden Affekten, son-
dern eben aus der sozialen Interaktion.
146
So plausibel dieser Zugang ist, es bleibt zu berlegen, auf welches Problem er
antwortet. Die interaktionistische Betrachtungsweise antwortet in spezifischer
Weise auf die im Hintergrund jeder Analyse von Diskussion - insbesondere natr-
lich bei intellektuellen Debatten - liegende Frage nach dem Wahrheitsgehalt der
Aussagen, die gemacht werden.
147
Wo die Bedeutung, die ein Gegenstand gewinnt,
nicht von der >Natur der Sache< herrhrt, und diese auch nicht mehr eine richtende
Funktion haben soll, wie dies in der klassischen Formel veritas est adaequatio intel-
lectus ad rem mitgegeben ist, ist der interaktionistische Analytiker zunchst entla-
stet. Er hat die philosophische Wahrheitsfrage ausgeklammert, ohne in einen ufer-
losen Irrationalismus zu verfallen, denn ebenso wie die >Natur der Sache< sind die
der Sache zustrmenden Affekte in ihrer bedeutungskonstituierenden Rolle
zurckgedrngt. Pointiert gesprochen, markiert der interaktionistische Zugang
46
zwischen philosophischem Problem und psychologischem Problem eine Art sozia-
les Territorium, von dem her gedacht wird.
Aber dies ist nicht nur eine Frage der Disziplinen. Man knnte auch daran den-
ken, da der interaktionistische Zugang auf bestimmte Gefhrdungen des Dialogs
sich bezieht, wenn er sich so abgrenzt. Denn eine Gefhrdung des Dialogs wre es,
wenn eine privilegierte Instanz mitsprche, deren Privileg es wre, das >letzte Wort<
zu haben. Die Instanz >Natur der Sache< htte, wrde sie anerkannt, dies Privileg.
Auf der anderen Seite wre der Dialog gefhrdet, wenn ich in der Hauptsache
annehmen mte, die Bedeutungen, die mein Gesprchspartner Gegenstnden
gibt, resultierten aus einer im Kern unauflsbaren fetischistischen Liebe, die er
ihnen entgegenbringt, einem Strom von Affekten, der mir den Eindruck vermit-
telte, ber diese oder jene Gegenstnde lt er weder mit mir noch mit sich reden.
Der interaktionistische Zugang zum Phnomen einer diskutierenden Gruppe
hat dort seine Strke, wo es darum geht, den Blick auf den Austausch von Auffas-
sungen und Ideen zu richten. In diesem Austausch, der der Logik von Frage und
Antwort folgt, leistet jeder Diskutierende etwas fr die Aussagen des anderen, und
er zehrt von den Beitrgen anderer. Seine Ideen sind nicht allein individual-schp-
ferisch seine Ideen, sie sind zwar individuell profiliert, aber zugleich bernahmen,
Entwendungen, Ausfllungen und Verwerfungen der Ideen anderer. Reziprok gilt
dies fr alle, die die Kommunikationsgemeinschaft bilden.
Fr die Junghegelianer eignet sich ein interaktionistischer Zugang deshalb, weil
die Entwicklung der Auffassungen eines jeden so sehr mit der Diskussion in der
Gruppe verflochten ist, da eine isolierende Betrachtungsweise kaum mglich ist.
Diesen Sachverhalt hat der Historiker G. Mayer schon frh bemerkt, als er von der
Aufgabe sprach, das geistige Eigentum der fhrenden Berliner Junghegelianer
deutlicher als es bisher mglich war, abzugrenzen. Das sich berstrzende Tempo,
in dem die Selbstauflsung der spekulativen Philosophie sich schlielich vollzog,
auch der enge persnliche Verkehr der wichtigsten Vertreter, den man als eine
stndige gegenseitige Beeinflussung auslegen kann, macht diese Arbeit zu einer
ungemein schwierigen.
148
In den etwa sieben Jahren intensiver Diskussion hat jeder Junghegelianer in
Abhngigkeit vom kollektiven Diskussionsproze seine Auffassungen bisweilen im
Rhythmus eines Jahres oder weniger Monate tiefgreifend verndert, er hat sie nicht
einfach gradlinig ausgebaut, sondern korrigiert und teilweise verworfen. Die Argu-
mente finden sich von einem Stadium der Diskussion zum anderen neu verteilt wie-
der. Die Gruppenmitglieder reagieren stndig aufeinander; ihre Schriften bilden
ein Netzwerk von Aufnahme und Kritik, Gegenkritik und Anspielung.
Angesichts dieses kontinuierlichen Prozesses von gegenseitiger Beeinflussung
mu gefragt werden, ob es berhaupt sinnvoll ist, die Aufgabe zu stellen, das gei-
stige Eigentum< der einzelnen gegeneinander abzugrenzen. Sh. Na'aman hat in sei-
ner He-Biographie ausgehend von einem speziellen Fall, bei dem die Frage des
>geistigen Eigentums< von Marx bzw. He ungeklrt ist, grundstzlich daraufhin-
gewiesen, da das heikle Problem der >Beeinflussung<, des >Plagiats< und des
intellektuellen Eigentums (. . .) bei der Arbeitsweise dieser gegenber der Umwelt
abgekapselten intellektuellen Gruppe methodisch nicht am Platze ist: was in sol-
47
chen Kreisen ausgedacht wird, wird in nicht endenwollenden Diskussionen verar-
beitet, tags in Arbeitskammern und nachts in der Kneipe. Wer zusammengehrte,
benutzte die gleiche Terminologie, an der die >Partei< gleich kenntlich wurde, und
innerhalb der >Partei< - die Fraktion (oder Clique, wenn man so will).
149
Gerade
der interaktionistische Zugang erffnet die Mglichkeit, die Gruppendiskussion
als einen Austauschproze zu begreifen, bei dem das soziale Moment von aus der
Interaktion entstehenden Gruppenvorstellungen gegenber der isolierenden, auf
die Kohrenz eines Theoretikers bezogenen ideengeschichtlichen Betrachtungs-
weise hervorgehoben wird.
Dennoch reicht der interaktionistische Zugang allein nicht aus. Er konstituiert
zwar eine soziale Perspektive des Tausches, die geeignet ist, die philosophische
oder psychologische Fixierung von Bedeutung zu verflssigen, aber diese Perspek-
tive - bei all der Wertschtzung, die sie dem Dialogischen entgegenbringt - luft
Gefahr, einen bestimmten Typ von Gefhrdung des Dialogs zu bersehen. Fr
diese Perspektive wre ein adquates Verstndnis von Diskussion erreicht, wenn es
gelnge, die beiden bedrohlichen Gestalten: das >letzte Wort< der Sache selbst und
die Verweigerung der Kommunikation, die nicht von fetischistischer Obsession
ablassen will, an den Rand zu drngen. Wie aber, wenn diese beiden Gefahren
blind machten fr eine dritte, die nicht von den Peripherien her droht, sondern
gleichsam im Innern von Diskussion auftaucht?
Ich mchte diese Gefahr die sophistische nennen und einen zweiten soziologi-
schen Zugang um sie gruppieren. Es kann mir in der Diskussion geschehen, da in
irgendeiner Weise die Beziehung zwischen meiner Intention und meiner Aussage
brchig wird, oder da ich eine Antwort gebe, die zwar der Forderung auszutau-
schen gehorcht, aber quasi eine >leere< Antwort ist. Ebenso kann ich die Beitrge
anderer als blo Gesagtes, aber nicht Gemeintes oder als >leeres Gerede< erfahren.
Im Sinne des Interaktionismus knnte man zwar von verzerrter oder miglckter
Interaktion reden, bei der die Reziprozitten gestrt sind. Aber warum findet >leeres
Gerede< statt? Offenbar gibt es in Diskussionen nicht nur das Problem, da Inten-
tionen zum Ausdruck gebracht werden, verzerrt oder nicht verzerrt, sondern auch
das Problem, da geredet werden mu, da einfach eine Rede da ist, die fortgesetzt
wird. Dieses Selbstzweckhafte der Rede macht das sophistische Problem aus.
150
In die Richtung eines drohenden Sophismus geht die klassische Frage: Und auf
welche Weise willst Du denn dasjenige suchen, Sokrates, wovon du berhaupt gar
nicht weit, was es ist? Denn als welches Besondere von allem, was du nicht weit,
willst du es dir denn vorlegen oder suchen? Oder wenn du es auch so gut trfest,
wie willst du denn erkennen, da es dieses ist, was du nicht wutest?
151
In dieser
Frage scheint die Mglichkeit eines >leeren Geredes< auf. Die Rede gewinnt hier
einen selbstndigen Ereignischarakter. Durchtrennt sind die Bindungen zwischen
Intention und Handlung, sie sind in doppelter Weise durchtrennt. Eine Differen-
zierung, die A. Schtz gemacht hat, aufgreifend, knnte gesagt werden: weder
mein Um-zu-Motiv noch mein Weil-Motiv gelangen in der sophistischen Rede
zum Ausdruck.
152
Sophistische Rede ist prinzipiell mglich, weil sich Gesagtes
nicht auf die Intention beschrnken lt, sondern Sprache mit jedem Wort zu
>abwegigen< Assoziationen ebenso wie zu Pseudologik einldt.
48
Gadamer hat daraufhingewiesen, da bei Piaton im Menon der 2itierte Einwand
bezeichnender Weise nicht durch eine berlegene argumentative Auflsung ber-
wunden (wird), sondern durch die Berufung auf den Mythos der Prexistenz der
Seele.
153
Nicht logisch, sondern mythisch wird der drohende Sophismus auer
Kraft gesetzt. Im Medium des argumentativen Sprechens knnte ein Sophismus zu
weiteren Sophismen Anla geben. Ein Wort gibt das andere. Eine wirksame
Begrenzung des sophistischen Geredes ist interaktionistisch schwer vorstellbar.
Um dieser Gefahr Herr zu werden, ist ein zweiter Zugang erforderlich.
M. Foucault hat die These aufgestellt, da in jeder Gesellschaft die Produktion
des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird -
und zwar durch gewisse Prozeduren, deren Aufgabe es ist, die Krfte und die
Gefahren des Diskurses zu bndigen, sein unberechenbar Ereignishaftes zu ban-
nen, seine schwere und bedrohliche Materialitt zu umgehen.
154
Weil in jeder
Situation von Diskussion die sophistische Gefahr lauert, ist zu fragen, welche sozia-
len Arrangements vorliegen, um der latenten Tendenz sich verselbstndigender
Rede zu begegnen. Es darf nicht berall alles gesagt werden, es gibt soziale Regeln,
die die Diskussion begrenzen. Solche Regeln lassen sich typisieren. Foucault nennt
drei groe Formen der Ausschlieung: Das Verbot, das sich auf das Reden ber
bestimmte Dinge oder das Rederecht bestimmter Personen bezieht, die Entgegen-
setzung von Vernunft und Wahnsinn, mit der ein bestimmter Typ von Rede zu
sinnlosem Gerusch wird, und schlielich eine dritte Form der Ausschlieung,
die in modernen Gesellschaften die beiden ersten zunehmend verdrngt: der Wille
zur Wahrheit. Diese Form hat sich historisch frh um die Bewltigung der sophisti-
schen Gefahr erstmals im Griechenland des 5. Jahrhunderts gebildet und zahlrei-
che Transformationen erfahren.
Die Verbannung der Rede um der Rede willen, die Ermchtigung der Rede,
die
vom Willen zur Wahrheit geleitet ist, diese Grenzziehung ist rein diskursiv nicht zu
erreichen, sie erfolgt vielmehr in Medien sozialer Macht. Die Ausscheidung der
sophistischen Gefahr bedarf institutioneller Merkmale, die den Grund der
Diskus-
sion festlegen.
Nur auf ihre Rede gesttzt, htten die Diskussionsteilnehmer nur wenig in der
Hand, um >leeres Gerede< zu bannen. Wenn ein Teilnehmer das Wort ergreift, um
der bedrohlichen Verselbstndigung der Debatte zu begegnen, so wird er die
Gruppe daran erinnern, wozu sie zusammengekommen sind, was ihre Aufgabe ist.
Er wird auf die Existenzbedingungen der Gruppe zu sprechen kommen, mgen sie
nun in selbstgesetzten sozialen Normen oder verordneten Aufgabengebieten lie-
gen. Er wird versuchen, die Debatte auf ihren Grund zurckzufhren. Dieser
Grund ist etwas, das nicht zur Disposition steht. Andernfalls ginge man in vier
Himmelsrichtungen auseinander.
Der Wille zur Wahrheit ist sozial nicht freischwebend, er wirkt erst in sozial defi-
nierten Zusammenhngen, deren Definitionen - in doppeltem Sinne von Begren-
zung und Eindeutigkeit - das Ma dafr abgeben, was dem Willen zur Wahrheit
folgt und was nicht. Es ist immer mglich, da man im Raum eines wilden Auen
die Wahrheit sagt; aber im Wahren ist man nur, wenn man den Regeln einer diskur-
siven >Polizei< gehorcht, die man in jedem seiner Diskurse reaktivieren mu.
155
Um die diskursanalytische Perspektive von Foucault lt sich insofern ein sozio-
49
logischer Zugang gruppieren, als hier auf den Aspekt sozialer Macht Bezug genom-
men wird, einer sozialen Macht, die nicht am Vermgen des einzelnen festhaftet,
sondern die immer zugleich mit den Anerkennungsbewegungen gegeben ist, die
Individuen fr ihr gemeinsames Dasein vollziehen.
Fr die Junghegelianer ist dieser zweite diskursanalytische Zugang von gleich-
wertiger Bedeutung wie der interaktionistische. Auch diese Gruppe definiert das
entscheidende Feld, in dem allein der Wille zur Wahrheit als legitimer sich zeigen
kann. Von besonderer Bedeutung ist nun, da die Junghegelianer im Proze der
Diskussion den kollektiven Grund ihrer Existenz verndert haben. Die Junghege-
lianer definieren sich zunchst als eine philosophische Schule. Aber sie wollen
zugleich etwas anderes werden, nmlich eine politische Partei. Sie versuchen, ihre
soziale Definition gleichsam umzubauen, indem sie den Willen zur Wahrheit nicht
mehr nur in dem philosophischen Gesprch verorten, sondern ihn erst im Felde
parteipolitischer Praxis aufblhen sehen. In den Zwischenrumen des bergangs
von der philosophischen Schule zur politischen Partei tut sich fr sie jedoch eine
dritte Mglichkeit der sozialen Definition auf: sie entdecken sich als eine Gruppe
journalistischer Boheme. Schlielich sind ihre Debatten auch noch von einer vierten
sozialen Definition durchzogen, die ihnen teils zugemutet wird und die sie teils als
ein inneres Band akzeptieren. Was sie von anderen unterscheidet ist das Band, das
sie als eine atheistische Sekte umschliet.
Alle vier Definitionen lsen teils einander ab, teils berlagern sie sich, teils wer-
den Kreisbewegungen vollzogen. In den bergngen und Doppeldefinitionen des-
sen, was der soziale Sinn ihrer Gruppe ist, bricht immer wieder die sophistische
Gefahr durch, und sie kann nur gebndigt werden durch eine angestrengte und
sichernde Debatte ber das, was der Grund der Gruppe sein soll. Am Ende der
junghegelianischen Debatte werden schlielich Zeitgenossen, die nicht mehr wis-
sen, womit sie es bei den Junghegelianern zu tun haben, auf die Idee kommen, da
in ihnen moderne Sophisten auferstanden sind.
156
c) Zum Problem heterologer Zugnge
Beide Zugangsweisen, die in dieser Arbeit erprobt werden, die interaktionistische
und die diskursanalytische, sind theoretisch kaum zu vereinheitlichen. Sieht man in
den Zugangsweisen nur die methodische Seite, so knnte wie selbstverstndlich auf
die Notwendigkeit eines Methodenpluralismus verwiesen werden, ohne den kein
Gegenstand von hinreichender Komplexitt zu bearbeiten ist. Beide Zugangswei-
sen enthalten jedoch darber hinaus grundlegende Perspektivierungen, die verfg-
bar zu machen leichter gesagt als getan ist. Es handelt sich um Perspektivierungen,
die jede fr sich und heterolog zueinander das Soziale der Diskussion mit Blick auf
ein mgliches Fundament bestimmen.
Der interaktionistische Zugang rckt die kommunikative Seite der Situation des
Austausches ins Zentrum. Was sich dem Austausch entzieht, gefhrdet die Kom-
munikation. Es kann gezeigt werden, wie bestimmte Theoreme im kommunikati-
ven Austausch verwandelt werden, wie die Logik des Gesprchs, die Annahme und
Abwehr von Begrndungen zu neuen Definitionen fhren. Die Analyse des sozia-
50
len Interaktionsprozesses der Gruppe kann Resultate aufweisen, die eine isolierte
Betrachtung denkerischer Leistungen nur schwer in den Blick bekommt.
Auch das >Wir< der Gruppe steht nicht auerhalb der Debatte. Die Begrenzun-
gen des Diskurses werden thematisiert: die Begrenzungen des philosophischen
Diskurses, in dem nur gesprochen, nicht praktisch gehandelt wird, die Begrenzun-
gen des politischen Diskurses, der vor_: Realisierbaren her seine Schranken erfhrt,
die Begrenzungen der Diskurse subkultureller Boheme, deren Breitenwirkung in
Zweifel steht, und die Begrenzung des religisen Diskurses, dessen Dogmatismen
den freien Tausch der Argumente behindern.
Der interaktionistische Zugang kommt methodisch dem Phnomen einer kollek-
tiven Selbstreflexion, die das Gesagte fortlaufend hinterfragt, entgegen. In diesem
Zugang spricht sich das Ideal aus, da Wahrheit nur dort erzeugt werden kann, wo
Setzungen erkannt, Begrenzungen reflexiv berschritten, stumme Herrschaft der
Kommunikation unterworfen wird.
157
Heterolog dazu steht der diskursanalytische Zugang. Er rckt eine andere Erfah-
rung ins Zentrum: In jeder Kommunikation mu auch mit der Angst vor einer sich
ausbreitenden Geschwtzigkeit umgegangen werden. Das Soziale von Kommuni-
kation zeigt sich nicht in der Unendlichkeit der Worte, die gewechselt werden. Es
geht nicht darum, Sprachlosigkeiten zur Sprache zu bringen, sondern die Unbere-
chenbarkeit der Rede fortlaufend zu kontrollieren. Das Soziale, das sich konstitu-
iert, wenn zusammen geredet wird, ist die gemeinsame Anstrengung, den Ereigni-
scharakter von Rede zu bewltigen, ihre berschsse zu vernichten, ihren Mangel
zu ertragen, ihre Unendlichkeit abzuschlieen.
Zugespitzt formuliert: der interaktionistische Zugang folgt einem Ideal, das
gegen das sich verstockende Schweigen, in welcher Form es auch auftritt, gerichtet
ist. Es gibt hier immer ein Zuviel von dem, was erst noch gesagt, gefragt, ins Spiel
des Austausches gebracht werden mu. Der diskursanalytische Zugang folgt einem
Ideal, das gegen die Inflation der Worte gerichtet ist. Es gibt hier immer ein Zuviel
an Gerede, Berge von Sprachmll, Assoziationsabflle und pseudologische Ruinen,
die nie vollstndig beseitigt werden knnen, weil sie fortlaufend wieder anfallen.
Beide Zugnge greifen Erfahrungsmomente auf, wie sie in Situationen von Dis-
kussionen spontan entstehen. Im Alltag von Diskussionen in Gruppen - das kann
reflektierte Selbsterfahrung und Gruppenbeobachtung zeigen - liegen beide
Erfahrungen dicht beieinander, etwa als Erfahrung, da etwas nicht zur Sprache
kommt oder da etwas zerredet wird. Auf eine methodische und theoretische
Ebene lassen sich die Durchmischungen des Alltags jedoch nur schwer projizieren,
weil methodisch-theoretische Reflexion programmatisch von einer geordneten,
homogenen Struktur des intellektuellen Bewutseins ausgehen mu. Theorie kann
sich die Ungenauigkeiten des Alltags nicht leisten. Sie mu trennen, ausklammern,
ebenso wie konstruieren, Verbindungen herstellen, die auf einen kohrenten Sinn
verweisen. Der der Wirklichkeit abgerungene kohrente Sinn ist notorisch radikal,
er drngt auf Entweder-Oder-Entscheidungen. Faule Kompromisse sind Snden
wider den theoretischen Geist.
Als bloe methodische Varianten gefat lieen sich beide Zugangsweisen harm-
los verbinden. Wie aber mte eine theoretische Struktur beschaffen sein, in der
die Gegenstzlichkeit beider Positionen ausgehalten und durchgefhrt werden
51
knnte, eine theoretische Struktur, die den fatalen Hang zum Fundamentalen
zugleich grozgig anerkennt und jene Fallen vermeidet, in die jede Fundamentali-
sierung gert? - Heterologie nennt Georges Bataille ein Denken, das sich auf das
richtet, was theoretische Systeme ausscheiden, um sich zu beruhigen.
158
An Batail-
les Heterologie wre ebenso anzuschlieen wie an ein Theorem von Siegfried Kra-
cauer: Wo bewut geworden ist, da theoretische Kohrenzen einen Hang zur
Ausschlielichkeit haben, mu das >Entweder-oder< durch ein >Seite an Seite<
ersetzt werden.
159
Was sich der Maler Raffael geleistet hat, Anliegen differenter Philosophien Seite
an Seite zu stellen, darf sich auch Theorie leisten. Der Bezug, in dem zwei hetero-
loge Anstze zueinander stehen, mu Kracauer zufolge theoretisch undefinier-
bar gehalten werden. Er pldiert fr einen Halt auf halber Strecke, der sich die
hastige Herabsetzung der je heterologen Position versagt und versagen mu, weil
in letzter Instanz nicht auf die homogene Struktur des intellektuellen Universums
vertraut werden darf. Bei Annahme dieser Einsicht ist der Boden fr eine theoreti-
sche Besttigung der namenlosen Mglichkeiten bereitet, von denen anzunehmen
ist, da sie in den Zwischenrumen der vorhandenen Lehren hoher Allgemeinheit
existieren und auf Anerkennung warten.
160
4. Forschungen zum Junghegelianismus
Der bei weitem grte Teil der vorliegenden Forschungen zum Junghegelianismus
bezieht sich auf deren weitreichende theoriegeschichtliche Bedeutung. Sa hat auf
einer Tagung anllich des 100. Todestages von Ludwig Feuerbach fr die junghe-
gelianischen Debatten der 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts die These aufge-
stellt: alle Spielarten berhaupt mglicher kritischer Theorie, alle Spielarten von
Anarchismus und Existentialismus sind ja doch einfach in Berlin durchgespielt
worden, und alles, was spter kam - um jetzt meinerseits eine These zu berspitzen
-: alles, was spter kam, sind Neuauflagen: Adorno, Marcuse, Habermas und Hei-
degger; sie sind nicht nur historisch spter, sie sind auch weniger originell, zugege-
ben in manchem grndlicher, im Grundstzlichen schon lange durchgespielt in
jenen Jahren in den zwei, drei Stammlokalen, die man in Berlin hatte.
161
Die These
ist zugegeben berspitzt, aber schon ein kurzer berblick ber einige der Wirkun-
gen junghegelianischer Debatten mag das kaum abzuschtzende Ausma von Tra-
ditionsstrngen verdeutlichen, das von diesen Gruppenzusammenhngen ausge-
gangen ist. (Eine ausfhrliche Darstellung der Forschungssituation zu einzelnen
Junghegelianern wrde die Arbeit sprengen, ich versuche im folgenden, in den
Anmerkungen einige orientierende Hinweise zu geben und verweise im brigen auf
das Literaturverzeichnis.)
Zunchst ist an die bekanntesten Junghegelianer Marx und Engels zu denken.
Innerhalb der junghegelianischen Debatten bilden sie die zentralen theoretischen
Elemente ihrer gesellschaftstheoretischen und konomiekritischen Auffassungen
aus. Der Junghegelianismus ist so seit langem zu einem festen Bestandteil der Lite-
ratur ber Marx und Engels geworden.
162
Unverkennbar ist dabei in vielen Arbei-
52
ten aber auch das Bestreben, die Begrnder des wissenschaftlichen Sozialismus aus
dem Kontext der Junghegelianer herauszulsen, um ihre singulre Stiftungsfunk-
tion hervorzuheben.
163
Die orthodox marxistische Literatur folgt bei der Darstel-
lung der Genese der Marxschen Auffassungen zumeist der Marx-Engelsschen
Selbstinterpretation ihrer junghegelianischen Phase. Den Junghegelianern wird
hier eine temporre Bedeutung im Zusammenhang der Auflsung des Hegelianis-
mus und der politischen Radikalisierung im Vormrz zugewiesen. Ihre Auffassun-
gen kommen unter der Perspektive der Marx-Engelsschen Polemiken zur Sprache,
und diese nachvollziehend, werden ihre Positionen als mehr oder weniger ideolo-
gisch beurteilt. Ohne eine Ernstnahme der theoretischen Alternativen der junghe-
gelianischen Mitstreiter von Marx und Engels ist jedoch ein fundiertes Marxver-
stndnis kaum zu erreichen.
Im Zusammenhang der Krise des Marxismus, die von K. Korsch bereits 1931
treffend analysiert wurde,
164
sind jene Tendenzen zu sehen, die zu einer vermehrten
Beschftigung mit Sozialismus- und Anarchismuskonzeptionen gefhrt haben, die
von der traditionellen deutschen Sozialdemokratie und dem Marxismus-Leninis-
mus ausgegrenzt wurden. Auch hier weisen die Spuren zurck in die junghegeliani-
schen Debatten: mit Michail Bakunin
165
hat der europische Anarchismus hier
einen seiner Ausgangspunkte, und der Junghegelianer Moses He
166
gilt heute nicht
nur als einer der Begrnder des Sozialismus in Deutschland; die >Philosophie der
Tat<, die er und andere Junghegelianer entwickelten, verweist ebenso wie die frh-
sozialistischen Theorien gerade auf jene subjektiv-aktiven Dimensionen von Eman-
zipationstheorie, die der orthodoxe konomistische Diskurs erstickt.
167
In der Geschichte der politischen Parteien in Deutschland haben die Junghege-
lianer ihren festen Platz erhalten, weil von ihnen erste Anstze einer Theorie der
Partei ausgingen. Darber hinaus verbindet sich mit den Junghegelianern Arnold
Ruge
l6S
und dem ihm zur Seite stellenden, kaum bekannten Karl Nauwerck
169
die
Kontroverse, ob es vor 1848 ein Programm und organisatorische Anstze einer
demokratischen Partei gegeben hat, die gegenber dem Liberalismus des Vormrz
eine Eigenstndigkeit besa und somit beanspruchen kann, zu den Anfngen der
deutschen demokratischen Bewegung gerechnet zu werden.
170
Kontrovers bis in die Gegenwart hinein ist auch die Bedeutung, die dem Junghe-
gelianer Ludwig Feuerbach
171
zugemessen werden mu. Hat er sich durch seine reli-
gionskritische Transformation von Religion in Politik, wie Rohrmoser meint, zu
einem Kirchenvater des 20. Jahrhunderts qualifiziert?
172
Oder kann Feuerbachs
Wesen des Christentums der modernen Theologie als Rettungsanker dienen?
Oder ist mit Feuerbachs Politisierung der Sinnlichkeit eine Korrektur an Marx vor-
zunehmen, wie A. Schmidt vorschlgt, eine Korrektur, die zu einer neuen Anthro-
pologie fhrt, wie sie H. Marcuse in Umrissen entwickelt hat?
173
Nicht nur die
neue Sensibilitt der Studentenrevolte der 60er Jahre, auch die vermehrte Refle-
xion auf die Folgen der Beherrschung innerer und uerer Natur, wie sie in sog.
neuen sozialen Bewegungen offenkundig ist, kommuniziert mit zentralen Motiven
der Feuerbachschen Philosophie der Zukunft.
Weitaus verdeckter dagegen ist die komplexe Wirkungsgeschichte des Junghe-
gelianers Max Stirner
174
. Seine Renaissance um die Jahrhundertwende stand
zunchst im Zeichen der Mackayschen Rubrizierung Stirners als Individualanar-
53
chisten. Aber Stirners Bedeutung reicht weit darber hinaus. Er hat vor Nietzsche
einen Typ radikaler Vernunftkritik entfaltet, der Anschlsse nach verschiedenen
Richtungen ermglichte. Seine Konzeption des Einzigen hat nicht nur Nietzsche
beeinflut, sondern auch den europischen Existentialismus und die moderne
Sprachphilosophie.
Trotz wichtiger Arbeiten, die in den letzten Jahren erschienen sind, steht die
Erforschung des monumentalen Werks des Junghegelianers Bruno Bauer
115
erst am
Anfang. Ein Zeitgenosse wie der Hegelschler und polnische Graf August von
Geszkowski
176
, dessen geschichtsphilosophisches Hauptwerk krzlich der philoso-
phischen Diskussion wieder zugnglich gemacht wurde, urteilte bereits 1842 ber
Bruno Bauer: Wenn man sagen wollte, da Bruno Bauer keine bedeutende wis-
senschaftliche Erscheinung sei, so hiee dies eben so viel, als wenn man behauptete,
die Reformation wre kein bedeutendes Ereignis gewesen. Dies ist aber keine Frage
mehr; er leuchtet bereits auf dem Horizont der Wissenschaft, ihn zu verdunkeln ist
nicht mehr mglich, es kommt vielmehr jetzt darauf an, den Lauf dieses neuen
Kometen zu lernen und zu berechnen.
177
Es ist wohl der irritierende Lauf dieses
Kometen gewesen, der der Forschung nur schwer zu bersteigende Probleme auf-
gab. Da Bauer in seiner Entwicklung mehrfach die politischen Fronten des
19. Jahrhunderts gewechselt hat und dennoch behauptete, immer derselbe zu sein
und zu bleiben, hat ihn bis heute weitgehend inkommensurabel gemacht.
Im folgenden mchte ich auf die Forschungen eingehen, die sich ber die
Beschftigung mit einem Junghegelianer hinausgehend mit dem Gesamtkomplex
des Junghegelianismus bzw. grerer Ausschnitte befassen. Ich gehe hierbei chro-
nologisch vor, um damit auch deutlich zu machen, wann der Gesamtkomplex des
Junghegelianismus und unter welchen Fragestellungen er thematisch geworden ist.
Noch mit zur junghegelianischen Selbstreflexion gehren zwei Darstellungen
der Entwicklung der Gruppe aus der Zeit vor 1848: Karl Schmidts Das Verstan-
destum und Individuum (1846)
178
und B. Bauers Vollstndige Geschichte der
Partheikmpfe in Deutschland whrend der Jahre 1842-1846 (1847). Gemeinsam
ist ihnen die Geste des Abrechnens mit der Gruppengeschichte. Aber die Figur des
Bruches mit der Gruppenvergangenheit hat in der Gruppe ihre eigene Geschichte.
So stehen diese beiden Darstellungen gleichsam auf der Schneide von Abrechnung
und Fortfhrung. Den Junghegelianismus als ein Phnomen, auf das zurckge-
blickt werden kann, gibt es erst nach dem Jahr 1848, das fr die Zeitgenossen einen
heute kaum nachzuvollziehenden Bruch im Zeitbewutsein darstellt. Nach 1848 ist
- berspitzt formuliert - alles das diskreditiert, was vorher Geltung hatte.
179
In der
zweiten Hlfte des 19. Jahrhunderts geraten die vormrzlichen Debatten rasch in
Vergessenheit, um erst um die Jahrhundertwende wieder in die Erinnerung zurck-
zukehren. Um so wichtiger ist es, auf die Texte hinzuweisen, die in den 50er und
60er Jahren erschienen und die auch fr die heutige Forschung noch wichtige
Informationen enthalten.
Am bekanntesten ist die Darstellung von J. E. Erdmann (1866), die fr die Erfor-
schung des Zersetzungsprozesses der Hegeischen Schule unentbehrlich ist. Erd-
mann sah sich selbst angesichts der allgemeinen Hegelmdigkeit als einen letzten
Mohikaner, und er mu den Leser gleichsam in eine andere Welt versetzen, um
54
ihm deutlich zu machen, wie sehr die Frage nach dem Verhltnis von Glauben und
Wissen dreiig Jahre zuvor interessiert hat.
180
Manchmal angefhrt wird die anonyme Darstellung Die deutsche Philosophie
seit Hegels Tod (1851), die von der Schwierigkeit spricht, in dem kurzen Raum
von zwei Jahrzehnten, mitten in dem Tumult kmpfender Parteien, bei dem
Zusammensturz alter und der pomphaften Ankndigung neuer Systeme, bei dem
philosophischen Sprachengewirr, in das sich noch die politischen und religisen
Tagesparolen mischen, den wesentlichen Gang der Entwicklung festzuhalten und
einer so kurz abgegrenzten Epoche ein bestimmtes, charakteristisches Geprge
aufzudrcken. - Hinter dem Anonymus verbirgt sich - wie ich hier erstmals mit-
teilen kann - der Junghegelianer Rudolf Gottschall.
181
Eingegangen ist diese Dar-
stellung in erweiterter Form in seine Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts
(1854)
182
Dieses Werk ist von der Forschung kaum zur Kenntnis genommen wor-
den, ebenso wie das Parallelunternehmen von Julian Schmidt, der sich in seiner
Literaturgeschichte (
2
1855) ausfhrlich mit dem philosophischen Radikalismus
auseinandersetzt.
183
Weder bei Erdmann und Gottschall, noch bei J. Schmidt fin-
det eine positive Wrdigung des Junghegelianismus statt. Die Katastrophe von
1848 wirkt nach in ihren Urteilen ber die gescheiterten Emanzipationsversuche.
Dafr bieten diese Arbeiten aufgrund der Vertrautheit der Autoren mit den Debat-
ten der 40er Jahre viele Hinweise, die anderswo nicht zu finden sind.
Der Junghegelianismus als ein bedeutendes Gesamtphnomen kommt erst wie-
der zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Blick. Zu nennen sind in erster Linie die
klassischen Arbeiten von G. Mayer
184
Nicht der philosophische Aspekt steht bei
ihm und anderen im Zentrum, sondern die politische Frage nach den Quellen des
Sozialismus und der Demokratie und nach der Entstehung von Parteien. Diese Pro-
blemstellung setzt sich bis in die 20er Jahre fort.
185
Eine Renaissance der philosophischen Problematik des Junghegelianismus setzt
Ende der 20er Jahre ein. Nicht mehr die Kontinuitten der Weltanschauungspar-
teien des 19. Jahrhunderts werden diskutiert, nicht mehr die parteiprogrammisti-
schen Differenzen von Sozialismus, Liberalismus, Anarchismus werden im Junghe-
gelianismus entdeckt, vielmehr stehen sie fr eine im Inneren des 19. Jahrhunderts
aufgebrochene Krise, die den Status der aus der christlichen Tradition hervorge-
gangenen Philosophie zweifelhaft werden lt.
186
Unter dem Eindruck der faschi-
stischen Bewegung und der Stalinisierung der Sowjetunion wird der philosophi-
sche Horizont des 19. Jahrhunderts, die Geschlossenheit der altbrgerlichen
Welt,
ein zunehmend verblassender Orientierungspunkt, fr den ein Ersatz nicht bereit
steht. 1939 schreibt K. Lwith: Wer von uns knnte leugnen, da wir noch durch-
aus von diesem Jahrhundert leben und eben darum Renans Frage - es ist auch die
Frage von Burckhardt, Nietzsche und Tolstoi - verstehen: >de quoi vivra-t-on apres
nous?<
187
Lwiths Antwort ist die entschiedene Resignation. Zwischen Hegel und
Nietzsche markiert Lwith in den junghegelianischen Debatten einen geistesge-
schichtlichen revolutionren Bruch, der auf die Problematik des 20. Jahrhunderts
verweist: sich nicht mehr selbstgewi in einer historischen Kontinuitt zu wissen.
Lwiths Arbeiten zum Junghegelianismus sind fr die heutige Junghegelianerfor-
schung nicht mehr wegzudenken.
Zu denjenigen, die in den junghegelianischen Debatten einen Startpunkt fr die
55
modernen politischen und philosophischen Auseinandersetzungen gesehen haben,
gehrt auch Carl Schmitt. Er schreibt 1947: Wer die Tiefen des europischen
Gedankenganges von 1830-48 kennt, ist auf das meiste vorbereitet, was heute in
der ganzen Welt laut wird. Das Trmmerfeld der Selbstzersetzung deutscher Theo-
logie und idealistischer Philosophie hat sich seit 1848 in ein Kraftfeld theognoni-
scher und kosmognonischer Anstze verwandelt. Was heute explodiert, wurde vor
1848 prpariert. Das Feuer, das heute brennt, wurde damals gelegt. Es gibt gewisse
Uran-Bergwerke der Geistesgeschichte. Dazu gehren die Vorsokratiker, einige
Kirchenvter und auch einige Schriften aus der Zeit vor 1848. Der arme Max gehrt
durchaus dazu.
188
Nach dem zweiten Weltkrieg konzentrieren sich die Forschungen im Bereich des
Junghegelianismus zunchst auf die berfllige Rezeption der Marxschen Frh-
schriften. Darber hinaus interessieren religionsphilosophische
189
und politisch-
publizistische Fragestellungen.
190
Erst zu Beginn der 60er Jahre setzt eine, gemes-
sen an der vorhergehenden Forschungslage intensivere Auseinandersetzung mit
dem Gesamtkomplex des Junghegelianismus ein, die bis heute andauert.
Hervorzuheben sind die Arbeiten von Hans Martin Sa, Jrgen Gebhardt und
Horst Stuke aus dem Jahre 1963.
191
Charakteristisch ist, da die Junghegelianer
Marx und Engels teils ausgeklammert (Gebhardt, Stuke), teils gleichberechtigt
neben die anderen Hegelschler gestellt werden (Sa). Zentrierend ist der Zusam-
menhang der Hegelschule und damit der Bezug der Hegelschler zur Hegeischen
Philosophie.
Nicht von den prominenten Ausgngen des Junghegelianismus, sondern von
Hegels Religionsphilosophie her entfaltet Sa das Spektrum der philosophischen
Konsequenzen, die die einzelnen Hegelschler gezogen haben. Whrend sich fr
Sa die hegelianischen Positionen am Problem der Skularisation ausdifferenzie-
ren
192
, sieht Gebhardt in der Hegelschule eine sich verdichtende Politisierung reli-
gionsphilosophischer, insbesondere eschatologischer Vorstellungen am Werk, eine
Sektenmentalitt, die auf die totalitren Bewegungen des 20. Jahrhunderts ver-
weise.
193
Bei Sa stehen die Junghegelianer fr eine Entwicklung, in der die religis-
methaphysische Entfremdung berwunden werden soll in der Erfllung mensch-
lich-skularer Ziele, bei Gebhardt stehen sie fr die sich ausbreitende neue gnosti-
sche Weltreligion im Sinne Voegelins
194
, die als Heilsbringer der Massen fr die
Katastrophen des 20. Jahrhunderts verantwortlich zu machen sei.
Stuke unternimmt den Versuch, die junghegelianische Philosophie der Tat als
einen eigenstndigen geistesgeschichtlichen Vorgang darzustellen. Auch fr ihn
tritt der messianische Charakter der junghegelianischen Tatphilosophie deutlich
hervor, aber sein Urteil differiert wesentlich von dem Gebhardts und bleibt pro-
duktiv offen. Stuke plaziert die Junghegelianer gleichsam zwischen der Hegeischen
Vershnungsphilosophie, in der die klassische Bestimmung der Philosophie qua
theoria erneuert wird, und der Marxschen radikalen Verendlichung in der Kritik
der politischen konomie, die der Philosophie ihre Selbstndigkeit aberkennt.
195
Mit den Arbeiten von Sa, Gebhardt und Stuke ist ein theoriegeschichtlicher Pro-
blemhorizont abgesteckt, der einerseits auf die Hegeische Philosophie und ande-
rerseits auf Fragen verweist, die, von Lwith und Voegelin in unterschiedlicher
Weise aufgeworfen, sich auf die Wirkungen eschatologischer Spekulation fr das
56
moderne Politik- und Geschichtsverstndnis beziehen und zugleich das Problem
der Skularisation ins Zentrum setzen.
Fr die Auseinandersetzung mit dem Junghegelianismus im angelschsischen
Raum stehen die Arbeiten von David McLellan (1969/1974) und William Brazill
(1970). Beide sehen im Junghegelianismus Denkanstze, die fr sich genommen
von Bedeutung sind.
196
Whrend McLellan die wichtigsten Junghegelianer gleich-
sam um Marx gruppiert, um neben ihrer Eigenstndigkeit zugleich ihren Einflu
auf Marx zu charakterisieren, verzichtet Brazill auf eine Einbeziehung Marxens. Er
affirmiert die These von der berragenden geistesgeschichtlichen Bedeutung der
Junghegelianer, die mehr ihrem produktiven Dissens als ihrer bereinstimmung zu
verdanken sei, und verweist auf die Kreativitt dieser Gruppe, deren Leistung darin
bestanden htte, da sie auf je verschiedene Art den bergang from Christianity
to philosophy experimentiert htten.
197
In den 70er Jahren hat sich die Forschung zum Junghegelianismus kontinuierlich
weiterentwickelt. Es erschienen nicht nur wichtige Arbeiten zu einzelnen Junghe-
gelianern,
198
auch der junghegelianische Gesamtkomplex wurde von verschiede-
nen Disziplinen her untersucht. In den Arbeiten von Kurt Rttgers, Johann Mader
und Rudolf Ruzicka wurde die Beschftigung mit der philosophie- und theoriege-
schichtlichen Problematik des Junghegelianismus fortgesetzt. Rttgers widmet
etwa die Hlfte seiner begriffsgeschichtlichen Untersuchung zum Begriff der >Kri-
tik< Hegel und der Hegeischen Schule.
200
Mader reflektiert die verschiedenen
Varianten im Junghegelianismus, der Theorie unter dem Verwirklichungsdesiderat
einen neuen Status zuzuweisen.
201
Ruzicka bezieht die junghegelianischen Ideolo-
giebegriffe auf die Hegeische >Phnomenologie des Geistes< zurck und zeigt, wie
mit dem Verlust der Dialektik zugleich die Aporien eines Panideologismus entste-
hen.
202
Aus dem literaturwissenschaftlichen Bereich sind die Arbeiten von Udo Kster
(1972) und Claus Richter (1978) hervorzuheben. Unter dem Eindruck des gewach-
senen literaturwissenschaftlichen Interesses an Autoren des Vormrz
203
untersu-
chen beide die Junghegelianer im Zusammenhang mit den Dichtern des Jungen
Deutschland. Kster legt den Schwerpunkt auf den politischen Gehalt der jung-
deutschen Anti-Literatur und der junghegelianischen Publizistik, wobei er auf den
letztendlichen Abstand hinweist, den diese Intellektuellen zu den Problemen der
konomischen und sozialen Krise ihrer Zeit hatten.
204
Richter untersucht den
Zusammenhang von jungdeutschem Emanzipationspathos und dem >Realismus<
der nachmrzlichen Zeit. Er zeigt, da die Junghegelianer in ihrer Kritik an den
Jungdeutschen bereits wesentliche Programmpunkte der nachrevolutionren Rea-
listen vorwegnehmen.
205
Im historisch-politikwissenschaftlichen Bereich hat Peter Wende
206
die Mayer -
sche Fragestellung nach der frhen demokratischen Bewegung im Vormrz erneut
aufgeworfen und die programmatische Eigenstndigkeit eines demokratischen
Radikalismus, zu dem er die Junghegelianer Rge und Nauwerck zhlt, herausgear-
beitet. Eine ausfhrliche Auseinandersetzung mit den Beziehungen der Junghege-
lianer zu den franzsischen Sozialisten hat Charles Rihs (1978) vorgelegt. Er analy-
siert die spannungsreichen Begegnungen, die zwischen deutschen und franzsi-
schen Intellektuellen in den 30er und 40er Jahren stattgefunden haben. Auf den
57
Kreis der Berliner Junghegelianer konzentriert sich die Arbeit von Robert J. Hell-
mann (1977). Er sieht Max Stirner im Mittelpunkt einer sozial randstndigen,
bohemeartigen Intellektuellengruppe, die sich, umstellt von der offiziellen Gesell-
schaft, einem blasphemischen Kritizismus hingibt. Hellmann versucht, die Berliner
Junghegelianer ein Stck weit aus dem Dunstkreis von Skandalgeschichten heraus-
zuholen, der die Hippeischen Weinkneipen-Intellektuellen in der Literatur
umgibt. Fr Ingrid Pepperle gehren diese Intellektuellen kaum noch zum Junghe-
gelianismus.
207
Sie setzt die Auflsung der junghegelianischen Bewegung um die
Jahreswende 1842/43 an, d. h. mit der Trennung Marxens von dieser Gruppe. So
unhaltbar und durchsichtig diese Periodisierung ist, es mu hervorgehoben wer-
den, da Pepperles Arbeit einen wichtigen Ansatz fr die Rehabilitation des Jung-
hegelianismus in der wissenschaftlichen Diskussion in der DDR darstellt.
208
Der weit berwiegende Teil der neueren Forschung zum Junghegelianismus hat
sich auf die theoriegeschichtlichen Impulse konzentriert, die von diesen Denkern
ausgegangen sind.
209
R. Bubner hat zurecht daraufhingewiesen, da - so folgerich-
tig auch der Marxsche Ausgang aus den junghegelianischen Debatten sein mag - es
die Geschichte der Marxschen Lehre und ihrer Prognosen waren, die die ver-
meintlich erledigten Denker nach Hegel wieder zu Ehren
210
kommen lieen.
In diese Problemlage fgt sich auch der Versuch von J. Habermas (1985). Er
geht von einem Veralten des marxistischen Produktionsparadigmas aus und
bestimmt die junghegelianische Hegelinterpretation als zentralen Startpunkt fr
den philosophischen Diskurs der Moderne:
Wir verharren bis heute in der Bewutseinslage, die die Junghegelianer, indem sie sich von
Hegel und der Philosophie berhaupt distanzierten, herbeigefhrt haben. Seit damals sind
auch jene auftrumpfenden Gesten wechselseitiger berbietung in Umlauf, mit denen wir
uns gerne ber die Tatsache hinwegsetzen, da wir Zeitgenossen der Junghegelianer geblie-
ben sind.
2
"
Habermas geht davon aus, die Junghegelianer htten von Hegel das Problem der
geschichtlichen Selbstvergewisserung der Moderne bernommen und damit zwei
Gegner herausgefordert: 1. die rechtshegelianische Partei der Beharrung, die er
im neukonservativen Abschied von der Moderne, z. B. bei Gehlen, Ritter und
Luhmann sich fortsetzen sieht, und 2. die an Nietzsche anschlieende Partei der
Jungkonservativen, deren anarchistischen Abschied von der Moderne er bei
Autoren wie Heidegger und Bataille und bei den von ihm als Neostrukturalisten
etikettierten Konkurrenten Derrida und Foucault zu erkennen glaubt.
So bersichtlich dieses philosophische Dreiparteiensystem auch dargestellt ist,
seiner ganzen Anlage nach drfte es einer berprfung kaum standhalten. Haber-
mas reduziert - wie in der marxistischen Junghegelianerinterpretation blich - den
Junghegelianismus auf Konzepte, die sich auf die Marxsche Theorie hin beschrei-
ben lassen. Im Vergleich zu Lwiths differenzierter Analyse ist dies schon ein Rck-
schritt. Nach dieser Reduktion kann er in Nietzsche erstmals den Auftakt fr eine
Vernunftkritik festmachen, die zum Jungkonservatismus fhre. Habermas igno-
riert nicht nur die etatistischen, sozialdisziplinren Elemente in junghegelianischen
Konzepten, die nher bei den sog. Rechtshegelianern liegen, als es seine Konstruk-
tion zult; er ignoriert auch, da mit Stirner einige Jahrzehnte vor Nietzsche ver-
58
nunftkritische Positionen formuliert waren, aus deren Aufnahme und Abwehr her-
aus Marx und Engels allererst zur Ausformulierung des historischen Materialismus
kamen. Gegenber der irrigen These, da vernunftkritische Positionen erstmals als
Reaktion auf marxistische Positionen aufgetreten seien, mu daran festgehalten
werden, da die Marxsche Theorie selbst erst in der Reaktion auf die vorgngige
Vernunftkritik Stirners ihre spezifische Kontur gewonnen hat.
212
Was die Zeit der Junghegelianer der unsrigen nher bringt, ist neben allen gei-
stesgeschichtlichen Entwicklungen, die von ihnen zu uns reichen, die Erfahrung, in
einer Zeit des bergangs zu leben, in der sich neue Definitionen, Zugnge und
Lsungen erst bilden. In bergangssituationen stoen sich die nachdenkenden
Individuen an der Weisheit geschlossener Konstruktionen. Es gibt kaum einen
Ansatz, der befriedigt, die Probleme wachsen schneller als die Lsungen, und der
Zeitdruck
213
nimmt zu. Lernprozesse, Umorientierungen, Verwerfungen von
Interessen und Entwrfe neuer Ideale - all dies vollzieht sich mit einer greren
Intensitt und Geschwindigkeit.
Eine Erforschung des Junghegelianismus heute brchte jedoch wenig Ertrag,
wenn sie blind die Schlachten der Vergangenheit nachspielte. Sie erfolgt in einer
Zeit, in der die Leitbegriffe des 19. Jahrhunderts, wie >Fortschritt< und >Reaktion<
zunehmend unscharf werden, in der die vertrauten Adjektive >frei<, >human<,
>sozial<, die auf den Fahnen von Bauer, Feuerbach und He standen, sich im Laby-
rinth der Sachzwnge verlaufen und in der der Massenatheismus ebenso konstatiert
wird wie die Umrisse neuartiger Religiositt. Sie erfolgt schlielich in einer Zeit, die
zwar bergangszeit ist, aber doch andere Erfahrungsgehalte ins Zentrum setzt. Auf
die Fragen, die uns mit der Technisierung und sthetisierung unserer Lebenswelt
gestellt sind, geben uns die Junghegelianer keine Antworten. Ihre Erforschung als
Beitrag zu einer Ethnologie des 19. Jahrhunderts kann jedoch helfen, da wir ler-
nen, - wo ntig - heiter von unserer Vergangenheit zu scheiden.
Anmerkungen
1 A. von Martin (1972) S. 378.
2 P. Valery (1965) S. 50, vgl. auch Valerys Beschreibung des Paris der Intellektuellen: Es
schien mir, als fhren wir einer Wolke schwirrender Worte entgegen. Tausend aufstei-
gende Ruhmesbahnen, tausend Bchertitel pro Sekunde erschienen und verloren sich
unsichtbar in diesem wachsenden Nebelfleck. Ich wute nicht, ob ich dieses unsinnige
Treiben sah oder hrte. Es gab da Schriften, die schrien, Wrter, die Menschen, und
Menschen, die Namen waren . . . Kein Ort auf Erden, dachte ich, wo so viel Sprache
wre, wo diese strkeren Widerhall, weniger Zurckhaltung htte als in diesem Paris, wo
Literatur, Wissenschaft, Knste und Politik eines groen Landes eiferschtig konzen-
triert werden. (. . .) Reden, wiederholen, widersprechen, weissagen, schmhreden . . .
alle diese Verben zusammen enthielten abgekrzt fr mich das Gesumm dieses Wortpa-
radieses. (Ebd. S. 44) Aus der Literatur ber Valery und das Problem der Intellektuali-
tt sei in dieser Arbeit auf die Schriften von K. Lwith hingewiesen, denn es darf vermu-
tet werden, da seine Durchquerung der junghegelianischen Wortparadiese mit sei-
nem Interesse fr Valery in einem Zusammenhang steht: K. Lwith (1970); ders., (1971).
3 K. Mannheim (1964) S. 378.
59
4 Vgl. hierzu die frhen kontroversen Diskussionen um die Mannheimsche Wissenssozio-
logie, dokumentiert in: V. Meja und N. Stehr (1982) und K. Lenk (1964) S. 52 ff. u. a.
Einen hilfreichen problemgeschichtlichen Aufri hat N. Abercrombie (1980) vorgelegt.
Abercrombie weist darauf hin: However, the problem is not merely to show that certain
beliefs are associated with certain social classes, it is also to explain why one particular set
of beliefs, rather than any other, goes together with a particular social class. (Ebd. S. 9,
vgl. auch S. 173) Zu gegenwrtigen Problemen der Klassentheorie vgl. W. Ebach
(1986).
5 Th. Geiger (1962) S. 441.
6 F. H. Tenbruck (1976) S. 51.
7 O. Negt, A. Kluge (1981) S.1221.
8 Ebd. S. 1220.
9 Ebd. S. 796. Vgl. zur neueren Diskussion M. Ewert (1982).
10 H. Plessner (1985) S. 68.
11 Alfred Schtz to Eric Voegelin (November 1952), in: PJ. Opitz, G. Sebba(1981)S. 437;
A. Schtz (1981) S. 313: Im tglichen Leben ber den Mitmenschen nachdenkend,
nehme ich ihm gegenber gleichsam eine sozialwissenschaftliche Haltung ein. Wissen-
schaft betreibend bin ich noch immer Mensch unter Menschen, ja es gehrt geradezu zum
Wesen der Wissenschaft, da sie Wissenschaft nicht nur fr mich, sondern fr jedermann
sei. Und weiter setzt Wissenschaft bereits einen bestimmten Rckbezug meiner Erfah-
rungen auf die Erfahrungen einer Erkenntnisgemeinschaft voraus, auf die Erfahrungen
anderer alter egos, welche gleich (!) mir, mit mir und fr mich Wissenschaft betreiben.
Der Wissenschaftler unter Menschen ist mehr >ungleich<, der Wissenschaftler unter Wis-
senschaftlern mu sich angleichen. Trotz aller berschneidungen bleibt eine winzige Dif-
ferenz.
12 Vgl. A. v. Martin (1932) S. 58 f.; A. Hauser (1957) S. 362.
13 K. Garber (1983) S. 32.
14 K. Mannheim S. 454. Kritisch dazu: A. Neusss (1968).
15 Bildnachweis: J. H. Beck (1981) S. 107. Zur Interpretation der >Schule von Athen< ver-
danke ich wichtige Hinweise: L. M. Batkin (1981) S. 483-491.
16 K. Mannheim (1964) S. 379 und 378.
17 L. Batkin (1981) S. 86.
18 Ebd.
19 Vgl. hierzu F. Hartmann, R. Vierhaus (1977); J. Voss (1980); K. Garber (1983) S. 36;
O. Dann (1976); R. Vierhaus (1980). Von den lteren Arbeiten sei auf die bekannten Pio-
nierstudien R. Koselleck (1959); J. Habermas (1965) hingewiesen.
20 Ch. P. Ludz (1976) hat darauf hingewiesen, da der Zusammenhang von Ideologie,
Intelligenz und Organisation historisch in einer bestimmten Phase, nmlich der des Vor-
mrz, sich selbst immer strker und in mannigfaltigen Ausprgungen herauszukristallisie-
ren beginnt. (Edb. S. 124) Ludz untersucht drei Intellektuellengruppen, die er gem
eines funktionalistisch inspirierten Ideologiebegriffs ideologische Gruppen nennt:
Fichtes >Bund der freien Mnner<, den >Bund der Gechtetem und die >Rechts- und
Linkshegelianer<. Leitende Fragestellung ist bei Ludz, inwieweit soziale Integration bzw.
Desintegration in die Gesellschaft intentional-utopisches Denken befrdert oder nicht.
Ludz' Ansatz stellt im Bereich wissenssoziologischer Forschung insofern einen wichtigen
Fortschritt dar, als er fr die Intelligenz die Frage der Gruppenbildung (bei ihm als Orga-
nisation begriffen) ins Zentrum rckt. Allerdings beschrnkt sich seine Analyse auf den
Begriff der ideologischen (intentionalen) Gruppe (Edb. S. 88 ff.), der sicherlich, was die
Parteigenese betrifft, von zentraler Bedeutung ist, aber nicht das gesamte von den Jung-
hegelianern gegebene Spektrum von Gruppendefinitionen abdeckt.
21 M.Weber (1964) S. 14.
60
22 Vgl. R. Vierhaus (1973) S. 72.
23 Vgl. in diesem Zusammenhang: W. J. Mommsen (1981).
24 J. Schumpeter (1946) S. 235 ff. Vgl. auch das Urteil ber den Intellektuellenstand(es),
der nichts kann wie diskutieren und seine Bedeutung lediglich dem Umstnde verdankt,
da er die Arbeit der Welt zu stren vermag. Ders. (1952) S. 509.
25 Th. Geiger (1949) S. 12 f, 19. Vgl. in diesem Zusammenhang auch D. Bering (1978).
26 H. Schelsky (1977) S. 142.
27 M. Foucault (1978) S. 47.
28 Bildnachweis: Ruge bei den Berliner Freien, in: MEW Bd. 27, gegenber S. 400.
29 Zu den schwbi schen Junghegel i anern i m Kont ext bergrei fender Gruppenzusammen-
hnge vgl . : W. Brazi l l (1970) bes. S. 97 ff, 156 ff u. a. ; H. Fi scher ( 1916); F. W. Graf
(1978). Eine wichtige Orientierung ber die schwbischen Junghegelianer gibt H. Harris
(1975). Im Zusammenhang dieser Arbeit sei auf die Angaben zu E. Zeller (Ebd. S. 55 ff.)
und A. Schwegl er ( Ebd. S. 78 f f . ) hi ngewi esen. Zu F. T. Vi scher vgl . : H. Gl ockner
(1931); F. Schlawe(1959).
Aus der umf angrei chen Li t erat ur zu D. F. St rau sei en hervorgehoben: A. Hausrat h
(1876/78); J. F. Sandberger (1972); H. Horton (1973); F. W. Graf (1982 a). Die Arbeit
von Graf enthlt eine umfangreiche Strau-Bibliographie.
30 Zu den Schweizer Junghegelianern vgl.: W. Marr, Das junge Deutschland in der Schweiz,
1846; ( H. Gei zer ) , Di e gehei men Ver bi ndungen i n der Schwei z, 1847; A. Becker ,
Geschichte des religisen und atheistischen Frhsozialismus, 1932. Siehe auch die ein-
schl gi gen Dokument e bei : A. Kowal ski , Vom kl ei nbrgerl i chen Demokrat i smus zum
Kommunismus, 1967. Zur Situation in der Schweiz: vgl.: E. Schraepler (1972) bes. S. 40-
. 126. Vgl. auch Anm. 121.
31 H. Spiegelberg (1953) S. 237.
32 H. G. Gadamer (1965) S. 288 f.
33 H. Spiegelberg (1964) S. 11.
34 Knigsberger Zeitung Nr. 138 v. 17. 6. 1842, zit. nach: R. Prutz, Zehn Jahre, 1856, Bd. 2,
S. 100-102. Die Berliner Korrespondenz wurde auch in der RhZ Nr. 176 v. 25. 6. 1842
abgedruckt, allerdings ohne den Hinweis: die Parteien mten sich jetzt bestimmt grup-
pieren.
35 B. Bauer, Parteikmpfe, 1847, Bd. 1, S. 138.
36 anonym, Zwei Vota ber das Zerwrfnis zwischen Kirche und Wissenschaft, in: DJ 1842
S. 34. Das zweite anonyme Votum ist mit Ein Philosoph unterzeichnet. Es wurde auf-
merksam regi st r i er t von: (I . H. Fi cht e) , Di e phi l osophi sche Li t erat ur der Gegenwar t .
5. Artikel , in: ZPsP T (1842) H. 1, S. 144. Ebenso von: (L. Buhl), Die Not der Kirche,
1842, S. 9.
37 R. Prutz vermutet, die Initiatoren seien durch die heftige Pressereaktion zum Aufgeben
ihres Vorhabens gebracht worden (R. Prutz, Zehn Jahre, Bd. 2, S. 102). G. Mayer denkt
an einen taktischen Rckzieher (G. Mayer, (1913) S. 56 f. und 108.) R. J. Hellmann sieht
die Quelle der Nachricht in einem abendlichen Kneipenulk der Berliner Junghegelianer
(R.J. Hellmann, (1977) S. 112 f.).
38 M. Stirner, Kleinere Schriften, 1976, S. 130. Die Korrespondenz, auf die Stirner Bezug
nimmt, erschien in der >Leipziger Allgemeinen Zeitung< Nr. 184v.3. 7. 1842. Das Glau-
bensbekennt ni s , das i m Fr ankf ur t er Jour nal zuer st er schi en, wur de i n der RhZ
Nr. 192 v. 11. 7. 1842 abgedruckt. Zum Dementi vgl. M. Stirner, Kl Sehr, S. 149.
39 G. Schuster, (1906) Bd. 2, S. 261.
40 A. Rge an K. Marx, 7. 8. 1842, i n: MEGA I . Abt . Bd. 1, 2 S. 279. Zu Ol shausen und
Philalethen vgl.: (Theodor Olshausen), Denkschrift des Vereins der Wahrheitsfreunde
oder Philalethen, Kiel 1830.
41 R. Prutz, Zehn Jahre, Bd. 2, S. 103.
61
42 Th. Font ane nennt Sieben Weise aus dem Hippel schen Kell er: B. Bauer, E. Bauer,
L. Buhl, M. Stirner, Leutnant Saint-Paul, Leutnant Techow, J. Faucher (Th. Fontane,
Von Zwanzig bis Dreiig,
2
1898 S. 52-61). Bei J. H. Mackay bestehen die Freien aus
15 Personen des inneren Ringes, einem weiteren Kreis von ca. 30 Personen und ca. 20
zeitweiligen Besuchern, (J. H. Mackay (1914) S. 55.ff.). Bis in neuere Arbeiten ist unklar,
wer zu den Freien gehrt. R. J. Hellmann orientiert sich an der Gelegenheitsskizze des
jungen Engels (vgl. diese Arbeit, S. 23, R. J. Hellmann, (1977) S. 98 ff.). Ohne Angabe
von Belegen wei I. Pepperle, da die Freien sich seit Ende 1841 (!) Freie nannten,
und rechnet alle Berliner Junghegelianer dazu (I. Pepperle (1978) S. 250). G. Mayer
bemerkt, da die Freien rasch zu einer Art Chiffre wurden, die im weiteren Sinne bald
auf alle Kreise angewandt wurde, die gegen die preuische Kulturpolitik ffentlich Ein-
spruch erhoben. (G. Mayer (1913) S. 50) In dieser Arbeit wird die Bezeichnung Freie
nur in Zusammenhang mit dem Gercht des Juni 1842 verwandt. Zu den Berliner Jung-
hegelianern vgl. die bersicht S. 41 f.
43 H. Leo, Die Hegelingen,
2
1839. Zu H. Leo vgl. Ch. Freiherr von Maltzahn (1979).
44 H. Leo, Die Hegelingen, S. 2 f.
45 Ebd. S. 2,1,39 f und 3.
46 Ebd. S. 25.
47 Di e wi cht i gst en Schri ft en si nd: A. Ruge, Preuen und di e Reakt i on, 1838 (= Ruges Bei -
trge in den HJ); L. Feuerbach, ber Philosophie und Christentum (1839), in: LFW
Bd. 2, S. 261-330 (Eine vollstndige Verffentlichung in den HJ wurde von der Zensur
verboten); E. Meyen, Heinrich Leo, 1839; G. O. Marbach, Aufruf an das protestantische
Deutschland, 1838/9; Karl Zschiesche, Die deutsche Theologie, 1838; A. Hegeling
(= C. M. Wolff), Heinrich Leo vor Gericht, 1838; B. Hegeling (= K. W. Khne), Neu-
entdeckte Jesuitenbriefe, 1838 (die Pseudonyme dieser beiden Schriften hat I. Pepperle
(1978) S. 238 aufgelst); hervorzuheben ist auch der hellsichtige Beitrag: (anonym), Die
Voraussetzungen des Hegelschen Systems, in: ZPsT 4 (1839) S. 291 ff. Leo wird vertei-
digt von: K. A. Kahnis, Rge und Hegel, 1838; zu nennen sind aus Hengstenbergs EKZ:
(anonym), Die Hallischen Jahrbcher fr Deutsche Wissenschaft und Kunst, EKZ 1838
Nr. 69 ff., Sp. 545-568; (anonym), Die Hegelingen, EKZ Nr. 75 ff., Sp. 596-600, 1839
Nr. 13 ff., Sp. 97-111.
48Ausfhrlicher sei hier auf die denunziatorisch-publizistische Antizipation der Gruppen-
definition Junges Deutschland eingegangen, weil sie eine Art Vorlauf fr die Denunzia-
tionsstrategien, die die Junghegelianer betreffen, darstellt.
Im Dezember 1835 dekretierte die Bundesversammlung in Frankfurt das Verbot der
Schriften aus der unter der Bezeichnung >das junge Deutschland< oder >die junge Litera-
tur bekannten literarischen Schule, zu welcher namentlich Heinr. Heine, Karl Gutzkow,
Heinr. Laube, Ludolf Wienbarg und Theodor Mundt gehren. Es habe sich eine lite-
rarische Schule gebildet ( . . . ) , deren Bemhungen unverhohlen dahin gehen, in belletri-
stischen, fr alle Klassen von Lesern zugnglichen Schriften die christliche Religion auf
die frechste Weise anzugreifen, die bestehenden sozialen Verhltnisse herabzuwrdigen
und alle Zucht und Sittlichkeit zu zerstren, (zit. nach: J. Hermand (1974) S. 331).
Vorbereitend fr den Beschlu der Bundesversammlung waren vermutlich die Angriffe
Wolfgang Menzels auf Gutzkows Roman >Wally, die Zweiflerin<. Menzel stellt Gutzkow
als Fhrer eines sogenannten jungen Deutschland dar. Die Sache ist eine potenzierte
Nachahmung der neufranzsischen Frechheit, und auch diese ist nur eine Wiederholung
frherer Snden. Schriften, wie die von Gutzkow, worin die sogenannte Freigeisterei und
Obscnitten Hand in Hand gehen, waren nach Voltaire sehr hufig und kamen auch
nach Deutschland. (zit. nach: A. Estermann (1972) Bd. 1, S. 42 und 46 )
Mit dem Beschlu der Bundesversammlung wurde der Begriff das junge Deutschland
als Name einer Schriftstellergruppe aktenkundig gemacht. Dabei ist dieser Begriff in
62
Deutschland zunchst nur ein Schlagwort gewesen, das bei den betroffenen Autoren sehr
verstreut und keineswegs als Gruppenbezeichnung auftaucht. So widmet Wienbarg seine
1834 erschienenen sthetischen Feldzge im Untertitel dem jungen Deutschland, in
dem Sinne, da er sich an die junge Generation wendet.
Zwi schen den l i t erari schen und pol i t i schen Auffassungen der bet r offenen Aut oren
bestanden sicher eine Reihe von Gemeinsamkeiten, auch hat es einige zweiseitige Kon-
takte gegeben, aber von einer literarischen Schule oder einer Gruppe mit gegenseiti-
gem Gedankenaustausch und einer ausreichenden Anzahl sozi aler Kontakt e kann nicht
die Rede sein. (vgl. W. Hmberg (1975) S. 12 ff.)
Es mu auch off en bl ei ben, ob di e Bundesver samml ung ni cht ei nf ach di e genannt en
Autoren mit dem im Schweizer Exil gebildeten Geheimbund von Handwerkern verwech-
selte, der sich unter dem Namen das junge Deutschland als nationale Abteilung der von
Gi useppe Mazzi ni i m Fr hj ahr 1834 i ns Leben geruf enen pol i t i schen Bewegung Das
j unge Europa verst and. Kont akt e zwi schen den deut schen Aut oren und Mazzi ni s
Geheimbund lassen sich nicht nachweisen (vgl. E. R. Huber, Bd. 2, S. 129-133 ;J. Proel
(1892) S. 650 f.; W. Hmberg (1975) S. 13. Zu Mazzini siehe: H. G. Keller (1938).
Bei den Aut oren, die 1835 durch den Beschlu der Bundesversammlung als das junge
Deutschland konstituiert werden, fhrt di e Defini tion von auen zu einer Zersetzung
der geringen bestehenden Kontakte. Indem sie - zu Recht - die Existenz einer Schrifts-
t el l erorgani sat i on l eugnen, schwren Laube, Mundt und Gut zkow di r ekt oder i ndi r ekt
auch den Gemeinsamkeiten ab (. . .). Der Kampf gegen die Verbotsfolgen artet teilweise
i n ei nen Kampf gegenei nander aus. (Hmberg (1975) S. 20) So schrei bt Gut zkow an
Varnhagen: Ich werde mi ch ht en, fr das j unge Deut schl and di e Verant wort l i chkei t
einer zerhackten und geschwtzigen Schreibart (. . .) auf meine Schultern zu laden. (. . .)
Von einer Partei kann um so weniger die Rede sein, da es einigen Herren jetzt pltzlich
einfllt, mit ihr zu rechnen. (Ebd.).
49 Vgl. MEGAI. Abt. Bd. 1, 2 S. 279 und 287.
50 E. Meyen, Heinrich Leo, 1839, S. 30.
51 (B. Bauer), Posaune, 1841, S. 8, vgl. auch die wichtige Rezension in den DJ: (anonym, Die
Posaune, DJ 1841, S. 594-596).
52 In der junghegelianischen Presse wird auf diese Nachbildung gezielt angespielt : Der
Posaunist hat seine Sache vortrefflich gemacht. Er hat Leo bertroffen. (E. Meyen, Die
Posaune, in: Ath 1841, S. 722).
53 B. Bauer, Posaune, 1841, S. 35.
54 Di e Fr age, i nwi ewei t di e Begri ffe Junghegel i aner bzw. Li nkshegel i aner si nnvol l
anzuwenden si nd, wi rd wei t er unt en i m Zusammenhang des Kapi t el s Phi l osophi sche
Schule errtert. - Leos Denunziation steht in dieser Zeit nicht allein. Zu erinnern ist, da
K. E. Schubart 1839 - vielleicht ermuntert durch Leos Hegelingen - seine bereits zehn
Jahr e zuvor ver sucht e Denunzi at i on der Hegel schen Recht sphi l osophi e al s ei ner ver -
kappten Revolutionslehre erneuert : Hegel selbst habe zwar die Gewaltsamkei t seiner
Lehr e ni cht vol l zogen, aber j unge Hegel sche Dokt or en gl aubt en i hr e demagogi -
schen Verirrungen aus Hegels Rechtsphilosophie rechtfertigen zu knnen. (K. E. Schu-
bart , ber di e Unverei nbarkei t der Hegel schen St aat sl ehre mi t dem oberst en Lebens-
und Entwicklungsprinzip des Preuischen Staates, Breslau 1839, abgedruckt in: M. Rie-
del, Materialien zu Hegels Rechtsphilosophie, 1975, Bd. 1, S. 249 bis 266, zit. S. 265 f.
Riedels Edition enthlt auch die wichtigsten Gegenschriften zur Schubartschen Denun-
ziation.)
55 K. Mannhei m (1964) S. 449.
56 A. Ruge, Die Denunziation der Hallischen Jahrbcher, in: HJ 1838 Sp. 1425-1440. Das
Politische Wochenblatt wurde nach diesem Artikel zitiert. (Zit. Sp. 1435,1426,1436 f.)
Zu dieser Zeitung vgl.: W. Scheel (1964).
63
57 Der irreale, imaginative Charakter des Verdachts ist auh den Zeitgenossen aufgefallen.
1834 reflektiert ein Anonymus (Der Zeitgeist oder das Geld) ber dieses Problem: es ist
nichts mit der ganzen Demagogie, es ist ein Wahn- und Schreckgebild unserer Zeit, das
nur i n uns er er Vor st el l ung ei n Das ei n hat , und das uns bi s her ganz ver gebl i ch und
umsonst gengst i gt hat . (Ebd. S. 22) Bei Li cht e besehen, knne er ni rgendwo i n der
Gesellschaft das entdecken, worauf sich der Demagogenverdacht bezi eht. (Ebd. S. 15)
Aber woher kommt di eser Wahn? Di ese Propaganda und Demagogi e hat i hren Si t z
nicht etwa in weitverzweigten Gesellschaften, die planmig wie die Jesuiten einem gro-
en Endzweck ent gegenarbei t et en, ni cht et wa i n gehei men Obern, di e mi t Frankrei ch,
England und Belgien in Verbi ndung stnden, ni cht etwa in einer Carbonari- oder Frei-
maurerschaft , die sich allmhl ich unter dem Begriff von Emanzi pation und Zivilisat ion
ber ganz Europa ausbreitete. Nein! meine Herren! sie hat ihren Sitz in unserem eigenen
Kopf, in unserem eigenen Wahn, berall die Spuren einer geheimen Demagogie zu fi n-
den, sie hat ihren Sitz in unserm eigenen frheren Klagen und Tadeln aller bestehenden
Regierungen. (Ebd. S. 28 f.)
Zu den Verdacht-Strategien der Polizei im Vormrz vgl. auch die geheimen Berichte der
Met t erni ch- Agent en (H. Adl er (1977). Al s Quel l e fr Gruppenbi l dungen i m Vormrz
sind diese Berichte nur mit groer Vorsicht zu benutzen. Zur Interpretation vgl. den ein-
fhrenden Aufsat z von H. Adl er . Ebd. S. 1-45 und F. T. Hoefer (1981/ 82).
58 J. Baudrillard (1982) S. 137. Baudrillard weist daraufhin: Mode gibt es nur im Rahmen
der Moderne. Das heit i n einem Schema von Bruch, Fort schri tt und Innovat ion. Alt es
und Neues alternieren in jedem beliebigen kulturellen Kontext. Aber erst fr uns gibt es
sei t der Auf kl r ung und der i ndust r i el l en Revol ut i on ei ne hi st ori sche und st rei t bare
Struktur von Vernderung und Krise. Anscheinend erzeugt die Moderne gleichzeit ig die
l i neare Zei t des t echni schen Fort schri t t s, der Produkt i on und der Geschi cht e und ei ne
zyklische Zeit der Mode.
59 H. Marggraff, Deutschl ands jngst e Lit eratur- und Kulturepoche, 1839, S. 195 f.
60 L. Bergeron, F. Fret, R. Koselleck (1969), S. 296 f.
61 MEWBd. 3,S. 63.
62 H. Leo, Sendschreiben an Josef Grres, 1838, S. 129 f.
63 Angaben nach: J. Paschen (1977) S. 18. Paschen sttzt sich auf C. F. W. Dietericis Mit-
teilungen des Statistischen Bros, Berlin 1 (1848) 3 (1850) und 7 (1854). Zum dominie-
renden agrarischen Sektor vgl. H. Schissler (1978).
64 Th. Ni pperdey (1983), S. 113.
65 Angaben nach: J. Paschen, (1977) S. 19. Dem Modell dieser drei Schichten lag auch Die-
tericis Interesse zugrunde, in die Diskussion des Jahres 1849 zugunsten des Drei-Klassen-
Wahlgesetzes einzugreifen. Zur Lebenswelt der vormrzlichen Unterschichten vgl.
H. G. Husung (1983) bes. S. 134-156.
66 T. Nipperdey (1983) S. 454. Vgl. auch: K. H. Jarausch (1974).
67 Zur Entwicklung und Bedeutung des Bildungsbrgertums vgl. in diesem Zusammenhang
die lteren Arbeiten: H. Weil (1930); E. Manheim (1933); H. Gerth (1935). An neueren
Untersuchungen ist hervorzuheben: H. J. Henning (1977); R. S. Elkar (1979). Elkars
Untersuchung ist zwar regional begrenzt, aber in ihrer Ausfhrlichkeit von exemplari-
scher Bedeutung.
8 Die Erforschung der Freimaurer- und Geheimgesellschaften hat in der jngsten Zeit
einen erheblichen Aufschwung zu verzeichnen. Hingewiesen sei auf: R. v. Dlmen
(1975); E. H. Balzs (1979); P. C. Ludz (1979); H. Reinalter (1983), mit Bibliographie. -
Zu Lesegesellschaften vgl.: O. Dann (1981) und die dort angegebene Literatur. Aus der
Flle zeitgenssischer Reflexionen sei besonders genannt: E. S., ber die Lesevereine in
Deutschland, DVjs 1839, H. 1, S. 129-251. - ber die geselligen Formen der Berliner
Gebildeten informiert; P. Weiglin (1942); G. Hermann (1965); E. Heilbronn (1922)
64
als Textsammlung. Eindrucksvolle Schilderungen finden sich auch bei Th. Fontane, Von
Zwanzig bis Dreiig, 1898, und ders., Christian Friedrich Scherenberg, 1885.
69 T. Nipperdey (1976). Diese Thesen sind reformuliert in: ders. (1983) S. 267 ff. Ergiebig
ist in diesem Zusammenhang immer noch: F. Baiser (1959). Die vormrzliche Diskussion
ber das Verhltnis von stndischen Bindungen und Verein ist unter rechtsgeschichtli-
chem Aspekt entfaltet bei F. Mller (1969). Den Versuch einer typologischen Differen-
zi erung des Ver ei nswesens i n der Zei t von 1765- 1819 hat O. Dann ( 1976) vor gel egt .
Dann beschr ei bt anhand j e ei nes konkret en Bei spi el s si eben Typen: di e pat ri ot i sche
Gesellschaft, die Lesegesellschaft, den Geheimbund, die informelle Aktionsgruppe, den
pol i t i schen Di skussi onszi rkel , di e st udent i sche Reformbewegung, den nat i onal - pol i t i -
s chen Unt er st t zungsver ei n. Vgl . dar ber hi naus G. Wur zbacher ( 1971) ; F. Kr l l ,
S. Bartjes, R. Wiengarn (1982); F. H. Tenbruck, W. A. Ruopp (1983).
70 So konstatieren die junghegelianischen >Norddeutschen Bltter< (NB): Wir hren vom
Lokal - und Gewerbe-Verei n, vom Verei n der prot est ant i schen Freunde und dem i hr er
Gegner, vom Zschokke-, Advokaten- und Gesellen-Verein, von Migkeits- , von Trink-
und von Brger-Vereinen, endlich auch vom Gustav-Adolf-Verein. Die Zahl dieser Ver-
eine mehrt sich fast tglich, und wer Lust hat, ein >Mann von Namen<, ein >Volksmann<
zu werden, der ersinne nur eine neue Zusammenstellung eines Namens, in dem ein reli-
gi ses oder brgerl i ches Verhl t ni s si ch ausdrckt , mi t dem Wort e >Verei n< - und er
kann des Beifalls und der Berhmtheit gewi sein. (anonym, Der Gustav-Adolf-Verein,
in: NB 1845, H. 9, S. 35).
71 Vgl. : K. Abraham (1955); W. Fischer (1964); W. Gimmler (1972); O. Busch, H. Herz-
feld (1975).
72 T. Nipperdey (1976) S. 198.
73 Zu den geselli gen Kommuni kat ionsformen der Beamt en und ihrem Ei nflu auf die De-
finitionen von Gemeinwohl vgl. A. Ldtke (1982) S. 83 ff.
74 R. Koselleck (1966) S. 66. Zur preuischen Verwaltung vgl. auch ders., (1967). Zu den
Pr obl emen mar xi st i scher Geschi cht sschr ei bung mi t den Thesen Kosel l ecks ber di e
Rol l e der pr eui schen Br okr at i e al s I ni t i at or ei nes Moder ni si er ungspr ozesses >von
oben< siehe J. Kocka (1974). Speziell zu Vor- und Nachmrz vgl. J. R. Glis (1971). Zur
Mentalitt der hheren Beamten sind Hinweise zu finden bei H. Branig (1979). Aus der
Flle der Literatur zum >Preuen-Jahr< sei hervorgehoben R. v. Thadden (1981), in unse-
rem Zusammenhang bes. S. 60 ff.
75 R. Kosel l eck (1966), S. 67.
76 O. Dann (1976) weist daraufhin, da entgegen der Absolutismusvorstellung der Libera-
len des 19. Jahrhunderts davon ausgegangen werden mu, da vermutlich gemessen an
den restriktiven Bestimmungen der ersten Hlfte des 19. Jahrhunderts - im 18. Jahrhun-
dert eine weitgehende Vereinsfreiheit bestanden hat (S. 224). Erst der mit dem Deu-
tungsmuster Revolution einhergehende politische Verdacht strukturiert das Feld der
Vereine.
77 A. v. Ungern-Sternberg, Erinnerungsbltter, Bd. 2, 1856, S. 13.
78 G. Jellinek und M. Weber haben insbesondere im Calvinismus einen Geburtshelfer der
modernen Staats- und Gesellschaftsordnung westeuropischen Typs gesehen. Ihre The-
sen sind oft reformuliert worden. Vgl. in diesem Zusammenhang: O. Hintze (1906);
H. Holborn (1966) S. 85-108; H. Plessner (1982) S. 50 ff. und 69 ff.; sowie R. v. Thad-
den (1980) S. 146 ff.
79 H. Holborn (1966) S. 97.
Auf diese Zusammenhnge gehe ich in Kapitel IV ausfhrlicher ein.
H. Rosenberg urteilt zusammenfassend: Die gesellschaftlichen Trger dieses geistig-
politischen Mobilisierungsprozesses waren Studenten und berufsttige Angehrige der
beamteten und nicht beamteten vorindustriellen Bildungsschichten. Die intellektuelle
65
Fhrungsrolle lag vornehmlich in den Hnden von Mitgliedern der geisteswissenschaftli-
chen und literarischen Leistungselite in den Universittsstdten, die in jener Zeit als
Foren der politischen Bewutseinsklrung und der Meinungs- und Willensbildung
besonders bedeutsam waren, zumal Sprecher des noch schwachen kapitalistischen Indu-
striewirtschaftsbrgertums in der politischen ffentlichkeit der neustndischen Gesell-
schaft vor den 1840er Jahren nur ganz vereinzelt hervortraten. H. Rosenberg (1972)
S. 9.
82 MEWBd. 1,S. 380 und 379.
83 F. Wehl, Berlin und seine jetzige Stellung, in: ders., Berliner Wespen, 1843, H. 1, S. 1 f.
84 R. Prutz, ber die gegenwrtige Stellung der Opposition, 1847, S. 57,53 f., 58 f., 60 f.
83 Gerade im Bereich literarischer Produktion wird deutlich, wie nach 1848 die Diskrepanz-
erfahrungen eingeebnet werden. Zu Gustav Freytags Soll und Haben vgl. C. Richter
(1978) hier bes. S. 209 ff.
86 Arnold Ruge (1802-1880) stammt aus einer Pchterfamilie der Insel Rgen. 1821 bis 1824
studiert er Theologie und klassische Philologie in Halle, Jena und Heidelberg. Er wird
aktives Mitglied des Geheimbundes Bund der Jungen. 1824 Verhaftung und Verurtei-
lung zu 15 Jahren Festungshaft. 1825-1830 Haft in Kolberg. 1831 Lehrer am Pdago-
gium in Halle und Habilitation. Freundschaftliche Kontakte zu Rosenkranz, Echtermeier
und Prutz, Frderung durch Hinrichs. 1838 Mitherausgeber der HJ, seit 1841 Verlegung
der Redaktion von Halle nach Dresden (Umbenennung in DJ). 1843 werden die Jahrb-
cher verbot en, Ruge geht nach Pari s. 1844 Herausgabe der Deut sch-Franzsi schen
Jahrbcher, gemeinsam mit Marx. 1845 bersiedelt Rge nach Zrich, wo er zusammen
mit J. Frbel die demokratische Opposition im Exil organisiert. Ruge untersttzt die frei-
religise Bewegung und kehrt 1846 nach Leipzig zurck.
Ruge beteiligt sich aktiv an der Revolution von 1848 und wird Mitglied des Frankfurter
Parlaments als Vertreter der Linken. 1849 wird er aus Berlin ausgewiesen, nimmt am Mai-
Aufstand in Sachsen teil, flieht nach Karlsruhe und geht im Interesse der badischen Revo-
lutionre nach Paris, von dort ber Brssel nach London. Hier grndet er mit Mazzini
und L. Rollin das Europische demokratische Komitee. Seit 1850 ist er bis zu seinem
Tode Deutschlehrer in Brighton. 1866 untersttzt er Teile der Bismarckschen Politik.
1876 wird ihm von Bismarck ein jhrlicher Ehrensold von 3.000 Mark zugesprochen.
(ADB Bd. 29, Zu A. Ruge vgl. die Literatur Anm. 168).
87 Hermann Friedrich Wilhelm Hinrichs (1797-1861) stammt aus einer friesischen Pfarrers-
familie. Hinrichs hrt Hegel 1816 in Heidelberg und wechselt von der Jurisprudenz zur
Philosophie ber. Er lehrt seit 1826 als einer der ersten Hegelianer in Halle und betreibt
dort eine rhrige Nachwuchspolitik. Zwei Momente mssen im Hinblick auf seine Rolle
fr den Junghegelianismus hervorgehoben werden: er gehrt zu den systemtreuesten
Hegelschlern, seine Terminologie und sein spekulatives Konstruieren bieten einen gesi-
cherten Rahmen fr die Hallenser Schler. Auf der anderen Seite bereitet Hinrichs die
Wendung spekulativer Schulphilosophie zu einer Beschftigung mit politischen Fragen
vor. Er greift in die verfassungspolitischen Debatten des Vormrz mit seinen Politischen
Vorlesungen (1843) ein und gert in Konflikt mit der preuischen Kultusverwaltung. Er
mu seine Vorlesungen fr einige Wochen aussetzen und begegnet dem ministeriellen
Verweis mit einer aufsehenerregenden Publikation der Vorlesungen. Er untersttzt 1845
die freireligise Bewegung der Deutschkatholiken.
Nach dem Scheitern der Revolution von 1848 rckt er von den konstitutionellen Forde-
rungen ab, die er allenfalls in einem zuknftigen Amerika fr realisierbar hlt. Wichtiger
ist fr ihn, gegenber dem sich ausbreitenden Empirismus und Materialismus einen idea-
listischen Kernbestand vor der skeptizistischen Resignation zu bewahren. (ADB Bd. 12;
NBD Bd. 9; H. Rosenberg (1929) S. 571-577; H. Lbbe (1960) S. 208-213 u. a. ;
K. Rttgers (1975) S. 225-232).
66
88 Julius Schaller (1810-1868) stammt aus einer Magdeburgischen Predigerfamilie. Er stu-
diert in Halle zunchst Theologie, unter dem Einflu von Karl Rosenkranz wechselt er
zur Philosophi e. Schaller wird 1834 zum Privatdozenten ernannt, 1838 erhlt er eine
auerordentliche Professur. Er ist mit Ruge befreundet, allerdings besteht zwischen bei-
den ein Konkurrenzverhltnis. Schaller gelingt die Universittskarriere, die Ruge mi-
lingt. Ruges Bestreben, die HJ ganz auf die Linie der Religionskritik von D. F. Strau und
der Tbinger Junghegelianer zu stellen, wird von Schaller nicht geteilt. Er nimmt ber-
wiegend gegen Strau Stellung (Der historische Christus und die Philosophie, 1838). In
der Folgezeit lst er sich mehr und mehr von hegelianischen Positionen und verfat
Arbeiten zur Kritik der Anthropologie und des Materialismus. (ADB Bd. 20; zum Ver-
hltnis Rge - Schaller siehe F. W. Graf (1978 a) S. 390,412 f.).
89 Robert Eduard Prutz (1816-1972) stammt aus einer Stettiner Kaufmannsfamilie. 1834-
1838 studiert er in Berlin, Breslau und Halle Philologie. In Jena lebend gehrt er mit zum
Initiatorenkreis der HJ. Mit Ruge ist er befreundet und verschwgert. Er ist Mitarbeiter
der RhZ und schl i et 1842 Freundschaft mi t Herwegh. 1843 wi rd er wegen ei nes
Tischliedes auf Dahlmann aus Jena verwiesen. Er bersiedelt nach Halle und entfaltet
eine breite schriftstellerische Ttigkeit. 1845 trgt ihm eine politische Komdie einen
Proze wegen Majesttsbeleidigung ein, der jedoch von Friedrich Wilhelm IV. auf Inter-
vention A. von Humboldts niedergeschlagen wird. 1846/7 kommt es zu einer ffentli-
chen Polemik zwischen Ruge und Prutz, bei der Prutz von radikalen Positionen zugung-
sten >realpolitischer< berlegungen abrckt.
An der Revolution von 1848 beteiligt sich Prutz als Mitglied des konstitutionellen Klubs
in Berlin. 1849 wird er auerordentlicher Professor fr Literaturgeschichte in Halle.
Unter dem Druck nachmrzlicher Repressionen, Intrigen und Denunziationen gibt Prutz
1857 seine hallische Professur auf und kehrt in seine Geburtsstadt Stettin zurck, wo er
als freier Schriftsteller ttig ist. 1866 wird er wegen seiner Terzinen Mai 1866 zu drei
Monaten Gefngnis verurteilt und bald darauf amnestiert. Trotz zunehmender gesund-
hei tl i cher Schwche unt erni mmt er noch zahl rei che Vort ragsreisen. (ADB Bd. 26;
G. Bttner (1912); W. Spilker (1937); I. Pepperle (1978) S. 109-132, u. a.).
90Ernst Theodor Echtermeier (1805-1844) st ammt aus ei ner schsi schen Beamt enfami l i e.
Er studiert zunchst Jura in Halle, dann in Berlin unter dem Eindruck Hegels Philoso-
phie. 1831 wird er Lehrer am Pdagogium der Franckeschen Stiftungen in Halle. Die
Idee der HJ stammt wahrscheinlich von ihm. Echtermeier begeistert Rge fr die Hegel -
sche Philosophie und gewinnt ihn fr die Herausgabe der HJ. Eine unheilbare Erkran-
kung zwingt ihn seit 1838, seine Aktivitten einzuschrnken. Er tritt 1841 frmlich von
der Redaktion der HJ zurck. (ADB Bd. 48; NDB Bd. 4; A. Stahr, Kleine Schriften,
1871, Bd. 1, S. 395^t22; A. Rge, SW Bd. 6, S. 137-159).
91Zur Situation in Halle siehe H. Rosenberg (1929). Die Herausbildung von Ruges Kreis in
Halle ist ausfhrlich dargestellt bei F. W. Graf (1978 a) bes. S. 388 ff.
92 Michail Bakunin (1814-1876) stammt aus einer russischen Adelsfamilie. Er besucht die
Petersburger Artillerieschule, quittiert aber 1835 den Militrdienst. 1836-39 schliet er
sich einer Moskauer Intellektuellengruppe an, in der er Hegels Philosophie rezipiert.
1840 kommt er nach Berlin und befreundet sich mit Turgenjew, der Kontakt zu Bruno
Bauer hat. 1842 befreundet er sich mit Ruge in Dresden und schreibt fr die Jahrbcher.
Wegen seiner Aktivitten fr die Jahrbcher mu er Dresden verlassen. 1843 befreundet
er sich mit Herwegh in Zrich; in der Schweiz lernt er Weitling kennen. Wegen politi-
scher Umtriebe mu er die Schweiz verlassen und hlt sich in Brssel und Paris auf
(1844-1848), wo er mit Proudhon und Marx zusammentrifft.
In Paris und Dresden nimmt er an der Revolution von 1848 teil und gert in Haft. Von
Sachsen wird er an sterreich, von dort an Ruland ausgeliefert. 1861 flieht er aus Sibi-
rien ber Nordamerika nach London und entfaltet eine ausdauernde konspirative revolu-
67
tionre Ttigkeit in ganz Europa. 1869 kommt es auf dem Kongre der Internat ional en
Arbeiter-Assoziation zur Konfrontation zwischen Marx und Bakunin, in deren Folge sich
der hi storische Bruch zwischen sozialrevoluti onrem Anarchismus und marxist ischer
Sozialdemokratie entwickelt. (Literatur zu Bakunin siehe weiter unten Anm. 165).
93 Ludwig Feuerbach (18041872) stammt aus Landshut, sein Vater war der Strafrechtsleh-
rer Anselm Ritter von Feuerbach. 1823 studiert er Theologie in Heidelberg, 1825 in Ber-
lin; er hrt Hegel und wendet sich der Philosophie zu. 1825/ 26 naturwissenschaftliche
St udi en i n Er l angen. 1832 gi bt ef sei ne akademi sche Lehr t t i gkei t al s Pri vat dozent i n
Erlangen auf. 1837 heiratet er Bertha Lwe und bersiedelt nach Bruckberg bei Ansbach,
wo er bis 1860 als freier philosophischer Schriftsteller lebt. Rge gewinnt ihn 1837 zur
Mitarbeit an den HJ. 1839 greift er in die Debatte um die Leosche Denunziationsschrift
ein. 1841 erscheint Das Wesen des Christ entums, 1842 die Vorlufi gen Thesen zur
Reform der Philosophie mit denen er neben D. F. Strau und B. Bauer zu einem zentra-
len Bezugspunkt junghegelianischer Diskussion wird. Er sympathisiert 1848 mit der Lin-
ken im Frankfurter Parlament. Seit 1860 lebt er in Nrnberg. 1870 tritt er der SDAP bei.
Feuerbach hat die engen hegelianischen Schulzusammenhnge ebenso wie die junghege-
lianischen Gruppentreffen sorgsam gemieden. Er korrespondierte von Bruckberg aus mit
Ruge und anderen, empfing auch junghegelianische Besucher. Der Einflu, den er auf die
Gruppe hat t e, vol l zog si ch wesent l i ch durch seine Schri ft en. (Li t er at ur zu Feuer bach
siehe Anm. 171).
94 Karl Theordor Bayrhoffer (1812-1888) ent st ammt ei ner Marburger Buchdruckerfami l i e.
Er studiert Philosophie in Marburg, promoviert und habilitiert sich im selben Jahr 1834.
1838 wird er dort auerordentlicher Professor. Von Leo wird er als Mitglied der junghe-
gelianischen Partei denunziert. Bayrhoffer gehrt zu den regelmigen Mitarbeitern der
HJ. 1839 nimmt er gegen Rosenkranz Stellung (HJ 1839, Sp. 1391-1416) und engagiert
sich im kurhessischen Symbolstreit gegen die protestantische Orthodoxie. Er organisiert
in Marburg einen protestantischen Leseverein, der sich zu einer der radikalen Gemein-
den der Bewegung der Lichtfreunde entwickelt. Er hat wesentlichen Anteil an der Ver-
breitung junghegelianischer Philosophie in der freireligisen Bewegung. 1846 wird er ein
Jahr nach Erhalt einer Professur in Marburg vom Amt suspendiert.
An der Revolution von 1848 nimmt er aktiv teil und ist Reprsentant der hessischen
Demokraten. 1850 gelingt ihm die Flucht nach Zrich. Von dort wandert er in die USA
aus. Seine Marburger Professur wird ihm entzogen, 1853 wird er in Abwesenheit zu
15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Aufforderungen, an den Verfassungskmpfen der 60er
Jahre teilzunehmen, lehnt er ab. Sptere Rckkehrversuche scheitern. Bayrhoffer lebt bis
zu seinem Tod als Farmer in Green Country und Town Jordan (Wisconsin). (Bayrhoffer
ist in der ADB und NDB nicht aufgefhrt. Zur Biographie vgl. Ph. Losch (1939) S.8-9).
95 Georg ]ung (1814-1886) stammt aus einer Rotterdamer Kaufmannsfamilie. Er studiert
Jura: 1834-35 in Bonn, wo er preuischer Staatsbrger wird, um 1835-36 in Berlin. Er
wird Referendar und Assessor am Klner Landgericht. Jung schreibt fr die HJ und
gehrt zu den Mitbegrndern der RhZ. Zusammen mit seinen Freunden He und Marx
wendet er sich sozialistischen Positionen zu und finanziert das wahrsozialistische Kl-
ner Allgemeine Volksblatt. 1846 geht er nach Berlin.
Im Mrz 1848 hlt er eine bekannt gewordene Rede am Grab der Berliner Revolutionre.
Er wird Prsident des Politischen-Demokratischen Clubs, und in der preuischenkonsti-
tuierenden Versammlung engagiert er sich auf der Seite der demokratischen Linken. In
den 60er Jahren tritt er politisch nicht hervor. 1863-76 gehrt er dem preuischen Abge-
ordnetenhaus an, zunchst als Mitglied der Fortschrittspartei, ab 1867 untersttzt er als
Nationalliberaler die BismarckschePolitik. (NDB Bd. 10).
96 Moses He (1812-1875) stammt aus einer jdischen Bonner Kaufmannsfamilie. Entgegen
seinen spteren Selbstdeutungen kann von einer streng jdischen Erziehung nicht
68
gesprochen werden. 1826 soll er in das Geschft des Vaters eintreten, er beginnt jedoch
1830 in Bonn ein zielloses Studium. 1833 geht er heimlich nach Holland und Frankreich
und trifft auf oppositionelle Emigranten. Finanzielle Not zwingt ihn zur Rckkehr nach
Bonn, 1837 erscheint Die heilige Geschichte der Menschheit. Von einem Jnger Spino-
zas und 1841 Die europische Triarchie. Im selben Jahr trifft er Marx in Bonn. He
gehrt zur Initiativgruppe der RhZ, deren Pariser Korrespondent er wird. Er untersttzt
die Rezeption des franzsischen Sozialismus bei den Junghegelianern, arbeitet an den
>Deutsch-franzsischen Jahrbchern< mit. 1844 nimmt er gegen Feuerbach, B. Bauer
und Stirner Stellung (Die letzten Philosophen) und ist mageblich an dem Elberfelder
>Gesellschaftsspiegel< beteiligt, dem Organ der deutschen Sozialisten. 1845 betreibt er
zusammen mit Marx und Engels den Aufbau einer europischen kommunistischen Orga-
nisation in Brssel.
In der Revolution von 1848 weicht He der Auseinandersetzung mit Marx und seiner
Fraktion im Bund der Kommunisten aus und geht nach Paris. He orientiert sich neu.
1862 ist er Mitglied der althegelianischen Berliner Philosophischen Gesellschaft und ver-
ffentlicht Rom und Jerusalem, in dem er fr die Errichtung eines jdischen Staates in
Palstina pldiert. In den 60er Jahren nhert sich He Lassalle an und wird Mitglied des
Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. 1867 rckt er von den Lasalleanern ab und
nhert sich Liebknecht und Marx an. Bei Beginn des Krieges 1870 wird He aus Frank-
reich ausgewiesen, wohin er 1872 zurckkehrt. (Sh. Na'aman (1982) Vgl. auch die Litera-
tur in Anm. 166).
97 Zu den organisatorischen Verdichtungen um die RhZ vgl. W. Klutentreter (1966). Neben
G. Jung gehrt auch Rudolf Schramm zu den Klnern, die an den HJ mitwirken. Verbin-
dungen zwischen den HJ und der RhZ liefen auch ber Ruges Freund K. M. Fleischer.
Im Sommer 1842 wird fr einen Teil der Klner Gruppe die Diskussion um die soziale
Frage wichtig. Zu den sog. Montagskrnzchen, das auch nach dem Verbot der RhZ
1843 weiter besteht, gehren: M. He, G. Jung, Brgers, E. Mayer, W. Thome, C. d'E-
ster, G. Mevissen, K. Marx. (Klutentreter (1966) S. 35).
98 Karl Heinzen (1809-1880) stammt aus einer niederrheinischen Forstbeamtenfamilie.
1827 Studium der Medizin in Bonn. 1829 wird er wegen aufrhrerischer Reden gegen die
Universittsbehrden fr immer vom Studium ausgeschlossen. 1829 bis 1831 lt er sich
in die hollndische Fremdenlegion nach Batavia anwerben. 1833-1840 tritt er in den
preuischen Staatsdienst als Steuerbeamter. In dieser Zeit radikalisiert er sich und
gewinnt 1840 Kontakt zum Jungen Kln und zu den Initiatoren der RhZ, deren eifriger
Mitarbeiter er wird. 1844 flieht er nach Erscheinen seines Buches Die preuische Bro-
kratie nach Belgien, dann in die Schweiz, wo er mit Ruge und Frbel verkehrt. 1847
berwirft er sich mit Marx und Engels.
In wirtschaftlicher Not lebend, geht er 1848 in die USA, kehrt jedoch zur Revolutionszeit
wieder nach Deutschland zurck und nimmt am badisch-pflzischen Aufstand teil. ber
die Schweiz und London kehrt er 1850 nach Nordamerika zurck. Dort gibt er nachein-
ander mehrere radikale Zeitschriften heraus. Am einflureichsten wurde der zuletzt in
Boston verlegte >Pioneer< (1859-79). Heinzens Bedeutung fr die Entwicklung des ame-
rikanischen Radikalismus und Anarchismus mu besonders hervorgehoben werden.
(ADB Bd. 50; NDB Bd. 8; H. Huber (1932); C. F. Wittke (1945).
99 Die Quelle fr den Doktorclub ist Marx' Brief an seinen Vater vom 10. 11. 1837, in:
MEW EA 1, S. 10. Genannt wird hier namentlich nur Rutenberg. B. Bauers und
F. K. Kppens Zugehrigkeit zum Doktorclub wird in der Literatur aufgrund der
Freundschaften zu Marx angenommen. Vgl. S. Miller/B. Sawadzki (1956) S. 68 und 226.
100 Bruno Bauer (1809-1882) stammt aus einer thringischen Porzellanmalerfamilie, die
nach Berlin bergesiedelt ist. Er studiert 1825-1834 Theologie in Berlin und hrt Hegel.
1834 habilitiert er sich, hlt Vorlesungen in Berlin und greift in die theologische Diskus-
69
sion ein. Bis zum Sommer 1839 ist er radikal-orthodoxer Hegelianer und Anhnger
Hengstenbergs. 1839 kritisiert B. Bauer seine Vergangenheit und greift Hengstenberg
an. Er wird nach Bonn versetzt. In seiner Kritik der Evangelien versucht er, Strau'
Leben Jesu zu berholen. Bauer entwickelt sich zu einem radikalen Atheisten und hat
mageblichen Einflu auf die junghegelianischen Gruppen. Er ist vertraut mit Ruge und
befreundet mit Marx, fr dessen Karriere er sich verantwortlich fhlt. Er ist Mitarbeiter
der HJ und der RhZ. 1842 wird ihm die Lehrerlaubnis entzogen (vgl. S. 125 ff. dieser
Arbeit). 1843 beginnt B. Bauer mit einer Kritik des 18. Jahrhunderts, der Revolution
und des politischen Radikalismus brgerlicher und sozialistischer Prgung. Er entwik-
kelt die Theorie der reinen Kritik, die er in der ALZ und den NB propagiert.
In der Revolution von 1848 wird B. Bauer in Charlottenburg als Abgeordneter vorge-
schlagen, aber nicht gewhlt. Er wird Opfer der reaktionren Schlgerkommandos des
20. August in Charlottenburg. Schon 1849 erscheint seine beiende Kritik der Revolu-
tion. 1850-1852 arbeitet er ber das Urchristentum. 1852-1855 gert er in den Ver-
dacht, russischer Spitzel zu sein, weil er das Ende des Germanentums und den Aufstieg
der groen Mchte Ruland und Nordamerika prognostiziert. Seit 1859 arbeitet
B. Bauer an H. Wageners konservativem Staats- und Gesellschafts-Lexikon und kon-
servativen Zeitschriften mit. Seine Sptwerke behandeln das englische Qukertum und
den deutschen Pietismus (1878), deren Bedeutung fr die Skularisation des Christen-
tums er herausstellt, und Bismarck (1880, 1882) - Werke, in denen er unter anderem die
staatssozialistischen Strategien seiner Zeit reflektiert. Von der nachmrzlichen Zeit bis
zu seinem Tode lebt B. Bauer in Rixdorf bei Berlin, wo er neben seiner Schriftstellerei
eine kleine Landwirtschaft betreibt. Trotz aller Rtsel, die B. Bauers Leben enthlt, ver-
git kein Biograph, an B. Bauers charakterliche Gre zu erinnern. (ADB Bd. 46; NDB
Bd. 1. Vgl. die in Anm. 175 angegebene Literatur.
101 Adolf Rutenberg (1808-1869) stammt aus Berlin. Er studiert in Berlin Philosophie, Phi-
lologie und Theologie und wird als Burschenschaftler zeitweilig verhaftet. Er ist als Leh-
rer an verschiedenen Berliner Schulen beschftigt, von 1831-40 an der Berliner Kadet-
ten-Schule. Wegen seiner Mitarbeit an liberalen Zeitungen wird er entlassen. Er gehrt
mit zum Doktorclub, zu den Athenensern und den Organisatoren der >Serenade fr
Theodor Welcker<, fr dessen Staatslexikon er mehrere Artikel schreibt (vgl. S. 206 ff.
dieser Arbeit). Er ist Mitarbeiter der HJ und der RhZ, als deren Redakteur er im Novem-
ber 1842 auf Drngen der Regierung entlassen wird. Rutenberg kehrt nach Berlin
zurck, wo er in den Gruppenspaltungen an der Seite Meyens und Nauwercks auf-
taucht.
In der Revolution von 1848 ist er zunchst im demokratischen, dann im konstitutionellen
Club ttig. Mit F. Zabel grndet er die >National-Zeitung<, zieht sich aber bald ausdem
politischen Leben zurck. Spter ist er Redakteur des >Preuischen Staatsanzeigers<.
(Rutenberg ist in der ADB nicht bercksichtigt.)
102 Karl Friedrieb Kppen (1808-1863) stammt aus einer altmrkischen Pfarrerfamilie.
18271831 studiert er in Berlin Theologie. Er leistet seinen Militrdienst ab, Engels
zeichnet ihn 1842 in Leutnantsuniform. Seit 1833 ist er Lehrer in Berlin. 1837 erscheint
eine Arbeit ber die Nordische Mythologie, deren religionskritische Intentionen parallel
zu denen B. Bauers und Feuerbachs laufen. Als enger Freund von Marx in Berlin gehrt
er vermutlich zum Doktorclub des Jahres 1837. Er ist der erste Berliner Junghegelia-
ner, der Kontakt zu Ruges HJ aufnimmt. 1839 verteidigt er Hegel gegen die Schubart -
sche Denunziation und initiiert vermutlich um 1840 die Fichte-Rezeption der Junghege-
lianer. Er gehrt zu den Teilnehmern der >Serenade fr Th. Welcker< (vgl. S. 206 ff. die-
ser Arbeit) und zieht sich den Unmut der Regierung zu. Er wird Mitarbeiter der RhZ.
Seine Verortung in den Spaltungen der Berliner Junghegelianer ist nicht einfach vorzu-
nehmen. 1843 erscheint er kurz an der Seite von Prutz, 1844 beteiligt er sich an den NB
70
der B. Bauerschen Richtung. 1845 kndigt er eine B. Bauer-Kritik an. 1847 bersetzt er
mit Buhl Louis Blancs Geschichte der Franzsischen Revolution. Der gnzlich gute
Koppen (Engels) hat offensichtlich den mit den Spaltungen einhergehenden Kommu-
nikationsabbrchen zu widerstehen gewut.
In der Revolution von 1848 taucht er im Umkreis von St. Borns Arbeiterverbrderung
auf; 1849 ist er Mitglied des Zwlf-Ausschusses der Berliner Demokratischen Partei.
Nach der Revolution befat sich Kppen mit der Erforschung des Buddhismus. 1857-
59 erscheint seine zweibndige Arbeit Die Religion des Buddha. (H. Hirsch (1955)
S. 19-81).
103 Zur j unghegel i ani schen Phase von Karl Marx (1818-1883) vgl. Die i n Anm. 162 angege-
bene Literatur. An dieser Stelle sei an Marx' Aufenthaltsorte erinnert: 1835 Bonn; 1836-
April 1841 Berlin, Kontakte im >Doktorc'ub< und mit den >Athenensern<; 1841Ende
1843 Kln, Kontakte durch die RhZ; Ende 1843-Februar 1845 Paris; Februar 1845-
1848 Brssel.
104 Edgar Bauer (18201882), der elf Jahre jngere Bruder Bruno Bauers studiert in Berlin
zunchst Theologi e, dann Jura. 1842 bricht er sein St udium ab und wi rd freier Schrift-
steller. Er ist Mitarbeiter der DJ und der RhZ und entfaltet eine rege publizistische Ttig-
kei t. Er verteidigt sei nen Bruder anllich des Entzugs der Lehrerlaubnis und initi iert
die junghegelianische Kritik am Liberalismus. Seine Position in den Berliner Fraktions-
kmpf en dar f ni cht mi t der sei nes Br uder s i dent i f i zi er t wer den. I m Unt er schi ed zu
Bruno Bauer, an dessen ALZ und NB er zwar mitarbeitet, entfaltet Edgar Bauer eine Kri-
tik der brgerlichen Gesell schaft, di e nicht mehr auf die Formen t raditionel l en Poli tik-
verst ndni sses zurckgrei ft , sonder n den Aspekt der sozi al en Revol ut i on herausst el l t ,
die im wesentlichen vom Proletariat getragen wird. In der angestrebten freien Gemein-
schaft ist der politische Staat aufgehoben. Die Publ ikati on von Der St reit der Kritik
mi t Ki r chen und St aat ( 1843) i s t Anl a f r di e Ver haf t ung und Gef angens et zung
E. Bauers. Zu vierjhriger Festungshaft verurteilt, ist er seiner Einflumglichkeiten auf
die junghegelianische Diskussion weitgehend beraubt.
1848 wird E. Bauer freigelassen. An der Revolution in Berlin beteiligt er sich aktiv. 1849
gibt er zusammen mi t Theodor Ohlshausen di e >Norddeutsche Freie Presse< heraus, in
der di e Bef rei ung Schl eswi g- Hol st ei ns gefor dert wi rd. Edgar Bauer l ebt i n Hannover
und Flensburg. In den 50er Jahren geht er nach London, wo er Marx regelmig trifft.
E. Bauer ist Redakteur der Londoner Zeitung >NeueZeit<. Nach der Amnestie von 1861
kehrt er nach Deutschland zurck. 1866 versucht er, in Hamburg und Altona Fu zu fas-
sen. Er wird preuischer Beamter und redigiert seit 1870 in Hannover die konservativen
Kirchlichen Blatten. (E. Bauer ist weder in der ADB noch in der NDB bercksichtigt .).
105Karl Riedel (Hg), Athenum. Zeitschrift fr das gebildete Deutschland, Berlin 1841
(50 Hefte). Zu den Beitrgern des Athenums gehren ber die Genannten hinaus u. a.:
Theodor Mgge, Moritz Carriere, Wilhelm Cornelius, Ludwig Eichler, C. M. Wolf und
Constantin Frantz. Aus dem Athener-Kreis heraus wurde die Serenade fr den badi-
schen Liberalen Theodor Welcker organisiert (vgl. S. 206 ff. dieser Arbeit). Die fakti-
sche Redaktion des Athenum lag in den Hnden von E. Meyen.
106 Karl Riedel (1804-1878) stammt aus Franken. Er studiert Theologie und ist 1826-1839
Pfarrer in verschiedenen frnkischen Stdten. Er ist mit L. Feuerbach befreundet. 1839
gibt er seine Pfarrerttigkeit auf und kommt nach Berlin. Er propagiert zur Thronbestei-
gung 1840 entschieden die Unvereinbarkeit von freiem Staat und kirchlicher Hierarchie
und erffnet ein Jahr spter die junghegelianische Polemik gegen Schelling.
ber Riedels weiteren Lebensweg ist wenig bekannt. Um 1850 ist er nach Amerika aus-
gewandert. (Riedel ist in der ADB nicht bercksichtigt.)
107 Eduard Meyen (1812-1870) stammt aus Berlin. Er studiert in Berlin und Heidelberg und
promoviert 1835. 1838/9 ist er Redakteur der Berliner Literarischen Zeitung<. Seit 1839
71
ist er Mitarbeiter der HJ. Die faktische Redaktion des >Athenum< liegt 1841 in seinen
Hnden. 1842 ist er Mitarbeiter der RhZ. In den Berliner Spaltungen vertritt er Positio-
nen, di e i hn i n di e Nhe von Rut enber g und Buhl rcken l assen. 1843 wendet er si ch
sozialistischen Positionen zu und ist seit 1844 mit Karl Grn Redakteur der wahrsoziali-
stischen >Trierschen Zeitung<.
In der Revolution von 1848 ist er u. a. mit Frbel und Kriege Mitglied des provisorischen
Zent r al ausschusses der demokrat i schen Verei ne. Er gehrt mi t Faucher zu den Mi t ar-
beitern der Berliner >Abendpost<. Nach dem Scheitern der Revolution emigriert er 1851
nach London, wo er i n Konkur renz zu Mar x und Engel s si ch i n der opposi t i onel l en
Szene engagiert. Ende der 50er Jahre kehrt er nach Deutschland zurck und ist mit Ruge
Begrnder der >Reform<. Meyen schliet sich nat ional li beral en Posit ionen an und ist
zuletzt Redakteur der >Danziger Zeitung<. (In der ADB ist Meyen nicht bercksichtigt.)
108 Karl Theodor Nauwerck (1810-1891) stammt aus Salem (Herzogtum Lauenburg). 1828-
31 studiert er in Berlin und Bonn Theologie. 1834 promoviert er in Halle im Fach Philo-
sophie. In Berl in, wo er die venia legendi fr Arabisch und Geschichte der Philosophie
erhlt, ist er seit 1836 Privatdozent. Er gehrt mit zum frhen Kreis der Berliner Junghe-
gelianer. 1841 ist er Mitarbeiter der HJ und des >Athenum<, 1842 schreibt er in der RhZ.
Di e Grndung ei nes akademi schen Lesezi rkel s erregt den Unmut der Behr den, Nau-
wer ck wi r d wegen mangel nder Auf si cht der St udent en ger gt . 1843 i nt er veni er t der
Kni g i n Sachen des Pr i vat dozent en, und 1844 wi rd i hm di e Lehr er l aubni s ent zogen,
was bei den Berliner Studenten zu ei ner Demonstration fhrt. In den Fraktionskmpfen
steht er an der Seite Ruges, mit dem er befreundet ist.
An der Revolut ion von 1848 beteiligt si ch Nauwerck akti v und wi rd Abgeordneter der
Frankfurt er Nat i onal versamml ung. Hi er gehrt er der uer st en Li nken an. Von 1849
bis zu seinem Tode lebt Nauwerck als Inhaber eines Zigarrengeschftes in Zrich. (In
der ADB ist Nauwerck nicht bercksichti gt. Vgl. Anm. 169)
109 Ludwig H. F. Buhl (1814-Anfang der 1880er Jahre) stammt aus der Berliner franzsi-
schen Kolonie. Er ist Schler Michelets und promoviert 1837 in Berlin. Im gleichen Jahr
verffentlicht er die erste junghegelianische Schrift zur Hegelschen Rechtsphilosophie
(eine bersetzung aus der Sprache der Gtter in die der bertgigen Menschen). Buhl
entfaltet im Vormrz eine umfangreiche publizistische Ttigkeit, in deren Zentrum poli-
tische Analysen stehen. Er gehrt zum frhen Berliner Kreis der Junghegelianer, ist Mit-
arbeiter des >Athenum< und der RhZ. In den Berliner Fraktionskmpfen taucht er an
der Seite von Kppen, Meyen und Stirner auf. Seine Schriften werden hufig beschlag-
nahmt, und Buhl gert mehrmals in Haft.
In der Revolution von 1848 taucht Buhl in demokratischen Clubs in Berlin auf, wo er
wegen seiner ironischen Witzeleien die Emphase strt. Nach der Revolution lebt er
zurckgezogen. ber sein weiteres Schicksal sind genauere Angaben nicht aufzufinden.
(In der ADB ist Buhl nicht bercksichtigt.)
110 Zur junghegelianskhen Phase von Engels (1820-1895) vgl. die in Anm. 162 angegebene
Literatur. An dieser Stelle sei an Engels Aufenthaltsorte erinnert: 1838-1841 Bremen;
1841-1842 Berlin im Kreise der Athenenser; 1842 Barmen, Kln, Treffen mit He und
Marx; 1842-1844 England; 1844 Paris; 1845-1847 Brssel.
111An dieser Stelle sei an Stirners Herkunft, Aufenthaltsorte und Kontakte erinnert. Stirner
(1806-1856) stammt aus Bayreuth, sein Vater war Instrumentenmacher. 1826-28 Stu-
dium der Philosophie in Berlin, dort hrt er Hegels Vorlesungen. 1828 Studium in
Erlangen, 1829-1832 in Knigsberg immatrikuliert, lebt zeitweise in Kulm, seit 1832 bis
zu seinem Tode in Berlin. 1835 Lehrerexamen (Arbeit ber Schulgesetze), 1835-1836
und 1839-1844 Lehrerttigkeit in Berlin. Er stt Anfang der 40er Jahre zu den Berliner
Junghegelianern. 1842 Mitarbeit an der RhZ und der >Leipziger Allgemeinen Zeitung<.
In den Beitrgen werden auch Kontakte zu Knigsberg deutlich. 1843 Heirat mit der
72
Junghegelianerin Marie W. Dhnhardt (vgl. S. 292 dieser Arbeit). 1844 Mitarbeit an
Buhls >Berliner Monatsschrift<. Ende 1844 erscheint >Der Einzige und sein Eigentum<.
1845 Experimente mit einer Milchwirtschaftskooperative. Stirner gert in finanzielle
Not. 1846 Trennung von M. Dhnhardt. 1848 ist kein Hervortreten Stirners berliefert.
1852 erscheint die zweibndige >Geschichte der Reaktion. 1853 gert Stirner in Schuld-
arrest. Er stirbt vllig verarmt. (ADB Bd. 36, vgl. die in Anm. 174 angegebene Literatur)
112 Eduard Gans (1798-1839) stammt aus einer jdischen Berliner Kaufmannsfamilie. Er
studiert in Berlin, Gttingen und Heidelberg, wo er vielleicht schon Hegelsche Ideen
kennenlernt, Jura, Geschichte und Philosophie. 1820 kehrt Gans nach Berlin zurck, wo
er 1828 eine Jura-Professur erhlt. Auf seine Initiative hin kommt es zur Grndung der
Berliner Jahrbcher (JWK). Als Kritiker der >historischen Rechtsschule< Savignys vertei-
digt er die Notwendigkeit von Rechtsschpfungen aus den Bedingungen der Gegenwart.
Gans hlt an den progressiven Elementen der Hegelschen Rechtsphilosophie, wie sie vor
1820 entwickelt wurden, entschieden fest und formuliert die Hegelschen Grundstze in
einer auf tagespolitische Ereignisse offen Bezug nehmenden publizistischen, engagierten
Sprache. Zu seinen zahlreichen Hrern gehrt auch der junge Marx. Ruges HJ verfolgt
Gans mit groer Sympathie. Auf die junghegelianische Rechts- und Staatsauffassung hat
er groen Einflu gehabt. (ADB Bd. 8; NDB Bd. 6; H. G. Reissner (1965); M. Riedel
(1967).
113Carl Ludwig Michelet (1801-1893) stammt aus einer Berliner Kaufmannsfamilie franz-
sischer Calvinisten. Er studiert in Berlin Jura und wendet sich der Hegeischen Philoso-
phie zu. Von 1825-1850 ist er Lehrer am franzsischen Gymnasium, seit 1826 lehrt er
als Privatdozent, seit 1829 bis zu seinem Tode als auerordentlicher Professor Philoso-
phie in Berlin. Michelet gehrt seit 1827 zum Herausgeberkreis der JWK und beteiligt
sich an der Herausgabe der Werke Hegels. Rosenkranz zufolge bildet Michelet den
bergang von den Althegelianern zu den Junghegelianern. (K. Rosenkranz, Aus einem
Tagebuch, 1854, S. 140) Von Leo wird er 1839 als Vertreter der junghegelschen Partei
angegriffen. 1843 grndet er zusammen mit dem befreundeten Cieszkowski die Philo-
sophische Gesellschaft zu Berlins
In der Revolution von 1848 tritt Michelet fr ein Bndnis von Konstitutionellen und
Demokraten ein. 1860-1866 redigiert er die Zeitschrift >Der Gedanke<. Bis zu seinem
Tod verffentlicht er zahlreiche philosophische Arbeiten. (ADB Bd. 55; C. L. Michelet,
Wahrheit aus meinem Leben, Berlin 1884)
114 Im Zentrum der Knigsberger brgerlich-liberalen Opposition steht der Arzt Johann
Jacoby (vgl. S. 205 und 211 f. dieser Arbeit). In der Konditorei Siegel trifft sich seit 1839/
40 ein politischer Zirkel, dem neben Jacoby u.a. Julius Waldeck und Ludwig Walesrode
angehren. Seit 1842 stoen zu der Donnerstags-Gesellschaft weitere Teilnehmer
hinzu. Unter den ca. 20 Personen sind auch: Rudolf Gottschall, F. Gregorovius, Julius
Rupp, Wilhelm Jordan, E. Flottwell. Neben dem Jacoby-Kreis existiert eine Gruppe
liberaler Junker, die sich um den Oberprsidenten Th. v. Schn scharen. Einen eher lite-
rarischen Charakter hat der Dichterbund um Karl Rosenkranz, dem u. a. Gottschall,
Jordan und Gregorovius angehren. Rosenkranz selbst hat zum Jacoby-Kreis wie zum
Schn-Kreis eine sympathisierende Distanz gehalten. Aber seine Verbindung zu Ruge
erffnete den Knigsbergern einen Zugang zur junghegelianischen Diskussion, der sich
rasch von den Rosenkranzschen >Vermittlungsdiensten< emanzipierte. (E. Silberner
(1976) bes. S. 66-74 u. a.; L. Esau (1935) bes. S. 70 ff.; A. Jung, Knigsberg und die
Knigsberger, 1846)
115 Karl Rosenkranz (1805-1879) stammt aus einer Knigsberger Beamtenfamilie. Er stu-
diert in Berlin (seit 1824) und in Halle (seit 1826) zunchst Theologie, dann Philosophie.
Hinrichs veranlat ihn zum tieferen Studium der Hegelschen Philosophie. Rosenkranz
promoviert und habilitiert sich 1828. Um 1830 prsidiert er in Halle der informellen
73
hegelianischen Gartengesellschaft (Gesellschaft zum ungelegten Ei), der Hinrichs,
Ritschi, Ruge, Echtermeier und Leo (damals noch Hegelianer) angehrten. Seit 1833
lehrt er bis zu seinem Tode in Knigsberg. 1838 grndet Rosenkranz einen Dichter-
bund in Knigsberg. R. Gottschall und W. Jordan werden seine Schler, deren literari-
sche Initiativen er frdert. Mit Ruge befreundet, untersttzt er anfangs die HJ und stellt
so einen Kontakt zwischen den Knigsbergern und den Junghegelianern der Jahrbcher
her. Seit 1840 beginnt eine Entfremdung zwischen dem >radikalen< Ruge und dem
>gemigten< Rosenkranz. Er unterhlt Kontakte zu den Liberalen einerseits um den
preuischen Oberprsidenten Th. v. Schn und andererseits um den Arzt Johann
Jacoby. Er untersttzt jedoch den ostpreuischen Liberalismus aus einer kritischen
Distanz heraus. Die Spaltung der Knigsberger Gruppe in >Liberale< und >Radikale< ver-
folgt er mit Skepsis. Rosenkranz bleibt ein Anhnger des preuischen Verwaltungsstaa-
tes, den er um sozialstaatliche Elemente angereichert sehen will.
In der Revolution von 1848 beteiligt er sich am Knigsberger Konstitutionellen Club
und wird kurze Zeit vortragender Rat im preuischen Kultusministerium. 1849 ist er
Mitglied des preuischen Landtags (Linkes Zentrum). Im Herbst 1849 kehrt er nach
Knigsberg zurck und konzentriert sich auf seine philosophisch-literatursthetische
Arbeit sowie auf ein Engagement in akademischen und kommunalen Angelegenheiten.
(ADB Bd. 29; L. Esau (1935)
116 Rudolf Gottschall(1823-1909) stammt aus Breslau. Sein Vater war Artilleriehauptmann.
Nach der Schulzeit in Koblenz studiert Gottschall in Knigsberg und Breslau Jura. Er
wird von Rosenkranz gefrdert und gehrt mit zum Knigsberger Jacoby-Kreis. Zu den
Berliner Junghegelianern hat er Kontakt whrend seines Militrdienstes in Berlin. Gott-
schall schreibt politische Lyrik (Lieder der Gegenwart, 1842; Zensurflchtlinge, 1843).
Nach der Auffhrung seines Revolutionsdramas Robesspierre wird er aus Breslau aus-
gewiesen. 1846 promoviert er in Knigsberg im Fach Jura. Gottschall strebt eine Univer-
sittskarriere an, kann jedoch die vom Minister binnen Jahresfrist geforderten Beweise
der Gesinnungsnderung nicht erbringen.
In der Revolution von 1848 ist er 24jhrig Mitglied des Knigsberger Arbeitervereins.
Gottschall wird Dramaturg in Knigsberg und entfaltet eine breite literarische und lite-
raturgeschichtliche Ttigkeit. Seit 1864 redigiert er die >Bltter fr literarische Unterhal-
tung< Spter wird er Mitarbeiter der >Gartenlaube<. Politisch wendet er sich mehr und
mehr der Rechten zu (Kriegslieder 1870). 1877 wird er von Wilhelm I. geadelt. (Gott-
schall ist in der ADB und NDB nicht bercksichtigt. R. v. Gottschall, Aus meiner
Jugend, 1898; J. Proel (1901)
117 Wilhelm Jordan (1818-1904) stammt aus einer ostpreuischen-pommerschen Pfarrerfa-
milie. Er studiert in Knigsberg zunchst Theologie, dann Philosophie und promoviert
1842. Im gleichen Jahr erscheinen seine ersten politischen Gedichte (Irdische Phanta-
sien, 1842). Von Knigsberg hlt er Kontakt zu den Berliner Junghegelianern und lt
sich 1844 als freier Schriftsteller in Leipzig nieder. 1846 wird er wegen eines blasphemi-
schen Toasts mit Gefngnis bestraft und des Landes Sachsen verwiesen. Theoretisch
entwickelt Jordan sehr frh historisch-materialistische Positionen und will programma-
tisch die Philosophie in die Naturwissenschaften auflsen. Er geht 1846 nach Bremen
und ist nach der Februarrevolution Korrespondent der Bremer Zeitung in Paris.
Im April 1848 geht er nach Berlin und wird als Vertreter der Linken in das Frankfurter
Parlament gewhlt. Groes Aufsehen erregen seine Reden in der Polendebatte, weil er
sich der deutschnationalen Position anschliet und zur Parlamentsrechten bergeht. Im
November 1848 wird er Ministerialrat in der Marineabteilung des Reichsministeriums
fr Handel. Nach der Versteigerung der deutschen Flotte 1849 wird ihm eine 30jhrige
Pension gezahlt. Finanziell gesichert unternimmt er von Frankfurt/M ausgehend als
wandernder Rezitator seiner Stabreimversepen zahlreiche Reisen durch Deutschland,
74
sterreich, die Schweiz, Ruland und Nordamerika (bis nach San Francisco).
Die junghegelianischen Auseinandersetzungen werden von ihm 185254 in dem Verse-
pos Demiurgos literarisch gestaltet. Er schreibt zahlreiche Dramen, Epen und
Romane und wird in seiner Zeit als Dichter hochgeschtzt. Politisch gilt er besonders seit
1870 als Propagandist neudeutscher Gre. (NDB Bd. 10; A. Gnther (1920); F. Meh-
ring (1961a); P.Scholz (1930)
118 Friedrich August Witt studiert in Knigsberg Philosophie und wird Oberlehrer am
Kneiphfschen Gymnasium zu Knigsberg. Er gehrt zum Jacoby-Kreis und ist ma-
geblicher Redakteur der Knigsberger Zeitung<. Aufgrund seines Engagements im Pro-
ze gegen Jacoby wird er 1841 als Lehrer suspendiert, weil er seine Redaktionsttigkeit
nicht aufgeben will. - In der Revolution von 1848 ist er Vorstandsmitglied des >Volks-
wehrclubs<. (F. A. Witt ist in der ADB nicht bercksichtigt.)
Hingewiesen sei auf den Umstand, da G. Mayer (1913) statt Friedrich August Witt den
Knigsberger Oberlehrer Carl Witt als Redakteur der >Knigsberger Zeitung< anfhrt
(S. 6). Carl Witt, der spter als Pdagoge bekannt wurde (ADB Bd. 43; Sebastian Hen-
sel, Carl Witt, Leipzig 1894), gehrte zwar auch zum Jacoby-Kreis, ist aber in dieser Zeit
politisch-publizistisch nicht in dem Mae hervorgetreten wie F. A. Witt. Zu dieser Ver-
wechslung bei G. Mayer kommt eine weitere: Mayer schreibt den wichtigen anonymen
Aufsatz: >Preuen seit der Einsetzung Arndts bis zur Absetzung Bauers<, in: EB S. 132
ebenfalls Carl Witt zu. Nach E. Silberner (1976, S. 129) stammt dieser Aufsatz nachweis-
lich von K. R. Jachmann. Die von Mayer festgestelte wrtliche bereinstimmung mit
Passagen einer Broschre, die von August Witt stammen mte, habe ich nicht berpr-
fen knnen. (Vgl. G. Mayer, Ebd. S. 6)
119 Karl Reinhold Jachmann, geb. 1810 in Jenkau bei Danzig, studiert Theologie an der Uni-
versitt Knigsberg. Er promoviert 1834 und wird Privatdozent. Er gehrt zum Jacoby-
Kreis in Knigsberg. 1841 tritt er mit einer Streitschrift zur Frage der kirchlichen Union
hervor. Er ist Mitarbeiter der >Knigsberger Zeitung<, hat ber G. Julius Kontakte zur
Leipziger Allgemeinen Zeitung< und wird von E. Flottwell aufgefordert, fr die RhZ zu
schreiben. 1843 zieht der Gutsbesitzer Jachmann nach Kobulten, bleibt aber in engem
Kontakt mit radikalen Gruppen, auch whrend der Revolution von 1848. 1862 ist er
Redakteur des >Neuen Elbinger Anzeigers<, dann ab 1873 wieder Gutsbesitzer und bis
1879 Abgeordneter fr Ortelsburg-Sensburg. Seit 1879 lebt er als Rentier in Knigsberg.
(Jachmann ist in der NDB und ADB nicht bercksichtigt.)
120Eduard Flottwell (1811-1862), ltester Sohn des Oberprsidenten der Provinz Sachsen
E. H. Flottwell, studiert Jura in Knigsberg. Er ist Mitglied im Jacoby-Kreis. 1841 geht
er wegen seines Assessorexamens nach Berlin und schliet sich den Berliner Junghegelia-
nern an. Er nimmt an der Serenade fr Welcker< teil, was den besonderen Unmut des
Knigs erregt. Er wird Mitarbeiter der RhZ und steht mit Jacoby in Knigsberg in regem
Briefwechsel. 1844 wird er in Elbing zum Stadtrat und Syndikus gewhlt.
Nach der Revolution wird er 1851 vom Amt suspendiert und wegen seiner demokrati-
schen Haltung 1852 durch richterlichen Spruch seines Amtes entsetzt. Seit 1853 lebt er
als Fotografin Danzig. (E. Flottwell ist weder in der ADB noch in der NDB bercksich-
tigt.)
121 Zrich ist im Vormrz ein berragendes Zentrum der radikalen Publizistik in der Emi-
gration. Auch zahlreiche junghegelianische Schriften werden hier verlegt. Hervorzuhe-
ben ist das Literarische Comptoir Zrich und Winterthur, das Anfang der 40er Jahre
von Julius Frbel und August Folien gegrndet wird. (Vgl. W. Nf (1929);H. G. Keller
(1935); ders. (1943).
J. Frbel, ein Anhnger der Feuerbachschen Philosophie, war reger Mitarbeiter der RhZ
und besa Kontakte zu fast allen bedeutenden Radikalen seiner Zeit. A. Folien war
befreundet mit Friedrich List und verstand sich als politischer Adoptiwater Georg Her-
75
weghs. Privatdozent in Zrich ist Wilhelm Schulz, Mitarbeiter der RhZ und Freund Her-
weghs. Schulz' wichtige Rolle fr die Kontinuitt in den vormrzlichen Oppositionspha-
sen i st dargel egt von W. Grab ( 1979) . Zu den Schwei zer Gr uppenzusammenhngen
si ehe ebd. S. 177-210.
Eine bersicht ber die radikale Publizistik in der Schweiz gibt K. Koszyk (1966) S. 80-
86. Zur Ent wi ckl ung der Emi gr ant enkul t ur i n der Schwei z vgl . E. Schraepl er (1962);
W. Schieder (1963); A. Gerlach (1975); H. J. Ruckhberle (1983).
122 In Paris halten sich in den 40er Jahren als Besucher oder Emigranten u. a. zeitweise auf:
M. Bakunin, A. Cieszkowski, K. Grn, G. Herwegh, M. He, K. Marx, A. Ruge. Wich-
tige Vermittler zwischen franzsischen Sozialisten und Junghegelianern sind neben He
(vgl . S. 270 ff. di eser Arbei t ) Jakob Venedey, Herausgeber des Gecht et en i n Pari s
und Mitarbeiter der RhZ, Lorenz von Stein, der 1840 mit einem Stipendium der preui-
schen Regierung den franzsischen Sozialismus studiert und gleichzeitig fr die RhZ kor-
respondiert, und Alexander Weill, der an franzsischen wie deutschen Zeitungen mitar-
beitet, Kontakte zu Pariser kommunistischen Vereinen hat, sich 1843 den Berliner Jung-
hegel i aner n anschl i et , 1844 zur Gruppe um Her wegh, Mar x und Ruge ber schwenkt
und ein Jahr spter die freireligise Bewegung der Deutschkathol iken unt erst tzt.
Zur Kont i nui t t der deut schen Tei l nehmer an den Pari ser i nt el l ekt uel l en Zi rkel n vgl .
A. Kaltenthaler (1960); fr die frhe Arbeiterbewegung: W. Schieder (1963). Zum Ver-
hltnis von Junghegelianern zu franzsischen Sozialisten in Paris vgl. C. Rihs (1978).
123 Brssel entwickelt sich nach Zrich und Paris zu einem wichtigen Zentrum. Whrend in
Paris den deutschen Intellektuellen die Verbindung mit den franzsischen Sozialisten
milingt, entwickelt sich zwischen Zrich und Brssel insbesondere nach dem Scheitern
der >Deutsch-franzsischen Jahrbcher< eine auch politische Konkurrenz. Whrend fr
Zrich A. Rge die integrierende Gestalt wird, bildet sich in Brssel um K. Marx ein
politisches Zentrum. (Vgl. Sh. Na'aman (1982) S. 169 f.; A. Cornu (1968) Bd. 3, S. 14-
16,149-155; H. v. d. Dunk (1966)
124 Georg Herwegh (1817-1875) stammt aus einer wrttembergischen Gastwirt- und Hof-
bedienstetenfamilie. 1835 wird er in das Tbinger Stift aufgenommen, das er wegen Auf-
lehnung gegen die Stiftsordnung bald verlassen mu. Er wechselt vom Theologie- zum
Jurastudium ber und bricht 1837 das Studium ab, um freier Schriftsteller zu werden.
Dem strafweisen Einzug zum Miltrdienst entzieht sich Herwegh 1839 durch die Flucht
in die Schweiz. Hier lernt er ber G. A. Wirth, J. Frbel und A. Folien die oppositionel-
len Emigrantengruppen kennen. 1841 und 1842 ist Herwegh in Paris. Aufgrund seines
literarischen Erfolges (Gedichte eines Lebendigen, 1841) unternimmt er 1842 eine
Triumphreise durch Deutschland, die insbesondere von der RhZ publizistisch beglei-
tet wird. Herwegh schliet u. a. Kontakte zu Prutz, Ruge, Bakunin und der Klner Jung-
hegelianergruppe. (Zu Herweghs Reise 1842 und den Ereignissen, die zu seiner Auswei-
sung aus Preuen fhren vgl. S. 219 ff. dieser Arbeit) 1843 gibt Herwegh die Einund-
zwanzig Bogen aus der Schweiz< heraus, seit 1843 lebt er in Paris in engem Kontakt zu
Heine, Ruge und Marx.
Mit Ausbruch der Februarrevolution 1848 wird er Prsident der Pariser Deutschen
Legion, die den Versuch unternimmt, die badischen Revolutionstruppen militrisch zu
untersttzen. Die Legion wird Ende April 1848 geschlagen. Herwegh und seine Frau,
die engagierte Revolutionrin Emma Herwegh, fliehen in die Schweiz. Herwegh gert in
wirtschaftliche Notlagen und schreibt fr Schweizer Journale. Unter dem Einflu Las-
salles schliet er sich dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein an und wird dessen
Bevollmchtigter fr die Schweiz. 1865 trennt er sich von den Lassalleanern und nhert
sich Marx und Engels an. 1866 wird er Ehrenkorrespondent der I. Internationale. Seit
dem Eisenacher Vereinigungsparteitag untersttzt er den revolutionren Flgel der
SDAP. Die letzten Jahre seines Lebens verbringt Herwegh in Baden-Baden unter sehr
76
rmlichen Lebensumstnden. (ADB Bd. 12; NDBBd. 8; F. Mehring (1961 b); B. Kaiser
( 1948) ; W. Bt t ner ( 1967)
125Jakob Venedey (18051871) stammt aus ei ner Klner Juristenfami lie. Sein Vat er war
ber zeugt er Jakobi ner . Venedey st udi er t 1825- 27 Jur a i n Bonn und Hei del ber g und
wi r d Recht sanwal t . 1832 ver l i er t er durch ei ne Schri f t gegen di e Schwur ger i cht e di e
Chance auf ei ne Anstell ung im preuischen Staat und wird Mitarbeiter am Mannheimer
>Wcht er am Rhei n<. Er i st Tei l nehmer am Hambacher Fest und wi rd verhaft et . Sei n
zweiter Fluchtversuch gelingt, Venedey geht ber Straburg nach Paris, wo er sich nie-
der l t . 1833 st eht er dem aus dem Deut schen Vol ksver ei n hervor gehenden Bund
der Gecht et en vor. 1835 wi rd er aus Pari s ausgewi esen, und der Bund ent wi ckel t
unt er dem Gt t i nger Pr i vat dozent en Theodor Schust er ei ne zunehmend kommuni st i -
sche Pr ogr ammat i k. Nach Auf ent hal t en i n Mont pel l i er und Le Havr e kann Venedey
nach Pari s zurckkehren. Er hat u. a. Kont akt zu Ruge, fr dessen Jahrbcher er unt er
dem Pseudonym Heinrich Marc schreibt. Er entwickelt sich in den 40er Jahren zu einem
ar gwhni s chen Kr i t i ker der Li nken, besonder s wenn di es e gegen sei ne Lehr e vom
gesetzl ichen Widerstand verstie.
I n der Revol ut i on von 1848 wi r d er i n den Fnfzi ger- Ausschu des Vor parl ament s
gewhlt. Er gehrt zu den Begrndern der Fraktion Westendhall, die einen Ausgleich
zwischen Liberalen und Demokraten anstrebt. 1850 berni mmt er die Statthalterschaft
von Schleswig-Holstein. Pol itisch gert Venedey in der nachmrzlichen Zeit zwischen
alle Fronten. 1852 zieht er nach Bonn, 1853 nach Zrich, wo er sich im Fach Geschichte
habilitiert. 1855 lebt er in Heidelberg beim Chemiker Moleschott, schlielich erwirbt er
1858 ein al tes Bauernhaus in Oberwei ler, das seine Frau al s Pension fhrt. Er schreibt
ber Franklin, Washington, Stein. Kurz vor seinem Tod wird ihm ein Reichstagsmandat
in Aussicht gestellt, das er nicht mehr erwerben kann. (ADB Bd. 39; W. Kppen(1921);
H. Venedey (1927)
126Dieser Gruppenkern wird besonders seit 1844/45 erkennbar. Vgl. die Gruppendifferen-
zi erung, di e R. Got t schal l i n sei nen Memoi r en vorni mmt . Er nennt auf der ei nen Sei t e
E. Meyen und A. Rutenberg, die er von der Gruppe um B. Bauer (den Freien) unterschei-
det (R. v. Gottschall, Aus meiner Jugend S. 169). Eine hnliche Differenzierung nimmt
auch Friedrich Sa vor. Er unterscheidet zwischen einem philosophischen Radikalismus
(B. Bauer, E. Bauer und L. Buhl) und einem radikalen Liberalismus. Zu dieser Partei
zhlt er Rutenberg, Zabel, Nauwerck, Mgge und Volkmar. Er bezieht sich dabei auf die
geschei t er t en Zei t ungspr oj ekt e von K. Nauwer ck, Monat sschr i f t f r Pol i t i k, Ber l i n
1846; T. Mgge, F. Zabel, Monatsschrift fr Volksbindung, Berlin 1846; A. Rutenberg,
Monatsschrift fr Volkswirtschaft und soziales Leben, Berlin 1846. (F. Sa, Berlin, 1846,
S. 163) A. Cornu rechnet zu dieser Gruppe auch noch L. Buhl, G. Julius und K. F. Kop-
pen (A. Cornu (1968) Bd. 3, S. 28 f . ). I. Pepperl e (1978) S. 104 gruppi ert ber Berl i n
hinausgehend R. Prutz, K. Nauwerck, G. Juli us und A. Rge als die Gruppe, die weder
B. Bauer noch Marx und Engels zu folgen bereit ist. Die Zuordnung von Buhl, Julius und
K. F. Koppen zu di esem Gruppenkern halt e i ch fr zweifelhaft.
127Dieser Gruppenkern versammelt sich 1844 um L. Buhls >Berliner Monatsschrift, die
sich einerseits programmatisch gegen Rugesche und Nauwercksche Positionen wendet,
andererseits gegenber der Gruppe um B. Bauer Distanz hlt. Diese fraktionelle >Mittel-
lage< zeigt sich auch in anderen Schriften dieser Junghegelianer. Buhl vertritt eine Kritik
der Politik, die nicht ins Konzept der politischen Radikalen pat, und ebenso wendet er
sich gegen die Einsamkeit der Bauerschen Kritik. Dies verbindet ihn mit Stirner, der
versucht, eine Position zwischen Feuerbach und Bauer zu entfalten. E. Bauer und
K. F. Koppen mssen auch diesem Gruppenkern zugeordnet werden, obwohl sie in der
B. Bauerschen ALZ und den NB ihre Beitrge publizieren. E. Meyens Positionen dage-
gen liegen teilweise auch sehr nahe bei Ruge/Nauwerckschen Auffassungen.
77
128 Ernst Jungni t z ( 1818- 1848) st t nach 1842 zu den Berl i ner Junghegel i aner n und
schliet sich der Gruppe um B. Bauer an. Er ist eifriger Mitarbeiter der ALZ. Seit 1843
publiziert Jungnitz zahlreiche Arbeiten ber die Franzsische Revolution: Religion und
Kirche in Frankreich bis zur Auflsung der Konstituierenden Versammlung, 1843; Reli-
gion und Kirche in Frankreich seit der Auflsung der Konstituierenden Versamml ung
bis zum Sturz Robespierres, 2. Bde., 1844. Zum Teil werden seine Arbeiten in die von
den Brdern Bauer herausgegebenen Denkwr di gkei t en zur Geschi cht e der neueren
Zeit seit der Franzsischen Revolution, 1843/44< aufgenommen. Die Vorgeschichte der
Revolution behandelt Jungnitz in: Geschicht e der franzsi schen Revoluti on von 1787
und 1788, 2 Theile, 1846. Hervorzuheben ist darber hinaus: Geschichte des religisen
Lebens, 1845.1848 stirbt Jungnitz im Alter von 30 Jahren. (Inder ADB ist Jungnitz nicht
bercksichtigt. )
129 Julius Faucher 1820-1878) st ammt aus ei ner Berl i ner hugenot t i schen Hut macherfami -
lie. Er studiert in Berlin Philosophie. Nach 1842 stt er zu den Berliner Junghegelianern
und wird 1844 Mitarbeiter der ALZ. 1846 grndet er mit J. Prince-Smith u. a. den ersten
deutschen Freihandelsverein.
An den Mrzkmpfen der Revolution von 1848 nimmt er lebhaften Anteil. 1850 ist er
Mitbegrnder und Redakteur der anarchistisch-freihndlerischen >Abendpost<. 1850-
1861 emigriert er nach London, wo er seit 1856 Redakteur des >Morning Star< ist. Fau-
cher wird literarischer Sekretr von R. Cobden. 1861 kehrt er nach Deutschland zurck
und wird Mitglied des preuischen Abgeordnetenhauses (Fortschrittspartei). Mit
Th. Fontane ist er seit der Zeit des Vormrz befreundet. (NDB Bd. 5)
130 Unter dem Pseudonym Szeliga hat der preuische Offizier Franz Zychlin von Zychlinski
(1816-1900) an der ALZ und den NB mitgearbeitet. Bei den Berliner Junghegelianern
hlt er sich frhestens seit November 1842 auf. Seine letzte junghegelianische Schrift
stammt aus dem Jahre 1846: Die Universalreform und der Egoismus. Aus seiner vor-
mrzlichen Zeit stammt seine Freundschaft zu Th. Fontane. Zychlinski macht bei der
preuischen Armee Karriere. Er verffentlicht militrgeschichtliche Arbeiten:
Geschichte des 24. Infanterieregiments. 2 Bde. (1854-1857); Anteil des 2. Magdeburgi-
schen Infanterieregiments an dem Gefecht bei Mnchengrtz und an der Schlacht von
Kniggrtz (1866). Zuletzt ist Zychlinski Kommandeur der 15. Infanteriedivision in
Kln. (In der ADB ist Zychlinski nicht bercksichtigt.)
131 Karl Schmidt (18191864) stammt aus einer anhaltischen Bauernfamilie. 1841 studierter
in Halle Theologie, 1843 wird er unter dem Einflu von Erdmann und Schaller Hegelia-
ner. 1844 geht er nach Berlin. Er vollzieht in kurzer Zeit, ausgehend von althegeliani-
schen Positionen, den bergang zu D. F. Strau, zu Feuerbach, zu B. Bauer, zu Marx
und zu Stirner nach, um sich 1846 selbst als Spitze der junghegelianischen Theorie zu
prsentieren. Gleichzeitig vollzieht er einen dramatischen Bruch mit den Junghegelia-
nern und wird Pfarradjunkt in Ederitz.
Nach der Revolution von 1848 scheidet er aus dem Pfarrdienst aus und wird Lehrer in
Kthen. K. Schmidt wird als anthropologischer Pdagoge durch zahlreiche Werke
zur pdagogischen Theorie und Geschichte bekannt. (ADB Bd. 31; Paul Wtzel (1949)
132ber die Kthener >Kellergesellschaft< informiert P. Wtzel (1949) S. 66 ff.
133Gustav Julius (18101851) studiert Theologie und wird Anhnger der neupietistischen
Orthodoxie. Wie B. Bauer entwickelt er sich vom Theologen zum Kritiker der Religion.
1842/43 ist er fr kurze Zeit Chefredakteur der >Leipziger Allgemeinen Zeitung<, die
sich unter seiner Leitung rasch radikalisiert. 1843/44 wird er >Bauerianer<, um seit 1845
zu einer Kritik der Bauerschen Richtung berzugehen, die er mit einer Kritik an Marx'
und Engels' Heilige Familie verbindet. 1846-1849 gibt er die >Berliner Zeitungs-
Halle< heraus.
In der Revolution von 1848 steht Julius auf der Seite der Linken und emigriert nach der
78
Niederlage nach London. In der Emigrantenszene versucht er, eine unabhngige Posi-
tion zu wahren. 1851 kommt es zu einer theoretischen und praktischen Annherung zwi-
schen Julius und Marx und Engels. (In der ADB und NDB ist Julius nicht bercksich-
tigt.)
Zur Leipziger Dependance der >Kellergesellschaft< vgl. J. Schmidt, Geschichte der
Deutschen Literatur, 1855, Bd. 3, S. 429.
134 In dieser Arbeit wird auf Aspekte der Hegelschen Philosophie nur insoweit eingegan-
gen, als von ihnen her Bewegungsformen und Problemzonen der junghegelianischen
Debatten sich erhellen lassen. Die Frage, ob und wie die junghegelianischen Hegelinter-
pretationen heute Hegel gerecht werden, wird ausgeklammert. Ein Beitrag zu Hegel ist
diese Arbeit allenfalls unter einem spezifischen Blickwinkel, nmlich unter dem Blick auf
die >Kollektivierbarkeit< von Grundzgen seines Denkens. Dieser Blick ist >ungerecht<,
weil er eine ganz andere Frage an die Philosophie stellt als diese sich selbst. Fr die Koh-
renz der Hegelschen Philosophie ist es eine periphere Frage, welche Elemente in einem
sozialen Sinne >Schule machen< und vor allem machen knnen und mit welchen Elemen-
ten keine Schule zu machen ist. Es macht einen Unterschied, ob einer Geschichtsphi-
losophie treibt oder ob sich mehrere um eine Geschichtsphilosophie vereinen; ob die
philosophische Polemik von einem Philosophen oder einer Gruppe im Namen eines
Philosophen gemacht wird; ob die philosophische Gewiheit bei >mir< oder ob sie bei
>uns< ist. In diesen Unterschieden liegt der Grund fr die spezifisch soziologische Frage.
- Zugnge zur Hegelschen Philosophie haben mir die Arbeiten von Lukcs, Kojve,
Marcuse und Adorno ebenso vermittelt wie Arbeiten von Ritter, Marquard, Sa, Riedel,
Henrich, Theunissen und Bubner. Viel gelernt habe ich in den Diskussionen mit Kosmas
Psychopedis.
133 Zur Hegelschen Schule vgl. S. 54 ff. angegebene Literatur. Hegelschule nenne ich den
Gesamtkomplex der Schler mit den verschiedenen Aufspaltungen und Fraktionierun-
gen. Hegelianisch bezieht sich auf die Hegelschule, hegelsch auf Hegel selbst. Die
Begriffe Althegelianer, Junghegelianer, Rechtshegelianer und Linkshegelianer
werden weiter unten S. 137 ff. diskutiert.
136 Zum Begriff der ideologischen Gruppe vgl. A. Schweitzer (1944) S. 415, C. Mongar-
dini (1979) sowie weiterfhrend P. C. Ludz (1976) S. 89 ff. Der Begriff ideologische
Gruppe trifft das Phnomen der junghegelianischen Gruppenbildung nicht, weil er
bereits eine politische und theoretische Zuspitzung enthlt, die weit vorgreift. Der
Gedanke, da Ideen als Ideologien definiert werden knnen, entsteht zwar bei den Jung-
hegelianern, aber er entsteht in einer spezifischen Diskussionslage. Selbst ihre Gegner
haben die Junghegelianer nicht als Ideologen gesehen, sondern als Vertreter von
Prinzipien, mit denen ein geistiger Kampf auszutragen ist. Die von Stirner erzwun-
gene Marxsche Einfhrung des Ideologiebegriffs steht systematisch am Ende des Jung-
hegelianismus, sie hat die Funktion, die Debatte zu beenden, den Prinzipienkmpfen
einen Status zuzuweisen, der via argumenti sinique nicht mehr zu verndern ist. (Vgl.
dazu W. Ebach (1982) S. 63 ff.)
Prziser als der Begriff der ideologischen Gruppe trifft F. W. Grafs der theologischen
Diskussion entnommener Begriff der Positionalitt und der Positionenkonkurrenz.
Eine Position entsteht durch Selbstunterscheidung von geltenden Positionen, sie tritt
damit in eine Konkurrenz, in der sie ihre Eigentmlichkeit behaupten mu. Die Rede
von Ideologie wre das Todesurteil fr Positionalitt, weil ihr die Kraft der
Selbstunterscheidung abgesprochen wird. (vgl. F.W.Graf (1982 a) S. 44 ff.; ders.
(1978 a)S. 383 ff.)
137 Die soziologische und sozialpsychologische Literatur zum Thema Gruppe ist unber-
sehbar. Einige wenige Arbeiten seien hervorgehoben.
Zu einer Universalisierung des Gruppenbegriffs neigt der einflureiche Ansatz von
79
G. C. Homans (1965).Im Gegenzug mu hingewiesen werden auf G. Lapassade(1972);
Lapassade insistiert auf dem Phnomen der Brokratisierung von Gruppen. Stark theo-
riegeschichtlich systematisierend ist der Ansatz von Th. M. Mills (
4
1973).
Aus dem deut schsprachigen Bereich seien genannt : D. Ciaessens (1977); F. Nei dhardt
(1979). Analysen zu Gruppenstrukturen in politisch motivierten Studentengruppen fin-
den sich bei L. Binger (1974). Vor einer berschtzung der Leistungsfhigkeit kleiner
Gr uppe n und e i ne r be r hhung von Gr uppe n i m t he or e t i s c he n Be r e i c h wa r nt
H. P. Bahrdt (1980). B. Schfers (1980) biet et ei nen einfhrenden berbl i ck. Zum
Stand der Diskussion siehe F. Neidhardt (1983).
138 Forschungen zu Intellektuellengruppen, bei denen ein besonderer Aspekt auf die Grup-
penbildung gelegt wird, sind noch immer sprlich. Von lteren Arbeiten sind neben viel-
fltigen Hinweisen bei G. Simmel theoretisch anregend immer noch: K. Mannheim, Die
Bedeutung der Konkurrenz auf dem Gebiete des Geistigen, in: ders. (1964) S. 566-613;
S. Kracauer (1963). Die frhen Arbeiten von H. Rosenberg stellen Anstze fr eine gei-
stige Gruppengeschichte dar. (H. Rosenberg (1972) S. 10)
Die erkenntni stheoretischen Zuspitzungen im Streit um die Wissenssoziologie mgen
mit dazu beigetragen haben, da eine Weiterentwicklung der wissenssoziologischen Dis-
kussion in Richtung auf eine Analyse von Intel lektuel lengruppen gebremst wurde.
Hi l f r e i c h s i nd i n di es em Zus ammenhang i mmer noch di e f r hen Ar bei t en von
C. W. Mills, in denen z. B. die Auffassung, das Publikum eines Theoretikers bestehe in
der zeitlosen Schar derjenigen, die die Wahrheit suchen, zurckgewiesen wird. Mills
versucht den Begriff des Publikums in Richtung auf Gruppenzusammenhnge zu przi-
sieren. Es handelt sich dabei u. a. um Personen, die so denken, da die Bedingungen
eines bestimmten Denkmodells erfllt werden, dessen Formen ihnen mehr oder weniger
bewut si nd und dem sie sich anzupassen t rachten. Das i st es, was die >die Wahrhei t
suchen< bedeutet. ( . . . ) Die bloe Existenz einer solchen Gruppe ist bereits soziologisch
bedeut sam. Der Ursprung und di e Fol gen sol cher Gruppen i n den verschi edenen
Zus a mme nh nge n habe n bi s he r we ni g a us dr c kl i c he Bea c ht ung ge f unde n.
( C. W. Mi l l s ( 1964) S. 290) Ri c ha r d Gr a t hof f ve r da nke i c h de n Hi nwe i s , da
C. W. Mills in seiner Dissertation (1943) ausgehend von der pragmatistischen Intellek-
tuellengruppe um Peirce und James die Frage nach der Sozialitt eines Intellektuellenmi-
lieus aufwirft.
Von neueren Arbeiten sind neben den Arbeiten von P. C. Ludz (1976) die Bemhungen
hervorzuheben, die seit einigen Jahren vermehrt im Bereich der Erforschung der Frei-
maurer und geheimen Gesellschaften stattfinden (vgl. hierzu: Anm. 68). Im literaturwis-
senschaftlichen Bereich sind zahlreiche Arbeiten ber spezielle Dichter und Schriftstel-
lergruppen zu finden. bergreifende Fragestellungen entwickeln: H. Kreuzer (1968);
F. Krn (1976); F. Krll (1978)
Zum Stand soziologischer Analyse von historischen Intellektuellengruppen siehe insbe-
s onde r e d i e Be i t r ge von K. W. Ba c k, D. Pol i s a r , Sa l ons und Ka f f e e h us e r ;
H. P. Thurn, Di e Sozi ali t t der Sol i t ren, Gruppen und Netzwerke i n der Bi l denden
Kunst; F. Krll, Gruppenzerfall. Versuch ber die Gruppe 47, in: F. Neidhardt (1983).
139 Zum folgenden vgl. J. P. Sartre (1967) hier bes. S. 271 und 371. Auf Sartres Gruppen-
theorie hat mich Konrad Thomas aufmerksam gemacht.
140 Ebd. S. 375,292,307.
141 Ebd. S. 373,271.
142 Ich fhle meine Ohnmacht im Anderen, weil ja der Andere als Anderer entscheidet, ob
meine Tat eine verrckte Einzelinitiative bleibt oder mich in die abstrakte Isolierung
zurckwirft oder die gemeinsame Tat einer Gruppe wird. So wartet jeder auf die Tatdes
Anderen, und jeder macht sich zur Ohnmacht des Anderen, insofern der Andere seine
Ohnmacht ist. Ebd. S. 295.
80
143 Ebd. S. 399,403.
144D. Ciaessens (1967) S. V, 59 ff.
145Ebd. S. 10.
146H. Blumer (1973) S. 81 ff.
147Zur erkenntnistheoretischen Problematik vgl. K. O. Apel (1972).
148G. Mayer (1913) S. 95.
149 Sh. Na'aman (1982) S. 133. H. Hirsch (1955) spricht pointiert von einer junghegel-
sche(n) Arbeitsgemeinschaft, die das System einer objektiven Begriffsgeschichte an sich
zu verwirklichen suchte, indem sie auf individuelle Schreibweise verzichtete. (S. 46)
150Ich bediene mich bei der Zusammenstellung von sophistischen Problem< und leerem
Gerede< bewut einer konventionellen antisophistischen Redeweise. Sie wird den histo-
rischen griechischen Sophisten keineswegs gerecht. Es ist legitim, in den Sophisten die
Initiatoren des Konzepts einer intellektuellen ffentlichkeit zu sehen und sie an den
Beginn der Wissenschaft zu setzen, weil sie mit den verschiedensten Geheimformen der
Wissensproduktion und -Vermittlung brachen und als mobile Wanderlehrer rationales
Denken und Argumentieren jedermann zugnglich machten, (vgl. F. H. Tenbruck
(1967) S. 63 ff.) In dieser Perspektive wren die Sophisten ein hervorragendes Beispiel
fr den interaktionistischen Zugang zur Analyse von Diskussion. Aber auch die konven-
tionelle antisophistische Redeweise hat einen sozialen Sinn, denn mit dem ffentlichen
Ereignis von Diskussion sind auch die Phnomene der Kontingenz von Debatten, ihrer
Verselbstndigung, der Labilitt ihrer Verbindlichkeit und der mglichen >Leere< des
Gesagten gegeben. Auf diese Phnomene bezieht sich meine Rede vom sophistischen
Probleme
151Platon, Menon (1957) S. 21, 80 d.
132 A. Schtz (1981) S. 115 ff. Das Um-zu-Motiv orientiert sich am Zukunftsentwurf
einer Handlung, das Weil-Motiv kann erst nach Ablauf eines motivierten Erlebens
gesehen werden. Erst auf einer zweiten Ebene knnte sophistische Rede vom Motiv her
eingefangen werden: etwas zu sagen, um berhaupt zu reden, kann zwar Motiv sein, aber
in diesem Motiv verlieren sich die kommunikativ vorausgesetzten Erwartungen an Spra-
che.
153H. G. Gadamer (1965) S. 328.
154M. Foucault (1977) S. 7. Vgl. dazu auch W. Ebach (1985 b).
155Ebd. S. 25.
156Vgl. K. Fischer, Moderne Sophisten, Die Epigonen 5 (1848), S. 277-316. BeiK. Fischer
heit es: Die Philosophie hat in der Sophistik ihren hchsten Feind, ihr eigenes diaboli-
sches Prinzip zu bekmpfen, einen Feind, der mit ihr auf gleichem Niveau steht, indem
er die Waffen des Denkens gegen das Denken selbst kehrt, einen Feind, der mit der Auf-
lsung der theoretischen Wahrheit zugleich die sittliche Praxis fundamental angreift;
erst in der berwindung dieses Feindes gewinnt die Philosophie ihre volle Konkretion
und die Sicherheit der philosophischen Praxis. (Ebd. S. 277 f.) Im Anschlu an Hegel
behandelt K. Fischer: Strau, B. Bauer, Feuerbach und insbesondere Stirner und
K. Schmidt. Eine Formulierung fr den junghegelianischen Sophismus, die das Empfin-
den vieler Zeitgenossen gut ausdrckt, hat G. G. Gervinus gefunden: er spricht von
herzloser Spekulation. (G. G. Gervinus, Die Mission der Deutschkatholiken,
1845.S. 47).
157Im Werk von J. Habermas hat dieses Ideal eine fundierte Gestaltung erfahren. Hetero-
log zur Idee der herrschaftsfreien Kommunikation stehen die berlegungen von
M. Foucault (1977): Man mu wohl auch einer Denktradition entsagen, die von der
Vorstellung geleitet ist, da es Wissen nur dort geben kann, wo die Machtverhltnisse
suspendiert sind, da das Wissen sich nur auerhalb der Befehle, Anforderungen, Inter-
essen der Macht entfalten kann. Vielleicht mu man dem Glauben entsagen, da die
81
Macht wahnsinnig macht und da man nur unter Verzicht auf Macht ein Wissender wer-
den kann. Eher ist wohl anzunehmen, da die Macht Wissen hervorbringt (und nicht
blo frdert, anwendet, ausnutzt); da Macht und Wissen einander unmittelbar ein-
schlieen; da es keine Machtbeziehung gibt, ohne da sich ein entsprechendes Wis-
sensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehungen voraus-
setzt und konstituiert. (S. 39)
158G. Bataille (1975) S. 308.
159S.Kracauer (1971c) S 187.
160Ebd. S. 187,198 f.
161H. Lbbe und H. M. Sa (1975) S. 146. ber Zusammenhnge zwischen Junghegelia-
nismus und Frankfurter Schule finden sich Hinweise bei R. Bubner(1971 a)S. 160-209.
162Aus der Literatur ber Marx und Engels mchte ich nur einige wenige Arbeiten anfh-
ren, die im Zusammenhang dieser Arbeit von Bedeutung sind. Unverzichtbar, weil in
hohem Mae traditionsbildend, sind die beiden klassischen Biographien: F. Mehring
(1960); G.Mayer (1975).
Fr die junghegelianische Phase von Marx und Engels grundlegend ist A. Cornu (1954-
1968). Von lteren Arbeiten ist noch heute lesenswert H. Speier (1952) S. 142-177;
S. Hook (1936). Eine wichtige bibliographische Zusammenstellung der Rezeption der
Werke von Marx und Engels in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts bietet B. Andreas
(1964/65) S. 353-526.
Angesichts der unbersehbar gewordenen Literatur zum >jungen Marx<, die seit der Pio-
nierstudie: H. Popitz (1967) erschienen ist, beschrnke ich mich auf exemplarische Hin-
weise. Weitgehend orthodox wird Marx im Kontext des Junghegelianismus dargestellt
bei G. Armanski (1974); N. Lapin (1974). Aus den junghegelianischen Gruppendebat-
ten gehen Marx und Engels in dieser Literatur regelmig als Sieger hervor. Es hat sich
auch eine Art Skala der Wertung einzelner Junghegelianer herausgebildet: Feuerbachs
philosophische Leistung, He' sozialistische Orientierung, Ruges Organisationstalent
stehen in der Wertung oben an. Ihre Beitrge werden bis zu dem Zeitpunkt verfolgt, an
dem Marx und Engels sich von ihnen trennen. Die Brder Bauer und Stirner bilden die
Schlulichter der Wertungsskala. Ihre Auffassungen sind oft bis zur Karikatur verzerrt
dargestellt. Junghegelianer, denen nicht das zweifelhafte Glck widerfuhr, Opfer der
Marx-Engelsschen Polemik zu werden, sind in weiten Bereichen der Literatur ber-
haupt in Vergessenheit geraten. Insgesamt mu festgestellt werden, da die starke Kon-
zentration des Forschungsinteresses auf die Marxsche Entwicklung und die Entwick-
lung der frhen Arbeiterbewegung, so verstndlich dies angesichts der weltgeschichtli-
chen Bedeutung des Marxismus auch ist, den Junghegelianismus sowohl immer wieder
mitthematisiert wie andererseits auch berschattet hat.
Literatur zu speziellen Aspekten der junghegelianischen Phase von Marx und Engels ist
im Literaturverzeichnis aufgefhrt. An dieser Stelle sei auf Arbeiten hingewiesen, in
denen der junghegelianische Kontext der Entwicklung des jungen Marx besonders her-
ausgearbeitet wird: N. Lobkowicz (1967) untersucht aus antimarxistischer Perspektive
die Genese der Idee der revolutionren Praxis bei Marx und behandelt dabei auch aus-
fhrlicher die Auseinandersetzung der Hegel-Schule in den 30er und 40er Jahren (bes.
Ebd. S. 141-292). Whrend Lobkowicz bestrebt ist, die Ursprnge stalinistischer Poli-
tik beim Junghegelianer Marx nachzuweisen, bemht sich A. Wildermuth (1970), den
junghegelianischen Kontext des jungen Marx fr die heutige gesellschaftstheoretische
Diskussion zu aktualisieren. Wildermuths These, da es bei Marx darum geht, die
Hegelsche Geistdialektik als einen universellen menschlich-gesellschaftlichen Kommu-
nikationsproze aufzuschlsseln (Ebd. S. 420 ff.), wird kenntnisreich und subtil entfal-
tet, und dabei werden zugleich die Leistungen der anderen Junghegelianer gewrdigt. In
diesem Zusammenhang mu auch auf die kleine przise Arbeit von R. Bubner (1971 b)
82
hingewiesen werden, die das Theorie-Praxis-Problem ausgehend von den junghegeliani-
schen Debatten errtert. Vgl. in diesem Zusammenhang auch: S. Kratz (1979).
Ohne Bezug auf die Junghegelianer, aber im Zusammenhang dieser Arbeit zu nennen,
ist T. Meyer (1973). Meyer konzentriert sich auf zwei Marxsche Probleme, die fr die
Spaltung der Junghegelianer von besonderer Bedeutung sind: 1. das Konzept der Ideo-
logie und 2. die Rolle des Proletariats. - Einen interessanten psychoanalytischen und
familiensoziologischen Ansatz hat M. Schneider (1980) verfolgt.
163 Exemplarisch seien hier berlegungen von E. Bottigelli (1963) genannt. Bottigelli fragt:
Liegt der point de dpart des Marxschen Denkens im Junghegelianismus, oder hat es
seine entscheidende theoretische Kontur vor der Konstituierung der Junghegelianer
gewonnen? (Ebd. S. 10) Welcher Junghegelianer hat Marx mageblich beeinflut, und
wie ist l'originalit de la pense de Marx<' festzustellen? (Ebd. S. 12) Schlielich heit
es: Si l'volution et la radicalisation de l'idologie jeune hglienne est une partie int-
grante de l'itineraire intellectuel de Marx, le problme essentiel reste de dterminer de
faon prcise les conditions dans lesquelles il a opr le dpassement de cette idologie.
A quel moment la dmarche de Marx est-elle devenue radicalement diffrente? (Ebd.)
Bei der Verflechtung der junghegelianischen Diskussion sind diese Fragen nur gewalt-
sam zu lsen.
164 Karl Korsch (1971) S. 167-172.
165 Zu Bakunin vgl. die Arbeiten von M. Nettlau (1901); ders. (1927). Aus der Flle der
Sekundrliteratur sei aufgefhrt: E. H. Carr (1937); B.-P. Hepner (1950); P. Schreibert
(1956); R. R. Bigler (1963); Institut d'Etudes Slaves (Hg), Bakounine (1979).
ber Bakunins Rolle im Jungehelianismus ist wenig berliefert. Er war mit Ruge und
Herwegh gut bekannt. Vgl.: A. Ruge, Erinnerungen an Michael Bakunin, Neue freie
Presse, Wien 28/29. 9. 1876 und M. Herwegh, Georg Herweghs Briefwechsel mit sei-
ner Braut, 1906. Zum Junghegelianismus Bakunins vgl. auch: D. Tschizewskij (1961)
und M. Wolff (1970) S. 151-182.
166 Aus der lteren He-Forschung ist zu erinnern an die Pionierarbeit von T. Zlocisti
(1921). Grundlegend fr die Auseinandersetzung mit Moses He sind die Arbeiten von
E. Silberner. Im Kontext dieser Arbeit sind hervorzuheben: E. Silberner (1963) S. 387-
437; ders. (1964) S. 5-44; ders. (1966).
In den Arbeiten von W. Mnke wird insbesondere die Rolle von He fr die Herausbil-
dung des Marxismus herausgearbeitet. W. Mnke (1963) S. 438-509; (1964). Von neue-
ren Untersuchungen zur He-Interpretation sind zu nennen: H. Hirsch (1975); H. La-
demacher (1977); S. Na'aman (1982). Insbesondere die aus post-marxistischer Perspek-
tive geschriebene umfangreiche und erhellende Biographie von Na'aman verweist auf
die bis heute nachwirkende Aktualitt von Moses He, dessen Gebeine 1962 am
150. Geburtstag nach Israel berfhrt wurden. Na'aman weist auf den gegenwrtigen
politischen Kontext hin, in dem gerade die Nationalittstheorie Moses He' neu zu
reflektieren wre.
167 Die Erforschung des vielfltigen Spektrums des Frhsozialismus, der in den Jahren
1842-1846 von den Junghegelianern rezipiert wird, ist inzwischen zu einer Spezialdiszi-
plin angewachsen. Vgl. hierzu D. Dowe (1981). Statt einzelne Arbeiten hervorzuheben,
sei an den Impuls erinnert, der Ende der 60er Jahre diese Forschung beflgelt hat. Es war
Herbert Marcuse, der die utopische Konzeption des Sozialismus zunchst rehabili-
tierte und dazu aufforderte, von Marx zu Fourier berzugehen. H. Marcuse (1969)
S. 41. Vgl. dazu auch M. Vester (1970/71) hier: Bd. 1, S. 223.
168 Neben dem Briefwechsel und den autobiographischen Zeugnissen (s. Literaturverzeich-
nis) ist fr die Biographie immer noch grundlegend W. Neher (1933). Eine ausfhrliche
Ruge-Bibliographie hat A. Zanardo (1969) vorgelegt, die auch smtliche Beitrger der
HJ und DJ auffhrt.
83
Auerdem sind zu nennen: F. Blaschke (1919); H. Rosenberg (1972); I. Fanto (1937);
M. G. Lange (1948); H. Strau (1954); G. Groth (1967); G. B. Vaccara (1980). Eine
ausfhrl iche Auseinandersetzung mit Rge findet in zwei neueren Arbei ten zum vor-
mrzlichen Radikalismus bzw. Junghegelianismus statt: I. Pepperle (1971), auch als:
dies. (1978); P. Wende (1975).
169ber Karl Nauwerck habe i ch kei ne Arbei t gefunden. Bi ographischeHinwei se
geben P.Wende (1975) S. 47, der sich auch mit Schriften Nauwercks
auseinandersetzt, und R. J. Hellmann (1977) S. 203-222.
170Vgl . Probl emst el l ung und Li t erat ur bei P. Wende (1975) S. 17. Zur DDR-Di skussi on i n
dieser Frage siehe: I. Bauer, A. Liepert (1982).
171Nach der Feuerbach-Renaissance in den 20er Jahren, die mit den Namen Karl Barth und
Karl Lwith verbunden ist, konzentrierte sich die Diskussion der 50er und 60er Jahre auf
das Ver hl t ni s des j ungen Marx zu Feuer bach. Exempl ar i sch sei en genannt G. Di cke
(1960) ; W. Schuffenhauer (1965).
I nzwi schen i st i nsbesonder e i n den 70er Jahren di e Li t er at ur ber Feuer bach enor m
angewachsen. Ei n Verst ndni s f r di e Kont roversen um Feuer bach gewi nnt man gut
anhand des Sammelbandes: E. Thies (1976). Im Jahrgang 26 (1972), No. 101 der Revue
internationale de Philosophie, Brssel, S. 255-423 finden sich Beitrge ber Feuerbach,
und zwar von H. -M. Sa, E. Thi es, K. Lwi t h, N. Rot enst rei ch, C. Bruai re, H. Arvon,
J. Gl asse, M. Henry und C. Cesa.
Fr die DDR-Diskussion i st zu nennen: Ludwi g Feuerbach 1804-1872, Deutsche Zeit-
schrift fr Philosophie, 20 (1972) Heft 9, mit Beitrgen, die sich in erster Linie mit dem
Feuerbach-Marx-Problem ausei nanderset zen. Si ehe hierzu auch W. Bial as, K. Richter,
M. Thom ( 1980) . Ei n br ei t er es Spekt r um wi r d abgedeckt i n H. Lbbe, H. M. Sa
( 1975) . Der Band ent hl t auch ei ne Bi bl i ogr aphi e der Feuer bach- Li t er at ur der Jahr e
1960- 1973. Hervor gehoben sei en: H. Arvon (1957); C. Ascheri ( 1969) ; A. Schmi dt
(1973); M. W. Wartofsky (1977). Von den greren lteren Arbei ten i st zu eri nnern an
S. Rawi dowi cz(1931). Von neueren Arbei t en sei genannt H. H. Br andhorst (1981) .
172Rohrmoser, in: Lbbe, Sa (1975) S. 10.
173A. Schmidt (1973) S. 30 ff. Zu Marcuse vgl. in diesem Zusammenhang bes.: H. Marcuse
(1973) S. 72 ff.
174Von den l t eren Arbei t en ber St i rner i st zu nennen J. H. Mackay (1914). Di ese bi sher
ei nzi ge St i rner- Bi ographi e i st ebenso unent behrl i ch wi e unzurei chend, da Mackay mi t
dem von i hm gesammel t en Mat eri al uerst nachl ssi g umgegangen i st . Whrend Mak-
kays Arbeit die Stirnerrezeption mageblich beeinflut hat, wurde Max Adlers noch
heute diskussionswerte Stirnerinterpretation in der Literatur kaum rezipiert. M. Adler
(1914). Hervorzuheben sind darber hinaus H. Arvon (1954); H. G. Helms (1966);
R. W. K. Paterson (1971); B. Kst (1979).
Zum Verhltnis von Stirner und Marx vgl. aus dogmatisch marxistischer Sicht G. Herz-
berg (1968); J. Maruhn (1982); sowie andererseits: A. Schaefer (1968); N. Lobkowicz
(1969); P. Thomas (1975). Meine Versuche einer Interpretation der Kontroverse zwi-
schen Marx und Stirner finden sich: W. Ebach (1982 und 1985 a). - Zu Stirner-Nietz-
sche vgl. J. Bergner (1973); zu Stirners Bedeutung fr den Existentialismus vgl. H. Ar-
von (1954). Stirners Einflu auf die moderne Sprachphilosophie erfolgte ber Fritz
Mauthner, dessen Bedeutung H. Wein (1968) hervorgehoben hat (Ebd. S. 309). Einen
Vergleich der Auffassungen Stirners und des Semantikers A. Korzybski hat M. Whitlow
(1950) vorgelegt.
175 Charakteristisch fr den Stand der Forschung zu B. Bauer ist, da immer noch eine
Gesamtausgabe seines Werkes fehlt. Kme sie zustande, so drften allein die Arbeiten
zum Neuen Testament und zum Urchristentum einen Umfang von knapp 4000 Seiten
haben. Eine ausfhrliche Bibliographie B. Bauers aus den Jahren 1837-1849 hat A. Za-
nardo (19651 vorgelegt.
84
Von der lteren Bauer-Forschung sind zu nennen: M. Kegel, G. Runze und G. A. van
den Bergh von Eysinga (vgl. Literaturverzeichnis). Kegels Arbeiten sind heute nur noch
von rezeptionsgeschichtlichem Interesse. Runze und van den Bergh van Eysinga(dessen
groe Arbeit ber B. Bauer noch nicht vollstndig verffentlicht ist) haben als Theolo-
gen in den 30er Jahren B. Bauer auf ihre Fahnen geschrieben, was nicht ohne gravie-
rende Umdeutungen zu bewerkstelligen war. Dagegen hat E. Barnikol (siehe Literatur-
verzeichnis), der sich ber 50 Jahre mit B. Bauer befat hat, versucht, die Kontinuitt
der Bauerschen Entwicklung zu ergrnden. Seine 31 in Frageform gehaltenen Thesen
zur Entwicklung B. Bauers machen eindringlich deutlich, welche Probleme auf denjeni-
gen zukommen, der sich mit diesem Autor eingehender auseinandersetzen will. (E. Bar-
nikol (1972) S. 1-5) Angesichts der kaum abzuschtzenden Herausforderung, die die
Bauerschen Schriften darstellen, erweisen sich vorschnelle, selektive Deutungen bzw.
nicht unter Kontrolle gebrachte Voreingenommenheiten als unzureichend. So z. B. bei
D. Hertz-Eichenrode (1957); C. Dannenmann (1969); L. Koch (1971).
Hervorzuheben sind aus den Arbeiten der 60er Jahre C. Cesa (1960); J. von Kempski
(1962); das Kapitel ber Bruno Bauer in H. Stuke (1963); H.-M. Sa (1967 c); ders.,
Nachwort zu: Bruno Bauer (1968). ber die Rolle Bruno Bauers in der neueren theologi-
schen Diskussion vgl. J. Mehlhausen (1965 und 1975); C. Comoth (1975); G. Lmmer-
mann (1979). Zum Verhltnis Marx - Bruno Bauer siehe J. Gebhardt (1962); Z. Rosen
(1970). Die wichtige Arbeit von Z. Rosen (1977) enthlt einen guten berblick ber die
Probleme der Bauer-Forschung (S. 716) Zur noch in den ersten Anfngen steckenden
Wirkungsgeschichte B. Bauers siehe: A. K. Jelti (1981); Z. Rosen (1982). Zu Bauers
Ruland-Schriften siehe: D. Groh (1965) S. 263-274.
176 Fr das neuere Interesse an dem Hegelschler und polnischen Grafen August
von Cieszkowski sprechen die Neuausgaben A. v. Cieszkowski (1979).
Von den lteren Arbeiten sei her vor gehoben W. Khne( 1938, Nachdr uck
1968) . ber Ci eszkowski si ehe: H. Stuke (1963) S.83-122; und A.Liebich(1979)
177A. v. Cieszkowski, Gott und Palingenesie, 1842, S. 93.
178 Zu K. Schmidt vgl. Anm. 131.
179 Vgl. H. Arvon: Es kam in der deutschen Geistesgeschichte 1849 zu einem Bruch:
einem Bruch, den man jetzt berwinden will, den man aber noch nicht berwunden hat.
Alles, was vor 1848 geschah, verschwand eben. In: Lbbe, Sa (1975) S. 150. Da die-
ser Bruch in den Formeln der 40er Jahre antizipiert wurde, zeigt E. Redslob (1940).
Redslob rechnet die 16 Jahre vor 1848 zu den betont problematischen Zwischenepo-
chen der Menschheit (Ebd. S. 271) Lwiths berhmte These vom revolutionren
Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts gehrt mit in diesen Zusammenhang. Die ambi-
valenten Phantasien von schwindelerregenden totalen Verwirklichungsmglichkeiten
und ihren selbstdestruktiven Verkehrungen gehren G. Steiner zufolge zu den Struktur-
eigentmlichkeiten des 19. Jahrhunderts. Vgl. G. Steiner (1972) S. 9-34. Die Ambiva-
lenzen, die Steiner beschreibt, kristallisieren sich in Deutschland in hohem Mae an dem
Geschehen der 1848er Revolution.
180 J. E. Erdmann (1896) S. 637 ff., S. 728 und 685.
181(R. Gottschall), Die deutsche Philosophie seit Hegel's Tod, in: Die Gegenwart. 6. Bd.,
1851, S. 292-340, Zitat S. 293. Den ersten Hinweis auf R. Gottschalls Verfasserschaft
erhielt ich bei: F. Kampe, Geschichte der religisen Bewegung, Bd. 1,1852, S. 29. In der
Vorrede (1854) von: R. Gottschall, Die deutsche Nationalliteratur des 19. Jahrhunderts,
3
1872, Bd. 1, S. XIII bekennt sich der Autor zur Verfasserschaft. Rezensiert wurde Gott-
schalls anonymer Text von Moritz Carriere in dem Organ des Pseudohegelianers
I. H. Fichte, siehe ZPsT 21 (1852) S. 153-159. Carriere kritisiert, da der junghegeliani-
sche Radikalismus viel zu stark hervorgehoben wird: Die negativen Richtungen (der
Hegelschule, d. V.) sind auf Gassen und Mrkten ausposaunt worden als die alleinige
85
Wahrhei t und Geistesfreiheit , aber auf die Durchfhrung ihrer Theorien haben sie war-
ten lassen. (Ebd. S. 158).
182 R. Gottschall, Die deutsche Nationalliteratur (1872). Hier bes. Bd. 2, S. 142-190. ber
die Junghegelianer im Vormrz siehe auch S. 208-242.
183 J. Schmidt, Geschichte der Deutschen Literatur, Bd. 3.
2
1855, S. 380-449. Fr die Beur-
teilung der Junghegelianer nach der 48er Revoluti on vgl. auch (anonym), Die Triarier,
1852.
184 G. Mayer (1913 und 1920) aufgenommen in: ders. (1969).
185 Zur Junghegelianerliteratur dieser Phase ist zu rechnen: D. Koigen(1901);B. Groethuy-
sen (1923) ist ein Referat der Arbeiten von Koigen und Mayer; in diesen Kontext geh-
ren auch di e Arbei t en von Mackay ber St i rner (Anm. 174), von Bl aschke und Rosen-
berg ber Ruge ( Anm. 168), von Zl oci st i ber Hess ( Anm. 166). Zu nennen i st auch:
M. Nettlau (1925) bes. S. 169-179; H. Kobyl inski (1933).
186 Die Arbeit von W. Moog (1930) lt davon noch nichts spren; sie fllt an Genauigkeit
hi nt er di e Er dmannsche Darst el l ung zurck. Das neue Probl em refl ekt i eren di e Arbei -
t en von Lwi t h ber Feuer bach ( 1928) und der s. , Di e phi l osophi sche Kr i t i k ( 1933) ;
ders. , Von Hegel zu Niet zsche (1941,
8
1981). Zu erinnern i st in di esem Zusammenhang
daran, da 1931 der junge T. W. Adorno in seiner Kierkegaard-Schrift ber die Selbst-
vernichtung des Idealismus reflektiert. T. W. Adorno (1974), S. 190 ff.
187 K. Lwith (1964) S. 9.
188 C. Schmitt (1950 a) S. 81. Der arme Max ist Max Stirner.
189 G. E. Mller (1948); E. Benz (1955 b).
190 Es er schi enen Di sser t at i onen zu den wi cht i gst en j unghegel i ani schen Zei t schr i f t en:
H. Kor net zki (1955) ; W. Kl ut ent ret er (1966) .
191 Zu Gebhardts und Stukes Arbeiten siehe auch den ausfhrlichen Rezensionsartikel von
D. Gr oh ( 1964) . Zur Konj unkt ur der Junghegel i aner - For schung zu Begi nn der 60er
Jahr e vgl . auch di e Text auswahl en, di e i n der BRD und DDR er schi enen. K. Lwi t h
( Hg) , Di e Hegel sche Li nke, 1962; H. St eussl of f (Hg), Di e Junghegel i aner , 1963. Der
Band 6 ( 1963) der Annal i ent hl t berwi egend Bei t r ge zum Junghegel i ani smus und
Frhsozi al i smus, u. a. von E. Bot t i gel l i , A. Cor nu, C. Cesa, G. A. van den Bergh von
Eys i nga, E. Si l ber ner , W. Mnke. Zur Di s kuss i on der Al t hegel i aner vgl . H. Lbbe
(1960), aufgenommen in: ders., (1963).
192 H. M. Sa (1963) S. 221 f. Sa behandelt neben den Althegelianern aus den junghegelia-
ni schen Gr uppenzusammenhngen u. a. St rau, Feuer bach, Rge, Bayr hoffer,
B. Bauer, E. Bauer, Stirner, Marx, K. Schmidt .
193 J. Gebhardt (1963) S. 15, 18, 61, 152. Gebhardt behandelt neben den Althegel ianern aus
den j unghegel i ani schen Gr uppenzusammenhngen D. F. St rau, Ci eszkowski , Feuer-
bach.
194 Ebd. S. 48, 165 f. Zu E. Voegelins Gnosisthese vgl. E. Voegelin (1958), J. Taubes (1984)
sowi e di e Bei t r ge von P. J. Opi t z und G. Sebba, bei de i n: di es. (1981) S. 21-73 und
S. 190-241. Im letzten Kapitel dieser Arbeit werde ich auf diese These zurckkommen.
195 H. Stuke (1963) S. 247 ff.
196 D. Mc Lellan (1974) S. 7, 185; W. J. Brazill S. 16, 21.
197 Ebd. S. 282 und 263. Zur Di skussi on i m angel schsi schen Raum vgl . Phi l osophi cal
Forum (1978).
198 Vgl. die entsprechenden Literaturangaben in den Anmerkungen 166 ff.
199 K. Rttgers (1975) behandelt neben den Althegelianern: Feuerbach, D.F.Strau,
B. Bauer, E. Bauer, K. Schmidt, A. Rge, K. Marx, J. Mader (1975) bezieht sich u. a. auf
Cieszkowski, B. Bauer, Stirner, Feuerbach, Kierkegaard, He. R. Ruzicka (1977) kon-
zentriert sich auf B. Bauer, Feuerbach und Stirner.
200 K. Rt t gers (1975) S. 139 ff.
86
201vgl. J. Mader (1975) S. 140 ff.
202R. Ruzicka (1977) S. 3 und 112 ff.
203vgl. hierzu J. Hermand, M. Windfuhr (1970), W. W. Behrens u. a. (1973) und das mo-
numentale Werk von F. Sengle (1971, 1972, 1980).
204U. Kster (1972) S. 158 ff.
205C. Richter (1978) S. 3 und 95. Obwohl Richter die Junghegelianer nur am Rande seiner
Arbeit mitbehandelt, gibt diese sorgfltige und materialreiche Arbeit viele wichtige Ein-
blicke in die vor- und nachmrzliche Intellektuellenkultur in Deutschland.
206P.Wende (1975) untersucht Ruge und Nauwerck in Verbindung mit J. Frbel, J. G. A.
Wi rth, G. St ruve und K. Hagen ausgehend von der Gruppi erung l inker Abgeordnet er
in der Paulskirche. Zur Begrndung der Auswahl siehe Ebd. S. 31 ff.
I. Pepperle (1978). Zur Periodisierung Pepperles siehe Ebd. S. 88, 104,139.
208Der Schwerpunkt der Arbeit I. Pepperles liegt auf der Kunsttheorie der Junghegelianer,
insbesondere der Auffassungen von R. E. Prutz. Wie so oft in der wi ssenschaftlichen
Diskussion in der DDR kndigen sich vielleicht auch hier produktive Neuorientierun-
gen im literaturwissenschaftlich-sthetischen Bereich an.
209In den Jahren 1972-1976 fanden i m Rahmen des Zent rums fr i nt erdi szi pl inre For-
schung der Uni versi t t Bi el efel d unt er Lei t ung von J. Frese mehrere Tagungen einer
Arbeit sgemei nschaft Theori ebi ldung und Gruppenproze st at t , i n der anhand ver-
schiedener theorieproduzierender Gruppen eine wissenssoziologische Theorie der Bil-
dung von Theori en ent wi ckel t werden sol l t e. Neben der Gr uppe der Fr ei en um
B. Bauer in Berlin 184044 wurden ber acht weitere Gruppen von der Littrischen
Gesellschaft der freien Mnner in Jena u. a. 1796-1801 bis zum Institut fr Sozialfor-
schung um Max Horkheimer diskutiert. (Zentrum fr interdisziplinre Forschung Uni-
versitt Bielefeld, Jahresbericht 1973, S. 42 ff. Leider sind mir die Tagungsmaterialien
nicht zugnglich gewesen.)
210 R. Bubner, Ei nl ei t ung zu A. v. Ci eszkowski (1981) S. XIX.
211 J. Habermas (1985) S. 67.
212 Vgl. dazu ausfhrlich W. Ebach (1982 und 1985 a).
213 Zeitdruck im doppelten Sinne von knapper Zeit und belastenden Zeitumstnden.
Diese Formulierung verdanke ich Hans Paul Bahrdt, der sie fr die Stellung der Soziolo-
gie zu den Problemen ihrer Zeit verwendet hat.
87
88
I. Philosophische Schule
bersicht
Der Begriff >Schule< (1) wird typologisch im Hinblick auf externe (Verhltnis zu
Kirche und Staat) und auf interne (Piett gegenber dem Lehrer, Verbrderung
der Schulmitglieder und der Rolle der >groen Gedanken<) historische Strukturele-
mente entfaltet. Im externen Bereich sieht sich die phosophische Schule im Bnd-
nis mit dem preuischen Staat (2) und orientiert sich als integrierter Te des Staates
an der Figur der beamteten Intelligenz (3), die reformpolitischen Zielsetzungen
folgt. Im internen Bereich akademischer Schulbildung (4) steht die Schule vor dem
Problem, mit konkurrierenden Auffassungen umgehen zu mssen. Sie tut dies
durch eine Aufwertung der Polemik, der besonderen Legitimation von Schulbil-
dungen und der spezifischen Definition ihrer Aufgaben. Im symbolischen Jahr
1840 steigern sich die Erwartungen (5) der Gruppe, da sich ihr Bndniskonzept
erfllt bzw. da ihnen eine Chance zur Verteidigung gegeben wird. Die Entlassung
B. Bauers (6) bedeutet fr die Gruppe das Scheitern des Bndniskonzeptes, aus
dem sie als >bloe Menschen< hervorgehen. Der interne Positionenstreit (7) kann
mit der brchig werdenden Schuldefinition nicht mehr rein spekulativ gesichert
werden, das politische Richtungsschema >Rechte-Mitte-Linke< indiziert nicht nur
die Schulspaltung, es beruhigt auch das aufbrechende Sophismusproblem.
1. Zum Begriff >Schule<
Der Ausdruck >Schule<, auf wissenschaftsgeschichtliche Zusammenhnge ange-
wandt, ist vieldeutig.
1
Er bezeichnet >Richtungen<, >Denkweisen<, >Theoriesy-
steme< ebenso wie bestimmte Gruppen von Wissenschaftlern. Man kann an .kleine
Zusammenhnge mit ausgeprgtem >esprit de corps< denken und an sehr groe
Gebilde wie den >Marxismus< als >Schule< oder an sog. >nationale Schulen<. Wenn
in dieser Arbeit von >Schule< die Rede ist, so bezieht sich der Ausdruck nicht auf
eine typologische Ebene derart, da von mir aus wissenschaftsgeschichtlicher Per-
spektive verschiedene Denker zu einer Schule zusammengefat werden, we ich
bei ihnen Gemeinsamkeiten entdecke, die den Ausdruck >Schule< rechtfertigen
knnten. Auch soll >Schule< nicht einen Kreis von Denkern bezeichnen, die mehr
oder weniger gemeinsame Ansichten zu bestimmten Problemen entwickeln, die
jedoch sozial kaum oder wenig miteinander zu tun haben. Der Ausdruck >Schule<
soll dagegen einen Typ wissenschaftlicher Gruppenbildung bezeichnen, der zah-
lenmig und lokal definiert werden kann, dessen Zugehrigkeitskriterien sowohl
von Seiten der Gruppe wie von Seiten des einzelnen bewut anerkannt werden und
dem ber die Zugehrigkeit zu Institutionen der Wissenschaft hinausgehend
besondere Bindungen eignen.
E. Tiryakian hat eine idealtypische Definition von >Schule< gegeben, die sich
89
zwar stark an den kunstgeschichtlichen Schulbegriff anlehnt, aber im Hinblick auf
wissenschaftliche Schulen angelegt ist. >Schule< ist ihm zufolge eine wissenschaftli-
che Gemeinschaft, die sich um eine zentrale Figur schart, einen geistigen charisma-
tischen Fhrer und ein Paradigma ber die vorfindliche Realitt, die Gegenstand
der Untersuchung ist.
2
Die paradigmatischen Kernformulierungen - oft auch sol-
che esoterischer Art - stammen vom Grnder, die Gefolgschaft besorgt die Ausle-
gung und Interpretation der >groen Gedanken< und kooptiert ihrerseits neue
Schlergenerationen. In der Schule knnen neben Grnder und Schlern eine
kleine Anzahl von Mitgliedern aus der Alterskohorte des Grnders sein, die,
obwohl nicht seine Schler, sich dennoch seinen Thesen aus berzeugung ange-
schlossen haben. An der Peripherie der Schule sind oft >Helfer< anzutreffen, die, sei
es als Verleger oder als Staatsbeamte, die Schule frdern, ihr angehren, ohne
selbst im intellektuellen Bereich hervorzutreten.
Tiryakian kommt bei seiner idealtypischen Definition von >Schule< nicht ohne
religionssoziologische Begriffe aus. Zumindest im Stadium ihrer Entstehung sei die
Schule mit einer Sekte oder Bruderschaft vergleichbar: ihr eigne ein intellektueller
Missionswille, und anfangs werde der Schule der Zutritt zum Tempel verwei-
gert. In dem Mae, wie die Schule sich etabliert, komme es wie bei Sekten zu einer
Veralltglichung des Charismas, und die Ideen der Schule werden in die Standard-
konzeption der Disziplin integriert.
3
So plausibel die Hereinnahme religionssoziologischer Begriff in die Schuldefin-
ition auf den ersten Blick erscheinen mag, die bloe Analogie von >Schule< und
>Sekte< verfhrt leicht zu einer polemischen Sicht. Sicher lassen sich zwischen
Schule und Sekte vielfltige bergangsformen ausmachen: so kann das gelehrte
Wissen auf eine religise Heilswahrheit bezogen sein, oder die Anhnger eines Pro-
pheten oder Gottgesandten knnen die Verbreitung der Heilswahrheit als routi-
nierten Schulbetrieb organisieren. Dennoch ist es sinnvoll, mit Max Weber den
philosophischen Lehrer und seine Schule vom Propheten und seiner Gemeinde zu
unterscheiden.
4
Der philosophische Lehrer bt ein professionelles Weisheitsge-
werbe aus, der Prophet ist definiert durch die Verkndigung einer religisen
Heilswahrheit kraft persnlicher Offenbarung. Dieser arbeitet gleichsam unent-
geltlich kraft eigenem Charisma, jener lehrt professionell im Auftrag. Im Unter-
schied zur Sektenbildung ist die >Schule< von vornherein auf die jeweilige Weise der
Institutionalisierung des philosophischen Wissens bezogen.
Der Grad der Institutionalisierung mag hoch oder niedrig sein - bevor die
Gruppe um einen Weisheitslehrer >Schule< genannt wurde, war >Schule< der Ort,
an dem Muezeit verbracht wurde -, entscheidend ist, da mit der Abgrenzung von
Bereichen, in denen philosophisches Wissen gelehrt wird, ein Raum fr konkurrie-
rende Weltauffassungen entsteht. Schulbdung findet in einem Konkurrenzraum
statt, der institutionalisiert ist.
Der Glaubenskrieg von Sekten ist im strengen Sinne keine Konkurrenz, weil jede
Sekte durch ihren Bezug zur Heilsoffenbarung auer Konkurrenz steht und weil
Heilswahrheiten ihrer Natur nach der Einrichtung von Konkurrenzrumen, in
denen sie >degradiert< werden knnten, widerstreiten. Im Unterschied zur >Sekte<
bezieht sich >Schule< immer auf ein Forum. An dieser Differenz mu festgehalten
werden, um die Selbstdefinitionsprobleme der Junghegelianer erhellen zu knnen,
90
die sich sowohl als philosophische Schule als auch im Kontext hretischer Sekten-
traditionen begreifen.
3
Im folgenden werde ich einige historische Strukturelemente skizzieren, die sich
auf die Genese des Konkurrenzraumes philosophischer Schulbildung und auf die
innerschulischen Verhltnisse beziehen.
Im Unterschied zum klassischen Altertum, auf dessen Philosophenschulen hier
nicht eingegangen werden soll, vollzieht sich die mittelalterliche philosophische
Schulbildung im Rahmen der theologischen Anstalten und wird gemeinhin als Pro-
ze der Verselbstndigung der Philosophie gegenber der Theologie begriffen.
6
Die Differenz von Priesterbeamten und Philosophen entwickelt sich ber das
metatheoretische Grundmuster der doppelten Wahrheit. Es gibt die Wahrheit der
biblischen Offenbarung, die in der kirchlichen Lehre tradiert wird, und es gibt die
Wahrheit, die durch logische, spekulative oder empirische Rekonstruktion der
Offenbarung entsteht. Mit diesem Grundmuster ist der Proze einer Freisetzung
der Philosophie von der Religion in Gang gesetzt. Entscheidend ist, da gerade
dort, wo es um die intellektuelle Rekonstruktion der Offenbarung geht, ein
zunchst geringer, aber im Laufe der historischen Entwicklung grer werdender
Raum fr konkurrierende Rekonstruktionen gegeben ist. Dieser Konkurrenzraum
ist aber eine der wesentlichen Voraussetzungen fr die Genese konturierter philo-
sophischer Schulbildungen, die sich zwar alle zunchst noch bei Strafe sozialer oder
physischer Vernichtung dem kirchlichen Dogma unterordnen mssen, die aber
doch unter sich um eine adquate Rekonstruktion der Offenbarung konkurrieren
knnen.
Im Gefolge der Reformation und der Religionskriege wird ein zweites histori-
sches Strukturelement wichtig, das den sozialen Raum fr philosophische Schulbil-
dung absichert. Die erstarkenden absolutistischen Staaten befrdern durch Akade-
mie-Grndungen und Einwirkung auf Universitten nicht nur die gesellschaftliche
Anerkennung wissenschaftlicher Forschung, sondern sie helfen mit, Institutionali-
sierungen zu schaffen, die den Wissenschaftler von den Wechselfllen grerer
oder geringerer Toleranz der religisen und politischen Herrschfat entlasten.
7
Die
Institutionalisierungen von neutralen Sphren der Wissenschaften geht, worauf
Krohn hinweist, einher mit einer gesellschaftlichen Definition legitimer Wissen-
schaft.
Die neutrale Sphre, die der Wissenschaft in ihren Institutionen geschaffen worden ist, ist
zugleich ein Kompromi, den sie gegenber Kirche, Staat und Wirtschaft eingeht. Die
gesellschaftliche Stabilisierung erreichen die Wissenschaftler um den Preis, da ihre eigene
Sicherung zugleich eine Zusicherung zu sein hat, keinen Anla zur Gefhrdung der ffentli-
chen Ordnung, der religisen Orientierung und der Legitimation von Herrschaft zu geben.
Es legen damit die Institutionen fest, welches Forschungsverhalten als ein wissenschaftliches
auf Anerkennung und auf Schutz rechnen kann.
8
Kernpunkt dieser gesellschaftlichen Definition legitimer Wissenschaft ist, da
die Wissensbereitstellung als eine neutrale Ttigkeit definiert wird, die als solche
weder herrschaftskonform noch dysfunktional ist.
9
Eliminiert sind in dieser Defi-
nition umfassendere emanzipatorische Ansprche, die auf eine praktische Vern-
91
derung sozialer und politischer Strukturen sich richten knnten. Das Abkappen
der praktisch-emanzipatorischen Dimension verweist den Wissenschaftler auf den
Modus der >Ratschlge<. Auf der anderen Seite bringt die Institutionalisierung der
Wissenschaften eine Entlastung der Erkenntnisgewinnung von den Zwngen und
Gefahren gesellschaftlicher Praxis. In jedem Fall fhrt die gesellschaftliche Legiti-
mierung der neutralen Sphre Wissenschaft zu einer wichtigen Stabilisierung des
Konkurrenzraumes fr Schulbildungen, die nunmehr relativ abgekoppelt von Ver-
bindlichkeiten der kirchlichen Dogmatik und den Wendungen politischer Herr-
schaft miteinander konkurrieren knnen.
Natrlich sind die beiden geschilderten historischen Strukturelemente nicht
ungefhrdet. Im Gegenteil: Verfolgt man die Geschichte der Universitten, so sind
kirchliche und staatliche Eingriffe allzu hufig anzutreffen. Auch setzen sich beide
Strukturelemente in den verschiedenen Wissenszweigen unterschiedlich rasch und
stabil durch. Whrend sich im Bereich der technisch-naturwissenschaftlichen,
medizinischen und konomischen Wissenschaften die Verselbstndigungen frher
durchsetzen und sich rascher stabilisieren, dauert es im Bereich der Philosophie
erheblich lnger.
10
Noch im 19. Jahrhundert - dies lehrt gerade die Geschichte der
Hegelschule - ist die Entkoppelung philosophischer Lehre und Forschung von
kirchlichen und staatlichen Imperativen nicht gesichert vollzogen.
Die beiden skizzierten historischen Strukturelemente beziehen sich gleichsam
auf >externe< Voraussetzungen philosophischer Schulbildung. Mit ihnen ist virtuell
der Konkurrenzraum gegeben, in dem sich die Schule bewegt. Im folgenden
mchte ich auf zwei weitere historische Strukturelemente eingehen, die die Bezie-
hungen der Mitglieder einer Schule untereinander betreffen: sie beziehen sich auf
den Komplex der Piett gegenber dem Lehrer, der Verbrderung der Schule und
die Frage der Beschaffenheit der >groen Gedanken<.
M. Weber zufolge gehrt die Beziehung zwischen Schler und Weisheitslehrer
berall zu den festesten Piettsverhltnissen, die es gibt.
n
Der Begriff Piett ver-
weist auf Bindungsformen familialer Herkunft. Er fllt in den Bereich des traditio-
nell blichen und Erwarteten, einen Bereich, der anders strukturiert ist als die
besondere charismatische Beziehung.
12
Es ist sinnvoll, fr die Lehrer-Schler-
Beziehung zunchst die Probleme, die mit einem charismatischen Lehrer gegeben
sind, auszuklammern, nicht nur, weil sonst die typologische Differenz von religi-
ser Gemeinde und philosophischer Schule zu verschwimmen droht, sondern vor
allem, weil fr die genauere Bestimmung der Schulpiett ihr Verhltnis zur Fami-
lienpiett magebend ist.
Es gehrt zu den Eigentmlichkeiten der vom Christentum geprgten abendln-
dischen Tradition der Lehrer-Schler-Beziehung, da die Frage nach dem Verhlt-
nis von Schulpiett zu Familienpiett nicht eindeutig festgelegt ist. Whrend z. B.
der indische >Guru< ein souverne Gewalt ber seine Schler hat, die die Familien-
piett annulliert, kennt die christliche Tradition eine zweifache Antwort: Es gibt
sowohl einen Traditionsstrang, in dem die Pietas gegenber dem christlichen Leh-
rer als eine die Familienbande sprengende begriffen wird. Bezugspunkte dieser
Tendenz sind die bekannten Jesu-Worte: Es werden entzweit sein der Vater mit
dem Sohn und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Toch-
92
ter mit der Mutter. (Lukas, 14,26) Auf der anderen Seite gibt es einen Traditions-
strang, in dem das Lehrer-Schler-Verhltnis ganz nah an die familiale Situation
angelehnt wird, so da im Idealfall geistlicher Lehrer und Vaterschaft zusammen-
fallen, wie die Verbreitung der Idee einer >geistigen Vaterschaft< bezeugt.
13
Schulpiett ist aufgrund dieser Ambivalenz sowohl eine Wiederholung der Fami-
lienpiett: der Vater als Lehrer wiederholt sich im Lehrer als Vater, als auch eine
der Familienpiett entgegengesetzte Verbindung: der Lehrer depotenziert den
Vater. Es kann hier nur daraufhingewiesen werden, da diese Uneindeutigkeit eng
verwoben ist mit dem von der psychoanalytisch orientierten Kulturtheorie entdeck-
ten Zusammenhang von Vaterschaft, Sublimation und kultureller Produktivitt.
Der dipale Vater, der sich dem Begehren des Sohnes in den Weg stellt, ist zugleich
eine Gestalt, die den Proze der ffnung der familiren Sozialbindungen in Gang
setzt und zur Anerkennung der Person ebenso wie zur Konstitution der Realitt
herausfordert.
14
Die Ambivalenz zwischen einer familialistischen und einer antifamilialistischen
Fassung der Piett gegenber dem Lehrer scheint diese eher zu strken als zu
schwchen. Es ist eine fruchtbare Ambivalenz, weil sie in die Autorittsbeziehung
zugleich das Moment ihrer Auflsung einfhrt.
15
Dies wird besonders deutlich,
wenn man die der christlichen Tradition entstammende Idee einer Selbstaufhe-
bung der Lehrer-Schler-Beziehung in Betracht zieht.
L. Schuckert hat darauf hingewiesen, da das christliche Verstndnis des Leh-
rers, wie es schon frh in den Benediktinischen Regeln erfat wird, zwar die Hier-
archie von Lehrer und Schler kennt, aber diese Hierarchie wird nicht paternal im
rmischen Sinne und auch nicht als Verhltnis von Meister und Jnger aufge-
fat.
16
Im rmischen Paternalismus und in der Meister-Jnger-Beziehung ist die
innerschulische Hierarchie grundstzlich unaufhebbar, lediglich die Folge der
Generationen macht aus Shnen-Schlern-Jngern Vter-Lehrer-Meister. Dage-
gen kennt die christliche Lehrer-Definition nur die graduelle, nicht prinzipielle
interschulische Differenz. Der Abstand zwischen Lehrer und Schler verringert
sich progressiv, bis er sich - jedenfalls der Idee nach - innerschulisch, d. h. schon
vor dem generativen Platzwechsel, selbst aufhebt. Die sozialen Effekte dieser Auf-
fassung liegen zum einen in der Mglichkeit, das Lehrer-Schler-Verhltnis ten-
denziell egalitr zu definieren, zum anderen in der Mglichkeit einer Beschleuni-
gung der Bildungsprozesse, wird doch das Abstandverringern zum gemeinsamen
Bezugspunkt.
Die Tendenz der Selbstaufhebung der Lehrer-Schler-Beziehung liegt schon
sehr nahe bei dem Komplex der Verbrderung der Schule. Tiryakian hatte in seinem
Idealtypus >Schule< auf die Schulmitglieder hingewiesen, die, neben dem Grnder
stehend, seiner Alterskohorte entstammend, sich, obwohl sie ihre Ausbildung
anderswo abgeschlossen haben, dem Schulgrnder angeschlossen haben.
17
Die
Bedeutung dieser Mitglieder besteht darin, da sich in ihrer Beziehung zum Lehrer
gleichsam modellartig der Verbrderungsaspekt darstellt. Denn ihr Anschlu an
die Schule verdankt sich nicht einer jugendlichen Verehrung des Lehrers, die erst
zu lutern wre, sondern sie erfolgt als Zusammenschlu von virtuell Gleichen.
Der Verbrderungsaspekt in schulischen Beziehungen soll im folgenden histo-
93
risch spezifischer dargestellt werden. Religionssoziologisch betrachtet, lt sich die
Brderlichkeitsethik weit zurckverfolgen,
18
und sie ist vielleicht als Reaktion auf
die immer gegebene Erfahrung von Gewalt zurckzufhren, die auch in der Schule
als pdagogische Gewalt zugegen ist. Im Zusammenhang dieser Untersuchung ist
spezieller auf die eigentmliche Sentimentalisierung sozialer Beziehungen hinzu-
weisen, die im 18. Jahrhundert aufbricht und die auch den innerschulischen Ver-
brderungsaspekt in ihren Bann schlgt.
Es ist hier nicht der Ort, auf die komplexe Genese dieser Bewegung einzugehen,
die zum Ende des 18. Jahrhunderts nahezu alle Bereiche des sozialen Lebens erfat
hat. Genannt seien stichwortartig: die Empfindsamkeit, die Sentimentalisierung
der Familienbeziehungen, der Freundschaftskult und die Protestbewegung des
>Sturm und Drang<.
19
Wahrscheinlich stehen diese Bewegungen in Zusammenhang
mit sozialstrukturellen Vernderungen der Sozialisationsbedingungen. Der fami-
lire Raum erhlt eine auerordentliche Wertschtzung als ein Ort, den Liebe, Inti-
mitt, Spontaneitt und gefhlhafte Verstndigung beherrschen sollen - Qualit-
ten, die dann zum Mastab fr das Zusammenleben der >Menschheitsfamilie< erho-
ben werden.
20
Allgemein kann man sagen, da in dieser Bewegung das Brgertum
seinen Anspruch auf moralische Integritt und auf die Authentizitt der Emotionen
gegen die politische Weltklugheit< der Oberschichten geltend macht, fr die Emo-
tion und Moral strategische Elemente im verhflichten Spiel der Macht waren.
Im Bereich der Universitten macht sich die Sentimentalisierung der sozialen
Beziehungen etwa im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts geltend. Seit den 70er
Jahren zeichnet sich zunchst im studentischen Bereich ein tiefgreifender Wandel
in den Formen der Gruppenbildung ab.
21
Die traditionellen Gruppenformen der
alten Orden, Landsmannschaften und >Krnzchen<, die auf staatlichen, landschaft-
lichen, stndischen und Altersunterschieden basierten und die sich exklusiv defi-
nierten, werden von einer neuartigen Bewegung der Verbrderung in Frage
gestellt, fr die ein gesteigertes, soziale Distanzen aufhebendes Freundschafts- und
Gemeinschaftsgefhl, verbunden mit emphatisch-idealisierten Wertvorstellungen,
charakteristisch ist. Man beginnt, sich ber Standesschranken hinweg zu duzen,
und erhebt die freundschaftliche Verbindung mit Fremden zum Programm.
22
H. Gerth verweist in diesem Zusammenhang auf die Effekte, die die Auflsung
stndegesellschaftlicher Bindungen bei der Intelligenz hervorruft: Die aus ihren
Stnden ausgebrochenen Individuen ( . . . ) tasteten im exaltierten Abbau der eige-
nen Standestradition nach Formen fr die zu neuer Gemeinschaft drngenden
Gehalte.
23
Die Sentimentalisierung der sozialen Beziehungen, die an den Ausbildungsinsti-
tutionen in der studentischen Verbrderungsbewegung gipfelte, gehrt zu den tief
wirkenden geschichtlichen Erfahrungen der Vertreter der klassischen Epoche.
Fichte und Goethe sind in die hochschulpolitischen Auseinandersetzungen in
Sachsen-Weimar verwickelt, Schillers Ruberlied wurde von den Studenten begei-
stert aufgenommen, Hlderlin, Schelling und Hegel hatten in Tbingen Kontakt zu
studentischen Verbrderungen.
24
So wechselvoll und uneinheitlich ihre Haltung
zu den Verbrderungen im einzelnen auch gewesen sein mag, das soziale Klima der
Sentimentalisierung sozialer Beziehungen hat diese Generation entscheidend
geprgt. Goethe schreibt rckblickend: Es war berhaupt eine so allgemeine
94
Offenherzigkeit unter den Menschen, da man mit keinem einzelnen sprechen,
oder an ihn schreiben konnte, ohne es zugleich als an mehrere gerichtet zu betrach-
ten. Man sphte sein eigen Herz aus und das Herz der anderen.
25
Ein anschauli-
ches Beispiel fr die Wirkungen der Verbrderungsbewegung auf die Beziehungen
zwischen Hochschullehrern und Studenten liefert der Bericht eines Studenten ber
die Feier auf dem Picheisberge vom Mai 1819:
Eingeladen waren vornehmlich von den Burschen Prof. Schleiermacher, De Wette, Hegel,
Hasse (der nicht kam) und Jahn (der kam auch nicht). Ein Trupp zog schon um 7 Uhr fort, ein
anderer um 9, ein dritter um 11. Auf dem Berge dort sammelten wir uns alle, und dort war
auch das Mahl gerstet. Mit Ballspiel und Wettlaufen und andern Spielen brachten wir die
Zeit hin, bis die Professoren kamen. Als nun alles bereit war und alle Pltze mit den Marken
belegt, die wir von unsern Festordnern fr 2 Tlr 4 Gr gelst, zogen wir hinein in den Saal und
sangen bald: Sind wir vereint zur guten Stunde! - zum Wein hatte jeder sein eigenes Glas
mitgebracht, doch ist keins wieder heimgekommen. Dann ermahnte uns Schleiermacher,
das Lied >Wem gebhrt der hchste Preis?< zu singen, und nachdem sprach er: >Wir wollen
trinken: da der Geist, der die Helden von Grschen beseelte, nicht ersterbe! < Glserklnge
und frhliches Jubelrufen antwortete ihm. Dann sprach Dr. Frster einiges ber Kotzebues
Tod und endete so: >Nicht Sands Lebehoch wollen wir trinken, sondern da das Bse falle,
auch ohne Dolchsto !< Mir schiens, als wurde nicht ganz laut Bescheid getan. Auch Jahns
ward nicht vergessen. Endlich ri der Wein berall hindurch. An die Stelle des ruhigen
Gesprchs trat jauchzende Lust; auch die Professoren wurden Jnglinge. Alles Bruder und
Freund! >Lieber Bruder Schleiermacher<, sagte Hermes, >Du bist ein zu herrlicher Kerl; la
uns Schmollis saufenU Und es geschah. Haake aber sprach zu demselben: >Schleiermacher,
Du bist zwar sehr klein und ich sehr gro; ich bin Dir doch gar sehr gut!< Ich aber meinte:
Ach wie wirst Du und alle morgen um 6 Uhr in Deine sthetik finden! - Selbst vor Lachen
und Trunkenheit stammelnd, fhrte er uns salomonische Sprche ins Gedchtnis. Alle rie-
fen ihm zu: >Du liesest morgen nicht!<, und so gings mit allen Doktoren, die dort waren.
26
Der Bericht zeigt zum einen die sukzessive Aufhebung des Distanzverhltnisses:
getrennter Anmarsch, Vereinigung bei Gesang und Wein, die Idealisierung der
Situation Alles Bruder und Freund!, und schlielich die rauschhaften ber-
schreitungen der institutionellen Rollendefinitionen. Nicht weniger wichtig sind
die politischen Bezge. Beschworen wird die Zeit der Befreiungskriege, die Lehrer
und Schler im gesteigerten Patriotismus zusammen finden lie, und es deutet sich
eine Spaltung an, die Sympathisanten und Gegner von Sands Attentat auf Kotze -
bue trennt. Wenige Monate spter werden nach den Karlsbader Beschlssen und
der einsetzenden Demagogenverfolgungen Feiern wie diese dem polizeilichen Ver-
dacht ausgeliefert sein.
Die Verbrderungsbewegung stand auch mit Pate bei Fichtes, Schleiermachers
und Humboldts berlegungen zur Universittsreform. Humboldt begreift, die
christliche Idee einer tendenziellen Aufhebung der Lehrer-Schler-Hierarchie
radikalisierend, die Universitt als die Emanzipation vom eigentlichen Lehren, da
der Universittslehrer nur von fern das eigene Lernen (der Studenten, d. V.) lei-
tet.
27
Es geht nicht mehr um bloen Ausgleich des Geflles zwischen Lehrer und
Schler, sondern um die Konstituierung einer geisterfllten Geselligkeit, in der
bei allen Beteiligten ein gleicher Wille zur Wahrheit vorausgesetzt wird. Der
Aspekt allseitiger Kommunikation gewinnt hier einen klaren Vorrang vor dem der
Belehrung.
95
Fr die internen Beziehungen philosophischer Schulbildung bedeutet dies: dem
philosophischen Lehrer als Mittelpunkt einer Schule gebhrt zwar immer noch die
traditionelle Pietas, aber diese wird zunehmend als Verpflichtung gegenber einer
Symbolsphre begriffen, die sich im egalitren Proze der innerschulischen Kom-
munikation weiter entfalten soll. Unter diesem Aspekt werden die Debatten der
Hegelschler verstndlich werden, die davon handeln, inwieweit es notwendig sei,
gerade in der Treue zum Lehrer ber dessen Lehren hinauszugehen.
Hinzukommt, da die Geringachtung der sozialen Distanzverhltnisse in der
Tendenz dazu fhren kann, auch den institutionellen Rahmen der Schulbildung,
den akademischen Raum, als hinderlich fr die Entwicklung der Schule zu begrei-
fen. Denn der institutionalisierte akademische Raum besitzt mit seinen Disziplinen,
Prfungen und Graden als ein aufgefchertes Erziehungsinstitut eine eigene soziale
Schwerkraft, die dem Verbrderungsstreben der philosophischen Schule hufig
entgegensteht. Das heit, die internen Schulbeziehungen sind nicht vollstndig mit
den akademischen Sozialbeziehungen zur Deckung zu bringen, handelt es sich
doch um zwei Strnge, die sich in der philosophischen Schulbildung des beginnen-
den 19. Jahrhunderts treffen: Ein sozialer Beziehungstyp, der dem akademischen
Bereich Universitt als einer staatlichen Ausbildungsinstitution in der Tradition des
Absolutismus entspringt, mit klar definierten Lehrer- und Schlerrollen, und auf
der anderen Seite ein sozialer Beziehungstyp, der dem durch die brgerliche
Gesellschaft begrndeten freien Verbrderungs- und Vereinswesen zu verdanken
ist.
Im Schnittpunkt beider Formen ist die Schule anzusiedeln. Sie beruht auf der
Pietas gegenber dem Lehrer ebenso wie auf der Verbrderung der Schulmitglie-
der. Die Festigkeit der Piett beruht auf der Beziehung der >geistigen Vaterschaft:,
die die mit der bloen Lehrerschaft gegebene Hierarchie in eine Bewegungsform
verwandelt, in der die Prozesse der > Abarbeitung< und Wertschtzung des so Ange-
eigneten ineinander greifen. In der Verbrderung entsteht eine horizontale Kom-
munikationsebene, in der sich das Verpflichtungsgefhl zugleich mit der Bewlti-
gung der persnlichen Autorittsprobleme auf eine Symbolsphre bezieht, deren
>groe Gedanken< den gemeinsamen Bezugspunkt darstellen.
Diese gemeinsame Symbolsphre entsteht, weil in einem doppelten Sinn der
>Tod des Vaters< in der Schule prsent ist. Nicht nur in dem Sinne, da von Schule
nur geredet werden kann, wenn sie nach dem Tod des Grnders mindestens eine
gewisse Zeit weiterlebt, sondern auch in dem Sinne, da sie die >groen Gedanken<
in eine tradierbare Struktur bringt, die ihnen Dauer und Bleiben sichert.
Nicht jeder Philosoph oder Theoretiker hat >Schule< gemacht, und es wre zu
einfach, dies lediglich auf die Gunst oder Ungunst der Umstnde zurckzufhren.
Vielmehr ist daran zu denken, da sich vielleicht gerade solche Theorien als >schul-
fhig< erweisen, in denen der >Tod des Vaters< in besonderer Weise anwesend ist.
Dieser Gedanke mu nicht der Erfahrung widersprechen, da es sich bei den
Schulgrndern in der Regel um auergewhnlich selbstgewisse Persnlichkeiten
handelt. Auch sind in der Regel die >groen Gedanken< so beschaffen, da sie einen
gleichsam paradigmatischen Charakter haben, der sie als verallgemeinerungsfhi-
gen >Schlssel<, als >Methode< oder als >Ansatz< zur Lsung zuvor verstreut erfahre-
96
ner Phnomene und Probleme erscheinen lt. Der >Tod des Vaters< ist jedoch in
schulfhigen Theorien in der Weise anwesend, da sich die >groen Gedanken< in
seltsamer Weise um eine Leerstelle gruppieren. Auf einer persnlichen Ebene mag
so etwas wie die Flle des Charismas wirken - was die Theorie angeht, die Schule
macht, so mu von einer Leerstelle im Zentrum gesprochen werden. Sie kann
umschrieben werden als Arkanum oder esoterischer Bereich, aber sie ist in der
Hauptsache nicht positiv bestimmbar. Sie ist daher auch nicht, wie bei Sektengrn-
dern, eine Offenbarung, sondern eher umgekehrt eine Verrtselung.
Ein Artikel in der RhZ, der von B. Bauer stammen knnte, macht dies deutlich.
28
Wie viele groe Mnner sei auch Hegel nach seinem Tode ein Gegenstand der Volksmythe
geworden. Es wird erzhlt, kurz vor seinem Tode soll er ausgesprochen haben: >Keiner sei-
ner Schler habe ihn verstanden, auer einem, dieser habe ihn aber miverstanden >Sie
haben mich nicht verstanden< hat der groe Denker geseufzt und ist gestorben. Diese
Mythe sei populr bei den Gegnern der Schule, aber sie sei natrlich eine Erfindung, sie
knne auch nicht in dem Sinne stimmen, da Hegel nicht zu verstehen sei: Hunderte von
Schlern, Tausende von Lesern haben Hegel verstanden und verstehen ihn fortwhrend
sehr wohl.
Was knnte aber ein Sinn der Mythe sein, der fr die Schule wichtig wre? Worauf
bezieht sich das mythische Hegel-Wort: Sie haben mich nicht verstanden? Dem
junghegelianischen Autor zufolge bezieht sich das Miverstehen nicht auf etwas
vom Lehrer Gesagtes, sondern auf etwas Nicht-Gesagtes, gleichsam auf eine Leer-
stelle. Das Miverstandene seien gewi nicht jene Worte, welche vernehmlich in
die Ohren seiner Hrer drangen, und welche der Prebengel verewigt hat; wohl
aber das, was er nicht aussprach, was der nicht verstehen konnte, der den Lehrer zu
sehr beim Wort nahm. Wirkliche Schlerschaft konstituiert sich auf der Ebene
des Paradigmas um eine Leerstelle. Der Mythos drckt dies im Tod des Lehrers
aus. Erst nach seinem Tode geht das wahre Verstndnis seiner Philosophie auf;
und so hat Mythos uns prophezeit, was wir jetzt erfllt sehen.
29
Beziehen wir diesen symbolischen Tod des Lehrer-Vaters auf die Situierung der
Schule im Konkurrenzraum philosophischer Schulbildung, so kann der soziale
Sinn der Leerstelle deutlich gemacht werden. Der Konkurrenzraum kann als ein
Feld gegenseitiger Herausforderungen umschrieben werden, in dem sich die Bewe-
gungen des Bietens und berbietens austauschen. Auf diesem Kampfplatz zhlt die
>Strke<, die >Kontur<, die >Geschlossenheit<, und diesen Werten mu die Theorie
sich anpassen, wenn sie sich behaupten will.
Da es aber in der Natur intellektueller Arbeit liegt, da nagender Zweifel, entmu-
tigende Irrlufe und das kontingente Ermden geistiger Anstrengung kaum zu ban-
nende Begleiterinnen darstellen, besteht das soziale Problem, mit diesen Dimensio-
nen umzugehen. Sie knnen individuell ausgehalten werden, aber ein Schulkollek-
tiv mu auch eine soziale Lsung finden. Liegt es nicht nahe, daran zu denken, da
der Strkste der Gruppe, der Grnder der Schule, die paralysierenden Elemente
intellektueller Arbeit als eine symbolische Schuld auf sich nimmt und ihnen eine
Stelle im Innern seines Paradigmas zuweist? Die Schule wre so entlastet, was die
Konkurrenzfhigkeit nach auen angeht, zugleich wren aber die paralysierenden
Elemente nicht einfach verschwunden, sondern als symbolische Schuld des Schul-
vaters stellen sie eine uerst motivierende Herausforderung dar.
97
Aus soziologischer Sicht ist anzunehmen, da sich im Innern der >groen Gedan-
ken< die Schule gemacht haben, eine Leerstelle befindet, die als symbolische
Schuld des Vaters ihre Tilgung verlangt, wenn das Paradigma sich im Konkurrenz-
raum behaupten soll. Aus ideengeschichtlicher Perspektive mag es verwegen sein,
im Unbewuten bei Freud, in der Revolution bei Marx, in der societe bei
Durkheim, im Ding an sich bei Kant oder im Absoluten bei Hegel eine Leer-
stelle zu sehen. Meine Argumentation ist auch weit entfernt davon, die Leerstelle
zum Anla einer schlichten Polemik gegen den >Stein der Weisen< zu nehmen. Ent-
scheidend ist der Gedanke, da sich die Schulbildung im Konkurrenzraum um so
besser behaupten kann, je mehr es ihr gelingt, ihre Schwchen nach innen auf den
Grnder zu zentrieren. Die Theorie, die in dieser Frage ein Angebot macht, indem
sich ihre Aussagen um ein Rtsel gruppiert wie um ein Monopol der Abwesenheit,
eignet sich fr eine Schulbildung weitaus besser als eine Theorie, die auf dieses
Angebot verzichtet.
Die berlegungen zum Begriff der >Schule< abschlieend, mchte ich auf ein
Paradox aufmerksam machen, das sich auftut, wenn man die Hegeische Philoso-
phie mit den dargestellten Strukturelementen philosophischer Schulbildung in
Beziehung setzt. Folgt man der Programmatik Hegels in bezug auf die dargestellten
fr die Schulbildung relevanten Strukturelemente, so kommt man zu dem Ergeb-
nis, da der Zielpunkt Hegeischen Denkens in der Idee einer Vershnung zwischen
der Philosophie und der Kirche, der Philosophie und dem Staat und zwischen sei-
ner Philosophie und konkurrierenden Philosophien liegt. Im Verhltnis zur Kirche
knpft Hegel an das metatheoretische Grundmuster einer doppelten Wahrheit an,
aber nicht nur oder nicht in erster Linie, um die Emanzipation der Philosophie von
der Religion zu legitimieren, sondern eher, um das Zusammenfallen von philoso-
phischem Wissen und religisem Glauben zu affirmieren. Im Verhltnis zum Staat
zielt die Vershnung darauf, den Dualismus zwischen philosophischer Vernunft
und unvernnftigem Staat zu berwinden. Im Verhltnis zum Konkurrenzraum
philosophischer Schulbildung zielt die Vershnung darauf, differente Auffassun-
gen nicht einfach als wahr-falsch einander feindlich gegenberzustellen, sondern
alle uerungen der Denkttigkeit als wahr und berechtigt in das philosophische
System aufzunehmen. Schlielich, im Verhltnis zum Problem innerschulischer
Differenz, zielt die Vershnung auf die Legitimation innerschulischer Abweichung
durch ihre Einbettung in das Modell einer Totalitt, in die sich widerstreitende
Momente einfinden.
Paradox ist nun, da aus diesem umfassenden Vershnungsprogramm eine
Schule erwchst, die zu den aggressivsten philosophischen Schulbildungen gehrt,
die wir kennen. Eine Schule, die die externen wie internen Strukturen philosophi-
scher Schulbildung angreift, die die Balancen zwischen Schule und Kirche, zwi-
schen Schule und Staat, zwischen Schule und akademischem Konkurrenzraum wie
auch die internen Beziehungen aus dem Gleichgewicht bringt und die einzelnen
Strukturelemente revolutioniert. Kann es sein, da in dieser Philosophie der >Tod
des Vaters< als eine motivierende und herausfordernde Leerstelle gleichsam im
berma vorhanden gewesen ist? Die Aggressivitt der Junghegelianer ist nicht
restlos auf externe soziale Bedingungen zurckzufhren. In der Leerstelle, die
98
Vershnung heit, ist der soziale Grund fr das Drama der Schulbildung und
ihres Zerfalls gegeben.
2. Das Bndnis der Schule mit dem modernen Staat
Die These ist oft wiederholt worden: die Intelligenz des deutschen Idealismus habe
ber der Ausbildung eines apolitischen sittlichen Bewutseins des Einzelmenschen
die Aufgabe aus den Augen verloren, theoretische und praktische Entwrfe fr die
politische Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens einzubringen. Das Prestigebe-
wutsein der bildungsbrgerlichen Intelligenz habe sich an einer geistig-sittlichen
Rangordnung orientiert, die gleichsam unverbunden neben politischen Machtver-
hltnissen aufgebaut wurde. Dabei wird Bezug genommen auf die Spaltung des
Brgertums in Besitz und Bildung und konstatiert, da das politische Interesse des
Wirtschaftsbrgertums in den Ideen der Intelligenz nur einen schwachen Aus-
druck gefunden habe. Fr Mannheim war dies einer der Grnde, in der bildungs-
brgerlichen Intelligenz eine freischwebende Schicht auszumachen.
30
Fr die Junghegelianer am Ausgang des deutschen Idealismus trifft diese These
kaum zu, und zwar nicht erst in dem Moment, in dem sie daran denken, da die
Philosophie Partei ergreifen soll, sondern schon zu einem Zeitpunkt, wo sie sich
primr als philosophische Schule definieren. 1838 schreibt Ruge programmatisch,
es sei nicht ntig, fr die Vernunft Partei zu machen, solange der Staat durch und
durch auf die Verwirklichung der Vernunft gerichtet ist.
31
Nur wenn man von
einem brgerlichen Politikverstndnis ausgeht, kann man Ruges Programm unpo-
litisch nennen. Die Jungehegelianer definieren dagegen ihr Verhltnis zur Politik
als ein Bndnis von philosophischer Schule und modernem Staat.
32
Gehen wir im
folgenden den wesentlichen Argumentationsfiguren weiter nach.
K. Riedels Ausfhrungen von 1840 sttzen zunchst die These vom unpoliti-
schen Charakter der Intelligenz.
Der deutsche intellektuelle Geist scheint die Bestimmung zu haben, das innerste Wesen
der geistigen Menschennatur zu ergrnden und zu reprsentieren. Er sei nach innen
gerichtet, steige in den Schacht des Wissens hinab und wohne in dem so eroberten
Lande ( . . . ) mit heimatlicher Liebe. Entscheidend aber sei, da der preuische Staat diese
Intelligenz in sich als Lebens- und Staatsprinzip aufgenommen habe. Die Lehre, welche
den Menschen als freies, geistiges, sich selbst aus innern Krften bestimmendes, und aus
innern Gesetzen eine Welt konstruierendes Subjekt erfat, sei in das staatliche Handeln
eingegangen. Die Philosophie Deutschlands, seine Seele, gewinnt so einen Leib. Die Zeit
des blo theoretisch glcklich-Seins sei vorbei, und Riedel vergit nicht, den Thesen des
industriellen Brgertums eine klare Absage zu erteilen. Nicht auf Rechnung materieller
Interessen ginge der moderne Staat, so groartiger Umschwung fliet nicht aus dem
Eigennutze, es sei Absicht des Weltgeistes, der, was er dem sinnenden Geiste vertraut hat,
auch im Leben verwirklicht sehen will.
33
Das Bndnis, das Riedel vorstellt, geht schon weit ber die bloe staatliche
Gewhrung einer Sphre legitimer Wissenschaft hinaus, vielmehr hat der Staat ein
legitimes politisches Verhltnis zur Philosophie und die Philosophie ein legitimes
politisches Verhltnis zum Staat: ein Bndnis gegenseitiger Erwartungen.
99
Woher stammt dieses Bndnis? Bleiben wir bei den Selbstdeutungen der Jung-
hegelianer. Hervorzuheben ist hier Ruges Schrift Preuen und die Reaktion
(1838), in der der Versuch unternommen wird, die Genese des Bndnisses histo-
risch-spekulativ zu konstruieren. Das allgemeine Charakteristikum der neueren
Epoche ist fr Ruge, da sich der Geist als eine Macht erprobt. Dabei interes-
siert ihn nicht die ganze Ausbreitung des modernen Geistes, sondern nur sein Mit-
telpunkt, der deutsche Geist, und dieser wiederum nur in seinem Kern, dem prote-
stantischen Deutschland,
34
und d. h. in Preuen. In streng hegelianisch konstru-
ierter Stufenfolge wird nun von Rge dargetan, wie sich der neue Geist zunchst in
der Unmittelbarkeit des subjektiven Gefhls, dann in seinen objektiven Gestalten
in Staat und Kirche und schlielich - als Stufe der Aufhebung - im Bndnis von
Philosophie und Staat darstellt.
Der ehemalige Burschenschaftler Ruge, der wegen demagogischer Umtriebe
mehrere Jahre lang im Gefngnis gesessen hat, rekonstruiert die erste Stufe der
Ausbreitung des modernen Geistes als die der Begeisterung der Freiheitskriege
und der burschenschaftlichen Aufbruchstimmung. Diese Stufe, gleichsam die pri-
mitive Form des modernen Geistes, basiert auf dem Gefhl des vollkommenen
Selbstbewutseins.
35
Hegelianisch gedacht, handelt es sich dabei um eine notwen-
dige, aber auch einseitige Entwicklung: notwendig, weil das freiheitliche Selbstge-
fhl erst einmal ein erworbener Besitz
36
werden mute, und einseitig, denn: das
Schumen, die Phantasie und ihre Trume (. . .) knne nicht ohne weiteres staa-
tenbildnerisch werden, wie sie es allerdings wohl gemocht htten.
37
Interessanter-
weise erfhrt die vom Wiener Kongre ausgehende Restauration bei Ruge eine
explizite Legitimation. Gegen die Begeisterung der Freiheitskriege erhob sich die
Gegenwirkung des besonnenen Staatslebens und seiner wirklichen Entwicklung
auf den neuen im Kriege bewhrten Grundlagen gegen den sich selbst verkennen-
den oder noch nicht begreifenden Geist der Freiheitskriege.
38
In Ruges selbstkritischer Argumentation bestand der Fehler derjenigen, die wie
er auch Opfer der Demagogenverfolgungen wurden, darin: sie verlegten trich-
terweise die wertvolle Sittlichkeit nicht in die Gestalten des wirklichen Lebens, son-
dern in den engen Kreis der vorgeblich gereinigten Jugend. Aus diesem Freiheits-
gefhl als einem ausschlielichen Gemtsheiligtum sei auch Sands Attentat ent-
sprungen.
39
Sinnlos sei eine Opposition aus der Zukunft, die sich an Utopiestaaten
orientiere. Auf dieser neuen Stufe der Erkenntnis ist die Subjektivitt des Freiheits-
gefhls aufgehoben in den objektiven Institutionen. Die Gewalt des Gedankens
und die Macht des Gemtes sind in unwiderstehlichem Bunde.
40
Preuen ist in
dieser Konstruktion ein moderner Staat, dem die Synthese von philosophischem
Freiheitsbegriff und wirklicher Ordnung im Prinzip gelungen ist. Ruge nimmt die
Hegelsche Figur von der Vershnung zwischen Staat und Philosophie auf, wenn er
fordert, das gewonnene Freiheitsgefhl in dem existierenden preuischen Staat
bereits als realisiert zu betrachten.
Was aber begrndet die Fortschrittlichkeit des preuischen Staates 1838? Der
eine moderne Faktor in Preuen, auf den Rge setzt, ist das Militr: weil jeder
Brger Soldat ist, so ist die Soldaten- und die Brgerehre eine allgemeine, nur abge-
stuft durch Verdienst um den Staat.
41
Die egalitr-leistungsorientierten Prinzipien
des preuischen Militrs bestimmen fr Ruge den Charakter des gesamten Staates.
100
Und wenn nun bei uns ein groer Teil des Beamtenstandes im Zoll-, Polizei- und sonstigen
Dienst aus der Armee hervorgeht; so ist die notwendige Folge davon die bertragung dieses
hheren, sittlichen und wahrhaft freien Geistes auf diesen Stand und zwar ist dies eine ber-
tragung durchs Leben und durch die bestimmteste Eingewhnung in die Formen des ehren-
haften Dienstes.
42
Und der zweite moderne Faktor in Preuen? Dem Militr zur Seite tritt das preui-
sche Unterrichtssystem. Das Ministerium Altenstein habe es auf eine solche Hhe
erhoben, da es sogar die Franzosen sich zum Vorbild genommen.
43
Mit einer
geschickt verdeckenden Argumentation werden die historischen Zeitabschnitte
belegt, in denen Preuen versucht, die Oppositionsbestrebungen in seinen Unter-
richtsanstalten niederzuhalten. Jahn und das Turnwesen htten aufgrund ihrer
Fixierung auf blo subjektive Gesinnung einen Geist des Mivergngens berei-
tet, und dagegen habe sich auf Seiten der Regierung der Geist des Mitrauens
geltend gemacht.
Auch die ganze Gelehrsamkeit und Literatur trat sodann allmhlich unter den Gesichts-
punkt des Mitrauens, und es entstanden vielfltige polizeiliche, vornehmlich die Zensur-
maregeln. Sie stellen den Widerspruch im Geist der Gegenwart dar, da einerseits die freie
Wissenschaftlichkeit und die Intelligenz fr das Prinzip des Staates selbst, andererseits der
wissenschaftliche Geist und die Intelligenz fr verdchtig gilt.
44
Aber die Teilung Deutschlands, die verschiedenen Entwicklungsstufen der deut-
schen Staaten, die Uneinigkeit der Zensoren hebe diese Einrichtung (die Zensur,
d. V.) in ihrer Einseitigkeit wieder auf. Die Wissenschaft ist ohnehin ber die
Gesinnung hinaus. Es bestnde, so Ruge, gegenwrtig sowieso eine faktische
Freiheit der Wissenschaft, die auch wohl bald in den gesetzlichen Formalismus
hineingebildet werden wird.
45
Ruge resmiert: Die Zeit des Mivergngens und
des Mitrauens sei im Prinzip berwunden.
46
Besonders aber werde das Vertrauen des Staates auf die freie Wissenschaft
gestrkt, wo diese sich selbst zur Vorkmpferin eines modernen Staatsverstndnis-
ses gegenber romantisch-mittelalterlichen Oppositionsbestrebungen mache.
Rge hat eine freie Wissenschaft im Auge, die nun allerdings nicht blo im
unbefangenen Gewhrenlassen, sondern in der ausdrcklichen Berufung des Staates
ihre Freiheit erblickt.
47
An dieser Stelle wird deutlich, da die Junghegelianer als
philosophische Schule sich nicht allein auf den institutionalisierten Konkurrenz-
raum philosophischer Schulbildung verlassen, sondern zugleich sich im politischen
Bndnis mit dem modernen Staat definieren. Wie bei Riedel wird auch bei Rge die
liberale Opposition aus dem Bndnis ausgeschlossen. Es handele sich um eine
Opposition, welche nur auf der einfachen Unkunde der wirklichen Staatszustnde
ihre Luftschlsser auffhrte.
48
Das Bndnis zwischen Schule und modernem Staat ist jedoch nicht als eine kon-
fliktfreie Beziehung anzusehen.
Denn - wie B. Bauer ausfhrt: Auch die Wissenschaft, das reine Denken geht ber den
Staat hinaus, das Denken kann und mu sogar mit seinen Gesetzen gegen die beschrnkten
Bestimmungen des Staates in Widerspruch geraten, es kann vermge seiner reinen Notwen-
digkeit mit der vernnftigen Notwendigkeit, die im Staate durch die Verwicklung mit natr-
lichen Verhltnissen noch zufllige Bestimmungen an sich hat, in Kollision geraten.
49
101
Aber entscheidend sei, da auf Grund der Bndniskonzeption der Konflikt
keine prinzipielle Staatsgegnerschaft erzeugen knne. Der Staat streitet in diesen
Kollisionen mit sich selber, fhrt darin sein eigenes Interesse aus, denn beide strei-
tenden Mchte gehren ihm an, er ist sie beide. Der moderne Staat hat das philo-
sophische Denken zu seinen innern Angelegenheiten gemacht.
50
Zu diesen innern Angelegenheiten zhlt insbesondere der Bereich, der in der
eingangs skizzierten These als apolitischer Bezugsrahmen bildungsbrgerlicher
Intelligenz gesehen wurde. B. Bauer schreibt: Die Menschlichkeit als solche in
ihrer reinen Unbestimmtheit ist die Wut, die gegen alle positiven Statute sich
emprt, das Ich ist der Dmon, der mit seiner listigen Dialektik alle gesetzlichen
Schranken zernagt. Aber: Der neuere Staat kann alle diese Dmonen und Unge-
heuer in sich ertragen und sie bilden, zhmen und erziehen.
51
Diese Idee vom Erziehungsstaat hat bei den Junghegelianern, wenn sie sich als
Schule definieren, eine weite Verbreitung. So fat z. B. auch He den Staat als
Volkserziehungsanstalt auf, durch dessen Gesetz die humane Bildung gefr-
dert werde.
52
Die bildungsbrgerlichen Werte liegen nicht auerhalb der staatlich-
politischen Sphre, sondern in ihr. Der moderne Staat ist, wie B. Bauer schreibt,
die einzige Form, in welcher die Unendlichkeit der Vernunft, der Freiheit, der
hchsten Gter des menschlichen Geistes in Wirklichkeit existiert.
53
Und Marx
wird noch zu einem Zeitpunkt (1843), als er bereits die soziale Frage reflektiert,
daran festhalten, da gerade der politische Staat, auch wo er von den sozialisti-
schen Forderungen noch nicht bewuterweise erfllt ist, in allen seinen modernen
Formen die Forderungen der Vernunft (enthlt).
54
Die philosophische Schule sieht sich bereits 1838 im Bndnis mit einem solchen
Staat. Ruge schreibt ber Preuen:
Das Reich der Sittlichkeit ist in Preuen zu einer bewundernswrdigen Wirklichkeit gedie-
hen, nirgends wird man das Pflicht- und Rechtsgefhl schrfer, wirksamer und gebildeter
finden, als bei uns, das Beamtenverhltnis dient nur dazu, den Gemeinsinn zu verwirklichen,
man braucht nicht weit nach Sden und Osten zu reisen, um den Unterschied zu erfahren,
ferner das Recht des Staates auf den einzelnen hlt das Militrwesen gegenwrtig und ist eine
wichtige Kur der Feigheit und Philisterei, das Familienleben endlich und das Leben des Ver-
kehrs, wo ist es in wahrerer Gestalt, als eben jetzt bei uns?
55
Das heit nicht, da es keine Bereiche mehr gbe, in denen der moderne Staat
noch auszubauen wre, aber die im modernen Staat enthaltene Vernunft kann
davon nicht tangiert werden: auch wenn ja hin und wieder noch ein drckender
Punkt herausspringt, so liegt in dem ganzen Gang der bisherigen Staatsentwick-
lung die sicherste Brgschaft seiner endlichen Erledigung.
56
Angesicht des Bndnisses von philosophischer Schule und modernem Staat kn-
nen die Denunziationen eines Leo die Schule nicht treffen. So mu sich der Denun-
ziant von Rge fragen lassen, bei wem er die Junghegelianer denunzieren wolle:
doch wohl nicht bei dem Ministerium des Unterrichts, welches die genaueste
Kenntnis nicht nur der Terminologie, sondern auch der Begriffe dieser Philosophie
hat?
57
Leo knne, auerhalb des Bndnisses stehend, die Denunziation doch nur
an sich selbst richten.
102
3. Beamtete Intelligenz
Das Bndnis von Schule und modernem Staat, auf das die Junghegelianer setzen,
ist fr sie ein Modell, das sich bewhrt hat. In den 30er Jahren erobern Schler
Hegels wichtige Lehrsthle in Preuen.
38
Ihre Hauptsttze besitzt die Hegelschule
im preuischen Kultusministerium, das, 1817 als ein selbstndiges Ministerium fr
geistliche und Unterrichtsangelegenheiten gebildet, ber 20 Jahre von dem Mini-
ster Altenstein geleitet wird. Die Verbindung zwischen dem Minister und der
Hegelschule wird durch Johannes Schulze hergestellt. Schulze, der mageblich an
der Schaffung des preuischen Gymnasial- und Hochschulsystems beteiligt war
und zunehmend zur rechten Hand des Ministers wird, hatte sich ganz in den
Zusammenhang der Hegelschule begeben.
59
Um den Erfolg dieses Zusammenspiels zu verstehen, ist es notwendig, daran zu
erinnern, da seit den Karlsbader Beschlssen die innere Situation der Universit-
ten prekrer wurde. Das Klima des Verdachts und der Bespitzelung behinderte die
wissenschaftliche Arbeit ebenso wie die Prozesse der Verwaltung. In solchen sozia-
len Situationen besteht ein vermehrtes Bedrfnis nach direkten persnlich stabilen
Kontakten, nach Loyalitten, die eine Versicherung gegenber wachsenden Kon-
tingenzen darstellen. Die Loyalittsbande der Hegelschule sind festgeknpft gewe-
sen, und ihr Erfolg hat sie noch mehr gefestigt. Darber hinaus besa das Ministe-
rium ber den Hegelianer Schulze einen verllichen Zugang zu den inneruniversi-
tren Auseinandersetzungen, wie umgekehrt die Schule des Schutzes und der Pro-
tektion sicher sein konnte. Es handelt sich um ein Zusammenspiel, mit dem die
Paralysierungen des Verdachts vermieden werden konnten.
ber die Grnde, warum gerade die Hegelsche Philosophie und die Hegelschule
diese bevorzugte Stellung an den preuischen Universitten erhalten konnten, ist
viel nachgedacht und geschrieben worden. Hat der Grnder der Schule sein
System so angelegt, da er zum >preuischen Staatsphilosophen< avancieren
konnte? Hat der preuische Staat in Hegels Philosophie seine Legitimationsgrund-
lage gesucht?
60
Hier ist zunchst darauf aufmerksam zu machen, was die Privilegie-
rung einer Schule soziologisch bedeutet.
Bei dem Konkurrenzraum philsophischer Schulbildung, der universitren Insti-
tution, handelt es sich um ein berraschungen erzeugendes Feld, das unter admini-
strativer Perspektive schwer zu beruhigen ist, und selbst wenn dies in Richtung auf
eine totale berwachung gelingen sollte, trte der Effekt ein, da der Betrieb kaum
noch akzeptable Resultate liefern wrde. Wenn die Verwaltung vom Verdacht
beherrscht wird, da die berraschungen, die diesem Ereignisfeld der Intelligenz
entspringen, sie bedrohen knnten, so bleiben ihr zwei Mglichkeiten: entweder
die Schlieung der Universitt als eines Konkurrenzraumes oder die Kooptation
einer der konkurrierenden Konfigurationen, auf die sie setzt, wie jemand, der eine
Wette mit groem Einsatz abschliet.
Im Konkurrenzraum philosophischer Schulbildung kann die Verwaltung nicht
selbst als Konkurrenz auftreten, ebensowenig kann dort eine Schule berleben, die
sich nur auf Protektion verlt.
61
Whlt die Verwaltung den Weg der Privilegie-
rung einer Schule, so >leistet< sie unter funktionalistischem Aspekt zweierlei: sie
erhlt eine Minimalstruktur von Konkurrenz, und sie steigert zugleich den Kampf
103
der Positionen. So ist der Aufstieg der Hegelschule untrennbar verbunden mit der
Konjunktur von Hegelkritiken und Hegeldenunziationen. Die Privilegierung hat
sie dem Streit nicht entzogen, im Gegenteil, sie hat sie mehr als andere Positionen
in den Streit hineingezogen.
2
Die Frage, welche philosophische Schule sich fr eine Privilegierung >eignet<,
lt sich nach dem Gesagten einfacher beantworten. Weder taugt dazu eine Schule,
die sich als bloes Vollzugsorgan von Regierungsabsichten darstellt, noch eine, fr
die die Verwaltungssphre primr als ein formaler Rahmen in den Blick gert,
weder eine Schule, die der Staatsintelligenz konform huldigt, noch eine Schule, die
den Staat aus dem Bereich der Intelligenz entlt. Was die Hegelschule dagegen zu
bieten hatte, war die ambivalente Figur einer >beamteten Intelligenz< im >auf Intel-
ligenz sich grndenden Staat<.
63
Die ambivalente Figur sttzt sich auf den Topos der Zeit von der >Macht des Gei-
stes< der Preuens Kraft begrnde. Der Topos bezieht sich auf eine ganze Reihe
von Elementen: die Erinnerung an den Philosophen-Knig, die existenznotwen-
dige Toleranz gegenber Konfession, die >Knstlichkeit< der Staatskonstruktion,
die mangels nationalem oder ethnischem Geist immer eines besonderen staatlichen
Geistes bedurfte, die Erinnerung an die Begeisterung der Freiheitskriege. Der
Topos zielt Koselleck zufolge auf einen Geist, der allein die Einheit sicherte,
einem Staat, dem die konfessionelle, ethnische, sprachliche, rechtliche, ja sogar die
geographische Einheit abging. Der ttige Trger dieses Geistes war nun die berufs-
mige Intelligenz, die Beamtenschaft; sie bildete - neben dem Heer - das institu-
tionelle Substrat einer Einheit, die eben nur >im Geiste< lag.
64
Auf diesen Topos bezieht sich Karl Rosenkranz in seiner Hegelbiographie von
1844.
65
Preuen, als ein noch nicht arrondierter Staat sucht seine Nachbarn
zunchst von innen aus, durch ein bergewicht der Bildung, sich ideell zu unter-
werfen. Instinktmig fhlt er die ihm noch fehlenden Elemente heraus und sucht
sie sich anzueignen, wenn sie in bereits fertiger Gestalt auer ihm existieren.
Daher habe auch die Wissenschaft eine weit wichtigere Bedeutung als bei Staaten,
welche sich durch ihre natrliche Lage, durch die nationale und kirchliche Einheit
ihrer Bevlkerung, oder durch groe materielle Hilfsmittel gesichert sehen. Die
Vermittlung der Bildung sei lebensnotwendig fr den preuischen Staat, und so
habe ja auch Preuen aus sich die Kantische Philosophie hervorgebracht. Diese sei
aber durch Hegel vollendet, und so ergibt sich hieraus die hhere Notwendigkeit,
welche Hegels Berufung nach Preuen und die schnelle Einwurzelung seiner Philo-
sophie in demselben bewirkte. Was Manche gern nur als Befriedigung eines Lieb-
lingswunsches des Ministers Altenstein ansahen, war im Grunde das Werk der pro-
gressiven Tendenz des preuischen Geistes.
Der Staat kann sich aber nur auf die >Macht des Geistes< sttzen, wenn er ihn von
den partikularen Interessen der brgerlichen Wirtschaftsgesellschaft und ihren
reprsentativen Ausdrucksformen emanzipiert.
66
Erst der >autonome Geist< kann
zu einer Macht werden. Die Autonomie des >Geistes< spiegelt sich gleichsam in der
Autonomie des Staates, und diese spiegelt jene zurck. Die Intelligenz ist als eine
Macht erst gesichert als beamtete Intelligenz: denn der Beamtenstaat vertritt die
Intelligenz und die Bildung, whrend in den stndischen und reprsentativen Staa-
ten geistig imponderable Elemente zur Geltung kommen.
67
104
Die Figur der >beamteten Intelligenz< im >auf Intelligenz gegrndeten Staat<
beinhaltet zwei Bewegungen. Einmal schreibt sie dem Staat die Aufgabe zu, die
Autonomie von >Geist< gegen die zerspaltenen Interessen der Gesellschaft an ver-
schiedenartigsten Funktionalisierungen der Intelligenz durchzusetzen, anderer-
seits schreibt sie der Intelligenz die Aufgabe zu, unter Berufung auf den Staat als
rechtliche Form fr deren Ausbau und Sicherung Verantwortung zu bernehmen.
Fr die Definition des Verhltnisses der Schule zum Staat bedeutet dies ein
pri-
mres Interesse an der Begrndung von Reformpolitik. Hegelianer und Junghege-
lianer sehen sich in der Tradition der preuischen Reformpolitik als einer Leistung
der beamteten Intelligenz. Ein Konzept philosophischer Schule, die den akademi-
schen Raum nur nutzt, ohne auf die staatlichen Bedingungen der Existenz dieses
Raumes zu reflektieren, kommt fr den Junghegelianer nicht in Frage. Die Figur
einer beamteten Intelligenz vor Augen, begrnden sie eine Reformpolitik, die sich
offensiv von revolutionrer Programmatik absetzt.
So wrdigen die HJ Autoren wie Gervinus, in denen nicht die geringste Sym-
pathie mit den unruhigen hitzkpfigen Wortfhrern der Staatsumwlzung (ist),
welche vom ersten franzsischen Schusse aufgescheucht, aus dem Verstecke her-
vorstrzen, den kahlen Freiheitsbaum aufpflanzen und die rote Mtze schwin-
gen.
68
Und Rge fragt: Wer wird nun irgendeinem vernnftigen Menschen den
Gedanken zumuten, der Veitstanz der Revolution sei ebenso befriedigend, als der
schne Rhythmus der Freiheitsbewegung?
69
Auch fr Buhl ist ein Anknpfen an die Revolution kaum sinnvoll vorstellbar,
denn sie kann nach dem Proze, den sie durchgemacht hat, nicht mehr als gleich-
sam jungfruliches Prinzip begriffen werden. Eine Idee, die so viele Stadien
durchlaufen hat, langt endlich an einem Ruhepunkt an. Es wre zuviel gesagt, wenn
wir ihr die bewegende Kraft absprechen wollten, aber jedenfalls sind ihr die Fang-
zhne ausgebrochen.
70
Die Auseinandersetzungen zwischen Revolution und Legi-
timitt haben im Laufe der Entwicklung zu einer qualitativ neuen Konstellation
gefhrt.
Weder die Revolution noch die Legitimitt haben sich rein zu erhalten gewut, wie das
allen groen geschichtlichen Gegenstzen auf die Dauer begegnet. Beide haben aufeinander
zurckgewirkt. (. .. ) Es fanden Annherungen und Friedensschlsse statt, die auch die Her-
bigkeit der Prinzipien migten. Vor allem aber wurde der Ungestm der Revolution durch
ihren eigenen Fortschritt gemildert. Sie hatten in dem Schreckens-Systeme einen Punkt
erreicht, vor dem sie nur herabsteigen konnte. (. . .); damals verrrauchte die furchtbarste
Wut der Revolution und es wird ihr nie gelingen, sich zu einer hnlichen aufzustacheln, weil
nie wieder dieselben Bedingungen eintreten knnen.
71
Die Revolution existiere nur noch in den Traumgesichtern des politischen Wochenblat-
tes< als blutbefleckte Hyne, als furchtbare Lawine, die jeden Augenblick droht, in die
Ebene niederzustrzen. In der Wirklichkeit stellt sich die Sache anders. Die Revolution hat
ihre Stadien durchlaufen; sie hat die Grundlagen des modernen Staates, welche die ideale
Einheit aller einseitigen Staatsformen ist, aufgerichtet. Sie hat jetzt die Aufgabe, auf diesen
Grundlagen weiterzubauen, die Revolution ist zum konstitutionellen Staate gelangt, und
dadurch aus ihrer angreifenden Position herausgeworfen.
72
Wie in Frankreich Revolution
und Legitimitt koexistieren, so auch auf dem europischen Kontinent. Im Westen hat die
Revolution ihre Herrschaft aufgerichtet, im Osten der Absolutismus in seiner reinsten
Gestalt. Aber zwischen dem revolutionren Frankreich und dem absoluten Ruland liegt
105
Deutschland, welches das Schicksal gehabt hat, wie religis so auch politisch gespalten zu
werden. Deutschland bildet den bergang; hier sind alle Gegenstze vertreten. Hier finden
sich die unbeschrnkte Monarchie und der konstitutionelle Staat in ihren verschiedensten
Nuancen und Abstufungen. Die politische Reform hat denselben Ausgang genommen wie
die Religise: keine von beiden hat sich ganz durchsetzen knnen.
73
In diesem bergangsfeld ist eine Revolution unwahrscheinlich. Beide Prinzipien
seien in eine so eigentmliche Stellung getreten, da der Vorteil nicht auf Seite des
angreifenden Teils, sondern des angegriffenen sein wrde.
74
Auf die preuische
Situation bersetzt heit dies implizit: Bei der gegebenen Figur der beamteten
Intelligenz, in der Revolution und Legitimitt im Prinzip identisch sind, bleibt nur
der Weg der Reformpolitik. Ihr gegenber geraten klassisch revolutionre wie klas-
sisch reaktionre Positionen quasi automatisch ins Abseits.
Ausgehend vom Konzept einer Reformpolitik kann Rge den Begriff Revolu-
tion auf die Bestrebung der >Rechten<, die er unter dem Begriff Romantik
zusammenfat, anwenden. Sie suche berall Pflcke einzuschlagen, an denen sich
die reformatorische Bewegung des freien Geistes brechen soll. (. . .) So fngt die
Romantik die Revolution an. Mit dieser Strategie verlasse die Romantik den fr
Deutschland charakteristischen Weg der Reformen. Was sie betreibe, sei das
kaprizierte Einfhren der sprungweisen, gewaltsamen, aufgeregten Entwicklung
in deutsche Religions- und Staatsverhltnisse.
75
Entscheidender als die Frage, wer angreift und wer sich verteidigt, ist fr Rge
jedoch die Definition des Raumes, in dem Gegenstze ausgetragen werden.
Der Vorwurf des Revolutionierens lt sich immer von der Freiheit auf die Unfreiheit und
umgekehrt hinber und herber schieben; auch auf das Anfangen kommt es nicht an.
Anfangen mu immer das nicht geltende Prinzip. Aber daraufkommt es an, ob der Prinzi-
pienkrieg auf dem Boden des Lebens gefhrt wird, wo er Revolution ist und die ganze Masse
des Volks in Anspruch nimmt mit seinem Fr oder Wider, oder ob er, wie bisher, trotz den
Versuchen der Romantik, das Schlachtfeld zu ndern, auf dem Boden der Wissenschaft und
Theorie bleiben soll, wo er die Reformation ist, und nicht eher das Leben des-Srats und der
Gesellschaft umgestaltet, als bis beide freiwillig die neue Gestalt fr die Wahre erkennen.
76
Reformpolitik durch einen aufgeklrten fortschrittlichen Beamtenstaat, der sich
auf Vorschlge der beamteten Intelligenz stzt, die einem institutionell garantierten
autonomen Konkurrenzraum entspringen und aus einem dort gefhrten wissen-
schaftlichen Prinzipienkrieg siegreich hervorgehen: diese junghegelianische De-
finition des Verhltnisses von philosophischer Schule zu modernen Staat - ist in ihr
vielleicht ein Grundri zu sehen, der nahe bei dem liegt, was Schelsky die Herr-
schaft der Reflexionselite
77
nennt?
Geht die Tendenz der Junghegelianer nicht in diese Richtung, wenn Meyen an
Rge schreibt, da die Regierung in den HJ eine Macht kennenlerne, die ber ihr
steht und vor der sie sich beugen mu, die Macht der nationalen Intelligenz?
78
Die
Junghegelianer greifen ja in ihren Argumentationen nicht zuletzt auf Konzepte der
klassischen Kulturstaatsidee zurck, so etwa, wenn Rge an Fichtes Bestimmung
des Gelehrtenstandes erinnert, die die oberste Aufsicht ber den wirklichen
Fortgang des Menschengeschlechts im Allgemeinen und die stete Befrderung die-
ses Fortgangs sei.
79
Die Kulturstaatsidee birgt auch den alten Traum einer
Abschaffung des Gewaltelements der Herrschaft, wie er in Schellings Forderung
106
zum Ausdruck kommt, den Staat, wo nicht entbehrlich zu machen und aufzuhe-
ben, doch zu bewirken, da er selbst allmhlich sich von der blinden Gewalt be-
freie, von der er auch regiert wird und sich zur Intelligenz verklre.
80
Da es um das Problem der Herrschaft einer Reflexionselite gehen knnte,
haben philosophische Konkurrenten deutlich ausgesprochen. Der frh aus der
Hegelschule ausgetretene Philosoph Hermann Christian Weie, zunchst an einer
Mitarbeit an den HJ interessiert, schreibt bald an Ruge: Gesteht es nur, Ihr Her-
ren, es ist Euch nicht um Denkfreiheit, sondern um Herrschaft im preuischen
Staat zu tun.
81
Was den Vergleich zwischen der junghegelianischen Figur von der >beamteten
Intelligenz< im >auf Intelligenz gegrndeten Staat< und der Herrschaft einer Refle-
xionselite im Sinne Schelskys nagelegt, sind die historischen Bezge, die dieser
selbst anfhrt. Sie sind jedoch - worauf hingewiesen werden mu - in einer spezifi-
schen Weise doppeldeutig und ungeklrt. Auf der einen Seite zhlt Schelsky Fichte
zu den geistigen Ahnen der Klassenherrschaft der >Sinnproduzenten<
82
, auf
der anderen Seite rechnet er gerade die Fichte-Humboldtsche Bestimmung der
Philosophie als Kernfach der Universitt und die philosophische Begrndung
der Dienstleistungen als Staatsdiener zu den produktiven Formen, in denen eine
stabilisierte Spannung zwischen individuell-autonomer Normativitt oder Sitt-
lichkeit und der Entwicklung und gesellschaftlichen Dienstleistung der funktiona-
len Wissens und Erkennens gelungen sei.
83
Was die Schelskysche These von einem Zerbrechen dieser produktiven Form
und einer heute fr ihn bei den Sinnproduzenten sich abzeichnenden politi-
schen Herrschaftsergreifung gegenber der sachlichen Kontrollfunktion des Staa-
tes
84
in ihren historischen Bezgen so schief macht, ist, da er den Kernpunkt der
Figur der beamteten Intelligenz: ihre Bindung an ein reformpolitisches Gesetzge-
bungs- und Verwaltungshandeln des Staates aus dem Blick verliert.
Weder fr Hegel noch fr seine Schler geht es um die Bindung an den Staat als
eine faktische Evidenz, sondern an den Staat als einen Realisator von Vernunft. Da
der Staat und keine andere Institution fr dieses Projekt in Frage kommt, rhrt
nicht allein von der Erinnerung an die preuische Reformra her, vielmehr ist die
Realisation der Vernunftprinzipien Freiheit und Gleichheit weder in der Familie
noch in der Wirtschaftsgesellschaft, noch in der Kirche denkbar, es sei denn, man
wrde staatliche Formprinzipien auf diese bertragen. Fr die Verwirklichung der
Vernunft gibt es berhaupt keinen anderen Ort als den des Staates, mag man sich
ihn als neuen, revolutionr zu schaffenden Staat vorstellen oder den gegebenen
Staat als Reformstaat anerkennen.
85
Fr die Junghegelianer steht die Revolution nicht auf der Tagesordnung, wo sie
sich als philosophische Schule definiert, die sich von anderen dadurch unterschei-
det, da sie sich in der Berufung auf den Staat nicht bertreffen lt. Sie orientieren
sich am Bild Preuens als einem Staat, der modern ist, weil er reformfhig ist, und
er ist reformfhig, weil er die Intelligenz als beamtete Intelligenz zu seinem Struk-
turelement gemacht hat. Die Verwirklichung der Vernunft im Medium des Staates
ist Reform.
So kohrent das Modell eines Bndnisses von Schule und modernem Staat und
die Figur der beamteten Intelligenz auch ist, die Bindung an die Reform erffnet
107
eine spezifische soziale Dynamik, die sich lngs der Frage entfaltet, was denn eine
>Reform< und was >Nicht-Reform< ist. Vor allen inhaltlichen Aspekten, die ver-
schiedenartigster Natur sein knnen, verweist >Reform< auf einen Erwartungshori-
zont. Mit der Abweisung von Revolution als einem vorgestellten Handeln, in dem
sich Ziele beschleunigt erfllen knnten, entsteht mit >Reform< eine Art Zielhem-
mung. Der Horizont mag derselbe sein wie bei der Revolution, aber es mu mehr
gewartet werden. Die Reformtaten verblassen regelmig vor der Reformerwar-
tung, so wie umgekehrt die Revolutionstaten die Revolutionserwartungen so oder
so, d. h. im >Guten< oder >Schlechten<, in den Schatten stellen.
4. Philosophen unter sich
Das platonische Modell, demzufolge der Philosoph Herrscher sein msse, so sehr
es auch bei den junghegelianischen Reformerwartungen Pate gestanden haben
mag, es reflektiert allzu wenig das Problem, das entsteht, wenn mehrere Philoso-
phen bzw. eine philosophische Schule bildende Philosophen sich auf den promi-
nenten Platz kniglichen Handelns hinorientieren. Ein einzelner Denker kann fr
sich leicht in einer souvern handelnden Rolle imaginieren, was er tun wrde, aber
schon bei zwei Philosophen beginnt der Streit, denn der Platz des Knigs ist nur
einmal zu vergeben. Es handelt sich hier um ein soziales Problem, das die Philoso-
phen unter sich zu lsen haben, wenn das Modell des Bndnisses von Schule und
modernem Staat funktionieren soll.
86
Zu den zentralen Charakteristika des Hegelschen Denkens gehrt seine
Umgangsweise mit dem historischen und je aktuellen Sachverhalt widerstreitender
philosophischer Auffassungen. In den >Vorlesungen ber die Geschichte der Phi-
losophie< wendet sich Hegel gegen zwei gelufige Deutungen der Verschiedenheit
der Philosophien. Die einen sehen in der Geschichte der Philosophie lediglich
einen Vorrat von differenten Meinungen, denen man sich gelehrt nacherzhlend
zuwenden oder die man nach dem Ma der eigenen Ansicht als eine Galerie der
Narrheiten bewerten msse.
87
Andere zgen aus der Verschiedenheit der Philoso-
phien den skeptischen Schlu, da das Bestreben der Philosophie nichtig sei.
88
Beide Lsungen sind fr Hegel nicht akzeptabel. Der Skeptizismus bedeute gleich-
sam eine Kapitulation vor der Aufgabe, die Eine Wahrheit darzustellen, und das
Verharren im abstrakten Gegensatze von Wahrheit und Irrtum
89
fhre nicht zu
einem Zustand, in dem die Gltigkeit der Einen Wahrheit mit der Tatsache der
Verschiedenheit der Philosophien vershnt sei. Hegels originelle Lsung besteht
bekanntlich darin, da die Verschiedenheit philosophischer Systeme als Entwick-
lungsproze des Geistes selbst aufgefat wird. Fr Hegel gibt es nicht einfach
einerseits philosophische Wahrheiten und andererseits Irrtmer, vielmehr gehrt
das, was man die Irrtmer nennt, ebenso zum Entwicklungsproze des Geistes wie
die Wahrheiten; ja mehr noch: das Denken, das auf der Scheidung von Wahrheit
und Irrtum insistiert, gehrt selbst einer bestimmten Stufe der Entwicklung des
Geistes an und hat dort ein notwendiges, aber relatives Existenzrecht.
Das Resultat der Geschichte der Philosophie ist fr Hegel:
108
1. da zu allerzeit nur Eine Philosophie gewesen ist, deren gleichzeitige Differenzen die
notwendigen Seiten des Einen Prinzips ausmachen; 2. da die Folge der philosophischen
Systeme keine zufllige, sondern die notwendige Stufenfolge der Entwicklung dieser Wis-
senschaft darstellt; 3. da die letzte Philosophie einer Zeit das Resultat dieser Entwicklung
und die Wahrheit in der hchsten Gestalt ist, die sich das Selbstbewutsein des Geistes ber
sich gibt. Die letzte Philosophie enthlt daher die vorhergehenden, fat alle Stufen in sich,
ist Produkt und Resultat aller vorhergehenden.
90
Fr unseren Zusammenhang ist nicht entscheidend, dem Hegelschen Stufen-
gang im einzelnen zu folgen, vielmehr soll nach den sozialen Effekten gefragt wer-
den, die Hegels Konstruktion fr die Selbstdefinition der Philosophen unter sich
besitzt. Zunchst handelt es sich um ein Programm der Vershnung, es geht nicht
um Ausstoung und Abweisung von philosophischen Auffassungen, sondern um
eine Totalitt, die kein Auen kennt. Die letzte Philosophie ist das Resultat aller
frheren; nichts ist verloren, alle Prinzipien sind enthalten.
91
Die Vershnung
kommt jedoch um den Preis zustande, da den konkurrierenden Philosophien
gleichsam immer schon eine bestimmte Stelle im systematischen Stufengang der
Entwicklung des Geistes sicher ist. So konnte die Hegeische Philosophie gerhmt
werden, den Inhalt der philosophischen Erkenntnis aller Zeiten und aller
Systeme, selbst den scheinbar entgegengesetzten und widersprechenden, in sich zu
vereinigen und den Gang der Entwicklung dieser Erkenntnis fr alle Zeit abzu-
schlieen.
92
So konsequent auch der Vershnungsgedanke durchgefhrt wurde, und so sehr
Hegel auch forderte: man mu sich erheben a) ber die Kleinigkeiten einzelner
Meinungen, Gedanken, Einwrfe, Schwierigkeiten: b) ber seine eigene Eitelkeit,
als ob man etwas Besonderes gedacht habe.
93
- allein schon der Anspruch einer
Vershnung fhrte zu einer feindlichen Polarisierung von Hegelianern und Anti-
Hegelianern - einer Polarisierung, die den Philosophenstreit enorm verschrfte. So
urteilten Zeitgenossen ber die Hegelschule: Schwerlich ist nmlich jemals eine
Schule mit so gebieterischem Anspruch auf Alleinherrschaft, mit so wegwerfender
Verdammung aller Andersdenkenden aufgetreten, wie die Hegelsche.
94
Der mit
der Hegelschule streitende Prager Philosoph Franz Exner trifft das Problem
genauer, wenn er schreibt, zwar bte die Hegelsche Philosophie allerwrts Frie-
den an, und versichert, sie wolle die Gegner wohl gelten lassen: diese aber meinen,
der gebotene Friede sei eben der rgste Krieg, ein halbversteckter nmlich. Man
gestehe ihnen zwar Wahrheit zu, aber eine solche, die eigentlich Unwahrheit ist;
man lasse sie gelten, jedoch nur, indem man sie fr aufgehoben erklrt.
95
Naheliegend ist der Gedanke, das Problem des Hegelschen Umgangs mit kon-
kurrierenden Philosophien im Rckgriff auf religionssoziologische Kategorien zu
lsen und seine Gewiheit der Vershnung im auerphilosophischen Terrain der
Heilsgewiheit anzusiedeln. So entlastend dies Verfahren auch im Moment sein
mag - ich werde im letzten Kapitel darauf zurckkommen -, die philosophische
Gewiheit gehrt zunchst ganz dem Bereich konkurrierender Philosophien an,
und auf diesem Felde wre die Stigmatisierung einer Philosophie als dogmatisch
religis nur das umgekehrte Programm der Hegeischen Vershnungsfigur: nicht
Eingliederung der Positionen, sondern Ausstoung.
In diesem Zusammenhang interessiert vorrangig, wie sich der Hegeische
109
Umgang mit konkurrierenden Philosophien sozial fr diejenigen darstellt, die als
Schler dem Schulgrnder folgen und nun ihrerseits als eine Gruppe von Denkern
das Problem der Konkurrenz lsen mssen. Es sind drei eng miteinander verfloch-
tene Fragen, die die Hegelschule beschftigen: a. Wie lt sich der Proze der
Anerkennung der Hegelschen Philosophie durch die existierenden Philosophen
denken? b. Welchen Status innerhalb des abgeschlossenen Hegeischen Systems
kann eine philosophische Schule haben? c. Wenn mit Hegel der Endpunkt der phi-
losophischen Entwicklung erreicht ist, was sind dann noch die Aufgaben der Hege-
lianer?
a) Die Polemik
Fr Bayrhoffer bedeutet das Auftreten der Hegelschen Philosophie:
nun sei erkannt, da der Begriff und seine unendliche Zentralitt, der Geist, alle Wahrheit
und da die ganze Welt nur die unendlich scheinende Idee ist. Es ist die Materie und die
Weltgeschichte durchdrungen und zum reinen durchsichtigen Kristalle verklrt worden.
Die Hllen und Substanzen der religisen und knstlerischen Formen selbst auf ihren abso-
luten Hhepunkten sind aufgelst worden in die Silberklarheit der reinen Idee.
Erreicht sei ein Zustand der sich wissenden Wahrheit, d. h. konkurrierende
Philosophien sind darin in allen ihren Mglichkeiten enthalten. Auf dieser Versh-
nungsbasis mu die Frage kommen: Warum denn haben nicht sogleich alle diese
Philosophie, welche sich als die Sophia selbst zu wissen behauptet, ja sich als solche
mit immanenter Auflsung aller anderen Gestalten beweiset, anerkannt?
96
Der eigentmliche Zugzwang der Vershnungsfigur erlaubt nur zwei Antwor-
ten: entweder stimmt die Vershnung nicht, sie erweist sich als Schein, als eine feh-
lerhafte Konstruktion, oder es handelt sich um ein Problem von der Art der Zeit-
verschiebung. Die erste Antwort kommt fr die Schule nicht in Frage: der Grnder
hat die Vershnung der konkurrierenden Philosophien vollbracht, sie ist auch kein
Schein, sondern eine wesentliche Grundlage. Was bleibt, ist die zweite Antwort:
die Vershnung ist eine Frage der Zeit.
Die Sicherheit, da die Vershnung bereits als Grundlage vorliegt, knnte zu
einer abwartenden Haltung fhren, aber die Gelassenheit, die ein Philosoph der
sich wissenden Wahrheit an den Tag legen knnte, kommt fr eine soziale
Gruppe, qua Gruppe, nicht in Frage. Sie bedarf der Legitimation fr Aktivitten.
Wie aber kann eine Philosophie, die sich vershnt hat, dafr herhalten?
Die Philosophie der Vershnung ist Bayrhoffer zufolge zugleich eine neue
Gestalt der Philosopie, und sie hat den Kampf gegen die anderen unmittelbaren
Formen zu bestehen, gegen das Leben wie die Wissenschaft.
97
Man msse einsehen, da der Weltgeist in den Momenten seiner neuen tiefsten Ausgebur-
ten allerdings in dem Kampfe der bestehenden mit den neuen Gestaltungen sich entwickelt,
und da so jede neue geistige weltgeschichdiche Geburt, wie die physische, nur der Phnix
ist, welcher aus den Weltwehen und Weltschmerzen emporsteigt, insofern er sich als neue
Gestalt gegen alle frheren vorausgesetzten Formen nicht nur positiv, sondern zugleich
auch negativ wendet, so da er nun, indem jene Formen gleichfalls ihn zu negieren streben,
sich in den Kampf mit denselben verwickelt.
98
110
Implizit wird damit die Vershnungsfigur auf den Kopf gestellt, indem sie zeit-
lich anders lokalisiert wird. Hervortritt eine Metaphorik des Kampfes, die einer
schlielichen Vershnung dienen soll, aber ebenso >unvershnend< ist wie die
Kriege, die gegen den Krieg gefhrt werden.
Wo aber bleiben in dieser Konstruktion die anderen Philosophien, deren Recht
doch immer noch im Rahmen der Vershnungsfigur zu begrnden wre, auch
wenn die Vershnung zeitlich anders lokalisiert wird? Eine bloe Abweisung oder
Verfemung der Konkurrenz wrde die Idee desavouieren, da die >neue< Philoso-
phie in der Tendenz doch vershnen kann. Es gilt, ein Verfahren zu entwickeln, mit
dem die Kritik an der >neuen< Philosophie als zu dieser schon mit dazugehrig
betrachtet wird. Diese Verwandlung der Feinde in unfreiwillige Helfer ist die Iro-
nie des Weltgeistes und der absoluten Idee, sie besteht darin, da die Richtun-
gen, welche die Philosophie ber den Haufen zu werfen vermeinen, doch im letzten
Resultate ihr den Thron bereiten mssen.
99
Diese seltsame Figur ist nicht leicht zu
erklren. Warum mssen die der neuen Philosophie der Vershnung entgegen-
stehenden Philosophien dieser einen zum Siege verhelfen, in der sie enthalten sind?
Man knnte diese argumentative Figur durchaus mit der psychoanalytischen
Deutung des Widerstands vergleichen, derzufolge die Heftigkeit des Widerstandes
nicht etwa die Erkenntnis, der der Widerstand gilt, widerlegt, sondern vielmehr
besttigt. Die Verwandlung der Feinde in unfreiwillige Helfer erfolgt ber eine
Reflexion der unbeabsichtigten Folgen philosophischen Handelns<. Jede Positio-
nalitt gibt in ihrer Richtung als unbeabsichtigten Effekt zugleich die Gegenrich-
tung mit an. Sie steht nicht nur fr sich, sondern zugleich fr das, wogegen sie sich
richtet. Diesem Zwang entgeht keine Philosophie. Aber eine Philosophie, die dies
wei, kann die unbeabsichtigten Folgen philosophischen Handelns< fr sich und
gegen andere besser nutzen. Sie tut dies, indem sie sich selbst polemisch macht, sich
auf die Ebene ihrer Gegner stellt, sie zum Streit herausfordert, um den Widerstand,
den sie hervorruft, als Zeichen ihrer Kraft sich anzueignen. Diese Zauberei kann fr
sie funktionieren, weil sie wei, da im polemischen Kampf mit den Richtungen
zugleich die Gegenrichtungen wachsen.
Der beabsichtigte Effekt dieses Verfahrens ist eine Steigerung der Polemik, die
keineswegs von der Vershnung wegfhrt, sondern gleichsam den Knigsweg zur
Vershnung darstellt. So erffnet J. Schaller eine Rezension in den JWK:
Jede wissenschaftliche Zeitschrift hat schon dadurch eine polemische Tendenz, da sie ein
bestimmtes Prinzip vertritt, und dies als ein wesentliches und fr den geistigen Standpunkt
der Zeit bedeutsames nach auen hin geltend macht. Und sollte auch die Tendenz einer
Zeitschrift vorzugsweise die Vermittlung und Vershnung der Gegenstze sein, so kann sie
doch diesen Zweck nur durch den Besitz eines Prinzipes erreichen, welches jene Gegenstze
als solche aufhebt und als einseitig nachweist; denn das bloe Nebeneinanderstellen und
Geltenlassen der Gegenstze oder die freundschaftliche Behandlung, welche sich dieselben
gegenseitig zukommen lassen, und die Behutsamkeit oder auch Mutlosigkeit, ihre Differenz
in aller Schrfe herauszustellen, kann so wenig fr eine wirkliche Vershnung angesehen
werden, da es vielmehr nur ein Abstumpfen und Verflachen der Gegenstze und somit das
krftigste Mittel gegen die Vershnung ist.
100
Was Schaller macht, ist ein virtuoses Ausspielen der unbeabsichtigten Folgen
>philosophischen Handelns< gegenber seinem Gegner - ein Ausspielen, dessen
111
Pointe auch darin besteht, da er in den von Hegel gegrndeten JWK
101
durch
Erffung einer Polemik, die auch auf ihn und diese Zeitschrift umkehrbar ist, eine
andere hegelianische Konkurrenzzeitschrift, die sich auf die Vershnungsfigur
beruft, auf die unbeabsichtigten Effekte dieser Figur verweist, um so durch die
Polemik hindurch gerade diese Figur zu retten.
Fr Schaller ist die Polemik ein notwendiges Moment in der philosophischen
Entwicklung und wird mit dieser bestehen und aufhren.
102
Um so wichtiger ist es
fr ihn, Kriterien fr ihre Form zu errtern. Seine berlegungen zu Verhaltensre-
geln fr Beurteilungen und zur Abfassung von Polemiken knnen als paradigma-
tisch fr die Standards der Schule in dieser Frage gelten. Insgesamt zielen sie auf
eine Enttabuierung polemischen Verhaltens.
So zhlt fr ihn die Versicherung, da es einem Verfasser allein um die Sache
gehe, wenig, da dieses Versichern des sich von selbst Verstehenden unwillkrlich
zur Vermutung des Gegenteils auffordert. Auch in diesem Bereich wirke der
unbeabsichtigte Gegensinn. Die Berufung auf gewisse Gesetze des Anstands, die
jeder Gebildete des neunzehnten Jahrhunderts fr heilig achten msse, greife
kaum, da doch jeder die Erfahrung mache, da entweder diese Gesetze sehr vage
sein mssen oder da man sich eine bertretung derselben so sehr hoch gerade
nicht anzurechnen geneigt ist. Die Forderung, in der Polemik die Person von der
Sache zu trennen, sei eine seltsame Prtention, denn wenn es erlaubt ist, die
Sache platt, drftig, schal zu nennen, so sind natrlich die Inhaber der Sache,
wenigstens in diesem Falle, auch wenn man es nicht sagt, schale, drftige Kpfe.
103
Auch fr B. Bauer ist die Polemik gegen die wissenschaftliche Persnlichkeit
gerechtfertigt, denn in der Person hat es der Polemiker zugleich mit einer Form
des allgemeinen Bewutseins zu tun. Und weitergehend:
Rein persnlich mte der Kritiker in dem Falle werden, wenn die wissenschaftliche Per-
snlichkeit, die er charakterisiert, durch eigene Schuld, weil sie nur eine Meinung reprsen-
tiert, keine allgemeinere Bedeutung hat und nur Gegenstand der Kritik werden kann, um in
ihrer Bedeutungslosigkeit dargestellt zu werden.
104
Festzuhalten ist, da im Bereich des Hegelianismus die Polemik nicht als eine
bloe Randerscheinung philosophischer Arbeit gilt, vielmehr erfhrt sie eine
bedeutende Aufwertung: Die Polemik stellt als Kritik gleichsam die Seite philoso-
phischer Arbeit dar, bei der es um den Kampf um die Anerkennung der Resultate
der Philosophie geht. Diese Anerkennung kann die Philosophie fordern, weil sie
nicht jenseits der Polemik steht, sondern weil, wie Schaller formuliert: jedes philo-
sophische System nicht nur nach auen, sondern in sich selbst polemisch (ist),
indem es nicht nur ein abstraktes Resultat, eine einfache Versicherung aufstellt,
sondern ein konkretes, sich selbst beweisendes Ganzes ist.
105
Die Polemik ist in
dieser Zuspitzung eine Bewegung, die das gesamte Feld der konkurrierenden Phi-
losophien durchzieht. Sie macht weder halt an der Grenze einer Person, noch an
der Grenze einer Lehre.
b) Selbstdefinition der Schule
So sehr auch die Existenz philosophischer Schulen eine geschichtliche und soziale
Tatsache ist, nicht selbstverstndlich ist, da Philosophien zur Schulbildung ein
112
positiv begrndetes Verhltnis entwickeln. Wo die Hegelianer dies tun, haben sie
sich zunchst damit auseinanderzusetzen, die Schulbildung vom Geruch einer bor-
nierten akademischen Cliquenwirtschaft zu befreien. Die landlufige Karikatur
einer Schule skizziert Schaller:
Zu einer Schule gehrt einmal, da die Schler nicht Anhnger des Systems sind, sondern
Anhnger des Lehrers, da sie also seine Worte auf Treu und Glauben annehmen und dar-
auf schwren, da sie lernen nicht etwa das System verstehen, sondern in den Formeln des-
selben sich bewegen und diese bestmglich streng und ohne Abweichung nachschwatzen.
Ferner gehrt dazu, da der Lehrer nicht blo diese Stockblindheit duldet und ertrgt, son-
dern er mu selbst stockblind sein, und in ser Eitelkeit von seiner Infallibilitt berzeugt,
keinen Zweifel und Widerspruch dulden, sondern auf diese Ketzereien ein fr alle Mal einen
Bann legen. Drittens ist aber ntig, da der Meister ffentlich Lob gegen die Schler aus-
spricht, und die Schler wieder den Meister mit begeisterter Salbung loben, und unter sich
selbst, sich an den Schlagwrtern kennen, sich jubelnd empfangen und die Hnde reichen
und zur Teilnahme an der geoffenbarten Weisheit Glck wnschen. Endlich aber haben
Meister und Schler zusammenzutreten und allen anders Denkenden einen Kampf auf
Leben und Tod anzukndigen. Jeder, der nicht die Schuluniform trgt, ist ein Feind und der
Kampf ist nicht schwer, denn die Feinde sind - a priori - insgesamt blessiert, hinkend und
krank.
106
In dieser Karikatur sind eine Reihe von Elementen versammelt, die wir schon aus
Tiryakians moderner idealtypischer Schuldefinition kennen und die auch in Scho-
penhauers Kritik der Philosophieprofessoren eingegangen sind.
107
In Schallers
Entkrftung der Karikatur sind fr uns zwei Komplexe von besonderer Bedeutung,
die einer Aufwertung des Phnomens philosophischer Schulbildung in der Regel
im Wege liegen und die reflektiert werden mssen, wenn eine befriedigende Selbst-
definition der Schule vorgeschlagen werden soll. Es ist dies das Problem der Uni-
formitt und das der Hierarchie, die, wo sie auftreten, die Produktion von Wahr-
heit behindern oder verknappen knnten.
Schaller verteidigt die Notwendigkeit der Schule, indem er sich zunchst dage-
gen wendet, das Streben nach einer Einheit in der Sache fr leere gedankenlose
Nachbetung zu halten.
108
Die kollektive Orientierung hat einen klaren Vorrang
vor dem Streben nach Originalitt.
Die Forderung der Originalitt macht die Philosophie zur subjektiven Meinung des einzel-
nen Individuums. Indem jeder lernt, um nur fortzuwerfen, treibt jeder fr sich ein besonde-
res Geschft; die Wahrheit als der allgemeine Inhalt jedes Bewutseins ist dann ein ganz lee-
res Wort, und nicht nur das Fleisch, sondern der Geist selbst ist durch und durch Egoist und
die Zersplitterung in lauter inhaltslose Punkte sein Wesen und seine Bestimmung.
109
Ebenso weist Ruge den Vorwurf zurck, die HJ htten keine philosophische
Berhmtheit gemacht, sondern alles nur der Schule, der Innung zu Gute kommen
lassen<, es sei dies gerade das grte Lob: keine Berhmtheiten zu machen, son-
dern nur das freie philosophische Prinzip, die Methode und den Begriff der histo-
rischen und logischen Dialektik vorauszusetzen, Dinge, die fr Ruge den Begriff
Schule ausmachen.
110
Die Kollektivitt der Schule ist jedoch erst dann adquat begrndet und vom
Geruch der Uniformitt befreit, wenn sie in eine notwendige Verbindung mit der
Ttigkeit des Philosophierens selbst gebracht werden kann. So schreibt Schaller:
113
Wre die Philosophie, wie sie zunchst ein einsames Geschft des einzelnen Individuums
ist, weiter nichts als die Meinung eines einzelnen, so knnte man allerdings fordern, da
jeder Philosoph eine solche Meinung fr sich haben solle; daran knnte sich aber zugleich
die andere Forderung anschlieen, da er diese Meinung fr sich behalten und die anderen,
die auch eine solche htten, oder sie bald erwerben knnten, nicht weiter damit inkommo-
dieren mchte.
111
In der philosophischen Ttigkeit liegt aber eine Orientierung auf eine Kommuni-
kationsgemeinschaft, die nicht mit der Trivialitt zu beruhigen ist, da in allen
philosophischen Systemen doch etwas Wahres sei.
112
Philosophischer Fortschritt
bedarf der Definition. Dies >tut< in der Hegelschen Philosophie bekanntlich der
Weltgeist, und nicht Jeden kann das Glck treffen, der vom Weltgeist Auser-
whlte zu sein, die philosophische Erkenntnis in wesentlichen Punkten weiterzu-
fhren, und einen neuen hheren Standpunkt des Wissens zu erreichen.
113
Bei
dem Glck, einen wissenschaftlichen Fortschritt zu tun, handelt es sich um ein
kontingentes Ereignis. Aber es ist notwendig, auf dieses kontingente Glck zu
vertrauen. Ohne das Bewutsein, einen wissenschaftlichen Fortschritt errungen zu
haben, entfiele der Grund fr die Aufstellung von Thesen, das Schreiben philoso-
phischer Bcher usw.
Wenn nun ein Philosoph mit dem Bewutsein auftritt, einen Fortschritt errungen zu
haben, so knpft sich notwendig an dieses Bedrfnis sogleich die Forderung, da sich
andere ihm anschlieen, und zwar nicht an ihn als das einzelne Individuum, sondern viel-
mehr an die Sache (. . .). Und zwar ist die Sache ein ganz bestimmter Inhalt, und das
Anschlieen an dieselbe hat nicht die leere Bedeutung, da andere nur mitphilosophieren,
zur Erkenntnis der Wahrheit auch das Ihrige beitragen; ebensowenig wie einem Philoso-
phen einfallen kann, durch sein System weiter nichts als anregen zu wollen, sondern er gibt
vielmehr ein positives Resultat - dies behauptet er als die Wahrheit, und nicht blo, da es
mit der Philosophie im allgemeinen eine schne Sache ist.
114
Die schne Sache der Philosophie im allgemeinen, das Anregen und Mit-
philosophieren bezieht sich indifferent auf alle im Konkurrenzraum der Philoso-
phie Versammelten. Schule dagegen ist ein Medium zur Verstrkung der Konkur-
renz, indem von dem vorgetragenen Paradigma eine Aufforderung ausgeht, sich
entweder als Konkurrent zu verhalten oder sich das Paradigma anzueignen. Von
daher ist es fr Schaller ein unproduktives philosophisches Verhalten, wenn Philo-
sophen, wie der Pseudohegelianer Fichte, bei der Ankndigung seines Systems
erklren, da es ihm nicht einfalle, dadurch auch eine neue Schule stiften zu wol-
len, sondern da er sich diese Art Anhang geradezu verbitte. Im Widerspruch
stnde dazu, da jede philosophische Darstellung zugleich den Zweck habe, den
Leser zum Verstndnis zu zwingen, und ihn fr jetzt wenigstens zu seinem Anhn-
ger zu machen.
115
Die Schulbildung uniformiert die Positionen nicht, sie formiert
die Positionen, die sonst uniform, d. h. blo vereinzelt indifferent und streitlos
nebeneinander bestnden. Daher sei die philosophische Schule als ein notwendi-
ges Moment in der Entwicklung der Philosophie anzuerkennen.
116
Die Karikatur der Hierarchie zwischen einem Lehrer und nachplappernden
Schlern entkrftet Schaller, indem er zunchst gegenber einem aschulischen,
geistreichen Philosophieren darauf insistiert, da die Philosophie wie die ande-
ren Wissenschaften auch gelernt werden msse.
117
Auf schulisches Lernen sei nicht
114
zu verzichten. Erst von diesem Ausgangspunkt aus entfaltet sich die Spannung zwi-
schen der Forderung selbstndigen Denkens und der Notwendigkeit des Lernens.
Die Schule ist eine Institutionalisierung dieser Spannung. Die Lehrer-Schler-
Hierarchie soll entsprechend der oben skizzierten Idee des christlichen Lehrers
sukzessiv aufgehoben werden. Wie ist aber eine Schuldefinition aufrecht zu erhal-
ten, wenn die Emanzipation vom Lehrer mit zum Schulprogramm zhlt? Fr
Michelet ist im Bezug auf die Arbeiten der Schler selbstverstndlich: Ohne
Abweichungen von Hegeischen Stzen wird es dabei nicht abgehen knnen, ja in
manchen Punkten ist ein Teil der Schule ber dergleichen schon einig; und sie wer-
den sich immer noch hufen.
118
Die Einheit der Schule sieht Michelet im Festhal-
ten an der absoluten Methode gesichert.
Solche fortschreitende Entwicklung der Philosophie ist aber keine Aufstellung eines neuen
Prinzips; der Hegeische Standpunkt, da er alles preisgibt auer der Methode, enthlt viel-
mehr in sich die Mglichkeit weiterer Ausbildung nicht blo als Geduldetes, sondern
scheint sogar dazu aufzufordern. Und die nderungen im einzelnen, weit entfernt, den gan-
zen Standpunkt zu gefhrden, werden nur dazu dienen, ihn immer mehr zu besttigen; denn
die Quelle, aus der sie hervorgehen, die Methode, ist unversiegbar und in ewiger Jugendfri-
sche stets dieselbige.
119
Lst Michelet das Problem des Schlerfortschritts gegenber dem Lehrer durch
die, nebenbei bemerkt, wenig hegelianische Trennung von Methode und Anwen-
dung (Hegel: die Methode ist nichts anderes als der Bau des Ganzen in seiner rei-
nen Wesenheit aufgestellt
120
), so kommt Schaller zu der Auffassung:
Indem aber die Philosophie ihrem ganzen Wesen nach produktiv ist, so treibt die durch die
Zucht des Lernens und durch die Besitznahme der Sache errungene Selbstndigkeit not-
wendig ber die Reproduktion des Gegebenen hinaus. Man kann so allerdings sagen, da
jeder wahre Schler darauf bedacht sei, ber das System seines Meisters hinauszugehen;
allein dies ist kein uerlicher Vorsatz, der ohne weiteres mit dem Fortwerfen der Lehre der
Schule beginnen knnte, sondern fllt mit dem freien Besitz der Sache zusammen.
121
Dieses notwendige Hinaustreiben ist ein konfliktreicher Proze, bei dem die
Konfigurationen der Schule im Konkurrenzraum philosophischer Schulbildung
innerschulisch sich wiederholen. Wenn ein Lehrer die Auffassung seines Schlers
mibilligt, so liegt darin zunchst weiter nichts, als da die Systeme beider wirk-
lich verschieden voneinander sind; der Proze der Scheidung liegt jedem vor
Augen.
122
Wollte man dem Richterspruche des Meisters eine unbedingte Autori-
tt zugestehen, sicherlich wre die Entwicklung der Philosophie mit einem Male
gehemmt.
123
Die Voraussetzung fr eine Anerkennung der Abweichung der Sch-
ler als progressive ist lediglich die vollstndige Besitznahme des schon errungenen
Resultats.
124
Aber jeder freie Besitz der Sache ist schon ein Darber-hinausgehen.
So, wie die Philosophie der Vershnung die konkurrierenden Philosophien in sich
aufnimmt und >aufhebt<, so hat der Schler, der sich das System seines Lehrers
angeeignet hat, zugleich dieses System fr sich >aufgehoben<. Zur Schule selbst
gehrt daher konstitutiv der Fall, da es gerade die eifrigsten Schler und Anhn-
ger der Lehrer und Meister sind, welche die Erkenntnis zu einem hheren Stand-
punkt fortfhren, und somit als Gegner ihres Lehrers auftreten.
125
Die Konflikttoleranz ist in der Hegelschule enorm ausgeweitet. Die Argumenta-
115
tionsfiguren laufen darauf hinaus, in einer uersten dialektischen Anspannung
das, was als Zerfall der Schule gelten knnte, zum Integrationspunkt umzubiegen.
So sehr die Schule gefeiert wird als unverzichtbares Moment philosophischen Fort-
schritts, dem Paradigma der absoluten Philosophie nach, auf das auch die Schule
sich bezieht, ist >Schule<: eine Beschrnktheit, welche sie selbst als zugleich aufge-
lst wei und bestndig auflst.
126
c) Aufgaben der Schule
Das Problem, die Aufgaben der Schule zu definieren, stellt sich fr die Hegelianer
radikal mit dem Tod des Lehrers. Dies so pltzliche Ereignis ist allerdings ein
Moment der Scheidung und der Krise fr die Schule gewesen, schreibt Miche-
let.
127
Zu Hegels Lebzeiten war die Aufgabenstellung durch die Anwesenheit des
Lehrers gesichert: In kompakter Masse um den Meister gedrngt, verfocht sie (die
Schule, d. V.) die Absolutheit des Erkennens.
128
Das Problem der Aufgaben nach
Hegels Tod ist fr die Hegelianer deshalb so gravierend, weil es ja der Anspruch
Hegels war, das Ende und den vershnenden Abschlu des philosophischen Streits
darzustellen.
Der Logik dieses Anspruchs folgend, war die erste Aufgabe der Schule, sich um
die Edition der Schriften des Lehrers zu kmmern, ein Projekt, das 1832 beginnt
und 1845 abgeschlossen ist. Was aber soll ein Fortschritt ber Hegel hinaus sein?
Sicher blieb der Schule die Aufgabe, den Proze einer Anerkennung Hegels mit
den Mitteln der Polemik und der Kritik weiterzufrdern, und diese Aufgabe wird
auch immer wieder hervorgehoben. Es handelt sich hierbei gewissermaen um eine
Art Daueraufgabe, es knnen nmlich immer noch, nach Aufstellung desselben
(des wahren Systems, d. V.), Philosophien mit einseitigen Prinzipien auftauchen,
die aber nur ein Stehenbleiben auf irgend einer untergeordneten Stufe in ihm
sind.
129
Dennoch bleibt die Frage, wie ein Fortschritt ber Hegel hinaus aussehen
knnte. Es wre verwunderlich, wenn Dialektiker aus dieser Verlegenheit keinen
Ausweg fnden. Michelet, einer der ergiebigsten Chronisten der Schule, glaubt,
da ein Hinausgehen ber das absolute System Hegels nicht mglich sei, aber
daraus folge
doch noch keineswegs, da darum alles wahrhafte Leben aus der Geschichte der Philoso-
phie verschwunden, oder ein Kampf um Prinzipien nicht mehr ausgefochten werden knne.
Nicht also aufgehrt hat die Geschichte der Philosophie mit Hegel; sie hat nur eine andere
Gestalt angenommen.
130
Michelet denkt an einen qualitativen Sprung. Die andere
Gestalt setzt gleichsam voraus, da die negative Aufgabe der Schule, die Polemik, den
Erfolg zeitigt, da allmhlich der Prinzipienstreit auf dem Boden der Wissenschaft ver-
schwinde, um Raum zu schaffen fr die positive Entwicklung der Wissenschaft (. . .),
indem sie nicht mehr in neue Prinzipien auseinanderzufallen braucht.
131
Zur Aufgabe wird
auf dieser Stufe eine die Philosophie berschreitende Ausbildung des Systems der Wissen-
schaft.
132
Weit entfernt, da es mit der Philosophie zu Ende geht, fngt sie, knnen wir
sagen, erst jetzt recht an.
133
Und: Die Aufgabe der Hegelschen Schler ist daher vorzugs-
weise, da jeder in seiner Wissenschaft die Bahn, die Hegel in allen gebrochen, weiter ver-
folge und den spekulativen Gedanken immer tiefer in die Wirklichkeit versenke, oder viel-
mehr aus ihrem Schachte zu Tage frdere.
134
116
Die Aufgabenformulierung ist doppeldeutig. Sie kann so aufgefat werden, da
die Hegeischen Prinzipien in den verschiedenen universitren Disziplinen zur
Anwendung gelangen sollen, es handelte sich dabei um eine berschreitung der
Disziplin der Philosophie in die anderen Wissensbereiche. Und Michelet selbst ten-
diert sicherlich in diese Richtung. Aber die Forderung, den spekulativen Gedanken
immer tiefer in die Wirklichkeit zu versenken, kann auch interpretiert werden als
eine berschreitung des gesamten universitren Bereichs hin zu einer Ausbreitung
Hegelscher Prinzipien in andere Sektoren der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Bei
Bayrhoffer wird diese Interpretation der Aufgaben der Hegeischen Schule deutli-
cher. Es geht ihm um
ein konkretes Durcharbeiten der in Hegel gegebenen Grundlage der absoluten Idee durch
alle Wirklichkeit der Natur wie des Geistes, ein Sichselbstbestimmen und Konkreszieren
der Idee bis zu den Einzelmomenten des Begriffs und seiner Verwirklichung. Dadurch wird
die Philosophie, der Gedanke vollends die Macht des Lebens und damit der Drang der Zeit
befriedigt.
135
Der Jungehegelianer Bayrhoffer stellt der spezialwissenschaftlichen Aufgaben-
stellung: Einzelmomente des Begriffs das Desiderat der Verwirklichung der Phi-
losophie zur Seite. Die Doppeldeutigkeit der Durchfhrung: Durchfhrung der
Philosophie im Ensemble universitrer Disziplinen oder Durchfhrung der Philo-
sophie im gesellschaftlichen Leben, deutet eine Bruchstelle in der Aufgabenstel-
lung der Schule an, die Althegelianer und Junghegelianer trennen wird. Aber fr
die Schule im Bndnis mit dem modernen Staat ist diese Doppeldeutigkeit kein
Problem, denn sie kann sich in die reformpolitische Aufgabenstellung der beamte-
ten Intelligenz ohne Irritationen einschmiegen. Die gedankenvolle Bearbeitung
des Stoffes, die E. Gans in seinem Hegel-Nekrolog zur Aufgabe der Schule erklrt
hatte,
136
entspricht den Ttigkeitsmerkmalen der beamteten Intelligenz, die die
>Macht des Geistes< im Staatsleben durchfhrt.
5. Erwartungen
Will man den Erwartungshorizont der philosophischen Schule prziser fassen, so
ist zunchst an die beruflichen Erwartungen zu denken. Die Junghegelianer erwar-
ten fr sich Karrieren als Teile der beamteten Intelligenz: Koppen, Rutenberg, Stir-
ner, Witt haben Lehrerexamen abgelegt; Bayrhoffer, B. Bauer, Feuerbach, Gott-
schall, Marx, Nauwerck, Prutz, Rge erwarten fr sich eine Karriere als Universi-
ttsprofessoren. Fr eine ganze Reihe von Junghegelianern handelt es sich bei die-
ser beruflichen Orientierung zudem um die Erwartung eines sozialen Aufstiegs
durch Bildung.
Rckenwind erhlt diese Erwartung durch die Erfahrung des rapiden Ausbaus
des preuischen Unterrichtssystems vor allem in den 20er und 30er Jahren. Von
1816bis 1846 steigt die Zahl der Volksschler um 108 %.
137
Die Berliner Universi-
tt zhlt im Sommer 1820 910 Studenten, im Winter 1833/34 sind es 2001. Seit die-
ser Zeit geht zwar die Gesamtzahl kontinuierlich zurck, aber die Entwicklungen
sind in einzelnen Fchern unterschiedlich. Whrend die Zahl der Theologen bis
117
1830/31 dramatisch steigt (641), um dann kontinuierlich abzufallen (1835: 509/
1840: 396/1845: 267), ist die Zahl der Philosophen durch ein stetiges Wachstum
gekennzeichnet. (1830: 241/1835: 291/1840: 360/1845: 425)
138
Mit ihrer beruflichen Orientierung auf die Beamtenkarriere sind die Junghege-
lianer Teil einer umfassenden Entwicklung, die auch von den Zeitgenossen
bemerkt und zum Teil skeptisch betrachtet wurde. So schreibt Wessenberg 1833:
Nicht ohne Grund hat man, besonders in den neuesten Zeiten, ber zu groen Zudrang von
minderfhigen Jnglingen an den Universitten geklagt. Die Hauptursache dieses Zudrangs
liegt nicht in dem Reize der Wissenschaft, sondern in dem Reize des bequemeren, behag-
licheren Lebens, in einer mit Staatsbesoldung verbundenen Anstellung. Dieser Reiz wurde
durch die ausnehmende Vervielfltigung der Werkzeuge der Staatsregierung sehr vermehrt.
Jeder mchte nun lieber an der reich besetzten Tafel der Brokratie mitgenieen.
139
In liberalen Kreisen wird diese Entwicklung sorgsam registriert. Der Altonaer
>Freihafen< bemerkt 1840, da die groe Zahl der Studenten unmglich in den
Staatsdienst aufgenommen werden knne.
Auf der einen Seite wird der Drang der Jugend nach Bildung immer grer und auf der
andern nehmen die Mittel zu einer ehrenvollen Stellung fr gebildete Stnde im Staate
immer mehr ab. Um diesen knstlichen Zustand so wenig gefhrlich als mglich zu machen,
bleibt nichts anderes brig, als nicht nur alle Nahrungsquellen der Gewerbe und der Indu-
strie ohne irgendeine ngstlichkeit freizugeben, sondern auch den Industriellen einen
ebenso hohen Rang, als den Staatsbeamten und dem Adel einzurumen.
140
Fr die Mehrheit der Junghegelianer liegen diese berlegungen unterhalb der
Wahrnehmungsschwelle. Fr sie ist entscheidend, da das Bndnis von Schule und
modernem Staat erhalten bleibt.
Die groe Erwartung richtet sich auf das Jahr 1840. Es handelt sich fr die
Gruppe um ein symbolisches Jahr in mehrfacher Hinsicht. Es hat seine Bedeutung
schon im Voraus durch eine zahlenmystische Erwartung, es gewinnt eine zustzli-
che Bedeutung durch die Ereignisse, die in dieses Jahr fallen, und schlielich wer-
den die Erwartungen des Jahres 1840 in die Gruppengeschichte so inseriert, da sie
die Qualitt eines Mythos erhalten.
Auf das Jahr 1840 wird als ein bedeutendes Jahr gewartet. Die 400-Jahrfeier der
Erfindung der Buchdruckerkunst, die als Beginn der modernen Zeit gilt, spielt
dabei eine geringere Rolle als die wachgehaltene Erinnerung daran, da mit der
Jahreszahl 40 entscheidende Wendepunkte der preuischen Geschichte verbun-
den sind. 1440 das Todesjahr des ersten Kurfrsten von Brandenburg, 1540 die
Reformation in Preuen durch Joachim II., 1640 der Regierungsantritt des groen
Kurfrsten, und 1740 die Thronbesteigung Friedrich des Groen.
141
Drei Jahre spter, 1843, wird K. R. Jachmann die zahlenmystische Fixierung auf
das Jahr 1840 in Zweifel ziehen und fragen:
Aber was wei der Weltgeist, vor dem die Weltgeschichte von Anfang bis zu Ende oder
besser von Ewigkeit zu Ewigkeit wie ein Gemlde aufgerollt daliegt, von den Jahreszahlen,
von den Zeichen und Abschnitten, die wir erfunden haben, um unserem Gedchtnis zu
Hilfe zu kommen?
142
Die Junghegelianer dagegen beginnen schon 1838, sich auf die Wiederkehr der
Zahl 40 vorzubereiten.
143
Im Zentrum steht dabei das Jubilum der Thronbestei-
gung Friedrichs II.
118
In einer dem Freunde Karl Marx aus Trier gewidmeten Jubelschrift: Fried-
rich der Groe und seine Widersacher feiert K. F. Kppen den Philosophenknig
als den freiesten Diener des Weltgeistes, der je gelebt und geherrscht hat.
144
Ein
Diktum Hegels abwandelnd, heit es von Friedrich II:
Seine Zeit, seine Stellung in derselben, seine weltgeschichtliche Aufgabe, das Wesen und
der Zweck seines Staates, des Staates berhaupt, des Gesetzes, der Verwaltung und Verfas-
sung, der Religion und Kirche usw. hat er im Gedanken erfat und diesem Gedanken nach
regiert.
145
Wiederkehrender Bezugspunkt der Schrift ist die Staatsauffassung des Knigs:
Was ist der Zweck des Staates? Das ffentliche Wohl. Was ist der Frst? Der erste Diener
des Staats; diese beiden Stze, die an der Spitze von Friedrichs philosophischer Staatstheorie
stehen, sind auch die Basis seines kniglichen Tuns.
146
Der Absolutismus Friedrichs wird
von Koppen entschieden verteidigt. Fr ihn ist Friedrich kein Despot. Er hatte sein Ich rein
und ganz hingegeben, damit es eben die Ichheit des Staats sei. Und so konnte er denn wie
Ludwig der XIV, obwohl im entgegengesetzten Sinn sagen: l'etat c'est moi. Sein Ich war der
Staat, aber nicht sein empirisches (car tel est notre plaisir), sondern sein transzendentes, in
den Staatszweck aufgegangenes und mit diesem identisch gewordenes Ich.
147
Das Ideal des rationalen Verwaltungsstaats hat bei Koppen Vorrang vor der
Frage der Reprsentativverfassung. Die Garantien liegen in der Gesetzmigkeit
der Verwaltung und in der Rechtspflege. Die Offenheit gegenber Beschwerden,
die Friedrich seinen Beamten als Pflichterfllung abverlangt, wird besonders her-
vorgehoben: Friedrich habe geduldet, da Winkeladvokaten, Aufhetzer und
Rabulisten ihn bis zur Ungebhr mit Klagen und anderen Vorstellungen heimsuch-
ten. >Die Leute<, sagte er, >haben zwar sehr oft Unrecht, aber ich mu sie doch
anhren, denn dazu bin ich da.<
14S
Die Junghegelianer des Jahres 1840 stehen in Preuen an der Spitze der Fried-
richverehrung. In diesem Knig symbolisiert sich fr sie der >Geist< als eine souve-
rne >Macht<. Die Widersacher Friedrichs II. sind die Feinde der Vernunft und
des Menschengeschlechts berhaupt. Es sind Feinde, die sein Wesen, sein Prin-
zip hassen und bekmpfen, die ihm von Anfang an gegenberstanden, die ihm noch
gegenberstehen und gegenberstehen werden bis zur Gtterdmmerung.
149
Das
Pathos der Kppenschen Schrift wird noch berboten durch Ruges Rezension in
den HJ.
Ruge will die Begeisterung nicht unterdrcken, zu der uns Kppens herrliche Jubelschrift
aufgeregt. Allerdings, hier ist Stoff zu jubeln, hier ist aber auch Kraft niederzuwerfen und in
die Hlle zu strzen, wo sie hingehren, die Schnder seines Ruhms und die Feinde unserer
Zukunft; und beides ist geschehen mit erschtternder Beredsamkeit, mit freiem Geist und
mit tiefster Kenntnis der Aufklrer sowohl, als des feindlichen Lagers der Romantik. Das
Buch ist ein frisches Produkt des neuen, des befreiten Geistes der ecclesia militans, wie sie
diese Bltter mit vollem Bewutsein und mit unabwendbarer Entschlossenheit auf sich
genommen haben. Wer sich fhlt als freier Mann, als Protestant, als Philosoph, - und das
wre wahrlich das rechte Gefhl eines jeden, der Anteil hat an den Ehren Friedrich II. und
seines Staates, -jeder gebildete Preue sollte diese Jubelschrift, wie einen teuren Schatz, wie
ein heiliges Buch, welches die Fundamente seiner Freiheit, die Grundlage seiner National-
ehre, den Kern seines religisen und politischen Bewutseins enthlt, nicht lesen, nein stu-
dieren und liebgewinnen, aufbewahren, und in ihm ein teures Familiengut auf Kind und
Kindeskinder vererben.
150
119
berschwengliche Erwartungen haben ihre eigene Dialektik. Wie magische
Beschwrungen versuchen sie, die kontingente Geschichte zu verpflichten: Preu-
en mu die Grundstze Friedrich II. weiterentwickeln, und dieses Mu versu-
chen die Junghegelianer mit allen Mitteln darzustellen. So endet Kppens Schrift
mit dem Verweis auf den alten Volksglauben,
da nach 100 Jahren die Leute wiedergeboren werden. Die Zeit ist erfllet. Mge sein
(Friedrich II., d. V.) wiedergeborener Geist ber uns kommen und alle Widersacher, die
den Eintritt ins Land der Verheiung uns wehren, mit Flammen im Schwerte vertilgen! Wir
aber schwren, in diesem, seinem Geiste zu leben und zu sterben!
151
Die Dialektik berschwenglicher Erwartungen erfordert normalerweise ihre
Enttuschung. Aber die Zahlenmystik des Jahres 40 wird nicht enttuscht, und die
pltzlich eintretende Besttigung der berschwenglichen Erwartung fhrt zu einer
sich steigernden gegenseitigen Konnotation von Erwartung und Ereignis. Im Mai
1840 stirbt der Minister Altenstein, und im Juni stirbt Friedrich Wilhelm II. Und
da der Tod des Knigs whrend des Pfingstfestes eintritt, steigert die zahlenmysti-
sche Erwartung noch einmal fr alle, die sich in der chiliastischen Tradition ausken-
nen. In der hretischen Pfingstdeutung steht dieses Fest fr den Beginn des Gottes-
reiches auf Erden.
Prutz schreibt rckblickend:
Und jetzt nun endlich mit dem zweiten Pfingsttage des Jahres vierzig war der Moment
gekommen, diese Hoffnungen zu erfllen, diese Erwartungen zu befriedigen. Des Jahres
vierzig! Dieses geheimnisvollen, dieses weltgeschichtlichen Jahres, auf welches die Sehn-
sucht der Vlker schon solange gelauert, das die Stimme der Weissagung schon zum Voraus
bezeichnet hatte! Bedurfte es fr den jungen Regenten noch eines glnzenderen Zeugnisses,
als dieses rtselhaften, dieses berraschenden Zusammentreffens? Jetzt erst war die Verhei-
ung eingetroffen, jetzt erst hatte die dmonische Macht des Jahres vierzig sich bewhrt. Mit
stolzer Freude zhlte man die Reihe der Jahrhunderte zurck und berzeugte sich, da
jedesmal mit dem Jahre vierzig ein groer, glorwrdiger Name in die Reihe der preuischen
Regenten eingetreten war; mit Entzcken erinnerte man sich, wie gerade hundert Jahre
zuvor, beinahe an demselben Tage, Friedrich der Groe den Thron seiner Vter bestiegen
hatte. Ja es war kein Zweifel mehr: das tausendjhrige Reich war gekommen, alle Hoffnun-
gen, alle Trume sollten Wahrheit werden, eine neue, glnzende Zeit begann und ihr Held
hie Friedrich Wilhelm der Vierte!
132
Erwartung ist ein uerst komplexes soziales Phnomen. Soziologisches Den-
ken, das sich auf Zusammenhnge richtet, tut sich schwer damit, die eigentmliche
ffnung zu beschreiben, die gar mit einer erfllt geglaubten Erwartung einhergeht.
Angesichts der sich aufdrngenden voreiligen Geste, mit der auf die Enttuschung,
die Desillusionierung, die derart gesteigerten Momenten folgen wird, in der Regel
verwiesen wird, ist es notwendig, sich den erfllten Erwartungsraum genauer anzu-
sehen. Die Erwartung des Jahres 1840 ist von Zeitgenossen immer wieder als eine
Verwandlung der sozialen Situation beschrieben worden:
Frhling in jeder Brust, lngst zu Grabe getragene Wnsche erwachen wieder, erstarrte
Hoffnungen brechen wieder hervor. Die Menschen schauen sich wieder an, freier, frischer,
das gebckte Haupt hebt sich wieder an, man sieht sich ins Auge, man fhlt sich. Alles, alles
sieht anders aus. Es sind nicht mehr dieselben Menschen, die uns begegnen; man geht
rascher, frhlicher, der Morgenschein der Hoffnung liegt auf allen Antlitzen, strahlt auf
120
allen Blicken; es ist, als wenn jeden Augenblick unendlicher Jubel aus allgemeiner Brust her-
vorbrechen wollte.
Dies ist die Wirkung des Thronwechsels 1840, wie sie Flourencourt beschrieben
hat, Formulierungen, die B. Bauer in seine >Geschichte der Parteikmpfe< aufge-
nommen hat.
153
Der kollektiv >irrationale< Charakter dieser Verwandlung der sozialen Situation
steht auer Frage, aber fr die Zeitgenossen ist das Erlebthaben dieser Verwand-
lung ein gemeinsamer Bezugspunkt, der nicht so rasch vergessen wird. Die Ver-
wandlung der sozialen Situation ist prgend durch die Entzauberung hindurch. Im
strengen Sinne ist die erfllt geglaubte Erwartung gar nicht zu enttuschen, sofern
ihr ein kollektives Erfahrungsbruchstck von auch nur krzester Dauer zugrunde
liegt. Was sich Pfingsten 1840 an Verwandlung der sozialen Situation fr einen
Moment ergeben hatte: Alles, alles sieht anders aus, bleibt ein Muster, das den
Horizont bis zum Jahre 1848 bestimmt.
1843, zu einem Zeitpunkt, da betrchtliche desillusionierende Erfahrungen mit
dem neuen Knig vorliegen, die auch ausgiebig reflektiert werden, ist das Muster
dennoch prsent, wenn z. B. F. Wehl schreibt:
Friedrich Wilhelm der Dritte starb und Friedrich Wilhelm der Vierte folgte. Wie ein Wet-
terleuchten zuckte dies Leuchten empor. Die alte Zeit ging mit dem alten Knig zu Grabe
und die neue Zeit hob den neuen Knig auf ihren Schild. Friedrich Wilhelm der Vierte
mute ein anderer sein, als sein Vater; es lag dieses weniger an seinem Willen, als an der Not-
wendigkeit der zeitlichen Zustnde. Wie er ein anderer sein wird, wird uns die Zukunft leh-
ren. Hoffen wollen wir das Beste, wir haben Grund dazu.
154
Den Moment der Verwandlung in ein Kontinuum zu transformieren, dieser Stra-
tegie folgen die Argumentationen der Junghegelianer, wenn sie, wie K. Riedel, auf
den neuen Knig setzen. Die Erwartung verpflichtet den Knig, die Kette der
erfllten Weissagungen reit nicht ab:
Was wir seit Friedrich Wilhelm des Vierten Thronbesteigung unter glckbedeutenden Zei-
chen kommen und erstehen sahen, weissagt uns, da die Zeit, deren geistigen Inhalt wir
andeuteten, auch vom Throne herab erstrebt und in Wirklichkeit gerufen werde, durch
einen Willen, der nur im Trefflichsten seine Aufgabe gelst sieht.
155
Natrlich nhrt sich das Muster von Anhaltspunkten, die im Verhalten des
neuen Knigs liegen. Seine Amnestie fr politische Untersuchungshftlinge, die
Wiedereinsetzung Arndts, seine schwankende Haltung in der Frage der Einlsung
des >Verfassungsversprechens< von 1815, schlielich seine Pressepolitik schienen
die in ihn gesetzten Erwartungen immer auch zu einem Teil zu besttigen. Selbst in
den schrfsten junghegelianischen Kritiken Friedrich Wilhelms IV., wie z. B. in der
von Marx 1843, reproduziert sich das Muster der Thronwechselerwartung:
Der alte Knig wollte nichts Extravagantes, er war ein Philister und machte keinen
Anspruch auf Geist. Er wute, da der Dienerstaat und sein Besitz nur der prosaischen,
ruhigen Existenz bedurfte. Der junge Knig war munterer und aufgeweckter, von der All-
macht des Monarchen, der nur durch sein Herz und seinen Verstand beschrnkt ist, dachte
er viel grer. Der alte verkncherte Diener- und Sklavenstaat widerte ihn an. Er wollte ihn
lebendig machen und ganz und gar mit seinen Wnschen, Gefhlen und Gedanken durch-
dringen; und er konnte das verlangen, er in seinem Staate, wenn es nur gelingen wollte.
121
Daher seine liberalen Reden und Herzensergieungen. Nicht das tote Gesetz, das volle
lebendige Herz des Knigs sollte alle seine Untertanen regieren. Er wollte alle Herzen und
Geister fr seine Herzenswnsche und langgenhrten Plne in Bewegung setzen. Eine
Bewegung ist erfolgt; aber die brigen Herzen schlugen nicht wie das seinige, und die
Beherrschten konnten den Mund nicht auftun, ohne von der Aufhebung der alten Herr-
schaft zu reden.
156
Marx projiziert hier das Erwartungsmuster auf den Knig als von ihm ausge-
hende Erwartungen, eine Umstellung, die legitim ist, denn Erwartung ist kein Ph-
nomen, das sich getrennt entfaltet, die Verwandlung der sozialen Situation betrifft
alle. Erst die Desillusionierung trennt und kann Versagen einer Seite zuschlagen. So
ist im schlielichen Resultat der Knig vom Volk enttuscht und das Volk von ihm.
Der Wechsel an der Spitze des preuischen Staates tangiert die Junghegelianer
in dramatischer Weise, weil ihre Konstruktion: das Bndnis von Schule und
modernem Staat auf dem Spiel steht. B. Bauer schreibt 1840: die Wissenschaft
wird mit unerschpflicher Piett das Andenken Friedrich Wilhelms III. feiern, der
sie in ihrer ruhigen Entwicklung nicht stren lie. Der Schutzgeist der Wissen-
schaft sa auf dem Thron und verhinderte es, da das Zeichen zum Kampfe gege-
ben wrde.
157
Der Kampf, den Bruno Bauer im Auge hat, ist der Kampf um die
Stellung der Schule im preuischen Staat unter der Regierung Friedrich Wilhelms
IV. Die Prozesse der Destabilisierung des Bndnismodells lassen sich nur ober-
flchlich auf einen Konflikt zwischen den progressivem Junghegelianern und dem
reaktionrem Verhalten der neuen Regierung beziehen. Die DeStabilisierungen
finden auf beiden Seiten statt, und in ihnen wirkt das Erwartungsmuster vielfach
gebrochen weiter.
Im Unterschied zu seinem Vorgnger betreibt der neue Knig eine aktive Uni-
versittspolitik, was schon ganz unabhngig von den Zielen eine Destabilisierung
bedeutet, weil die Brokratie kaum in der Lage ist, die Flut der Initiativen zu verar-
beiten. Selbst diejenigen, die dem Knig seit seiner Kronprinzenzeit nahestehen
wie die konservativen Brder v. Gerlach, sehen in den Initiativen absolutistische
Exzesse.
158
Sie wirken um so destabisierender, als der Knig seine Absichten,
Ziele, Erwartungen ffentlich proklamiert und sich somit ber die Brokratie hin-
weg als Dialogpartner gesellschaftlicher Ansprche prsentiert.
Vor diesem Hintergrund ist auch der oft zitierte Ausspruch zu sehen, der Knig
wolle die Drachensaat des Hegelschen Pantheismus aus den Geistern der Jugend
ausrotten.
159
In der Art, in der der neue Knig die Altensteinsche Politik der Pro-
tektion der Hegelschule revidiert, destabilisiert er zugleich einen gesellschaftlichen
Funktionszusammenhang. Denn Friedrich Wilhelm IV. ersetzt nicht die Hegel-
schule durch eine andere, vielmehr betreibt er eine Berufungspolitik, die zwar kon-
sequent antihegelianisch, aber in ihren positiven Aspekten nicht mehr vom Kon-
zept der Privilegierung einer Schule ausgeht, die sich in besonderer Weise auf die
>beamtete Intelligenz< beruft. Die neuen Berufungen, die auf die Initiative des
Knigs zurckgehen: z. B. den Theoretiker des christlichen Staates< Julius Stahl,
der den Stuhl des verstorbenen Hegelianers E. Gans einnimmt, die Brder Grimm,
deren Protest im hannoverschen Verfassungsstreit sie zu Symbolgestalten liberalen
Professorenmutes hatte werden lassen, den gelehrten Poeten Friedrich Rcken,
der neben dem vom Knig verehrten Malerprofessor Cornelius und Musikprofes-
122
sor Mendelssohn den knstlerischen Ruhm der Universitt vergrern sollte -
diese Berufungen folgen eher arbitrren Impulsen als einem berlegten Konzept.
K. A. Varnhagen von Ense befrchtet angesichts der Vielzahl von Berufungen ver-
gangener Berhmtheiten die Entstehung einer verfluchten Rumpelkammer.
160
Die Erwartungen, die der Knig mit der spektakulren Berufung Schellings nach
Berlin verbindet: mit diesem Philosophen jemanden zu gewinnen, der ein Gegen-
gewicht gegen die Hegelschule darstellen knnte, werden ebenso enttuscht wie
die Erwartungen der Hegelianer, einem Kontrahenten gegenberzustehen, mit
dem gestritten werden kann. Es sind insbesondere die Junghegelianer, die sich
intensiv auf die Ankunft Schellings in Berlin vorbereiten. Sie tun dies in dem Erwar-
tungshorizont, da mit dem von Knig protegierten Schelling gleichsam eine Alter-
native zum Bndnis der Hegelschule mit dem Staat aufgebaut werden soll.
Im Juli 1841 erffnete das >Athenum< die Vorbereitungen mit einer Stellung-
nahme gegen einen Korrespondenten der >Augsburger Zeitung<, der davon
schreibt:
Er hre, >die Hegelsche Schule (. . . ) ber Rckschritte der Intelligenz in Preuen<, sowie
darber sich >rgern und seufzen, da sie, die bisher im Staat als die erste herrschende Rich-
tung bevorzugt worden sei, jetzt andere nicht nur unter, sondern auch neben sich dulden
solle.<
161
Diese Nachricht wird entschieden zurckgewiesen: Leider hat jedoch dieser
seufzende rger nirgends Realitt als in dem frommen Wunsche des auf den Genu der
Schadenfreude vergeblich sich spitzenden edlen Berichterstatters. Die Hegelsche Schule ist
niemals im preuischen Staate so bevorzugt worden, da andere Richtungen neben ihr gar
keine Bercksichtigung gefunden htten. Die von unserem Gegner gehoffte Neuerung ist
daher keine Neuerung. Ob anderes Philosophieren in der Republik der Wissenschaft mit
der Hegeischen Philosophie zu gleicher Geltung kommen soll, das hngt nirgends vom
Belieben der Regierung ab. Die Hegelsche Philosophie hat sich bisher gegen alle ihre Geg-
ner durch ihre eigene alleinige Kraft als die herrschende behauptet.
162
Die Hegelianer wrden auch unter den vernderten Bedingungen keineswegs
an Wirklichkeit des Vernnftigen zu verzweifeln anfangen, vor Schellings
Ankunft in Berlin habe ausschlielich er selber und die Seinigen sich zu frch-
ten.
163
Der Kampf mit einem so hochstehenden Gegner wird die Hegelschule zu
noch lebendigerer Ttigkeit anspornen.
164
Das Kompromiangebot eines Anhngers Schellings, der in der >Augsburger
Zeitung< den Vorschlag macht, Schellingianer und Junghegelianer sollten sich ver-
einigen und eine dritte Philosophie entwerfen, welche dem preuischen Staat in
der patriarchalischen Stellung, die er heute bekleidet, die politisch-kritische und
ideale Kraft einzuflen vermgen werde
165
- diese sollte von Ruge, jene vom
neuen Schelling stammen -, dieses Kompromiangebot lehnen die Junghegelianer
ab. Stattdessen publiziert K. Riedel eine Kampfschrift gegen Schelling, die von
E. Meyen begeistert rezensiert wird.
166
Als Zeichen der Schwche werten es die
Junghegelianer, da Schelling hufig diejenigen, die sich ihm anschlieen, desa-
vouiere, und besonders kosten sie seine Desavouierung Stahls aus.
167
Die junghegelianischen Vorbereitungen fr einen Kampf der Schulen gehen
jedoch ins Leere. Die mit Spannung erwartete erste Vorlesung Schellings im dicht
besetzten Auditorium Maximum verluft ebenso enttuschend wie die folgenden.
Schelling vermeidet eine direkte Auseinandersetzung mit Hegel und der Hegel-
123
schule, im Gegenteil, er zitiert sogar anerkennend den verstorbenen Gans. Im bri-
gen sei er gekommen, um zu vershnen, Schwchen sollten nicht schadenfroh auf-
gedeckt werden, sondern womglich vergessen gemacht werden.
168
Schelling will,
wie er anllich eines verspteten mit ministerieller Untersttzung zustande
gekommenen drftigen Fackelzuges kundgab, eine Philosophie, die nicht blo
innerhalb der vier Pfhle einer engen Schule oder in einem beschrnkten Kreis von
Schlern sich behauptet.
169
Es kommt in Berlin trotz aller Protektion, die Schelling geniet, nicht zum
Kampf der Schulen. Die antihegelianische Koalition findet nicht nur keinen
gemeinsamen Nenner, die ganze Figur einer >beamteten Intelligenz< im >auf Intelli-
genz sich grndenden Staat< zerfliet. Diejenigen, die an der Figur festhalten wol-
len, finden nicht nur keinen Bndnispartner in der Regierung, auch das Gegenbild
einer anderen Schule erweist sich als Illusion. Schelling wird nicht als neuer
>Staatsphilosoph<, sondern als >Hofphilosoph< gehandelt.
Das Konzept einer philosophischen Schule, die mit anderen um eine adquatere
Wahrnehmung der mit dem Konkurrenzraum philosophischer Schulbildungen
gegebenen Mglichkeiten konkurriert, indem sie die Progression der Intelligenz im
Staate zum Mastab erhebt, dieses Konzept fllt nicht einfach der Repression des
Staates zum Opfer, sondern es implodiert, weil die Mitspieler gleichsam ausfallen.
Mit anderen Worten: die Bindekraft des Modells, die darauf beruhte, da die ver-
schiedenen Interessen in eine Struktur eingelassen waren, die auf Herausforderun-
gen abzielte und so immer mehr >verlangte<, als vorhanden war, schwand zugleich
mit den Herausforderungen. Die arbitrre Selbstgengsamkeit des Knigs, Schel-
lings Vermeidungsverhalten und die Irritationen der Verwaltung boten fr eine
philosophische Schule keine Herausforderungen, an denen sie ihre Kontur bewh-
ren konnte.
6. Die Entlassung der Philosophie aus dem Staatsdienst
An dieser Tuschung, an der Hoffnung auf eine, vom Thron ausgehende politi-
sche Reform haben sie sich verblutet. So urteilt der schwbische Junghegelianer
A. Schwegler ber seine preuischen Mitstreiter.
170
Die Metapher verweist auf
einen wichtigen Aspekt: die Enttuschung greift nur langsam in den Erwartungsho-
rizont ein und erzwingt gegen groe Widerstnde eine Umorientierung.
Ginge es allein nach den Karriereerwartungen, so htte die Enttuschung frher
Platz greifen mssen. Ruge erfhrt 1837, da er nicht mit einer Professur rechnen
knne. Sein Eintreten fr das Bndnis von Schule und Staat erreicht erst danach
seinen Hhepunkt. Feuerbach sucht 1836 zum letzten Mal um eine Professur nach,
eine Erwartung, die scheitert, da ihm seine Gedanken ber Tod und Unsterblich-
keit von 1830 noch immer >angerechnet< werden, obwohl er bereit ist, sich von
dieser Schrift als Jugendschrift zu distanzieren.
171
Noch 1842/43 ist ihm der Staat
der Inbegriff aller Realitten - der Staat die Vorsehung des Menschen.
172
Das
berufliche Schicksal dieser beiden wre fr die anderen Anla genug gewesen, die
Karriereorientierung zu berdenken. Aber Marx will noch 1841 Professor werden,
Prutz' Gesuch um eine Professur wird in dieser Zeit abgelehnt, Bayrhoffer wartet
124
bis 1846 auf eine ordentliche Professur, Nauwerck bleibt Privatdozent, bis ihm
1844 die Lehrerlaubnis entzogen wird. Gottschall wiederholt die Rugeschen Erfah-
rungen fast 10 Jahre spter. Das Karrieremuster der Junghegelianer hlt sich trotz
der Enttuschungen relativ konstant durch. Widerstrebend wird es aufgegeben
und die freie Schriftstellerexistenz gewhlt, die fr eine Reihe der Mitstreiter schon
gegeben ist.
173
Will man die kaum von der Hand zu weisende Tendenz, sich am Erwartungsho-
rizont, der mit dem Jahre 1840 symbolisiert ist, festzuklammern, genauer untersu-
chen, so bietet es sich an, die Entlassung B. Bauers in den Mittelpunkt der Analyse
zu stellen.
174
Der >Fall B. Bauer< kann exemplarisch gemacht werden, weil im
Unterschied zum Scheitern der anderen junghegelianischen Karrieren die Gruppe
selbst diesen Fall fr sich exemplarisch gemacht hat. In der Entlassung B. Bauers
spiegelt sich fr sie die Entlassung der Philosophie aus dem Staatsdienst.
Auf Initiative Altensteins war B. Bauer an die Universitt Bonn bersiedelt, teils
weil an der Theologischen Fakultt in Berlin kein Platz war, und teils, weil in die
Bonner Fakultt der Hegelianismus noch keinen Einzug gehalten hatte. Darber
hinaus hatte sich B. Bauer in Berlin durch seine Streitschrift gegen Hengstenberg
die Gunst der Fakulttsmehrheit verscherzt. Die Finanzierung der Bauerschen
Ttigkeit in Bonn, die er nach langer Zeit rmlichster Verhltnisse erhlt, ging
jedoch zu Lasten zweier lterer Bonner Privatdozenten - eine Querele, die Bauers
Stellung in Bonn nicht gerade verstrkte. ber diesen Auseinandersetzungen starb
Altenstein. Der neue Minister, der von der Bonner Universitt sogleich ersucht
wurde, die Finanzierungslsung fr B. Bauer rckgngig zu machen, versuchte
zunchst, einen Kompromi durchzusetzen: Dieser sollte sich mit einer Gehalts-
krzung nach Charlottenburg zurckziehen, um dort auf dem neutralen Gebiet der
Kirchengeschichte zu forschen. Mit Hilfe der Frsprache seines Lehrers Marhei-
neke gelingt es B. Bauer jedoch, wieder nach Bonn zurckzukehren. Der Bruch mit
dem Ministerium erfolgt, als B. Bauer statt wenig brisanter kirchengeschichtlicher
Forschung dem Minister am 20. Juni 1841 den ersten Band seiner >Kritik der evan-
gelischen Geschichte der Synoptiker< mit der Bitte um einen theologischen Lehr-
stuhl bersendet.
175
Hervorzuheben am Verlauf der Auseinandersetzung um die Entlassung B. Bau-
ers sind zunchst Irritationen, die die Verhaltenskohrenz von Verwaltung und
Ministerium betreffen. Fr Entlassungen von miliebigen Hochschullehrern hat es
in Deutschland insbesondere whrend der Demagogenverfolgung eine Reihe von
Przedenzfllen gegeben (z. B. die Verfolgung De Wettes und die Gewaltsprche
gegen die Gttinger Sieben). Aber whrend damals Entlassungen relativ >problem-
los< vollzogen wurden, erffnet der Minister im Fall B. Bauers ein Verfahren, das
den Liberalisierungserwartungen im Gefolge des Thronwechsels mehr zu entspre-
chen schien. Eichhorn legt zunchst den theologischen Fakultten Preuens die
Fragen vor:
1. welchen Standpunkt der Verfasser nach dieser seiner Schrift im Verhltnis zum Chri-
stentum einnimmt, und 2. ob ihm nach Bestimmung unserer Universitten, besonders aber
der theologischen Fakultten auf denselben, die licentia docendi verstattet werden
kann?
176
125
B. Bauers Haltungen dem Proze, der mit seiner Entlassung endet, ist schwer zu
rekonstruieren. Zwei Interpretationsmuster, die beide wenig befriedigen, drngen
sich auf: die Rede vom >pathologischen Bauer<, der extrem berreizbar sich launen-
haft und verworren in eine ausweglose Lage hineinmanvriert, und die Rede vom
>Opfer staatlicher Repression< in der B. Bauer als Held der freien Wissenschaft
gefeiert wird.
Der >pathologische Bauer< findet sich prgnant in dem Ministerialgutachten von
J. Schulze.
181
Er schreibt seinem Minister, nach mndlichen Unterredungen und
nach der Lektre der Posaune habe er von B. Bauer die berzeugung gewonnen,
da er sich in einer leidenschaftlichen krankhaften Aufregung befindet, solange diese fie-
berhafte Stimmung andauere, kann ich den B. Bauer nur als einen geistig Kranken
betrachten, welcher um so gerechteren Anspruch auf meine Teilnahme hat, je grer die
Gefahr ist, worin er mir zu schweben scheint und je bedeutender die Talente sind, welche
ihm Gott verliehen hat.
Man kann dieses starke Urteil relativieren: der alte Protege der Schule will
B. Bauer helfen, er rt dazu, B. Bauer eine rettende Hand zu bieten, ihn vielleicht
an einer greren Bibliothek anzustellen. Aber auch der Hegelianer Marheineke,
der in seinem Separatvotum vorschlgt, B. Bauer aus der theologischen in die phi-
losophische Fakultt berzuleiten, geht auf die Pathologie ein. Er spricht von der
schmerzlichen Erfahrung B. Bauers, sich stets und ohne Unterla zurckge-
setzt zu sehen, und erklrt sich so, wie die Sure des Unmuts und die Bitterkeit,
von der in seiner letzten Schrift (der erste Band der >Synoptiker<, d. V.) deutliche
Spuren sind, sich in seiner Seele ansetzen mu.
182
Der pathologische Verdacht ist
aber auch verbreitet in den Berliner junghegelianischen Kreisen. So schreibt Edgar
an seinen Bruder Bruno Bauer: Den Ernst deiner Sache einzusehen ist man hier
noch weit entfernt. (. . .) Es sei eine >Verrckheit< von dir, so zu handeln, wie du
handelst: was du denn nachher anzufangen dchtest; freilich das mtest du am
besten wissen.
183
Der >pathologische B. Bauer< ist zunchst zu dechiffrieren als der B. Bauer, der
nicht verstanden wird, der also ein abweichendes Verhalten zeigt, dessen Sinn sich
verrtselt. Die Paradoxie des B. Bauerschen Verhaltens lt sich zugespitzt auf die
Formel bringen: Es insistiert darauf, in der theologischen Fakultt als beamteter
Lehrer zu wirken, und baut gleichzeitig eine Konfliktstrategie auf, die absehbar mit
seiner Remotion enden mu. B. Bauer testet mit einem lebensgeschichtlichen Ein-
satz die politische Frage unserer Zeit, die Ruge darin sieht: ob der Staat in einer
bestimmten Verfassung die Bewegungen des Geistes, welche ber diese Bestimmt-
heit hinausgehen, unterdrcken, oder ob er Formen erfinden solle, welche die
unendliche Bewegung ausdrcklich zu seiner eigenen Angelegenheit machen.
184
B. Bauer testet diese Frage, d. h. er lt der Geschichte nicht ihre Evidenz, son-
dern fordert sie heraus. Er wei sptestens seit dem Tode Altensteins, da er kaum
eine Chance hat, Theologieprofessor zu werden, aber diese Evidenz macht er zu
einem historischen Experiment, in dem die Grenzen zwischen >gespieltem< Verhal-
ten und >ernsthaftem< Einsatz verschwimmen. Daher ist B. Bauer auch nicht ein-
fach >Opfer der Repression< Als >Opfer< mte er die Evidenz der Repression in
dem Sinne anerkennen, da er aufhrt mitzuspielen, um den Gegensinn authen-
126
tisch zu entfalten. Aber in dieser Art will B. Bauer nicht >unschuldig< sein an dem,
was ihm >passiert<, er will in seinem historischen Experiment mitwirken, d. h. eben
nicht Opfer sein.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang B. Bauers Brief vom 6. Dezember 1841 an
Ruge, der in dieser Zeit zu seinen wichtigsten Vertrauten gehrt. B. Bauer fordert
Ruge auf, in nichtpreuischen Zeitungen Denunziationen gegen ihn in Gang zu set-
zen, um den Konflikt zu forcieren:
Da die Regierung nichts gegen mich zu wagen scheint, so wre es sehr gut, wenn Sie Mittel
und Wege fnden, mich in der Leipziger Allgemeinen Zeitung und in der Augsburger
ffentlich anzuklagen. Und B. Bauer signalisiert Ruge auch schon den Tenor, den die
Denunziation haben soll: Sagen Sie es den hohen Herren, da man es sehr bedenklich
fnde, da einem so bsen Dmon Raum gegeben werde. Freiwillig werde ich mich nicht in
die philosophische Fakultt begeben. Mein Lstergeist wrde sich nur zufrieden geben,
wenn man mich als Professor autorisierte, ffentlich das System des Atheismus zu predigen.
Hoffentlich aber wird man fr das Heil der Seelen mehr bedacht sein. Werde ich removiert,
dann allerdings eventualiter bin ich dabei.
185
Festklammern am akademischen Raum und gleichzeitig Verstrkung der Kon-
fliktstrategie, dieser Widersinn lst sich nur, wenn der Experimentcharakter des
Verhaltens im Auge behalten wird. B. Bauer inszeniert gleichsam eine Art Ge-
richtsproze, in dem er seine wissenschaftlichen Kontrahenten ebenso wie die
Regierung aktiv herausfordert. ber eine Unterredung mit Eichhorn, dem er sei-
nen ersten Band der >Synoptiker< mit dem Gesuch um einen Lehrstuhl bersandt
hatte, berichtet er Ruge:
Eichhorn ist auer sich gegen mich. Ich war bei ihm, weil ich seine gegenwrtigen Absich-
ten kennenlernen wollte, d.h. besttigt haben wollte. Es war eine starke Expektoration. Wir
sind aber Sieger. Die Ruhe, Selbstgewiheit, alles ist unser, den anderen nur die Unsicher-
heit, Unklarheit und dumpfe Leidenschaftlichkeit. Es war kstlich.
186
Angesichts der Erfolgsaussichten seines Prozesses ist das Wir sind aber Sieger
eine vllige Verkehrung der Krfteverhltnisse. Aber B. Bauers historisches Expe-
riment zielt auf anderes als auf die Evidenz von Gewaltverhltnissen.
Im Monat vor seiner Entlassung schreibt er Ruge:
Jetzt habe er die Theologische Fakultt vor Gericht geladen und die Sachen zwischen ihr
und mir, da ich diese Leute nicht anders zu Wort bringen kann, vor das Ministerium in dem
Sinne gebracht, da dieses entscheiden soll, ob die Fakultt ein haltbares Argument vorbrin-
gen kann, welches mich fr den Staat totmachen mte. Ich will sie so gut wie den Staat zur
Sprache und zur Entscheidung bringen, ob die Kritik vom Staate ausgeschlossen werden
soll. Natrlich hoffe ich von diesem Proze nichts, aber er mu auch einmal entschieden
werden. Indessen wanke und weiche ich nicht, sie mgen machen, was sie wollen, - es ist mir
gleich.
187
Getestet werden soll mit B. Bauers Experiment die Fhigkeit von Staat und Uni-
versitt, wissenschaftliche Kritik in sich aufzunehmen, d. h. es steht die Bndnis-
konzeption der Junghegelianer auf dem Prfstand. In der RhZ macht B. Bauer
deutlich, da es in seinem Proze nicht primr um Gewissensfreiheit geht. Sie sei
in der neueren Zeit so stark und sicher geworden, da sie nicht erst noch garantiert
zu werden braucht.
188
Wenn aber das Gewissen und das Bestehende nicht mehr
127
schlechthin harmonieren, so mu der Staat dafr sorgen, da beide nicht endlich
zu weit auseinander treten. Er tue dies durch die Garantie der Druckfreiheit.
Aber auch um diese geht es B. Bauer nicht primr in seinem Proze.
Die Druckfreiheit lt immer noch den Schein stehen, da dieser einzelne Mensch, dieser
Autor, dieser Schriftsteller, obwohl er eine allgemeine Idee prsentiert, nur als diese einzelne
Person dastehe; dieser Schein kann bei aller Druckfreiheit geltend gemacht und diese
Ansicht am Ende sehr nachteilig werden.
Die Druckfreiheit ist keineswegs ausreichend, um den Konflikt zwischen dem
Gewissen und dem Bestehenden zu lsen. Denn trotz des Scheins, es handele
sich um blo einzelne Ideen, htten zwar alle tchtigen berzeugungen sich end-
lich Eingang, Anerkennung und Einflu auf das Bestehende verschafft, aber sie
htten dies in der Vergangenheit auf eine sehr unwrdige, inhumane Weise tun
mssen.
Bauer fragt: Aber soll und darf der Mensch immer nur wie ein Tier durch die
unorganischen, ungeordneten Massen hindurcharbeiten? An Anspielung auf pro-
minente Hegelsche Tiervergleiche schreibt B. Bauer, dies msse zwar ein Hund,
ein Wurm und ein Maulwurf tun, aber zu fragen sei:
Soll die Geschichte nur ein Gewhl sein? Sollen die Bewegungen der Geschichte nur
dadurch herbeigefhrt werden, da die neuen Ideen sich wie ein Maulwurf durchwhlen
und endlich die Rinde durchbrechen? Der Mensch ist mehr als ein Wurm. Sein Adel ist die
Form. Und diese Form gibt ihm der Staat.
Auf dieser Ebene liegt fr B. Bauer der Testpunkt seines Prozesses:
An dem Staat ist es, das Formlose, Gewhlartige, Unorganische und scheinbar Zufllige,
was in den Bewegungen der Presse liegt, dadurch aufzuheben, da er zur Druckfreiheit die
Lehrfreiheit hinzufgt, d. h. fr eine ffentliche, zum Staatsorganismus selbst gehrende
Form, sorgt, in welcher sich die neuen berzeugungen aussprechen knnen.
189
In der Schere, die sich zwischen der ffentlichkeit und der beamteten Intelligenz
auftut, steht B. Bauer bis zum Ende theoretisch auf der Seite der beamteten Intelli-
genz als einer der Wissenschaft angemessenen Form, die nicht in ein wildes Auen
abgedrngt werden will. Zugleich tut er praktisch alles, um den Test fr sich zu ver-
lieren.
Woher bezieht B. Bauer seine Energie fr dieses Experiment? An zwei mgliche
Quellen kann gedacht werden: er ist in dieser Zeit ein Symbol fr die Junghegelia-
ner, die sein Experiment mittragen, und er definiert den Proze zugleich als eine
Selbstfindung. Fr die Gruppe gewinnt B. Bauers Konzept der sich in den Staat
verklammernden Kritik zunehmend an Bedeutung und wird zu einem intellektuel-
len Instrument, das auch ber die Evangelienkritik hinausgehend Verwendung fin-
det. Er selbst bleibt dagegen in eigentmlicher Weise sich selbst beschrnkend bei
der Durchfhrung seines Tests, so wie er es 1840 seinem Bruder annonciert.
B. Bauer beglckwnscht ihn, da er sein Theologiestudium abgebrochen hat, sagt
aber ber sich:
Ich stecke einmal darin und der Kampf hat sich zu tief in mich eingefressen, als da ich
mich davon abtrennen knnte. (Ich werde erst dann ein Ende machen knnen, wenn ich alle
Wendungen durchgemacht habe.) Ich bin so fest mit der Theologie verwachsen, da ich nur
128
mir tue, was ich in der Theologie tue, d. h. ich wasche mich vom Unrat rein, indem ich
dieTheologie aufrume. Wenn ich fertig bin, werde ich rein sein.
190
Diese durchhaltende und ausharrende Selbstfindung ist gebunden an das Bnd-
nismodell von Schule und modernem Staat, und zwar auch ber den Moment hin-
aus, wo dieses Bndnis zweifelhaft wird. Im Februar 1840, noch vor dem Tode
Altensteins, schreibt B. Bauer:
Der Staat mu an sich selber ein religises Interesse nehmen und die Fortentwicklung der
Philosophie beschrnken. Sie war bisher durch ihre Verbindung mit dem Staate consolida-
risch verpflichtet, also auch eingeengt; sie hatte sich, da sie scheinbar freigelassen und ohne-
hin begnstigt war, d. h. an den Vorteilen der Regierung teilnahm, selbst ihre Grenze
gesetzt. Indem sie aber gefesselt wird, wird sie ber alle Fesseln und Grenzen hinausgetrie-
ben. Der gefesselte Prometheus war als solcher freier als damals, da er noch frei umherging
und die Menschen opfern lehrte. Der freie Pometheus war bekanntlich in seiner Opferlehre
ein Sophist, aber im Schmerz seiner Fesseln war er ber alle Mchte erhaben.
191
Das Bewutsein der heraufziehenden Fesselung kann aber nur zu einer intellek-
tuellen Kraft werden, wenn die Philosophie es ablehnt, sich als >Opfer< zu definie-
ren. Das ist der Sinn der Anspielung auf den Prometheus-Mythos. So antizipiert
B. Bauer 1840 seine Entlassung auch nicht als einseitig repressiven Akt, dessen
Opfer er sein wrde. Im Gegenteil:
Indem die Wissenschaft verstoen wird, ist sie sich selbst berlassen. Man will sie nicht
mehr, gut! so ist sie emanzipiert und ich bin auch frei, soweit ich der Verstoenen diene. Ich
habe mich noch nie so glcklich, so frei gefhlt.
192
Die Entlassung der Philosophie aus dem Staatsdienst ist ein mehrschichtiger
Vorgang: Die Karrieremuster, die sich auf die beamtete Intelligenz beziehen, wer-
den brchig. Sich als Hegelianer bekennen, ist so gut, als sich fr ewige Zeiten das
Fortkommen versperren, konstatiert ein Anonymus in den DJ.
193
Aber auch die
beamtete Intelligenz hat ihr Intelligenzmonopol verloren, fr Intellektuelle verliert
diese Figur an Anziehungskraft. Und mit ihr gert die Selbstdefinition als eine phi-
losophische Schule ins Wanken. Jetzt kann Rge schreiben: Diese eigentlich unge-
schulte und andere schulende Schule kann nicht produktiv sein, das liegt in ihrem
Begriff. Ihr Vorteil, mit dem fertigen Reiche Gottes, zu dem die Staatsregierung,
eben weil es fertig vorlag und sein Urheber (Hegel, d. V.) dafr Brgschaft leistete,
das beste Zutrauen hatte, sehr schnell zum Guten dieser Welt und in den Staats-
dienst zu gelangen - dieser Vorteil zhlt nicht mehr.
194
B. Bauers historisches Experiment bringt fr die Junghegelianer an den Tag, da
die Universitten
sich nicht mehr fr die Herde der Wissenschaft hielten, auf welchen das reine Feuer der
freien Kritik brennen, auf denen jede Richtung ein Asyl finden knne; da konnte auch Bruno
Bauer gar nicht mehr daran denken, auf einer Universitt lehren und seinen Platz ausfllen
zu wollen. Da war die freie weite Welt sein wrdigster Platz, sein groartigster Katheder.
195
Der moderne Staat, der seine Intelligenz entlassen hat, regrediert E. Bauer
zufolge zum Polizeistaat, und die Wissenschaft, die er lehren lt, wird keine
echte sein, weil sie stets unter Aufsicht und gezwungen ist, eine offizielle zu sein.
196
Die offizielle Wissenschaft ist hier zum negativen Bezugspunkt geworden. Die
129
Gruppe mu sich umorientieren. Die entlassenen Philosophen bewegen sich
gleichsam in einem definitorischen Vakuum, und sie feiern dies als eine Befreiung.
Feuerbach, der zu denen gehrt, dessen Karriere frh scheiterte, schreibt:
Es ist allerdings eine Tatsache, da es bereits so weit gekommen ist bei uns, da Philoso-
phie und Professur der Philosophie absolute Widersprche sind, da es ein spezifisches
Kennzeichen eines Philosophen ist, kein Professor der Philosophie zu sein, umgekehrt ein
spezifisches Kennzeichen eines Professors der Philosophie, kein Philosoph zu sein. Aber der
Philosophie gereicht diese humoristische Tatsache nur zum Vorteil.
197
Der philosophische Schulzusammenhang setzt sich nicht in der Aufhebung der
Lehrer-Schler-Hierarchie fort, vielmehr wird die Differenz bei Feuerbach am
Konkurrenzraum philosophischer Schulbildung selbst festgemacht.
Ein wesendicher Unterschied endlich zwischen Hegel und meiner Wenigkeit besteht
darin, da Hegel Professor der Philosophie war, ich aber kein Professor, kein Doktor bin,
Hegel also in einer akademischen Schranke und Qualitt, ich aber als Mensch, als purer blan-
ker Mensch lebe, denke und schreibe. Die Philosophie ist so nicht mehr zu einer bloen
Professoralangelegenheit, sondern zur Sache des Menschen, des ganzen, freien Menschen
gemacht. Mit dem Austritt der Philosophie aus der Fakultt beginnt daher eine neue Periode
der Philosophie.
198
Die Philosophie hat in den akademischen Schranken ihre Heimat verloren, und
die entlassenen Philosophen definieren sich als pur-blanke Menschen, die weite
Welt ist ihr Katheder. Die Rhetorik des Austritts und der Entlassung, sie bezieht
sich nicht nur auf einen philosophiegeschichtlichen Sachverhalt, der auf das Pro-
blem von akademischer Theorie und gesellschaftlicher Praxis verweist, sie reflek-
tiert zugleich eine der zentralen lebensgeschichtlichen Erfahrungen der Junghege-
lianer. Es sind dies nicht nur Momente der je einzelnen Biographie, sondern die
Philosophen sehen in der Entlassung eine Emanzipation im wrtlichen Sinne, ein
Geschehen, das sie als Gruppe betrifft. Und sie bleiben eine Gruppe. Aber eine
Gruppe pur-blanker Menschen in der weiten Welt ist dem Soziologen nur schwer
vorstellbar. Die neue Periode der Philosophie bedarf neuer sozialer Definitionen
fr die, die die Philosophie aus der offiziellen Wissenschaft ihrem Verstndnis
nach herausgerettet haben. Diese neuen Definitionen sind zu einem gewissen Teil
noch an die alte Sei Dstdefinition als philosophische Schule gebunden, und zwar in
den Bereichen, die die erlernten Umgangsweisen mit Phnomenen der Fraktionie-
rung und der Spaltung betreffen.
7. Positionenstreit und Schulspaltung
Das Hegelsche Paradigma eint die Schule. Aber wer in der Schule interpretiert das
Paradigma angemessen? Wer macht philosophische Fortschritte, wer nicht? Wes-
sen Gedanken offenbaren so groe Abweichungen, da sein Bezug zum Paradigma
bezweifelt werden darf? Was kann als Lsung eines Streits angesehen werden, und
was ist ein Grund fr die Aufkndigung des Konsenses, fr die Spaltung?
Es gehrt zu den Charakteristika der Hegelschule, da sie fr den innerschuli-
schen Positionstreit und noch fr ihre Zerfallsprozesse positive Interpretationen
130
bereithlt. So schreibt Michelet: Der Kampf in der Schule selbst ist nichts Schlim-
mes, sondern das Zeichen ihres vollendeten Sieges, indem nun alles Interesse inner-
halb ihrer fllt.
199
Weit entfernt davon, ein Indiz der Schwche zu sein, bedeuten
die Schulkmpfe, da sich auf der mit der Hegelschule erreichten hheren Stufe
der Entwicklung ein Lebensproze auf erweiterter Stufenleiter entfaltet. Die
Hegelschule, als sich entwickelnde Totalitt einer neuen Gestalt der Philosophie
vorgestellt, kennt auch wieder Trennungen und Auseinandersetzungen, aber es
handelt sich der Selbstdeutung zufolge nicht mehr um den alten Kampf der Philo-
sophien untereinander, sondern um die >Eine Philosophie< die es auf der Hhe
ihrer Zeit zwar immer gegeben hat, die aber nun - und das ist der qualitative Sprung
- als >Eine Philosophie< erkannt, sich selbstbewut entfalten, und d. h. eben auch
in Momente auseinander treten kann.
Es ist eine zentrale Figur der Hegelschen Dialektik, da jede Einheit sich
dadurch entfaltet, da sie das Anderswerden aus sich heraus bewirkt. In der Einheit
liegt ein latenter Widerspruch, der mit der Entwicklung manifest wird. Auf diesen
anti-identischen Zug der Hegelschen Dialektik hat besonders Adorno hingewie-
sen: Dialektik ist das konsequente Bewutsein von Nichtidentitt.
200
Das Insi-
stieren auf dem Widerspruch, auf der Negativitt ist zugleich das Eingedenken
einer stets drohenden und anfallenden Ohnmacht des Begriffs gegenber dem
Anderswerden der Sachen. Der Dialektiker sucht nicht schlicht andere Begriffe,
wenn Sachen sich ndern, er mchte den Widerspruch im Begriff selbst darstellen.
Im Rahmen philosophischer Reflexion, den ein einzelner Philosoph entwirft,
mag diese Dialektik auszuhalten sein - aber die sich dem Paradigma Hegels ver-
pflichtende Schule, wie kann sie als soziale Figuration mit dieser Dialektik leben?
Es entsteht ein gravierendes Gruppenproblem, wenn sich Philosophen unter der
Vorstellung versammeln: Die Dialektik, die sie am Begriffe aufweist, hat demnach
diese Philosophie an sich selbst zu vollziehen, und dieser Proze, diese Bewegung
zur eigenen Gegenstndlichkeit und Aktualitt ist ihre Geschichte.
201
Das Schul-
problem lautet: Wie kann Einheit der Schule als ein Streit von Positionen definiert
werden?
Das Problem wird deutlicher, wenn man sich einen der verschiedenen Versuche
ansieht, den Kampf der Positionen als dialektische Einheit geschichtlich zu konkre-
tisieren. Fr Bayrhoffer ist die Schule - fr ihn das Geisterreich der Idee - im
Jahre 1838 im allgemeinen schon zahlreich, und er versucht, die wesentlichen
Schulmitglieder in ihren Streitpunkten dialektisch zu plazieren.
202
Die Idee stellt
sich in der Schule fr ihn in weltgeschichtlichen Momenten dar, die als beson-
dere Totalitten anzutreffen sind. Es gibt zusammen mit der gediegenen Fortbil-
dung auch extreme Richtungen, und durch die Entfaltung der Extreme kommt
es berhaupt erst zu vermittelnden Bewegungen. Ohne Zerfall in extreme Positio-
nen ist die Arbeit der Vermittlung nicht mglich. So zeigt sich das, was man auf
den ersten Blick fr eine Entartung und Entstellung halten mchte, doch in der
Vernunft und Notwendigkeit des Ganzen gegrndet.
203
Es ist nur der >erste Blick<,
der ein chaotisches Bild des Positionstreites entdeckt, der >zweite Blick< bersieht
die Topographie der Positionen, fr die das Ordnungsraster vorgegeben ist: die
Vermittlung der Extreme der Negation und der Bewahrung.
Das eine Extrem, die negative Freiheit der Idee, eine Richtung, die sich kri-
131
tisch gegen alle Unmittelbarkeit verhlt, sieht Bayrhoffer reprsentiert in Richter,
Strau und Vatke.
204
Gerechtfertigt wird dies fr Strau und Vatke wegen ihrer
religionskritischen Arbeit und fr Richter wegen seiner positiven Religionsstif-
tungsversuche (das ist konsequent dialektisch: auch auf der negativen Seite gibt es
wieder ein Zerfallen in kritisch und positiv). Der negativen Seite wird auch das
junge Deutschland locker assoziiert, welches Saft, Fleisch und Leben in die Idee
bringen will.
205
Das andere Extrem ist die Bewahrung der positiven konkreten Wirklichkeit,
die in das Befangensein in der positiven Unmittelbarkeit umgeschlagen ist.
206
Zwar sei hier der denkende Geist in der Tiefe des Gemts offenbart, aber er
ist gefesselt, weil diese Richtung die positive Wirklichkeit ebenso wie die Form
der Idee nur bewahren will und sich gegen das negative Moment der Freiheit stellt.
In dieser Reihe finden sich Gschel, B. Bauer, Erdmann, Leo, Billroth und andere
zusammen. B. Bauer wird dem positiven Extrem offensichtlich aufgrund seiner
Polemik gegen Strau zugeschlagen und gert in eine Reihe mit Leo, der im glei-
chen Jahr seinen Angriff auf die Hegelingen startet. Gleichsam kontrapunktisch
zum >jungen Deutschland< auf der negativen Seite erscheinen am Rande des positi-
ven Extrems die Pseudohegelianer Fichte und Weie.
207
Schlielich definiert Bayrhoffer die Reihe derer, welche die Idee wahrhaft, in
der spekulativen Vermittlung von Form und Inhalt, denkender und seiender Ver-
nunft fortzubilden strebten und streben, und so das wahre freie Reich der Idee bil-
den.
208
Die Liste der auf Vermittlung Zielenden, zu der sich auch Bayrhoffer selbst
rechnen mchte, umfat 20 Personen. Neben den Herausgebern der Werke
Hegels sind unter anderen Gabler, Hinrichs, Rosenkranz ebenso genannt wie Ruge
und Feuerbach. Bayrhoffer konzediert, da unter den Genannten manche speziel-
lere Gegenstze herrschen, aber entscheidend sei, da die in die besonderen
Gebiete eindringende Idee wie eine in denselben aufgehende Sonne die einseitigen
Gegenstze, Extreme und Voraussetzungen in diesen Sphren auflst, sie in den
Begriff erhebt und in seinem konkreten Elemente entfaltet.
209
Die Bayrhoffersche Topographie der Positionen versucht zu balancieren. Nega-
tion und Bewahrung sind die Flgelmchte, die sich wieder in sich in Gegenstze
aufspalten, um sich durch ihre Bewegung mit der vermittelnden Arbeit der dritten
Reihe auszutauschen. Es handelt sich um ein dialogisches Modell, in dem die kon-
troversen Positionen im Hinblick auf ihren mglichen Dialog geordnet werden.
Der >erste Blick< sieht das Trennende des Streits, der >zweite Blick< sieht eine Ord-
nung mglichen Fortschreitens, eine Ordnung, die dialogischen Austausch antizi-
piert. Negation ist eine Frage an die Bewahrung und umgekehrt.
Die dritte vermittelnde Reihe ist die umfangreichste. Es ist heikel, diesen Ort per-
sonell allzu sehr auszudnnen. Zunchst ist es vom Modell her heikel, denn zwar
liee sich gedanklich auch diese Reihe noch positionalistisch in Dialoge aufspalten,
in die unendlichen Verfeinerungen des Positiv/Kritisch zerteilen, aber da auf der
Ebene geschichtlicher Konkretion Namen genannt werden mssen, wer bliebe
dann in dieser Reihe brig? Zum zweiten ist es heikel, hier nur wenige zu nennen,
weil die Gefahr bestnde, da die ganze Positionstopographie fr die Genannten
nicht akzeptabel wird.
Ob wohl alle hier von Herrn Dr. Bayrhoffer aufgezhlten sich die Rubrizierung
132
gefallen lassen werden, oder doch ihrer geistigen Stellung nach gefallen zu lassen
brauchen? fragt Leo und hlt Bayrhoffer jene Reihungen vor, die Michelet im sel-
ben Jahr den Zeitgenossen darbietet.
210
Und in der Tat besteht soziologisch das
Problem darin, da es zur personalen Bestimmung der Momente der sich entfalten-
den Totalitt Hegelschule einer innerschulischen Autoritt bedrfte, die in der
Lage wre, die Definitionen durchzusetzen. Da eine solche Definitionsmacht in der
Selbstdefinition der Schule nicht vorhanden ist, kommt es zu den differentesten
spekulativen Deutungen der Spaltungssystematik, nicht nur in der Weise, da zu
einem gegebenen Zeitpunkt Uneinigkeit herrscht, wer wo anzusiedeln wre, son-
dern auch dergestalt, da die neuen hegelianischen Publikationen, die Fortschritte
in der Durchfhrung der absoluten Idee, die personale Bestimmung der
Momente der sich entfaltenden Totalitt Hegelschule durcheinander bringen.
So vorsichtig auch die Topographie der Positionen angelegt wird, auf der
schwankenden Basis der Hegeischen Dialektik gert die Topographie selbst zur
Position. Wer der wahren vermittelnd aufhebenden Spur folgt, die dem Denken
des Schulgrnders gerecht wird, und wer im >abstrakt Negativem oder im >abstrakt
Positivem sich verfngt - die Geschichte der Hegelschule und die Geschichte der
Hegelinterpretation bis heute zeigt, da diese Frage nicht einigungsfhig ist.
Knnte diese Frage deshalb nicht einigungsfhig sein, weil die Topographie der
Positionen immer nur auf den zweiten Blick erfolgt, weil sie Vermittlungen antizi-
pieren mu, die die Unvershnlichkeiten des ersten Blicks auf den Streit transzen-
dieren? Wird die Topographie der Positionen selbst positionell, weil kein Intellek-
tueller sich gern das Ereignis des Denkens vorsehen lassen will? Gadamer bemerkt:
Hegels Dialektik ist ein Monolog des Denkens, der vorgngig leisten mchte, was
in jedem echten Gesprch nach und nach reift.
211
Fr die Positionstafeln der
Hegelschler trifft dies zu, sie sind Vorgriff, auch wenn sie sich auf Positionen
beziehen, die vorliegen.
Am konsequentesten hat vielleicht Rosenkranz das Problem begriffen, indem er
dem biederen Ernst, mit dem etwa Michelet eine komplizierte dialektische Schulsy-
stematik entfaltet, den Charakter der Spiels entgegen hlt. Rosenkranz publiziert
1840 die Komdie Das Centrum der Speculation.
21
"
1
In der ersten Szene trauert der Chor der Eulen auf dem Berliner Kirchhof vor dem Oranien-
burger Tor an den Grbern Fichtes, Solgers und Hegels: Ringsum schauen wir aus, doch
nirgends sehen wir Hilfe, / In das Zentrum (der Spekulation, d. V.) trifft keiner der Leben-
den mehr.
21
' Ein Herold berbringt den Hegelianern einen Vorschlag der um das Schick-
sal der Philosophie ebenso besorgten Gttin Athene, auf der Berliner Hasenheide ein Wett-
schieen zu veranstalten, um zu ermitteln, wer in der Lage sei, den Punkt, / Zu treffen in
der Scheibe, welchen Hegel traf, / Das Punctum saliens. Drauf kommt es jetzo an. / Es tret'
ein jeder kampfgerstet vor, /Je nach der Reihe schiee jeder los, / Denn also hat Minerva
es befohlen mir.
214
Auf dem Schieplatz kommt es zum lrmenden Streit der Schler, bei
dem Rosenkranz die einzelnen Positionsbestimmungen des Zentrums in Szene setzt.
Schlielich treten, durch den Streit aufmerksam geworden, zwei Polizisten auf, denen es
gelingt, die Philosophenversammlung ohne Schwierigkeiten aufzulsen. Die anwesende
George Sand, die beim Erscheinen der Polizei gleich an Aufstand und Barrikadenbau denkt,
wird von Franz von Baader beruhigt: Madame, restez transquille. Nous sommes en Prusse.
Le gouvernement y est trop eclaire et se rejouit d'une trop grande Sympathie avec toutes les
classes de la societe, pour craindre une revolte. (. . .) Vous verrez bientot, que ce n'est,
133
qu'une comedie.
215
Sie reist nach Paris ab, o l'on possde l'art, de composer des erneutes
et des barricades, d'une manire si admirable.
216
Fr den Soziologen ist Rosenkranz' Komdie sehr hilfreich, weil er den kontin-
genten Charakter des Positionenstreits deutlich macht. Seine Pointe - die Philoso-
phen streiten sich, bis die Polizei kommt, und keiner ist zu einem Schu gekommen
- verweist darauf, da im Zentrum des Paradigmas, das zur Debatte steht, sich eine
Leerstelle befindet. Daher ist der Positionenstreit kaum zu beruhigen, im Gegen-
teil, er wird durch diese Leerstelle immer wieder genhrt. Will die soziologische
Analyse von Intellektuellengruppen nicht bei der Betrachtung >uerer< Bedingt-
heiten geistiger Ttigkeiten stehenbleiben, sondern einen Schritt in Richtung auf
ein soziologisches Verstndnis des Phnomens >Positionenstreit< tun, so darf sie
nicht das >Warum< des Streits als ein schon Gegebenes voraussetzen. Sie mu auf
der Offenheit des Positionenstreites, die sich in einer philosophischen Schule als
Leerstelle des Paradigmas zu erkennen gibt, insistieren.
Wenn die Hegelschler versuchen, ihren Streit als dialektische Einheit zu defi-
nieren und ihre Position in einer dialogischen Struktur vorgreifend zu plazieren, so
dient dieses Verfahren einmal dazu, die Bedrohlichkeit des Streits zu bannen, denn
einige werden sich vielleicht ihre Einordnung und die anderer gefallen lassen,
zugleich aber entfesselt dieses Verfahren den Streit erneut, wenn die Positionalitt
des Verfahrens thematisch wird.
Das Moment einer dialektischen Einheit der streitenden Positionen birgt aber
ber das Gesagte hinaus noch weitere Probleme. Auf der Ebene des Modells lassen
sich bei jeder gegebenen Anzahl von Schulmitgliedern dialogische Ordnungen des
Positiv/Kritisch antizipieren - zu fragen ist jedoch, wie gesichert werden kann, da
auch alle wesentlichen Positionen bercksichtigt werden. Fr Bayrhoffer gibt es
zwar in der Schule so etwas wie Abflle von der Idee, aber diese Erscheinungen
betrfen immer nur eine Beschrnktheit im Individium. Dies seien daher aber
nicht eigentlich Abflle von der Idee, sondern von ihrem Formalismus in einem
Individuum. Das bedeutet: von der Idee selbst ist Abfall ohnmglich, weil sie
die Auflsung aller Standpunkte und aller Widersprche ist.
217
Ins Soziologische bersetzt lautet Bayrhoffers Schulregel: wenn eine Position als
ein Abfall vom Paradigma verdchtigt wird, so ist davon auszugehen, da es sich
nur um Strungen handelt, deren Grund in uerlich-schematischen Dimensionen
liegt, z. B. in einer ungewohnten Art zu formulieren, einer irritierenden Art der
Systematik u.a.m. Von diesen Eindrcken her darf nicht darauf geschlossen wer-
den, da ein Abfall stattgefunden habe, sondern es ist ein Gebot der Gruppe, diese
verdchtige Position als ein Moment der Entwicklung der Idee anzuerkennen.
berspitzt formuliert: der Schulregel zufolge kann kein Hegelianer der Schule ver-
lorengehen.
Natrlich ist dies eine prekre Regel, denn sie ist kaum durchzuhalten. Dies zei-
gen besonders deutlich die Konstellationen, die zur Grndung der HJ gefhrt
haben. Der Idee der Schule nach wre diese Zeitschrift nicht ntig gewesen, denn
die Schule besa in den von Hegel begrndeten Jahrbchern JWK) ein Organ, das
die Momente der Totalitt Schule zur Darstellung bringen sollte. Aber in dem
Augenblick, wo die Berliner Redaktion nicht mehr alle Positionen in die Zeitschrift
aufnimmt, entsteht fr die Abgewiesenen ein gravierendes Problem. Anla fr
134
Ruge, an die Grndung einer eigenen Zeitschrift zu denken, ist konkret gewesen,
da seine kritische Rezension von Erdmanns Leib und Seele (Halle 1837) von der
Berliner Redaktion der JWK abgelehnt wird.
218
Der Positionenstreit zwischen dem
hegelianischen Ordinarius Erdmann und dem hegelianischen Privatdozenten
Ruge, beide in Halle, drohte innerschulisch unentfaltet zu bleiben.
Wichtig an diesem Vorgang ist in unserem Zusammenhang, da das dialogische
Positionenmodell durchkreuzt wird von einer anders gelagerten Ordnung, die die-
jenigen, die ganz dazugehren, von denen trennt, die noch nicht ganz dazu geh-
ren. Das heit, das dialogische Positionenmodell bedarf gleichsam adialogischer
Begrenzungen, die hier nach Magabe des Universittsranges erfolgen. F. W. Graf
hat zu Recht darauf aufmerksam gemacht, da die Spaltung der Hegelschule ber-
wiegend zwischen denen verluft, die keine akademische Laufbahn einschlagen
knnen, und denen, die sich an der Universitt durchsetzen.
219
Die Entlassung der
Philosophie aus dem Staatsdienst und die Spaltung der Schule greifen ineinander.
Fr die Selbstdefinition der Junghegelianer entscheidend ist, da sie ihre Zei-
tung, die HJ, nicht positioneil bestimmen, sondern gleichsam das Modell der JWK
wiederholen wollen. Ruge anerkennt, da ohne die JWK und ohne den durch sie
gelegten Grund wir selbst nach keiner Seite hin mit diesen Jahrbchern (den HJ, d. V.) den
Erfolg und die Wirksamkeit gewonnen htten, deren sie sich rhmen knnten.
220
Aller-
dings htten die JWK in der letzten Zeit nicht vllig dem Geiste entsprochen, aus dem sie
hervorgegangen, sie seien zu ngstlich bestrebt gewesen, die Philosophie in dem von
Hegel gegebenen Bestand zu erhalten und in verkncherten Phrasen fortzupflanzen, anstatt
das unsterbliche Prinzip, das er der Zeit zum Bewutsein gebracht, sich frei entwickeln und
zu neuen Konsequenzen und zu immer reineren Formen sich fortbilden zu lassen.
221
Mit der Wiederholung des dialogischen Positionsmodells wiederholen sich in
der junghegelianischen Schule die Probleme, ihren Streit in einer binren Struktur
von positiv/kritisch zu ordnen. Wenn der Althegelianer Hinrichs auf die Zerstrit-
tenheit der Junghegelianer verweist, so wird ihm der Junghegelianer G. Julius das-
selbe hegelianische Argument vorhalten, das Michelet zur Interpretation der Schul-
kmpfe gebrauchte:
der junghegelianische Streit der Stimmfhrer knne nicht als ein Zeichen der Zerrttung
und des Untergangs angesehen wreden. Als ob es nicht gerade ein Zeichen des regsten
Lebens wre! Im Denken stehen bleiben wre ja Tod! Denken, Prfen ist eine Parteisache,
keine Sache, die sich durch die kompakte Masse ihrer Anhnger anempfehlen und durchset-
zen mte. Der Gedanke des einen setzt sich durch, indem er vom anderen erwogen, aufge-
nommen, weiter verarbeitet, umgebildet wird; nichts natrlicher, als da unter strebenden,
denkenden Menschen der eine immer wieder ber den anderen hinausgeht oder hinauszu-
gehen glaubt: es ist ein Wettlauf, der nie endet, und dessen Ende Tod und Fulnis wre.
222
Der Dialog der Positionen ist unendlich. Dies macht das Ungeheure intellektuel-
ler Ttigkeit aus, vor dem man wie Paul Valery erschrecken kann: Intellektuell. . .
Jedermann an meiner Stelle htte begriffen. Aber ich! . . .
223
Fr den Junghegelia-
ner G. Julius wird die unendliche dialogische Binaritt von positiv/kritisch zu
einem Spiele des Verstandes mit sich selbst.
224
Es ist dies ein Spiel, an dem teilzu-
nehmen die kulturelle Gruppe sich zur Pflicht machen mu, wenn sie Kultur
begrnden will. Gegen den Vorwurf von Zeitgenossen: Vielrednerei ist
Geschwtz! setzt Rge:
135
Die Rede ist die Tat des Menschen, nur die Rede ist rein menschliche Tat, die Tat eines gei-
stigen Wesens. Nicht reden drfen heit, nicht Mensch sein drfen, nicht reden wollen,
heit, das Bedrfnis, Mensch zu sein, noch nicht empfinden.
225
Der Wissenssoziologe kann sich zwar angesichts dieses Phnomens auf den Weg
machen und hinter den Grnden, die in der Rede vorgebracht werden, andere
Grnde ausmachen, Grnde, die nicht gesagt worden sind, weil sie einer >stum-
men< Basis entstammen, Grnde, die er nun sagt. Aber woher nimmt er sein Recht,
dies zu tun? Nimmt er so nicht auch teil am Spiele des Verstandes mit sich selbst?
Der Begriff der Ideologie fhrt hier nicht weiter, weil er das Ungeheure intellektu-
eller Ttigkeit nur zu beruhigen, aber den leeren Grund der Beunruhigung nicht
auszuhalten vermag.
Wo der Positionenstreit entbrennt, passiert allerorts hnliches. Nicht nur den
preuischen Junghegelianern geht es so, sondern auch der Moskauer Intellektuel-
lengruppe, an die sich Alexander Herzen erinnert:
Man sprach fortwhrend ber die Hegelsche Philosophie. Die drei Teile der Logik und die
zwei der sthetik und Enzyklopdie enthalten keinen einzigen Paragraphen, der von uns
nicht im Sturme und im verzweifelten Kampfe schwerer Nchte genommen wurde. Men-
schen, die sich schtzten und lieb hatten, sahen sich wochenlang nicht an, weil sie sich ber
die Definition des bergreifenden Bewutseins< nicht einigen konnten, und faten eine ent-
gegengesetzte Ansicht ber die >absolute Person und ihr An-sich-Sein< als persnliche Belei-
digung auf.
226
Anerkennt man die Existenz eines leeren Grundes, der im Dialog der Positionen,
wo er dem Strickmuster des Positiv/Kritisch bis zur Erschpfung folgt, sich auftut,
so kann das dringliche Bestreben der Individuen verstndlich werden, nach Defini-
tionsmerkmalen fr den Positionenstreit zu greifen, mit denen der leere Grund
gefllt werden kann. Das Spiel des Verstandes mit sich selbst ist sozial nicht
akzeptabel. Die sophistische Gefahr des Selbstzweckhaften der Rede, von der ich
in der Einleitung gesprochen habe, fordert soziale Vorkehrungen heraus.
227
Der dialektischen Selbstdefinition der Schule als einer produktiv in bewahrende
Positivitt, kritische Negation und Vermittlungsarbeit zerfallenden Totalitt kam
ein beilufiger Einfall von D. F. Strau zu Hilfe: die Definition der Hegeischen
Rechten, Linken und des Zentrums. Man kann den Einfall getrost das Ei des Kolum-
bus fr die Definition des Positionenstreites nennen. Der Einfall konnotierte die
spekulative Ebene mit einer Ebene, die auf anderes verwies, auf ein weites Terrain
unerschpflicher Grnde, die bereit standen, dem autophagischen Dialog in den
Rachen geworfen zu werden. Zugleich war es eine Ebene, die als >Notbremse< in
Betracht kommen konnte, wenn das verrterische berlaufen der Gedanken von
der einen Seite zur anderen allzu groe Turbulenzen zu erzeugen drohte. Mit der
Rechten, Mitte oder Linken waren Orte bezeichnet, in denen fr krzere oder ln-
gere Momente Ruhe gefunden werden konnte.
In dieser Arbeit wird nicht von Rechts- oder Linkshegelianern gesprochen. Das
politische Richtungsschema war und ist dort, wo versucht wurde, es fr die Defini-
tion der Schulspaltungen durchzufhren, auf der Ebene philosophischer Diskus-
sion nicht einigungsfhig.
228
Die Beschrnkung auf die von W. R. Beyer vorge-
136
schlagenen alten Oberbegriffe Alt- und Junghegelianismus
229
bringt nicht nur
pragmatisch gesehen erheblich weniger Einordnungsprobleme, sie reflektieren
darber hinaus als zunchst denunziatorisch von auen an die Schule herangetra-
gene Begriffe, die dann z. T. als Selbstdefinition bernommen wurden,
230
die Tat-
sache, da das, was diese Junghegelianer sind, in ihren Diskussionen gerade zur
Klrung ansteht.
Der Strausche Einfall bezieht sich zunchst nur auf ein spezielles Problem der
spekulativen Deutung der Evangelien. Ob nun die Evangelien mit dem philosophi-
schen Begriff des Gottmenschentums entweder ganz oder nur teilweise, schlielich
weder ganz noch teilweise als historisch wahre Berichte zu erhrten seien, diese drei
Antworten knne man nach der herkmmlichen Vergleichung als rechte Seite,
Zentrum oder linke Seite bezeichnen.
231
Zur Rechten zhlt Strau die berwie-
gende Zahl der Mitglieder der Hegelschule, fr das Zentrum wei Strau eigentlich
nur einen (Rosenkranz) zu nennen. Whrend er die Rechte ausgiebig ber 24 Seiten
charakterisiert, dem Zentrum 6 Seiten widmet, so ist die Linke mit einem vierzeili-
gen Halbsatz reprsentiert:
Strau wrde auf die linke Seite der Hegelschen Schule treten, wenn es diese Schule nicht
vorzge, mich aus ihrem Bereiche ganz auszuschlieen, und anderen Geistesrichtungen
zuzuwerfen; - freilich nur, um mich von diesen, wie einen Ball, wieder zurck geworfen zu
bekommen.
232
Strau steht vor demselben Problem wie Ruge, auch seine Positionen der Evan-
gelienkritik werden in den JWK nicht publiziert.
Fr die Hegelschule ergeben sich zwei Probleme: 1. Ist die herkmmliche Ver-
gleichung, die Strau einbringt, d. h. die politische Richtungsebene, philoso-
phisch berhaupt akzeptabel? 2. Wie soll sie sich auswirken? Michelet, der das
politische Richtungsschema rasch aufgreift, mu sich von einem Rezensenten sagen
lassen, die Analogie zur franzsischen Kammer sei kaum akzeptabel, denn in den
politischen Begebenheiten trten die Individuen mit ihren aufs Endliche gerich-
teten Leidenschaften auf den Schauplatz. Philosophisch korrekt msse man sich
auf die Weltgeschichte im Ganzen und die Philosophie der Geschichte bezie-
hen, es drfe nicht einem einseitigen politischen Treiben dieser hohe Wert beige-
legt werden (. ..). Was sollen auch Kategorien, wie Rechts, Links und Zentrum,
einer Schule dienen, die sich im Besitze der absoluten Wahrheit wei?
233
Auch Michelet mte sich eingestehen, wie ungengend die politischen Katego-
rien seien, da immer nur in Rcksicht auf einige Stze des einen oder anderen die
Klassifikation vorgenommen werden kann, die durch andere Behauptungen wie-
derum umgestoen wird.
234
Der Einwand trifft ein Kernproblem der Versuche,
eine politische Bezeichnungsebene fr philosophische Positionen einzufhren.
Denn die Attribute >rechts< und >links< knnen auf der spekulativen Ebene sich
jeweils nur in einer Sache auf verschiedene Momente der Sache selbst beziehen,
d. h. es geht hier allenfalls um eine dialektische Systematik von >rechten< bzw. >lin-
ken< Argumenten. Auf der politischen Ebene jedoch bezeichnen die Attribute
jeweils die letztlich auf die ganze Person zielende Kohrenz eines in sich stimmigen
Ensembles von Argumenten.
Die mglichen Auswirkungen des politischen Richtungsschemas werden rasch
deutlich, wenn Michelet 1838 schreibt:
137
So schlage ich die Koalition des Zentrums mit der linken Seite vor: was eine kompakte
Majoritt bilden wrde, deren Leiter der Abgeschiedene (d. i. Hegel, d. V.) selber bleiben
wrde. Wenn dann Strau in Berlin sich zu meinen Vortrgen hielt, so will auch ich mich
jetzt meinerseits unter obiger Klausel zu ihm halten. Als diejenigen, die unbedenklich mit
auf diese Seite treten, nenne ich, ihrer Zustimmung gewi, Gans, Vatke, Benary: und drnge
eine Menge sich mir darbietender Namen nur darum zurck, weil ich ihrer Erklrung nicht
vorgreifen will.
235
Da Michelet den Tod des Lehrers nicht rckgngig machen kann, bedeutet sein
Vorschlag nichts weniger, als eine Art demokratisches Abstimmungsverfahren in
Fragen der Christologie. Entscheidend fr die Zuordnung einzelner Hegelschler
bzw. einzelner Argumentationen im Rahmen einer spekulativen Totalitt ist hier
nicht mehr die systematische Interpretationsleistung eines Philosophen - so noch
bei Strau und Bayrhoffer -, sondern vielmehr das vereinsmige Abstimmungs-
verhalten selbst. Michelet will den Selbsterklrungen durch Interpretation nicht
vorgreifen. Da dieser Vorschlag jedoch dem Hegelschen Begriff der Einen
Philosophie, die produktiv in ihre Momente zerfllt, zutiefst entgegenluft, macht
Hinrichs in den HJ deutlich.
236
Ihm ist schon die Definition der Hegelschule bei
Michelet nichts als eine lcherliche Cliquenmacherei.
Die Philosophie kann aber von niemand einer so komischen Frage blogestellt werden, als
von einem Philosophen, der die Schule ber sie zur Abstimmung aufruft. Fr Hinrichs sind
gegen dies Verfahren selbst alle unphilosophischen uerungen, in denen sich die Besorg-
nis um den Glauben, mit seiner Frage nach der Unsterblichkeit, der Persnlichkeit Gottes
ausspricht, vorzuziehen, weil sie doch immer ein Ansto zum Philosophieren, whrend die
Parteimacherei irgend einer Koalition mit dem Philosophieren ein fr allemal fertig ist.
Michelets Vorschlag ist aus Not geboren. Wenn die Positionstafeln, die ein
Schulmitglied aufstellt, aus den oben genannten Grnden nicht einigungsfhig
sind, wenn Gefahr besteht, da der stille Ausschlu von Positionen nicht mehr
funktioniert, weil sie wie ein Ball wieder zurck geworfen werden, was bleibt da
brig, als abzustimmen? >Schlu der Debatte - Abstimmung<: fr eine philosophi-
sche Schule ist dies Verfahren inakzeptabel, sofern es um den positiv-kritischen
Dialog geht. Aber die Parteimacherei, dieser Zwischenraum, in dem die dialogi-
schen berraschungen der Dialektik ein bichen nach herkmmlicher Verglei-
chung kontrolliert werden knnen, ohne da sie ganz getilgt werden - er eignet
sich hervorragend fr die Selbstdefinition des Positionenstreits. Hinrichs' grund-
stzlicher Widerstand gegen die politische Bezeichnungsebene in philosophischen
Fragen hat nicht lange gehalten. 1842, in seiner Rezension von B. Bauers >Posaune<,
unternimmt er selbst den Versuch, sich im politischen Richtungsschema zu veror-
ten.
237
Die Rechte - die Mitte - die Linke: es handelt sich um ein groartiges soziales
Sortierschema. Welche Klarheit der Beschrnkung und welche Unendlichkeit der
Mglichkeiten! Keine Stillegung des Dialogs, vielmehr eine permanente Anreizung
des Dialogs, aber auch keine berreizung des Dialogs, sondern seine fortwhrende
Zhmung. Der wilde Tausch der Argumente kann zum geordneten Spiel werden,
und das ngstliche Schweigen, das die Situation der Abstimmung mit sich bringt,
ist aus dem Positionenstreit vertrieben. Die Rechte - die Mitte - die Linke: sie ist
138
geschichtlich konkret und das Spiel des Verstandes mit sich selbst, in ihr hat die
Schule die Dialektik, die sie am Begriffe aufweist, an sich selbst vollzogen.
238
Den Siegeszug dieses Sortierschemas, das die Hegelforschung bis heute nicht in
Ruhe lt, kann eine Soziologie der Intelligenz aufhellen helfen, wenn sie auf die
sozial wohlttigen Folgen verweist, die eine Selbstdefinitionsformel bietet, die so
klug der Not des Denkens gehorcht und zugleich der Gefahr begegnet, im Dialog
sein Gesicht zu verlieren.
Anmerkungen
1 Soziologische berlegungen, die fr eine Errterung des Phnomens >Schule< relevant
gemacht werden knnen, finden sich oft verstreut in wissenschaftssoziologischen Arbei-
ten. Hervorgehoben seien: H. P. Bahrdt (1971); P. Weingart (1973/74). Bei
Th. S. Kuhn (1967) finden sich nur wenige Hinweise auf >Schulen<. Erst im >Postskrzpt
1969< (in: P. Weingart (1973) Bd. 1, S. 287-319) geht Kuhn auf Gemeinschaftsstruktu-
ren und Gruppenbildungen von Wissenschaftlern ein und versucht, sie mit seinen The-
sen zum Paradigmenwechsel in Verbindung zu bringen. Verstreute Hinweise zum Schul-
problem finden sich in den Beitrgen des Bandes v. N. Stehr, R. Knig (1975). - Anre-
gend ist immer noch das Kapitel ber Schulen in: F. Znaniecki (1940) S. 91163. Wichti-
ges Material bietet S. R. Mikulinsky (1977). Gegenber dem oftmals anzutreffenden
abwertenden Unterton, mit dem ber >Schulen< gesprochen wird, heben sich die Bei-
trge in: W. Lepenies (1981) Bd. 2, Teil 3, Theoriegruppen, Schulen und Institutionali-
sierungsprozesse, deutlich ab. berlegungen zur Definition von >Schule< finden sich
inbesondere in den Beitrgen: J. Szacki und E. A. Tiryakian.
2 E. A. Tiryakian, in: W. Lepenies (1981) S. 43-45, Zitat 43.
3 Ebd. S. 40-42.
4 M. Weber (1964) S. 350 f. Zitat 351.
5 Siehe hierzu meine Ausfhrungen im Kapitel IV dieser Arbeit.
6 Vgl. W. Krohn (1976) S. 28.
7 Vgl. Ebd. S. 19.
8 Ebd. S. 20.
9 Ebd. S. 21. Weitergehende Folgerungen in Richtung auf eine Finalisierung der Wis-
senschaften sind jedoch m. E. hieraus nicht abzuleiten.
10 Zum Problem der Trennung des >Wissenschaftlers< vom >Philosophen< im Hinblick auf
die neutrale Sphre Wissenschaft vgl. W. van den Daele (1977) S. 129-182, hier S. 164 ff.
11 M. Weber (1964) S. 350.
12 Ebd. S. 837.
13 Vgl. A. Schindler (1978) S. 70 ff.
14 Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Arbeiten von J. Lacan, der die Position des
Vaters in seiner psychoanalytischen Kulturtheorie besonders prgnant akzentuiert hat.
Eine auf gesellschaftstheoretische Probleme bezogene Interpretation Lacans hat A. Lipo-
watz (1982) vorgelegt. Vgl. auch J. Storck (1974).
15 Wie dies geschehen soll, macht die >Ratschlagliteratur< fr Studenten in der ersten Hlfte
des 19. Jahrhunderts so deutlich: ber den Umgang mit Professoren und ffentlichen
Lehrern heit es: Sie stehen hoch, er ist nur Anfnger; jene sind fortgeschritten in
Weisheit und Lehre; und sind, auch wenn z.T. noch jung an Jahren, doch alt in gesam-
melter Erfahrung. Von selbst also tritt eine Art Scheidewand zwischen den Studierenden
und den Lehrer, welche durch die Achtung noch hher gezogen wird, und welche nur die
139
Liebe durchschauen und gleichsam durchbrechen lt. (anonym, Brief ber das kono-
mische und wissenschaftliche Leben eines Studierenden, 1828, S. 98 f.)
16 L. Schlickert (1978) S. 126.
17 Siehe Anm. 2.
18 M. Weber (1964) S. 458.
19 Zur>Empfindsamkeit< vgl. insbesondereG. Sauder (1974); W. Doktor (1975); R. Meyer-
Kalkus (1977).
20 Diese These ist subtil entwickelt von M. Schneider (1980) S. 11 ff., u. a.
21 Vgl. H. Gerth (1935) S. 62 ff.; C. Brinkmann (1932).
22 Der sptere Turnvater Jahn kritisiert die alten Verbindungen: Da die Krnzchen blo
aus Leut en ei ner Gegend si ch rekrut i eren, so kann ei n Haupt zweck des akademi schen
Lebens, di e Abschl ei fung durch den Umgang mi t Fremden, ni cht errei cht werden. Der
Krnzchen-Geist macht ungesellig gegen jeden, der nicht aus einer Gegend ist: weil ihren
Geset zen zuf ol ge ei n Kr nzi aner mi t kei nem f r emden Landsmann al s St ubenbur sch
zusammen wohnen, vi el weni ger vert raut e Freundschaft mi t i hm schl i een darf. Kei n
Fr eundschaft s-Band knpft di e Mi t gl i eder anei nander, sondern das Schwert . Wer das
Krnzchen verlassen will , mu mit dem Senior und den Vier Conseniores si ch duelli e-
ren. (Zit. nach C. Brinkmann (1932) S. 10)
Zur s ozi al en Bedeut ung von Fr eunds chaf t s bezi ehungen vgl . A. Sal omon ( 1921) ;
W. Rasch (1936); F. H. Tenbruck (1964). Hilfreich ist auch K. Lankheit (1952). Anre-
gungen sind zu finden bei H. Kern (1932); S. Kracauer (1972).
23 H. Gerth (1935) S. 63.
24 Vi el es an den neuen Verbrderungen der Ami ci st en, Konst ant i st en und Uni t i st en ver-
weist auf einen Zusammenhang mi t den geheimen Gesellschaft en des 18. Jahrhunderts,
den nor ddeut schen Fr ei maur er l ogen und den sddeut schen I l l umi nat en. Di e egal i t r
demokrat i sche Tendenz und das humani st i sche Menschhei t si deal si nd hi er zu nennen.
Auf den kompl i zi er t en Versel bst ndi gungspr oze der st udent i schen Ver br derungen
soll hier nicht ausfhrlich eingegangen werden. Wichtig ist, da im Zuge der Revolutions-
zei t di e Hochschul regi erungen gegenber der neuen Bewegung i n ei ne ei gent ml i ch
doppelseitige Stellung gerieten: Als aufklrerische Gegner der althergebrachten Uni-
versitts-Sonderrechte muten sie dem aufgeklrten Absolutismus willkommen, als Tr-
ger liberal-demokratischer und (was im damali gen zerrissenen Deutschland den Regie-
rungen gleich gefhrlich war) je nach dem nat ional en oder internationalen Ideal e aber
muten sie diesem Absolutismus wieder ebenso bedenklich sein. (C. Brinkmann (1932)
S. 12).
25 J. W. v. Goethe, Dicht ung und Wahrheit,
5
1964, S. 558.
26 Zit. nach M. Lenz (1910-1918) Bd. 4 S. 357 f.
27 W. v. Humboldt, Der knigsberger und der litauische Schul plan, 1920, Bd. 13, S. 278.
Vgl. H. Schelsky (1963) S. 91 ff.
Humboldts Begrndung des sozialen Aspekts wissenschaftlicher Arbeit lautet: Da aber
auch das geistige Wirken in der Menschheit nur als Zusammenwirken gedeiht, und zwar
nicht blo, damit einer ersetze, was dem anderen mangelt, sondern damit die gelingende
Ttigkeit des einen den anderen begeist ere und allen die all gemeine, ursprngliche, in
den einzelnen nur einzeln oder abgeleitet hervorstrahlende Kraft sichtbar werde, so mu
die innere Organisation dieser Anstalten ein ununterbrochenes, sich immer selbst wieder
bel ebendes, aber ungezwungenes und absi cht sl oses Zusammenwi rken hervorbri ngen
und unterhalten. (W. v. Humboldt, ber die innere und uere Organisation der hhe-
ren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin (1810), zit. nach H. Schelsky (1963) S. 93).
28 (B. Bauer?), Die Mythe von Hegel, RhZ 167 16. 6. 1842.
29 Ebd.
30 K. Mannheim (1952) S. 136 f.; vgl. auch H. Weil (1967) S. 9.
140
141
das Prinzip der Revolution nach Preuen bertragen, ihre Resultate zum Segen des Staa-
tes dorthin verpflanzt. (S. 322) Stein habe sich hier eben im Widerspruch mit sich
selbst befunden. Ebenso wird mit Steins nicht in die junghegelianische Argumentation
passender liberalistisch gefrbter Kritik an der Brokratie umgegangen. Gerade die
Steinschen Passagen, in denen auf den parasitren Charakter der Brokratie und ihre in
der Eigentumslosigkeit begrndete Verantwortungslosigkeit verwiesen wird, - Passagen
also, die am ehesten geeignet wren, ein brgerlich revolutionres Bewutsein zu signali-
sieren, werden von Meyen als abstrakte Vorstellung abgetan. Fr ihn gehrt die Bro-
kratie zum unverzichtbaren Inventar des fortschrittlichen preuischen Staates. Der
belstand der Brokratie, den Meyen sieht, beruht in der Abgeschlossenheit von der
Nation, in dem Mangel an korrespondierender ffentlichkeit, welche die Beamten in
stets lebendigem Verkehr mit dem Publikum erhlt, und ein freieres, humaneres Verhlt-
nis beider zueinander begrndet. Das Verdienst der ausgezeichneten Mnner wrde
dadurch bei weitem mehr hervorgehoben, ihr Einflu erhht, und die Rohheit der bri-
gen paralysiert werden. (S. 338) Da Steins Parteinahme fr die Pietisten Meyen nicht
ins Konzept pat, sei nur am Rande erwhnt.
E. Bauer verteidigt 1842 den Patriotismus der Jungehegelianer: Wir wissen aus der
Geschichte, da der preuische Staat eine Idee vertritt - die des Fortschritts. ( . . . ) Sind
wir keine Patrioten, wenn wir die Interessen der Idee verfechten, da wir wissen, da sie
allein es sind, welche einem Staate seine Macht, sein Ansehen geben? Sind wir es wirklich
nicht? Ja, wir sind echte Preuen. (E. Bauer, Wer ist Preue? RhZ 66, 7. 3. 1842) Zur
Konstanz der Argumentation vgl. E. Meyen, Blick auf den Ansto und die Richtung der
deutschen Bewegung, BM 1844, S. 215 f., 234.
58 So z. B. in Berlin: P. K. Marheineke (1780-1846), G. A. Gabler (1786-1853). L. v. Hen-
ning (1791-1866), E. Gans (1798-1839), C. L. Michelet (1801-1893), W. Vatke (1806-
1882), H. G. Hotho (1802-1873). In Haue: F. W. Hinrichs (1794-1861), J. Schaller
(1810-1*868), J. E. Erdmann (1805-1892). In Knigsberg: K. Rosenkranz (1805-1879).
Vgl. J. E. Erdmann (1896) Bd. 2, S. 630 ff.
39 vgl. K. Varrentrapp, Johannes Schulze und das hhere preuische Unterrichtswesen in
seiner Zeit, Leipzig 1889, bes. S. 431 ff; M. Jacobson (1905).
60 Das Verhltnis Hegels zu Preuen und die Interpretation seiner Rechtsphilosophie
gehrt bis heute zu den umstrittensten Fragen der Hegeldeutung. Auf der einen Seite ste-
hen diejenigen, die die Hegelsche Philosophie der >Staatsvergottung< bezichtigen und sie
als Vorlufer des Totalitarismus des 20. Jahrhunderts ansehen; auf der anderen Seite gilt
Hegels Philosophie als ein Denken, das durchgehend der Emanzipation und der Freiheit
verpflichtet ist. Die Thesen vom >Staatsphilosophen< und vom verkappten >Revolutions-
philosophen< sind seit dem Erscheinen der Rechtsphilosophie im Herbst 1820 in zahlrei-
chen Versionen und Schattierungen ber 150 Jahre lang hin- und herdiskutiert worden.
Seit der Entdeckung der Wannenmannschen Mitschrift der Rechtsphilosophie (Heidel-
berg 1817/18) im Jahre 1982 hat sich eine neue Quellenlage ergeben, (vgl. G. W. F. He-
ge], Die Philosophie des Rechts (1983). Nach der neuen Quellenlage mu anerkannt wer-
den, da die junghegelianische Version der sog. >Akkomodationsthese<, derzufolge
Hegel die relativen geschichtlichen Existenzen des preuischen Staates zu metaphysi-
schen Bestimmungen erhoben habe (A. Rge, Die Hegelsche Rechtsphilosophie, DJ
1842, S. 763), um so mehr fr die Berliner Zeit zutrifft, als er bereits in Heidelberg einen
geschichtlich zukunftsoriemierten Konstitutionalismus begrndet vertreten hatte.
Ebenso darf mit grerer Sicherheit vermutet werden, da in Berlin dieser Sachverhalt
bekannt war und vielleicht auch noch alte Heidelberger Mitschriften in der Schule kur-
sierten oder in den Hnden von E. Gans sich befunden haben. Das Schulgeheimnis der
Hegelschule, da Hegels Philosophie zwar exoterisch sich dem Bestehenden anpasse,
aber esoterisch revolutionr sei, ist nun berprfbar geworden.
142
Zur Diskussion um die Hegelinterpretation vgl. H. Ottmann (1979 a); ders. (1977) und
die dort aufgefhrten Interpretationsrichtungen. Vgl. auch D. Henrich, R. P. Horst-
mann (1982).
61 So bemerkt J. E. Erdmann, da im damaligen Deutschland die gouvermentale Protek-
tion dem System (Hegels, d. V.) gewi nicht in weiteren Kreisen zur Empfehlung gedient
htte. feit, nach K. Varrentrapp (1889) S. 435)
62 Ihren eindrucksvollen Niederschlag hat diese Situation der staatlichen Protektion einer
philosophischen Schule in Texten von Arthur Schopenhauer gefunden. Seine an Hatira-
den grenzenden Ausfhrungen ber die Philosophieprofessoren sind insofern fr eine
soziologische Betrachtungsweise von Bedeutung, als hier Interpretationsfiguren vorlie-
gen, in denen eine Philosophie nicht allein auf dem Wege immanenter Kritik widerlegt
wird, sondern durch Verweis auf ihre institutionellen Voraussetzungen.
In seinen Manuskript-Bchern definiert Schopenhauer: Ich bin der Kaspas Hauser der
Philosophieprofessoren: sie haben mich von Luft und Licht abgesperrt; - damit meine
angeborenen Ansprche nicht zur Geltung kmen. (A. Schopenhauer, Der hand-
schriftliche Nachla (1974) Bd. 4/1, S. 292) Aus diesem Gefhl des Ausgeschlossenseins
und der Miachtung entwickelt Schopenhauer eine Sensibilitt fr die institutionellen
Restriktionen, denen die Idee der Wahrheitssuche unterworfen ist. Das ffentliche
Geheimnis der Universittsphilosophie bestehe darin, da im Unterschied zu allen
anderen Wissenschaften diese vor dem Problem stehe, mit der Landesreligion zu har-
monieren. Den unter diesen Beschrnkungen Lehrenden bleibt sonach nichts anderes
brig, als nach neuen Wendungen und Formen zu suchen, unter welchen sie den in
abstrakten Ausdrcke verkleideten und dadurch fade gemachten Inhalt der Landesreli-
gion aufstellen, der als dann Philosophie heit.(A. Schopenhauer, SW (1946) Bd. 5,
S. 151)
Die Aufgabe der Philosophie besteht hier darin, da die knftigen Referendarien, Advo-
katen, rzte, Kandidaten und Schulmnner auch im Innersten ihrer berzeugungen die-
jenige Richtung erhalten, welche den Absichten, die der Staat und seine Regierung mit
ihnen haben, angemessen ist. (Ebd. S. 157) In dieser Ausbildungsfunktion sieht Scho-
penhauer die Ursache fr das Bndnis zwischen Hegelianismus und Unterrichtsverwal-
tung. Konnte es eine bessere Zurichtung fr knftige Referendarien und demnchst
Staatsbeamte geben, als diese, in Folge welcher ihr ganzes Wesen und Sein, mit Leib und
Seele, vllig dem Staat verfiel, wie das der Biene dem Bienenstock und sie auf nichts ande-
res, weder in dieser, noch in einer anderen Welt hinzuarbeiten hatten, als da sie taugli-
che Rder wrden, mitzuwirken, um die groe Staatsmaschine, diesen ultimus finis
bonorum, im Gange zu erhalten? Der Referendar und der Mensch war danach Eins und
das Selbe. (Ebd. S. 157 f.)
Schopenhauer verweist auf eine typische berufliche Sozialisation der Philosophieprofes-
soren. Die nachteilige Vorschule seien die Hauslehrerstellen gewesen, in denen die
knftigen Professoren zur Fgsamkeit erzogen wurden. Diese, frh angenommene
Gewohnheit wurzelt ein und wird zur zweiten Natur; so da man nachher, als Philoso-
phieprofessor, nichts natrlicher findet, als auch die Philosophie ebenso den Wnschen
des die Professuren besetzenden Ministeriums gem zuzuschneiden und zu modeln;
woraus denn am Ende philosophische Ansichten, oder gar Systeme, wie auf Bestellung
gemacht, hervorgehen. (Ebd. S.206)
Sicherlich sind die Ausfhrungen Schopenhauers durchtrnkt von einem tiefen Ressenti-
ment, und in ihnen spricht sich der Ha auf den gesellschaftlich erfolgreichen Philoso-
phen aus. In unserem Zusammenhang ist jedoch entscheidender, da sich hier ein Typus
von zwar nicht deklassierter, aber doch randstndiger Intelligenz zeigt, ein Typ, der ein
modernes Phnomen bezeichnet. Schopenhauers Kritik an den institutionellen Zwngen
der wissenschaftlichen Wahrheitssuche, die sich gegen die Hegelschule richtet, werden
143
144
Interessen wird deutlich in J. Frauenstdts Rezension der Biedermannschen Broschre
Wissenschaft und Universitt in HJ 1839, Sp. 2273 ff.
67 R. Gottschall, Die deutsche Nationalliteratur, 1872, Bd. 2, S. 212.
68 Anonym, G. G. Gervinus. Eine Charakteristik, HJ 1838, Sp. 1343.
69 A. Ruge, Ein nachtrgliches Wort ber bonner Kritik und Apologetik, HJ 1841, S. 423.
70 L. Buhl, Die Weltstellung der Revolution, Ath 1841, S. 464. Vgl. hierzu: (L. Buhl),
Hegels Lehre vom Staat und seine Philosophie der Geschichte in ihren Hauptresultaten,
1837, bes. S. 99. Diese Schrift kann als die erste junghegelianische Interpretation von
Hegels Rechtsphilosophie gelten.
71 Ebd. S. 466.
72 Ebd. S. 481.
73 Ebd.
74 Ebd. S. 481.
75 A. Ruge, Konsequenz der Reaktion, HJ 1840 Sp. 279 u. 280.
76 Ebd. Sp. 280. - Die dargestellte reformpolitische Orientierung der Junghegelianer ist
keine taktische Verlegenheit, sie darf auch nicht angesichts spterer revolutionrer Posi-
tionen als bloes Vorspiel abgetan werden. Vielmehr folgt diese Orientierung einer
geschichtsphilosophischen Perspektive, wie sie Hegel in den Vorlesungen ber die Phi-
losophie der Geschichte< (Hegel, Werke Bd. 9, Berlin
2
1840) entwickelt hat.
Hier stellt Hegel die Reformation als die Alles verklrende Sonne (S. 497) dar, mit der
die dritte Periode des germanischen Reiches - Hegel konstruiert nach der Zeitalterlehre
des Joachim v. Fiore - beginnt. Hegel fat Luthers Lehre dahingehend zusammen, da
das Dieses, die unendliche Subjektivitt d. i. die wahrhafte Geistigkeit, Christus, auf keine
Art in uerlicher Weise gegenwrtig und wirklich ist, sondern als Geistiges berhaupt
nur in der Vershnung mit Gott erlangt wird - im Glauben und im Gensse.(S. 500) Der
Mensch hat zu Gott ein unmittelbares Verhltnis im Geiste. (S. 501) Mit der Reforma-
tion fllt die Sklaverei der Autoritt (S. 498) ebenso wie der Wunderglaube, es ist das
Herz, die empfindende Geistigkeit des Menschen, die in den Besitz der Wahrheit kom-
men kann und kommen soll, und diese Subjektivitt ist die aller Menschen. Jeder hat an
sich selbst das Werk der Vershnung zu vollbringen. (S. 501)
Bei Hegel erhlt - und dies ist im Zusammenhang dieses Kapitels von Bedeutung - die
Reformation den Charakter eines politischen Wendepunkts: Mit der Reformation ist
das neue, das letzte (!) Panier aufgetan, um welches die Vlker sich sammeln, die Fahne
des freien Geistes, der bei sich selbst, und zwar in der Wahrheit ist, und nur in ihr bei sich
selbst ist. Dies ist die Fahne, unter der wir dienen, und die wir tragen. Die Zeit von da bis
zu uns hat kein anderes Werk zu tun gehabt und zu tun, als dieses Prinzip in die Welt hin-
ein zu bilden, indem die Vershnung an sich und die Wahrheit auch objektiv wird, der
Form nach. (. . .) Recht, Eigentum, Sittlichkeit, Regierung, Verfassung usw. mssen nun
auf allgemeine Weise bestimmt werden, damit sie dem Begriffe des freien Willens gem
und vernnftig seien. (S. 502) Geht man den einzelnen Bestimmungen der Reformation
in Hegels Argumentation weiter nach, so kommt man zu dem Ergebnis, da die Reforma-
tion als brgerliche Revolution konstruiert wird. Alle entscheidenden Charakteristika der
brgerlichen Revolution werden von Hegel in die Reformation projiziert.
Wenn Luther seinen Mnchsstatus aufgibt und heiratet, so begrndet er die Familie als
brgerliche Institution. Der Mensch tritt durch die Familie in die Gemeinsamkeit, in die
Wechselbeziehung der Abhngigkeit in der Gesellschaft, und dieser Verband ist ein sitt-
licher; wogegen die Mnche, getrennt aus der sittlichen Gesellschaft, gleichsam das ste-
hende Heer des Papstes ausmachten (S. 508 f.).
Indem die Reformation gegen den Bettel Front macht, etabliert sie das System von
Bedrfnis und Arbeit: Die brgerliche Gesellschaft, in der gilt, da der Mensch in der
Abhngigkeit durch Ttigkeit und Verstand und Flei sich selber unabhngig macht. Es
145
ist rechtschaffener, da wer Geld hat, kauft, wenn auch fr berflssige Bedrfnisse, statt
es an Faulenzer und Bettler zu verschenken; denn er gibt es an eine gleiche Anzahl von
Menschen, und die Bedingung ist wenigstens, da sie ttig gearbeitet haben. Die Indu-
strie, die Gewerbe sind nunmehr sittlich geworden, und die Hindernisse verschwunden,
die ihnen von Seiten der Kirchen entgegengesetzt wurden. Die Kirche nmlich hatte es
fr eine Snde erklrt, Geld gegen Interessen auszuleihen: die Notwendigkeit der Sache
aber fhrte gerade zum Gegenteil. (S. 509)
Schlielich berwindet die Reformation den blinden Gehorsam gegenber der Kirche
und fhrt zu einer Anerkennung des Staates. Es wurde jetzt der Gehorsam gegen die
Staatsgesetze als die Vernunft des Wollens und Tuns zum Prinzipe gemacht. In diesem
Gehorsam ist der Mensch frei, denn die Besonderheit gehorcht dem Allgemeinen.
(S. 509)
Diese drei Elemente, die mit der Reformation gegeben sind, entsprechen genau der Syste-
matik des dritten Teils der Rechtsphilosophie, der die Strukturen der modernen brgerli-
chen Welt darstellt. Selbst bis ins Detail hinein parallelisiert Hegel Reformation und br-
gerliche Revolution. So besitzt z. B. die protestantische Hexenverfolgung, in der das
Prinzip des Verdachts regierte, fr die Reformation die gleiche Funktion wie Robes-
spierres Schreckensherrschaft fr die Franzsische Revolution. Und wie aus dieser ein
moderner Verfassungsstaat entstand, so entstand aus der Reformation Preuen als eine
protestantische Macht (S. 526).
Wird die Reformation als brgerliche Revolution gedeutet, so folgt daraus eine Argumen-
tation, wonach eine Revolution in Deutschland, die nach dem Bilde der Franzsischen
Revolution erfolgen soll, unntig erscheint. Auf die sich seinen Zeitgenossen stellende
Frage: Warum sind nur die Franzosen und nicht auch die Deutschen auf das Realisieren
(des formellen Freiheitsprinzips, d. V.) losgegangen? antwortet Hegel, der Grund liege
tiefer als darin, da die Franzosen Hitzkpfe seien.
Dem formellen Prinzipe der Philosophie in Deutschland nmlich steht die konkrete
Welt und Wirklichkeit mit innerlich befriedigtem Bedrfnis des Geistes und mit beruhig-
tem Gewissen gegenber. (S. 532) Und dies sei eine Leistung der Reformation. In
Deutschland war in Ansehung der Weltlichkeit schon Alles durch die Reformation gebes-
sert worden, jene verderblichen Institute der Ehelosigkeit, der Armut und Faulheit waren
schon abgeschafft, es war kein toter Reichtum der Kirche und kein Zwang gegen das Sitt-
liche, welche die Quelle und Veranlassung von Lastern ist, nicht jenes unsgliche
Unrecht, da aus der Einmischung der geistlichen Gewalt in das weltliche Recht entsteht,
noch jenes andere der gesalbten Legitimitt der Knige. (S. 533) Weil Deutschland qua
Reformation in einer gleichsam postrevolutionren Stufe der Geschichte lebt, steht die
Revolution nicht mehr auf der Tagesordnung, sondern nur die Vertiefung und Ausbil-
dung der Reformation, d. h. Reformpolitik.
77 H. Schel sky(1977) S. 97 ff.
78 Brief E. Meyens an A. Rge vom 20. 11. 1839 (Sachs. Landesbibliothek Dresden, h 46,
Bd. II, Nr. 52) zit. nach I. Pepperle (1978) S. 237.
79 A. Ruge, Bruno Bauer und di e Lehrfrei hei t , An Bd. 1 1843, S. 122.
80 Schel ling, Schriften zur Gesel l schaftsphil osophie, 1926, S. 720.
81 Br i ef H. C. Wei es an A. Rge vom 25. 12. 1838 ( Sachs. Landesbi bl i ot hek Dr esden,
h. 46, Bd. II, Nr. 110) zi t . nach I. Pepperl e (1978) S. 235. Vgl . auch Anm. 100.
82 H. Schelsky (1977) S. 297.
83 Ebd. S. 153 f.
84 Ebd. S. 257.
85 Hegel zufolge hat die Philosophie in der Moderne eine ffentliche, das Publikum berh-
rende Existenz, vornehmlich oder allein im Staatsdienste (Hegel, Grundlinien der Phi-
losophie des Rechts, (1972) S. 8). Dies ist eine qualitative Differenz gegenber den Exi-
146
stenzweisen der Philosophie in der Geschichte (Hegel, Vorlesungen ber die Geschichte
der Philosophie, Bd. 3, 1971, S. 196 ff.).
Die griechischen Philosophen waren Privatleute, ihr Zusammenhang mit der Welt
vollzog sich nach Magabe ihrer Individualitt. Sie lieen sich nicht in Dinge ein, die
nicht das Interesse ihres Denkes waren. (S. 197) Im Mittelalter treiben vornehmlich
Geistliche, Doktoren der Theologie das philosophische Geschft, und in der bergangs-
periode haben die Philosophen im Kampf, im inneren Kampf mit sich und im uerli-
chen Kampf mit den Verhltnissen sich gezeigt, haben sich auf wilde, unstete Weise im
Leben herumgetrieben. (S. 197) Dies haben die modernen Philosophen nicht mehr
ntig, weil sich die uerliche Welt beruhigt, in Ordnung gebracht hat (S. 198). Philo-
sophische Ttigkeit ist zu einem Beruf geworden, und dieser hat seinen Ort in einem ver-
stndigen Zusammenhang. Damit ist schon ein Stck Philosophie verwirklicht, um das
nicht mehr gekmpft zu werden braucht. Dieser allgemeine, verstndige Zusammen-
hang ist von solcher Macht, da jedes Individuum ihm angehrt und doch zugleich eine
innere Welt sich erbauen kann. (S. 198)
Auch die khnsten Kritiken knnen nun nicht mehr von dem verstndigen Zusammen-
hang absehen, sie knnen ihn als sich reformierenden Zusammenhang begreifen, oder
von einem zu schaffenden revolutionren Zusammenhang her sich definieren: die Macht
des Zusammenhangs selbst steht nicht mehr zur Disposition.
86 H. Schelsky bersieht das Problem bei seiner Kritik der Priesterherrschaft der Intellek-
tuellen. Er fat die Reflexionselite als eine im wesentlichen homogene Klasse. Zu
einem soziologischen Zugang zum Streit innerhalb der Intelligenz kommt er in sehr ver-
krzter Form, indem er die Wissenschaftler gegen die neuen Heilslehrer ausspielt.
(H. Schelsky (1977) S. 212) Einmal abgesehen von der politischen Storichtung seiner
Thesen - was es soziologisch zu erklren gilt: das Phnomen differenter Positionen inner-
halb beider Gruppen, die sich ja beide auf den Staat berufen, bleibt bei Schelsky ausge-
spart.
87 G. W. F. Hegel, Vorlesungen ber die Geschichte der Phi losophie, Bd. 1, 1971, S. 98.
88 Ebd. S. 105.
89 Ebd. S. 107.
90 G. W. F. Hegel, Vorlesungen ber die Geschichte der Phi losophie, Bd. 3, 1971, S. 628.
91 Ebd. S. 622.
92 Ch. H. Weie, Die philosophische Literatur der Gegenwart. 2. Artikel, ZPsP 7/NF 3
(1841) H. 1, S. 104.
93 G. W. F. Hegel, Vorlesungen ber die Geschichte der Philosophie, Bd. 3, 1971, S. 628.
94 Anonym, Der St rei t des Di essei t s und Jensei t s i n der deut schen Phi l osophi e, i n: DVj s
1843, H. 2, S. 7.
95 F. Exner, Psychologie der Hegeischen Schule, 1842, H. 1, S. 1.
96 K. T. Bayrhoffer, Di e Idee und Geschichte der Phil osophie, 1838, Zitate S. 425 und 430.
97 Ebd. S. 430.
98 Ebd.S. 431.
99 Ebd. S. 433.
100 J. Schal l er , Zei t schri ft fr Phi l osophi e und spekul at i ve Theol ogi e hg. v.
Dr. J. H. Fichte etc. (= ZPsT), in: JWK Nr. 115 Dezember 1837, Sp. 913. Immanuel
Hermann Fichte (1796-1879) und Christian Hermann Weie (1801-1866), diese 1837
die ZPsT herausgeben, gelten in der Hegelschule als Pseudohegelianer, weil sie die
dialektische Methode von ihren religionsphilosophischen Implikationen trennen und sie
quasi formalisiert als Hilfsmittel zum Begreifen der Wirklichkeit gebrauchen. Vgl.
J. Gebhardt(1963)S. 66 ff.
101 Zu den Selbstverstndlichkeiten der Hegelianer gehrt in diesem Zusammenhang,
immer wieder an die von Hegel mitbegrndeten >Jahrbcher fr wissenschaftliche Kri-
148
147
148
149
150
151
152
153
154
155
II. Politische Partei
bersicht
Die junghegelianische Selbstdefinition als politische Partei wird zunchst ausge-
hend von Ambivalenzen des Hegeischen Parteibegriffs (1 a) im Hinblick auf die
Tranformation des philosophischen Dialogs in eine politische Theatralik (1 b) ent-
faltet, bei der Prinzipienparteien auf der ffentlichen >Bhne< auftreten. Im ber-
gang von der Theorie zur Praxis kann >Partei< mehr positiv auf Zukunft gerichtet
oder mehr eliminatorisch-negativ auf die Gegenwart bezogen werden, in jedem Fall
erfordert die politisch-pragmatische Dimension neue Grenzziehungen fr die Dis-
kussion (2). Anhand der Beitrge von Feuerbach (3 a) und B. Bauer (3 b) werden
zwei Weisen vorgestellt, das bergangsfeld zu definieren. Errtert wird, wann der
Begriff politische Partei< (4) auf historische Gruppen angewandt werden kann.
Erst wenn ein Bezug zur Parteienkonkurrenz und zum Problem der Organisation
der >Vielen< gegeben ist, ist die Rede von >Partei< gerechtfertigt. In ihrer groen
Debatte um die Verfassungsfrage gehen die Junghegelianer von einer Absolutis-
musdefinition aus (5 a) und gelangen ber die Errterung der konstitutionellen
Monarchie (5 b) und die Differenzierung von liberal/radikal (5 c) zu Entwrfen
einer freien anarchistischen Gemeinschaft (6 d). Im praktischen Verhltnis der
junghegelianischen Partei zur liberalen Opposition in Sddeutschland (6 a), Ost-
preuen (6 b) und Rheinpreuen (6 c) werden differente lokale Erfahrungshori-
zonte der Teilgruppen in Berlin, Knigsberg und Kln deutlich, die die Parteikoh-
renz belasten. Die Spaltung der junghegelianischen Partei entzndet sich an der
Debatte um die Nachricht ber den Verein der Freien (7 a) und wird manifest in
den Konflikten um die Reise Herweghs (7 b), dessen von der Klner Teilgruppe
und Rge gefrderte Parteiagitation in Berlin auf einen Kontext von Intellektuellen
stt, der >unter aller Partei< ist. Kommentare von Zeitgenossen zum Scheitern der
junghegelianischen Partei (8), in denen auf die Politikunfhigkeit von Intellektuel-
len verwiesen wird, schlieen das Kapitel ab.
1. Politik als Schauspiel
a) Das Hegeische Erbe
Von der >linken Seite< der Hegeischen Schule zur politischen Partei berzugehen,
dies scheint nur ein kleiner Schritt zu sein, zumal zu Beginn der 40er Jahre das Wort
>Partei< unaufhaltsam in den Diskussionen zu wuchern beginnt. 1843 schreibt Karl
Rosenkranz:
Die Sprache, als die treueste Darstellerin des Geistes, lt uns in ihren Wandlungen die
Geschichte desselben wie in einem unbestechlichen Spiegel erblicken. Wir haben nur auf sie
zu merken, um der Vernderungen, zu welchen der Geist mit sich fortgeschritten, recht inne
156
zu werden. Wenn uns nun epochenweise aus dem Wortvorrat, der im tglichen Verkehr
umgesetzt wird, ein Wort hufiger als sonst begegnet; wenn es in allen grammatischen For-
men, als Substantiv, Adjektiv und Verbum, bald hier, bald da erscheint; wenn es sich unge-
sucht einstellt; wenn es im Hin und Her der gewhnlichen Debatte ein unentbehrliches
Schlagwort, ein notwendiger Gedankenhebel wird: dann drfen wir uns auch darauf verlas-
sen, da dies stereotypierte Wort einen Begriff bezeichnet, der fr die Bewegung des Geistes
charakteristisch ist. Ein solches Wort ist jetzt das Wort Partei.
1
Der kleine Schritt zur politischen Partei, zu dem die Bewegung des Geistes
einldt, stellt jedoch die Gruppe der Junghegelianer vor uerst schwierige Pro-
bleme der Umdefinition ihres Gruppen-Wir. Sie mssen mit dem Erbe der Schul-
definition fertig werden, an das sie Marheineke anllich einer Serenade erinnert,
die zu seinen Ehren von Studenten organisiert wird. Er ruft ihnen zu:
die Wissenschaft, der wir angehren, und die nicht ausschlieend, sondern einschlieend
zu Werke geht, und auch dem Irrtum Gerechtigkeit widerfahren lassen kann, - sie ist keine
Partei, sie hat nur alles, was Partei heit, auer sich, und freilich eben darum auch gegen
sich.
2
Zwischen der Totalitt der Schule, die im Progre der Reflexion die streitenden
Positionen vershnt, und der Doktrin der Partei - wo sollte dort eine Transforma-
tionschance bestehen, zumal wenn die Lehre der Schule sich den Vorwurf einer
Geheimlehre gefallen lassen mu? Es wird behauptet, da ein System, das dem
menschlichen Denken so hartes und widerstrebendes zumutet, wie nach seinem
eigenen Gestndnis das Hegeische, nie die herrschende Lehre und der allgemeine
Glaube der Menschheit werden kann.
3
In der Tat ist das Hegeische Erbe in Sachen >Partei< sehr zwiespltig. Grob
gesprochen kennt Hegel zwei Parteibegriffe: einen abgewerteten und einen aufge-
werteten. Der abgewertete Parteibegriff hat seinen Ort in der Rechtsphilosophie
von 1820, der aufgewertete ist dort zu finden, wo vom geschichtlichen Werden der
wahren Philosophie die Rede ist.
Die Parteisucht um blo subjektives Interesse, etwa um die hheren Staatsstel-
len
4
, ist Hegel ebenso suspekt gewesen wie die allgemeine Wahl von Reprsentan-
ten. Sie fhre bei Massenwahlen notwendig zur Gleichgltigkeit des einzelnen
Whlers, der nicht mehr zur Stimmabgabe erscheint, so da aus solcher Institu-
tion vielmehr das Gegenteil ihrer Bestimmung erfolgt und die Wahl in die Gewalt
weniger, einer Partei, somit des besonderen zuflligen Interesses fllt, das gerade
neutralisiert werden sollte.
5
Innerhalb der Rechtsphilosophie ist >Partei< im
gleichsam vorpolitischen Raum des bloen Meinens und der Willkr angesiedelt,
und wo von diesem Raum ausgehend sich Parteikrfte unvermittelt in politischen
Ebenen durchsetzen, wirken sie destruierend gegenber der Verfassung, die fr
Hegel wesentlich ein System der Vermittlung ist.
6
Die politische Partei wird der ffentlichen Meinung vergleichbar gewertet.
ffentliche Meinung ist die Befriedigung jenes prickelnden Triebes, seine Mei-
nung zu sagen und gesagt zu haben.
7
Dieser Trieb wird ernst genommen, denn:
Das Prinzip der modernen Welt fordert, da, was jeder anerkennen soll, sich ihm als ein
Berechtigtes zeige. Auerdem aber will jeder noch mitgesprochen und beraten haben. Hat
er seine Schuldigkeit, d.h. sein Wort dazu getan, so lt er sich nach dieser Befriedigung sei-
ner Subjektivitt gar vieles gefallen.
8
157
ffentliche Meinung ist nicht der Gipfelpunkt politischen Lebens, sondern -
wie Parteien auch - das Rohmaterial der Politik. Die ffentliche Meinung ist die
unorganische Weise, wie sich das, was ein Volk will und meint, zu erkennen gibt.
Was sich wirklich im Staate geltend macht, mu sich freilich auf organische Weise
bettigen, und dies ist in der Verfassung der Fall.
9
Kommt dagegen die unorgani-
sche Weise zur Herrschaft, so ergibt sich fr Hegel die absurde Bewegung: Der
Wille der Vielen strzt das Ministerium, und die bisherige Opposition tritt nun-
mehr ein; aber diese, insofern sie jetzt Regierung ist, hat wieder die Vielen gegen
sich.
10
"
Die Junghegelianer sind als philosophische Schule in weiten Strecken der Hegel-
schen Abwertung des politischen Parteibegriffs gefolgt. Fr Ruge ist es ein beson-
deres Glck, da die Redaktion der HJ den Rcksichten gar einer praktischen
Partei nicht unterworfen war.
11
Und noch 1842 ist es nicht zu akzeptieren: Wenn
z. B. die Regierungspartei diejenigen bedeutet, welche die mter haben, und die
Opposition die, welche danach haschen.
12
Das Interesse, das in Parteien zum Aus-
druck kommen knnte, ist fr die philosophische Schule allenfalls ein Interesse, das
dem Hegeischen System der Bedrfnisse entspringt. Es hat seinen systematischen
Ort gleichsam unterhalb der politisch-staatlichen Sphre.
Als es 1839 ber Streckfu' Garantien der preuischen Zustnde zu einer
breiteren Diskussion der Verfassungsfrage kommt, drucken die HJ den Beitrag des
liberalen K. Biedermann nur mit einer distanzierenden Redaktionsbemerkung ab:
Die Redaktion und die ganze Richtung dieser Zeitschrift ist nun zwar so wenig mit dem
Prinzip der praktischen und industriellen Interessen als der vollen und gengenden Grund-
lage der Staatsfreiheit einverstanden, da die nchsten Bltter mit einer ausfhrlichen Kritik
dagegen aufgetreten werden.
1
'
Die hegelianische Abrechnung mit den industriellen Interessen bernimmt im
November 1839 Frauenstdt, der Biedermanns liberales Prinzip eines unendli-
chen Strebens und steten Fortschritts ad absurdum fhrt.
14
Aus dem praktischen
Standpunkt sei berhaupt nichts abzuleiten.
Warum hat er nicht lieber gleich ein Dampfwerk angelegt oder eine neue Maschine erfun-
den u. dgl. ? Ist es nicht ein Widerspruch, die Theorie theoretisch vernichten, den praktischen
Standpunkt theoretisch geltend machen zu wollen? Der praktische Standpunkt, wo er sich
feindlich gegen den theoretischen verhlt, lt sich nur praktisch behaupten; denn sonst
nimmt er ja den Feind in seinen eigenen Busen auf. Taugt die Theorie berhaupt nichts, so
taugt ja auch des Verf. Theorie nichts; und so ist es wirklich.
15
Vllig widersinnig erscheint
dem Hegelianer die Fixierung aufs industrielle Interesse. Warum legt er immer wieder den
Akzent auf die materielle Betriebsamkeit, die industriellen Bestrebungen, und will so dem
ganzen Geschlechte die praktischen Tendenzen aufdringen?
16
1842 hat sich die Haltung der Junghegelianer ein Stck verschoben. Fr He
zhlt Biedermann jetzt zu den sogenannten >Praktischen<.
17
Umakzentuierungen
werden zwar deutlich, aber die materiellen Interessen ihrer selbst wegen zum
Ausgangspunkt fr eine Partei zu nehmen, ist weiterhin undenkbar. Diese Interes-
senpartei begreife nicht, da die Fortschritte in den Werksttten der Industrie
und jene in den Werksttten des Geistes Kinder ein und desselben Vaters sind, des
freien Selbstbewutseins, der mnnlichen Selbstndigkeit, die sich nur in ihren
158
eigenen Schpfungen genieen will.
18
Es bleibt bei der Abwertung eines liberalen
Interessenbegriffs, aber zugleich zeichnet sich eine Kontur ab, die an die Stelle des
Bndnisses von philosophischer Schule und modernem Staat treten knnte: eine
politische Partei unter der Regie der Werksttten des Geistes.
Aber die Werksttten des Geistes, sie kennen auch >Parteien<, und auf dieser
Ebene liegt der aufgewertete Hegelsche Parteibegriff, mit dessen Erbe umzugehen
fr die Gruppe nicht minder schwierig ist. Wenn die Kritik selbst einen einseiti-
gen Gesichtspunkt gegen andere ebenso einseitige geltend machen will, so ist sie
Polemik und Parteisache,
19
hatte Hegel geschrieben, und an diesem philosophi-
schen Parteibegriff haben sich die Argumentationsfiguren orientiert, mit denen der
innerschulische Positionenstreit begriffen werden konnte.
20
Lagen hier nicht gn-
stigere Voraussetzungen vor, ein Konzept politischer Partei zu begrnden?
Man mu schon Hegel zuhren, um zu ermessen, in welche Dilemmata die Jung-
hegelianer geraten, wenn sie sich auf Hegels philosophischen Parteibegriff sttzen
wollen. So heit es beim Schulgrnder:
Weil aber, wenn eine Menge eine andere Menge sich gegenberstehen hat, jede von beiden
eine Partei heit, aber wie die eine aufhrt, etwas zu scheinen, auch die andere aufhrt, Par-
tei zu sein, so mu einesteils jede Seite es unertrglich finden, nur als eine Partei zu erschei-
nen und den augenblicklichen, von selbst verschwindenden Schein, den sie sich im Streit
gibt, nicht vermeiden, sondern sich in Kampf (...) einlassen. Andernteils, wenn eine Menge
sich gegen die Gefahr des Kampfes und der Manifestation ihres inneren Nichts damit retten
wollte, da sie die andere nur fr eine Partei erklrte, so htte sie diese eben damit fr etwas
anerkannt und sich selbst diejenige Allgemeingltigkeit abgesprochen, fr welche das, was
wirkliche Partei ist, nicht Partei, sondern vielmehr gar nichts sein mu, und damit zugleich
sich selbst als Partei, d. h. als Nichts fr die wahre Philosophie, bekannt.
21
Diese Parteilogik heit nichts weniger, als da im Kampf der Parteien zwei sich
gemeinhin paralysierende Bewegungen vollziehen: eine Bewegung der Erzwingung
des Parteicharakters, und eine Bewegung, die eben diesen Charakter inakzeptabel
macht. Wer seinen Parteicharakter aufheben will, mu erst recht ganz Partei wer-
den, und wer den anderen fr Partei erklrt, hat sich selbst der Chance begeben,
seinen Parteicharakter aufzuheben. In seinen Aphorismen definierte Hegel lako-
nisch: Eine Partei ist dann, wenn sie in sich zerfllt.
22
Kann mit diesem Diktum
auch eine politische Partei begrndet werden? Und wie steht es mit den berhmten
Stzen aus der Phnomenologie, die praktikabel zu machen sich die Gruppe
abmht? Es heit dort:
Eine Partei bewhrt sich erst dadurch als die siegende, da sie in zwei Parteien zerfllt;
denn darin zeigt sie das Prinzip, das sie bekmpfte, an ihr selbst zu besitzen, und hiermit die
Einseitigkeit aufgehoben zu haben, in der sie vorher auftrat. Das Interesse, das sich zwischen
ihr und der anderen teilte, fllt nun ganz in sie und vergit der anderen, weil es in ihr selbst
den Gegensatz findet, der es beschftigt. Zugleich aber ist er in das hhere siegende Element
erhoben worden, worin er gelutert sich darstellt. So da also die in einer Partei entstehende
Zwietracht, welche ein Unglck scheint, vielmehr ihr Glck beweist.
23
Die Rede von der rechten und der linken Seite der Hegelschule schliet
zwar an die Aufwertung der Polemik und des dialektischen Positionenstreits an, sie
scheint sanft auf das Feld der Parteidefinition hinberzugleiten, auch dient 1838
159
das Hegel-Zitat der Phnomenologie Michelet zur Explikation der innerschuli-
schen Differenzen,
24
und 1843 dient es Rosenkranz zur Explikation des Begriffs der
politischen Partei,
25
- aber jener Anschlu und diese Umfunktionierung bringen
erhebliche Folgeprobleme mit sich, gerade dann, wenn auf der anderen Seite des
Hegelschen Erbes in Sachen >Partei< die Werksttten der Industrie und die
Werksttten des Geistes nach denselben Regeln arbeiten sollen.
Die Lsung, in die dieser bergang schlielich mnden wird, ist bekannt: es ist
der fr Deutschland charakteristische Typ der Weltanschauungspartei.
26
Es ist
weithin anerkannt, da die Junghegelianer an der Profilierung der Definition von
Weltanschauungspartei mageblich mitgewirkt haben.
27
Fr sie ist das Freige-
ben und Konstituieren der Parteibewegung in der Politik ganz das, was das Freige-
ben der geistigen Gegenstze in der Wissenschaft ist.
28
Parteien sind berechtigt
nur, wenn ihre Trger eben Trger eines Prinzips sind; bloe Personen sind alle-
mal ekelhaft, wenn sie als Partei hypostasiert werden.
29
b) Philosophischer Dialog als theatralische Politik
Die politische Ideengeschichte hat den Typ der Weltanschauungspartei ausgiebig
thematisiert und den Zusammenhang mit Religionsparteien, die inhaltliche Profi-
lierung der Prinzipien und politischen Ideale in ihren Mutationen, ihren Anpas-
sungsschwierigkeiten an die geschichtliche Wirklichkeit und ihren Bezug zu ver-
borgenen Interessenlagen grndlich untersucht. In unserem Zusammenhang soll
ein anderer Aspekt hervorgehoben werden, der oft vergessen wird, weil er die feier-
liche Aura, die politische Ideale mit sich fhren, tangiert, nmlich die Darstellung
des philosophischen Dialogs als theatralische Politik.
D. Blackbourn und G. Ely weisen im Anschlu an R. Sennett darauf hin, da
brgerliche Politik insbesondere in der Mitte des 19. Jahrhunderts stark von der
Auffassung der Politik als Bhne, politisches Handeln als Schauspiel
30
beeinflut
wurde. Fr die junghegelianische Selbstdefinition als politische Partei ist dieser
Zusammenhang nicht von der Hand zu weisen. Der dialogische Positionenstreit
der philosophischen Schule wird bei ihnen zum Kampf der politischen Parteiprin-
zipien auf der Ebene politischer Theatralik.
Nicht nur maskiert sich z. B. Bauer als reaktionrer Pietist in der Posaune,
M. Stirner und L. Buhl folgen ihm in ihren Maskeraden zur Sonntagsfeier,
31
-
das groe Schauspiel des Prinzipienkampfes, das die Junghegelianer auffhren, ist
das Drama der Parteien der franzsischen Revolution.
32
Fr Cieszkowski ist
D. F. Strau Girondist und B. Bauer Montagnard.
33
Ruge rechnet sich ebenfalls
zur Bergpartei und die Tbinger Junghegelianer zur Gironde. Bruno Bauer
(und Marx und Christiansen) und Feuerbach haben schon die montagne prokla-
miert, schreibt Ruge an Stahr.
34
In der politischen Theatralik spielt B. Bauer den
Robesspierre, A. Ruge den Danton, Feuerbach gilt als Marat und E. Bauer als Des-
moulins.
35
Diese Maskerade ist nicht einfach seltsames Beiwerk theoretischer Refle-
xion, vielmehr eignet sich die theatralische Ebene in besonderem Mae dazu, die
zwiespltige Problematik des Hegelschen Parteibegriffs aufzulsen.
Fr E. Bauer sind Parteien die Pole, welche das vorher gleichgltige, regellose
Treiben einer chaotischen Masse in einen geregelten Gang, in eine gesetzmige
160
Bewegung zwingen.
36
E. Bauer kombiniert die beiden Seiten des Hegelschen Par-
teibegriffs. Auch er setzt hier nicht auf die Vielen mit ihren zersplitterten, je sub-
jektiven Interessen. Sie gilt es vielmehr in geregelten Gang zu zwingen. Aber die-
ser Zwang erfolgt nicht ber ein beruhigendes System der Verfassung wie bei
Hegel, sondern ber eine aufreizende polarisierende Parteidramaturgie. Die polare
Struktur leistet die Organisation der Vielen, aber sie kann dies nur, wenn die Par-
teien sich in ihren Prinzipien selbst entdecken. Nur dann werden sie (die Parteien,
d. V.) sich mit vollstndigem Bewutsein einander gegenberstehen knnen, nur
dann wird ihr Kampf, werden ihre Reibungen zu einem ergiebigen Ende fhren
knnen.
37
Es handelt sich hier um eine theatralische Ebene, die Prinzipien treten
als Parteien verkleidet auf der politischen Bhne auf.
Darum trifft auch der Begriff Fanatismus die Prinzipienpartei nur ungenau.
Die Junghegelianer wollen keine wilde, polternde, drauflosstrmende Gesellen
werden.
38
Sie konzedieren, da zwar alles Groe und Herrliche und oft freilich
furchtbar Erhabene (!), was die Geschichte aufzuweisen hat, ( . . . ) mit feindlicher
Nebenbezeichnung Fanatismus genannt werden mag, aber sie fordern: Halten
wir den Fanatismus von seiner poetischen Seite genommen also dreist fest.
39
Poetisch genommen, gehrt die Kollision der Prinzipien in die thetik des Dra-
mas, das fr Hegel wie fr die Junghegelianer zur hchsten Stufe der Kunst zhlt
und das Produkt eines schon in sich ausgebildeten nationalen Lebens ist.
40
Das
Drama zeigt die zu lebendigen Charakteren und konfliktreichen Situationen indi-
vidualisierten Zwecke, in ihrem Sichzeigen und -behaupten, Einwirken und
Bestimmen gegeneinander.
41
Im Drama treten die geistigen Mchte als Pathos
von Individuen gegeneinander auf.
42
Was die Junghegelianer auf der politischen Bhne darstellen, ist das Pathos fr
die Freiheit, zu dem die Theorie umgebildet werden mu.
43
Ruge definiert:
Wer ist aber Partei? Wer sich klarmacht, wo die Sache hinaus will und die allgemeine Sache
zu der seinigen macht, d. h. wer denkt und als denkender Mensch sich fr oder wider
bestimmt. Also heit Partei sein nichts anderes, als einen vernnftigen entschiedenen Willen
haben.
44
Dieser individualisierte Zweck< bedarf, wenn er sich politisch darstellt, der dra-
matischen Form, der leidenschaftlichen Sprache. Die Forderung der Zensur, Err-
terungen sollen anstndig und wohlmeinend sein, ist fr E. Bauer inakzeptabel.
Man glaube also nicht, da man, indem man sich gegen die Form wendet, sich nicht auch
gegen den Gedanken wende. Anders ausgesprochen wird auch der Gedanke ein anderer
und verliert seine Wirkung. (. . .) Jede neue Wahrheit spricht sich leidenschaftlich aus.
45
Zum politischen Leben gehrt eine leidenschaftliche, radikale Schreibweise.
46
Radikalismus ist in diesem dramatischen Sinne ein Merkmal der politischen Par-
tei. Der Radikalismus sollte von Rechts wegen bei allen Parteien in Gunst stehen
(. . .). Radikale Ttigkeit von jeder Art bringt uns lediglich weiter, heit es bei
Nauwerck.
47
Radikal ist jemand, dessen Worte und Handlungen die getreuen
Abdrcke seiner Gedanken sind. Als solche Gestalten mten sich alle Indivi-
duen ber dem Altar des Radikalismus die Hnde reichen, und sollten sie sich
auch gleich nachher auf Leben und Tod bekmpfen.
48
Persnlichkeit wird zur
ffentlichen Persnlichkeit dramatisiert.
161
Natrlich kann man mit H. Stuke davon sprechen, da die Junghegelianer, wie
er am Beispiel B. Bauer zeigt, die Hegelsche Dialektik in eine revolutionre Anti-
thetik verwandelt htten.
49
Berechtigt ist diese These dort, wo man die Junghege-
lianer nur als eine philosophische Schule begreift. Als politische Partei beziehen sie
sich aber darber hinaus auf ein Szenario dramatischer Kollisionen, dessen Span-
nung sich erst entfaltet, wenn der intime Vershnungsaspekt der Dialektik zugun-
sten ffentlicher Polaritten auer Kraft gesetzt wird.
Deutlich werden diese Effekte der Selbstdefinition als politische Partei bei Baku-
nin. Die politischen Gegner, die als Parteien von Prinzipien erscheinen, werden als
fr einander unverzichtbare Mitspieler auf der politischen Bhne behandelt.
Ihrem Wesen, ihrem Prinzipe nach ist die demokratische Partei das Allgemeine, das Allum-
fassende, ihrer Existenz nach aber, als Partei, ist sie nur ein besonderes, das Negative, dem
ein anderes Besonderes, das Positive gegenbersteht.
30
Diese Einseitigkeit ist nicht einfach aufzuheben, wie die Partei der vermitteln-
den Reaktionre meint, weil dies zur praktischen Gesinnungslosigkeit fhre."
Dieser Vorwurf sei kein persnlicher:
das Innere eines Individuums ist mir ein unantastbares Heiligtum, ein Inkommensurables,
ber welches ich mir niemals ein Urteil erlauben werde; - dieses Innere kann fr das Indivi-
duum selbst einen unendlichen Wert haben; fr die Welt, in der Wirklichkeit ist es aber
nur insofern, als es sich uert, und nur ein solches, als welches es sich uert.
52
Die entscheidende Wirklichkeitsebene ist die des ffentlich auftretenden Indivi-
duums. Auf dieser Bhne der ffentlichkeit wollen Bakunin zufolge die auf dialek-
tischer Vermittlung Beharrenden nicht auftreten, da sie in ihrer Leblosigkeit kein
anderes Geschft so gern bernehmen als das Bemeistern der Geschichte und sich
nicht von ihrem theoretischen Hochmut befreien knnten.
53
Der theoretische
Hochmut lt keine politische Dramatik entstehen.
Fr E. Bauer zhlt die Partei der Mitte, das Juste-Milieu, kaum. Freilich, es
gibt eigentlich nur zwei wahre Parteien; die eine steht ganz links, die andere ganz
rechts. Wenn wir nmlich Partei nur die nennen drfen, welche ein konsequent
durchgefhrtes Prinzip hat.
54
Auf der Ebene politischer Theatralik gilt:
Jedes Prinzip ist extra. Das Juste milieu hat kein Prinzip, sondern droht mit zwei Prinzi-
pien, die ihm rechts und links stehen. Es sagt: bei mir allein findet ihr Frieden und se
Ruhe; wenn ihr aber nicht artig seid - da seht zu meinen beiden Seiten zwei Ausartungen,
zwei Fatalitten, denen ihr unrettbar anheim fallt, wenn es euch in meinem Sche nicht
mehr gefllt.
55
Aber wenn nun diese vermittelnden Gestalten in die politische Theatralik hinein-
gezogen werden - die junghegelianische Rhetorik verfolgt dieses Ziel unablssig -,
werden es tragische oder komische Figuren sein? Und die, die den ernsten Willen
der Extreme darstellen, werden sie in einer politischen Tragdie oder einer politi-
schen Komdie auftreten? Politik als Schauspiel und die Dramaturgie des Parteien-
kampfes als einer Kollision von Prinzipien - beide Bestimmungen reichen noch
nicht aus.
Fr die Junghegelianer gilt die Komdie als die dramatische Gattung, die dem
politischen Leben entspricht. Sie schlieen an Hegels sthetik an, in der die Kom-
162
die einer Welt zugerechnet wird, in welcher sich der Mensch zum vollstndigen
Meister alles dessen gemacht hat, was ihm sonst als der wesentliche Gehalt seines
Wissens und Vollbringens gilt.
56
Der Mensch hat die schicksalhaften Mchte, die
in der Tragdie ihren Ort haben, durchschaut, er ist ber seinen eigenen Wider-
spruch erhaben. Zum Komischen gehrt die Seligkeit und Wohligkeit der Subjek-
tivitt, die; ihrer selbst gewi, die Auflsung ihrer Zwecke und Realisationen ertra-
gen kann.
37
E. Bauer zufolge mten es schon die politischen und staatlichen Fragen sein,
die den Gegenstand eines deutschen Lustspiels abgeben.
58
Aber er antizipiert die
Reaktion seiner Zeitgenossen, die es frevelhaft finden, den Staat mit seinen gewal-
tigen Interessen zum Gegenstand einer Komdie zu machen, und er antwortet
ihnen:
Nun ja, ich gebe Euch vollkommen Recht. Eben weil wir in unserem ehrlichen theoreti-
schen Wesen stets einen Schauer der Piett fhlen, wenn wir nur das Wort Staat nennen
hren, eben weil wir bei jenen gefhrlichen Schwankungen, die Deutschland in Bezug auf
staatliche Fragen schon seit Dezennien erschttern, oft genug den gottlosen Zweifel erhoben
sehen, ob auch Recht und Wahrheit endlich siegen werden, eben weil wir unsere Krfte
mehr zu tragischem Streit als zu komischen Satyrtnzen zu sammeln haben - weil das alles
ist, sage ich - ist fr jetzt ein deutsches Lustspiel unmglich.
59
Im Bereich des Staates sei die Art Kampf noch nicht mglich, der in seiner
Wrde und Bedeutung von beiden Seiten anerkannt ist und in dem jede Partei als
gleichberechtigt auftritt. Wo dies - wie im politischen Leben Frankreichs - der
Fall ist, dort gedeiht das Lustspiel. Fr Deutschland gilt: unser ganzes Leben ist
kein komisches. Wir sind geborne Tragiker.
60
Die junghegelianische Prinzipienpartei hat so auf der Bhne der Politik eine pre-
kre Stellung. Sie folgt einer Theatralisierung des philosophischen Dialogs, aber
der parteiliche Mensch verfllt in eine tragische Rolle, die dem Stck, das er spielen
soll, nicht angemessen ist. Rge lst dieses Dilemma in einer historischen Perspek-
tive. Der komische Sieg ist ein theoretischer und kann dem praktischen um viele
Jahre in der Entwicklung vorgreifen.
61
Die Komdie antizipiert eine Form politi-
schen Lebens, in dem der Geist in vollkommenster Heiterkeit und Macht sich frei
bewegen knnte.
62
In diesem Sinne feiert Ruge die Maskeraden B. Bauers und die Schellingpolemi-
ken von Engels als die sich abzeichnende Wiedergeburt der historischen Kom-
die.
63
Im Unterschied zu Aristophanes, dessen Komdien unmittelbar aus dem
politisch-sthetischen Leben des Volkes hervorgegangen seien, entspringe die
neue Komdie aus dem philosophischen Bereich.
64
Sie ist politische Theatralik
gewordener philosophischer Positionenstreit. Trotz aller geschichtsphilosophi-
scher Vergewisserung, auf die in der Forschung hufig der Hauptakzent gelegt
wird, ist das Drama, in dem die junghegelianische Partei ihren Part spielt, offen.
65
Es kann als Tragdie enden, wenn die Seite der Schicksalhaftigkeit des Geschehens
und die Fatalitt der Motive Oberhand erhlt, oder es kann Komdie werden,
wenn es gelingt, zu den eigenen Prinzipien eine Distanz zu wahren, bei der das
Handeln auf der Bhne des politischen Lebens von den vershnten Eindimensio-
nalitten aller Art verschont bleibt.
163
2. Das bergangsproblem
Die Hegelsche Rechte, die Linke, die zwei wahren Prinzipienparteien: diese
Rede, die philosophische Positionen politisiert und politische Termini philoso-
phisch aufldt, verweist auf das komplizierte Problem des bergangs. Die junghe-
gelianische Rhetorik selbst ist randvoll mit Formeln des bergangs: Von der Schule
zur Partei, von der Philosophie zur Politik, von der Wissenschaft zum Leben, von
der Theorie zur Praxis.
66
Die Rhetorik des bergangs spricht sich leicht aus. Aber was ist ein >bergang<?
Sehr gut lt sich in der Regel der Zustand erfassen, von dem aus ein bergang
stattfindet, und ebenso klar mag der Zustand erscheinen, der als Resultat der Ent-
wicklung greifbar ist. Auf unseren Fall bezogen: Die Junghegelianer als philosophi-
sche Schule sind typologisch ebenso gut darstellbar wie die Intellektuellengruppe,
die sich als Partei definiert. Die wissenschaftliche Arbeitsteilung reflektiert dies,
wenn die Junghegelianer philosophiegeschichtlich als philosophische Schule unter-
sucht, sozialgeschichtlich oder politikwissenschaftlich dagegen in den Kontext der
Genese der politischen Parteien gestellt werden.
Das Problem, vor dem wir stehen, liegt darin, den Zustand des bergangs selbst
zu fassen. Wir stehen hier schon vor sprachlichen Nten, die sich im Vorherrschen
negativer Benennungen kenntlich machen. Die Junghegelianer sind nicht mehr eine
philosophische Schule, aber noch nicht eine politische Organisation oder Partei.
Dennoch ist zu vermuten, da in diesem >nicht mehr< und >noch nicht< gerade der
auch soziologisch relevante Eigenwert des Phnomens liegt. Um es mit einem
Wortspiel zu verdeutlichen: Einen bergang zu analysieren, heit nicht nur, sich
dessen bewut zu werden, da bergegangen wird, sondern auch zu verhindern
wissen, da der Zustand des bergangs bergangen wird. Diese Bemerkungen blei-
ben der Sache selbst nicht uerlich, wenn man daran erinnert, da jener geheim-
nisvolle Begriff des >Aufhebens< in der Hegelschen Dialektik mit dem Problem des
bergangs zusammenfllt. Die Mehrdeutigkeit und Ambivalenz, die sich im Raum,
den der bergang darstellt, auftut, ist ebenso entscheidend wie Anfang und Ende
des bergangsprozesses.
Die Philosophie macht Partei, schreiben Ruge und Echtermeyer 1840, und sie
denken dabei an einen bergang von der theoretischen Faulheit der Althegelia-
ner zur Praxis der Arbeit.
67
Die Durchfhrung der Idee ist nicht als eine Durch-
fhrung zu verstehen, die sich auf universitre Spezialdisziplinen bezieht, wie dies
in der Aufgabenstellung als philosophische Schule gegeben war,
68
sondern als eine
unbedingte Praxis, die sich polemisch auch gegen ihren eigenen Vater, d. h.
gegen Hegel, wendet. Diese Praxis ist die absolute Tatenlust des befreiten Gei-
stes, sie begngt sich nicht mit der Hegelschen Beschaulichkeit, welche in theo-
retischer Selbstzufriedenheit dem Prozesse blo zusieht, und jede Absurditt kon-
struiert, sondern handelt, fordert, gestaltet.
69
Auf den ersten Blick handelt es sich um eine Rhetorik des bergangs, in der Kon-
templation gegen Aktion, Denken gegen Handeln ausgespielt wird, eine Rhetorik,
die das Fichtesche Sollen gegen die Hegelsche post festum Betrachtung der vollzo-
genen Selbstbewegung des Seins rehabilitiert,
70
eine Rhetorik, die in der endlos
zitierten Marxschen 11. These ber Feuerbach sich wiederholt. Diese Rhetorik
164
kann als junghegelianische >Allzweckwaffe< bezeichnet werden. Sie ist jedoch,
obwohl sie nur einen Punkt des bergangs zu signalisieren scheint, enorm ausdeh-
nungsfhig, sie kann weite Rume besetzen und ausfllen, denn es geht nicht um
bloe Tatenlust, sondern um absolute Tatenlust; diese Praxis ist ein neues
System, schreiben Ruge und Echtermeyer.
71
Die Formel von der Philosophie, die Partei macht, bezieht sich nicht auf einen
einfachen Wechsel, so sehr sie auch emphatisch auf den Augenblick des bergangs
sich zuzuspitzen scheint, vielmehr umreit die Formel gleichsam topographisch ein
neues diskursives Feld, in dem die Philosophie nach ihrer Parteifhigkeit und par-
teiliches Handeln nach seinem philosophischen Systemwert befragt werden. Die
bergangsformeln sind an ihren Rndern in einer aufdringlichen Weise monoton:
die Forderung, berzugehen, wird unablssig wiederholt. Im Innern des neuen dis-
kursiven Feldes dagegen entwerfen die Junghegelianer verschiedene Versionen der
Vermittlung von Theorie und Praxis, die bis heute die Forschung nicht in Ruhe las-
sen.
72
Im Zusammenhang dieses Kapitels ist zu fragen: worin liegt aus der Perspektive
der Gruppengeschichte das Neue des diskursiven Feldes einer Philosophie, die
Partei macht? Das Desiderat einer Verwirklichung der Philosophie ist ja nicht an
die Forderung, Partei zu machen, gebunden. Denn als philosophische Schule, die
sich der Figur der beamteten Intelligenz verpflichtete, hatten die Junghegelianer
bereits ihre Philosophie auf die Reformpiaxis des Staates bezogen. Aber fr die ent-
lassenen Philosophen kommt diese Praxis nun nicht mehr in Frage. Das Neue einer
Philosophie, die Partei macht, liegt daher jetzt auf einem Gelnde, das es erst zu
sichern bzw. erst zu bereinigen gilt: es liegt in der Zukunft und in der Destruktion
des Bestehenden. Zwischen diesen beiden Definitionen entfaltet sich die junghege-
lianische Debatte ber den bergang zur Partei.
Den Gedanken, da der Hegelschen Philosophie die Reflexion auf die Zukunft
fehle, hat der polnische Graf und Hegelschler Cieszkowski 1838 entwickelt. Die
Erkennbarkeit der Zukunft aus der philosophischen Reflexion auszusparen, sei
eine Anomalie des Hegelschen Systems, zur Totalitt der Weltgeschichte gehre
die Zukunft.
73
Diese Hegel berschreitende Teleologie der Weltgeschichte
kennt drei einander ablsende Stadien: 1. die Kunst, in der es auf die Darstellung
des Inneren, d. h. auf die Objektivierung der Bedeutung ankommt, 2. die Philoso-
phie, die sich umgekehrt auf die Bedeutung der Objektivitt richtet, und 3. das
absolut Praktische, das den Widerspruch und die Einseitigkeit der beiden vor-
hergehenden teleologischen Ansichten auflst auf der Ebene des hchsten, prakti-
schen sozialen Lebens, welches die untergegangene Kunst einerseits und die in
besonderer Hinsicht erstarrte Philosophie andererseits selbst neu beleben wird.
74
Die besondere Eignung der Kunst fr das Parteimachen der Philosophie wurde
im vorhergehenden Abschnitt dargestellt. Das absolute Tun Cieszkowskis, das
sich der Zukunft bemchtigt, wird nicht nur in Ruges Formulierung von der abso-
luten Tatenlust aufgegriffen, auch M. He bezieht sich auf den polnischen Gra-
fen, und er nutzt dessen Thesen als Erklrungsraster fr die Spaltung der Hegel-
schule. Weil die Hegeische Philosophie nicht so absolut gewesen ist, sich auch die
Zukunft zu vindizieren, muten sich trotz aller Vermittlungsversuche die Hegel-
schler in zwei Feldlager teilen. Die sogenannte >linke Seite< der Hegelschen
165
Schule bildet schon den bergang aus der Philosophie der Vergangenheit zur Phi-
losophie der Tat.
75
Wichtig ist, da He sich in diesem bergang in spezifischer Weise verortet.
He will nmlich kein >Junghegelianer< sein, er nimmt Cieszkowski und sich selbst
aus dem Hegelianismus heraus, weil im bergang der von ihm gruppierten >linken<
Hegelianer noch eine dunkle Seite liegt.
76
Ihr bergang sei ein negativer, zur Tat
fhre jedoch nur ein positiver bergang. Nicht nur herrsche bei ihnen eine
polemische Befangenheit (. ..), welche verhindert, positiv weiterzukommen,
vielmehr: Anstatt die ganze Weltgeschichte zu heiligen, gibt sich jene Tendenz
wieder viele Mhe, auch der Vergangenheit ihre Heiligkeit zu rauben.
77
Es ist das negative, auf das Geschehene bezogene Verhalten, das fr He nicht
praxisfhig ist. Die kritische Negation ist, weil an die Auflsung der Philosophie
gebunden, nicht fr die Tat zu gebrauchen.
Das Positive mu jetzt in einem anderen Gebiete, als der theoria gesucht werden. Das freie
Denken vertrgt sich mit keinem Dogmatismus. Kann aber die Philosophie nicht mehr
zum Dogmatismus zurckkehren, so mu sie, um Positives zu erringen, ber sich selbst hin-
aus zur Tat fortschreiten.
78
Was passiert, wenn die Philosophie Partei macht? Wird sie positiv, indem sie
zur Tat schreitet, weil sie sich teleologisch auf Zukunft hin definiert? Oder macht
die Philosophie praktisch negativ Front gegen die aus der Vergangenheit in die
Gegenwart hineinragenden unvernnftigen Formen des Lebens? Vollzieht die Par-
tei eine eliminatorische Geste, die eine freiere Zukunft ermglicht, weil sie sich
praktisch negativ auf ihre Hemmnisse bezieht, oder ist diese Eliminationslogik
nicht notwendigerweise der Verzicht auf Praxis als gestaltender Ttigkeit? Die
junghegelianische Partei ist in dieser Frage zerstritten.
Gegen den Vorwurf destruktiver Tendenzen macht Echtermeyer geltend,
da alle wahre Philosophie als solche kritisch, und insofern negativ, oder, wenn
man will, destruktiv ist. Wer an dem Geiste und der Freiheit Teil haben will, mu
( . . . ) fr die Negativitt und Dialektik der Idee gegen die sogenannten Realitten
und Wirklichkeiten, gegen die Objektwelt als solche entschlossen Partei ergrei-
fen.
79
Fr E. Bauer ist gewi, da jedes Prinzip, welches neu auftritt in der Welt-
geschichte, vandalisch ist.
80
Die Partei der Menschheit vertritt ein Prinzip, das
sansculottisch ist. Ihre Praxis ist eine eliminatorische, revolutionre Praxis, sie
bringt Nichts, und das ist ihr Vorzug, welcher ihren Vandalismus wieder gut, oder
vielmehr welcher ihn vollkommen macht. Was sollen Eure Fragen nach dem, was
wir Euch Neues bringen? Wir bringen Euch keine neue Fessel, keinen neuen
Koran, wir bringen Euch nur Euch selber.
81
Aber ist diese negative Praxis berhaupt denkbar? Ein Korrespondent der RhZ
bemerkt: Der Zertrmmerer hat einen Boden ntig, auf dem er steht; er hat einen
Arm ntig, um seine Waffen zu fhren, er brauche Waffen, Mut und Willen, alles
Dinge, die er somit in seinem eigenen Interesse nicht wird zertrmmern wollen.
82
Auerdem habe er ein Herz, Sympathien und Freundschaften, auch diese wird
der Destruktive nicht zertrmmert wissen wollen, ja er wird sie sogar aufs uerste
zu verteidigen und zu erhalten suchen. Die Begriffe revolutionr, destruktiv,
negativ seien nur luftige Schlagworte.
83
166
Die positive Partei der Zukunft und die negative Partei der Kritik des Bestehen-
den, wo liegt hier ein mglicher Verbindungspunkt? Auf einer theoretischen Ebene
ist er schwer kollektiv vorstellbar, und dieser Streit durchzieht die junghegeliani-
sche Parteidiskussion bis zu ihrem Ende. Aber auf der Ebene kollektiver Praxis,
d. h. im zu schaffenden Selbstverstndnis einer politischen Handlungsgemein-
schaft, gibt es noch die pragmatische Dimension, den internen Streit zu beenden.
Wie dies geschehen kann, zeigt Buhl in seiner Rezension der Heschen Triar-
chie.
84
Buhl apostrophiert He seiner Erstlingsschrift entsprechend als Spinozist.
85
Aber dessen Kritik der Junghegelianer spielt er geschickt herunter. He stehe
auch im Grunde auf keinem anderen Standpunkt als die jngeren Hegelianer,
welche die linke Seite der Schule bilden.
86
Buhl akzeptiert das Hesche Programm
der Philosophie der Tat, er kritisiert kurz einige philosophische Aussagen von He:
seine Gleichsetzung von poetischen, philosophischen, prophetischen und mysti-
schen Ausdrucksformen des spekulativen Geistes und seine Rehabilitation der
Natur als ebenbrtiges Weib des Geistes, um rasch abzubrechen: Doch lassen
wir diese Polemik gegen die falschen Konsequenzen des Spinozismus fallen, um
uns mit dem Verfasser (d. h. He, d. V.) ber seine politischen Ideen zu unterhal-
ten, die uns mehr interessieren.
87
Fr die philosophische Schule wren die falschen Konsequenzen des Spinozis-
mus ein Thema ersten Ranges gewesen, jetzt mu der Philosophienstreit gebremst
werden. Es geht um eine Begrenzung des Diskurses fr einen neuen Sinn der
Gruppe. Wichtiger sind die politischen Aussagen, insbesondere He' Definition
des Parteienspektrums.
Fr He existieren drei Fraktionen, die der Reaktion gegenberstehen.
88
Ent-
sprechend seiner triarchischen Konstruktion (Deutschland: Geistfreiheit, Frank-
reich: Revolution der Sitte, England: politisch-soziale Revolution)
89
gruppiert er
die rechte Fraktion als >deutsche Deutsche< mit D. F. Strau und den HJ, das Zen-
trum als franzsische Deutsche< mit Heine, Laube, Bettina v. Arnim u. a., die
Linke als >englische Deutsche< mit Brne, Gutzkow, Wienbarg. Auf den Streit
innerhalb des Jungen Deutschland anspielend fordert He, man sollte endlich
aufhren, mit vergifteten Waffen zu kmpfen.
90
Buhl stimmt dem Aufruf zur
Einigkeit zu, auch fr ihn ist es an der Zeit, da die Kraft der Einzelnen fr das
gemeinsame National-Interesse konzentriert wrde.
91
Einigkeit herrscht in dem
Wunsch nach der Begrenzung des Diskurses.
Was Buhl nicht akzeptieren kann, ist die Hesche Stellung der Parteien. Die
Junghegelianer lassen sich nicht ins Abseits der Theorie stellen, schon gar nicht auf
die >rechte Seite< des Fortschritts. Buhl antwortet He:
Die Hegelianer der linken Seite sind nicht blo theoretisch, sondern wesentlich praktisch,
und sie bilden fr die gesamte Nation die Linke, sowohl den Orthodoxen und den Absoluti-
sten als auch den Althegelianern gegenber. Die englischen Deutschen, zu denen der Spino-
zist sich rechnet, sowie Brnes schon erloschenes Wirken, dem er dann noch Gutzkow und
Wienbarg beigezhlt, knnen wir nicht als besondere Parteibildung anerkennen. Wienbarg
und Gutzkow bewegen sich da, wo sie wahrhaft tchtig sind, in demselben Anschauungs-
kreis, wie die Hegelianer der linken Seite, und auch der Spinozist wird von dieser Richtung
vollkommen absorbiert.
92
167
Und der Spinozist hat sich absorbieren lassen. Ein halbes Jahr spter verteidigt
er im >Athenum<, das Buhls Rezension publiziert hatte, zusammen mit dem ber-
gang der Philosophie zur Tat auch die negative Praxis.
93
Die politische Handlungs-
gemeinschaft mu die Grenzziehung fr den Streit neu bestimmen. Den Streit, den
sie als philosophische Schule sich erlaubt hat, mu sie sich ein Stck weit versagen,
wenn sie zur politischen Partei bergehen will. He' Abgrenzung gegen die von
ihm gruppierten Junghegelianer ist dafr noch viel zu spekulativ. Gegen die Buhl-
sche Definition der Junghegelianer als Reprsentanten der Linken fr die gesamte
Nation hat sie keine Chance.
Aber welche Einigungsformel wre in der Lage, eine neue Begrenzung des Dis-
kurses zu signalisieren, in dem die beiden strittigen Seiten des Parteibegriffs beru-
higt werden knnten? Die Formel, auf die der absorbierte Spinozist He setzt,
heit: Konsequenz. Die positive Philosophie der Tat ist ebenso konsequent
wie die negative Kritik des Bestehenden. Unter der Parteifahne der Konsequenz
kann sich der Vandalismus des neuen Prinzips mit der positiven Gestaltung der
Zukunft vereinen.
Wenn Vermittlung und Aufhebung die Zauberworte der Hegelschen Philo-
sophie sind, so ist das junghegelianische Zauberwort Konsequenz. In ihm bn-
deln sich die wichtigsten Elemente, die den Parteibegriff ausmachen. >Konsequenz<
fhrt zum Parteiergreifen, der Inhalt der Partei ist ein >konsequentes< Prinzip, es
gilt praktische >Konsequenzen< aus der Philosophie zu ziehen, die praktische
Anwendung der Kritik ist >konsequent<. Der politische Radikalismus ist fr Nau-
werck schlicht das System der Konsequenz.
94
Die Formel bndelt die Probleme
des bergangs, liegt sie doch ganz nahe am Begriff des bergangs selbst. Sie
begrenzt den Schulstreit und erffnet einen neuen Rahmen, in dem die Stellung der
philosophischen Politiker auf der Bhne des ffentlichen Lebens definiert werden
kann.
3. Die praktische Konsequenz bei Feuerbach und B. Bauer
Die Philosophie, die ins Leben bergeht und dort Partei macht, steht vor zwei Pro-
blemen: sie mu im Innern ihrer Stze erhebliche Umbauten vornehmen, und sie
mu in irgendeiner Weise mit den pragmatisch-taktischen Dimensionen umgehen,
die politisches Handeln mit sich bringt. In diesem Abschnitt sollen die Lsungen
vorgestellt werden, die Feuerbach und B. Bauer entwickelt haben. Sie stellen fr
die Gruppe wichtige Orientierungen fr ihren Versuch dar, als politische Partei die
Philosophie praktisch werden zu lassen.
95
a) Philosophie und Leben beiVeuerbach
Eine Programmatik des bergangs der Philosophie zum Leben findet sich bei Feu-
erbach schon frh in einem Brief an Hegel, dem er 1828 seine Dissertation schickt.
Er stellt sich als Hegelschler vor, bringt die besonderen Piettspflichten gegen-
ber dem Lehrer zur Sprache, die durch Werke, die im Geiste seines Lehrers gear-
beitet sind, erfllt werden.
96
168
Feuerbach geht jedoch ber die traditionelle Schlerformel von >Studium und
freier Aneignung< hinaus und unterlegt seine Weise der Aneignung der Hegelschen
Philosophie mit einem ungewhnlichen existentiellen Sinn. Die Ideen, die der Leh-
rer geweckt habe, hielten sich nicht oben im Allgemeinen ber dem Sinnlichen
und der Erscheinung, sondern sie wirkten schaffend in mir fort, und dieses
quasi Persnlichwerden der Ideen korrespondiere mit einer Art des Philosophie-
rens, welche man die Verwirklichung und Verweltlichung der Idee, die Ensarkosis
oder Inkarnation des reinen Logos nennen knnte.
97
Die Unsicherheit des neuen Gedankens wird sprbar, wenn Feuerbach am
Rande zu Verwirklichung bemerkt: keineswegs aber Popularisierung oder Ver-
wandlung des Denkens in ein anstierendes Anschauen oder etwa der Gedanken in
Bildchen und Zeichen
98
. Diese abweisende Geste enthlt im Kern schon das Pro-
blem, das entsteht, wenn die politisch-pragmatische Dimension der Popularisie-
rung sich ankndigt. Das Problem bleibt an dieser Stelle ungelst, denn es gibt
eine Koinzidenz, die darin besteht, da die umrissene neue Art des Philosophie-
rens ( . . . ) an der Zeit ist oder (was eins ist) im Geiste selbst der neuern oder neue-
sten Philosophie begrndet ist, aus ihm selbst hervorgeht.
99
Bei Hegels Philoso-
phie handele es sich nicht um eine Sache der Schule, sondern der Menschheit, es
sei der Geist der neuesten Philosophie, der dahin drngt, die Schranken einer
Schule zu durchbrechen und allgemeine, weltgeschichtliche, offenbare Anschau-
ung zu werden; es liege hier nicht blo der Same zu einem bessern literarischen
Treiben und Schreiben, sondern zu einem in der Wirklichkeit sich aussprechen-
den, allgemeinen Geiste, gleichsam zu einer neuern Weltperiode. Es gelte ein
Reich zu stiften, (. . .) auf da die Idee wirklich sei und herrsche.
100
Will man die Entwicklung des Topos von der Verwirklichung der Philosophie
bei Feuerbach weiterverfolgen, so bietet sich an, seinen Brief an Riedel von 1839 zu
untersuchen, in dem Feuerbach etwa ein Jahrzehnt spter, bereits in den Streit um
Leos >Hegelingen< verwickelt, ber seine Bestimmung des bergangs von der Phi-
losophie zum Leben Auskunft gibt.
101
Der existentielle Sinn des Topos hat zu dieser Zeit eine lebensgeschichtliche
Dimension hinzugewonnen, die es zu verarbeiten gilt: Feuerbachs Karriere ist
gescheitert, er lebt als philosophischer Schriftsteller auf dem Lande. Der Junghege-
lianer Riedel fordert Feuerbach ffentlich auf, seine Einsiedelei aufzugeben: Es
wre gar sehr zu wnschen, da F. recht bald in eine bestimmte Wirksamkeit ein-
trte. In Sphren, welche dem Leben und der Kunst nher stehen, wrde sein
Talent glnzen.
102
Feuerbach antwortet mit einer Verteidigung seiner Lebensumstnde in Bruck-
berg. Nicht ein widriges, sondern ein gnstiges Lebensgeschick, mein eigener
Genius hat mich daher auf diesen Boden versetzt.
103
Er definiert seine Existenz-
weise in Differenz zu der universitrer Wissenschaftler, indem er seine Nhe zur
Natur und die Naturfeme der akademischen Welt doppeldeutig zum Kriterium fr
die geistige Qualitt des Orts macht.
Reine, gesunde Luft weht hier, aber wie wichtig ist fr das wichtigste Organ des Menschen,
das Denkorgan, die reine, frische Luft! Die spekulative Philosophie Deutschlands, wie sie
sich bisher entwickelt hat, ist ein Beispiel von den schdlichen Einflssen der verpesteten
Stadtluft. Wer kann leugnen, da ihr Denkorgan, namentlich in Hegel, vortrefflich organi-
169
siert war, aber wer auch bersehen, da die Funktion des Zentralorgans von den Sinnen-
funktionen zu sehr abgesondert, da namentlich der Kanal bei ihr verstopft war, durch wel-
chen die Natur ihren heilbringenden Odem uns zustrmt?
104
Einer Philosophie, die das Denkorgan von der Erkenntnisfunktion der Sinne
abgesondert entwickelt, ist die Einsicht verstellt: Nicht nur die wesentliche Eigen-
schaft des Geistes, Denken, sondern auch die wesentliche Eigenschaft der Materie,
die Ausdehnung gehrt zur Wesenheit des absoluten Wesens.
105
Feuerbach paral-
lelisiert seinen bergang vom Dozentenstand zum Stand eines bloen Privat-
manns
106
mit einer Bewegung, die die Zerrissenheit von Philosophie und Leben
berwindet. Es ist dieser erreichte, neue Standpunkt, der ihm nun die Mglichkeit
gibt, in die Debatte um die Verwirklichung der Philosophie kritisch einzugreifen.
Feuerbach macht fr sich geltend, da er nie - auch nicht auf den steilsten
Hhen der Philosophie, auch nicht in den entlegensten Tlern der Historie - die
Beziehung auf das Leben, die praktische Tendenz, aus dem Auge verloren habe. Er
wendet sich jedoch entschieden gegen eine aktivistische Position, bei der die Wis-
senschaften und Knste nur nach ihrer Beziehung auf das Leben geschtzt wer-
den. Die Aktivisten des bergangs zum Leben bersehen nmlich: Das Wesen
dessen, was man eigentlich Leben nennt, ist genau besehen, immer nur der Egois-
mus.
107
Darber hinaus berliee man die Gelehrsamkeit - eine gewaltige Waffe,
wenn sie der Geist fhrt - dem Pedantismus und religisen Fanatismus oder politi-
schen Absolutismus.
108
Entscheidend aber ist:
Die wissenschaftlichen Ideen knnen berhaupt da erst in das Leben bergehen ein
bergang, der immer durch die sthetik vermittelt ist -, wo sie durch und durch wissen-
schaftlich ausgebildet sind daher es viel zu voreilig ist, wenn bereits jngere Talente die
Ideen der neuern Philosophie ins Leben bertragen wollen, da diese selbst noch mannigfa-
cher Modifikationen und selbst kritischer Berichtigungen bedrfen.
109
Der Verwirklichungstopos wird hier an mehrere Voraussetzungen gebunden:
1. Es bedarf gleichsam einer existenziell vorgngigen Vernderung der Lebens-
weise, um die praktische Tendenz der Philosophie zur Wirkung zu bringen. Der
Philosoph darf sich selbst nicht als bergehend definieren, er mu schon
bergegangen sein. 1842 heit es kategorisch: Wolle nicht Philosoph sein im
Unterschied vom Menschen, sei nichts weiter als ein denkender Mensch; (. . .) denke
in der Existenz, in der Welt als ein Mitglied derselben.
110
Ohne diese vorgngige
existentielle Vernderung bleiben der Egoismus und Utilitismus
111
des Lebens
ungebrochen bestehen, und die Gelehrsamkeit geht mit diesen Elementen eine
Art >unheiliger Allianz< ein.
2. Ein bergang der Ideen ins Leben setzt ihre Vollendung voraus, denn ohne
eine vollkommene Ausbildung der Philosophie wrde wohl alles Mgliche verwirk-
licht, nur keine Philosophie, die diesen Namen verdient. Was sind aber dieKrite-
rien einer vollkommenen Ausbildung? Die Philosophie mu anerkennen, da Kopf
und Herz die wesentlichen Werkzeuge, Organe der Philosophie sind,
112
d. h.
ihre Ausbildung besteht in der Aufnahme nichtintellektuellerWahrnehmungsfor-
men. Dem Denken geht das Leiden voran.
113
Die ausgebildete Philosophie setzt
auf ein passives Prinzip, das mit der Denkaktivitt zusammengenommen werden
mu.
170
Der Philosoph mu das im Menschen, was nicht philosophiert, was vielmehr gegen die Phi-
losophie ist, dem abstrakten Denken opponiert, das also, was bei Hegel nur zur Anmerkung
herabgesetzt ist, in den Text der Philosophie aufnehmen. Nur so wird die Philosophie zu
einer universalen, gegensatzlosen, unwiderleglichen, unwiderstehlichen Macht.
114
In den Text der Philosophie aufgenommen werden sollen aber nicht nur die Lei-
denschaften des Herzens, die Gemtskrfte, sondern auch die ueren rumlichen
und zeitlichen Existenzbedingungen:
Negation von Raum und Zeit in der Metaphysik, im Wesen der Dinge hat die verderblich-
sten praktischen Folgen. Nur wer berall auf dem Standpunkt der Zeit und des Raums steht,
hat auch im Leben Takt und praktischen Verstand. Raum und Zeit sind die ersten Kriterien
der Praxis. Ein Volk, welches aus seiner Metaphysik die Zeit ausschliet, die ewige, d. h.
abstrakte, von der Zeit abgesonderte Existenz vergttert, das schliet konsequent auch aus
seiner Politik die Zeit aus, vergttert das rechts- und vernunftwidrige, antigeschichtliche
Stabilittsprinzip.
115
3. Der bergang ist fr Feuerbach sthetisch vermittelt. Hier schlieen seine
berlegungen an die junghegelianischen Thesen zur Komdie an. Es ist der
Humor, der die Wissenschaft mit dem Leben verknpft.
116
Er ist der Privatdozent
der Philosophie.
117
An Riedel schreibt er ber die Methode seiner (im hheren
Sinne) praktischen Tendenz: Die humoristische Bilderttigkeit ist bei mir
Methode des seiner selbst vollkommen mchtigen und bewuten Gedankens.
118
Der Humor als Medium des bergangs verhindert den politischen Absolutis-
mus, der bei einem direkten Bezug der Philosophie auf das Leben entstehen
knnte, und er verhindert ebenso, da der Philosoph sich als ein absoluter
Monarch denkt.
119
Die genannten drei Voraussetzungen des Verwirklichungstopos sind so angelegt,
da, von ihnen ausgehend, sich die pragmatisch-taktische Ebene politischen Han-
delns ohne groe Brche einfgen kann. Feuerbach hlt daran fest: Rein und
wahrhaft menschlich zu denken, zu reden und zu handeln ist aber erst den kom-
menden Geschlechtern vergnnt.
120
Die Ausbildung der praktischen Philosophie,
mit der der Philosoph, der sich als existierender Mensch denkt, angefangen hat, ist
noch nicht abgeschlossen. Wir sind noch nicht auf dem bergange von der Theo-
rie zur Praxis, denn es fehlt uns noch die Theorie, wenigstens in ausgebildeter und
allseitig durchgefhrter Gestalt. Die Doktrin ist noch immer die Hauptsache.
121
Daher fordert er Ruge auf, bis zu einem gewissen Grade politisch im gemeinen
Sinne des Wortes zu sein.
122
ber den revolutionren Charakter des bergangs der Philosophie zum Leben
ist sich Feuerbach im klaren: Diejenigen Schriften, die Wahrheit enthalten, sind
keine wissenschaftlichen, sondern aufrhrerische Schriften, aber gerade darum
mahnt Feuerbach: Wir htten vorsichtiger, klger sein sollen - nicht um unserer,
sondern um der Sache willen. List, Klugheit gehren auch zur Strategie. Aber nur
mu man sie sich nicht aufntigen lassen. Man mu dem Feind zuvorkommen.
123
Diesen taktischen Vorsprung besitzt die Feuerbachsche Philosophie, weil sie ihren
Standpunkt schon vorgngig verschoben hat. Der Philosophie, der es gelingt, die
empirischen Sinne als mit dem theoretischen Sinn zusammenfallend zu antizipie-
ren, hat schon in sich einen taktischen Vorsprung, weil sie nicht erst ein Geflle zwi-
171
sehen getrennter Theorie und getrennter Praxis aufbaut. Feuerbachs Strategie zielt
darauf: Dazu mssen wir es noch bringen, nicht da wir dozieren, sondern da
nach uns doziert wird, allen Prohibitivmaregeln zum Trotze, und dazu bringen
wir es. Einen anderen Weg von der Lehre zum Leben wei ich nicht.
124
Hier wird ein hohes Ma an politischer Reflexion deutlich, das geeignet ist, das
verbreitete Bild vom blo Anschauenden, in Naturbewunderungen sich ergehen-
den kontemplativen Philosophen Feuerbach zu korrigieren. Da die politische
Reflexion mehr ist als ein abgespaltenes tagespolitisches Rsonnement, zeigt eine
uerung an Ruge aus dem Jahre 1844: Ich werde meine Lebensaufgabe treu und
beharrlich bis zum letzten Atemzug durchfhren und einst wird man vielleicht
erkennen, da der Bruckberger Philosoph und Anachoret ein guter Praktiker, aber
vielleicht ein tiefgrndiger war.
125
Diese >tiefgrndige Praxis< beruht darauf, da Feuerbach den Versuch unter-
nimmt, den Zwiespalt zwischen einer vorlaufenden Praxis und der Theorie aufzu-
heben.
126
Das Handeln, die empirisch sinnliche Ebene, geht dem Denken immer
voran, aber eine Philosophie, die dies in sich aufnimmt, zieht virtuell mit der Praxis
gleich. Dieser Ansatz Feuerbachs, den praktischen Trieb, der fr ihn nicht
zuletzt ein politischer Trieb nach aktiver Teilnahme an den Staatsangelegenhei-
ten
127
ist, theoretisch einzuholen, ist von ihm nicht schriftlich ausgefhrt worden,
und es ist zu fragen, ob er, sich selbst treu bleibend, berhaupt als ein theoretisches
Werk auszufhren ist. Eher ist zu vermuten, da dieser Ansatz eine Art Wegweiser
darstellt, der von jemandem aufgestellt wird, der fr sich geltend macht, den ber-
gang von der Lehre zum Leben im Kern verwirklicht zu haben. Dies ist allerdings
die Herausforderung, die Feuerbach fr die Gruppe der Junghegelianer darstellt.
Der Ansatz fordert dazu auf, Existenzweisen zu entwerfen, die als individuelle oder
kollektive praktisch mglich sind.
b) Philosophie ohne Fessel (Bruno Bauer)
Whrend bei Feuerbach die Formeln der bergangs aus dem Geltendmachen
einer auerphilosophischen Standpunktes gewonnen werden, ein Geltendmachen,
das den Charakter des Spiels nicht verleugnet, finden wir bei B. Bauer die Idee
einer Entfesselung der Philosophie, die ihr schlieliches Zusammenfallen mit dem
geschichtlichen Proze vorbereiten soll. Feuerbach hat seine Differenz zu B. Bauer
selbst deutlich gemacht, indem er darauf hinweist, da B. Bauer methodisch an
Hegel gebunden gleichsam eine immanente Explikation gebe, whrend seine
Auffassung nur aus der Opposition gegen Hegel zu begreifen sei.
128
In der Tat
geht es einmal um ein Denken des bergangs, das mit beiden Positionen, der der
Philosophie und der des Lebens, spielt; das andere Mal um ein Denken, das die
Ruhe der Philosophie von innen her strt, um sie so umzubauen, da sie ihren
geschichtlichen Aufgaben gerecht wird.
Im Zusammenhang des ersten Kapitels habe ich darauf hingewiesen, wie sehr
B. Bauer in seinem historischen Experiment sich am akademischen Raum festklam-
mert und zugleich eine ausgreifende Konfliktstrategie praktiziert.
129
Auf den ersten
Blick geht es ihm darum, das Recht der Wissenschaftsfreiheit zur Geltung zu brin-
gen. Das ist sicher richtig, aber genau genommen geht es B. Bauer nicht lediglich
172
um die Erkmpfung eines bestimmten Ortes, an dem Wissenschaftsfreiheit gesi-
chert ist, sondern umgekehrt um die Auflsung der bestimmten Orte der institutio-
nalisierten Wissenschaft, eine Auflsung, die Theorie erst praxisfhig macht.
Warum bin ich nicht freiwillig aus einer Fakultt getreten, mit deren illusorischem und
sophistischem Benehmen ich gebrochen habe?
130
fragt B. Bauer und antwortet: Nur dann
trete ich freiwillig aus dem Verbande und der Fakultt, wenn sie sich freiwillig aufgibt; nur
wenn sie sich auflst, gehe ich nach Hause, fr jetzt bin ich nur beiseite gegangen, um nicht
die Gewalt gegen mich aufgeboten zu sehen.
131
Fr Feuerbach ist das freiwillige Verlassen der Universittsphilosophie, die vor-
gngige Anerkennung des >denkenden Menschen< vor dem akademischen Schulbe-
trieb zentraler Bezugspunkt der Aufnahme praktischer Elemente in die Theorie.
B. Bauer dagegen entfaltet die praktische Dimension gerade im Konflikt mit den
bestehenden Institutionalisierungen der Theorie. Wie fr Feuerbach eine Existenz
im Drauen dessen, was kritisiert wird, notwendig ist, so ist umgekehrt fr Bauer
die Existenz im Innern dessen, was kritisiert wird, unabdingbar.
In diesem Sinne sind auch Bauers Ratschlge von 1841 an Marx zu verstehen,
seine Dissertation zu entschrfen. Marx solle jetzt auf keinen Fall etwas in die
Dissertation aufnehmen, was die philosophische Entwicklung berschreitet. (. . .)
Nachher, bist Du einmal auf dem Katheder und mit einer philosophischen Ent-
wicklung aufgetreten, kannst Du ja sagen, was Du willst und in welcher Form Du
willst.
132
Wie aber mu die Theorie umgebaut werden, damit sie praxisfhig im
Sinne einer Auflsung der je bestehenden Institutionalisierungen wird? Fr Bauer
ist diese Frage nicht generell zu beantworten. Bei ihm geht es nicht um den Enwurf
einer Philosophie der Zukunft wie bei Feuerbach, sondern um je geschichtliche
Anwendungen der Kritik auf ein sich vernderndes historisches Feld. Drei Etap-
pen, in denen die B. Bauersche Theorie von innen heraus sich auf die Vernde-
rung der Institutionalisierungen, in denen sie existiert, bezieht, die Etappen der
Jahre 1840,1842,1844, seien hier kurz skizziert.
Rckblickend auf den Zustand der Hegelschule in den 30er Jahren schreibt
Bauer 1840:
Mit ihrem jetzigen Standpunkt verglichen war damals ihr (der Hegelschen Schule, d. V.)
Gesichtskreis in jene Unbefangenheit eingeengt, welche gewhnlich eintritt, wenn der erste
Jngerkreis um einen Meister sich gesammelt hat und in dessen System sich einhaust. Wie
die seligen Gtter wohnten die Jnger mit patriarchalischer Ruhe in dem Reiche der Idee,
das ihnen der Meister zum Vermchtnis hinterlassen hatte, und die Trume der Chiliasten
von der Zeit der Vollendung schienen bereits in Erfllung getreten zu sein, als der Blitz der
Reflexion in das Reich der Seligkeit einschlug und den Traum beunruhigte.
133
Mit diesem
Blitz der Reflexion ist Strau' >Leben Jesu< gemeint; und Bauer fhrt fort: So wenig war
man auf den Schlag gefat, da die Berliner wissenschaftliche Kritik dem Strauischen
Buche einen Rezensenten entgegenstellte, der noch im seligsten Traume von Einheit der
Idee und der unmittelbaren Wirklichkeit oder vielmehr der Welt des empirischen Bewut-
seins redete und seinen Traum sogar in einer besonderen Zeitschrift durchaus noch fortset-
zen wollte.
134
Dieser Rezensent, von dem B. Bauer 1840 so distanzierend schreibt, ist er
selbst.
173
Was hier zum Ausdruck kommt, sind zwei Elemente der B. Bauerschen Theorie:
die Selbstkritik und die Bindung der Selbstkritik an die Formation, der der Kritiker
selbst angehrt. Die Philosophie ist gebunden an ihre Existenzweisen, aber sie hat
mit dem Blitz der Reflexion zu rechnen, ein Blitz, der in den je geschichtlichen
Boden einschlgt und den Philosophen zu einer Selbstkritik zwingt, die seinen
Traum vom Einklang der Reflexion mit der Wirklichkeit, d. h. von einer adquaten
Existenz der Theorie, aufstrt und ihn zu praktischen berschreitung auffordert.
Zwei Jahre spter, 1842 - die Junghegelianer sind auf dem Hhepunkt ihrer Ver-
suche, sich als politische Partei zu konstituieren -, schlgt der Blitz der Reflexion
erneut ein. B. Bauer schreibt:
Allen Leidenden und Unglcklichen berhaupt, sagt man, ist der Schlaf und der Traum
zum Troste gesandt. In hnlicher Weise knnte man sagen, da den Schwrmern und den
Parteien, die sich fr mit Unrecht Unterdrckte halten, von einem gtigen Geschick eine
vllige Bewutlosigkeit ber ffentliche Verhltnisse und eine unbegrenzte Einbildung auf
ihre eigene Wichtigkeit geschenkt sei. Die Opposition hlt sich immer fr den Mittelpunkt
des Kreises, in dem sie sich irgendein Pltzchen anzueignen gewut hat, ja in den sie viel-
leicht noch nicht einmal eingedrungen ist; alles bezieht sie auf sich, alles, meint sie, bezieht
und richtet sich auf sie.
135
Es ist dieselbe Metaphorik wie die von 1840. Damals galt es, den Schlaf der
Schule, die sich in Hegels System huslich eingerichtet hatte, zu stren; jetzt geht es
darum, die Selbstgengsamkeit der Parteidiskussion aufzubrechen. Auch dies ist
fr B. Bauer Selbstkritik. Er attackiert nicht von auen, vielmehr ist es selbstkriti-
sche Ironie, wenn er schreibt, die deutsche Opposition sei
so weit fortgeschritten, da sie aus einer deutschen Opposition eine franzsische, aus einer
germanischen eine romanische, aus einer wissenschaftlichen eine politische, aus einer
>Denk-Revolution< eine kritische Tat zu werden drohte. Es war die hchste Zeit, da eine
eingebildete Macht zum Gefhl ihrer Ohnmacht und eine Richtung, die das Wesen des
Bestehenden fr eine Illusion erklrte, dahingebracht wrde, da sie sich selbst als die nich-
tigste Illusion erkannte. Wer von Siegen und gelungenen Gewalttaten trumt, mag vielleicht
nicht gern erwachen. (. . .) Unser Erwachen war schrecklich, aber es ist gut, da wir nicht
mehr trumen.
136
Es sind die berzogenen Hoffnungen, die sich an das Projekt der Partei knpfen,
die zu diesem Zeitpunkt kritisiert werden mssen. Die kritische Tat als politische
Partei ist die Illusion, die es zu destruieren gilt. Die Verwirklichung der Philosophie
ist fr B. Bauer nicht zu entkoppeln vom Proze der Selbstkritik. Wo sich die
Opposition als ein lokalisierbares Lager, als eine positive Gre einrichtet, dort
trumt sie von der Praxis, so wie die philosophische Schule davon getrumt hatte,
Idee und unmittelbare Wirklichkeit seien vershnt. Praxisfhig im B. Bauerschen
Sinne wird die Theorie jedoch erst dort, wo sie sich selbstkritisch auf ihre Existenz-
formen bezieht, mgen sie Schule oder Partei heien.
Im Jahre 1844 ist wiederum eine Illusion aufzugeben. Es schien
hinreichend, da die Literatur mit einem neuen Werke bereichert wurde, da eine Zeit-
schrift mit einem gediegenem und originellen Aufsatz auftrat, um alle Enthusiasten mit der
Hoffnung zu erfllen, da das Alte vor der Macht des Neuen sich unmglich mehr lange hal-
ten knne. Lest, lest, rief man, gebt es allen zu lesen, und ihr werdet sehen, da wir gewon-
174
nen haben.
137
Aber: Die literarische Teilnahme gab einer Menge von Leuten nur einen
Anflug von neuen Ideen, deren wahrer Inhalt nicht ins Innere drang, drauen stehen blieb
und in der Form von Stichworten und Phrasen der Gegenstand einer gutgemeinten Vereh-
rung wurde.
138
War zwei Jahre zuvor die Illusion zu bekmpfen, in der Existenzform der Partei
als eines selbstgengsamen Mittelpunktes sei die adquate Form der Verwirkli-
chung der Philosophie gefunden, so geht es jetzt darum, die revolutionre Intelli-
genz aus dem Traum zu wecken, da die Masse der natrliche Partner der Philoso-
phie sei.
139
Im Zusammenhang dieses Kapitels soll es nicht um eine inhaltliche Diskussion
der einzelnen Bauerschen Wendungen gehen, sondern vielmehr darum, Bauers
spezifische Fassung des berschreitenden Denkens zu charakterisieren. Die Wis-
senschaft fhrt gleichsam ein nomadisches Dasein; sie ist: Die ewige, unermdete
Wanderin.
140
Das ist keine Bewegung der Flucht, wie die marxistische Bauerkritik
glauben machen will: So wenig die Wissenschaft
sterben kann, so wenig ist es ihr mglich zu fliehen: wo sie einmal Hausrecht gewonnen hat,
da bricht sie nicht eher auf, als bis sie den letzten Kampf mit ihrem Gegensatz bestanden hat.
Denn so ist es ihre Gewohnheit, da sie Nichts unentschieden lt, - fliehen hiee aber den
Streit nicht entscheiden wollen. Mte sie wirklich wieder zum Wanderstab greifen, so kann
und tut sie es nicht anders, als wenn sie ihre Kraft durch die Entscheidung des Kampfes
gestrkt hat und ihren Gegensatz als ein entkrftetes, geistloses Phlegma zurcklassen
kann.
141
Die Verwirklichung der Philosophie ist fr B. Bauer kein einmaliger Akt des Par-
teiergreifens, sondern ein ausgedehnter Proze, in dem Kritik und Selbstkritik die
Existenzweisen der Philosophie dort unterminieren, wo sie diese begrenzen. Kritik
ist gleichsam der Moment des Praktischwerdens der Philosophie, den es immer
wieder zu gewinnen gilt, weil eine realisierte Idee, die positiv geworden ist, keine
kritische Potenz mehr besitzt. Die Kritik liegt gleichsam zwischen den Polen Den-
ken und Handeln, es ist die Philosophie im Sprung und zugleich der nicht gedachte
Rest eines jeden Handelns.
Der Einwand, die B. Bauersche Kritik sei praxisunfhig, weil sie ihre positiven
>Taten< immer gleich wieder selbstkritisch in das Selbstbewutsein zurcknehme,
trifft nur bedingt. Ebenso vehement, wie Bauer sich dagegen wehrt, sich in der posi-
tiven Tat zu beruhigen, so entschieden lehnt er es ab, das kritische Selbstbewuts-
ein als eine absolute Instanz zu begreifen. Man kann zwar im Sinne einer Analo-
gie davon sprechen, da das menschliche Selbstbewutsein bei B. Bauer dem
Hegeischen Weltgeist nachgebildet ist, und mit Carl Schmitt Bauer einen Partisa-
nen des Weltgeistes
142
nennen, entscheidend bleibt aber, da B. Bauer fr das
Selbstbewutsein den Titel absolut zurckweist. Das Selbstbewutsein
will nicht das Absolute sein, weil die Annahme dieses Titels nichts anderes als die Unter-
schrift zu dem Dekret seiner Pensionierung wre; es ist nicht das Absolute, kann und darf
sich nicht in Ruhestand versetzen lassen, da es nur als unendliche Bewegung durch alle For-
men und Gegense seiner Schpfung, nur als Entwicklung seiner selbst ist.
143
B. Bauers Selbstbewutsein ist insofern nicht mit Hegels Weltgeist vergleichbar,
als mit ihm sich die Offenheit der Geschichte wieder auftut. Der Weltgeist ist eine
175
Konstruktion, die in der komtemplativen Haltung des Philosophen ihr Gegenstck
findet. Fr B. Bauer ist der Eingriff der Kritik in die Geschichte selbstverstndlich.
Reine und wahre Theorie ist nur mglich zwischen Gleichen und Freien. In einem Zustand
z. B., wo die Stnde, die Geburtsunterschiede und Privilegien herrschen oder mit Gewalt
restauriert werden sollen, ist die Theorie ein Verbrechen, weil sie sich zunchst als Kritik
gegen diese natrlichen Unterschiede richten und die Gleichheit, die noch nicht vorhanden
ist und im Gegenteil als ein bel abgewehrt werden soll, wiederherstellen wrde.
144
Feuerbach und B. Bauer markieren die Spannbreite junghegelianischer Ent-
wrfe zur Praxis der Philosophie: auf der einen Seite ein Heraustreten der Philoso-
phie aus ihren akademischen Schranken durch die Aufhebung der Trennung zwi-
schen sinnlichen und theoretischen Erkenntnisformen, die Andeutung eines neuen
Terrains, auf dem die alte hochmtige Spekulation nun depotenziert ihr Daseins-
recht mit anderen menschlichen Lebensuerungen teilen mu - auf der anderen
Seite eine Philosophie, die sich gebunden sieht an die Fesseln, die ihre immer ver-
schiedenen Existenzweisen ihr aufzwingen, Fesseln, derer sie nicht eher ledig wird,
als bis sie die Kritik des sie umgebenden Zusammenhanges durchgefhrt hat.
Beide Entwrfe erffnen einen Raum des bergangs ebenso wie ein neues dis-
kursives Feld. Die Gestalt, die diese Entwrfe zunchst befriedigen soll, ist die poli-
tische Partei. Aber schon in den Entwrfen ist angelegt, da es sich bei den ber-
gngen um keine einmaligen, sondern um sich wiederholende Prozesse handelt.
Trotz der unermdlich wiederkehrenden Forderungen, doch endlich die Philoso-
phie aufzuheben, zur Praxis berzugehen, das wirkliche Leben anzuerkennen, die
Schranken zu durchbrechen - und wie die Formeln auch sonst heien mgen -, hat
man bisweilen den Eindruck, da es weniger um eine Erfllung der Forderungen
geht, als vielmehr um ihre Formulierung. Auch Marx und Engels machen hier keine
Ausnahme. Schon wenige Monate nach der Niederschrift der 11. These ber Feu-
erbach, in der das Verndern der Welt dem Interpretieren der Welt gegenberge-
stellt wird, bezeichnen sie sich angesichts der beginnenden Arbeiterbewegung
explizit als theoretische Kommunisten.
145
Vielleicht liegt aber auch gerade der
Reiz der junghegelianischen Rhetorik des bergangs darin, im Medium der Spra-
che bergnge und Durchbrche zu vollziehen, die als geschichtliche Fakten
einem die Sprache verschlagen wrden.
4. Zum Begriff politische Partei
Um 1840, so kann man berpointiert, aber griffig sagen, bilden sich die modernen
deutschen Parteien aus, schreibt Th. Nipperdey, und er bezieht sich auf das deut-
sche Fnf-Parteien-System, das ber fast 100 Jahre fr die deutsche Geschichte
prgend gewesen sei.
146
In diesem Parteisystem von Konservativen, Katholiken,
Liberalen, Demokraten und Sozialisten sind die Junghegelianer gleich zweimal zu
lokalisieren: im Kontext der Ausdifferenzierung von Liberalen und Demokraten
und von Demokraten und Sozialisten. Dies ist die griffige Seite, aber warum ist die
Nipperdeysche Formulierung berpointiert? Das analytische Problem besteht
darin, Kriterien zu entwickeln, ab wann die Rede von Parteien gerechtfertigt ist.
176
Nipperdey schreibt ber die 40er Jahre: berall gibt es Kryptopolitik und deren
Umschlag in wirkliche Politik.
147
Was aber entscheidet den Umschlag? Wie sind
die beiden Seiten Kryptopolitik und wirkliche Politik zu definieren?
Das analytische Problem trifft den gesamten Bereich der Entstehung der Par-
teien, ihrer genetischen Vorlufer oder strukturellen Vorformen.
148
Je nach dem,
welches Element fr die Parteidefinition als zentral definiert wird, lassen sich Vor-
lufer und Vorformen ausfindig machen. Greift man das Element der Prinzipien
oder >Weltanschauung< heraus, so lassen sich ideengeschichtlich die vielfltigen
uerungen politischer Denker zu einem beeindruckenden Traditionsstrang
zusammenknpfen, wobei z. B. die Frage, in welchen sozialen und organisatori-
schen Zusammenhngen die Prinzipien diskutiert wurden, weniger Gewicht erhlt.
Versucht man dagegen, bestimmte historische Gruppen als Frhformen politischer
Parteien zu identifizieren, so ergeben sich erhebliche Definitionsprobleme.
So hat z. B. A. Kuhn den Versuch unternommen, die deutschen Jakobiner-
Gesellschaften am Ausgang des 18. Jahrhunderts als Frhformen politischer Par-
teibildung zu interpretieren. Die Verfasser ihrer Satzungen und Entwrfe htten
danach gestrebt, eine ffentliche und demokratisch aufgebaute Massenpartei zu
begrnden.
149
Diese These ist in der Diskussion umstritten: Handelt es sich um
eine falsche Aktualisierung? Handelt es sich nicht um Vorformen, sondern eher um
Voraussetzungen des spteren Parteiwesens? Ist Opposition mit Partei zu identifi-
zieren? Kann man ein Modell der Entwicklungsstufen entwerfen? hnliche Pro-
bleme ergeben sich bei dem Versuch, die geheimen Gesellschaften des 18. und fr-
hen 19. Jahrhunderts als Vorlufer politischer Parteien zu interpretieren.
130
Kann
man z. B. den Illuminatenorden tendenziell - modisch gesagt - als eine system-
berwindende Weltanschauungspartei
151
ansprechen? Auch hier sind dieselben
Fragen zu stellen wie bei den deutschen Jakobinern.
Der Schlssel fr die Frage, wann Kryptopolitik in wirkliche Politik
umschlgt, wann von Vorlufern oder Vorformen, wann von richtigen Parteien
gesprochen werden kann, liegt zunchst auf der Ebene sinnvoller Definitionen.
Diese Definitionen mssen sich der Tatsache bewut sein, da es zwar eine
geschichtliche Kontinuitt der Selbstdeutungen politischer Bestrebungen gibt, da
aber diese Tatsache noch nicht ausreichend fr die Rede von Vorformen bzw. von
Vorlufern von politischen Parteien ist.
So hat z. B. W. Grab anhand der politischen Biographie von Wilhelm Schulz die
Kontinuitt demokratischer Bestrebungen in der ersten Hlfte des 19. Jahrhun-
derts exemplarisch nachgewiesen.
152
Der 22jhrige Schulz nimmt 1819 die jakobi-
nischen Forderungen der 90er Jahre wieder auf, und er nimmt teil an den entschei-
denden revolutionren Bewegungen bis zum Jahre 1848/49. Auch die Junghegelia-
ner sind in dieser Kontunitt zu verorten, nicht nur, weil sie ber ihre Kontakte zum
Schweizer Exilzentrum in Zrich mit den Kreisen kommunizieren, in denen sich
u. a. auch Schulz bewegt,
153
sondern auch, weil sie in ihren Diskussionen die
gesamte Tradition demokratischer Bewegungen reflektieren. Zu nennen sind hier
z. B. B. Bauers und E. Bauers Schriften zu Adam Weishaupt und den Ilumina-
ten
154
und E. Bauers Geschichte der konstitutionellen und revolutionren Bewe-
gungen im sdlichen Deutschland in den Jahren 1831-34.
155
Gegenber dieser historischen Kontinuitt politischer Bestrebungen mu die
177
Rede von der politischen Partei< sorgfltiger bestimmt werden. Das brgerliche
Vereinswesen tendenziell in Richtung auf politische Parteien zu interpretieren, ist
wenig sinnvoll, da es sich um einen allgemeineren sozialen Typ handelt, dessen ent-
scheidende Leistungen gerade in der virtuellen Unendlichkeit der Vereinszwecke
besteht. Zwar kann man sagen, da das Vereinswesen indirekt politisch
156
sei,
aber in diesem Sinne ist sehr vieles indirekt politisch: technische Erfindungen
ebenso wie die Entstehung neuer Familienideale.
Die Differenzierung zwischen einem Vereinstypus, der keine direkten, ber sei-
nen Binnenraum hinausweisenden gesellschaftlichen Zielsetzungen hat, und
einem Vereinstypus, der eindeutig als ein mit aufklrerisch-pdagogischen und
staatspolitischen Zielsetzungen verbundener Willens- und Zweckverband anzu-
sprechen ist und der sich wie jede politische Partei definitionsgem als Kampfver-
band versteht und demzufolge straff organisiert ist
157
- diese Differenzierung v.
Biebersteins bringt nur einen kurzreichenden analytischen Vorteil. Zwar wird hier
ein politisches Kriterium eingefhrt, aber es gilt zu bedenken, da politische Grup-
pen nicht notwendigerweise Parteien sein mssen. Die von O. Dann exemplarisch
skizzierten politischen Vereine der Zeit von 1765-1819 kennen zwar vielfltige
politische Zwecke - sie tendenziell als politische Parteien anzusprechen, wre aber
ebenso verfehlt, wie heutige politische Gruppenbildungen von Brgerinitiativen
bis zu konspirativen Zirkeln als Parteien zu titulieren.
138
Politische Vereine und politische Gruppenbildungen entstehen historisch dort,
wo die politische Ordnung als eine Sphre sichtbar wird, die als Reflexionsgegen-
stand und virtuelles Handlungsfeld in die Verfgung von sich assoziierenden Men-
schen geraten knnte.
159
Die Figur des politischen Engagements kann zwar als Vor-
aussetzung fr politische Parteibildung betrachtet werden, aber sie mu weder
unter absolutistisch-monarchistischen, noch unter konstitutionell-demokratischen
Formen der Staatsgewalt notwendig zur politischen Parteibildung fhren. Soll der
Parteibegriff historisch und systematisch aussagekrftig gemacht werden, so ist an
zwei Komplexe zu denken, in denen er sich zu bewhren hat: 1. den Komplex der
Parteikonkurrenz, 2, den Komplex der Organisationsleistung der>Vielen<.
Wo eine politische Gruppe sich in Richtung auf eine Partei definiert, definiert sie
nicht nur ihre politischen Ziele, sondern auch die Ziele anderer politischer Parteien.
Indem sie dies tut, definiert sie darber hinaus ein Terrain, das sie mit ihren Kon-
kurrenten teilen mu oder teilen will. Parteipolitische Formierung setzt dort ein,
wo nicht blo die politische Eigenbewegung auf die staatliche Sphre in den Blick
gert, sondern wesentlich dort, wo die politische Konkurrenz und der Konkurrenz-
boden thematisch werden.
160
Nicht, da Brger auf staatliches Handeln Einflu
nehmen wollen, sondern da konkurrierende Brger dies wollen, ist der Anfang
der Parteibildung. Revolutionre Bewegungen mssen dies Problem nicht notwen-
dig reflektieren. In der Menschenrechtserklrung von 1789 fehlt z. B. die Freiheit,
sich zu Parteien zusammenzuschlieen. Fr Marx dagegen ist es selbstverstndlich,
da die revolutionre politische Partei der Arbeiterklasse auf der Basis des allge-
meinen Wahlrechts mit anderen Parteien konkurriert und nicht nur sich selbst,
sondern auch die Konkurrenz definiert. Nach Rosa Luxemburg sind politische Par-
teien auch auf rtesozialistischer Basis unverzichtbar.
161
178
Ein soziologisch brauchbarer Begriff der politischen Partei mu nicht an
bestimmte Staats- oder Wirtschaftsverfassungen gekettet werden; er ist auch nicht
auf die Fragen zu reduzieren, die sich mit revolutionren Bewegungen stellen. Poli-
tische Partei ist eine Form, in der Gesellschaftsmitglieder ein Mittel finden, die Ver-
schiedenheit ihrer Ideale, Ziele, Interessen, soweit sie die politische Sphre betref-
fen, als konkurrierende darzustellen. Politische Parteien knnen existieren, ob
ihnen nun kein, ein begrenzter oder ein groer Einflu auf das Handeln des politi-
schen Gesamtverbandes eingerumt wird, ob in den Bereich des politisch Verfg-
baren nur im engeren Sinne >politische< Handlungsfelder fallen, oder ob sie im wei-
teren Sinne sozialpolitische Bereiche betreffen, oder ob sie auch den Bereich der
Produktionsentscheidungen und des Konsumrahmens umfassen.
Politische Parteien knnen existieren, auch wenn sie verboten sind. Dies ist
gerade im Vormrz der Fall. Nur darf nicht umgekehrt geschlossen werden, da
alle Gruppen, die verboten werden, auch politische Parteien sind. Was verboten
wird, welches Handeln mit staatlichen Sanktionen belegt wird, folgt einer >Logik<,
die fr die Definition der politischen Partei nur am Rande von Bedeutung ist. Da
etwas fr den Staat >politisch gefhrlich< ist, verleiht der Gefahrenquelle noch nicht
den Titel der politischen Partei. Im Vormrz knnen nur die verbotenen politi-
schen Bestrebungen als politische Partei begriffen werden, die den Versuch
machen, sich und andere als Konkurrenten auf einem antizipierten Konkurrenzfeld
politischer Handlungsmglichkeiten zu definieren.
Wenn politische Partei< hier nicht an bestimmte Staats- oder Wirtschaftsverfas-
sungen gekettet definiert wird, so bedeutet dies nicht, da sie hierzu keinen Bezug
hat. Im Gegenteil: als konkurrierende soziale Figuration mu jede Partei die allge-
meinen Grundlagen der Konkurrenz und ihre Grenzen mit definieren. In der Par-
teienkonkurrenz reproduziert sich zugleich der Konkurrenzrahmen. Dieser kann
von einzelnen Parteien in den verschiedensten Hinsichten als unzureichend
betrachtet werden. Parteien knnen versuchen, den verfassungsmigen Konkur-
renzrahmen zu vergrern oder zu verringern. Erst dort, wo sie aufhren, sich auf
die staatliche Sphre als einen Konkurrenzraum von Parteien zu beziehen, verlieren
Parteien ihren Parteicharakter, sei es, da sie sich auflsen, sei es, da sie mit den
staatlichen Institutionen verschmelzen, sei es, da sie die Form der Partei nicht
mehr als relevantes Organisationsmedium fr Brgerkonkurrenzen anerkennen
knnen und sich auf andere Medien verlegen.
Dem Komplex der Parteikonkurrenz ist der Komplex der Organisation der>Vie-
len< zur Seite stellen.
162
Erst beide Komplexe zusammengenommen fhren zu einer
aussagekrftigen Definition der politischen Partei. Das Problem der Organisation
der >Vielen< entsteht mit der Auflsung der stndischen Bindungen. Das brgerli-
che Vereinswesen kann als ein Lsungsversuch fr die aus ihren stndischen Bin-
dungen freigesetzten Individuen betrachtet werden, sich auf einer anderen Ebene
wieder zusammenzuschlieen. Der Vereinstypus lt sich jedoch in seiner faszinie-
renden Elastizitt die Fragen offen: Wieviele bilden den Verein? In wieviel Verei-
nen kann der einzelne Mitglied werden?
Das brgerlische Vereinswesen der ersten Hlfte des 19. Jahrhunderts kennt
sowohl den lokalen Verein als auch den berregionalen Zusammenschlu lokaler
179
Vereine. Die Frage der Menge ist auf der Basis der Vereinsstruktur nicht entscheid-
bar. Von politischer Partei ist dagegen erst zu sprechen, wenn Festlegungen erfol-
gen, die auf die Organisation mglichst Vieler zielen. Politische Partei hat den
Anspruch, jeweils >alle< in ihren Kreis zu ziehen: alle, die einem definierten Prinzip
folgen, alle, die diese Interessen haben, alle, die sich im Programm wiedererkennen,
alle, die dem Parteifhrer ihr Vertrauen schenken usw. Die winzige Differenz ist
leicht zu bersehen: politische Parteien erzeugen strukturell einen Erwartungs-
druck, ihre Organisationsansprche zu erfllen, der weitaus dringlicher gemacht
werden kann als die Einladung, sich einem Verein anzuschlieen. Fr einen Verein,
der sich berlokal orientiert, ist es >schn<, wenn ihm dies organisatorisch gelingt.
Gelingt es ihm nicht, so hlt das Vereinsmodell immer noch die lokale Alternative
bereit, auf die umgeschwenkt werden kann. Gelingt es einer politischen Partei
nicht, sich berlokal zu organisieren, so ist dies ein dramatisches Problem, das an
die Wurzeln der Existenz geht.
Worauf beruht diese Angewiesenheit der politischen Partei, da ihrer Definition
eines >Alle, die . . .< Folge geleistet wird? Zunchst ist an die Konkurrenzsituation
zu denken, die zur Partei gehrt. Ebenso wichtig ist aber auch, da der Modus der
Organisation der >Vielen< an das Modell der Reprsentation dessen gebunden ist,
was als je relevante und >wahre< Einheit der >Vielen< propagiert wird. Zu erinnern
ist hier an die berlegungen zur Politik als Schauspiel. Politische Parteien stehen
unter dem Druck, ihre Darstellungsfunktion sichern zu mssen. Vereine mgen
sich Zwecke und Ziele setzen, politische Parteien mssen darber hinaus ihre
Zwecke und Ziele darstellungsfhig machen, sei es mehr programmatisch oder
mehr personell. Sie organisieren die >Vielen< in den Formen von Mitgliedern und
Anhngern. Sie bentigen dafr eine zustzliche mediale Ebene, auf die Vereine im
Prinzip verzichten knnen. Die mediale Ebene kann eine Doktrin sein oder ein
politischer Fhrer.
Whrend Vereine besonders in den Zusammenhang mit der Lockerung und Ver-
unsicherung stndischer Bindungen zu stellen sind, so knnen politische Parteien
besonders in den Zusammenhang mit dem In-Erscheinung-Treten von >Volksmas-
sen< gestellt werden. Die Organisation der >Vielen< als einer Masse - dies Problem
wird in Deutschland gerade in den 40er Jahren virulent.
163
Der oppositionelle poli-
tische Verein, so revolutionr seine Zielsetzung sein mag, kann die >Volksmassen<
doch immer nur fr einen Moment in Szene setzen, ihnen einen dauerhaften sozia-
len Sinn zu verleihen, wird ihm erst mglich sein, wenn er sich als politische Partei
definiert. Das Auftreten der Massen in einen geregelten Gang
164
zu bringen,
bedeutet, sie zu interpretieren und zu versuchen, den Interpretationen eine konti-
nuierliche Form zu geben.
Politische Parteien knnen in dieser Hinsicht als Versuche angesprochen wer-
den, dem Erscheinen der Masse eine Prsenz zu geben, die ihre Riskanz mildert
und ihr zugleich Dauer verleiht. Riskant ist die gefrchtete Wankelmtigkeit der
Menge, ihr kurzsichtiger Opportunismus, ihre schwer zugnglichen Erregungen,
ihr Murren und ihre Panik, ihre notorische Undankbarkeit, ber die politische Par-
teien so beredt zu klagen wissen. Der geregelte Gang erfordert auch, da darauf
verzichtet werden mu, mehr als einer politischen Partei anzugehren, eine Not-
wendigkeit, die im Vereinswesen, selbst im politischen Vereinswesen, nicht
besteht.
180
Die Frage nach dem Umschlag von Kryptopolitik in wirkliche Politik lt
sich mit Hilfe der genannten Kriterien prziser beantworten. Der bergang der
Junghegelianer von der Philosophie zur Partei kann durchaus als Versuch gewertet
werden, sich als politische Partei im hier definierten Sinne zu konstituieren.
163
Die
Junghegelianer definieren nicht nur sich selbst als Reprsentanten der nationalen
Linken, sie definieren andere politische Bestrebungen als Parteien, mit denen sie
konkurrieren, und sie definieren die ffentliche Sphre im Hinblick auf einen
Raum, in dem alternative Politiken mglich sind. Sie streben danach, Anhnger zu
gewinnen, indem sie versuchen, die Bewegungen der Menge interpretatorisch zu
gliedern. Da die politische Partei der Junghegelianer scheitert, kann nicht verges-
sen machen, da sie den Versuch unternommen haben.
Fr Buhl ist Partei eine inkorporierte, gesetzlich reprsentierte politische
Ansicht. Parteien finden wir in allen vollkommeneren politischen Organismen, und
in den vollkommensten gerade am entschiedensten ausgeprgt; sie scheinen also
einen notwendigen Bestandteil jedes ausgebildeten Staatswesens zu bilden.
166
Fra-
gen der inneren Staatsverwaltung seien nicht an sich fr interessant zu halten, das
politische Interesse entstehe nur dort, wo eine Frage nicht blo an sich, wie der
brokratische Standpunkt es tut, sondern im Zusammenhang mit dem Gesamtin-
teresse betrachtet wird.
167
Dieses Zusammensehen ist notwendig politisch per-
spektivisch, weil das Gesamtinteresse nicht von der Zeitdimension abzukoppeln
ist. So verwandelt sich Buhl zufolge eine sachliche Frage in eine politische Tages-
frage. In diese Tagesfragen teilen sich die politischen Parteien.
Die eine Partei vertritt das Recht der Vergangenheit, die andere das Recht der Zukunft,
und der parlamentarische Kampf gestaltet sich zu einem Abschleifungs- und Vermittlungs-
proze. Wo die Parteien nicht vertreten sind, wo sie sich nicht gegeneinander abreiben kn-
nen, da ist immer eine gewaltsame Explosion des unterdrckten Gegensatzes zu frch-
Die Reflexion auf die Explosion signalisiert die Funktion, die Parteien gegen-
ber der Riskanz der Masse haben.
Aber wo sind Parteien in Preuen? Buhl gibt die Frage zurck:
Und ist es denn so ganz ausgemacht, da wir keine Parteien haben? Gesetzlich vertreten
sind sie allerdings nicht; darum sind sie aber doch vorhanden. Auch bei uns existiert eine
Vergangenheit, die sich festzuhalten sucht, und eine Zukunft, die zur Gegenwart zu werden
strebt. Hat doch China seine Parteien, arbeitet doch in der Trkei der Gegensatz des Alten
und Neuen; wie sollten wir keine Parteien haben? Auch htten sich die Partei der Vergan-
genheit und die der Zukunft bei verschiedenen Gelegenheiten manifestiert, obwohl nicht
in der Art wie in Frankreich und England, weil ihnen das Terrain fehlt. Wo die Gegenstze
einmal da sind, da lassen sie sich - das liegt in der Natur der Sache - nicht so leicht abferti-
gen; wird ihnen ein Gebiet verschlossen, so werfen sie sich auf ein anderes. Das sehen wir
auch bei uns.
169
Nur weil die existierenden Parteien in Preuen noch nicht gesetzlich vertreten
sind, bewege sich der Parteienstreit auf dem Felde der Philosophie und der Theolo-
gie.
Die Philosophie macht Partei? Bei Buhl hat sich die Definition schon verscho-
ben: die Partei existiert und tarnt sich durch die Philosophie, weil sie gesetzlich
noch keine Politik machen darf. Es handelt sich bei diesen Tarnungen um
181
keine abstrusen, scholastischen Wortgefechte, sondern um Kmpfe, die in der unmittel-
barsten Beziehung zum Leben stehen. Und aus diesem Kampfgewhle sollten keine Tages-
fragen hervorgehen? Alles ist jetzt Tagesfrage. Schelling oder Hegel, Alt- und Neu-Hegel-
tum sind Tages-, sind Lebensfragen geworden.
170
5. Die Verfassungsfrage
Wie mu die staatliche Sphre organisiert sein, damit Parteien in ihr konkurrieren
knnen? In den Jahren 1839 bis 1843 diskutieren die Junghegelianer den Staat.
Genauer gesagt, handelt es sich um ein Durchdiskutieren des Staates. Die Verteidi-
gung der absolutistischen Monarchie Preuens und der Entwurf einer anarchisti-
schen freien Gemeinschaft bilden die Eckpunkte der Debatte, die, langsam begin-
nend und sich dann enorm beschleunigend, eine Staatsdefinition nach der anderen
entwirft, kritisiert und verwirft und im selben Proze das Spektrum der Parteien
fortlaufend definitorisch differenziert und przisiert.
a) Vom Absolutismus zur konstitutionellen Monarchie
Eine philosophische Schule kann sich im Bndnis mit dem Absolutismus definie-
ren, aber eine politische Partei mu auf einen innerstaatlichen Konkurrenzraum
reflektieren. Die Verfassungsdebatte wird von Ruge 1839 in den HJ, und zwar in
der Form der Politik als Schauspiel, erffnet. Anla bot der Aufsatz Garantien der
preuischen Zustnde, den der preuische Oberregierungsrat Streckfu 1839
verffentlichte.
171
Aufsehen erregte, da hier ein hherer Beamter, das alte knigli-
che Verfassungsversprechen von 1815 einfach bergehend, behauptete, in der exi-
stierenden preuischen Verwaltung seien gengend >Garantien< gegeben. Ruge
antwortet nicht als Reprsentant der HJ, die Preuen als modernen Staat feiern, er
maskiert sich als Wrttemberger, der offen eine konstitutionelle Monarchie for-
dert.
172
Der Text wurde gezielt in Szene gesetzt, Ruge erinnert sich spter an die sorgfl-
tigen Vorbereitungen:
Ich hab' ihn in verschiedenen Tonarten, erst so, dann so begonnen, ich habe die Wirkung
dieser Anfnge auf Echtermeyer und andere Freunde versucht und nicht eher die wirkliche
Durchfhrung des kleinen Musikstckes begonnen, als bis ich fand, da der richtige Ton
getroffen war.
173
Die Rollen sind genau verteilt: Ruge begrndet in einer Anmerkung das Auftre-
tens des Wrttembergers in den HJ damit, da Streckfu mit seiner Schrift die
Diskussion ber die politische Theorie tatschlich freigibt, nun erhebe sich
Widerspruch von einem geist- und kenntnisreichen Sddeutschen, und Ruge
bemerkt, dessen mgliche Irrtmer knnten in Preuen, dem Lande der Intelli-
genz, leicht die gengende Widerlegung finden. Auf der anderen Seite lt Ruge
den Wrttemberger die HJ selbst angreifen, sie htten bis zum berdru
borussiert.
174
Es handelte sich um ein gelungenes politisches Schauspiel, denn fr
einige Jahre hielt man D. F. Strau fr den Verfasser.
Der maskierte Ruge wrdigt die Errungenschaften der preuischen Reformzeit,
182
die Stdteordnung, das Militr- und Schulwesen, die Frderung der Wissenschaft
etc., aber mit Blick auf die HJ schreibt der Wrttemberger:
Whrend der Preue an alle diese Dinge, wie an dogmatische Heiligtmer, mit blinder
Hingebung glaubt, whrend der Preue nichts dagegen hat, da der Absolutismus das
Absolute, welches sich im Staat darstellt, ( . . . ) fr sich behlt, wie weiland der Papst und die
Kirche den Gott und die Wahrheit: so sind wir nicht-preuischen Deutschen auch im Staate
Protestanten, ( . . . ) wir kennen keinen Staat, der nicht vollkommen unser wre, bei dem wir
nicht durch und durch mit dabei wren; ( . . . ) Darum knnen wir den absoluten Staat nicht
vertragen, denn wir knnen es nicht aushalten, da uns der Staat das Absolute, welches er
selber in sich begreift, vorenthlt. An ihm mssen wir theoretisch mit vollem ffentlichem
Selbstbewutsein und praktisch mit freiester Vertretung teilhaben.
175
Die konstitutionelle Monarchie wird von Ruge mit einer Argumentation gefor-
dert, die weit von den traditionellen liberalen Mustern entfernt ist. Es geht nicht um
eine Begrenzung der Macht des Knigs durch Vertretungsorgane, nicht um eine
Zhmung des Absolutismus. Sondern umgekehrt:
Man knnte also sagen, der absolute Staat htte nur den Fehler, da er nicht absolut sei.
Denn wie sollte der Staat absolut sein, der nur in einem Teile, nmlich in der Regierung,
lebendig ist. Ebensowenig als Gott absolut wre, wenn er die Welt nicht durchdrnge, ist
der Staat absolut, wenn er nicht das ganze Leben der Menschen mit seinem Selbstbewut-
sein erfllt und durchdringt.
176
Es handelt sich um mehr als nur ein Wortspiel, wenn Rge den Absolutismus
im politischen Sinne mit dem Absoluten im religionsphilosophischen Sinne
parallelisiert. Rge fhrt die Verfassung im Rahmen einer politischen Theologie
ein. Die wahre Fassung des Absoluten sei im preuischen Staat erst erreicht,
wenn es im protestantischen Sinne den ganzen Staat durchdrungen und im konsti-
tutionellen Leben seine weltliche Realitt gewonnen habe.
177
Ruges politische Theologie ist zentriert um die spekulative Ausdeutung der Sou-
vernitt des Monarchen. 1840 ist sie fr Rge erst gegeben, wenn das Absolute
sich als Einheit von Staats- und Volkssouvernitt darstelle. Ohne Konstitution sei
diese Einheit nicht zu erreichen. Denn im
sogenannten absoluten oder Beamtenstaat ( . . . ) kommt es vor, da das empirische Subjekt
des Herrschers sich selbst fr den Zweck des Staates nimmt; die ganze Beamtenwelt hat nur
die Richtung nach dieser Spitze der Majestt des Staates; und je lnger diese Staatsform in
ihrer Abstraktion von den rein geistigen Zwecken und der selbstbewuten Beteiligung des
Ganzen bei den ffentlichen Angelegenheiten beharrt, desto unwahrer, ohnmchtiger und
geistloser wird ihre begriffswidrige Existenz. Nur der Monarch, der alle Momente der Idea-
litt des Staats, also auch den Inhalt der ffentlichen Vertretung der gesetzgebenden
Gewalt, in sich vereinigt, erst der konstitutionelle Knig ist die vollkommene Staatsper-
Ein Gesichtspunkt mu hervorgehoben werden, wenn der spezifische Modus
der Junghegelianer, den Staat durchzudiskutieren, in den Blick geraten soll. Als
politische Partei knnen sie sich nur definieren, wenn sie den Staat als Konkurrenz-
raum bestimmen. Die Forderung nach der konstitutionellen Monarchie entspricht
diesem Zwang. Aber im Kontext der Parteien rcken sie damit zugleich an die Seite
derer, die gleichfalls und schon viel lnger als sie eine Verfassung fordern. Die Mas-
183
kerade des Wrttembergers hatte dies Problem noch verdeckt. In dem Mae, in
dem die Junghegelianer eine konstitutionelle Monarchie offen fordern, sehen sie
sich gezwungen, den Liberalismus, den sie als philosophische Schule entschieden
ablehnten, ein Stck weit zu rehabilitieren.
179
Der Begriff Liberalismus, den Ruge im Unterschied zur frheren Abwertung
erstmals 1841 positiv einfhrt, ist der Sache nach immer noch streng im Sinne von
Hegels Rechtsphilosophie von 1820 gegen die liberale Tradition selbst gerichtet.
Ruges Liberalismus will weder verwechselt werden mit dem Begriff formeller
Garantien, welcher sich nur auf den Polizeistaat bezieht und die Voraussetzung der
Unsittlichkeit nur herumdreht, indem er sie der obersten Gewalt zurckgibt, noch
mit den Abstraktionen des Republikaners
180
. Es finden sich zwar vorsichtige
Anknpfungen an das liberale Erbe, wenn davon die Rede ist,
da die Formen der Vertretung, der ffentlichkeit, der Pressefreiheit, der Geschworenen-
Gerichte, der Nationalverteidigung etc., welche der Liberalismus einfhrt oder aufgenom-
men hat, keine zuflligen, sondern Begriffsformen entsprechende Bildungen der Freiheit
oder des freien Geistes sind,
181
- entscheidend ist aber auch hier, da die Rehabilitation des Liberalismus an die
politische Theologie argumentativ gebunden bleibt.
Diese erfhrt 1841, dem Stand der junghegelianischen Diskussion entsprechend,
eine erneute Umdeutung. An die Stelle des Absoluten tritt das B. Bauersche
Selbstbewutsein. Der Staat ist nun fr Ruge dieprozessierende Existenz unseres
Selbstbewutseins oder, wenn das deutlicher wre, das geordnete und in allgemei-
nen oder vernnftigen Formen steh selbst bestimmende Volk.
182
>Deutlicher< wird
in dieser Formulierung das Problem, vor dem die junghegelianische Partei steht:
eine Verbindung ihrer politischen Theologie (prozessierende Existenz des Selbst-
bewutseins) mit liberalen Begrndungsformen (Selbstbestimmung des Volkes)
herzustellen. Die Formulierung zielt auf eine Koalition zwischen der Partei der
Liberalen und der junghegelianischen Partei, auf eine Annherung liberaler und
junghegelianischer Positionen.
Man sieht es den Rugeschen Formulierungen an, wie er beide Seiten in immer
neuen Anlufen zu koalieren sucht:
Der Staat ist keine res privata, sondern res publica; er ist aber nach unseren Begriffen,
genau genommen, gar kein res, kein Ding, hchstens eine Angelegenheit, aber auch nicht
eine oder irgendeine Angelegenheit, sondern der Geist, die Freiheit, der Alles an sich selbst,
an ihrem Wissen und ihrem Tun gelegen ist. Der Staat ist sich selbst Zweck.
183
Der Satz fhrt von der res publica, die einen Liberalen erfreuen knnte, zum
Staat als Selbstzweck im Sinne der politischen Theologie, ein Schreckbild fr den
Liberalismus. Offensichtlich hat Ruge dies beim Niederschreiben bemerkt, denn er
fhrt, die andere Seite erinnernd, besnftigend fort:
Staat ist ein schlechtes, totes Wort, besser ist ffentliches Leben<, Geschichte, Reich des
Geistes, Freiheit. Aus diesen Namen sieht man sogleich, das Subjektive ist hier das Wesen
und der Zweck. Unsere Zeit verlangt nun dieses Reich der Freiheit in seiner selbstbewuten
und sich selbst bestimmenden Bewegung, oder die ffentlich und objektiv realisierte Ver-
nunft des Volkes.
184
184
Die Not des Philosophen, der Partei macht, ist nicht zu berhren. Formulierun-
gen in Richtung auf den Liberalismus (ffentliches Leben, Selbstbestimmung des
Volkes) werden kettenhaft mit Formulierungen der politischen Theologie des
Absoluten (Reich des Geistes, objektiv realisierte Vernunft) in eine zwanghafte
begriffliche Reihe gebracht.
Dieselben Probleme ergeben sich, wenn Ruge versucht, seine sich dem Liberalis-
mus zuwendende politische Theologie historisch abzuleiten. Dieser Versuch wird
breit ausgefhrt in Der protestantische Absolutismus und seine Entwicklung,
der ebenfalls 1841 erscheint.
185
Ruge gliedert die preuische Geschichte in drei Phasen: 1) die Entstehung der
protestantischen Macht, 2) die protestantische Weltmacht als absolutes Knigtum,
3) dieselbe als absoluten Staat oder als republikanische Monarchie seit 1808. Im
Mittelpunkt der ersten Phase steht der groe Kurfrst, der pulsierende Punkt, um
den die neue Bildung des modernen zentralen Staates sich ansetzt, dessen eigentli-
che Seele aber der protestantische Geist ist. Die zweite Phase gipfelt in dem Philo-
sophen-Knig, Friedrich II., der ganz in Kppenscher Manier gefeiert wird. Wich-
tig in unserem Zusammenhang ist die dritte Phase, die Ruge mit den Worten ein-
fhrt: Die neue Monarchie, in deren Entwicklung wir noch heute begriffen sind,
und welche man fglich die republikanische nennen kann, entsteht in der Folge der
Niederlage von 1806.
186
Eine eigentmlich zweideutige Bestimmung, deren Stra-
tegie sich jedoch rasch deutlich macht.
Wie Ruge 1838 im Streit mit Leo den modernen Staat Preuen unter Abweisung
des Liberalismus ab 1806 datiert, so datiert er nun fr Preuen ab 1806: Der Staat
des Liberalismus oder die republikanische Monarchie, war jetzt nicht erst zu grn-
den, sondern nur zu vollenden und zu bekennen.
187
Ruge spielt hier mit Rousseaus
Definition eines monarchischen Staates, der >Republik< genannt werden kann,
wenn er im Unterschied zur Tyrannis sittlichen Mindestanforderungen gengt.
Diese Definition identifiziert Ruge umstandslos mit dem Staat des Liberalismus.
Das ist, korrekt betrachtet, eine horrende Verdrehung geschichtlicher Tatsa-
chen. Preuen mag ein noch so fortschrittlicher Verwaltungsstaat gewesen sein,
aber von einem Staat des Liberalismus kann wohl kaum die Rede sein. Das Pro-
blem, das hier gelst werden soll, liegt auf einer anderen Ebene. Ruge mchte um
jeden Preis zur Einfhrung des Liberalismus kommen, aber diese Einfhrung soll
nicht revolutionr erfolgen. Er braucht eine liberale Definition der konstitutionel-
len Monarchie fr die Philosophie, die Partei macht, aber die politische Theologie
des Absoluten kann nicht davon ablassen, von der Seite des Souverns her zu
denken.
So mu Ruge immer wieder Vorgriffe machen. Der Widerspruch des Wrttem-
bergers, da der preuische Knig der politische Papst im protestantischen
Staat sei, dieser Widerspruch ist mit dem Pfingsten 1840 in der Auflsung inbe-
griffen.
188
Was fehlt, ist die Anerkennung des Souverns, da dem auch tatschlich
so sei: Der republikanische Inhalt msse anerkannt und gesetzt, das Prinzip mit
Bewutsein ausgesprochen und zum System ausgefhrt werden. Ruge adaptiert
die liberale Position: Man drckt dies ganz richtig aus, wenn man sagt, es ist keine
Verfassung vorhanden - und er bersetzt dies sogleich politisch theologisch: weil
der Staat als ganzes noch kein Forum der freien Vermittlung seiner Elemente in sich
185
hat. Es sei zwar anzuerkennen, da die Elemente der staatsbrgerlichen und
publizistischen Freiheit vorhanden sind, aber sie sind nicht lebendig und wirk-
sam und sie knnen es nicht eher werden (. . .), als bis der letzte rckhaltlos libe-
rale Schritt der Konstituierung geschieht, der Staat also in seiner Spitze selbst mit
der Freiheit ernst macht.
189
In die monarchische Perspektive soll schlielich auch
der Liberalismus Eingang finden.
Fr die zentrale Monarchie und den Beamtenstaat ist nichts zu frchten, diese, sowie die
Macht, welche in den vorhandenen liberalen Institutionen liegt, sind jedem System unent-
behrlich, bei jeder ernstlichen europischen Bewegung wird aber ebenso unentbehrlich
sein: die wirkliche lebendige Nationalmacht des absolut freien Staates, die Weltmacht des
Liberalismus.^
0
Um 1841 sind die Junghegelianer auf die Position des Liberalismus, der eine kon-
stitutionelle Monarchie fordert, eingeschwenkt. Ihr praktisches Verhalten gegen-
ber den Liberalen wird weiter unten zur Sprache kommen.
m
In diesem Abschnitt
geht es um den Proze des Durchdiskutieren des Staates, und dieser Proze hat
mit dem Einschwenken auf die konstitutionelle Linie gerade erst begonnen. Fr die
politischen Parteien bedeutet die Verfassungsfrage in dieser Zeit zweierlei: Verfas-
sung soll zum einen den Rahmen fr Parteienkonkurrenz bieten, zum anderen sind
Differenzen in der Verfassungsfrage zugleich Differenzen zwischen den politischen
Parteien. Der junghegelianische Konstitutionalismus ist der erste Schritt, sich als
Partei zu definieren.
Als Gruppe von Intellektuellen knnen sie sich damit nicht beruhigen. Sie blei-
ben nicht auf dieser Position, so lange, bis sie in Preuen praktisch realisiert ist, um
dann weiter zu sehen. Sie gehen ber den Konstitutionalismus hinaus, auch ohne
da er in Preuen anerkannt ist. Sie treiben die Verfassungsdebatte, ebenso wie die
Parteidefinition voran, indem sie in einem zweiten Schritt den Konstitutionalismus
als Konkurrenzraum fr politische Parteien intellektuell durchspielen.
b) Die Widersprche des Konstitutionalismus
In der ersten Hlfte des Jahres 1842 stehen im Zentrum der Gruppendiskussion die
Widersprche des Konstitutionalismus. Theoretisch fhrend in dieser Frage ist
B. Bauer, der in einer Reihe von Artikeln in der RhZ insbesondere an der Entwick-
lung der konstitutionellen Monarchie in Frankreich den Funktionsmechanismus
dieser Staatsform reflektiert und zur Diskussion stellt.
Warum Frankreich? Was begrndet die deutschen Sympathien fr Frank-
reich? England scheidet fr B. Bauer aus, diese Nation sei viel zu egoistisch auf
ihre Parteikmpfe gerichtet, und wenn sie etwas an uns wie an andern Vlkern
interessiert, so ist es unser Gold.
192
Solch besondere Parteiinteressen, die sich
in dieser beschrnkten Form hin und her bekmpfen, sind fr B. Bauer uninter-
essant, uns kann es fast gleichgltig sein, ob die Whigs oder Tory's das Staatsruder
fhren.
193
Allenfalls die Kmpfe unter Karl und Cromwell verdienten Beachtung,
allein die dumpfe, religise Schwrmerei, der kirchliche Fanatismus und die Heu-
chelei, welche hier die politischen Kmpfe beherrscht, geleitet und bestimmt hat,
stt uns zurck.
194
186
Da politische Parteien historisch mit den englischen Konfessionskmpfen
zusammenhngen, ist den Junghegelianern bekannt. Rutenberg lt im Rotteck -
Welckerschen >Staatslexikon< den eigentlichen Radikalismus zuerst in England,
in der kirchlichen Opposition der Sekten gegen die Staatskirche beginnen, und
er verbindet diesen Radikalismus mit den englischen Chartisten, mit dem Thema
der sozialen Frage. Rutenberg kann sich hierbei auf He berufen, der in seiner
europischen Triarchie ebenfalls auf den englischen Radikalismus setzt.
195
Wo
sich die Gruppe als journalistische Boheme oder als atheistische Sekte definiert,
werden diese Bezge wieder auftauchen, aber als politische Partei den Konstitutio-
nalismus durchzudiskutieren, fr dieses Projekt gilt Frankreich als zentraler Be-
zugspunkt.
Warum Frankreich? Weil - so B. Bauer - hier die politischen Fragen rein als
solche im Sonnenlicht der Vernunft, der Menschlichkeit und der Sache selbst ver-
handelt werden. Hier mu die Philosophie, die Partei macht, in die Schule gehen.
Wenn die Trumereien unserer Philosophen, zumal unserer philosophischen Politiker fr
Europa wirklich Bedeutung bekommen sollen, so mssen sie doch erst in eine mensch-
lichere Sprache bersetzt werden. Und wo haben wir diese zu lernen? Bei den Franzosen, bei
einem Montesquieu! Bei einem Mirabeau! Also bei einem Volke, welches auch noch in der
letztern Zeit in Tocqueville's Schrift ber Nordamerika ein Werk hervorgebracht hat, dem
wir kein gleiches an die Seite zu setzen haben.
196
In Frankreich sind die Ideen immer
sogleich, wenn sie zur Sprache und zur Verhandlung kommen, auf ihren reinen, allgemeinen
Ausdruck gebracht, also auf einen Ausdruck, in welchem sie (. . .) durch ihre Dialektik, sei
es auch durch ihre inneren Widersprche, hindurchgefhrt werden.
197
Ideen in menschlicher Sprache zur Verhandlung gebracht, als politisch sichtbar
gemachte Dialektik - das ist es, was die politische Partei der Junghegelianer interes-
siert. Und es ist zugleich das, was ihnen in Deutschland noch viel zu ungengend
ausgebildet ist.
Daher B. Bauers Angriffe auf die deutschen Zeitungskorrespondenten, die ver-
chtlich auf die Menge der parlamentarischen Parteien hierselbst (in Frankreich,
d. V.) und ihrer Unter- und Unterabteilungen hinweisen. Sie verstehen den Sinn
der Zersplitterung der Parteien in Frankreich nicht, sie beschreiben den Konstitu-
tionalismus nur im Hinblick auf seine Dysfunktionalitten.
Aber seht doch, sagen die deutschen Korrespondenten, welch ein Getreibe ist das, dieser
Kampf der konstitutionellen Gewalten, wie beargwhnt eine die andere; hrt doch, wie die
Staatsmaschine knarrt, wie die Rder krachen, wenn diese Gewalten ineinander greifen.
198
Fr B. Bauer jedoch reicht es nicht aus, Rsonnements ber das Zwecklose, Resultatlose
und Unfruchtbare der politischen Reibungen und Verhandlungen, welche nun schon lnger
als zehn Jahre Frankreich in Spannung versetzt, seine besten Krfte aufgerieben und ihm die
Kraft der inneren Einheit geraubt haben, ohne da es trotz aller Anstrengungen zu einem
erklecklichen Ergebnis gekommen wre, anzustellen.
199
Auch sei grte Vorsicht geboten, wenn berichtet wrde, den meisten Fhrern
der jetzigen Parteien in Frankreich fehle der Charakter oder alles dasjenige, was wir
zur Sittlichkeit der berzeugung, zur Basis alles Wollens und Handelns rechnen.
Sicher wrde in den franzsischen Zeitungen auch der Charakter der Parteifhrer
in den Streit hineingezogen, aber dieser Kampf um - modern gesprochen - die
187
Glaubwrdigkeit der Parteien in Frankreich htte eine ganz andere Qualitt als die
moralischen Entrstungen deutscher Korrespondenten ber die Parteifhrer in
Frankreich.
In der franzsischen Oppositions-Sprache hat (. . .) jene Anklage (gegen den Charakter der
Parteifhrer, d. V.) allein den wrdigen, mnnlichen und politischen Sinn, da die Gegen-
wart und Zukunft grerer und tieferer Anschauungen, umfassenderer Plne und einer
begeisterten Resignation auf die jetzigen beschrnkten Interessen bedrfe. In der Sprache
der deutschen Korrespondenten ist dieselbe Anklage nur der Ausdruck einer leeren und
zwecklosen Klugheit, die sich ber jene Kmpfe zu erheben dnkt, ohne zu wissen warum,
ohne einen hheren Zweck dagegen zu setzen.
200
Die Konkurrenz der politischen Grundstze und Ziele - sie ist der Bezugspunkt,
von dem aus die gegenseitigen Angriffe, die Zersplitterung der Parteien und Mei-
nungen zu betrachten sind. Nebenbei bemerkt: B. Bauers Artikel knnten noch
heute einen sinnvollen Platz in deutschen Schulbchern erhalten, wenn es darum
gehen soll, die emotionale Abwehr gegen das >Parteiengeznk<, das gegenseitige
Herabsetzen der konkurrierenden Parteipositionen, die Parteienvielfalt samt ihrer
Flgelkmpfe, aufzuklren.
Die jetzigen parlamentarischen Arbeiten Frankreichs sind fr B. Bauer keines-
wegs als lcherliche Zersplitterung der Meinungen abzutun: Die sptere
Geschichte wird aber gerade die Menge der Parteien als einen Beweis der Grnd-
lichkeit betrachten, mit welcher das Prinzip, mit dem sich Frankreich gegenwrtig
beschftigt, behandelt und nach allen Seiten bearbeitet hat.
201
Was fr B. Bauer in
Frankreich geschieht, ist die Durchfhrung der konstitutionellen Verfassung als
historisches Experiment: Die Franzosen haben in den konstitutionellen Kmpfen
der letzten Zeit experimentiert, aber sie haben fr uns alle, fr die ganze Geschichte
experimentiert.
202
Bei Ruge wurde die konstitutionelle Monarchie als erster Schritt eindeutig gefor-
dert, sie war eine Konsequenz des politischen Absolutismus. Bei B. Bauer kommt
ein neues Moment herein: die Verfassungsfrage wird historisch weit geffnet. Die
konstitutionelle Monarchie ist eine Mglichkeit, nicht eine blo zuknftige, son-
dern mit Blick auf Frankreich eine schon gegenwrtige, deren Funktionieren unter-
sucht werden kann wie in einem Experiment.
Hier begegnet uns eine theoretische Figur, die Schule machen wird. Es gibt nicht
nur die Konsequenz der Evolution der Staatsformen, es gibt auch das historische
Experiment, das man beobachten und abwarten kann, weil andere es vorexerzie-
ren, und das frei macht fr die Frage, ob man es wiederholen, modifizieren oder aus
dem Horizont politischer Ziele ausscheiden will. So wird spter Lenin die deutsche
Sozialdemokratie und Mao Tsetung den Stalinismus als ein historisches Experi-
ment definieren. Und heute definieren z. B. Lnder der Dritten Welt das, was
andere im Bereich der Politik tun oder getan haben, als historische Experimente,
die fr die Wahlmglichkeiten verschiedener Politiken Bedeutung gewinnen.
Die Rede vom historischen Experiment nimmt Geschichte nicht einfach als Ver-
lauf von Konsequenzen, in dem Ereignisketten zu Wirkungsketten werden, son-
dern sie privilegiert den Entwurf charakter geschichtlichen Handelns, dessen Reali-
sierung einem historischen Kalkl unterworfen werden kann.
203
Historische Expe-
rimente sind aufwendig, und der historische Kalkl rechnet kaum damit, da iden-
188
tische Wiederholungen den Aufwand lohnen. Als Reihe historischer Experimente
wird Geschichte so zum kollektiven Lernproze. Fr Bauer gilt:
wir wollen nicht dasselbe Experiment wiederholen, zur Experimental-Politik ist immer nur
Ein Volk bestimmt, jedes hat andere Experimente zu machen, wir wollen sehen, welches
Experiment uns vorbehalten ist, wenn dasjenige in Frankreich vollendet ist.
204
B. Bauer
vertritt nicht die Auffassung, da das konstitutionelle System ber alle Vlker und Staaten
ausgedehnt werden msse; es ist nicht die notwendige Form jedes Staates, sondern nur eine
bestimmte Form der Staats-Idee berhaupt. Es ist eine Form, die in Frankreich in allen
Konsequenzen durchgearbeitet wird, die aber nicht verspottet, als klglich verhhnt, son-
dern verstanden werden will.
205
Und was ist der Widerspruch im franzsischen Experiment?
206
Die Antwort:
Der Widerspruch dieser Verfassung und ihre fr sie selbst tdliche Schwierigkeit
liegt darin, da die gesetzgebende und exekutive Gewalt immerfort, in jedem
Augenblick ihrer Ausbung und notwendig miteinander in Kollision kommen
mssen. Wenn die Legislative den Willen und die Exekutive die Aktion dar-
stelle, so sei die Kollision unvermeidlich, da der Wille und die Aktion nie mecha-
nisch, uerlich auseinander gehalten werden knnen.
207
Jeder Wille richte sich
auf Aktion, und jede Aktion fue auf einem Willen. Dies sei nicht nur eine auftre-
tende praktische Kollision, weil jede Seite auf dem Felde des Handelns die andere
zu annektieren trachten msse; die Theorie des Konstitutionalismus, namentlich
die Hegeische Rechtsphilosophie, irre, wenn sie annehme, in der konstitutionellen
Monarchie sei der Konflikt der konstitutionellen Gewalten zu vermeiden.
208
B. Bauer zufolge verfehlt Hegels Theorie der konstitutionellen Monarchie schon
theoretisch ihren Vershnungsanspruch, den Anspruch, organisches System der
Vermittlung zu sein.
Die franzsischen Parteikmpfe zwischen Guizot und Thiers stehen fr diese
Kollision. Guizot wolle die agierende Exekutive gegen die bergriffe der Gesetz-
gebenden sicher stellen. Guizots Polemik sei vergleichbar mit der absoluten Pr-
destinationslehre Calvins: der Unterschied der Gewalten soll absolut prdesti-
niert und ein solcher sein, der fest, bestimmt und unvernderlich ist. Thiers dage-
gen verteidige die Rechte des Willens, der Legislative, die sich nicht mit der Pr-
destination abfinden will, sondern eine ihrem Willen entsprechende Aktion, d. h.
eine parlamentarische Regierung wolle.
209
Die Kollision der Gewalten in der
konstitutionellen Monarchie zeige auch, da Hegel sich geirrt habe in der
Annahme, da die Verfassung durch ihren vollendeten Mechanismus sich selbst
tragen soll.
210
Die Ausbildung der Gesinnung in der Form, auf der die Kon-
struktion beruhe, sei keineswegs gesichert, vielmehr breche der Widerspruch von
Form und Gesinnung wieder hervor.
Exemplarisch zeige sich dieser Widerspruch in der Frage: mu der Frst unbe-
dingt und ohne Rcksicht auf seine eigene berzeugung alle Akte des gesetzgeben-
den Korps besttigen? Der konstitutionellen Theorie zufolge erhalten die Akte
der Legislative erst Gesetzeskraft durch die Unterschrift des Frsten, fr Hegel ein
rein formeller Akt, bei dem nur einer da sein msse, der den berhmten Punkt auf
das >i< setzt. B. Bauer greift dagegen auf Mirabeau zurck, der den Konflikt von
Form und Gesinnung weitaus realistischer entfaltet und an dessen Darstellungen
189
abzulesen sei: Eine Besttigung durch ein willenloses Organ ist ein Unding, ist
eine Absurditt. Die franzsische Entwicklung zeige gerade, wie sehr der Frst
allen Scharfsinn seines Geistes, alle mgliche List anwenden mu, um seine persn-
liche Gesinnung durchzusetzen.
211
Im Zentrum der Analyse steht dabei Louis Philippe, dessen Politik fr B. Bauer
deutlich macht, wie unhaltbar Hegels konstitutionelle Theorie ist. Seit 1830 streite
man sich darber, ob Louis Philippe aufrichtig an der Chatte festgehalten oder
seinen Verstand (...) nur dazu angewandt habe, um die Verfassung zu einem
Schein zu machen. Diese Frage ist fr B. Bauer gleichbedeutend mit der, ob die
Durchfhrung der konstitutionellen Verfassung selbst eine solche sein msse, wel-
che das Prinzip zum Teil zu einem Scheine macht.
212
B. Bauer bejaht diese Frage. In den letzten zwlf Jahren habe sich die Ansicht
durchgesetzt, da die Politik Louis Philippes der vollendetste Ausdruck des
Machiavellismus sei, nmlich der Kunst, die Parteien auf den Punkt zu bringen, wo
sie sich selbst und jedermann anwidern, wo sie den Glauben an sich selbst verlieren,
sich selbst aufgeben und in der allgemeinen Gleichgltigkeit untergehen. Louis
Philippe, Meister in der Kunst, die Partei-Hupter abzunutzen, habe sich zum
absoluten Herrn ber sie gemacht. Fr B. Bauer ist dies eine Konsequenz des
Konstitutionalismus, der daher keine adquate staatliche Form fr die Konkurrenz
politischer Parteien ist. Fr die Junghegelianer steht nun zur Debatte, ob die kon-
stitutionelle Verfassung selbst diese Luftpumpe ist, welche den Partei-Huptern
die Lebensluft nimmt.
213
Dem konstitutionell nicht zu verhindernden Machiavellismus des Frsten ent-
spricht auf der anderen Seite die Ghrung der Massen. Sie betrachten die konsti-
tutionellen Kmpfe als ein lcherliches Spiel.
214
Noch habe das >Prinzip< der
Massen nicht die Klarheit, Reinheit und Bestimmtheit gewonnen, in der es schon
geschichtlich werden knnte, auch seien noch keine plastischen Fhrer der
Massen in Sicht, aber B. Bauer ist sicher, da es sich um eine Ghrung handelt,
die die Auflsung der Widersprche des Konstitutionalismus ankndigt. Wenn
das Volk gegen die bisherigen Parteien gleichgltig zu werden anfngt, so liegt der
Grund nur darin, weil es eine neue Macht ahndet, eine einfachere und falichere
Parole erwartet und der nahen Zukunft im Voraus sich zuwendet.
213
Wo finden sich in Deutschland Entsprechungen fr das franzsische historische
Experiment des Konstitutionalismus? B. Bauer nennt zum einen den Streit in der
Hegelschule. Hier htten die lteren Schler Hegels die zwei Gewalten des Glau-
bens und Wissens, der Offenbarung und der Vernunft, der gttlichen Macht und
der menschlichen Freiheit ( . . . ) in konstitutioneller Weise zu lsen, zu vermitteln
und in Einheit zu setzen gesucht, und wie in Frankreich htten sie sich in der
Durchfhrung dieses Projekts in eine fast unendliche Menge von Sekten, Parteien
und Fraktionen zersplittert.
216
Zum anderen knne man die Widersprche des
Konstitutionalismus anhand der Konflikte studieren, die in Baden und in Hanno-
ver stattgefunden htten. Und B. Bauer mahnt auch hier: Redet nicht so vercht-
lich von den Verwicklungen, die sich in den deutschen konstitutionellen Staaten
gebildet haben.
217
Vom neuen Standpunkt der politischen Partei aus werden die
Probleme der konstitutionellen Monarchie und die Probleme der konstitutionel-
len Philosophie< zusammengedeutet.
190
Geschichtlich mageblich aber bleibt fr B. Bauer das historische Experiment
Frankreich, dessen Ausgang 1842 noch im Scho der Geschichte verborgen
liegt. Dennoch geht B. Bauer einen Schritt weiter; aus den Widersprchen des
Konstitutionalismus sei
die Existenz derjenigen Partei in Frankreich zu erklren (. . .), die daran verzweifelt, da
aus dem Iconstitutioneen Prinzip ihr Heil hervorgehen knne und die deshalb ihr Auge
nach Nordamerika gerichtet hat. Dort, meint sie, sei der konstitutionelle Widerspruch zwi-
schen Form und Gesinnung aufgehoben, weil der Chef der exekutiven Gewalt je nach dem
herrschenden System wechselt, also nicht bestndig mit dem allgemeinen Willen in Kollision
zu kommen braucht.
218
Wre das eine Lsung? Wenn in der konstitutionellen Monarchie die politischen
Parteien zwischen dem Machiavellismus der Exekutive und der Gleichgltigkeit
der Massen aufgerieben werden, ist ihre Wirksamkeit und Lebensfhigkeit, die
Konkurrenz der Prinzipien, dann nicht besser garantiert, wenn die parlamentari-
sche Mehrheit ihren Willen, ihr System als Aktion ihrer Regierung realisiert?
Knnen so die Massen an Prinzipien gebunden werden? Vor die Alternative
gestellt, ob die Exekutive die Legislative zur Illusion herabwrdigt, oder ob die
exekutive Gewalt (. . .) der parlamentarischen als Beute
219
anheimfllt, entschei-
den sich die Junghegelianer fr die letztere. Sie gehen im Laufe des Jahres 1842 zur
Diskussion der parlamentarischen Demokratie ber.
c) Liberale Partei, radikale Partei
Ruges Selbtskritik des Liberalismus, mit der er 1843 die DJ erffnet, kann als
Abschlu der Phase gewertet werden, in der die Junghegelianer aus den Wider-
sprchen des Konstitutionalismus die Konsequenz ziehen, sich als radikale Partei
der Demokratie zu definieren. Die konstitutionelle Monarchie ist Rge zufolge ein
hlzernes Eisen, denn: Der liberale Souvern wnscht, da seine Untertanen frei
sind, ihm aber natrlich die Souvernitt lassen; die liberalen Untertanen wn-
schen, da der Knig sie frei macht, aber die Souvernitt natrlich fr sich
behlt. Rge fordert jetzt die Auflsung des Liberalismus in Demokratismus.
220
Was aber bedeutet Demokratismus, was Liberalismus, den Rge zwei Jahre
zuvor als Weltmacht gefeiert hatte?
Die Verfassungsdiskussion der Junghegelianer ist - daran mu erinnert werden
- eine Diskussion, in der sie ihr Selbstverstndnis als politische Partei klren.
Liberalismus und Demokratismus bezeichnen nicht lediglich Verfassungssy-
steme, es sind zugleich Parteinamen, die die Gruppe programmatisch einen sollen
und mit denen sie sich von anderen Parteien unterscheiden will. Der Begriff Libe-
ralismus, auf den die Junghegelianer zunchst eingeschwenkt waren, erweist sich
jedoch im Zusammenhang der Verfassungsdebatte als zu ungenau, er mu kritisiert
werden.
Ruges Selbstkritik nennt zunchst historische Bezge. Als Konstitutionalisten,
die sich auf das Verfassungsversprechen des Knigs von 1815 bezogen, haben die
Junghegelianer sich in den Rahmen einer Kontinuitt liberaler Bestrebungen
gestellt; jetzt bricht Rge diese Kontinuitt auf. Er bezieht sich auf die radikalen
Demokraten der Freiheitskriege und geht davon aus, da mit der Reaktionspe-
191
riode der Keim der demokratischen Partei in Deutschland erstickt worden sei.
Besiegt worden seien hier die Demokratie und die Menschenrechte der Revolu-
tion. Noch mehr, die demokratische Partei ist vernichtet. Das neue historische
Schema geht davon aus: Die Entwicklung Deutschlands in politischer Hinsicht
bricht da ab, wo die Demokratie der Regenerationsperiode vernichtet wird.
221
Der Liberalismus wird historisch zu einem sekundren Phnomen, er ist her-
abgesetzt zu einem theoretischen Sohn der frh verstorbenen demokratischen
Partei. Liberalismus ist die Freiheit eines Volkes, welches in der Theorie stek-
kengeblieben.
222
Der Begriff signalisiere verschwommene Haltungen, bei denen
mangels praktischer Bestimmtheit nur der gute Wille zur Freiheit zu erkennen
sei. Ob eine liberale Partei berhaupt existiere, sei zweifelhaft.
Die RhZ ergnzt die Rugesche Selbstkritik. Historisch sei der Liberalismus
eine sehr komplizierte Erscheinung gewesen, er war keineswegs eine Phase des
Demokratismus, er war nichts als das Gegenteil, der contre-coup einer systemati-
schen Reaktion. Der Integrationsnenner des Liberalismus sei die Reaktion gewe-
sen, sie sammelte oder zwang alles, was sie gegen sich in den Kampf rief, in eine
knstliche Partei, sie schuf ein knstliches Produkt, in dem die verschiedensten
Elemente und Richtungen sich zusammenfanden und das etwa den Anblick einer
Masse darbot, die sich unter einem dauernden, schweren Drucke kristallisiert hat.
So sei das Gemeinsame des Liberalismus nur negativ gegen die Reaktion zu bestim-
men gewesen, aber dieser alte Liberalismus, diese Partei mute natrlich jede
Antwort auf die Frage: was nach dem Siege geschehen solle, ablehnen, sie mute
und konnte dies lediglich >der Zukunft anheimstellen^
223
Jetzt stehe zur Diskus-
sion, wie die positiven Zielvorstellungen einzelner Tendenzen aussehen und ob
es
gemeinsame Grundlagen gibt.
Der positive Differenzierungsproze setzt 1842 ein, zunchst noch als Differen-
zierung verschiedener Liberalismen. Die Sprachregelungen setzen sich erst lang-
sam durch. Was bezeichnet man heutzutage nicht alles mit dem Worte liberal!,
ruft E. Bauer aus, und er mu feststellen: Es ist wirklich beinahe so, da, wenn
man die verschiedenen Arten von Liberalitt durchnehmen wollte, die es in Berlin
gibt, man die Meinung jedes einzelnen, welcher sich liberal nennt, anfhren
mte.
224
Es fehlten Zeitungen fr die Aufklrung und Luterung der Positio-
nen, daher sei die Gefahr gegeben, da blo eine groe Menge kleiner Geister
durch die glnzende Auenseite des Wortes >liberal< angezogen wrden. Nimmt
man diese Gruppe hinzu, so kommt E. Bauer auf drei Typen von Liberalen: die
Ziffern-Liberalen, die sich mit flachen Rsonnements aufblhen, die vermit-
telnden oder juste-milieu-Liberalen, und die, welche allein mit Recht Liberale
genannt werden knnen. Letztere sind die wahren Liberalen, welche die hohe
Macht der Wissenschaft und die Wrde der menschlichen Vernunft als die einzi-
gen Potenzen ansehen, welche dem Staatsorganismus wahres Leben mitzuteilen
vermgen.
225
Die definitorische Offensive fr das, was wahrhaft >liberal< genannt
werden kann, liegt seit 1842 bei der junghegelianischen Partei, d. h. bei denen, die
auch die Verfassungsdiskussion vorantreiben.
Wie die definitorische Offensive vorangetrieben wird, zeigt die anonyme junghe-
gelianische Schrift Staat, Religion, Partei (1843), die vielleicht von E. Bauer
stammen knnte. Hier heit es:
192
Es gibt einen Liberalismus der ungrndlichen Bequemlichkeit, und es gibt einen Liberalis-
mus der unbequemen Grndlichkeit. ( . . . ) Der erstere ist der Liberalismus par excellence,
fr den anderen gibt es keinen hervorstechenden Namen, weil er eben nichts Besonderes,
sondern etwas Allgemeines, Wissenschaftliches ist: die einen nennen ihn Demokratismus,
die einen Schwrmerei, die einen Radikalismus, die einen gar Nihilismus.
226
Prziser sind die Verfassungstheorien zu differenzieren. Insgesamt sind es drei,
auf die sich die Debatte zu konzentrieren hat: auf den Staat des gesunden Men-
schenverstandes (die Liberalen), den Staat der Individualitt (die Legitimisten),
den Staat der Prinzipien und der Theorie (die Radikalen). Mit den Legitimisten sei
keine Diskussion zu fhren, denn nicht der Vemunftsatz, sondern das rohe Fak-
tum ist ihnen das Hchste. Kernpunkt der Kritik an der liberalen Auffassung ist,
da dieser Staat des gesunden Menschenverstandes eine ganz abstrakte Macht ist,
die, weil sie nicht in den Gemtern, nicht im Geiste der Menschen existiert, son-
dern ihnen uerlich und tyrannisch gegenbersteht, die Persnlichkeiten nicht zu
ihrem Recht, nicht zur freien Entwicklung ihres Willens und ihrer Einsicht gelan-
gen lt. Im Unterschied dazu betont der Radikale: Die Staatsformen hngen
ganz genau mit dem politischen Bewutsein der Staatsangehrigen zusammen; sie
sind Ausdrucksweisen desselben. Przisiert wird diese Bestimmung: Freilich,
jede Regierung basiert auf dem Bewutsein des Volkes, aber nicht jede Regierung
ist eine bewute Schpfung desselben. Dies sei nur mglich, wenn die Scheidung
des Liberalismus zwischen privater und politischer berzeugung aufgehoben
werde. Das philosophisch-politische Bewutsein der Radikalen will in seiner
Regierung den Ausdruck seiner selbst sehen; es verlangt eine Selbstregierung.
227
Bei seinem Versuch, eine kohrente politische Theorie des vormrzlichen Radi-
kalismus, die vom Liberalismus der Zeit klar unterschieden ist, zu rekonstruieren,
macht P. Wende deutlich, da die Differenz von liberal und radikal wohl in der
Frage der konstitutionellen Monarchie ihren Ausgangspunkt nimmt, da sich
jedoch mit dieser Frage zugleich eine tiefergehende Differenz abzeichnet. Entschei-
dend fr den Liberalismus ist, da er der Erfahrung des Auseinandertretens von
Staat und Gesellschaft im Vormrz in spezifischer Weise begegnet. Es geht um Ver-
suche, einen innerstaatlichen Ausgleich zu erzielen, sei es als Versuch der orga-
nisch-konstitutionellen Liberalen, an die historisch gegebene Bipolaritt von
Frst und Stnden anzuknpfen, oder als Versuch des naturrechtlich-parlamenta-
rischen Liberalismus, zwischen Regierung und Volk, Staat und Gesellschaft: For-
men der Krftebalance anzustreben. In beiden Versuchen gehe es nicht um eine
Aufhebung dieser Dualismen, die Liberalen streben stattdessen ganz bewut
lediglich den Ausgleich der widerstreitenden Krfte durch die kunstvolle Etablie-
rung eines innerstaatlichen Gleichgewichts an, das im harmonischen Miteinander
von Regierungsgewalt und Volksvertretung gewhrleistet sein soll.
228
Im Unterschied zu diesen Auffassungen, die etwa bei Dahlmann wie auch bei
Rotteck anzutreffen sind, ist Wende zufolge die Tendenz zu einer monistischen Fas-
sung von Staat und Gesellschaft fr den vormrzlichen Radikalismus bestimmend.
Monistisch ist z. B. die These: Jede Gesellschaft, die sich vollkommen auf sich
sttzt und nach eigenem Willen bewegt, jede souverne Gesellschaft, ist Staat.
229
Fr die These, Strukturmerkmal des vormrzlichen Radikalismus sei eine monisti-
193
sehe Fassung von Staat und Gesellschaft, sprechen nicht nur die Auffassungen von
Rge und Nauwerck, die Wende untersucht hat, vielmehr tendieren alle Junghege-
lianer, wo sie sich als politische Partei des Radikalismus definieren, zu monistischen
Lsungen.
Allerdings geraten die monistischen Anstze im Proze des Durchdiskutierens
des Staates noch einmal in Bedrngnis. Die Junghegelianer beruhigen sich nicht mit
der Differenzierung von liberal-radikal; in dem Mae, in dem sie die Abgrenzung
gegen den liberalen Dualismus vertiefen und monistische Lsungen imaginieren,
wird die politische Sphre insgesamt zur Diskussion gestellt. Drei Streitpunkte der
Debatte seien hervorgehoben: 1. die Frage der Selbstregierung und der Reprsen-
tation, 2. die Frage nach den Grundlagen des Staates (das Verhltnis privat/ffent-
lich) und 3. die Frage nach der politischen Qualitt des Radikalismus.
Fr den bergang von der Verteidigung des Absolutismus zur konstitutionellen
Monarchie ist Rge theoretisch fhrend gewesen, die Widersprche des Konstitu-
tionalismus wurden in der Gruppe zunchst von B. Bauer prgnant entfaltet, in der
Diskussion des politischen Radikalismus ergreift E. Bauer die Initiative. Seine The-
sen sind in der Forschung kaum gewrdigt worden, teils wurde er kurzerhand mit
seinem Bruder Bruno in theoretische Sippenhaft< genommen, teils gilt er als epigo-
naler Schriftsteller.
230
Auch die Anarchismusforschung hat E. Bauer weitgehend
vergessen, obwohl er noch vor Stirner und mit mehr Recht in die Ahnenreihe des
Anarchismus aufzunehmen wre.
231
Im Sommer 1842 erffnet E. Bauer in der RhZ die Debatte um den politischen
Radikalismus, indem er zunchst die monistische Kritik am liberalen Dualismus
entfaltet.
232
Er trifft dabei nicht nur die >organisch-konstitutionellen Liberalem<,
sondern seine Thesen sind schon entschieden auf die >naturrechtlich-parlamentari-
sehen Liberalen< zugespitzt.
Er kritisiert wiederholt die durchgngige Tendenz der Liberalen: man teilt den
Staat in zwei Heerlager. Man macht aus der Deputierten-Kammer eine Versamm-
lung, die dazu da isi, die Regierung argwhnisch zu belauern, zu bekmpfen, ihr
Konzessionen zu machen oder sich solche machen zu lassen. Aus dem Dualismus
folge notwendigerweise der Kreistanz der Garantien.
233
Der Liberalismus
gelange berhaupt nicht zur Ausbildung freier Institutionen. Der Liberale erblicke
in der Einherrschaft kein Prinzip, sonst wrde er wissen, da man mit einem Prinzip nicht
unterhandeln kann, er erblickt in ihr nur eine Gefahr. Und ebenso sieht er die Volksherr-
schaft an. Nun ist schon das unbegreiflich, wie sich zwei Gefahren aufheben sollen, dadurch,
da man sie zusammenbringt, und, das ist vor allem hervorzuheben, das ganze Wesen des
Staates wird durch diese Anschauung verdreht und korrumpiert. Nmlich so: Alle Staatsin-
stitutionen werden angesehen als Einrichtungen, die nur der Sicherheit wegen da sind.
Nicht aus dem Volksgeiste sind sie hervorgegangen, sie sind nur, um zwei feindselige
Mchte, die ewig im Kriege liegen, zu beschrnken.
234
In dieser Perspektive verwandle sich alles in ein Kontrollsystem:
Die Volksreprsentation wird eine Kontrolle, die Pressefreiheit wird eine Kontrolle, die
ffentlichkeit wird eine Kontrolle. Dies alles msse eingefhrt werden, meint das Juste-
Milieu. Aber es leitet die Notwendigkeit hiervon nicht aus dem Prinzip ab, nicht daraus, weil
194
das Volk zum Bewutsein seiner Rechte und der Vernnftigkeit jener Institutionen gelangt
sei, sondern weil es die Einherrschaft kontrollieren msse.
Der Dualismus im liberalen Denken zeigt sich E. Bauer zufolge auch in der kon-
stitutionellen Fassung der Vertragstheorie. Das konstitutionelle Staatsrecht grn-
det sich auf den Vertrag zwischen Frst und Brger. Dieser Vertrag wird geschlos-
sen, um die natrlichen Rechte des Menschen durch den Rechtsstaat zu sichern;
und diese Sicherheit erhlt man durch Garantien. Dieses Vertragsmodell ist fr
E. Bauer nicht akzeptabel. Wie ein Vergleich von Hobbes und Rousseau zeige,
knnten auf Vertragstheorien die verschiedensten und widersprechendsten
Systeme gebaut werden. Auerdem sei die naturrechtliche Argumentation an sich
zweifelhaft.
Eben so wenig, wie wir sagen knnen, da die Menschen sich die Sprache durch berein-
kunft, Vertrag gegeben haben, eben so wenig drfen wir behaupten, da sie durch Vertrag
in Gesellschaft getreten sind. So wie sie dachten, sprachen sie, und so wie sie dachten und
sprachen, sahen sie sich in Gesellschaft.
Der Rekurs auf Naturzustand und Naturrecht habe nur einen Sinn, wenn man
nicht von den >ersten< Menschen, sondern von der entwickelten Gesellschaft aus-
geht.
Im wahrhaften Naturzustande, d. h. in dem, welcher seinem Wesen angemessen ist, befin-
det sich der Mensch nur dann, wenn er sich in der mglichst komplizierten und zivilisierten
Gesellschaft befindet. Und somit hat er nicht seine Rechte als Zugabe, als etwas unmittelbar
an ihm Haftendes, er entwickelt sie sich erst und macht sie sich in der Gesellschaft.
Was die >Naturrechte< meinen, ist das Resultat eines historischen Prozesses.
Die Bildung der Gesellschaft bringt erst die Rechte hervor, und je hher diese Bildung ist,
je mehr sich diese Gesellschaft dem Staate nhert, desto grer, desto erhabener werden die
Rechte des Menschen. Recht und Staat hngen also ihrem Wesen nach unmittelbar zusam-
men; kein Staat ohne Rechte, keine Rechte ohne Staat, und daher gibt es keine Naturrechte.
Schon hieraus sehen wir, da eine Gesellschaft, welche zusammentretend ihre Rechte schon
fertig mitbringt, und sich dieselben vertragsmig garantiert, ein Unsinn ist.
Wenn von >Naturrechten< sinnvoll geredet werden soll, so knnen sie allenfalls
auf einer spteren Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung erscheinen. Gesell-
schaft sei auf allen Stufen, dem archaischen Eroberungsdespotismus, dem Knig-
tum von Gottes Gnaden, dem aufgeklrten Despotismus und dem freien Staat,
gegeben, aber sie
entwickelt sich, sie bringt sich hierdurch alle Stufen, die sie zu durchlaufen hat, zu Bewut-
sein; sie lernt. Und indem sie lernt, so wird sie berechtigt, bildet sie ihre Rechte immer mehr
aus, was nichts anderes sagen will, als da sie immer vernnftiger wird. So macht sie die Ver-
nunft immer mehr zur Grundlage ihrer Institutionen, lernt sich in ihrer Kraft und Macht-
quelle kennen; sie wird - souvern. Und nur dann, wenn sie das vernnftige Bewutsein zu
ihrem heiligsten Eigentum gemacht hat, in welchem Alle gleich sind, weil sie Alle gleichen
Teil daran haben, nur dann hat sie auch das Bewutsein des Vertrages, nur dann bildet sie
einen auf Vertrag gegrndeten Staat.
Es handelt sich bei E. Bauer nicht einfach um eine historische Begrndung des
Naturrechts und der Vertragstheorie, vielmehr fhrt er die historische Perspektive
195
weiter. Man drfe den Vertrag der entwickelten Gesellschaft nicht falsch auffas-
sen. Eine Gesellschaft, die so vernnftig ist, ihre Rechte zu erkennen, wird auch so
vernnftig sein, sie zu behalten und sie nicht in demselben Augenblick, wo sie sie
erkannt hat, wieder verschenken. Im Innern der Vertragstheorie ist das Problem
der Reprsentation verborgen, auf das E. Bauers Argumentation zielt.
Die Frage, ob das demokratische System der Selbstregierung mit dem Institut
der Reprsentation vereinbar ist, wird von E. Bauer verneint. Seine These, die an
Rousseau anschliet, lautet: Der Wille kann nicht reprsentiert werden.
235
Selbst
unter den Bedingungen eines allgemeinen und gleichen Wahlrechts, sei eine Wil-
lensreprsentation sachlich unmglich.
Auf welche Weise soll eine Gemeinde ihrem Vertreter ihren Willen kund geben? Sie mu
ihm denselben schriftlich in einem Hefte oder mndlich mitteilen. Will er nun der wirkliche
Vertreter des Willens seiner Gemeinde sein, so darf er selbst keinen Willen, keine Macht,
selbstndig sich zu entscheiden, haben, er darf keine Gegengrnde anhren, sich nicht ber-
zeugen lassen, er mu selbst willenlos sein.
Der Vertreter brauchte an seinen Abgeordnetenplatz lediglich sein Heft zu
legen, weil er in der Tat nichts sein drfte, als ein lebendiges, atmendes Heft. Die
Reprsentation des Volkswillens schlsse so die Diskussion der Abgeordneten aus.
Da aber niemand sich so herabwrdigen lassen drfe, als bloes Instrument zu gel-
ten, entsteht eine Diskussionsnotwendigkeit. Die Konsequenz ist: dadurch, da
man in einer Deputiertenversammlung spricht, erklrt man sogleich, da man selbst
etwas sein will, d. h. da man nicht mehr Vertreter ist, nicht >Reprsentant<.
Sobald der Abgeordnete zu diskutieren beginnt, Argumente und Gegenargumente
entfaltet, vertritt er nicht mehr den Willen, man vertritt nur noch die Intelligenz.
Das heit, der Sache nach haben die Abgeordneten die Funktion von Beratern.
Und so sollten sie auch bloe Berater bleiben und dem Volke das Recht lassen, in
seinen Gemeindeversammlungen seine Gesetze anzunehmen oder zu verwerfen.
Denn nur dann wren diese - dem Prinzipe nach - wahrhafte Volksgesetze. Was
E. Bauer ins Spiel bringt, ist eine Form direkter Basisdemokratie.
Reprsentation und Selbstregierung schlieen einander aus, denn: sowie die
Reprsentanten gewhlt sind, sind diejenigen, welche stets Staatsbrger sein soll-
ten, nichts als Privatpersonen. Die Form der Reprsentation hat daher auch Kon-
sequenzen fr die Entwicklung der Parteien, die nur noch als Dualismus von Regie-
rungspartei und Oppositionspartei auftreten, ein Dualismus, in dem sich die Bipo-
laritt von Volk und Frst wiederholt. Parteien soll es zwar immer in einem Staate
geben, aber eben in einem Staate. Nicht soll eine Partei dem Staate gegenberste-
hen, oder was dasselbe ist, sich allein fr den Staat betrachten. Da Parteien im
Staate existieren, ist im strengen Sinne nur mglich, wenn der mit der Reprsenta-
tion einhergehende >Rckfall< der Staatsbrger in den Privatpersonenstatus aufge-
lst wird.
d) Demokratischer Monismus und Abschaffung des Staates
Um die Jahreswende 1842/43 konzentriert sich die Staatsdiskussion der Junghege-
lianer auf die Spaltung von privat und ffentlich, die den monistischen Lsungsver-
suchen widerstreitet. Der Artikel Betrachtungen ber Liberalismus und Zensur,
196
der im Januar 1843 in der RhZ erscheint, greift die E. Bauersche Argumentation
auf. Der Artikel ist mit S. unterzeichnet; inhaltliche und stilistische Eigenheiten
rechtfertigen es, Stirner als mglichen Verfasser ins Auge zu fassen.
236
Stirner greift Ruges Diktum von der Auflsung des Liberalismus in Demokratis-
mus auf und versucht, die Parteidifferenz zu przisieren. Wir Liberalen, spricht
Michel Liberalis, sind wackere, vortreffliche Leute, wenn wir nur knnten wie wir
wollten, was wrden wir nicht alles wollen. Der Liberale brchte es immer nur zu
der Versicherung, da er berhaupt wolle, diesen Willen aber nie auf ein
bestimmtes fixiert. Er setze sich auf einen Isolierstuhl, die Regierung (. . .) auf
den anderen, den anderen nicht liberalen Rest auf den dritten. Es handelt sich um
die vollkommenste Atomistik, der pure politische Tod, weil zwischen dem
Gemeinwesen und der privaten Existenz, zwischen dem allgemeinen Wollen und
dem bestimmten Wollen eine Spaltung vorhanden sei. Stirner fragt:
Wofr mhen wir uns ab, was ist unser Dichten und Trachten, was ist das summum
bonum, der Gtze, dem wir opfern? Antwort: Die Behaglichkeit des Privatlebens und seine
Gensse. In dem groen Strome der brgerlichen Gesellschaft, in diesem Systeme der
Bedrfnisse kommt es vor allem darauf an, da Nahrung und Kleidung, Wohnung und Kin-
dererzeugung bestehen.
Diese Orientierung bestimme das Verhltnis zum Staat. Er sei dann eben nichts
weiter, als der groe Rahmen der Mglichkeiten und Chancen, um zu dem Vollge-
nu dieser isolierten Existenz zu kommen. Die Regierung, die dieser Liberalismus
aus sich entlasse, entspreche dem, was er selbst ist. Sie ist nicht aus dem Monde
her, sie ist seine eigene Regierung.
Auch die Regierung folge dem atomistischen Prinzip, hier lgen die Wurzeln
einer isolierten Brokratie, die zentralisieren und zensieren msse, um parallel dazu
zu versichern, da sie das Allgemeine wolle.
Das Verhltnis dieser egoistischen Isolierung, wonach jeder nur an sich denkt und an sein
privates, profitables Bestehen und danebenher versichert, die Freiheit zu wollen, ist unseres
Erachtens das charakteristische Merkmal des Liberalismus, den die Jahrbcher nicht woll-
ten, und der fortan nicht sein soll.
Stirner interpretiert Ruges Forderung in Frageform dahingehend, da man die-
sen so beschaffenenen Liberalismus geradezu umzukehren habe, und diese seine
Umkehrung, der Demokratismus sei, wonach der Liberale zum Demokraten, d. h.
aus einem unpolitischen in ein politisches Tier< umzuwandeln sei? Stirner ber-
setzt zu diesem Zeitpunkt die konomischen Schriften von Smith und Say; die Spal-
tung von isolierender wirtschaftlicher Orientierung und einer allgemeinen politi-
schen Sphre der brgerlichen Freiheit ist ihm vertraut, und er bringt dies in die
Debatte ein. Die liberale Partei wre also diejenige, die diese Spaltung affirmiert,
die vom isoliert wirtschaftenden unpolitischen Tier ausgeht, die demokratische
Partei politisiert dagegen die Sphre der isolierten Bedrfnisse.
Marx greift in seinem unverffentlichten Manuskript zur Kritik des Hegeischen
Staatsrechts, geschrieben Mrz bis August 1843, die in der Debatte entwickelten
Positionen auf. Wie B. Bauer kritisiert er am Konstitutionalismus die Transaktio-
nen zweier gegenstzlicher Willen:,
237
und er reflektiert die von E. Bauer aufgewor-
fene Frage der Reprsentation ebenso wie die von Stirner akzentuierten Thesen zur
Spaltung von privat und ffentlich.
197
Der brgerliche Staat habe die sonderbare Erfindung gemacht, die allgemeine
Angelegenheit als eine bloe Form sich anzueignen. Dagegen sei die Demokratie
das aufgelste Rtsel aller Verfassungen. Demokratie ist nicht blo Form.
In der Demokratie ist das formelle Prinzip zugleich das materielle Prinzip. Sie ist daher erst
die wahre Einheit des Allgemeinen und Besonderen. In der Monarchie z. B., in der Republik
als einer nur besonderen Staatsform, hat der politische Mensch sein besonderes Dasein
neben dem unpolitischen, dem Privatmenschen.
Die Aufhebung der Trennung von brgerlicher Gesellschaft und politischem
Staat sei erst in der Demokratie gegeben, weil erst hier der abstrakte Staat aufge-
hrt (hat), das herrschende Moment zu sein. Die blo politische Republik, wie
Marx den Konstitutionalismus und Liberalismus nennt, ist blo eine unvollendete
Demokratie, sie ist die Demokratie innerhalb der abstrakten Staatsform.
238
Die Aufhebung der Spaltung von privat und ffentlich hat Konsequenzen fr die
Frage der Reprsentation. Findet eine Trennung des politischen Staats und der
brgerlichen Gesellschaft statt, dann knnen nicht Alle einzeln an der gesetzgeben-
den Gewalt teilnehmen; der politische Staat ist eine von der brgerlichen Gesell-
schaft getrennte Existenz. Dieser knne die Brger als Gesetzgeber nur in einer
Form ertragen, die seinem Mastab angemessen ist. Das Institut der Abgeordne-
ten folge dieser Notwendigkeit. Wre die brgerliche Gesellschaft eine wirkliche
politische Gesellschaft, dann
verschwindet die Bedeutung der gesetzgebenden Gewalt als einer reprsentativen Gewalt
gnzlich. Die gesetzgebende Gewalt ist hier Reprsentation in dem Sinne, wie jede Funktion
reprsentativ ist, wie z. B. der Schuster, insofern er ein soziales Bedrfnis verrichtet, mein
Reprsentant ist, wie jede bestimmte soziale Ttigkeit als Gattungsttigkeit nur die Gattung,
d. h. eine Bestimmung meines eigenen Wesens reprsentiert, wie jeder Mensch der Repr-
sentant des andern ist. Er ist hier Reprsentant nicht durch ein anderes, was er vorstellt, son-
dern durch das, was er ist und tut.
239
Marx bricht das Manuskript im August 1843 ab. Marxsche Abbrche sind her-
ausfordernd. Dies gilt nicht nur fr das Kapitel ber die Klassen am Ende des drit-
ten Bandes des >Kapital<,
240
sondern auch hier. Mit dem 313, bei dem Marx
abbricht, ist das innere Staatsrecht bei Hegel noch nicht zu Ende. Es werden von
Marx nicht kritisiert die Ausfhrungen zur ffentlichkeit als bildendem Schau-
spiel, das Verhltnis von Wissenschaft und ffentlicher Meinung, also genau die
Fragen, die fr die Parteidiskussion von Bedeutung sind.
241
Stie die Fortsetzung
des Manuskripts auf unberwindliche theoretische Schwierigkeiten? Ich mchte
dies Problem der Marx-Forschung berlassen.
Sicher ist, da in dem August, als Marx abbricht, E. Bauers Hauptwerk Der
Streit der Kritik mit Kirche und Staat erscheint.
242
Hier wird der Proze des
Durchdiskutierens des Staates einen solch beachtlichen Schritt weitergebracht, da
sich fr Marx sein eigener Ansatz als diskussionsmig berholt htte darstellen
knnen.
243
E. Bauer bringt die Frage ins Spiel: Ist es mglich, einen freien Staat zu
erlangen, wenn noch die Unterschiede des Besitzes, des Standes, des Ranges dem
Einen ein Vorrecht vor dem Anderen geben sollen? Und er antwortet: Jeder
Staat wird durch die sogenannten Oberen die sogenannten Unteren beaufsichtigen,
bevormunden, beherrschen wollen: auch eine sogenannte republikanische Regie-
198
rung wird sich, da sie nun einmal Regierung ist, nicht von Unterdrckungssucht
fernhalten knnen!
244
E. Bauer treibt nicht nur die Verfassungsfrage voran, er kritisiert die ganze bishe-
rige Haltung der Gruppe in ihren politischen Debatten. Seine Diagnose:
Die Politik, wie wir sie trieben, war noch zu abstrakt: darum war sie bald erschpft. Denn
um was handelte es sich in ihr? Um den Staat, die Regierung, das Recht, das Gesetz! Der
Politiker fragt nur: welches ist der wahre Staat? Welches die richtige Regierung? Welches
das hchste Recht? Diese Mchte selbst aber: Staat, Regierung, Recht und Gesetz stehen
ihm als ewig wahre Abstraktionen, als eine Aristokratie unantastbarer Heiligkeiten da! Die
Politik, wenn sie klar werden soll, mu ber sich selbst hinausgehen, mu sich selber kritisie-
ren.
245
E. Bauer thematisiert das Durchdiskutieren des Staates, das die Gruppe, indem
sie sich als politische Partei konstituierte, in den letzten Jahren betrieben hatte, in
einer grundstzlichen Weise. Er bezweifelt den Sinn der Debatte.
E. Bauer greift implizit den Orientierungspunkt der politischen Partei an, wenn
er zur Diskussion stellt, ob nicht der Ausdruck >freier Staat< berhaupt einen
Widerspruch enthalte, ob nicht die Redensarten von >gesetzlicher Freiheit< usw. in
sich falsch sind. E. Bauer fragt weiter, ob Selbstregierung nicht ein Widerspruch
ist. Der Staat der Radikalen fordere, da der ganze Mensch, mit all seinen Krf-
ten und Leidenschaften, mit all seinem Denken und Tun in ihm aufgehe. Aber die-
ser Staat sei um so tyrannischer, als er ein >freier Staat< zu sein behauptet. Auch
die Regierung des Volkes wrde
sich mit dem Ansehen und der Wrde des Staates bekleiden mssen. Knnt Ihr also die
Freiheit des Menschen gegen sie wahren? Auf keinen Fall! Wollt Ihr aber eine ewig wech-
selnde Regierung, so hebt Ihr das Wesen derselben auf, Ihr fordert eine Inkonsequenz, eine
Unmglichkeit, und wit dabei nicht, da Ihr ber das Charakteristische des Staates schon
hinausgeht.
246
Das Marxsche Zusammenfallen des Allgemeinen und Besonderen, des formellen
und materiellen Prinzips, das in der Demokratie gewhrleistet sein soll, ist aus
E. Bauers Perspektive immer noch viel zu etatistisch. Er schreibt: das gesellschaft-
liche Leben, wo wirklich Alles gemeinsam ist, (. ..) ist kein staatliches mehr.
247
Diese Konsequenz zeichnet sich zwar bei Marx ab, wenn er die neueren Franzo-
sen erwhnt, die die Auffassung vertreten, da in der wahren Demokratie der
politische Staat untergehe, aber wieder stark zurcknehmend ist die interpretie-
rende Auskunft, da er qua politischer Staat, als Verfassung, nicht mehr fr das
Ganze gilt
248
, d. h. harmlos als eine Gattungsuerung neben andere Gattungsu-
erungen tritt. War fr Marx die allgemeine Wahl quasi automatisch innerhalb
des abstrakten politischen Staats die Forderung seiner Auflsung, so ist fr
E, Bauer die allgemeine Wahl nur ein Scheinmittel, denn kein Staat ist ohne
Zentralisation, die allgemeine Wahl taste diese Zentralisation nicht im geringsten
an.
250
Mit dem allgemeinen Wahlrecht, das der politische Radikalismus fordere, wage
er sich zwar schon ber das Gebiet des Staates hinaus, denn heit seine Forderung
etwas anderes, als es solle bei Staatshandlungen der Unterschied des Besitzes ver-
schwinden? Aber der politische Radikalismus bersehe, da er hier schon auf
199
einer Ebene argumentiere, die jenseits der politischen Sphre liegt: bei einem
Staatsleben ist jene Forderung nie zu erfllen oder, erfllt, ohne Nutzen. Fr
E. Bauer gilt: Der Staat grndet seine Institutionen auf den Privatbesitz, daher
htte ein allgemeines Wahlrecht ohne Aufhebung des Privatbesitzes zur Folge, da
mit ihm auch die Bildungslosigkeit der Besitzlosen bleiben wrde, Der Radikale
wrde also nur eine Herrschaft der Dummheit einrichten.
251
Es ist unbestritten, da in den junghegelianischen Diskussionskontext die sozia-
listische Thematik in ihren frhesten prgnanten Formulierungen von M. He ein-
gebracht wird. Aber was die Rezeption und Verarbeitung dieser Thematik in der
Gruppe angeht, so arbeiten Marx und E. Bauer zumindest zeitlich parallel. Aner-
kannt werden mu auch, da, Monate bevor Marx die berhmte Einleitung zur
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie schreibt, in der das Hauptproblem der
modernen Zeit als Verhltnis der Welt des Reichtums und politischen Welt
herausgearbeitet wird und dem Proletariat die historische Mission der Auflsung
der bisherigen Weltordnung zugewiesen wird, sein Konkurrent E. Bauer bereits
offen Sozialrevolutionre Thesen publiziert hatte.
253
So heit es im August 1843 bei E. Bauer:
Kurz und gut: bei bestehendem Privatbesitz ist an keine Freiheit zu denken, weil der Besitz
in direktem Widerspruch gegen sie steht. Er widerspricht der Freiheit des Einzelnen: denn
ich bin nicht frei, wenn ich durch das, was ich habe, die Freiheit des Anderen beeintrchtige:
er widerspricht der Freiheit der Gesellschaft, weil diese nur auf Gemeinsamkeit gegrndet
sein darf. Ich bin noch kein echter Gesellschaftsmensch, ich fhle die Gattung noch nicht
vollstndig in mir, wenn ich noch etwas fr mich haben, und durch das, was ich fr mich
habe, eines Vorteils genieen will. Wo alles gemeinsam sein soll, wo die Gter des Geistes
sich gleich verteilen sollen, da mu auch der Besitz gemeinsam sein.
253
Eingehend kritisiert wird die nur politische Revolution: Soll die Revolution sich
erfllen, so mu die Freiheit weiter gefat werden, sie mu ihren ausschlielich
politischen Charakter ablegen. Denn: Erst mit der Revolution, welche die Zer-
strung staatlicher Formen beginnt, fngt die wahre Geschichte an, weil sie hier
bewut wird. Galt die Geschichte zuvor als Walten eines gttlichen Geistes, so
wissen wir jetzt, da die Menschen allein es sind, welche die Geschichte machen.
Zu diesem Bewutsein gehrt die Reflexion auf die sozialen Formen. Freilich, fr
euch sind die Formen nur etwas uerliches, weil ihr sie oberflchlich betrachtet.
Dagegen hlt E. Bauer:
Formen, die aus dem Egoismus hervorgegangen, werden, solange sie bestehen, wiederum
egoistische Menschen schaffen. (. ..) Der verbrecherische Hang der Menschen! Ihr mt
wissen, da Verbrechen stets eine Folge, ein Erzeugnis dieser bestimmten Zustnde sind:
die Verbrechen sind die Ergnzungen der Institutionen, sind ihr umgekehrtes Bild.
254
Diese These wird ausgefhrt an den Beispielen Privatbesitz/Diebstahl, christli-
che Sittlichkeit/Immoralitt, Ehe/Prostitution. Zwei Fragen schlieen sich an: Wie
sehen die freien gesellschaftlichen Formen aus? Wie sind sie herbeizufhren?
Die heikle Frage nach der Utopie wird von E. Bauer im Abschnitt Die freie
Gemeinschaft gestellt, eine Formulierung, die den nur politischen Begriff Volk
ablsen soll.
255
Kannst Du uns eine Lebensform sagen, welche nach dem Unter-
gange staatlicher Institutionen der Freiheit angemessener sein wird? Kannst Du
200
uns eine Gesellschaft konstruieren, in welcher der Privatbesitz aufgehoben? (. . .)
Zeige uns eine freie gesicherte Lebensform auf, und wir wollen dir gern beistim-
men !
256
Die Antwort, die Marx
257
auf diese heikle Frage finden wird: das Utopie-
verbot, sie findet sich bei E. Bauer prgnant vorformuliert: Da antworte ich ganz
einfach, da es nicht unser Amt ist, zu konstruieren. Kann doch keine neue Saat
emporschieen, solange das alte Unkraut ppig wuchert! Vorrang hat die Kritik
des Bestehenden in eine kontingente Zukunft hinein. Aber, so lautet die Gegen-
frage: Was ist das fr ein Leben, an dessen Ende ihr euch gestehen mt, ihr habt
in ihm doch nichts Rechtes vor euch gebracht? (...) Was ist das fr eine Freiheit,
die nie auf Erden einkehren soll? Ist das Utopieverbot berhaupt auszuhalten?
E. Bauer:
Ich antworte dir, da die Freiheit keine Zustnde schafft, sondern nur aufhebt, da sie den
Menschen nicht zufrieden, sondern unzufrieden macht (...) Die Freiheit wird also so lange
in der Geschichte wirken, als es eben Geschichte gibt, (. . .). Wer brigens eine sichere
Wahrheit haben will, der gehe doch zur Religion: sie predigt ewige Wahrheiten.
258
Auch diese Antwort hat ihre Gegenthese: eure Negation luft doch am Ende
auf Trumereien hinaus, die aller reellen Basis entbehren.
239
Es drfte kaum abzu-
schtzen sein, wie oft in der Geschichte von Intellektuellengruppen, deren Theo-
rien Praxis werden sollten, diese Gegenthese auf den Plan der Debatte gerufen
wurde.
Das Durchdiskutieren des Staates nhert sich seinem Ende. Die neuen Formen
der freien Gemeinschaft sind nicht dogmatisch zu antizipieren, hier gibt es kei-
nen Verfassungsentwurf mehr, in dem die politische Partei einen Platz htte.
E. Bauers Thesen gehen schon ber die Form der politischen Partei hinaus. Mit
einer politischen Opposition lassen sich Unterhandlungen anknpfen, Transaktio-
nen anstellen, zumal da man nur selten selber klar und ber das Mehr oder Minder
mit sich im Reinen ist. Die politische Partei bringt immer auch Abfall von einer
Partei zu anderen, das Problem der schwankenden Partei mit sich.
260
Und die >reelle Basis< fr die Trumereien der >freien Gemeinschaft? E. Bauer
nennt zwei Krfte, die uns im dritten Kapitel dieser Arbeit noch weiter beschftigen
werden: die theoretische Kritik und das Proletariat. Die Kritik zieht ihre Kraft dar-
aus, da wir uns nicht auf das Bestehende grnden, und den praktischen
Anknpfungspunkt, die praktischen Streiter fr das Neue haben wir an denen, wel-
che durch das Alte am meisten litten: an den Besitzlosen.
261
E. Bauers Schrift von 1843, die ihm eine vierjhrige Festungshaft einbrachte,
mndet in eine leidenschaftliche Apotheose des Proletariats:
Keine Vandalen, keine barbarischen Haufen gleich denen, welche der alten Welt ein Ende
machten, sind ntig, um den jetzigen Weltzustand zu zerstren. Unbekannte Waldungen
brauchen nicht halbnackte Eroberer auszusenden, um auf den Trmmern einer abgelebten
und desto stolzeren Bildung eine neue Lebensform zu begrnden. Wir haben unsere nack-
ten Wilden unter uns selbst, wir brauchen nicht weit zu suchen nach den Barbaren, an denen
unsere aristokratische Bildung spurlos vorbergegangen. Im Innern der Staaten wird sich
ein Schlund auftun, der bisher verachtete Flammen ausspeit; mit einer Erschtterung, vor
der unsere aristokratischen Bauwerke erzittern und in sich zusammensinken, wird er die
Scharen der Unterdrckten gegen den rechtlich und gesetzlich geschtzten Egoismus aus-
201
senden. Es sind die Besitzlosen, welche dem hochmtigen Vorrechte ein Ende zu machen
berufen sind.
262
Die historische Mission des Proletariats, das als reeller Trger der emanzipatori-
schen Disiderate der Philosophie entdeckt wird, - dieser Ansatz kann, wenn man
die Position E. Bauers von 1843 zur Kenntnis nimmt, ebensowenig als ein exklusiv
Marxscher Ansatz bezeichnet werden wie das Utopieverbot, das bekanntlich den
utopischen Frhsozialismus vom Marxismus, der sich auf die je stattfindende Klas-
senbewegung bezieht, trennt. Systematisch betrachtet vertritt E. Bauer einen antiu-
topischen Sozialrevolutionren Anarchismus, der auf das Proletariat setzt und seine
relevante Bewegung jenseits der Form der politischen Partei zu definieren sucht.
Programmatisch heit es: Wir gehren zur Partei der Menschheit, darum stehen
wir auf Seiten der Ausgeschlossenen.
263
Die Partei, die die Philosophie hier macht,
darf gerade nicht politisch sein, weil in der Sphre des Politischen Ausschlieungs-
formen zum Zuge kommen, die den philosophischen Emanzipationsansprchen
notwendigerweise Abbruch tun.
Die Unterschiede zwischen verschiedenen Verfassungstheorien und Parteipro-
grammen mag die traditionelle Wissenssoziologie oder Ideologiekritik in Korres-
pondenz zu sozialen Lagen oder als Ausdruck von Klasseninteressen deuten, fr
die Gruppe der Junghegelianer vermag dieser Ansatz nicht zu erklren, warum
diese Gruppe von der Affirmation des politischen Absolutismus zum Entwurf einer
konstitutionellen Monarchie, vom Konstitutionalismus zur parlamentarischen
Demokratie und schlielich zu einem antipolitischen Typ anarchistischer Gemein-
schaft kommt. Zwar kann man sagen, da die Entlassung der Philosophen aus dem
Staatsdienst den Proze des Durchdiskutierens des Staates in Gang setzt, aber die-
ser Proze folgt im Kern dann mehr seiner eigenen >Logik< als der mglicher
>dahinterliegender< sozialer Krfte.
Diese >Diskussionslogik< ist eine soziale Kraft, weil im Ereignisraum der Debatte
creatio continua stattfindet. Es handelt sich um einen von der Gruppe selbst defi-
nierten Raum, dessen Definition hier nach zwei Seiten begrenzt ist: alles, was noch
Phosophie ist, und alles, was noch in den Bereich des Politischen fllt, darf sich in
diesem Raum ereignen. Nicht jeder Rede ist gestattet aufzutauchen, aber zu all den
Reden, die in den Bereich der Philosophie, die Partei macht, fallen knnten, for-
dern sich die Diskutanten gegenseitig heraus. Sie bringen sich, d. h. virtuell jeder
den anderen, dazu, den Grund der Debatte, der zunchst mit wenigen Worten ins
Spiel gebracht wird, mit immer mehr Worten zu belegen, d. h. ihn dem sozialen
Tausch von Frage und Antwort auszuliefern. Dieser soziale Tausch bezieht sich
wesentlich nicht auf >Gter<, die die Diskutanten schon sicher haben, etwa in dem
Sinne, da sie sich mit Scken von Argumenten beladen in der Debatte treffen.
Zwar werden auch Argumente >mitgebracht<, aber eine Soziologie von Intellektuel-
lengruppen trfe ihren Gegenstand nur unzureichend, wenn sie nur das Rezeptive
des Tauschs ohne seine konzeptiven Effekte betrachten wrde.
Im sozialen Tausch von Argumenten ereignet sich Theorie nicht blo als Beein-
flussung, sondern auch als Konzept, als erste Versprachlichung einer Idee. Daher
ist die Debatte nicht nur ein Tausch von Hergebrachtem, sondern ebenso eine
>Brutsttte< neuer Ideen. Das schliet nicht aus, da es auch andere >Brutsttten<
202
gibt -, aber indem hier vom sozialen Tausch von Argumenten, wie er sich im
Durchdiskutieren des Staates darstellt, ausgegangen wird, kann erklrt werden, wie
es der sich als politische Partei definierenden Intellektuellengruppe mglich ist,
ber Rezeptionen hinaus verschiedene Konzepte zu erfinden, ohne da sich ihre
>Klassenlage< von Diskussion zu Diskussion nennenswert verndert htte.
6. Die junghegelianische Partei und die liberale Opposition
Geht man nur vom Proze des Durchdiskutierens des Staates aus, den die politi-
sche Partei der Junghegelianer vollzieht, so lt sich die Kohrenz ihres Radikalis-
mus, trotz der fortlaufenden selbstkritischen berwindungen, relativ gut beschrei-
ben als das Verfolgen einer monistischen Strategie, die sich deutlich vom liberalen
Dualismus abhebt. Betrachtet man dagegen die junghegelianische Partei in ihrem
praktisch-politischen Verhalten im Rahmen der liberalen Oppositionsbewegung,
so ergibt sich ein komplizierteres Bild.
Sucht man im vormrzlichen Preuen nach Kristallisationen liberaler Opposi-
tion, so wird man in der Hauptstadt Berlin nur wenig finden. Preuen kennt in die-
ser Zeit zwei wichtige Zentren des Liberalismus: Ostpreuen und das Rheinland.
Fr F. Wehl ist Berlin weder das Haupt noch das Herz des preuischen Staates,
sondern nur der Magen. Das Haupt Preuens sei Knigsberg, und sein Herz
schlage am Rhein, so die politische Anatomie des preuischen Staates, die nicht nur
fr F. Wehl selbstverstndlich ist.
264
Der ostpreuische Liberalismus
263
fut auf zwei Traditionsstrngen. Da ist einmal
der berragende Einflu Kants, dessen Ideal vom mndigen Brger das Selbstbe-
wutsein weiter Kreise der stdtischen Ober- und Mittelschichten prgt; zum
anderen leben bei einer Reihe von Grundbesitzern noch altstndisch-libertre Hal-
tungen weiter, wie sie in den Auseinandersetzungen zwischen dem Groen Kurfr-
sten und den ostpreuischen Stnden zum Ausdruck gekommen waren. In Knigs-
berg hat denn auch die preuische Verfassungsdiskussion ihren Startpunkt.
Wenige Monate nach seiner Thronbesteigung wollte Friedrich Wilhelm IV. in
Knigsberg die traditionelle Huldigung des Landtages entgegennehmen (Sept.
1840). Aus dem reprsentativen Fest machten die Knigsberger ein politisches
Ereignis, indem sie den neuen Knig selbstbewut baten, das Verfassungsverspre-
chen der Krone von 1815 einzulsen. Die unsichere Antwort des Knigs auf dem
Landtag war derart vieldeutig, da die Knigsberger und mit ihnen alles, was in
Preuen sich nach politischem Fortschritt sehnte, zunchst einmal den Knig mi-
verstanden und den Durchbruch in der Verfassungsfrage bejubelten, bis Wochen
spter mit der Kabinettsorder vom 4. Oktober der Knig den Verfassungsforde-
rungen eine rohe Absage erteilte.
266
Der Erfolg der Knigsberger bestand fr
K. R. Jachmann jedoch vor allem darin, da ihr Antrag das in lethargische Ruhe
versunkene Volk aus seinem totenhnlichen Schlafe weckte.
267
Der Petition von 1840 folgten ein Jahr spter zwei Verffentlichungen, die den
ostpreuischen Liberalismus in ganz Deutschland bekannt machten: einmal die
Denkschrift des Oberprsidenten Th. von Schn: Woher und wohin, in der der
203
Reformer von 1807 vehement fr Verwaltung und Regierung kontrollierende
Generalstnde eintritt,
268
und J. Jacobys Vier Fragen, in der die Teilnahme der
Brger am Staat im konstitutionellen Sinne gefordert wird.
269
Galt der in Ostpreu-
en tiefverehrte Beamte v. Schn der preuischen Regierung gleichsam als unan-
tastbar, so setzte sie gegen den Arzt J. Jacoby einen Hochverratsproze und ein
Majesttsbeleidigungsverfahren in Gang. Jacoby, der standhaft bei seinen ber-
zeugungen bleibt, und schlielich nach dem Durchgang durch alle Instanzen frei-
gesprochen werden mu, wird in diesem Proze der Reprsentant der konstitutio-
nellen Partei,
270
und wie die Knigsberger 1840 bereit waren, die vieldeutige
Knigsantwort sogleich zu ihren Gunsten auszulegen, ergreift die >Knigsberger
Zeitung< nach Bekanntwerden der Zensurlockerung vom Dezember 1841 die
Initiative und erffnet eine innenpolitische Berichterstattung, deren Grndlichkeit
und Wagemut in Preuen bis dahin unbekannt waren.
271
Im Unterschied zum stark intellektuell und bildungsbrgerlich geprgten ost-
preuischen Liberalismus hat der rheinische Liberalismus
212
seine Basis in den
Interessen von Kaufleuten und Unternehmern. Die konomische Spitzenstellung
des Rheinlands verdankt sich nicht unwesentlich der lngeren franzsischen Besat-
zungszeit von 1794 bis 1815, deren brgerliche Reformen die Entfaltung kapitali-
stischen Wirtschaftslebens begnstigte. Die Westorientierung der rheinlndischen
Liberalen wurde verstrkt durch die hohen steuerlichen Belastungen, die ihnen der
Anschlu an Preuen einbrachte. Erst die Einrichtung des Zollvereins schafft der
rheinlndischen Wirtschaft einen gengend groen Markt, der die franzsischen
Absatzgebiete zu kompensieren in der Lage ist. Im Zentrum der Forderungen der
rheinischen Liberalen steht denn auch immer wieder der Ausbau des Zollvereins,
der Bau von Eisenbahnen, niedrigere steuerliche Belastungen und die Beseitigung
von traditionellen Formen, die dem >Fortschritt< entgegenstehen. Rheinische Libe-
rale sind es auch gewesen, die die RhZ in Form einer Kommandit-Gesellschaft
grndeten, um ihre Forderungen publizistisch zu verbreiten. Auf die berhmte
Rolle der Junghegelianer bei der inhaltlichen Gestaltung dieser Zeitschrift komme
ich zurck.
Zunchst soll jedoch an den sddeutschen Liberalismus
273
erinnert werden, der
auerhalb Preuens zu einem wichtigen Bezugspunkt der Junghegelianer wird. In
Sddeutschland, insbesondere in Baden, hatte sich im Rahmen der Verfassung von
1818 ein bescheidenes konstitutionelles politisches Leben entwickelt, dessen
Bedeutung vor allem darin lag, da es fr die deutschen Oppositionellen gleichsam
ein Anschauungsunterricht in Sachen konstitutioneller Monarchie bedeutete. Sei-
nen theoretischen Ausdruck hat der sddeutsche Liberalismus im von Rotteck und
Welcker herausgegebenen >Staatslexikon<, das fr jeden, der sich in dieser Zeit mit
liberalen Verfassungsideen auseinandersetzt, ein notwendiges Bildungsmittel
geworden ist.
274
Baden, Ostpreuen und das Rheinland haben in dieser Zeit Verdichtungen libe-
raler Opposition aufzuweisen, die fr das praktische Verhalten der junghegeliani-
schen Partei bedeutsam sind. Im berblick wird man sagen knnen, da die jung-
hegelianische Partei zunchst eine Anlehnung an die liberale Opposition versucht,
mit ihr Bndnisse eingeht, um dann im Zuge des Durchdiskutierens des Staates in
ein konfliktreiches Spannungsverhltnis zum Liberalismus zu geraten, in dem die
204
Fragen nach prinzipieller Abgrenzung bzw.. taktischen Kompromissen dringlich
werden. Wie die Entscheidungen im einzelnen fallen, hngt aber wesentlich von
den lokalen Bedingungen ab, d. h. die rtlichen Teilgruppen der Junghegelianer
sind in unterschiedlicher Weise kompromifhig gegenber dem Liberalismus und
schtzen auch das politische Verhalten ihrer Brudergruppen unterschiedlich ein.
Die Spannungen, die sich aus den praktischen Verhaltensnotwendigkeiten erge-
ben, fhren am Ende zur Spaltung der Junghegelianer.
a) Die Serenade fr Theodor Welcher und das Verhltnis
zum sddeutschen Liberalismus
Vielleicht hat der verbreitete Topos von dem lediglich literarischen Heldentum der
Berliner Junghegelianer die Forschung dazu verleitet, einem Ereignis, wie der Sere-
nade fr Welcker, nicht weiter nachzugehen. Obwohl H. Hirsch bereits 1961 in
einem Aufsatz die Bedeutung dieser frhen Volksdemonstrationen herausgearbei-
tet hat, findet sich in der Literatur ber den Junghegelianismus kaum eine angemes-
sene Bercksichtigung dieses Ereignisses.
275
ber die Berliner Ereignisse vom 28. Sept. 1841 berichtet die Augsburger >A11-
gemeine Zeitung< am 5. Okt.:
Der Empfang, den der Abgeordnete der Badischen Stndeversammlung, Welcker, in Leip-
zig und Dresden gefunden, ist ihm nun auch hier (d. h. in Berlin, d. V.) geworden. Kaum
wurde seine Ankunft hier bekannt, als ein Verein wissenschaftlich gebildeter Mnner, vor-
zglich Literaten, zusammentrat, um dem berhmten Deputierten ihre Verehrung durch
eine Nachtmusik auszudrcken. Gegen Abend um 10 Uhr, beim schnsten Mondschein,
sammelte sich ein dichter Kreis von Menschen vor dem Hotel zum Kronprinzen, wo Welk-
ker wohnt. Es ertnte eine Ouvertre zur Stummen von Portici, von dem Musikkorps der
Gardeartillerie ausgefhrt. Sogleich wuchs der Knuel der Volksmenge immer dichter und
dichter an, bis sich die beiden Straen, welche das Eckhaus umgeben, Kopf an Kopf gefllt
hatten. Als die Musik schwieg und Welcker sich oben am Fenster zeigte, erhob ein hiesiger
geachteter Literat, Dr. Rutenberg, die Stimme krftig und rief: >dem khnen, unermdli-
chen Vorfechter fr deutsche Volksrechte, dem Abgeordneten der badischen Kammer,
Welcker, bringen wir ein donnerndes Lebehoch! < Er konnte kaum das Wort vollenden, als
schon der tausendstimmige Ruf der ganzen versammelten Volksmenge in dem Toast ein-
stimmte, und ihm unter schmetternden Fanfahren vielfach wiederholte. Als der Jubel end-
lich schwieg, nahm Welcker das Wort.
276
Welckers Rede gipfelte in dem Aufruf, Preuen mge in dem Kampf um br-
gerliche Freiheit vorangehen. Andere Quellen berichten, da die Demonstranten
die Lieder Was ist des Deutschen Vaterland? und Freiheit, die ich meine
anstimmten, und whrend Welcker zusammen mit den Organisatoren in einer Ber-
liner Weinhandlung speiste und diskutierte, demonstrierte die Menge zwei volle
Stunden weiter. Am folgenden Abend wiederholten sich die Kundgebungen, dann
schritt die Regierung ein: sie verfgte Welckers Ausweisung und begann, die Orga-
nisatoren zur Rechenschaft zu ziehen. - Nach vormrzlichen Mastben handelt es
sich um eine herausragende Massendemonstration. Da dies alles geschehen
konnte, ist ein Wunder,
277
schreibt K. A. Varnhagen von Ense in sein Tagebuch.
Welcker besucht nicht nur Berlin, er bereist mehrere Stdte in Norddeutsch-
land. Seine Route fhrt von Freiburg nach Leipzig, Dresden, Berlin, Hamburg-
205
Altona, einige kleinere Orte im Herzogtum Braunschweig und Bonn. Es handelt
sich um eine politische Reise, die durch die mehrmonatige Vertagung der fr einen
Protest bestraften badischen Kammer mglich wurde und mit der die politische
Prominenz des sddeutschen Liberalismus berregional sich ihrer Anhnger ver-
gewissern will. Diese Form wird ein Jahr spter G. Herwegh nachahmen.
278
Die
Berliner Welcker-Serenade bildet zweifellos den Hhepunkt der Reise. Zwar
kommt es auch in anderen Orten zu Kundgebungen, aber etwa gegenber der
Leipziger Serenade, bei der Metternichsche Geheimagenten hchstens 25 bis 28
Stundenten und 6 andere Leute mit hchstens 10 Fackeln zhlten,
279
handelte
es sich in Berlin um eine uerst erfolgreich durchgefhrte Massenkundgebung.
Bei dem Verein wissenschaftlich gebildeter Mnner, der als Initiator der
Demonstration auftritt, handelt es sich zweifellos um die Berliner Gruppe der Jung-
hegelianer. berliefert sind die Namen B. Bauer, der Buchndler Cornelius,
L. Eichler, E. Flottwell, F. Koeppen, E. Meyen, Th. Mgge, A. Rutenberg, K. Rie-
del, R. Wenzel, F. W. Zabel.
280
Der ganzen Anlage nach handelt es sich nicht um
eine spontane, sondern um eine sorgfltig organisierte Kundgebung. Vielleicht war
es Rutenberg - er ist im Rotteck-Welckerschen Staatslexikon mit dem Artikel ber
>Radikalismus< vertreten
281
-, der den Kontakt zu Welcker knpfte. Die Genehmi-
gung fr ein Stndchen hatten die Organisatoren bei der Polizei eingeholt, nur hat-
ten sie - wie sich spter herausstellte - dem Polizeikommissar nichts von dem badi-
schen Abgeordneten Welcker gesagt. Fr ein genehmigtes Stndchen konnte denn
auch eine Kapelle des Garde-Fu-Artillerie-Regiments gewonnen werden. Unter
den Bedingungen der Pressezensur sollte die Musik dazu dienen, rasch einen
Volksauflauf zu provozieren. Das Musikstck >Die Stumme von Portick war gezielt
ausgesucht: in dieser Oper symbolisiert ein einfaches stummes Mdchen das unter-
drckte Volk, und es ist bekannt, da es bei Auffhrungen dieses Revolutions-
stcks wiederholt zu Bekundungen des Freiheitswillens gekommen ist.
Wichtig ist die Welcker-Serenade nicht nur als Zeugnis fr den Organisations-
grad der Berliner Gruppe der Junghegelianer. Sie gibt uns darber hinaus einige
wichtige Anhaltspunkte fr ihr praktisches Verhalten gegenber dem Liberalis-
mus. Festzuhalten ist zunchst, da die Junghegelianer gemeinsam mit den Libera-
len auftreten, und weiter, da sie mit originellen Aktionsformen Steigerungseffekte
der Opposition zu erzielen versuchen. Aber schon bei der Welcker-Serenade
scheuen sie nicht davon zurck, ihre Differenz zum Liberalismus ffentlich kund-
zutun. B. Bauer, Mitveranstalter der Kundgebung, berrascht Welcker bei dem
anschlieenden Treffen im Walburgischen Weinhaus mit einem Toast auf Hegel,
namentlich auf seine Auffassung des Staats, ber die in Sddeutschland noch
manche irrige Vorstellungen verbreitet seien. Hegel berrage weit die dortigen
Ansichten vom Staatswesen durch Khnheit, Liberalitt und Entschiedenheit.
Das war eine gezielte Provokation Welckers, wie Bauer spter Ruge mitteilt.
282
Sie
zeigt auch schon die Richtung an, in der die Frontstellung der Junghegelianer zum
Sddeutschen Liberalismus sich entfaltet.
Im April 1842 verffentlicht Friedrich Engels in der RhZ seinen Beitrag >Nord-
und sddeutscher Liberalismus^
283
Seine Hauptthese lautet: Die politische Bewe-
gung des Liberalismus habe sich von Sden nach Norden verschoben. Noch vor
kurzem htten die sddeutschen konstitutionellen Monarchien als die einzigen
206
Altre gelten knnen, auf denen das Feuer des allein wrdigen, unabhngigen
Patriotismus aufflammen knnte. Jetzt sei die Bewegung des Sdens einge-
schlummert, ein Mund verstummt nach dem anderen und die jngere Generation
hat nicht Lust, auf dem Pfade ihrer Vorgnger zu gehen. Dagegen habe der Nor-
den
seit mehreren Jahren einen Fonds von gediegener, politischer Gesinnung, von charakterfe-
ster, lebendiger Energie, von Talent und publizistischer Ttigkeit aufzuweisen, wie ihn der
Sden in seiner schnsten Bltezeit nicht zusammenbrachte. Dazu kommt, da der nord-
deutsche Liberalismus unbestreitbar einen hheren Grad von Durchbildung und Allseitig-
keit, eine festere historische wie nationale Basis besitzt, als der Freisinn des Sdens jemals
sich erringen konnte. Der Standpunkt des ersteren ist weit ber den des letzteren hinaus.
Wo liegen fr Engels die Ursachen dieser Entwicklung? Kennzeichen des sd-
deutschen Liberalismus sei es gewesen, aus der unmittelbaren Praxis heraus Politik
zu machen, ohne tiefere theoretische Orientierung.
Die Praxis aber, aus der er sich die Theorie konstruierte, war bekanntlich eine sehr weit-
schichtige, franzsische, deutsche, englische, spanische usw. Daher kam es, da auch die
Theorie, der eigentliche Inhalt dieser Richtung, sehr ins Allgemeine, Vage, Blaue hinauslief,
da sie weder deutsch, noch franzsisch, weder national, noch entschieden kosmopolitisch,
sondern eben eine Abstraktion und Halbheit war.
Die berlegene norddeutsche Richtung besitzt demgegenber fr Engels ganz
andere Qualitten: Sie knpfte von vornherein ihr Dasein nicht an ein einzelnes
Faktum, sondern an die ganze Weltgeschichte und namentlich an die deutsche; die
Quelle, aus der sie flo, war nicht in Paris, sie war im Herzen Deutschlands ent-
sprungen; es war die neuere deutsche Philosophie.
hnlich wie Engels argumentiert auch ein Beitrger in den EB von 1843; er
nimmt seine Rezension eines Buches des ehemaligen wrttembergischen Abgeord-
neten Pfizer zum Anla, den Fragen nachzugehen: Ist der Liberalismus von 1840
wirklich ein anderer, als der von 1830? Sind wir in unseren Freiheitsansprchen
bescheidener oder kecker geworden? Hat sich vielleicht nur die Form verndert?
Oder ist unser ganzes Bewutsein ein anderes geworden? Der Forderungskatalog
der alten Liberalen habe auch jetzt noch Gltigkeit:
Was man damals wollte, war entweder ein konsequent durchgefhrtes Reprsentativsy-
stem in den einzelnen deutschen Bundesstaaten oder, wo man exzentrischer dachte, eine all-
gemeine deutsche oder wenigstens sddeutsche Republik. Verwandlung des Frstenbundes
in einen Vlkerbund, Teilnahme aller Brger an den ffentlichen Angelegenheiten, allge-
meine Volksbewaffnung, ffentlichkeit und Mndlichkeit des Gerichtsverfahrens, freie
Presse usw. sind Dinge, die, wenn im 19. Jahrhundert berhaupt von Freiheit die Rede ist,
sich von selbst verstehen, die also auch der jngsten Epoche mit der frhern gemeinsam sein
mssen.
Es geht dem Autor nicht um eine Differenz zu den liberalen Selbstverstndlich-
keiten^ vielmehr lge der Unterschied im Verhltnis von Form und Inhalt.
Der alte Liberalismus wollte nur eine andere Form, ohne sich um den Inhalt,
der diese Form fllen sollte, nher zu bekmmern. Diesen hatte man grtenteils
von auen her, teils von England, hauptschlich aber von Frankreich entlehnt, des-
sen Erschtterungen in Deutschland nachzitterten. Der neue Liberalismus, den
207
der junghegelianische Autor im Auge hat, wolle zwar auch andere Formen - den
alten Forderungskatalog -, aber das inhaltliche Prinzip sei doch von den Nachah-
mungen des alten Liberalismus verschieden, weil es als Resultat eigenen philoso-
phischen Denkens betrachtet werden msse.
Man ergrndete im Stillen das Prinzip der Freiheit tiefer, man fand, da man die Fragen,
die gelst werden sollten, zu uerlich, zu oberflchlich gefat hatte. Man ging wieder an sei-
nen Hegel, der sich ja auch der Bewegungspartei abgewandt hatte und seine Grnde gehabt
haben mute, warum -. Und in ihm, den die Liberalen den preuischen Hofphilosophen
gescholten hatten, in ihm fand man den wahren, den wissenschaftlichen Liberalismus, die
Freiheit des Geistes.
Im Proze des Durchdiskutierens des Staates grenzen sich die Junghegelianer
immer deutlicher vom sddeutschen Liberalismus ab. Schon im Februar 1842 hatte
E. Bauer eine umfangreiche Schrift ber das Rotteck-Welckersche Staatslexikon
geplant und seinem Bruder geschrieben: Gegen diese Konstitutionellen mte
mal ein furchtbares und krftiges Bombardement erffnet werden.
285
Die
geplante Arbeit kommt nicht zustande. Als ein Jahr spter E. Bauer eine Kritik des
sddeutschen Liberalismus vorlegt, hat sich der politische Bezugsrahmen schon
verschoben. Die Badische Opposition erscheint 1843 als zweites Heft der Serie
Die liberalen Bestrebungen Deutschlands, deren erstes Heft der ostpreuischen
Opposition gewidmet ist.
286
Im Zentrum der Kritik des sddeutschen Liberalismus
steht auch nicht mehr das Staatslexikon, sondern E. Bauer legt hier eine Kritik der
Verhandlungen der badischen Abgeordnetenkammer vor, in der er lngs einer
Analyse der praktischen Parlamentsarbeit zeigen will, da die konstitutionelle
Verfassung weit entfernt ist, die vernnftigste zu sein, da eine Opposition, deren
Gesichtskreis nicht ber den Konstitutionalismus hinaus ist, zu nichts kommen
kann, und da Deutschland auf dem Wege einer konstitutionellen Opposition
nicht das wird, was es werden soll.
287
Zusammenfassend kann gesagt werden: Wie Ruge die verfassungspolitische Dis-
kussion 1839 unter der Maske eines >Wrttembergers< in den HJ beginnt, nutzen
die Berliner Junghegelianer den Besuch des badischen Abgeordneten Welcker
1841 zur Organisation einer Massendemonstration, um aber zugleich auf die spezi-
fische Differenz von nord- und sddeutschem Liberalismus hinzuweisen. Geht es
dabei zunchst nur um die Herausstellung der entschiedenen >Wissenschaftlich-
keit< und theoretischen Reife des neuen Liberalismus, so wird der sddeutsche
Liberalismus zunehmend in der junghegelianischen Argumentation zur Projek-
tionsflche fr die Kritik des Konstitutionalismus schlechthin. Wichtig ist, da
die
Ablehnung des sddeutschen Liberalismus unter den Junghegelianern relativ ein-
hellig vollzogen wird. Die staatlichen Grenzen spielen hier eine groe Rolle. Als
mgliche Bndnispartner der junghegelianischen Partei sind die sddeutschen
Liberalen kaum je ernsthaft im Blick gewesen. Abgesehen von der Welcker-Sere-
nade sind sie fr die Junghegelianer ein ferner Orientierungspunkt, dessen Glanz
zunehmend verblat. Hier besteht kein Grund zu tieferen Differenzen in der
Gruppe. Anders ist die Situation beim preuischen Liberalismus in Ostpreuen
und im Rheinland.
208
b) Berlin und Knigsberg
Fr das Verhltnis der Junghegelianer zum ostpreuischen Liberalismus sind zwei
Momente entscheidend: Einmal die latente Konkurrenz um die Position eines gei-
stigen und politischen Zentrums und zum anderen die engen wechselseitigen Ver-
flechtungen und Bindungen der Berliner Gruppe mit dem ostpreuischen Zirkel.
Der Aspekt der Konkurrenz wird deutlich in einem Beitrag des Berliner
E. Meyen von 1841. Knigsberg wird charakterisiert als eine Stadt ersten Ranges.
Seine Stellung ist eine isolierte, aber diese Isoliertheit ist eine solche, welche die Energie in
sich trgt; die Gegenstze des Nationallebens so entschieden und stark in sich zu erzeugen,
wie es die individuelle Kraft des Menschen bedingt. In Knigsberg zeigen sich die Extreme
der deutschen Nationalitt straffer als irgendwo. ( . . . ) Berlin erscheint dagegen weit univer-
saler, mannigfaltiger, reicher, aber weniger entschieden und charakteristisch. Das Allge-
meine drngt die Energie des Individuellen zurck. Zwar kenne auch Berlin Gegenstze,
aber, wer nicht die Kraft und den Mut hat, eben dieser Allgemeinheit anzugehren und
sein subjektives Interesse, namentlich jede Eitelkeit des Individuellen zum Opfer zu brin-
gen, dem kann es nicht wohl in Berlin sein. Das Prinzip des Staates ist hier bereits wie in
Frankreichs und Englands Hauptstadt das Herrschende, allein Entscheidende geworden.
Berlin trgt wesentlich den Charakter der Zentralisation.
Nachdem Meyen so das >Allgemeine< in Berlin mit dem >Individuellen< in
Knigsberg in Konkurrenz gesetzt hat, sieht er die Aufgabe der Knigsberger
darin, ergnzend aufzutreten, und Berlin selbst die Spitze zu bieten, wenn es sich
in zu abstrakter Allgemeinheit verliert.
288
Solche Versuche einer Balancierung des intellektuellen und politischen Prestiges
der beiden Universittsstdte sind fr den Berliner Junghegelianer Meyen ntig,
weil seine Knigsberger Kampfgefhrten, wie z. B. der Redakteur der >Knigsber-
ger Zeitung< K. R. Jachmann, den Vorsprung seiner Landsleute an politischem
Bewutsein selbstbewut zur Geltung bringen. Rckblickend schreibt Jachmann:
Im Jahre 1840 habe man im brigen Preuen - und hier spielt er auf das hegeliani-
sche Zentrum in Berlin an - nicht viel mehr von Verfassungen gewut, als da sie
hufig die Minister wechseln. Forderungen nach einer Legislative, freier Presse,
ffentlichkeit der Verhandlungen und Verantwortlichkeit der Minister und die
Forderung, da es endlich eine Macht im Staate geben msse, der jeder, auch der
Hchstgestellte, unbedingten Gehorsam schuldig sei, und diese Macht das Gesetz
sei, der Ausdruck der Idee des Rechts und der Freiheit - diese Ansichten wurden
nur in Ostpreuen laut geuert.
289
Deutlich sprbar in Jachmanns Charakterisierung des ostpreuischen Liberalis-
mus ist der Einflu Kants. Im Kern bedeutet Liberalismus fr ihn die Vernunfter-
kenntnis angewandt auf unsere bestehenden Verhltnisse. Dies bedeutet zugleich,
in gnzlicher Abstraktion von allem Historischen nach dem alleinigen Mastabe
des Vernnftigen das Gewordene, das Daseiende zu beurteilen.
290
Solche Formu-
lierungen haben Berliner Junghegelianer, wie E. Bauer, herausgefordert, den
Hegeischen Vernunftbegriff gegen Einflsse aus der Tradition Kants zu verteidi-
gen.
Alles in der Welt ist nur dadurch, da es wird, und es hat die einzige Garantie seines Beste-
hens in seiner Entwicklung. Es gibt nichts absolutes, was von Anfang an war, was immer das-
209
selbe bleiben knnte und ewig wre. So ist auch die Vernunft nichts Feststehendes, nichts
Ausgemachtes; auch sie, da sie in einer ewigen Entwicklung begriffen ist, ist fortwhrend
eine andere. Darum kann man wohl sagen: die Vernunft ist und herrscht immer, und mit
demselben Rechte: die Vernunft ist und herrscht nie. (. . .) Als etwas Absolutes, als eine
Kategorie, die einen bestimmten, fr ewige Zeiten unantastbaren Inhalt haben will, ist sie
eine bloe Schwrmerei.
291
Die Konkurrenz um die intellektuelle Fhrung der Opposition darf nicht dar-
ber hinwegtuschen, da zwischen den Berliner und den Knigsberger Intellektu-
ellen enge, z. T. persnliche Beziehungen bestehen. So ist z. B. E. Flottwell mit
Jacoby in Knigsberg befreundet und mit Berlinern wie Engels, Meyen und
L. Eichler gut bekannt. Die Briefe, die Flottwell und auch J. Waldeck mit Jacoby
wechseln, zeugen von der engen Verzahnung beider Gruppen.
292
Hinzuzunehmen
ist, da die >Knigsberger Zeitung< den Berlinern die Chance gibt, sich zu Wort zu
melden. Allerdings gelingt es den Berliner Junghegelianern nicht, wie kurze Zeit
spter bei der RhZ, die Hegemonie in der Redaktion zu erreichen, dazu waren die
Knigsberger Liberalen im Unterschied zu den rheinischen Kaufleuten und Indu-
striellen viel zu sehr intellektuell interessiert.
Zu den Berliner Junghegelianern, die regelmig ber Knigsberger Vorgnge
berichten, gehrt M. Stirner, der als Student einige Zeit in Kulm und Knigsberg
verbracht hatte.
293
Seine Korrespondenzen enthalten berwiegend Zustimmung
gegenber Freimut und Hochherzigkeit der Knigsberger. Die >Knigsberger
Skizzen< von Karl Rosenkranz werden gleich zweimal den Lesern der RhZ annon-
ciert. Die Kritik an dem ostpreuischen Hegelianer ist vorsichtig formuliert. Stirner
weist lediglich Rosenkranz' positive Bewertung des Eklektizismus zurck:
Solange das Wesen unserer Zeit eklektisch war, galt Rosenkranz unbestritten als einer ihrer
Vordermnner; seitdem aber nur ihr trgerischer Schein eklektisch geblieben ist, mte er
khner ausschreiten, als er es tut, um nicht zu einem Nachzgler zu werden.
294
Ungeteilte Zustimmung dagegen finden bei Stirner die ffentlichen Vorlesungen
des Liberalen L. Walesrode. Sie sind fr Stirner vor allem deshalb von Bedeutung,
weil mehr als 400 Personen in der zweiten Residenz des Landes an dem Ausdrucke
der darin niedergelegten Gesinnung gleichsam mitgearbeitet haben. Stirners
Annonce gilt dem Zweck, dem brigen Deutschland zu zeigen, wo es seine Sym-
pathien zu suchen hat.
295
Von Stirner wie auch von dem Berliner K. Nauwerck wird die Denkschrift des
ostpreuischen Oberprsidenten Th. v. Schn Woher und Wohin als Schritt in
die richtige Richtung gewrdigt. Whrend Nauwerck jedoch v. Schns Diktum
ein jeder nicht konstitutionelle Staat ist ein interimistischer hervorhebt,
296
kann
Stirner seine Ironie nicht zurckhalten, wenn er von Schns Denkschrift sagt: und
da die Weltgeschichte schrittweise wandelt, so ist sie einstweilen auch gen-
gend.
297
Im Oktober 1841 planen die Berliner Junghegelianer, den Erfolg der
Serenade fr Welcker zu wiederholen, indem sie v. Schn ebenfalls ein Stnd-
chen bringen wollen. Allerdings erhalten sie keine polizeiliche Erlaubnis, da
v. Schn selbst die >Ehrenbezeugung< eindeutig ablehnt.
298
Entschiedener verteidigen Nauwerck und Stirner J. Jacoby. Nauwerck wider-
spricht den Kritikern des ostpreuischen Liberalismus, da es sich hier um ein iso-
210
liertes Phnomen handele. Vier Wochen freier Presse - und die, welche es
angeht, wrden erstaunen, wie allgemein verbreitet gewisse berzeugungen nicht
blo in Ostpreuen, sondern im ganzen Reiche sind.
299
Stirner schreibt fr die
>Leipziger Allgemeine Zeitung< zwei umfangreiche Korrespondenzen, in denen er
ausfhrlich ber den Proze gegen Jacoby berichtet. Jacoby wird uneingeschrnkt
als Vorbild hingestellt:
Was den seit anderthalb Jahren schwebenden Proze des Doktor Jacoby betrifft, so lernen
wir an ihm, wie der einzelne Mensch ein allgemeiner ist. Wer kennt den Doktor im fernen
Osten, diese Ziffer unter Millionen? Und doch bekmmert ihr euch um dieses unscheinbare
Wesen, fragt nach seinem Schicksale, nach seinem Tun und Denken. Es ist nicht der Doktor,
der so und so viele Menschen gesund gemacht und andere an das Grab geleitet hat; es ist der
>Mensch<, der eine Idee in sich >persnlich< werden lie und nun die zeitlichen Leiden der
Idee an seinem Leibe zu tragen hat: es ist der >Mensch<, der ihr auch seid oder werden
wollt.
300
Da hier schon begrifflich Anklnge an Stirners Hauptwerk zu hren sind, sei am
Rande vermerkt.
berblickt man die Stellungnahmen der Junghegelianer zum ostpreuischen
Liberalismus, so ist bis zum Sommer 1842 eine einhellige Sympathie und Zustim-
mung festzustellen. Auch mit spektakulren Aktionen halten sich die Junghegelia-
ner nicht zurck. So organisieren sie z. B. einen Spendenaufruf, dem verfolgten
J. Jacoby eine Brgerkrone zu stiften.
301
Die Krise, die sich zwischen Teilen der
Junghegelianer und dem ostpreuischen Liberalismus im Herbst 1842 abzeichnet,
kann deutlicher werden, wenn wir uns zunchst dem andern liberalen Zentrum
Preuens, dem Rheinland, zuwenden.
c) Die Junghegelianer und die >Rheinische Zeitung<
Ist die Knigsberger Situation davon bestimmt, da die Junghegelianer mit einem
politisch interessierten liberalen Brgertum, das sich selbst zu Wort meldet, koope-
rieren und konkurrieren mssen, so gewinnen die Junghegelianer im Rheinland
rasch eine intellektuelle Hegemonie. Denn die liberalen Geldgeber der RhZ, die
dieses Blatt zunchst mit Untersttzung der Regierung in Berlin - diese erhoffte
sich ein Gegengewicht gegen die Monopolstellung der katholischen >Klner Zei-
tung< - grndeten, sind an der journalistischen Tendenz des neuen Blattes nur inso-
weit interessiert, als ihre konomischen Interessen nicht tangiert werden. Da die
neue Zeitung mit den Redakteuren Jung und Oppenheim, die beide den Kreisen
der Geldgeber entstammten, rasch auf dem Lesermarkt Abonnenten gewinnt, las-
sen sie die Redaktion gewhren, obwohl es sich bei Jung und Oppenheim um radi-
kale Junghegelianer handelt. Die liberalen Geldgeber lassen auch zu, da der Jung-
hegelianer Rutenberg, der als Mitorganisator der Welcker-Serenade unter beson-
derer Polizei-Aufsicht steht, Chefredakteur wird.
302
Diese differente Situation zwischen Ostpreuen und Rheinpreuen wird in der
RhZ kaum verhllt dargestellt. So schreibt der Korrespondent >vom Rhein<:
Immer (. . . ) wird sich unser Liberalismus in den Kreisen des praktischen Lebens bewegen
und erhalten; wir sind liberal, so weit es unser gesunder Sinn und so weit es die Beziehungen
und Verhltnisse unseres Lebens, unserer kommerziellen, industriellen und gewerblichen
Ttigkeit mit sich bringen.
211
Dies sei eine Gabe der Natur und eine Gabe der Geschichte, wobei auf den
landsmnnischen Charakter und auf die Napoleonische Herrschaft verwiesen wird.
Daher lasse der Rheinische Liberalismus im Unterschied zum ostpreuischen
sich's auch nicht gern sauer werden und scheut jene tiefere und grndlichere Selbstbefrei-
ung durch die Wissenschaft, wo der Mensch verzichtend auf die goldenen Frchte materiel-
ler Ttigkeit tief in die Schchte seines Geistes hinabsteigt, um sich Selbsterkenntnis zu
erobern, in welcher jeder Liberalismus erst seinen wahren Halt und seine Luterung
gewinnt.
303
Unter diesen Bedingungen konnte sich die RhZ zu einer berwiegend junghege-
lianischen Plattform entwickeln. Whrend man in Knigsberg eher von einem
wenn auch komplizierten Bndnis von Junghegelianern und Liberalismus sprechen
kann, so trifft der Begriff Bndnis fr die rheinische Situation nur ungenau. Hier
mu mehr betont werden, da die rheinischen Liberalen den Junghegelianern
einen weitgehenden Freiraum berlassen, einen Freiraum, der die Gefahr in sich
birgt, da ber die zugrundeliegenden Machtverhltnisse und Interessenkonstella-
tionen Illusionen entstehen.
Die Initiativen des Knigsberger Landtages sind in den Augen der Junghegelia-
ner wrdige Anknpfungspunkte fr ein Bndnis, die Debatten des Rheinischen
Landtags ber die Pressefreiheit, die der Redakteur der RhZ Karl Marx einer bei-
enden Kritik unterzieht, dagegen nicht. Ausgehend von der These: Die liberale
Opposition zeigt uns den Hhestand einer politischen Versammlung, kommt
Marx zu dem Ergebnis: da die landstndischen Verteidiger der Pressefreiheit
sich keineswegs auf der Hhe ihres Gegenstandes bewegen.
304
Ein Vertreter des Brgertums hatte in den Debatten die Pressefreiheit im Namen
der Gewerbefreiheit verlangt. Marx' Kritik ist aufschlureich fr das Verhltnis der
Junghegelianer zum rheinischen Liberalismus. Marx geht zunchst auf den Ver-
gleich ein:
So originell die Betrachtungsweise des Redners auf den ersten Anblick erscheinen mag, so
mssen wir ihr doch einen unbedingten Vorzug vor den haltungslosen, nebelnden und
schwebelnden Rsonnements jener deutschen Liberalen zuschreiben, welche die Freiheit zu
ehren meinen, wenn sie dieselbe in den Sternenhimmel der Einbildung, statt auf den soliden
Boden der Wirklichkeit versetzen.
Im Verlauf der Argumentation wandelt sich jedoch die Zustimmung in eine Kri-
tik der Ableitung der Pressefreiheit aus der Gewerbefreiheit. Letztere sei als eine
Sphre fr sich zu begreifen: Jede bestimmte Sphre der Freiheit ist die Freiheit
einer bestimmten Sphre, und: Deine Freiheit ist nicht meine Freiheit, ruft die
Presse dem Gewerbe zu.
305
Sicher kann man Marx' Argumente als rein theoreti-
sche Ausfhrungen lesen, lohnend ist aber auch, sie in den Zusammenhang des
Verhltnisses von rheinischem Liberalismus und junghegelianischer Partei zu rk-
ken.
So gelesen, erweist Marx zunchst den liberalen Rheinlndern seine Anerken-
nung fr deren Wirklichkeitssinn, indem Marx die bildungsbrgerliche, materielle
Voraussetzungen gering schtzende Haltung >Ideen< gegenber zurckweist. Diese
Anerkennung weicht jedoch sogleich dem Versuch einer strikten Abgrenzung der
Einflubereiche gegeneinander. Wie du den Gesetzen deiner Sphre, so will ich
212
den Gesetzen meiner Sphre gehorchen. Dies markiert exakt die Haltung der
junghegelianischen Redaktion zu den Kreisen ihrer Geldgeber. Es geht um den
Aufbau von Argumenten, die den Freiraum der Redaktion als Kristallisationspunkt
fr parteiliche Eigenstndigkeit begrnden: Um die Freiheit einer Sphre zu ver-
teidigen und selbst zu begreifen, mu ich sie in ihrem wesentlichen Charakter, nicht
in uerlichen Beziehungen fassen. Das ist deutlich gegen den Einflu der Geld-
geber gerichtet. Und trotz der anfnglichen Abwehr einer von materiellen Voraus-
setzungen abgehobenen Behandlung der Pressefrage mndet die Argumentation in
Topoi, die auf die >Prinzipienpartei< zugeschnitten sind.
Ist aber die Presse ihrem Charakter treu, handelt sie dem Adel ihrer Natur gem, ist die
Presse frei, die sich zum Gewerbe herabwrdigt? Der Schriftsteller betrachte seine Arbei-
ten nicht als Mittel. Sie sind Selbstzwecke, sie sind so wenig Mittel fr ihn selbst und fr
andere, da er ihrer Existenz seine Existenz aufopfert, wenn's not tut, (...). Dagegen sollte
mir ein Schneider kommen, bei dem ich einen Pariser Frack bestellt, und er brchte mir eine
rmische Toga, weil sie angemessener sei dem ewigen Gesetz des Schnen! Die erste Freiheit
der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein.'
01
'
Man kann die Situation im Rheinland paradox nennen. Obwohl die rheinischen
Liberalen die Junghegelianer weit mehr begnstigen als die ostpreuischen Libera-
len, finden sie bei den Junghegelianern weit weniger Anerkennung.
Werfen wir nun einen Blick auf die Predebatten im ganzen zurck, knnen wir nicht Herr
werden ber den den und unbehaglichen Eindruck, den eine Versammlung von Vertretern
der Rheinprovinz hervorbringt, die nur zwischen der absichtlichen Verstocktheit des Privile-
giums und der natrlichen Ohnmacht eines halben Liberalismus hin- und herschwanken,
fat Marx sein Urteil zusammen.
307
Die Unterschiede der lokalen Situationen in Kln, Knigsberg und Berlin fhren
fr die junghegelianische Partei zu unterschiedlich pragmatisch-taktischen Hand-
lungserfordernissen. So kohrent sich ihr politischer Radikalismus im Durchdisku-
tieren des Staates erweist, in ihrer politischen Praxis werden Unterschiede deutlich,
die zur Spaltung der Partei fhren.
7. Die Spaltung der Partei
Die Spaltung der Junghegelianer, die seit 1842 die Gruppenbeziehungen vern-
dert, hat nicht mehr viel gemein mit den philosophischen Fraktionen des Schulzu-
sammenhangs. Vielmehr spielt sich die Spaltung hier auf einer anderen Ebene ab.
Gingen die philosophischen Fraktionen des Schulzusammenhangs vom akademi-
schen Raum aus und operierten nach Magabe einer Dialektik der Extreme, so
beziehen sich die neuen Spaltungen auf differierende pragmatisch-politische
Erfahrungshorizonte. Sicher hat die staatliche Repressionspolitik, die im Verbot
der Zeitungen gipfelte, die den Junghegelianern als Plattform dienten, die Spaltung
der Gruppe beschleunigt. Tiefergehend war jedoch die Frage, inwieweit sich die
Partei der Junghegelianer im praktischen Bndnis mit der liberalen Opposition
kompromibereit zeigen konnte und ein taktisch-politisches Verhalten hinzuzuge-
winnen vermochte.
213
Rckblickend schreibt Bruno Bauer ber das Bndnisproblem:
Das Volk war in seiner Indolenz undankbar: es verga, da gerade die groen Tagesbltter
des Jahres 1842 durch ihr Rsonnement und durch die Unruhe ihrer Forderungen (. . .)
seine Auflsung und Ablsung von den alten Lebensformen befrdert und gleichsam zu
einer Art von unklarem Bewutsein gebracht haben, was es selbst nur noch zum Faktum zu
machen hatte. Aber der in Gang gekommene Aufklrungsproze entwickelte seine eigene
Dynamik. Das Volk wollte in seiner eigenen Weise etwas sein; also mute es auch die vor-
nehmen Wendungen der gelehrten Herren, ihre weitausgesponnenen Belehrungen, ihre
rckhaltigen Prinzipien, die vielleicht zu weit fhrten, (. . .) zurckweisen (. . .). Fort also
mit den Radikalen, den Weltverbesserern: wir werden schon durch unsere eigene Macht
durchkommen, dachte der Brger: wir sind, was sie nur besprachen; wir besitzen den festen
Kern, auf den sie nur hinzeigten; wir werden die Teilnahme am Staat besitzen, die sie nur
forderten: wir werden herrschen, whrend sie nur bitten konnten.
308
Die junghegelianische Partei steht vor der Frage, wie sie mit ihrem politischen
Erfolg umgehen soll. Soll sie sich dem nicht zuletzt durch ihre Initiativen gewachse-
nen Selbstbewutsein der liberalen Opposition anpassen, sich angesichts des selb-
stndigeren Auftretens der Liberalen zurckhalten, oder soll sie das, was sich im
Proze des Durchdiskutierens des Staates als Vorsprung abzeichnet, auch gegen
die mglichen Bndnispartner offensiv vertreten?
Hinzu kommt die oben dargestellte regionale Situation. Von den drei junghege-
lianischen Kristallisationspunkten: Berlin, Knigsberg und dem Rheinland, stellt
sich die Anpassungsfrage am wenigsten in Berlin, weil es hier keine nennenswerte
liberale Opposition gibt. So ist es wohl kein Zufall, da in Berlin sowohl der erste
Versuch einer eigenstndigen, sich auch formell abgrenzenden junghegelianischen
Opposition abzuzeichnen scheint, als auch, da in der Berliner Gruppe eine Frak-
tion auftritt, die eine kompromilose Taktik einschlgt.
a) Vorspiel zur Spaltung: die Freien
Unabhngig davon, ob die Nachricht von der Grndung eines Vereins der
Freien in Berlin im Sommer 1842 einen realen Hintergrund hatte, ob es sich um
einen >Versuchsballon<, um eine Denunziation oder um eine Zeitungsente gehan-
delt hat,
309
die Bedeutungen, die der Nachricht zugemessen werden, konzentrieren
sich um das Problem einer autonomen junghegelianischen Organisation, ein Pro-
blem, das die Bndnisfrage vorrangig tangiert. Die Nachricht vom Versuch einer
selbstndigen, radikalen Organisation der Freien in Berlin stt in Knigsberg
und im Rheinland auf eine Situation, in der die Frage der Kooperation von Junghe-
gelianern und Liberalen eine andere Dringlichkeit besitzt als in Berlin selbst.
ber die Knigsberger Reaktionen auf die annoncierte Grndung der Freien
knnen Stirners Korrespondenzen einige Aufklrung geben. Mag sein, da die
geplante Vereinsgrndung in Ostpreuen teilweise auf Sympathie gestoen ist.
Dafr sprche nicht nur, da die >Knigsberger Zeitung< als erste die Nachricht
verbreitet hat, Stirner berichtet auch, da auf diese Nachricht hin eine Reihe von
ostpreuischen Grundbesitzern nach den genaueren Umstnden sich eifrigst
erkundigte und ihre Bereitwilligkeit erklrte, dem Vereine beizutreten.
310
Es han-
214
delt sich um Grundbesitzer, von denen Rosenkranz rhmend zu berichten wute,
da sie einen ganzen Winter konsequent Seite fr Seite von Strau durchgelesen,
durchgesprochen haben, ja nachher fr ihre abweichenden Ansichten miteinander
in Briefwechsel getreten sind.
311
Offensichtlich reichte diese Sympathie fr Stirner
nicht aus, um das Vereinsprojekt mit in die Kooperation zwischen Junghegelianern
und Liberalen einzubringen. Seine Korrepondenzen sprechen bei aller Sympathie
fr die Sache der Berliner Freien mehr von Vorbehalten, die sich aus der
Befrchtung nhren, das Berliner Unternehmen knnte das Bndnis mit den Libe-
ralen negativ tangieren.
Stirner kritisiert die abgerissene und eilfertige Darstellung, welche die Knigs-
berger Zeitung von den Freien gegeben habe. Gegen das Programm selbst, die
Grundberzeugung der modernen Philosophie aus der begrenzten Sphre der
Wissenschaft auch in die weiteren Kreise des Lebens einzufhren und daselbst gel-
tend zu machen, sei nichts einzuwenden.
Ob den Freien oder ein > Verein< zu diesem Zwecke frderlich oder wenigstens ntig ist, das
wre eine andere Frage. Mit welchem Schrecken man sie jetzt aufgenommen hat, davon
haben sie sich sattsam berzeugen knnen; wer also unter diesem Namen auftrete, der
wrde sich, wenigstens fr den Augenblick, die Zugnge verstellen und aus Gespenster-
furcht abgewiesen werden. Von dieser Seite betrachtet, was soll da ein Verein? Ungesetzlich
wre er nicht, wohl aber unklug. Stirner begrt es denn auch, da die Freien wohl jenen
Plan aufgegeben haben, um vor der Hand ihre Wirksamkeit nicht durch frmliche Konsti-
tuierung zu hemmen und eine geistige Macht vor der Gefahr zu bewahren, durch Voreilig-
keit zu einer materiellen Ohnmacht herabzusinken.
312
Insbesondere kritisiert Stirner, da die Freien den ffentlichen Austritt aus
der Kirche als zentrierenden Programmpunkt ansehen. Gerade dies war dazu
geeignet, das liberale, glubige Lager zu verschrecken. Stirners auf Kompromi zie-
lender Organisationshinweis zielt dagegen in eine andere Richtung:
Was nun schlielich die Freien betrifft, so haben sie ihre reelle Bedeutung nicht der Kirche,
sondern dem Staate gegenber, und ihre Opposition gegen eine seiner Institutionen ist eine
loyale, so loyal als z. B. die Opposition derer, welche gegen die Zensur sprechen und diese
berzeugung geltend zu machen suchen: es ist eine gesetzliche Opposition^
313
Da es ihm um eine Verhinderung der Spaltung der Oppositionsbewegung geht,
macht eine Anspielung deutlich, die er im Rahmen einer anderen Korrespondenz
macht. Er wehrt sich dagegen, da die Professoren und Akademiker, gewisse
Beamte und die Graduierten zusammen, den > Verein der Freiem bilden; das brige
Volk die >groe Masse<, bevormundet durch die >Freien<.
314
Selbst wenn Stirner zunchst an der Idee oder dem Gercht um die Vereinsgrn-
dung der Freien beteiligt gewesen sein sollte, seine Korrespondenzen zu diesem
Thema sind eher geprgt von dem Bemhen, eine Spaltung der Opposition zu ver-
hindern. Insbesondere nehmen seine Beitrge Rcksicht auf die Empfindungen
und Vorstellungen der ostpreuischen Liberalen um J. Jacoby, auf die wohl die
Formulierung von der gesetzlichen Opposition gemnzt ist.
315
Nicht minder kritisch gegenber der Nachricht von der Vereinsgrndung der
Freien ist die Reaktion aus dem Rheinland. So schreibt Marx besorgt an Ruge:
215
Wissen Sie was Nheres von den sogenannten >Freien<? Der Artikel in der Knigsberger
war mindestens nicht diplomatisch. Ein anderes ist, seine Emanzipation erklren, was
Gewissenhaftigkeit ist, ein anderes sich im voraus als Propaganda ausschreien, was nach
Renommisterei klingt und Philister aufbringt. Und dann, bedenken Sie diese >Freien<, ein
Meyen etc. Doch allerdings wenn eine Stadt, ist Berlin zu dergleichen Unternehmungen
geeignet. Marx befrchtet, da die Berliner Fadheit irgendwie ihre gute Sache lcherlich
macht und diverse >Dummheiten< bei dem Ernst nicht entbehren kann. Wer so lang unter
diesen Leuten war wie ich, wird diese Besorgnis nicht unbegrndet finden.
Fr Marx gilt es, Rcksicht zu nehmen auf die religisen Empfindungen der libe-
ralen Opposition im Rheinland, die leicht mobilisiert werden knnten, wenn sich
etwa die konservative >Klnische Zeitung< des Themas der Freien annhme:
Hermes (Redakteur der >Klmschen Zeitung<, d. V.) wird mir auch mit den
>Freien< auf den Hals rcken, von denen ich leider auch nicht das geringste Sichere
wei.
316
Die Schwierigkeiten, die die rheinischen Junghegelianer mit der Nachricht ber
die Freien haben, werden in He' Artikel vom 30. Juni 42 deutlich.
317
He ver-
weist zunchst auf die Stellungnahme der liberalen >Aachener Zeitung< und nimmt
den gesamten Aachener Text in seine Korrespondenz auf. In der Stellungnahme
aus Aachen heit es, bei den Freien handele es sich um etwas hchst Unkluges,
Unpolitisches, Unrechtes. Fr den liberalen Korrespondenten ist jede Religion
abgesehen von ihrer inneren Heiligkeit, etwas Unantastbares, weil wir noch nichts
kennen, was ihre Stelle vertreten kann, und er fragt mit Blick auf die Freien:
Aber was will man dem Volke geben, wenn man ihm die Sttzen des Positiven
durchschlgt? Man wnsche zwar nicht, da die Regierung die Freien verbieten
solle,
aber ebenso mssen wir dagegen protestieren, wenn man mit den Tendenzen jenes Vereins
die liberalen Richtungen zusammenwerfen wollte. Wenn liberale Bltter jenen freien Verein
ankndigen, so wrde doch die groe Majoritt der politisch-liberal Denkenden die Rich-
tung jener Assoziation von sich weisen. ( . . . ) Jener Verein hat nichts mit dem Liberalismus
in Preuen gemein, er ist eine isolierte Erscheinung.
He' umfangreiche Aufnahme dieser Aachener Korrespondenz macht das
Dilemma der Klner Junghegelianer deutlich: sie wollen den Bruch mit dem Libe-
ralismus vermeiden, stehen jedoch auch in Loyalitten gegenber den Berliner
Kampfgefhrten. Daher lassen sie andere sagen, was sie denken. He' eigene For-
mulierungen sind entsprechend akrobatisch. Er hofiert die Aachener Korrespon-
denz als einen in ernster, wrdiger Weise geschriebenen Artikel, er halte sich
rein an den Gegenstand, ohne dabei versteckte oder offenbare Insinuationen mit
einflieen zu lassen. Die aktuelle parteipolitische Brisanz wird von He herunter-
gespielt. Seine Differenz zu dem Aachener Liberalen entwickelt He auf einer sehr
allgemeinen Ebene der Diskussion des Verhltnisses von Kirche und Staat. Hier
insistiert er auf der Trennung von Kirche und Staat und gibt den Freien indirekt
Recht, wenn er sich gegen den materiellen Schutz einer Glaubensgemeinschaft
durch den Staat wendet.
318
Mit dem Heschen Manver ist die entstandene Situation nicht lange zu beruhi-
gen gewesen. Die Junghegelianer der RhZ geraten unter publizistischen Druck,
216
sich gegenber den Freien eindeutig zu erklren. Knapp zwei Wochen spter
unternimmt die RhZ einen neuen Anlauf. Die Reduktion der Freien auf ein reli-
gises Phnomen, die He versucht hatte, wird von dem Autor aufgegeben. Das
Projekt der Freien berhrt die Organisationsfrage, bei der generell gilt: es gibt
keine sittliche Macht im Staate, wenn ihr die uerlich, d. h. durch bestimmte
Gesetze festgestellte Existenz fehlt. Allerdings sei in unseren Tagen der Name
Opposition auf jede mgliche Weise entstellt und geflscht worden; sie (die Oppo-
sition, d. V.) wurde gleichsam von der Reaktion zu dem bequemen Gef gestem-
pelt, in das diese ihren gesamten Unrat hineingo. So habe sich die Meinung ver-
breitet, Opposition in Deutschland ( . . . ) sei eine im Finstern schleichende
geheime Gesellschaft. Die Nachricht ber die Freien werde nun in einer Weise
benutzt, die geeignet sei, die Bestrebungen der RhZ und der >Knigsberger Zei-
tung< zu disqualifizieren, weil diese Zeitungen als Hintergrund und Tummelplatz
der jener Erklrung (Nachricht ber den Verein der Freien, d. V.) unterlegten
Bestrebungen erscheinen.
319
Die RhZ weist nur noch die Gerchte ber die
Freien zurck, an ihrer Distanzierung lt sie keinen Zweifel.
Schon Wochen spter ist die Freien-Problematik ausgestanden, die Nachricht
ber die geplante Grndung erfllt sich nicht. Nicht ausgestanden sind die Span-
nungen zwischen den rheinischen Junghegelianern und der kompromilosen Berli-
ner Fraktion. Im Gegenteil, E. Bauers Artikel ber das Juste-Milieu
320
vom August
1842 provoziert Marx zu einer Kritik, die er in einem Brief an D. Oppenheim, Bru-
der des klnischen Bankiers Oppenheim, mitverantwortlicher Gerant der RhZ, for-
muliert. Die Kritik ist von Bedeutung, weil hier deutlich wird, wie die theoretische
Kohrenz des junghegelianischen Radikalismus und das praktische Problem der
Kooperation mit dem Liberalismus gegeneinander stehen.
Marx schreibt Oppenheim zu E. Bauers Artikel:
Eine so deutliche Demonstration gegen die Grundpfeiler der jetzigen Staatszustnde kann
Schrfung der Zensur, selbst Unterdrckung des Blatts zur Folge haben. Wichtiger ist
jedoch fr Marx das Bndnis mit den Liberalen: Jedenfalls aber verstimmen wir eine groe,
und zwar die grte Menge freigesinnter praktischer Mnner, welche die mhsame Rolle
bernommen haben, Stufe vor Stufe, innerhalb der konstitutionellen Schranken, die Frei-
heit zu erkmpfen, whrend wir von dem bequemen Sessel der Abstraktion ihre Widerspr-
che ihnen vordemonstrieren. Die RhZ sei fr einen solchen Artikel kaum das gehrige
Terrain (. . .). Zeitungen fangen erst dann an, das passende Terrain fr solche Fragen zu sein,
wenn diese Fragen Fragen des wirklichen Staates, praktische Fragen geworden sind. ber-
haupt seien ganz allgemeine theoretische Errterungen ber Staatsverfassung eher passend
fr rein wissenschaftliche Organe als fr Zeitungen. Die wahre Theorie mu innerhalb kon-
kreter Zustnde und an bestehenden Verhltnissen klar gemacht und entwickelt werden.
321
Was hier als Verhltnis von Theorie und praktischen Fragen bestimmt wird, ist
ein Modus, mit dem Bndnisproblem umzugehen. Marx will den praktischen
Zusammenhang mit der liberalen Opposition erhalten wissen und eine theoretische
Radikalitt, die keine Rcksicht auf Bndnisse nimmt, zurckdrngen. Diese Frage
der Zurcknahme theoretischer Radikalitt zugunsten der Bndnisfhigkeit der
Junghegelianer mu zur Spaltung einer Partei fhren, die von der politischen
Theatralisierung des philosophischen Dialogs ausgeht. Dabei ist daran zu erinnern,
217
da die Aufforderung zur Migung hier nicht einmal von den rheinischen Libera-
len ausgeht. Nicht der verantwortliche Gerant der RhZ aus der Bankiersfamilie
Oppenheim fordert Rcksichtnahme, sondern der radikale Junghegelianer Marx
ergreift die Initiative und fordert Oppenheim auf, von der bisherigen Handhabung
bei der Aufnahme von Artikeln abzugehen:
Ich halte es fr unumgnglich, da die Rh. Zeitung nicht sowohl von ihren Mitarbeitern
geleitet wird, als da sie vielmehr umgekehrt ihre Mitarbeiter leitet. Aufstze wie der
berhrte geben die beste Gelegenheit, einen bestimmten Operationsplan den Mitarbeitern
anzudeuten. Der einzelne Schriftsteller kann nicht in der Weise das Ganze vor Augen haben
als die Zeitung.
322
Whrend in Knigsberg die Balance von junghegelianischem Radikalismus und
liberaler Opposition durch das politische Engagement der Liberalen geprgt ist,
wird im Rheinland angesichts der laissez-faire-Haltung der Liberalen gegenber
ihrer Zeitung aus dem Kreis der Junghegelianer selbst eine Gegenposition formu-
liert. Dieses Verhalten tangiert jedoch im hohen Mae die innerparteiliche junghe-
gelianische Loyalitt. Denn hier ist das Spannungsverhltnis zwischen radikalen
und liberalen Positionen nicht mehr ein Auenverhltnis, sondern hat sich zum
Innenverhltnis gewendet. Das erklrt, warum die Spaltung der Junghegelianer
nicht im Verhltnis der Berliner zu den Knigsbergern, sondern im Verhltnis der
Rheinlnder zu den Berlinern ihren Ursprung hat.
323
b) Herweghs Reise
Will man eine Momentaufnahme der Beziehungen von Junghegelianern und Libe-
ralen im Herbst 1842 geben, so bietet es sich an, der Reise des Dichters Georg Her-
wegh zu folgen, deren Hhepunkte in Kln, Berlin und Knigsberg stattfanden.
Herwegh, in Wrttemberg geboren, von dort wegen eines Disziplinarvergehens
whrend seiner Militrzeit in die Schweiz geflchtet, wurde berhmt durch seine
Gedichte eines Lebendigen vom Sommer 1841, ber deren Wirkung R. Prutz
schreibt: Es war wie ein Rausch, der das ganze Publikum ergriffen hatte; selbst
Mnner, bejahrte Mnner, die ihrer politischen berzeugung nach einer ganz
anderen Richtung angehrten, vermochten sich dem Wohllaut dieser Verse, der
Pracht dieser Rhythmen, der Glut dieser Begeisterung nicht zu entziehen.
324
Fr
die Oppositionellen war Herwegh aufgrund seines jugendlichen Pathos eine noch
wirksamere Integrationsfigur als der Professor Welcker, dessen Demonstrations-
reise vermutlich bei Herweghs Plnen Pate gestanden hatte.
325
Herweghs Reise darf nicht als kulturelle Veranstaltungstournee miverstanden
werden, der Lyriker reist in Sachen Partei. Die Kunst bildet auch hier den sthe-
tisch vermittelten bergang von der Philosophie zur politischen Praxis. Herwegh
hat dies in seiner Dichterfehde mit Freiligrath, die groe Popularitt erlangt, deut-
lich gemacht, indem er gegen die Verse Freiligraths: Der Dichter steht auf hherer
Warte / Als auf den Zinnen der Partei zurckdichtete: Partei, Partei! Wer sollte
sie nicht nehmen, / Die doch die Mutter aller Siege war?
326
Dieser Aufruf zur Par-
tei wird in der radikalen Publizistik unablssig wiederholt; ab 1843 erscheint er bis
zur Revolution als Motto auf jeder Ausgabe des Blum-Stegerschen Vorwrts.
327
Wer ist die Partei, zu der Herwegh aufruft und fr die er seine Reise unternimmt?
218
Aufschlu gibt ein Artikel in der RhZ vom 30. Sept. 1842.
328
Herwegh hat die
Redaktion des >deutschen Boten aus der Schweiz<, eines radikalen Blattes von Emi-
granten in der Schweiz, bernommen und will mit seiner Reise Mitarbeiter in
Deutschland gewinnen. Die Zeitung soll ein Parteiblatt werden:
wer am Leben Teil nimmt, wird notwendigerweise zum Anschlu an Gleichgesinnte hinge-
trieben "und nur dadurch kann die Ttigkeit des einzelnen Gewicht und Einflu erhalten. Je
grer die Partei, desto grer mssen natrlich auch die Resultate ihrer Ttigkeit sein.
Es geht also um die Integration der verschiedenen oppositionellen Gruppierun-
gen, um einen breiten Zusammenschlu von radikalen Emigranten, liberaler
Opposition und der junghegelianischen Partei, der Herwegh als Mitarbeiter der
RhZ besonders verpflichtet ist. Die Unbestimmtheit der Programmatik ist ange-
sichts des entwickelten Standes der Verfassungsdiskussion kaum noch zu berbie-
ten, wenn Herwegh als Vertreter der jetzigen Jugend annonciert wird, in ihm
finden wir alle Sympathien, welche dieselbe empfindet, alle Bestrebungen, in wel-
chen sie ttig ist, allen jenen Enthusiasmus, in welchem sie erglht.
Wichtig ist darber hinaus eine neuartige Abgrenzung. Partei ergreifen heit
nicht nur, die Position aufzugeben, die glaubt, ber allen Parteien zu stehen, son-
dern es wird versichert, es bestnde keine Gefahr, da sich Herwegh unter die
Partei stellen, da er fr irgend eine literarische Clique oder Coterie sein Blatt her-
geben werde. Diese neuartige Abgrenzung verweist auf Gruppendefinitionen
oppositioneller Intelligenz, die uns im dritten Kapitel weiter beschftigen werden,
Gruppendefinitionen, die sich im Kontext der Spaltung der Junghegelianer anl-
lich der Reise Herweghs abzeichnen.
Am 1, Okt. 1842 meldet die RhZ die Ankunft des Dichters in Kln mit den
Begrungsversen: Im Gewand lebendger Blitze / Flammten deine Blitze nieder,
/ Von der Alpen Hhenpracht / Nieder in die deutsche Nacht\ Der Berichterstat-
ter versichert dazu, da der Dichter hier, in Kln, wie im ganzen Vaterlande die
Besttigung finden wird, da seine Lieder im Herzen des Volkes wurzeln.
329
Die
Mitarbeiter der RhZ veranstalten zu Ehren Herweghs ein glnzendes Festmahl,
und in den nchsten Wochen berichtet die Zeitung regelmig ber die Huldigun-
gen, die der Dichter in Jena und Leipzig erfhrt.
330
Im November kommt Herwegh nach Berlin, um die Berliner Gruppe fr eine
Mitarbeit an seinem Zeitungsprojekt zu gewinnen. Hier kommt es jedoch zu schwe-
ren Zerwrfnissen zwischen einerseits Herwegh und Rge, der den Dichter nach
Berlin begleitet hatte, und andererseits den Berliner Junghegelianern. Ehe ich hier-
auf im einzelnen eingehe, sei der weitere Verlauf der Reise skizziert. Herwegh mei-
det ein Zusammentreffen mit den Berliner Radikalen, stattdessen wird Herwegh
durch die aufsehenerregende Einladung zum Vortrag vor dem preuischen Knig
entschdigt (19. Nov. 1842). Spekulationen darber, was ein radikaler Dichter und
Parteifhrer einem Knig sagen sollte, und was ein Knig dem entgegnen knnte,
fllten die Zeitungen. Der Knig soll schlielich Herwegh mit den Worten inzwi-
schen wollen wir ehrliche Feinde bleiben verabschiedet haben.
331
Einige Tage darauf trifft Herwegh in Knigsberg ein. Wie in Kln wird er mit
einem glnzenden Festmahl bewillkommnet.
332
Der ostpreuische liberale
Oberlandesgerichtsrat Crelinger feiert Herwegh als unerschrockenen Freiheits-
kmpfer:
219
Es seien manche aufgetreten, sagte er, die gesprochen, was sie gedacht, die ohne Furcht das
freie Wort verkndet htten, indes sei ihnen statt des Lohnes Kerker und Kette zuteil gewor-
den: die Jugend aber, die die Freiheit ehren und erhalten soll, darf sich hierum nicht km-
mern, sie mu der Gefahr trotzen.
Herwegh bringt einen Toast auf Jacoby aus, und dieser erklrt unter Beifall:
Whrend wir den Dichter feiern, der mit den krftigen Worten die Jugend zu kh-
nen Taten ermutigt, wollen wir auch derer nicht vergessen, die mit der Kraft des
Wortes fr das Wohl des Vaterlandes sorgen - der Badischen Landstnde.
333
Zusammengefat kann zu den Hhepunkten der Herwegh-Reise festgestellt
werden: in Knigsberg ist das breite Spektrum der Opposition versammelt, in Kln
bestimmen die Radikalen der RhZ das Bild, und in Berlin kommt es zur Spaltung
der Junghegelianer. - Zum Abschlu der Reise mu noch nachgetragen werden:
Mitten in die Knigsberger Feierlichkeiten trifft die Nachricht vom Verbot des
noch gar nicht erschienenen Herweghschen deutschen Boten aus der Schweiz
ein. Herwegh schreibt aus Knigsberg direkt an den Knig und beruft sich auf die
ehrliche Feindschaft. Der ungeschickt abgefate Brief gelangt durch eine Indis-
kretion in die >Leipziger Allgemeine Zeitung<. Folge dieser Verffentlichung ist
nicht nur, da die oppositionelle Presse an der Integritt Herweghs zu zweifeln
beginnt. Er selbst wird aus Preuen ausgewiesen, und die >Leipziger Allgemeine
Zeitung< wird in Preuen verboten. Dies ist der erste Schlag gegen die gerade erst
vor kurzer Zeit mglich gewordene freiere Berichterstattung. Wenige Monate sp-
ter folgt das Verbot der RhZ.
334
Soweit der Rahmen, innerhalb dessen sich die Spaltung der junghegelianischen
Partei vollzieht. Das Zerwrfnis Herweghs und Ruges mit Teilen der Berliner Jung-
hegelianer ist von den Zeitgenossen unterschiedlich charakterisiert worden. Prutz
schreibt ber den Empfang Herweghs in Berlin:
Der Empfang war hier nicht so glnzend wie bisher; schon die Gre der Stadt, die Man-
nigfaltigkeit der Richtungen und Coterien verhinderte solche einstimmige (!) Kundgebun-
gen der ffentlichen Teilnahme, wie sie anderwrts stattgefunden hatten und auch an inne-
ren Widersprchen fehlte es nicht. Jene Berliner >Freien<, (. . .), die seit ihrem verunglckten
Versuch, sich als radikale Gemeinschaft zu konstituieren, so ziemlich in Vergessenheit gera-
ten waren, trotz der zahlreichen Zeitungsartikel, durch die sie selbst tglich an sich und ihr
wunderliches Treiben erinnerten - diese Berliner Freien, ein unerquickliches Gemisch von
philosophischem Radikalismus, sittlicher Zerfahrenheit und politischem Indifferentismus,
wollten Herweghs Anwesenheit in Berlin benutzen, ihre oft bezweifelte Existenz durch eine
geruschvolle Manifestation zu dokumentieren. Schlechte Kritiker wie sie waren, obwohl sie
sich selbst als der wahre Gipfel der Kritik, die eigentliche kritische Kritik verkndeten, hiel-
ten sie den Dichter vllig fr einen der ihren und rsteten sich, diese innerliche Gemein-
schaft auf lrmende Weise an den Tag zu legen. Allein sie tuschten sich; (. . .). Herwegh,
der in Arnold Ruge's Gesellschaft nach Berlin gekommen war, lehnte die angebotene
Gemeinschaft mit den Freien ab.
335
Anders lautet das Urteil eines Briefschreibers, der mit B. Bauer korrespondierte.
Er schreibt rckblickend ber seine Berliner Erlebnisse:
Ich erinnere mich immer noch mit Freude des Sommers von anno 42; was war das unter
uns >Radikalen< fr ein eintrchtig (!) Leben, trotz aller Debatten ber Atheismus und Popu-
220
laritt und Jacoby und Knigsberg; wir waren durch die Rheinische Zeitung verbunden -
kurz wir fhlten uns fast als Partei. Dann brachte uns im Herbst die Anhaltsche Eisenbahn
jene beiden >Freiheitsmnner<, die eigens gekommen schienen, um nach Berlin, das ihnen zu
frei und frivol war, ein gediegenes sittliches Prinzip und den Anker der Religion der Freiheit
zu bringen. Aber dieser Anker wollte gar nicht in dem bodenlosen >Sumpfe< der Frivolitt
haften und die >Straenjungen< verspottejten sie, als sie das neue Evangelium auf den Gassen
predigten. Sie wollten sich nicht weiter beschmutzen, der eine wendete sich ganz malcontent
nach Hause, der andere reiste in den Norden, um begeisterte Reden zu hren und zu halten.
Einige Zeit daraufmachte auch ich nach Hause zurck, wo ich mit der Nachricht der unter-
de eingetretenen Verbote eintraf.
336
Unterschiedlich ist schon die Situationsbeschreibung der Gruppen in Berlin. Fr
Prutz bietet Berlin ein Bild widersprchlicher Gruppenbildungen, der Briefpart-
ner B. Bauers erinnert sich an eine homogene Szene, die dem, was Partei in dieser
Zeit heien konnte, schon sehr nahe kam. Fr ihn sind Herwegh und Rge phili-
strse Gestalten, die mit der Berliner Radikalitt nichts anfangen knnen. Umge-
kehrt hat fr Prutz das Treiben der Berliner jeden ernsthaften politischen Sinn ver-
loren. Frivolitt versus politische Ernsthaftigkeit, diese beiden Bezeichnungen
tauchen hufig in den Beurteilungen von seiten der Kritiker der Berliner Gruppe
auf, whrend die Berliner das politische Pathos anderer Junghegelianer als quasi
religis und somit als den Ideen der Aufklrung und der Freiheit zuwiderlaufend
darstellen.
Was sich in der Spaltung abzeichnet, ist die Kontur eines anderen Typus junghe-
gelianischer Gruppenzusammenhnge, als die, die bisher dargestellt wurden. Die-
ser Typ ist verschieden vom Schulzusammenhang im Rahmen akademischer Teil-
kulturen. Er ist auch nicht mehr zu verstehen im Rahmen der Formeln des ber-
gangs von der Philosophie zum Leben. Und so sehr hier noch der Begriff >Partei<
im Spiele ist, das >Treiben< der Berliner gilt denen, die auf eine breite Oppositions-
partei hinarbeiten als unpolitisch oder, als modern gesprochen, parteischdi-
gend.
Zum Proze der Spaltung im einzelnen: Wahrscheinlich hat Herwegh sich auf
Ruges Rat hin gar nicht erst mit den Berlinern getroffen.
337
Rge hatte die Absicht,
die Berliner fr das Projekt einer freien Universitt zu gewinnen,
338
ber seine nega-
tiven Erfahrungen beim Treffen vom 10. November 42 hat er vermutlich mit Her-
wegh gesprochen, zunchst aber nichts unternommen. Aktiv wurden Herwegh und
von seiten der Berliner E. Meyen. Sie wandten sich an Marx in Kln, wohl nicht,
damit er ihren Streit schlichte, wie Cornu die Rolle Marxens berhht dar-
stellt,
339
sondern, um das Verhalten der RhZ zu erkunden und zu beeinflussen.
Marx stellt sich auf die Seite von Herwegh und schreibt am 29. Nov. 1842 unter
Verwendung Herweghscher Formulierungen in der RhZ:
Die >Elberfelder Zeitung< und aus ihr die >Didaskalia< enthalten die Nachricht, da Her-
wegh die Gesellschaft der >Freien< besucht, dieselbe aber unter aller Kritik befunden habe.
Herwegh hat diese Gesellschaft nicht besucht, sie also weder unter noch ber der Kritik fin-
den knnen. Herwegh und Rge fanden, da die >Freien< durch ihre politische Romantik,
Geniesucht und Renommage die Sache und die Partei der Freiheit kompromittieren, was
auch offen erklrt wurde und vielleicht Ansto gegeben haben mag. Wenn Herwegh also die
Gesellschaft der >Freien<, die einzeln meist treffliche Leute sind, nicht besucht hat, so
221
geschah es nicht, weil er etwa eine andere Sache verficht, sondern es geschah lediglich
darum, weil er die Frivolitt, die Berlinerei in der Art des Auftretens, die platte Nachfferei
der franz. Klubs, als ein Mann, der auch von franz. Autoritten sein will, hat und lcher-
lich findet. Der Skandal, die Polissonnerie mssen laut und entschlossen in einer Zeit desa-
vouiert werden, die ernste, mnnliche und gehaltene Charaktere fr die Erkmpfung ihrer
erhabenen Zwecke verlangt.
340
Einige Formulierungen dieser Korrespondenz, mit der die Spaltung der Junghe-
gelianer ffentlich dokumentiert wird, verdienen es, hervorgehoben zu werden.
Die Berliner werden als Freie tituliert, obwohl die Nachricht der Vereinsgrn-
dung schon seit Monaten als erledigt gelten mu. Die Freien existieren nicht
mehr, trotzdem hlt sich der Titel, und er wird zustzlich konnotiert in Richtung
einer Gruppierung, die >unter aller Partei< steht. Es ist keine Gruppierung, die
andere Ziele verfolgt als die Herweghsche Partei, es handelt sich auch nicht um eine
andere Partei; im Zentrum steht die Art des Auftretens, ein Kriterium, das inner-
halb der philosophischen Schulstreitigkeiten allenfalls als eine Differenz der Prinzi-
pien zur Geltung htte kommen knnen. Jetzt, als politische Partei, wird >Glaub-
wrdigkeit< gefordert, die auf Anhnger zielt. Als einzelne sind die Berliner meist
treffliche Leute, d. h. sie wren jeder schon parteifhig, aber es gibt einen Typ von
Verbindung unter ihnen, ein spezifisches Gruppenphnomen, das verhindert, da
ihre einzelnen parteifhigen Krfte adquat zur Geltung kommen knnen.
Einen Tag nach Erscheinen der Korrespondenz informiert Marx Ruge ber sei-
nen Briefwechsel mit Meyen, in dem er seine Haltung erlutert.
341
Neben der Kritik
an der Form, in der die Berliner auftreten, spielt eine entscheidende Rolle die
Frage, welchen Einfju die Berliner Gruppe auf die RhZ haben sollte. Marx
bemngelt die lasche Redaktionsfhrung Rutenbergs, bei der sich die Berliner
daran gewhnt hatten, die RhZ als ihr willenloses Organ zu betrachten, ich aber
nicht weiter dies Wasserabschlagen in alter Weise gestatten zu drfen glaubte. Die
Berliner interpretierten die von der preuischen Regierung verlangte Entfernung
Rutenbergs aus der Redaktionsleitung und die Nachfolge von Marx als grundlegen-
den Gesinnungswandel der Zeitung und verlangten nun von Marx Auskunft ber
das neue Redaktionsprinzip und die Stellung zur Regierung. Marx wird der Vor-
wurf des Konservatismus gemacht, die Zeitung drfe nicht temperieren, son-
dern msse das uerste tun. Marx bersetzt diese Forderung: d. h. ruhig der
Polizei und der Zensur weichen, statt in einem dem Publico unsichtbaren, aber
nichts desto weniger hartnckigen und pflichtmigen Kampf ihren Posten
behaupten.
Ruge zeigt sich in seiner Antwort berrascht, da Marx es durch die Verffentli-
chung in der RhZ und seinem Briefwechsel mit Meyen auf die Spaltung habe
ankommen lassen. Er hatte daraufgebaut, da die Geschichte sich ( . . . ) der Publi-
zitt entziehen wrde.
342
Gegenber Fleischer erklrt er: Ich hatte dabei anfangs
die sehr unbefangene Absicht, sie (die Freien, d. V.) zur Auflsung ihrer Soziett
zu bewegen, damit sie die gute Sache nicht kompromittieren und sich selbst nach
Gelegenheit blamierten.
343
Dies ist ihm nicht gelungen. Nun also ist der Wrfel
gefallen, schreibt er Marx. Allerdings macht er noch den Versuch, B. Bauer in der
Spaltungsfrage umzustimmen. Er schliet sich der Marxschen Kritik der Berliner
Gruppe an, besteht aber darauf: Die Hauptsache wre aber, Bauer selbst von dem
222
Plane abzubringen, die Freien und ihre hohle Renommage zu beschtzen und als
etwas Vernnftiges hinzustellen. Ruge mahnt Marx:
Aber noch einmal: ich hoffe, da Sie Bauer aus dieser Atmosphre retten - vielleicht schon
durch ihre Briefe an Meyen, die der natrlich mitteilt, und wenn sie noch so stark wren -
besser aber noch, wenn Sie sich bei ihm selbst ber das Unwesen der Freien ernstlich
beschwerten. Bauer darf nicht publice in diese Suppe mit verwickelt werden, und er traut
sich viel zu viel zu, wenn er meint, da er das vertragen knnte. Ohne sittlichen Ernst ist in
Deutschland auch die beste Sache verloren, (. . .). Ich mag es mir nicht gestehen, da Bauer
uns den Streich spielen und sich mit den Freien isolieren knnte, und ich wnschte um sei-
netwillen um der guten Sache willen diesen Tollhausstreich zu vermeiden. - Tun Sie
dazu, was Sie knnen. Ist er aber nicht zu vermeiden, und zerren die Freien sich und ihr
abgeschmacktes Prinzip (!) ins Publikum - so bin ich der erste, der alles daran setzt, sie
grndlich totzuschlagen und die Sache der Freiheit von dieser wsten Willkr, die es dahin
gebracht hat, da der herrscht, der am lautesten schreit, am strksten dreinschlgt, zu
befreien.
544
B. Bauer jedoch distanziert sich nicht von der Berliner Gruppe. Sein letzter Brief
an Marx vom 13. 12. 1842, der mit einem Lebe wohl endet, geht von der vollzo-
genen Spaltung aus. Bauer weigert sich angesichts des Briefwechsels zwischen Kln
und Berlin, eine Berichtigungsbude aufzuschlagen. In zurckhaltender Form
weist er Marx auf dessen Anteil an der Spaltung hin:
Alle und jegliche Briefe, die von hier aus nach Kln kamen, httest Du doch nach Deiner
Kenntnis der Person und Verhltnisse kritisieren sollen. Und Deine Briefe, die Du hierher
geschickt hast, httest Du, ehe Du sie abschicktest, einen Tag in Deinem Pulte liegen lassen
sollen.
Marx' Artikel vom 29. Nov., der die Spaltung ffentlich dokumentiert hatte,
schreibt Bauer allein Herwegh selbst zu und bemerkt dazu:
Endlich habt Ihr durch die Aufnahme von Herweghs Korrespondenz offenbar Partei
genommen, und Ihr mt umso triftigere Grnde dazu gehabt haben, da Ihr den Wider-
spruch in jener Korrespondenz bersaht, da derselbe, der die hiesigen schildert, selbst sagt,
da er sie nicht in corpore gesehen habe, und da Ihr nicht in Betracht zget, da das gereizte
Wesen dieser Korrespondenz das Zeichen einer kleinen Seele ist.
Fr Bauer haben sich die Berliner nichts vorzuwerfen:
Das Recht der Hiesigen ist unbestreitbar. Darum haben sie trotz aller Reizungen geschwie-
gen. Lieber Marx, das Recht Berlins ist so gro, die Berliner haben so wenig durch falsche
Schritte die bereilungen anderer hervorgerufen, da ich ber diese Sache gar nicht weiter
sprechen mag, da ich zuviel Unangenehmes, woran hier niemand schuldig ist, berhren
mte.
345
Gruppenspaltungen sind nicht nur ein organisatorisches Problem. Sie spielen
sich auch auf der Ebene persnlicher Bindungen ab. Davon zeugt der erregte Brief-
wechsel, den die Beteiligten miteinander fhren. Aber es wre unzureichend, die
Spaltung der Junghegelianer lediglich auf der Ebene persnlicher Streitereien im
Bereich des allzu Menschlichen anzusiedeln. Soziologisch bedeutender ist, da sich
fr die Gruppen in Kln, Berlin und Knigsberg unterschiedliche Erfahrungs-
rume darboten, die ihre vermeintlichen Handlungszwnge und Handlungsfreihei-
223
ten beeinfluten. Ein wesentlicher Faktor dieser Erfahrungsrume war extrem dif-
ferent: die Prsenz einer liberalen Opposition, mit der sich die Radikalen je nach
den Orten mehr oder weniger praktisch alltglich auseinandersetzen muten, vor
allem dann, wenn sie ihrem Postulat, politische Partei zu sein, gerecht werden woll-
ten.
346
Verwundert es, da die Junghegelianer als politische Partei von Hegels Diktum:
Eine Partei ist dann, wenn sie in sich zerfllt
347
eingeholt wurden? In der Tat:
Dort, wo sie daran gehen, sich in der Oppositionsbewegung des Vormrz zu veror-
ten, spalten sie sich in der Frage der Kompromibereitschaft gegenber den Libe-
ralen. Natrlich spielt die staatliche Repressionspolitik eine wichtige Rolle bei der
Spaltung, aber der Druck von oben reicht als Erklrung des Geschehens nicht aus.
Fat man allein ihn ins Auge, so wre auch ein Zusammenrcken der Oppositionel-
len denkbar gewesen.
Lassen sich ber den Gedanken an die unterschiedlichen lokalen Erfahrungs-
rume hinaus noch andere Momente benennen, die fr die Kompromiunfhigkeit
der Junghegelianer verantwortlich zu machen sind? Diese Frage mu gestellt wer-
den, denn auch die rheinische Gruppe, die um eines Kompromisses mit den Libe-
ralen willen die Spaltung in Kauf genommen hatte, wird nicht in den Liberalismus
eingehen. Im Gegenteil: einige Monate spter nehmen diese Junghegelianer den
Kampf gegen den Liberalismus im Namen des Sozialismus auf.
U. Kster hat die These aufgestellt, da das Strukturideal des radikalen Libera-
lismus der Junghegelianer dem Liberalismus selbst im Grunde feindlich war.
Der Grund hierfr lge in dem Widerspruch zwischen dem Festhalten an den
romantischen Mustern einer politisierten Theologie und der darauf aufgesetzten
Forderung nach liberalen Institutionen. Das romantische Strukturideal des radi-
kalen Liberalismus steht so im Widerspruch zu den konkreten Forderungen, die er
verwirklichen wollte, und es scheint, als liege ihm gar keine durchdachte politische
Konzeption zugrunde.
348
Bezogen auf die Differenz eines monistischen Lsungs-
versuchs des Verhltnisses von Staat und Gesellschaft und einer dualistischen Kon-
zeption der Balance beider Sektoren mag die These zutreffen. Und in der Tat ist ja
auch die Mangelhaftigkeit des Absoluten der theoretische Ausgangspunkt der
Verfassungsdiskussion gewesen.
Aber hat die junghegelianische Partei keine durchdachte politische Konzep-
tion ihrem Handeln zugrunde gelegt? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall: Im
Proze des Durchdiskutierens des Staates hat sie eher zu viele durchdachte politi-
sche Konzeptionen hervorgebracht. Dieser berschu an politischer Konzeption,
der berschu am Durchdenken des Politischen hat sich in seltsamer Weise als
dysfunktional erwiesen. Es wre auch voreilig anzunehmen, diese berschsse ht-
ten sie daran gehindert, >praktisch< zu werden. Eher das Gegenteil ist der Fall: es
gibt kein politisches Geschehen der fraglichen Zeit, in das sich die Gruppe nicht
eingemischt htte, ja, sie hat den Bereich des Politischen, den Horizont mglicher
Praxen erweitert und Fragen zu politischen Tagesfragen erhoben, die diesen Sinn
im Bewutsein der Zeitgenossen bisher nicht gehabt hatten. Auch hier knnte man
eher sagen, da die Gruppe ein Zuviel an >Praxis< aufzuweisen hat.
Die Frage nach den inneren Ursachen der hervorbrechenden Kompromiunf-
higkeit der Gruppe gegenber den Liberalen lt sich am prgnantesten damit
224
beantworten, da die Junghegelianer zwar eine politische Partei konstituiert haben,
die im Kontext der vormrzlichen Verhltnisse alle Elemente enthielt, die diese
Definition rechtfertigen, da sie aber neben dieser veritablen politischen Partei
auch noch mit anderen Gruppendefinitionen experimentiert haben. Hier liegt der
Quellpunkt des berschssigen, das dysfunktional wird. Im bergangsfeld der
Philosophie, die Partei macht, erhlt sich noch vieles, was dem Typ der philosophi-
schen Schule angehrt, und zugleich taucht das Bild einer Gruppe auf, die >unter
allen Parteien< steht. - Bevor wir uns den weiteren Gruppendefinitionen der Jung-
hegelianer zuwenden, sollen, dies Kapitel abschlieend, Zeitgenossen zu Wort
kommen, die das Scheitern der junghegelianischen Partei von auen kommentie-
8. Stimmen von Zeitgenossen zum Scheitern
der junghegelianischen Partei
1841, zu einem Zeitpunkt, als die Parolen der Junghegelianer von der Philosophie,
die Partei macht, schon ein konturiertes Profil erhalten haben, setzt sich Karl Bie-
dermann, ein Liberaler, der ber bildungsbrgerliche Orientierungen hinausge-
hend einen offenen Blick fr die Probleme der sich abzeichnenden brgerlich-
industriellen Gesellschaft hat, in der Altonaer Zeitschrift >Der Freihafen< mit der
Stellung der deutschen Philosophie zum ffentlichen Leben und zur modernen
Gesellschaft auseinander.
349
In seinen Ausfhrungen kommt der skeptische
Grundtenor vieler Zeitgenossen zum Ausdruck, die das junghegelianische Partei-
projekt verfolgen. Seine Zweifel richten sich darauf, ob denn die deutsche Philoso-
phie in ihren avantgardistischen junghegelianischen Vertretern berhaupt in der
Lage sei, eine Partei zu machen, die den Bedingungen der modernen Gesellschaft
gerecht wird.
Biedermann rhmt zwar die Leistungen der deutschen Philosophie von Kant bis
Hegel, indem er besonders auf die Elemente verweist, die ihm gesellschaftlich-
praktisch relevant erscheinen - so heit es von Kant: Das letzte Wort der Kant-
'schen Kritik war: Erfahrung, die letzte Tendenz seines Systems war eine rein prak-
tische. Und wichtig an der Hegelschen Philosophie ist fr ihn: nicht die in sich
selbst verschlossene, ruhende Allgemeinheit oder Idee, sondern die einzelne, reelle,
tatschliche Erscheinung ist der hchste Ausdruck und Zweck des Lebens.
350
Aber dies ist fr Biedermann noch nicht ausreichend. Die deutsche Philosophie
habe sich zwar von ihren spirituellen, religisen Voraussetzungen ein Stck weit
gelst, aber es sei ihr nicht gelungen, sich ganz auf die >Objektivitt< der prakti-
schen Beziehungen der Menschen einzulassen.
Whrend sie (die philosophischen Systeme, d. V.) nmlich nicht umhin knnen, fr die
rechtlichen und politischen Beziehungen der Menschen untereinander eine materielle Basis
aufzusuchen, gehen sie, in Bestimmung des allgemeinen und letzten Zwecks des menschli-
chen Lebens, wieder ganz ihren ideologischen Neigungen nach und verweisen das Indivi-
duum in eine Sphre, welche weit ber dem gemeinen, irdischen Treiben der Gesellschaft,
weit ber den Bedrfnissen und Interessen des natrlichen Lebens, in den luftigen Regionen
des Ideals, des reinen Gedankens oder des sublimsten Gefhls gelegen ist.
351
225
Auffllig an Biedermanns Begrifflichkeit ist schon, mit welcher Sicherheit er
Begriffe wie materielle Basis, rechtliche und politische Beziehungen und
ideologische Neigungen verwendet, Begriffe, die heute, aus postmarxistischer
Perspektive, selbstverstndlich klingen, die aber 1841 in Deutschland selten zu fin-
den sind.
Biedermanns These lautet: Die Stellung der Philosophie ist eine zwiespltige, sie
mu die gesellschaftlichen Tatsachen anerkennen, kann jedoch andererseits auf
ihre spekulativ spirituellen Traditionen nicht verzichten. Angesichts der Alterna-
tive, zu der die moderne Gesellschaft die Philosophie herausfordert: entweder als
Ziel eine innere, ideale Vollendung des Menschen anzustreben, oder den Akzent
auf die Erwerbung und Benutzung von ueren Gtern, die Entwicklung seiner
(des Menschen, d. V.) natrlichen Krfte und Talente, die Beherrschung und
Behandlung der Krperwelt zu legen, sei die deutsche Philosophie unentschie-
den.
352
Diese Unentschiedenheit habe sich - so die Pointe der Argumentation -
zunchst sehr vorteilhaft fr die Philosophie ausgewirkt, der Vorteil schwinde aber
zunehmend. Die strategisch vorteilhafte Situation habe darin bestanden, da die
Philosophen einerseits im Rckgriff auf Elemente der modernen Welt einen ber-
zogenen Spiritualismus religiser Herkunft abwehren und zugleich umgekehrt im
Namen des Idealen die freie Entfaltung der praktischen Interessen begrenzen
konnten.
353
Aus dieser Stellung der Philosophie resultiert denn auch fr Biedermann die
besondere Rolle, die der Hegelianismus in Preuen spielte.
Konnte es fr sie (die Philosophen, d. V.) irgendwo eine gnstigere Stellung geben, als in
einem Staate, wo zwar die Notwendigkeit gewisser sozialer Verbesserungen und eines gewis-
sen Fortschritts im liberalen Sinne anerkannt, aber die Initiative dieser Bewegung aus-
schlielich der Regierung vorbehalten war? Wo man sich mit den Bedrfnissen der Zeit, den
Anforderungen der ffentlichen Meinung auszugleichen wnschte, ohne doch dieser ffent-
lichen Meinung eine entscheidende Stimme in den Angelegenheiten des Staats zuzugeste-
hen ? Mit einem Worte, wo man Reformen wollte, aber nur begrenzte, eine Freiheit, aber nur
eii.e bedingte? Hier war die Philosophie mit ihren Konzessionen und Reservationen, mit
ihrem dialektischen Aussichherausgehen und Insichzurckschlagen, recht am Platze. Hier
konnte der Philosoph durch die Universitten und die Beamteten entscheidend auf den
Gang der Regierung einwirken und die praktische Probe auf seine theoretischen Ideen
machen. Daher ist auch stets zwischen der modernen deutschen Philosophie und dem preu-
ischen Staate eine auffallende Sympathie bemerkbar gewesen.
354
Diese gnstige Stellung ist weniger durch den Regierungswechsel des Jahres
1840 verloren gegangen, sondern durch einen fundamentaleren geschichtlichen
Proze:
Die Initiative des Kulturfortschritts ist an die groe Masse der praktischen Leute, der
Geschftsmnner, der Industriellen bergegangen; die Kenntnisse und die Ideen sind
demokratisiert; die Presse, mit ihren raschen, fr das praktische Bedrfnis des Tages berech-
neten, Mitteilungen, hat die schwerflligen Theorien der Gelehrten berflgelt. Der Natio-
nalgeist gehorcht instinktartig den Interessen des Verkehrs, und tritt durch seine industriel-
len und kommerziellen Verbesserungen gegen die mchtigsten Rivalen furchtlos in die
Schranken. (. .. ) Die Sache der Spekulation ist verloren; die Prrogative des Systems ist ver-
nichtet.
355
226
Angesichts dieser neuen Situation kommen fr Biedermann die Philosophen
als politische Bndnispartner kaum in Frage. Auch wo sie Partei ergreifen wollen,
bilden sie eine undisziplinierte Masse, welche weder ihre Fhrer, noch ihre Fah-
nen kennt. Dieselbe Fraktion, ja derselbe einzelne Philosoph dieser Partei verei-
nigt in sich die divergierendsten Ansichten; jeder ist ein verkrperter Widerspruch.
Das ist das Einzige, worin sie alle das Grundprinzip ihres Meisters reprsentie-
ren.
356
Biedermann beschliet seine Ausfhrungen mit einer eindrucksvollen Charakte-
risierung der Lage jener Philosophen, die das Terrain des bergangs von der Philo-
sophie zur Partei, von der Wissenschaft zum Leben, von der Theorie zur Praxis
bevlkern. Sie sind fr ihn die Mrtyrer der sozialen Wiedergeburt. Er
schreibt:
In der Verehrung von Idealen und in der Verachtung des Materiellen erzogen, mssen sie
(die Philosophen, d. V.) die faktische bermacht des Letzteren und die Ohnmacht des
Ersteren erfahren. Gewhnt, von ihrem erhabenen Standpunkte der Wissenschaft und des
Geistes mit Stolz auf die gemeinen Beschftigungen und die beschrnkten Ansichten der
Praktiker herabzublicken, sehen sie eben diese verachteten Praktiker in allen Lebensverhlt-
nissen vorgezogen, geehrt, im Gensse aller reellen Macht und alles reellen Glcks, sich
selbst aber berall zurckgestoen, durch das Mitrauen der anderen, wie durch die eige-
nen nicht zu berwindenden Idiosynkrasien von aller wirksamen Teilnahme an den Angele-
genheiten der Gesellschaft ausgeschlossen, und auf die milichen Trstungen poetischer
Erregung und logischer Begeisterung verwiesen. Sie wollen an das praktische Leben heran,
und es zieht sich vor ihrer ausgestreckten Hand, vor ihrem aufgehobenen Fue zurck, wie
Trank und Speise vor den Lippen des Tantalus. (. . .) Die freie, rasch entschlossene und
wirksam treffende Tat, welche bei den Mnnern des praktischen Lebens sich aus dem siche-
ren Instinkt des Bedrfnisses erzeugt, diese wollen sie durch einen dialektischen Gedanken-
proze vermitteln, wenn sie aber, durch tausend Verschlingungen und Lsungen ihrer
Begriffe, an dem Punkt angelangt sind, auf den sie hinzielten, so haben sie nur die Mglich-
keit dessen bewiesen, was schon ist, und die Erfahrung wei ihnen fr diese versptete Weis-
heit wenig Dank. Sie haben das traurige und undankbare Geschft, angewohnte und liebge-
wordene Illusionen zu zerstren, ohne doch einen positiven Einsatz dafr aus ihren Mitteln
gewhren zu knnen; sie wehren die Geister der alten Zeit von dem neu erbauten Boden ab;
aber die Urbarmachung und den Genu dieses Bodens mssen sie andern berlassen; sie
sehen das gelobte Land vor sich ausgebreitet und deuten die rechten Pfade an, aber ihnen
ist nicht vergnnt, in dasselbe einzuziehen und sich darin anzusiedeln. Durch solche Wirren
und Leiden ben die Philosophen die Schuld der Gesellschaft und ihre eigene Schuld.
Widerstrebend oder freiwillig, sie mssen ihr Geschick erfllen.
357
Passagen wie diese machen die Differenz der sozialen Erfahrung zwischen dem
wachsenden Selbstbewutsein der brgerlichen Praktiker und den angestreng-
ten Gesten der junghegelianischen Intellektuellen deutlich, in den heraufziehenden
modernen Verhltnissen als Partei Fu zu fassen. Anerkannt wird allenfalls die
Arbeit der Kritik und das Aufgeben der gnstigen Stellung, aber die junghegelia-
nische Partei ist fr Biedermann bereits 1841 eine Ansammlung tragischer Gestal-
ten.
358
Mit Gelassenheit beobachtet auch ein Jahr spter Ch. Feldman im Altonaer
>Freihafen< die Aktivitten der Junghegelianer.
359
227
Diese Schule tritt so ganz unbedingt und rcksichtslos allem entgegen, was bisher die
schnste Eigentmlichkeit des Deutschen nicht nur, sondern auch des menschlichen Gemts
berhaupt ausmachte, da, wrden die Grundstze allgemein, allerdings ein neues Volk, die
Hegelianer, an die Stelle unserer Vaterlandsgenossen treten mte. Da htten wir denn
buchstblich den Himmel auf Erden, aber auch nicht minder gewi die Hlle daneben.
Ein vernnftiger Fortschritt sei in den junghegelianischen Parteibestrebungen
nicht zu entdecken, und der Autor dreht den Spie geradezu um: ein Sieg der Jung-
hegelianer bedeute: Das monarchische Prinzip htte nun wirklich dem republika-
nischen Platz gemacht, und die Machtvollkommenheit des hchsten Gottes wre
unter so viele Millionen irdischer Gtter verteilt.
Ohnehin knne es sich bei der junghegelianischen Bewegung nur um eine
Scheinblte handeln.
Wie ist es doch gekommen, da die mit Impotenz und Tatenlosigkeit geschlagene Hegel-
sche Schule, fr den Augenblick, sich so bemerklich zu machen imstande war? Es ist eben
nur erklrlich durch allzu freies Walten der Bcherverbote und der Zensur, durch unbe-
fugte staatliche Einmischung in die unabhngige Glaubenssphre, und durch die fixe Idee,
vermittels theologischer Formen den Fortbestand des politischen Status quo zu sichern!
Die liberale Lsung des Problems lautet fr Feldmann:
Tut nichts, und ihr werdet eben alles getan haben. Gebt der Forschung und Untersuchung
in religisen Dingen eine allgemeine und unbeschrnkte Freiheit; gestattet den Rationalisten,
eben wie den Hegelianern, die volle, unumwundene Rede; den Hirten der Herde mag die
Herde selber whlen, und unabhngig und friedlich mgen die Herden mit und neben ein-
ander wandeln!
Auerdem habe die moderne Zeit den groen Vorteil der Druckerpresse;
sollen wir denselben nicht, seinem ganzen Umfang nach, benutzen? Kurz gesagt:
Mit liberaler Pressepolitik wrde das Phnomen der Junghegelianer von selbst
unattraktiv werden und auf den Status einer Sekte reduziert sein. Eine groe Hilfe
fr den Fortschritt, auf den Feldmann setzt, sind die Junghegelianer nicht.
Da sich gerade aus der HegeLschen Philosophie heraus eine praktische Bewe-
gung bilden sollte, ist fr viele Zeitgenossen schwer verstndlich gewesen. 1843 ver-
ffentlicht ein Anonymus in der >Deutschen Vierteljahrsschrifu einen umfangrei-
chen Beitrag, in dem Hegels Philosophie gleichsam auf ihre Praxisfhigkeit hin
geprft wird.
360
Die denkerische Leistung Hegels wird vom Autor gern anerkannt, jedoch mit
dem Nachsatz, diese Philosophie sei ganz im Geist und Sinne einer Zeit, die ohne
Tat und Anstrengung, wie ohne Selbstverleugnung den hchsten Preis gewinnen
will, und mute so Glck bei einem Volke machen, dessen fast einzige Macht der
Gedanke ist und das sich ber seine Tatenarmut und Unmacht im Handeln damit
trsten will, die Welt durch den Gedanken zu erobern oder zu vollenden. Die
Dimension der Praxis sei bei Hegel verschwunden. Hegels Grundfehler, wie wir
glauben, nach anderen freilich ein unsterbliches Verdienst, ist die starre Einseitig-
keit, mit welcher er blo die Interessen und Ansprche des Denkenden, wissen-
schaftlichen Menschen zu Rate zieht.
Darber hinaus ist der Hegelianismus schon seiner Form wegen nicht verallge-
meinerungsfhig.
228
Nun wird zwar ein System, das dem menschlichen Denken so hartes und widerstrebendes
zumutet, wie nach seinem eigenen Gestndnis das Hegeische, nie die herrschende Lehre
und der allgemeine Glaube der Menschheit werden, und Hegel selbst hat ber die Kluft,
welche den natrlichen Menschen von dem spekulativen (d. h. von dem im hegelschen
Sinne spekulativen) trennt, sich nie getuscht. ( . . . ) Hegel erkannte, da die Mnner, deren
Religion das Wissen ist, immer nur eine kleine Minderheit bilden werden, und besonnener
als diejenigen seiner Schler, welche das Hegeltum zum Volksglauben machen mchten,
schonte er sorgsam die nach seiner Ansicht freilich auf einer weit niedrigeren Stufe stehen-
den Vorstellungen der geoffenbarten Religion.
Der Charakter der Geheimlehre sei dem Hegelschen System wesentlich.
berhaupt sei die HegeLsche Intention in der Grundfigur ihres Denkens den prag-
matischen, nicht systematischen Bereichen geradezu gegenlufig. Je strenger, kon-
sequenter berhaupt das System des absoluten Wissens durchgefhrt wird, desto
trostloser sind die praktischen Resultate, desto deutlicher zeigt es sich, da der
Absolutismus des Wissens ein ebenso zerstrender, verneinender, unduldsamer ist
als der politische.
Bei diesen Voraussetzungen ist es fr den Autor schlechterdings unmglich, mit
einem Hegelianischen Instrumentarium in der Praxis zurechtzukommen. Und so
stellt der Autor mit Befriedigung fest, da die HegeLsche Philosophie bei den
Erben,
dem praktischen Zuge unserer Tage folgend, sich entschlieen mute, den beschaulichen
Gleichmut ihres Meisters, der an den Dingen dieser Welt blo einen kontemplativen Anteil
nahm und der Philosophie die Fhigkeit fr praktische Schpfungen ausdrcklich
absprach, aufzugeben, um praktisch zu werden. Hat aber die Schule in ihren energischsten
und frischesten Vertretern den Ha gegen alle philosophische Weltverbesserungen abgetan,
und sicher nur zu ihrem Vorteil abgetan, so ist dies jedenfalls schon eine radikale nde-
rung.
Die Bestrebungen eines A. RUge sind fr den Autor schon solche, die jenseits des
Hegelianismus liegen, als dessen immanente eigene Negation. Praktisches Enga-
gement und Hegelei - so knnte man den Autor resmieren, schlieen einander
aus. Und die Lehre, die hier den Junghegelianern von auen gegeben wird, lautet:
Folgt nur dem Zug der Zeit, werdet praktisch, auch als Partei, aber dann werdet ihr
nichts besonderes und schon gar keine Hegelianer mehr sein.
361
Rckblickend auf die deutsche Journalistik im Jahr 1843 beschreibt W. H. Riehl
den Abklrungsproze des deutschen Liberalismus.
362
Herweghs Audienz beim
Knig ist fr ihn der Wendepunkt, mit dem die vernichtende Katastrophe
ber den gesamten deutschen Liberalismus hereinbricht. Wichtig ist seine Ein-
schtzung der staatlichen Repressionspolitik und der Position der Radikalen.
Wir mchten es brigens eben fr kein Zeichen politischen Scharfblickes halten, da es
unsere Staatsmnner fr ntig erachteten, jenen exzentrischen Liberalismus mit Gewalt aus-
zurotten, was doch noch zu feindseliger Erbitterung reizte, whrend die gefhrlich erfun-
dene Richtung, sich bereits zu berleben begonnen und einen groen Teil ihrer wrmsten
Anhnger verloren hatte. Die Ministerien htten den Liberalismus nicht ausgerottet,
nein!, sie haben ihn gekrftigt, gelutert, sie haben wesentlich dazu beigetragen, das fr-
here, in der Luft schwebende Gebude niederzureien, so da wir nachgehends die Funda-
229
mente eines neuen Hauses auf festen Grund zu legen vermochten. (. . . ) Die Richtung (der
Radikalen, d. V.) hatte sich berlebt, darum vermochte sie den Angriffen von auen keinen
gengenden Widerstand entgegenzusetzen.
363
Riehl beruft sich dabei auf Ruges Selbstkritik des Liberalismus; dieser hatte
1843 geschrieben, da alles Philosophieren und alle Systeme ohne praktische
Anwendung gar keinen Wert htten, mithin auch eigentlich keine wahre Philoso-
phie seien, und Riehl betont, da man vielmehr auf das Vorhandene in scharfer
Bestimmtheit eingehen msse, damit die materielle Basis des Volks erst stark
werde. Riehl geht es nicht um weite politisch-theoretische Konzeptionen, er stellt
fest, da der Deutsche Zoll- und Handelsverein, nicht von Philosophen erfunden
und verwirklicht, das finanzielle Gleichgewicht unter den Nationen einigermaen
wiederhergestellt habe und mehr als alle literarischen Diskussionen beigetragen zur
Erhebung des Gemeingeistes und Nationalgefhls. Im Mittelpunkt stnden nun
Fragen von Industrie, Landwirtschaft und Handel. Das Projekt einer deutschen
Flotte wird diskutiert, die Frage nach deutschen Kolonien aufgeworfen. Die Teil-
nahme des Publikums, durch die vorhergehende Periode des pikanten kosmopoli-
tischen Liberalismus einmal gereizt, aber auch endlich bersttigt, fand hier neue
Themen, der hchsten Aufmerksamkeit wert.
364
Auch die Tbinger Junghegelianer, die beharrlich am Konstitutionalismus
festhielten, unterscheiden sich in ihren Beurteilungen des Scheiterns der preui-
schen Radikalen nur geringfgig von den bisher dargestellten Kommentaren. 1844
schreibt A. Schwegler:
Die Partei der Deutschen Jahrbcher hat, es ist unleugbar, groe Fehler gemacht. Zuerst
in der Weise ihres politischen Theoretisierens. Sie haben die heilsame Wirkung, die sie
anfangs ausgebt, zum Teil dadurch wieder verscherzt, da sie die Brcke zwischen sich und
der einmal vorliegenden Wirklichkeit abbrachen, da sie, statt ihre politischen Ideen im
Bestehenden Wurzel fassen zu lassen, statt an die berlieferten Zustnde, die gegebenen
Interessen, die ffentlichen Vorurteile, sich pdagogisch zu akkomodieren, und damit auf
allgemeine Verstndigung, auf die Bildung einer wirklichen politischen Partei von prakti-
scher Bedeutung hinzuwirken, - so manches noch Bildungs- und Entwicklungsfhige in
Eine Verdammnis warfen mit dem Unfruchtbaren und Abgelebten, da sie am Faden
abstrakter Kategorien fortrechnend die konkreten Verhltnisse des gegebenen Staatslebens
aus dem Auge verloren.
365
Eine Ursache fr diese Entwicklung liegt fr Schwegler darin, da die junghege-
lianische Partei nach den enttuschten Hoffnungen auf den Thronwechsel sich nur
schwer von einer etatistischen Orientierung und vom Primat der Theorie gelst
habe. Die theoretische und etatistische Orientierung bersieht jedoch die langsa-
mere Zeitstruktur demokratischer Lernprozesse. Bis eine politische Idee zum
Vorurteil der Masse wird - und dies ist die erste Voraussetzung einer von unten aus-
gehenden staatlichen Reform - dauert es lang. Dies haben die Mnner der Jahrb-
cher so wenig begriffen, da sie dem Deutschen Volke zu seiner radikalen Besse-
rung nur einige Jahre Frist gaben.
366
Woran ist die junghegelianische Partei gescheitert? An der Miachtung der
sozialen und politischen Realitten und am berstrzten Intellektualismus ihrer
230
Debatten - so knnte man die Antworten der Zeitgenossen zusammenfassen. Es ist
dies eine Antwort, die sich bis heute auf allen Seiten wiederholt. Fr Th. Nipperdey
handelt es sich um ein hchst eigentmliches Phnomen, wie sich hier eine revolu-
tionre Intelligenz - ganz jenseits der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Zeit - mit
dem ungeheuren Anspruch etabliere, gesellschaftlich-politische Macht zu sein.
367
Und fr. die DDR-Forscherin I. Pepperle war es die Loslsung von einer tragen-
den gesellschaftlichen und politischen Schicht, die den Junghegelianern zum
Verhngnis werden sollte, die nicht auf neue Klassenpositionen vorstieen.
368
Solch breitem Konsens ist schwerlich etwas entgegenzusetzen. Allenfalls dies,
da er auffllig in seiner rhetorischen Dringlichkeit ist, mit der auf ein politisches
Realittsprinzip verwiesen wird. Die dramatische Ungeheuerlichkeit der Anspr-
che und das schlieliche Verhngnis, von dem die Urteile sprechen, sie gehren
aber auch zur Gattung der Tragdie, in der das politische Realittsprinzip als
Schicksalsmacht auftritt. Haben wir es hier mit Eigentmlichkeiten politischer Kul-
tur in Deutschland zu tun, in der das Scheitern der Zwecke und Realisationen nicht
wie in der Komdie mit schallendem Gelchter ertragen werden kann? Die junghe-
gelianische Partei wre dann auch an der Unmglichkeit eines deutschen Lust-
spiels gescheitert, ber das E. Bauer reflektiert hat: Du bist ein Schwrmer,
meint Ihr, du, der du ein politisches Lustspiel auf die deutsche Bhne bringen
willst.
369
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
III. Journalistische Boheme
Die Gruppendefinitionen der philosophischen Schule und der politischen Partei
sind fr die Junghegelianer berwiegend positiv besetzte Selbstdefinitionen gewe-
sen. Ihre Gruppenexistenz als journalistische Boheme und ebenso ihre Gruppen-
existenz als atheistische Sekte dagegen sind intern zu einem Teil umstritten. Es geht
nicht mehr um einen Streit, der die Profilierungsweise der Definition betrifft, son-
dern i m einen Streit, ob die Definition berhaupt zutrifft. Diesem Umstand trage
ich Rechnung, indem ich diese beiden Typen so bezeichne, da der mehr strittige
und der mehr unstrittige Aspekt zusammengezogen sind. So sehr die Junghegelia-
ner - wie ich im Kapitel IV zeigen werde - einen gemeinsamen Atheismus propagie-
ren wollen, so unsicher sind sie, ob sie den Begriff Sekte fr sich gelten lassen sollen.
Und so sehr die Gruppe versucht, ihre Existenz als Journalisten mit positiven Attri-
buten auszustatten, ber die Bohemeartigkeit ihrer Lebens- und Denkweise werden
sie sich zerstreiten. Mehr als bei den Gruppendefinitionen der philosophischen
Schule und der politischen Partei geht es bei der journalistischen Boheme und der
atheistischen Sekte um definitorische Bndelungen, deren Elemente widersprch-
lich erfahren werden.
bersicht
Die Widersprchlichkeit der Gruppendefinition einer journalistischen Boheme
fhre ich aus, indem ich mit der journalistischen Seite beginne und mit den bohe-
mehaften Zgen das Kapitel abschliee. - Die Bedeutung, die die Junghegelianer
der Presse zuweisen, wird zunchst von der Kritik der Brokratie her entfaltet, die
den junghegelianischen Journalisten als ein defizienter Modus der >Distribution
der Vernunft< erscheint (1). berlegungen zu allgemeineren Aspekten des Verhlt-
nisses von Pressefreiheit und Zensur fhren zu Grundproblemen des Projekts br-
gerlicher ffentlichkeit: Imperative der Kommunikation und Strategien zu ihrer
Begrenzung. Im berblick ber die preuische Zensurgeschichte wird der Hinter-
grund der junghegelianischen Debatten zur Pressefrage skizziert (2). Anhand der
>Kmpfe< der Gruppe mit dem Zensor wird deutlich, wie politisch-dezisionistische
Elemente von der Idee einer universellen Kommunikationsgemeinschaft verdrngt
werden. Wo Presse nicht im parlamentarischen Bereich verankert wird, erfolgt die
sichernde Selbstdefinition der Korrespondenten-Existenzen mit Hilfe geschichts-
philosophischer Spekulation (3). Sie kann zweifach eingesetzt werden. Am Beispiel
von M. He wird der Zusammenhang geschichtsphilosophischer Selbstvergewisse-
rung und der schwierigen Definition eines in den proletarischen Massen aufgel-
sten Intellektuellen entwickelt (4). Spiegelbildlich dazu steht B. Bauers Entwurf
eines Intellektuellen, der seiner vernnftigen Selbstvergewisserung in der
Geschichte nur in Frontstellung gegen die Masse und gegen soziale Zusammen-
hnge sicher sein kann (5). Sozial auftretend wird der einsame Kritiker nicht mehr
248
verstanden, und auf der Ebene der Gruppe liegt der Handlungstypus des >Skandal-
machens< nahe (6 a). Literarische Darstellungen des Auftretens der >Genies< ent-
halten typisierende Elemente, die zur Konturierung des Bildes einer Boheme bei-
tragen (6 b). In berlegungen zum Begriff >Boheme< wird ber die Errterung
sozialgeschichtlicher Zusammenhnge hinausgehend auf das Spannungsverhltnis
zwischen soziologischer Denkweise und dem Phnomen Boheme eingegangen
(6 c). Ihr Selbstverstndnis als Avantgarde bringt die Gruppe nicht nur in eine
>schiefe Stellung< gegenber den Zeitgenossen, auch untereinander grassiert der
Verdacht, ob das jeweilige Auftreten >frivol< oder >authentisch< ist (7). In der gro-
en Stadt wird eine kohrente geschichtsphilosophische Selbstvergewisserung der
Intellektuellen extrem problematisch. Das Projekt der >Distribution der Vernunft<
verluft sich mit den umherschweifenden Flaneuren, die ihre Langeweile vertrei-
ben mssen (8).
1. Beamtenkritik und Distribution der Vernunft
Schon fr die aus dem Staatsdienst entlassenen Philosophen, aber mehr noch fr
die gescheiterten Parteipolitiker stellt sich das Problem, nach Formen zu suchen,
die ihrer Existenz als purer blanker Mensch
1
einen sozialen Sinn verleihen knn-
ten. Der neue soziale Sinn, den sie entdecken, lt sich gut ausgehend von der The-
matik der Kritik der Brokratie entfalten, weil sich hier die Brche und die Konti-
nuitten im Selbstverstndnis der Gruppe prgnant darstellen.
Im Zusammenhang mit dem Versuch, sich als politische Partei zu konstituieren,
kommen die Junghegelianer auch zunehmend in Kontakt mit radikal-demokrati-
schen Emigrantenkreisen. Hier, etwa im Bund der Gechteten, ist eine radikale
Brokratiekritik weit verbreitet gewesen. Auch der Anteil der Hegelianer an der
preuischen Politik wurde von den Radikaldemokraten klar gesehen. So schreibt
z. BJ.Venedeyl839:
Die Politik Preuens besteht darin, dem redenden Teile des Volkes einen Anteil an der
Ausbeutung der groen Masse zu gestatten, und ihm so Schweigen als Pflicht der Selbst-
liebe, oder Lobeserhebungen als Mittel der Gewinnsucht aufzubrden. Eine Unmasse von
Beamtenstellen knpft den ganzen Gelehrtenstand in Preuen an das Interesse der Regie-
rung. Fr Venedey ist die preuische Verwaltung reine >Willkrherrschaft<. Die Beamten
sind besessen vom Geist der Kriecherei. Wie geschmeidig, wie willenlos ergeben und
kriechend dieselben gegen ihre Vorgesetzten sind, desto stolzer und hochtrabender sind sie
gegen das Volk. Die Beamten gelten als zweites stehendes Heer. Viele Tausende von
Beamten zehren in Preuen von dem Marke des Volkes.
2
Im Vergleich zu den lteren radikaldemokratischen Positionen, wie sie von
Venedey artikuliert werden, beginnt die junghegelianische Brokratiekritik sehr
bescheiden. 1839 nennt Rge im Zusammenhang der Diskussion um den Konstitu-
tionalismus den Beamten Streckfu einen
Zahn in dem groen Kammrade der Beamtenhierarchie, welches, auch nur leidlich gelt,
nicht knarrt, und in dieser sanften Rundbewegung die Weltbewegung, in seinem geregelten
Rundlauf das einzige Geistesbedrfnis der Zeit erblickt, in die Garantie dieser Zustnde also
die vollste Befriedigung des Geistes, d. h. eine gengende Freiheit setzt.
3
249
Und 1841 schreibt Rge ber die Zeit vor dem Thronwechsel:
so lag doch die Macht des Knigs nicht im Nationalem/ und dessen konstituierter freier
Entfaltung, sondern in der geheimen Beamtenhierarchie, die den Staatskrper verwaltet und
bewegt. (Die Beamtenhierarchie ist allerdings erst der geist- und willenlose Staatskrper.)
4
So sehr es richtig ist zu sagen, da die ltere radikaldemokratische Brokratiekri-
tik, die den despotischen Charakter der Verwaltung hervorhebt, zunehmend in der
junghegelianischen Argumentation an Raum gewinnt - es mu auf eine besondere
Frbung der junghegelianischen Beamtenkritik hingewiesen werden: Die Brokra-
tie ist nmlich nicht in erster Linie repressiv, sie ist wesentlich geistlos, und die
Geistlosigkeit der Brokratie ist die Wurzel aller ihrer sonstigen negativen Seiten.
Der Topos von der Geistlosigkeit der Brokratie meint: Die Brokratie ist dys-
funktional, weil sie nicht in der Lage ist, das Bedrfnis nach Rationalitt bei den
Gesellschaftsmitgliedern zu befriedigen. Die Laien da drauen sind viel zu neu-
gierig und nach Grnden durstig, als da sie nicht die geheimnisreichen Priester
der Staatsverwaltung, welche im Lapidarstil Geld und Leistung verlangen, hufig
belagern sollten, schreibt Nauwerck.
5
Es geht um ein Defizit an Vernunft.
Die RhZ przisiert das Problem: Warum nimmt die Arbeit der hheren Staatsbe-
amten auf eine erschreckende Weise berhand? Es ist nicht nur die Raschheit
eines jungendlich rstigen Knigs und die neue errungene Bildung des Volkes,
es ist nicht ein Kampf zwischen Volk und Regierung, sondern zwischen System
und System, zwischen einem System der brokratischen Zentralisation und
einem System der selbstndigen Mndigkeit, des freien Staatsbrgertums.
6
Die
Brokratie mu sich beschrnken, weil ihre Rationalitt nicht mehr glaubhaft ist.
Die Macht des Geistes hat einen Platzwechsel vollzogen. Jetzt mu der Beamte
E. Bauer zufolge die Unmacht seiner Geheimnisse anerkennen.
7
Auch fr Nau-
werck ist das Rationalittsdefizit der Brokratie kaum noch aufzuhalten:
Eine Menge Spezialfragen, welche der Antwort dringend bedrfen, haben schon das
uerlich glnzende Kartenhaus, welches sich die Bromenschen konstruiert hatten, umge-
strzt. Die Fragezeichen sind zwar nicht jedermann bequem; sie drcken Zweifel, Unruhe,
Verlangen, Ungestm aus. Aber desto heilsamer sind sie der Gesamtheit; ja sie sind schlech-
terdings notwendig. Ein Staat mu ebensogut, wie der einzelne Mensch; tagtglich sich fra-
gen und antworten; sonst wird aus beiden nichts.
Und Nauwerck setzt vorsichtig der defizienten Rationalitt der Brokratie eine
andere leistungsfhigere Rationalitt entgegen: Wie wrde erst gar das naturge-
treue Bild von Preuen ausfallen, wenn die Pressefreiheit es malte?
8
Wie kommt es zu dieser Profilierung der Beamtenkritik, bei der die radikalde-
mokratischen Topoi von einer Perspektive berlagert werden, derzufolge die Kri-
tik der Herrschaft hinter der Kritik des Rationalittsdefizits zurcktritt? Warum
erscheint gerade die Forderung nach Pressefreiheit als der privilegierte Gegenpol
zur preuischen Beamtenverwaltung?
In der Formel von der Geistlosigkeit der Brokratie schwingt noch die Erinne-
rung an eine andere Idee der Brokratie mit: die >geistvolle Brokratien Das heit
die Formel ist bezogen auf das Modell der >beamteten Intelligenz<, bei dem die Ver-
waltung der zentrale Mechanismus ist, durch den >Geist< in die sozialen Beziehun-
gen gebracht wird. Es ist die Distribution der Vernunft per Brokratie, die fr die
Junghegelianer defizient geworden ist.
250
Fr Koselleck liegt hier ein zentraler Aspekt der Entwicklung Preuens in der
Restaurationszeit im Vormrz. Auf den Topos von der >Macht des Geistes< bezogen
handelt es sich um
eine schleppende Geschichte des schwindenden Geistes. Genauer gesagt: Der Geist als
integrierendes Moment des preuischen Staates lie sich nicht administrativ austeilen. ( . . . )
Je mehr sich die Stndegesellschaft entgliederte, entzndeten sich mit den neuen Vereini-
gungsformen auch eine Flle geistig divergierender Krfte, deren Rckbindung an den Staat
keineswegs ber den Stand der Beamten erfolgte. Die Verwaltung wurde stattdessen auf
eine Funktion verwiesen, die ihr von Anfang an auch innewohnte, auf die Technizitt ihrer
Ttigkeit.
9
Die Junghegelianer steigen relativ spt und in spezifischer Weise in diesen Pro-
ze ein. Spt, weil sie im Vergleich zu den lteren liberalen Gruppen lange an das
Modell einer Geistdistribution per Brokratie fixiert sind, und in spezifischer
Weise, weil sie den liberalen Dualismus von Gesellschaft und Staat nicht akzeptie-
ren und dem Monismus der Verwaltungsrationalitt einen anders gelagerten
Monismus des Geistes entgegensetzen wollen. Der Geist der Verwaltung hatte sein
materielles Substrat in der Beamtenmaschine. Das Problem der Junghegelianerist,
ein materielles Substrat fr >Geist< ausfindig zu machen, das gleich weit entfernt ist
von der Hierarchie der Verwaltung und pragmatischen Zwngen der politischen
Partei.
Was ist die >Macht des Geistes< in den Hnden der >pur-blanken< Junghegelia-
ner? Zunchst ist es eine demonstrativ erklrte Siegesgewiheit. 1840 erklrt Rge:
Unterdessen steigt die Flut des unsichtbaren Geistes ber alle Dmme, Deiche und Nacht-
wchterposten, fliet ber das Land und quer durch die eigenen Kpfe der Schreier ohne
da sie es gewahr werden bis zu dem Augenblick, wo dieses Fluidum die ganze Welt neu
baut und nach sich gestaltet.
10
Die Figur eines unsichtbaren Geistes, der strker sei als der in der Administra-
tion sichtbar gewordene >Geist<, gehrt zu den Standardargumenten der Junghege-
lianer in dieser Frage. So heit es 1842 in den DJ:
Es bedarf aber keines scharfen Blickes, um zu gewahren, da in dem Staatskrper noch
andere Ttigkeiten und Krfte wirksam sind, die den rohen Mechanismus des Kriegswesens
und der Administration bei weitem berwiegen, unsichtbare Krfte, aber von der gewal-
tigsten Energie, die in der Stille, aber in immer gesteigerter Potenz fortwirken, und diese
geistigen Mchte lassen sich ebensowenig durch Regierungsdekret abschaffen, als ein-
fhren, sie bemchtigen sich des Staates auch gegen seinen Willen.
11
Aber wo kommen die geistigen Mchte zum Vorschein? Das Modell eines
Bndnisses von Schule und Staat ist zerfallen, und angesichts der Begrenzungen
des parteipolitischen Diskurses ist es zweifelhaft, ob diese Dmme die Flut
halten werden. Die Formen der Distribution der Vernunft mssen weiter gefat
werden. So heit es programmatisch bei B. Bauer:
wenn die Geschichte mit allen bisherigen philosophischen Arbeiten und mit aller Aufre-
gung, welche die Philosophie in den letzten beiden Jahrhunderten verursacht hat, kein
hheres Ziel im Auge hat, als die Stiftung einer >Kirche der Vernunftglubigen< oder einer
>Gemeinde der Wissenden^ so kann das Volk ruhig zusehen, da einige Auserwhlte sich
251
daran ergtzen, die Vermittlung, welche >das gttliche Lebern durchluft, in Gedanken zu
rekapitulieren. ( . . . ) Dann drften wir die Frage, ob die Resultate der Philosophie Gemein-
gut werden knnen, nicht nur nicht unbeantwortet lassen, dann ist es sogar gewi, da das
Volk und die gesamte Geschichte in die philosophische Bewegung hineingezogen, ber
ihren Sinn aufgeklrt werden und an ihrer Dialektik einen auerordentlichen Anteil nehmen
werden.
12
Die Vernunft bedarf einer sozialen und geschichtlichen Existenzform, die ihrem
Charakter gem ist. Ihre Existenz in einem exklusiven, aristokratischen Selbstbe-
wutsein ist auch fr Rge inadquat, sie mu gemeines Bewutsein der Welt
werden. Aber wie kann es geschehen, wo doch gilt: die geistigen Mchte sind
absolut, d. h. jede technisch-administrative Institutionalisierung wre ihnen
inadquat? Es ist hier ein Reich freier und souverner Mchte, in dem keine ande-
ren Aufseher und Kampfrichter entscheiden knnen als die freie Gewalt des Gei-
stes selbst. Fr diesen Vorgang gibt es daher nur eine einzige Mglichkeit der
>Institutionalisierung<: Dies der wahre Grund, auf dem die Vernnftigkeit und
schlielich Notwendigkeit der unbedingtesten Prefreiheit beruht.
Die freie Presse ist der alternative Modus der Distribution des Geistes, der an die
Stelle der geistlos gewordenen Brokratie treten soll. In der Presse entdecken die
Junghegelianer die soziale Form, die sowohl an ihre alte Definition als >beamtete
Intelligenz< anschliet, die aber zugleich im dramatischen Bruch mit der Brokratie
ein unendliches neues Terrain von Aktivitten bietet. Deutlich ist dieser Zusam-
menhang von Kontinuitt und Bruch von Buhl formuliert worden:
Die Presse unterzieht sich der Aufgabe, welche das Beamtentum zwar vorschtzt, der es
aber nicht gewachsen ist; sie ist wirklich, was das Beamtentum nur scheint, die Lehrerin und
Bildnerin der Vlker, die Verknderin der Freiheit, die Missionarin der Vernunft, welche
mit der Fackel der Wahrheit und der Kritik in die dumpfen Schlupfwinkel des Vorurteils
( . . . ) eindringt ( . . . ) ; sie ist zugleich die demokratische Macht, die jedem zugnglich ist,
jeden in ihren Reihen willkommen heit, aber auch ber jeden ihr Scherbengericht bt, die
keine Autoritt, keine Macht des Bestehenden, keine hhere Instanz anerkennt - also in
allen Stcken das Gegenteil des Beamtentums.
14
Es bleibt in diesem virtuosen bergang zwischen beiden Systemen der Distribu-
tion der Vernunft offen, wie mit jenem Widerspruch umgegangen werden kann,
da die Presse einmal das ist, was die Brokratie zu sein scheint, und die Presse
doch zugleich das Gegenteil der Brokratie sein soll.
Fr die Gruppe der Junghegelianer gibt es nicht nur einen bergang von der
philosophischen Schule zur polititschen Partei, sondern ebenso einen bergang
von der philosophischen Schule zum Journalismus. Und die >Absolutheit< der Ver-
nunft, kommt sie in der freien Presse nicht noch mehr zur Geltung als in der politi-
schen Partei, wo - sei es als dramaturgische Stilisierung, sei es als >gemeine< Taktik
- Diskursbegrenzungen unumgnglich sind? Aber auch Zweifel mssen ausge-
rumt werden: Gehrt die Philosophie berhaupt in die Zeitung? Diese Frage kann
man Marx zufolge nur beantworten, indem man sie kritisiert. Er besteht darauf:
Die Philosophie hat, ihrem Charakter gem, nie den ersten Schritt dazu getan,
das asketische Priestergewand mit der leichten Konventionstracht der Zeitungen
zu vertauschen. Die Philosophie sei gezwungen worden, ihr Schweigen zu bre-
chen, sie wurde Zeitungskorrespondent. Es gibt eine geheime Verwandtschaft
252
zwischen der Philosophie, den Fragen der Zeit und den Zeitungsfragen, eine
Verwandtschaft, die Verpflichtungsverhltnisse birgt: Weil jede wahre Philoso-
phie die geistige Quintessenz ihrer Zeit ist, mu die Zeit kommen, wo die Philoso-
phie nicht nur innerlich durch ihren Gehalt, sondern uerlich durch ihre Erschei-
nung mit der wirklichen Welt ihrer Zeit in Berhrung und Wechselwirkung tritt.
15
Diese uerliche Seite ist nun nicht mehr die Verwaltung, sondern die Presse. Im
ersten System >war< die Zeit gekommen, von der Marx spricht, im zweiten System
>mu< die Zeit kommen. Diese Zeitdifferenz markiert ein geschichtsphilosophi-
sches Problem, das in den Komplex der Distribution der Vernunft eingelassen ist.
Was die Junghegelianer, wo sie sich als eine Gruppe von Journalisten definieren,
betreiben, ist zunchst eine heute kaum nachvollziehbare Befrachtung der Presse-
frage mit dem gesamten Erbe des philosophischen Diskurses. Was ist die Presse?
fragt Rge. Sie ist nichts weniger als das Reden des allgemeinen Geistes mit sich
selbst.
Wir haben in der Presse nicht die Rede des Einzelnen an den Einzelnen, nicht die Bespre-
chung von Privaten und solchen, die im Verborgenen ihren zu verbergenden Gedankengang
verfolgen; wir haben in ihr den ffentlichen Ausdruck des Gesamtdenkens, und was das
wahre Denken sein soll, das wirklich Allgemeine, die explizierte und sich selbst durchsich-
tige menschliche Gattung, das ist die Presse reell. - Sie ist also das Element des Allgemei-
nen, der Ort, wo die Gattung sich selbst objektiviert.
16
Es ist dies eine khne Umdeutung des Hegeischen Begriffs der Einen Philoso-
phie, die immer geherrscht habe und die Ausdruck des wahren Denkens sei. Fr
die Hegeische Philosophie selbst mag dies vorstellbar sein, aber Presse ist nur denk-
bar als ein Ensemble der vielen Stimmen. Wie kann sich in diesem Chaos der ffent-
lichen Meinung - Hegels verchtliche Worte darber seien in Erinnerung gerufen
-, wie kann sich hier das wahre Denken berhaupt darstellen? Noch schwieriger
wird die Situation, wenn man sich Hegels Staatsbegriff, den objektiven Geist als
Presse denken will.
Rge lst dieses Problem, indem er zunchst eine Gerichtsinstanz einfhrt.
Allerdings machen erst die vielen Stimmen diese Eine Stimmung; aber indem sie dies tun,
bleiben sie nicht die einzelnen, zuflligen Schreier, vielmehr entscheidet das Gericht der
ffentlichkeit und das sich erklrende Zeitbewutsein ber die Achtbarkeit oder Vercnt-
lichkeit der einzelnen. Wer den Proze der Geschichte wesentlich zu bestimmen die Kraft
hat, ist nicht zu verachten; fr was er aber zu achten sei, das lehrt die Zeit.
17
Man stelle sich diese Konstruktion als Selbstbild einer Gruppe von Journalisten
vor! Die wichtigen Standards, die ihrem Verhalten Sicherheit geben knnten, sind
konzentriert im Gericht der ffentlichkeit, das, obwohl sie als Journalisten an
diesem Gericht partizipieren, ebenso kontingent ist wie die >Lehren der Zeit< es
sind. Und man darf bei dem Gericht, das Rge im Auge hat, getrost an das Jng-
ste Gericht denken, dem das Bild sich verdankt.
18
Um wieviel greifbarer sind im
Vergleich dazu die Standards der Schule oder der Partei gewesen! Die Gefahr, ein
zuflliger Schreier zu bleiben oder zu werden, wie knnte sie zu bannen sein?
Rge kennt seine junghegelianischen Journalistenkollegen und ihre Not, die
wahre Philosophie im vielstimmigen Chor der Presse zur Geltung zu bringen.
253
Die Eitelkeit, ein besseres Wort, als das geltende, sagen zu knnen, sobald man es nur der
Mhe Wert hielte, - eine sehr gewhnliche Erscheinung - beruht daher auf dem Irrtume,
die bloe Mglichkeit ebenso hoch und sogar hher anzuschlagen, als die Wirklichkeit, oder
das zufllige Subjekt, wie es unmittelbar sich findet, ber das historische Subjekt zu setzen.
19
In der Figur des historischen Subjekts knnte eine Gestalt gedacht werden, die
verhindert, da der philosophische Zeitungskorrespondent mit seinem wahren
Denken am Gericht der ffentlichen Presse scheitert.
Aber widerspricht nicht das historische Subjekt mit seinen Privilegien der
Demokratie der Vielen, die doch gerade den Kern der freien Presse ausmacht? So
mu denn das historische Subjekt wiederum gezgelt werden:
Freilich ist die Vernunft republikanisch; sie macht das historische Subjekt, aber das histori-
sche Subjekt ist nicht der Zweck. Alle Subjekte und ihr Zusammenwirken zu der Vernunft der
Gattung sind der Zweck; das historische Subjekt hat nur die Ehre, hervorstechendes Mittel
zu diesem Zweck zu sein; ein hervorstechendes Mittel der Vernunftrealisierung knnen aber
nicht die Vielen und nicht Jeder, der sich gescheit dnkt, sein. Die eitlen Subjekte verken-
nen, da es auch darum sich gar nicht handelt. Der Zweck ist ja der republikanische, da das
Organ der Gattung die Funktion ihrer Selbstverwirklichung ausbe, nicht der persnliche,
da einzelne Subjekte hervorstechen und historische Ehren empfangen, weshalb denn auch
der wahre Stolz der freien Menschen darin besteht, da er fortdauernd sich als Tribunen
jenes republikanischen Gemeinsinns betrachtet und das historische Subjekt in seiner allge-
meinen Bedeutung (aber auch nur in dieser) neidlos anerkennt.
20
Eine prekre Argumentation, die deutlich macht, wie schwer es fr die Junghe-
gelianer ist, das am Beamtenstaat gebildete Modell einer Distribution der Vernunft
auf die Presse umzumnzen.
Intentional historisches Subjekt sein zu wollen, diese Rolle anzustreben, unter-
sagt Rge seinen Korrespondenten ebenso wie Calvin in seiner Prdestinations-
lehre die Glubigen im Ungewissen lie, ob sie von Gott angenommen oder ver-
worfen sind. Der Zweck ist nur republikanisch, das historische Subjekt bleibt
ebenso denknotwendig wie verborgen. Wie anders sollte die Alternative entschie-
den werden, die im System der Distribution der Vernunft durch die Presse enthal-
ten ist: Geht nun Wahrheit von allen Kpfen aus? Oder haben einige Kpfe das
Vorrecht, untrgliche Wahrheitsspender zu sein? Ohne Geschichtsphilosophie,
die ber einen mglichen Ausgang des ffentlichen Gerichts spekuliert, werden
diese Nauwerckschen Fragen nicht zu beantworten sein.
21
Eine erste Annherung an diesen Komplex stellt Ruges spekulative Konstruktion
einer stufenweisen Entwicklung der Formen, worin die Vernunft der Gattung
ausgesprochen und vernommen wird, dar. Die gesprochene Sprache ist die erste
Stufe, und die Freiheit der Sprache bildet quasi die erste Pressefreiheit, die
jedoch durch Ortsgebundenheit und Dialekt beschrnkt wird. Auf der Stufe der
Schrift beginnt Geschichte, Gesetz und Geistesbildung, man wei, da Sprache
und Schrift unmittelbar freie Elemente der Selbstverstndigung der menschlichen
Gattung sind, man kennt den Mibrauch der Schrift und das Problem der
Schreibfreiheit. Entscheidend ist:
die Schrift fhrt schon eine Entwicklung des Geistes in seinem eignen Elemente, eine ber-
wltigung seiner selbstgesetzten Schranken herbei. Sie schafft in ihm ein Material, worin er
sich selbst sicher vor Augen hat und das erreicht, da er durch die Bildung desselben nur
254
sich selbst bildet: die Knste, die Wissenschaften, die Staatsverfassungen in den gesetzlich
fixierten Bestimmungen sind dies Material und dieser Gegenstand, der selbst Geist ist.
22
Von der letzten Stufe schlielich heit es:
Aber erst die Form der Presse gibt dies Material in die Gewalt Aller und dehnt den Ort, das
Element des Gesamtbewutseins, oder der Selbstverstndigung der Gattung, aus fr den
Staat ber Ortschaft und Stadt, fr Kunst und Wissenschaft ber den Kreis weniger Bevor-
zugter und Begterter hinaus. Die Quantitt ndert hier wesentlich die Qualitt. Zur Her-
vorbringung des wahrhaft Menschlichen ist der ganze Kreis der wahrhaft zu humanisieren-
den Menschheit ntig.
Gerade durch die Fixierung und Reproduktion von Gedanken und Informatio-
nen in der Presse ist die Selbstverstndigung des Geistes im Mastab der empiri-
schen Gattung selbst mglich geworden. Durch das Herbeiziehen der grten
Versammlung mitttiger Menschen ist nun aber in der Tat ein hheres Element und
ein vergeistigter Ort fr die allgemeinen Angelegenheiten errungen; weshalb denn
auch die Literaturbewegung den republikanischen Zweck und den Ostracismus
sogar in sich selbst gesichert hat. Diese Stufe der Entwicklung verndert auch das
Verhltnis von Bchern und Zeitungen. Zeitungen schreiben die Vlker, und
lebendige Menschen mit ihrem besten Herzblut sind ihre Lettern; Bcher schreiben
die einzelnen. Sklaven haben sie geschrieben, Sklaven knnen sie auch heut noch
schreiben. Nur sehr wenige Bcher knnen Keime der Zukunft enthalten, Zei-
tungen sind die Zeit selbst.
23
Die Auseinandersetzungen um die Presse und Pressefreiheit machen einen
Hauptteil der junghegelianischen Publizistik aus. Allein die >Rheinische Zeitung<
hat in den fnfzehn Monaten ihres Bestehens in ber dreihundert Beitrgen Presse-
fragen errtert. Die Pressefreiheit gilt schlechthin als die eigentliche Lebensfrage
der Epoche.
24
Das Phnomen Presse bedeutet in dieser Zeit eine neue soziale
Erfahrung. Es ist eine nicht alltgliche Erfahrung, der Einbruch schwindelerregen-
der Mglichkeiten der Kommunikation. Wie dem begegnen? Nauwerck schreibt:
Die Stunde, in der man Zeitungen liest oder fr sie schreibt, ist (. . . ) eine von denen, in wel-
chen wir uns in das Objektive tauchen und der privaten Beengtheit entrckt mit dem ganzen
Menschengeschlechte der Gegenwart in magnetische Berhrung, in die vertrauteste
Gemeinschaft treten. Man knnte sich, wollte man ein briges tun, zu dieser Stunde
schmcken, wie der Spartaner vor der Schlacht, oder die Hnde waschen, wie der Muhame-
daner zum Gebet.
25
2. Pressefreiheit und Zensur
Der Kampf der Junghegelianer fr die Pressefreiheit findet in einem Zeitraum statt,
der am Ende des grundlegenden Auseinandersetzungsprozesses zwischen staatli-
cher Zensur und brgerlicher ffentlichkeit steht. 1848 geht in Deutschland eine
Zensurtradition zuende, die 350 Jahre lang bestimmend gewesen ist.
26
Historisch gesehen entstammt die Praxis der Zensur dem kirchlichen Bereich.
Mit ihr sollte die Orthodoxie der Lehre gegen hretische Abweichungen gesichert
werden. Um 1500 wird die Frage von Zensur und Pressefreiheit zu einem akuten
255
Problem, als mit der Entwicklung der Drucktechnik die Zahl der gedruckten
Schriften und Flugbltter sprunghaft ansteigt und zugleich den kirchlichen und
weltlichen Autoritten im Gefolge von Reformation und Religionskriegen die Kon-
trolle ber das publizierte Wort zu entgleiten droht. 1515 wird durch die ppstliche
Bulle Leo's X. die Prventivzensur systematisch eingefhrt, und 1529 beschliet
der Reichstagsabschied von Speyer die erste staatliche Zensurverordnung, mit der
das kirchliche Verfahren in die weltliche Gesetzgebung eingeht. Prventivzensur
meint, da alle zum Druck bestimmten Schriften zuvor der Obrigkeit bzw. legiti-
mierten Personen vorgelegt werden mssen, um das >Imprimatur< zu erhalten. Im
wesentlichen hatte dieses System in Deutschland bis 1848 Geltung.
ber den Gegenpol der Zensur, die Pressefreiheit, ist naturgem viel geschrie-
ben worden. Sie gehrt zusammen mit der Meinungsfreiheit zu den ehrwrdigsten
Gtern der demokratischen Traditionen Europas. Fr den Staatsrechtslehrer Rid-
der legen sich Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Lehrfreiheit, Pressefreiheit in
ihrem Verhltnis zur Gedankenfreiheit als konzentrische Ringe um die als Mittel-
punkt zu denkende subjektive Geistesfreiheit.
27
Und man kann die Geschichte des
Kampfes gegen Zensur gut in die Geschichte des brgerlichen Freiheitsstrebens
einbetten.
Darber darf jedoch nicht die soziologische Erkenntnis vergessen werden, da
keine Gesellschaftsform - auch diejenige nicht, die sich in ihren Normen dem br-
gerlichen Freiheitsbegriff verschrieben hat eine nicht reglementierte, >freie<
Weise des publizierten Ausdrucks erlaubt. Und so sehr man auch von einer
Anthropologie der Neugier ausgehend in der Befriedigung des sozialen Bedrf-
nisses nach Information fr den modernen Menschen eine Lebensnotwendig-
keit sehen kann, wie dies R. Clausse tut, es bleiben Restbereiche von Einschrn-
kungen bestehen: Aber wenn es auch wahr sein sollte, da alles allen gesagt wer-
den mu, so drfen dabei doch nicht gewisse legitime Grenzen auer acht gelassen
werden. Die Grenzen, die Clausse auffhrt, beziehen sich auf die Rechte der Per-
son, auf die Sicherheit des Staates und auf die relative Empfindlichkeit des Publi-
kums.
28
Was Clausse auffhrt, sind moderne Fortentwicklungen der klassischen Indizie-
rungsgrnde der absolutistischen Zensur. Im Kern geht es um drei Bereiche: 1. die
Staatsrcksichten (und mit ihnen hngt auch der Ehrenschutz historisch eng
zusammen), 2. die >guten Sitten< und 3. der staatliche Glaubensschutz. Sicher kann
man mit U. Otto sagen, da im Proze der Lsung der Zensurmanahmen von
konfessionellen Motiven und Hintergrnden der Problembereich Staatsraison
in den Vordergrund rckt und da das glaubensmige Moment dagegen oft zum
reinen Requisit erstarrt. Unter allgemeinerer Perspektive kann man jedoch
Schneider darin zustimmen, da die Bereiche Glaube und religises Gefhl,
Moral und Sittlichkeit, Ehre, Staatsrcksichten bzw. Staatsgeheimnisse ( . . . ) auch
heute noch die Themen fr die Diskussion um die Kommunikationsfreiheit (dar-
stellen). Sie sind keine Tagesfragen, sondern Grundsatzfragen, die sich an
bestimmten Fllen stets neu aktualisieren und variieren.
30
Die erstaunlich hohe Konstanz der Indizierungsgrnde ber einen langen Zeit-
raum hinweg verweist auf bergreifende kulturelle Deutungsmuster. Zu den gro-
en Mythen der europischen Kultur gehrt Foucault zufolge:
256
Dem monopolisierten und geheimen Wissen der orientalischen Tyrannei setzt Europa die
universale Kommunikation der Erkenntnis, den unbegrenzten und freien Austausch der
Diskurse entgegen. Doch hlt dieser Gedanke einer Prfung nicht stand. Der Austausch
und die Kommunikation sind positive Figuren innerhalb komplexer Systeme der Einschrn-
kung; und sie knnen nicht unabhngig von diesen funktionieren.
31
Auszugehen ist von Verschrnkungen, die den kulturellen Imperativ der Kom-
munikation in Begrenzungen einlassen, aus denen er seine Kraft beziehen kann.
Neben der universalen Kommunikation stehen immer auch die Schatten wuchern-
der Miverstndnisse. Wo Botschaften frei ausgetauscht werden, gibt es keine
Garantie fr gelingendes Verstehen. Zensur, wo sie sich legitimiert, zielt auf eine
Begrenzung von Kommunikationsunfllen, die unertrgliche >Verletzungen< verur-
sachen knnten.
Fr die Gruppe der Junghegelianer stellt die preuische Zensurgeschichte den
kleinlichen Rahmen dar, in dem sie ihre Definition der groen Mission der Presse
vollziehen. Einige Grundzge dieser Zensurgeschichte seien hier aufgefhrt, um
das Feld abzustecken, in dem sich die Debatten der Gruppe bewegen.
32
Der berhmte Ausspruch des aufgeklrten Friedrich II. von den nicht zu genie-
renden Gazetten kann bekanntlich nicht fr die Zensurpolitik unter dem >Philo-
sophenknig< stehen, bezog sich dieser Ausspruch ohnehin nur auf die Lokalbe-
richterstattung des Berliner Buchhndlers Haude. 1743 wurde dies Privileg wieder
zurckgenommen, weil gedruckte Falschmeldungen auswrtigen Puissancen so
empfindlich als anstig sein knnen. Zu solchen Staatsrcksichten kommen
im Zensuredikt von 1749 Religionsschutz und gute Sitten als Zensurgrnde fr
die wieder hergestellte Prventivzensur. Dafr, da die Aufklrung selbst keinen
Schaden nimmt, wurde durch Bestimmungen Sorge getragen, denen zufolge die
Schriften der kniglichen Akademie der Wissenschaften generell von der Zensur
ausgenommen wurden und Universittsschriften nur einer selbstverantworteten
Fakulttszensur unterlagen. 1788 wurde die Zensur unter dem Eindruck der Revo-
lutions-Prognosen durch das bermte Wllnersche Zensuredikt erheblich ver-
schrft (die Untersuchung der Wahrheit mute eine anstndige, ernsthafte und
bescheidene sein); whrend der Revolutionszeit mute der Zeitungszensor Renf-
ner so viele berstunden machen, da die Berliner Zeitungsverleger ihrem Zensor
ein jhrliches 100-Taler-Honorar extra bewilligten; unter napoleonischer Herr-
schaft und in den Befreiungskriegen brach das preuische Zensursystem schlie-
lich zusammen.
Die Entstehung eines selbstndigen politischen Journalismus in Deutschland ist
eng mit der Revolutionszeit und den Befreiungskriegen verbunden. Fr die deut-
schen Jacobiner wie fr den >Rheinischen Merkur< von Josef Grres gehrt Presse-
freiheit zu den zentralen politischen Forderungen. Im Kern sind hier bereits alle
Argumentationsfiguren ausgebildet, die bis 1848 immer wieder vorgebracht wer-
den. Aber die Reformversuche Hardenbergs, die Zensur zugunsten eines Pressege-
setzes aufzuheben, kommen zu spt. Die von ihm initiierte Reformkommission
beschlo zwar einstimmig die Prventivzensur als Ausnahme von der als Regel gel-
tenden Pressefreiheit, aber einen Monat zuvor war schon das preuische Zensurge-
setz vom 19. Okt. 1819 erlassen, mit dem die Karlsbader Beschlsse des Bundes auf
Preuen bertragen wurden.
257
Hatten die Karlsbader Beschlsse immerhin noch fr Schriften ber 20 Bogen
Umfang eine Zensurfreiheit als mglich statuiert, unterlagen jetzt in Preuen unter-
schiedslos alle Publikationen der Zensur. Selbst die von Wllner nicht angetastete
Zensurfreiheit der Kniglichen Akademie und die universitre Selbstzensur wur-
den aufgehoben. Der Karlsbader >20 Bogenfreiheit< lag die Kalkulation zugrunde,
da das einfache Publikum weniger zu umfnglichen Schriften greifen wrde. Die
zensurtechnische Unterscheidung von Volksschrift und gelehrter Literatur ist Aus-
druck der dilematischen Situation, >Lesenutzen< und >Leseschaden< berhaupt
kontrollierbar zu machen. Sie findet sich schon im Edikt von Friedrich dem Gro-
en, und sie wird auch in der Reformzeit nicht aufgegeben, wie die Denkschrift von
Raumer 1817 zeigt.
33
Die generelle preuische Zensur von 1819 ruft zunchst den Widerstand der
Kniglichen Akademie hervor. Der Philologe F. A. Wolff fordert seine Kollegen
auf, ffentlich zu erklren: Binnen fnf Jahren, solange das Zensurgesetz bestehe,
nichts drucken zu lassen!
34
Dieser >Wissenschaftlerstreik< kommt nicht zustande,
die Akademie erreicht 1820 durch ein Gesuch, da wenigstens die Akademieschrif-
ten zensurfrei seien; was sie dagegen als einzelne publizierten, fiel ebenso unter das
neue Gesetz wie die brigen Universittsschriften. Das preuische Zensurgesetz
bestimmte, da praktisch jedes gedruckte Stck Papier vom Aktienformular bis
zum Buch der Vorzensur unterworfen werden mute. Das eingerichtete Oberzen-
surkollegium war hier kaum in der Lage, fr die vage gefaten gesetzlichen Indizie-
rungsgrnde przise Ausfhrungsbestimmungen zu geben. So lag die Zensur prak-
tisch in den Hnden der unteren Stellen, wobei es nicht ausbleiben konnte, da gra-
vierende regionale Differenzen auftraten. Was ein Zensor verbot, erlaubte ein
anderer. Dieses Zensursystem wurde in Preuen ber zwanzig Jahre praktiziert
und durch Verschrfungen den politischen Bewegungen angepat. 1824, mit den
auslaufenden, aber sogleich auf unbestimmte Zeit verlngerten Karlsbader
Beschlssen, wurde in Preuen nicht nur wie 1788 eine bescheidene Errterung
religiser Fragen gefordert, sondern jede lieblose Untersuchung verboten. Die
Bundesversammlung tat ein briges, sie mahnte 1830,1831 und 1832 mehrfach zur
strengen Anwendung der Zensur. Die Mahnungen finden nach dem Frankfurter
Revolutionsversuch von 1834 im geheimen Schluprotokoll der Wiener Minister-
konferenzen ihren Hhepunkt in der Forderung, nicht nur keine Zensurlcken
zu dulden, sondern berhaupt die bermige Anzahl politischer Tagesbltter
zu vermindern.
33
Gerchte ber eine Lockerung der Zensur tauchen seit 1838 auf. So berichtet die
Leipziger Buchhndlerzeitung ber die Vorbereitung eines preuischen Pressege-
setzes.
Wenn man Gerchten glauben soll, so wrden durch dasselbe die bekannten Karlsbader
Beschlsse annuliert werden, und die Pressefreiheit bei allen wissenschaftlichen Werken,
deren Durchsicht dem Senate der Universitten anheim gestellt wrde, ausgesprochen sein.
Ebenso sollen Werke jeder Art ber 20 Bogen der Zensur nicht bedrfen, und nur die
Tagesliteratur eine eigentliche, aber gemilderte Beaufsichtigung erfahren.
36
Ein knappes Jahr spter wei ein Berliner Korrespondent dieser Zeitung zu
berichten: Unsere Zensur ist seit einiger Zeit merklich nachsichtiger geworden;
sowohl ber politische, als ber rein literarische Gegenstnde gibt sich in hiesigen
258
und in Provinzblttern eine Freiheit der Besprechung kund, wie sie seit dem Jahre
1829 nicht vorgekommen.
37
Der neue Knig Friedrich Wilhelm IV., vom Ideal eines romantischen Volksk-
nigs geleitet, hoffte, durch eine Zensurlockerung die Sympathie seiner Untertanen
zu gewinnen. Mit seiner Zensurinstruktion vom 24. 12. 1841 verfgte er eine mil-
dere Ausbung der Zensur, und er ermunterte geradezu die freimtige Bespre-
chung vaterlndischer Angelegenheiten, insofern sie wohlmeinend und anstndig
sei.
38
Dies Weihnachtsgeschenk lste bei den Zeitgenossen groe Verblffung
aus. Neben der begeisterten Zustimmung liefen sogleich Gerchte um, da die
Zensoren im geheimen mit Instruktionen entgegengesetzten Inhalts versehen wor-
den seien
39
. In den nchsten Monaten kam es jedoch in der Tat zu einer fr Preu-
en ungewohnt milden Zensurpraxis. Am 28. 5. 1842 wurde die Zensurfreiheit fr
Bilder eingefhrt, was eine Flut von Karikaturen zur Folge hatte, die um so aggres-
siver sich gestalteten, als die Bildunterschrift weiterhin der Zensur unterlag. Am
4. 10. 1842 schlielich wurde in Preuen die Zensurfreiheit ber 20 Bogen einge-
fhrt. Die Rheinische Zeitung kommentiert dies mit dem Distichon:
Willst Du frei sein, so schwitz' ber zwanzig Bogen zu schreiben,
Neunzehn, da wirst Du zensiert wie ein unmndiges Kind.
40
Und R. Prutz verffentlicht dazu in der Schweiz das Gedicht Preuens freie
Presse:
Zwanzig Bogen, zwanzig Bogen!
Nun gereckt und nun gezogen,
An den Federn nun gesogen,
Bis die zwanzig Bogen voll!
Ja zumal in diesen Tagen,
Wo die dampfbeschwingten Wagen
Sausend durch die Lnder jagen,
Und es doch an Zeit gebricht:
Zwanzig Bogen welche Menge!
Zwanzig Bogen - welche Lnge!
Zwanzig Bogen liest man nicht.
41
Dennoch reichten die wenigen Monate gemilderter Zensur aus, um einen Vorge-
schmack zu geben, was ffentliche Meinung sein knnte. Der Knig gab dieser
Tendenz noch Nahrung, wenn er dazu berging, unter offenem Himmel Reden an
tausendkpfige Massen zu richten.
Aber seine Vorstellungen gingen in eine ganz andere Richtung als die derer, die
Pressefreiheit forderten. Koselleck weist darauf hin, da die Zensurlockerung
weniger liberal (war), als sie schien und zunchst verstanden wurde; sie suchte der
Presse, statt sie wie bisher zu verbieten oder kurz zu halten, eine Richtung zu wei-
sen, die sie - in ihrer parteilichen Streuung - gar nicht einschlagen konnte.
42
Der
versuchte bergang von der absolutistischen Zensur zur aktiven Gesinnungssteue-
rung durch die Regierung scheiterte. Eine Distribution des >rechten Geistes< war-
modern gesprochen - nicht mehr glaubwrdig, weil der >Staatsapparat< zuneh-
mend blo technisch-administrativ wahrgenommen wurde. Gesinnungen waren
auch nicht durch die angestrengteste Verwaltungsttigkeit zu erzeugen. Die freige-
259
lassene ffentlichkeit diskutierte in eine andere Richtung, und die Kabinettsorder
vom 12. 10. 1842 leitete bereits die Kehrtwendung ein.
Den Oberprsidenten wurde es zur Pflicht gemacht, den schlechten Teil der
Presse zu zgeln und deren Ausartung vorzubeugen.
43
Die Zensurinstruktion des
Knigs vom 31.1. 1843 bndelt exemplarisch die Dilemmata der preuischen Zen-
surpolitik. Der Knig erklrte: die meisten Zensoren htten seine frheren Befehle
gnzlich miverstanden und durch ungeschickte Behandlung die Sache vllig verfehlt
(. . .). Was Ich durch die genannten Verordnungen (vom Januar 1843, d. V.) gewollt, das
will Ich unvernderlich noch: die Wissenschaft und die Literatur von jeder sie hemmenden
Fessel befreien und ihr dadurch den vollen Einflu auf das geistige Leben sichern, der ihrer
Natur und ihrer Wrde entspricht; der Tagespresse aber innerhalb des Gebietes, in wel-
chem sie auch Heilsames in reichem Mae wirken kann, wenn sie ihren wahren Beruf nicht
verkennt, alle zulssige Freiheit dazu gestatten. Was Ich nicht will, ist: die Auflsung der
Wissenschaft und Literatur in Zeitungsschreiberei, die Gleichstellung beider in Wrde und
Ansprchen, das bel schrankenloser Verbreitung verfhrerischer Irrtmer und verderbter
Theorien ber die heiligsten und ehrwrdigsten Angelegenheiten der Gesellschaft auf dem
leichtesten Wege und in der flchtigsten Form unter einer Klasse der Bevlkerung, welcher
diese Form lockender und Zeitungsbltter zugnglicher sind, als die Produkte ernstlicher
Prfung und grndlicher Wissenschaft.
44
Am 3. 2. 1843 wird die Bilderfreiheit zurckgenommen; am 24. 2. 1843 werden
die Zensurbehrden im Sinne der Januarinstruktionen reorganisiert.
Auffllig an der kniglichen Argumentation ist, wie stark schon brgerliche
Topoi wie der von der hemmenden Fessel Selbstverstndlichkeit geworden sind.
Die Abwehr der Auflsung der Wissenschaft und Literatur in Zeitungsschreibe-
rei bezieht sich zweifellos auf die Junghegelianer, die mit ihren bergangsformeln
von der Philosophie zum Leben zum entscheidenden Katalysator des deutschen
Pressewesens geworden waren.
45
Friedrich Wilhelms IV. Versuch, zu einer stn-
disch abgestuften Gesinnungsaktivierung zu gelangen, die nicht nur die Zensur -
technische Teilung in gelehrte Schriften und Volkslesestoff wiederholte, sondern
sie fr die Steuerung der Meinungen zur aktiven Loyalitt zu benutzen trachtete,
scheiterte.
Die weitgehend regierungstreue >Vossische Zeitung< hat denn auch Schwierig-
keiten, die Reaktionen einiger Zeitungen auf die Zensurinstruktionen zu deuten.
Manche Schriftsteller htten
sich jeder uerung der Teilnahme an den ffentlichen Angelegenheiten entzogen, sei es,
da ihre Meinung mit den gesetzlichen Vorschriften in zu grellem Widerspruche stand, um
sich mit der Zensur verstndigen zu knnen; oder sei es, da sie der Ansicht waren, unter
den gegenwrtigen Umstnden Ntzliches nicht mehr wirken zu knnen. Hier knne die
>Vossische Zeitung< nicht mitmachen: Wir werden uns also weder durch die Vorwrfe,
noch durch das bermtige Stillschweigen einzelner Journale irre machen lassen.
46
Die Formulierung vom bermtigen, d. h. hochmtigen Stillschweigen kenn-
zeichnet die Situation treffend. Unter absolutistischen Bedingungen ist Schweigen
kein gravierender Sachverhalt, erst wenn man von einer autoritativ hergestellten
Gesinnungsaktivierung, die sich beweisen mu, her denkt, bekommt die Formulie-
rung einen Sinn. F. Wehl lt sich die Paradoxien der Situation nicht entgehen,
wenn er schreibt:
260
Arme Vossische, ich bin neugierig, ob du das bermtige Stillschweigen demtig machen
wirst. Schwerer ist's, das ist sicher, als bei dem Reden. Schweigen hat auch eine Stimme und
es gibt manchmal sehr schlagende Antworten. Und das Schlimmste ist, es kann nicht zensiert
werden, es luft ohne Zensur durch die Welt. Es kann auch nicht verboten werden und die
Post kann seine Versendung nicht verhindern. Oh, das Schweigen ist oft die beredteste und
gefhrlichste Sprache der Welt!
47
Die Paradoxien dieser Formulierung verweisen auf jene Verschrnkungen zwi-
schen dem Imperativ der Kommunikation und der Begrenzung der Kommunika-
tionsunflle zurck, von denen ich oben gesprochen habe, und sie erinnern daran,
da der Proze der Durchsetzung der Pressefreiheit und des Prinzips, ffentlich
Widerspruch geltend zu machen,
48
weitaus komplexer ist, als es die Formel vom
Kampf brgerlichen Freiheitsstrebens gegen staatliche Repression suggeriert.
Koselleck hat in Kritik und Krise herausgearbeitet, wie die Konstitution br-
gerlicher ffentlichkeit mit der spezifischen Situation des Absolutismus verbun-
den ist. Aufklrung hat ihren Einsatzpunkt
in jener Lcke (...), die der absolutistische Staat ausgespart hat, um den Brgerkrieg ber-
haupt zu beenden. Die Notwendigkeit, einen dauerhaften Frieden herbeizufhren, veran-
lat den Staat, dem Individuum einen Binnenraum zu konzedieren, der die souverne Ent-
scheidung so wenig beeintrchtigt, da er vielmehr unabdingbar wird fr sie. Da der Bin-
nenraum politisch indifferent sein mu, ist konstitutiv fr den Staat, wenn er seine politische
Form wahren will.
49
Diese Konstruktion ist der Preis fr die Beendigung des religisen Brgerkriegs.
In den politisch unschuldigen privaten Innenrumen der Untertanen beginnt die
>freie< Kommunikation zu wuchern und zwar, gerade weil sie absichtlich aus dem
Staat ausgespart war, in geheimer Form. Der Mensch im geheimen ist frei; nur im
geheimen ist der Mensch Mensch. Der Mensch als Brger ist dem Souvern unter-
worfen; nur als Untertan ist der Mensch Brger.
50
So entspricht dem Arkanum der
moralisch neutralen Politik des Frsten das Arkanum der politisch neutralen Moral
des privaten >Gewissens< der Untertanen, die sich nicht-ffentlich als Gesellschaft
konstituieren.
>ffentlichkeit< und >Geheimnis< schlieen zunchst einander nicht aus, wie
man auf den ersten Blick meinen knnte, sie schlieen einander eher ein, indem
ffentlichkeit auf Rume verweist, in denen die Grenzziehungen zwischen dem,
was gesagt wird, und dem, was verschwiegen wird, sich berhaupt erst ausbilden
knnen.
51
Ruges Formulierung vom unsichtbaren Geist-eine Formulierung, die
nahe bei der Figur der unsichtbaren Kirche liegt, die uns in Kapitel IV beschfti-
gen wird - zielt auf diesen Zusammenhang, denn der unsichtbare Geist ist eben
das, was sich in der als Gattungsgeist interpretierten Presse ausdrckt. Und noch
1847 finden sich die Formeln der Konstitutionsphase brgerlicher ffentlichkeit
mit ihrer Verschrnkung von geheim/ffentlich in den Diskursen prsent. In dem
Bestreben, einen Staat der Freiheit und Gleichheit zu errichten, heben sich
J. Schmidt zufolge zwar die Differenzen der Religion und Nationalitt auf: Ver-
brdert dehnt sich die Partei der Freiheit ber alle Nationen aus. Aber was ist der
Grund dieser kommunikativen Transparenz? Ein jeder hat einen geheimen Ort
261
seines Herzens, in dem er sein Gttliches einschliet. Diese geheimen Orte wer-
den bleiben, solange es freie Menschen gibt.
52
Die Junghegelianer partizipieren in spezifischer Weise an den Verschrnkungen
des geheim/ffentlich, wo sie sich als Gruppe von Journalisten definieren. Einmal
setzten sie auf die unsichtbaren Krfte, die sich in den Rumen kommunikativen
Austausche offenbaren und die keine staatliche Institution zu kontrollieren vermag,
andererseits kommt fr sie das klassische Projekt einer Geheimgesellschaft nicht
mehr in Frage. Die Kritiken der Brder Bauer an Adam Weishaupt und den Illumi-
naten lassen in dieser Frage keine Zweifel aufkommen.
53
Aber der Bruch mit der
Geheimgesellschaft bringt eine Reihe von Folgeproblemen mit sich. Sie betreffen
einmal das Verhltnis des Binnenraums der Gesinnungen zu staatlichen Formen,
ein Folgeproblem, das sich im Vormrz um das Verhalten gegenber dem Zensor
kristallisiert, und sie betreffen zum anderen das geschichtsphilosophische Pro-
blem, das sich verschrft, wenn nicht mehr die strengen Gesetze freimaurerischer
Kooptation gelten sollen, sondern die Distribution der Vernunft sich unterschieds-
los an alle Gesellschaftsmitglieder richtet.
3. Der Zensor als Partner - Kommunikationsgemeinschaft
und Politik
Sie hat sich nicht durchgesetzt, die 1842 auftauchende Idee, den Bedrohlichkeiten
ungeregelter Distribution der Vernunft dadurch zu begegnen, da man die Zei-
tungsredakteure einem Staatsexamen unterwirft. Fr E. Bauer ist dieser Vorschlag
doch zu arg. Bei staatlichen Bildungsanstalten mag sich der Staat durch eine
Prfung der Tchtigkeit seiner Angestellten versichern. Aber ein Zeitungsredak-
teur ist kein Staatsbeamter, er steht an der Spitze einer Privatunternehmung. Und
berhaupt, was sollte der Inhalt der Staatsprfung sein? Historische, sprachliche
Kenntnisse? Ob der Redakteur solche hat, wird sich bald genug in seiner Zeitung
beurkunden. Und ist er unwissend, ist er unfhig, nun so wird sich sein Unterneh-
men nicht lange halten. Denn das Publikum ist in solchen Sachen der einzig legitime
Richter. Und auerdem lge die wichtigste Befhigung des Redakteurs in seiner
Gesinnung, d. h. in jenem staatlich kaum erreichbaren Arkanum, das sich zwar
offenbaren soll, aber gem einem >Soll< nicht-staatlicher Natur.
54
Im Vormrz ist
es bei der Dualitt von staatlicher Zensur und privatem Zeitungsredakteur geblie-
ben.
Der Zensor im Vormrz ist eine prominente Figur, die von den Zeitgenossen
unablssig diskutiert, kommentiert und karikiert wird. Dieser Sachverhalt bedeutet
nicht, da die Zensur einem Gipfelpunkt der Repression entgegengeschritten wre,
vielmehr rckt der Zensor in dem Mae ins Zentrum, wie seine Macht sich als br-
chig erweist und Lockerungen der Zensur sprbar werden." Wichtiges Indiz fr
diese Situation sind die zahllosen Zensuranekdoten, die mehr als alle frontale Kritik
geeignet gewesen sind, die Schwche der Zensurpraxis zu offenbaren. Es handelt
sich dabei um Anekdoten wie diese: Die Klner Zeitung brachte eine einfache
Annonce der gttlichen Komdie, bersetzt vom Prinzen Johann von Sachsen;
262
diese wurde mit dem Bemerken gestrichen, da man mit gttlichen Dingen keine
Komdie spielen drfe.
56
Die Pointe zielt auf die Dummheit des Zensors. Aber warum funktioniert die
Pointe? Warum darf ein Zensor bei Strafe des Gelchters nicht der Dummheit
berfhrt werden? Offensichtlich geht es um Fragen der Legitimation von Herr-
schaftsausbung. Wo es sich um Machtsprche auf dem Gebiete des Wissens han-
delt, macht sich die Herrschaft lcherlich, die die Standards des Wissens verletzt.
Die Legitimittskrise entsteht, weil der Zensor von der entscheidenden >Kraft-
quelle< der Herrschaftslegitimation abgekoppelt ist. Auch Zensur als Teil der Ver-
waltung bedeutet Herrschaft kraft Wissen. (M. Weber). Daher ist Zensur para-
doxerweise gerade fr jede >rationale< Herrschaft ein heikles Unternehmen.
Aber nicht nur von Seiten der Zensierten wird die Kompetenz des Zensors in
Frage gestellt, auch die Regierenden sind sich in diesem Punkt nicht ganz sicher. So
enthielt das preuische Zensurgesetz im 13 die Regelung, da der Schriftsteller
haftbar blieb, auch wenn es ihm gelungen war des Zensors Aufmerksamkeit zu
hintergehen (z. B. durch eingestreute strafwrdige Anspielungen oder Zweideutig-
keiten, deren beabsichtigter Sinn dem Zensor verborgen bleiben konnte).
57
Die
prsumptive Dummheit der Zensoren war damit gesetzlich festgeschrieben. Der
Zensor konnte sich aufgrund dieses Paragraphen immer noch auf seine mangelnde
Kenntnis oder auf stilistische Fallgruben berufen, denen er zum Opfer gefallen sei.
Die Schriftsteller reagierten auf diese Lage, indem sie einen ausgeklgelten Zen-
surstil entwickelten, der darauf abzielte, die Aufmerksamkeit des Zensors nachhal-
tig zu berlisten. Heine und Brne sind auf diesem Felde die unbestrittenen Sieger
geworden.
58
Fr die Junghegelianer ist nun das jungdeutsche Spiel mit dem Zensor
nicht mehr akzeptabel. Eine der vielen demoralisierenden Wirkungen der Zen-
sur ist fr He, da die Autoren aus der Not der Repression eine Tugend gemacht
htten, sie hielten am Ende die Konzessionen, die sie notgedrungen machen mu-
ten, fr eine freiwillige Tat. Jetzt gilt: wir halten es fr besser, ntzlicher und
ehrenhafter, zu schweigen - als mehr oder weniger gegen unsere berzeugung zu
schreiben.
59
Auffllig an der junghegelianischen Kritik der Zensur ist, wie sehr Zensor und
Publizist auf eine gleiche Ebene gezogen werden. Die Junghegelianer verstehen
sich latent als Konkurrenz zur Zensur. Konkurrenz in einem doppelten Sinne: sie
konkurrieren um die Aufgabe der Distribution des Geistes, und sie konkurrieren
um die Mastbe, nach denen der distributionsweite Geist bestimmt werden soll.
Die Konkurrenz macht sie in gewisser Weise zu Partnern einer Kommunikations-
gemeinschaft. Diese gleiche Ebene kann aber nur konstruiert werden, wenn die
politisch-dezisionistischen Elemente des Komplexes Zensur ausgeklammert wer-
den.
Angesichts des Verbots der DJ entwickelt Stirner eine Argumentation, in der er
Verbot und Zensur so geschickt gegeneinander ausspielt, da im Zeitungsverbot
sich gerade die Ohnmacht der Zensur erweisen mu. Zeitungsverbote zeigten,
da die Aufgabe der Zensur eine Unmglichkeit ist. Denn wenn eine Zeitung
wegen eines Textes verboten wird, warum hat die Zensur den Text dann berhaupt
passieren lassen?
263
Warum hat dann die Zensur dem Scharfsinn nicht den Scharfsinn, der Arbeit nicht die
Arbeit, der Pfiffigkeit nicht die Pfiffigkeit entgegengesetzt? Stirner gibt zu: jene Zeit-
schrift (die DJ, d. V.) entfernte sich immer weiter von dem Wege >der reinen Wissenschaft^
war leider immer praktischer, destruktiver, revolutionrer, unchristlicher. Gut! Wir sagen
immer wieder: Zensur, wir geben dich zu, wir rumen einmal ein, da du fr alle Interessen
des Lebens, fr alle Gter diesseits und jenseits, oben und unten, die hchste und absolut
notwendigste Macht bist. Macht? Nun, wer Macht hat, der ist mchtig. Warum hat die Zen-
sur jene Zeitschrift immer destruktiver, revolutionrer, praktischer, unchristlicher werden
lassen? Warum?
60
Das Verbot beweist, da die politisch-dezisionistischen Elemente erst im Verbot
selbst, aber nicht in der Zensur wirksam sein knnen. Wenn aber der Zensor so not-
wendigerweise >machtlos< ist, so bleibt fr ihn nur noch der Status eines Kommuni-
kationspartners.
Diese Kommunikationspartner werden herausgefordert, so z. B. von Marx,
wenn er fragt:
Lebt in Preuen eine solche Schar der Regierung bekannter Universalgenies - jede Stadt
hat wenigstens einen Zensor -, warum treten diese enzyklopdischen Kpfe nicht als
Schriftsteller auf? Besser als durch die Zensur knnte den Verwirrungen der Presse ein Ende
gemacht werden, wenn diese Beamten, bermchtig durch ihre Anzahl, mchtiger durch
ihre Wissenschaft und ihr Genie, auf einmal sich erhben und mit ihrem Gewicht jene elen-
den Schriftsteller erdrckten, (...). Warum schweigen diese gewiegten Mnner, die wie die
rmischen Gnse durch ihr Geschnatter das Kapitol retten knnten?
61
Der Zensor soll Teil der Kommunikationsgemeinschaft werden, weil seine
Handlungen sich strukturell nicht von denen der Schriftsteller unterscheiden. Zen-
sor und Publizist haben beide die Aufgabe der Distribution der Vernunft. Die Zen-
sur insgesamt wird de facto entpolitisiert und zu einem defizienten Kommunika-
tionsverhalten umgedeutet. Die Zensur ist die offizielle Kritik, ihre Normen sind
kritische Normen, die also am wenigsten der Kritik, mit der sie sich in ein Feld (!)
stellen, entzogen werden drfen. Der Zensor als Kommunikationspartner, der
sich verweigert, hat im Kern nicht mehr aufzubieten als seine Subjektivitt. Wir
sind auf die Temperamente des Zensors angewiesen. Es wre ebenso unrecht, dem
Zensor das Temperament, als dem Schriftsteller den Stil vorzuschreiben.
Auch fr Ludwig Buhl ist an eine Gleichartigkeit der Entscheidung, an eine
feste Norm derselben ( . . . ) auch unter den jetzigen Verhltnissen gar nicht zu den-
ken. Was hier dem einen Zensor ganz unschuldig erscheint, kann von dem anderen
verboten werden oder sagen wir lieber, wird verboten, ist verboten worden. Dieser
Sachverhalt kann aber gar nicht dem politischen Zensor angelastet werden, denn
seine Einwilligung oder Verweigerung ist Gewissenssache. Die Inhomogenitten
der Herrschaftsausbung bedeuten in dieser Perspektive: Also ein Zensor kann
einen anderen zensieren, und was der eine fr unverfnglich gehalten hat, fr
gefhrlich und belwollend erklren.
62
Zensoren untereinander und Zensoren
gemeinsam mit den Redakteuren stellen eine groe Kommunikationsgemeinschaft
dar, in der die privaten Gesinnungen sich austauschen.
Es ist nur konsequent, wenn Buhl in diese Kommunikationsgemeinschaft auch
noch den Monarchen selbst hineinzieht. Nicht die administrativen Verfgungen
zur Zensurlockerung seien die Hauptsache, weniger aus den positiven Bestim-
264
mungen der Zensurverfgung, als aus der darin ausgesprochenen Kniglichen
Gesinnung ergbe sich Anerkennenswertes. In der Kommunikationsgemein-
schaft sind alle Elemente, die auf Fragen nach der Institutionalisierung oder Dezi-
sion verweisen knnten, getilgt. Nach dem Verbot der RhZ bemerkt Karl Mager,
dessen Redaktionsmitarbeit 1841 am Widerstand der Junghegelianer gescheitert
war, treffehcl: Die Herren Hegelianer haben die Administration mit einer milie-
bigen literarischen Koterie, gegen die man in einem Journal Krieg fhrt, verwech-
selt.
63
Systematisch gesehen gibt es im Vormrz zwei mgliche Positionen, aus der Kri-
tik der Zensur das Verhltnis von Presse und Politik zu bestimmen. Entweder wird
die freie Presse politisch fundiert in antizipierten reprsentativen parlamentari-
schen Institutionen, oder man berantwortet die politische Fundierung einer wei-
teren Zukunft, um am Ende vielleicht ganz auf sie zu verzichten. Bevor wir der
zweiten Alternative und ihren Verzweigungen nachgehen, sei die erste Lsungs-
form dargestellt.
Das Modell einer Fundierung der Presse in reprsentativen Vertretungsorganen
wird 1843 von einem Korrespondenten der RhZ in Umrissen entwickelt.
64
Warum
droht eine Kollision zwischen Regierung und Presse? Warum ist die Regierung der
Gegenpol der Presse? Die Antwort: weil das Volk mit seinem politischen Denken
ber die vorhandenen Staatsformen schon weit hinaus sei; daher habe sich die
Presse hauptschlich an die Regierung wenden mssen. Die Presse ging wohl
davon aus, da die ffentliche Meinung hinlnglich bestimmt, bewut und ent-
schieden sei; da es auch nicht lohne, sich mit unermdlichen, fortgesetzten Err-
terungen an das Volk zu wenden. Aber die Mndigkeit des Volkes habe ihr nicht
geholfen, weil es keine Staatsformen vorfand, in denen es sich unverflscht und
sicher, mit der inneren Gewalt, die ihm etwa gebhren mochte, geltend machen
konnte. Es ist das Defizit demokratischer Volksvertretung, das dazu fhrte, da
die Presse in Opposition zum Staat geriet; die Presse und die Regierung finden
sich daher wie zwei Leute gegenber, die gern miteinander reden mchten, die aber
nichts weiter tun als - monologisieren. Dies aber sei nicht die wahre Bedeutung
der Presse, denn: ohne eine wahre Volksvertretung, ohne eine volle, gesicherte,
mitwollende und mithandelnde Teilnahme am gesamten Staatswesen hat eine mehr
oder weniger freie Presse keinen Sinn und daher auch immer nur eine sehr prekre
Existenz.
Von Seiten der Brokratie sei fr die Presse wenig zu erwarten, jene mu die-
selbe vielmehr notwendig verachten.
65
Der Grund liege darin, da die Brokratie
sich auf ein routinisiertes Wissen - in aufgehuften Akten, angesammelten Tradi-
tionen, in sehr ausgebildeten Systemen der Wissenschaft und des Geschfts -
sttze, die Presse dagegen operiere mit ihrem fragmentarischen Wissen, mit ihrem
raschen und daher oft unvollkommenen Ausdruck dessen, was sie sagen will, mit
ihrem anscheinend launenhaften, oft wunderlichen Wollen. Die Presse ist nicht
nur wesentlich anderer Natur als die Brokratie, entscheidend ist, da die Presse
einen Bezug zum Souvern braucht, um zur Geltung zu kommen. Bei einer sol-
chen Natur der Presse kann man nun sicher behaupten, da dieselbe wohl dem
Staatsmann mit tief dringendem und weitherrschendem Blicke, nicht aber den
265
Geschftsmnnern einer eigentlichen, isolierten Brokratie von irgendeinem erheb-
lichen Nutzen sein werde.
Angesichts der Wesensverschiedenheit von Brokratie und Presse bleibe der
letzteren nur der Schutz des Knigs als Existenzgarantie, und Friedrich Wilhelm
IV. wird auch zensurtaktisch gefeiert als ein Knig, dessen Absicht bei allen seinen
politischen Plnen eben die eigene Befreiung von der zhen, aufdringlichen und
sich selbst nicht berwindenden Gewalt der Brokratie ist. Im Kern geht es dem
Verfasser jedoch schon um einen Austausch der Souverne. Sprechen wir kurz
aus, was immer mehr allgemeine Meinung wird: die Presse kann nicht zur Achtung,
Anerkennung und zu unverkmmertem Bestnde kommen, ohne eine freie, krf-
tige Volksvertretung, d.h. denn, ohne da die Brokratie wenigstens in ihrer Spitze
gebrochen wird.
Diese Argumentation wird am 9. 2. 1843 noch einmal ausfhrlich wiederholt.
66
Presse und ffentliche Meinung werden gleichgesetzt, die Presse ist das laute Den-
ken des Volkes. - Die Presse, die ffentliche Meinung ist notwendig in sich
ungleichartig und ebenso notwendig drngt sie fort und fort zum Abschlu, ohne je
in sich zu einem wahrhaften Abschlu zu gelangen, ohne in sich und aus sich heraus
je fixiert werden zu knnen. Aber gerade diese unabgeschlossene Kommunika-
tionsgemeinschaft bedarf der Formen, in denen sich souvernes Handeln realisiert:
die Presse, die ffentliche Meinung bedarf eines verfassungsgemen Organes, das sie fr
den wirklichen Staat abschliet, fr einen gegebenen Vall fixiert, und je mehr positive Flle die
Presse, die ffentliche Meinung in sich trgt und in sich tragen soll, um so mannigfaltiger
und zahlreicher mssen diese Organe in einem Staatswesen sein, und nicht etwa z. B. auf
eine Volksvertretung in dem hchsten Kreise des Staates sich beschrnken, sondern die man-
nigfaltigste Teilnahme des Volkes am ganzen Staatsleben mglich machen.
Presse und Vertretungsorgane sind in diesem Modell eng miteinander verkop-
pelt. Die Presse ist gleichsam der weitgefcherte Vorlauf des Parlaments, sie initi-
iert geradezu weitere Vertretungskrperschaften, indem sie Flle des zu Bereden-
den und damit im Zugzwang zu Entscheidenden vervielfltigt. Die politischen
Organe dagegen schlieen den Diskurs ab, sie fixieren ihn, und es ist auch vorge-
sehen, da die konstituierten Organe bestimmend und luternd auf die ffentliche
Meinung und somit auf die Presse zurckwirken. Publizistisches Verhalten steht
hier eindeutig unter dem Primat der Politik, Presse ist der Vorhof der parlamentari-
sierten Gesellschaft.
67
Dieses Modell liegt jedoch in der Zukunft, und E. Bauer fragt: Wer kann abse-
hen, welchen Lauf die Kritik noch nehmen wird? ( . . . ) Wehe dem, der sie aufhalten
will!
68
Ist der Proze, der sich in der Kommunikationsgemeinschaft entfaltet,
berhaupt politisch abschliebar? Lt sich die Unendlichkeit der dem Arkanum
des Gewissens entspringenden Reden gewaltfrei in politisches Handeln berfh-
ren? Jeder Staat hat (. . .) das Bedrfnis, wirklicher Begriffsstaat zu werden,
schreibt ein Junghegelianer. Wenn dies einen Sinn haben soll, so mu gelten: Er
kann seine Institutionen nie abschlieen. Eine permanente Revolution ist vorpro-
grammiert. Denn jedes Mal hingegen, wenn der Staat seine Einrichtungen als voll-
kommen hinstellt und sie der Diskussion entzieht, tritt ( . . . ) Verkncherung ein.
69
266
Die Presse bewegt sich auf einem Geistesgebiet, welches ber den Staat hinaus-
liegt und stets (!) erhabener als er ist.
70
Also kein Primat der Politik, sondern
umgekehrt ein Primat der unabschliebaren Kommunikationsgemeinschaft, die
den Staat schlielich aufhebt, weil er die Diskussion strt?
Mu in dieser Konstellation die Presse nicht unter den Verdacht geraten, da sie,
indem sie^sich auf die Ebene bloer Diskussion zurckzieht, gerade sich selbst zur
mchtigsten politischen Kraft aufschwingt? Ist die Trennung der Sphren der Poli-
tik und der Presse durchzuhalten? Schafft sich politisches Verhalten in der Presse
seinen Ausdruck oder induziert Presse berhaupt erst Politik? Die Journalisten
sind ber die Beziehungen beider Sphren zueinander zerstritten. So kann
G. F. Knig das Verbot der >Leipziger Allgemeinen Zeitung< kommentieren:
Die Vorwrfe, die in letzten Tagen in einem Atem der jungen >Presse< gemacht wurden,
hoben sich wechselseitig auf. Seht, sagte man, welche feste, gehaltene, bestimmte Politik
haben englische und franzsische Bltter. Sie basieren auf dem wirklichen Leben, ihre
Ansicht ist die Ansicht einer vorhandenen fertigen Macht, sie doktrinieren das Volk nicht, sie
sind die wirklichen Doktrinen des Volkes und seiner Parteien. Ihr aber sprecht nicht die
Gedanken, die Interessen des Volkes aus, ihr macht sie erst oder schiebt sie ihm vielmehr
unter. Ihr schafft den Parteigeist. Ihr seid nicht seine Schpfungen. So wird es der Presse
zum Vorwurf gemacht, bald da keine politischen Parteien bestehen, bald da sie diesem
Mangel abhelfen und politische Parteien schaffen will.
71
Die Rettung aus dieser verworrenen Lage erfolgt schlielich durch den Einsatz
einer geschichtsphilosophischen Perspektive. Sie ist der zentrale Reflexionsmodus,
in dem sich die Dilemmata einer Distribution der Vernunft durch die Presse aufl-
sen. Nicht nur entlehnt sich die Figur des ffentlichen Gerichts< der des >Jngsten
Gerichts<, nicht nur kann sich mit ihrer Hilfe der >zuflligen Schreier< in der Nhe
eines historischen Subjekts< wissen, auch die Frage nach dem Verhltnis zwischen
Politik und Presse erhlt eine geschichtsphilosophische Antwort.
Knig schreibt zu den gegen die Presse gerichteten Vorwrfen:
Aber es versteht sich von selbst. Wo die Presse jung ist, ist der Volksgeist jung und das tg-
liche laute politische Denken eines eben erst erwachenden Volksgeistes wird unfertiger,
formloser, bereilter sein, als das eines Volksgeistes, der in politischen Kmpfen gro und
stark und selbstgewi geworden ist. Vor allem das Volk, dessen politischer Sinn erst
erwacht, fragt weniger nach der faktischen Richtigkeit dieser oder jener Begebenheit, als
nach ihrer sittlichen Seele, mit welcher sie wirkt; Tatsache oder Fabel, sie bleibt eine Verkr-
perung der Gedanken, Befrchtungen, Hoffnungen des Volks, ein wahres Mrchen. Das
Volk sieht dies sein Wesen in dem Wesen seiner Presse abgespiegelt und wo es dies nicht
she, wrde es sie als ein Unwesentliches keiner Teilnahme wrdigen, denn ein Volk lt sich
nicht betrgen. Mag sich daher die junge Presse tglich kompromittieren, mgen schlechte
Leidenschaften in sie eindringen, das Volk erblickt in ihr seinen eigenen Zustand, und wei,
da trotz allem Gift, was die Bosheit oder der Unverstand herbeischleppt, ihr Wesen immer
wahr und rein bleibt und das Gift in ihrem immer bewegten, immer vollen Strome zur Wahr-
heit und zur heilsamen Arznei wird. Es wei, da seine Presse seine Snden trgt, sich fr es
erniedrigt und zu seinem Ruhme, auf Vornehmheit, Sffisance und Unwiderleglichkeit ver-
zichtend, die Rose des sittlichen Geistes innerhalb der Dornen der Gegenwart darstellt.
72
Die Passage ist ein Exempel angewandter Geschichtsphilosophie. Die Frage der
Verantwortung der Presse, die Frage nach ihrem politischen Sinn wird virtuos
267
umgangen. Die junge Presse ist wie selbstverstndlich unschuldig, daher kann sie
nur entschuldigt werden. Sie ist der reine Beginn einer Lerngeschichte des histori-
schen Subjekts Volk, das sie untrglich spiegelt. Und wer wollte einen Spiegel
schelten? Das wahre Mrchen, das die Presse bietet, wie sollte es zu widerlegen
sein? Ihre Entlastungsfunktion gewinnt die angewandte Geschichtsphilosophie,
weil sie die Aporien der Gegenwart in die Zukunft verlagert, wo sie sie lsen kann,
um dann die Lsungen in die Gegenwart zu reinserieren. Das geschichtsphiloso-
phische Wissen hat seinen Ort im historischen Subjekt< selbst, es ist das Volk,
das wei. Da die Presse abschlieend mit quasi christologischen Funktionen
eingefhrt wird, verdient an dieser Passage ebenso hervorgehoben zu werden wie
die Anspielung auf die theologisch-philosophische Rosensymbolik.
73
Warum wird die geschichtsphilosophische Thematik gerade dort virulent, wo
sich die Junghegelianer als Gruppe von Korrespondenten definieren? So sehr man
davon ausgehen kann, da geschichtsphilosophische Reflexionen alle Debatten der
Gruppe durchziehen, im Bereich der Presse, die als Distributionsmedium von Ver-
nunft gelten soll, stellt sich in besonderem Mae die Frage, wie die Existenz von
Vernunft in der Zeit zu sichern ist. Als philosophische Schule haben die Junghege-
lianer zwar auch dem preuischen Staat eine geschichtsphilosophische Rolle zuge-
schrieben, ebenso haben sie als politische Partei die Prinzipienkmpfe geschichts-
philosophisch gedeutet, aber die soziale Wahrnehmung des Staates, mit dem sie
sich verbndeten, und auch die soziale Wahrnehmung der Verschiedenheit partei-
politischer Positionen hat bei diesen Gruppendefinitionen weitaus mehr sichernde
>Nahrung< erhalten als im unberschaubaren Feld der Presse und ihrer Leser.
Nicht ohne Ironie sieht ein Korrespondent der RhZ selbstkritisch die Zeitungs-
korrespondenten unter den hin und her gehetzten Wesen auf unserem hgeligen
Erdglobus, als die Wchter der Zeit, die eilenden Berichterstatter der hochwich-
tigsten sowie der geringfgigsten Einflle des Weltgeistes ( . . . ) berall im Vorder-
treffen. Sie sind gleichsam Spezialisten in Sachen Zukunft:
so trumen (!) sie gewi den ganzen Tag von den wichtigen Vernderungen, die sie durch
ihre Berichte in der Weltgeschichte hervorbringen, und haben keine Ruhe bei Nacht, weil
der Morgen die Anzeige von evenements bringen knnte, von deren Ursachen sie ihren
Anteil abwgen mten, um denn doch einmal mit Hochgefhl die Brust, still in der Ecke
einer Konditorei oder Restauration schlagen zu knnen, mit dem leise verhaltenen Ausruf:
zur Hlfte oder zum Drittel oder Zehntel mein Werk! Solche wrdige Mnner also haben
ihre liebe Not.
74
Diese Not lindert Geschichtsphilosophie, weil sie die Zukunft ein Stck weit
beruhigen kann, indem sie aufs >historische Subjekt< den Blick richtet, ein Subjekt,
dem sich der Korrespondent nahe wei, das er aber der Gruppennorm entspre-
chend nicht voll und nicht offen fr sich reklamieren darf, sondern nur in Bruchtei-
len still in der Ecke als sein Werk genieen darf. Denn was Marx gegen den Zen-
sor geltend macht, kann auch gegen den Korrespondenten gewendet werden: die
eigentliche Unbescheidenheit besteht darin, die Vollendung der Gattung beson-
deren Individuen zuzuschreiben. Der Zensor ist ein besonderes Individuum, aber
die Presse ergnzt sich zur Gattung.
75
Auf der antizipierten Basis der vollendeten universellen Kommunikationsge-
meinschaft, in der die gttliche Selbstkritik der ffentlichen Vernunft herrscht,
268
ist mit dem Zensor zugleich die Verantwortlichkeit der Korrespondenten ent-
schwunden. Denn Zensur kann in diesem Denken nur den Zweck haben: die
Berechtigung und Selbstgewiheit der Vernunft nicht nur nicht anzuerkennen,
sondern ihren Proze sogar mit frevelnder Hand zu stren und an die Stelle seines
notwendigen Verlaufs die Willkr der zuflligen Subjekte zu setzen.
76
Die Selbstge-
wiheit der Vernunft ist subjektlos, sie darf nicht gestrt werden, weder durch
eine Zensur noch durch einen Korrespondenten, der allenfalls still in der Ecke
seinen ttigen Anteil reflektieren darf. Geschichtsphilosophie sichert der Presse
ihre politische Unschuld.
4. Theorie und Masse
Im Juni 1842 vergleicht M. He die Tagespresse in Deutschland und Frankreich.
77
Ein solcher Vergleich sei erst mglich nach der freisinnigen Zensurinstruktion
vom Dezember 1841, denn zuvor htte man gar nicht von einem Charakter der
deutschen Journalistik reden knnen. He' These lautet:
Das Eigentmliche, wodurch sich die deutsche Presse von der franzsischen unterscheidet,
besteht darin, da jene die Wahrheit, ganz abgesehen von der unmittelbaren Ausfhrbarkeit
oder Anwendbarkeit derselben, theoretisch fordert, whrend diese umgekehrt, mehr die
Ausfuhrung, die Verwirklichung dessen, was sie fr zweckmig erachtet, denn die Wahr-
heit, erstrebt.
Die franzsische Presse stnde im Einklang mit der politischen Praxis, dort wr-
den die theoretischen Aussagen der Praxis folgen, bzw. aus ihr abstrahiert wer-
den. Von jener Presse, die mit Recht eine Macht genannt wird, kann eine neue
Theorie nur dann gepredigt werden, wenn ihr eine neue Praxis vorher gegangen ist.
( . . . ) Weil die bestehenden Institutionen der Ausdruck der ffentlichen Meinung
sind, kann die ffentliche Meinung keinem anderen Prinzip, als dem der bestehen-
den Institution huldigen. Was He in Frankreich sieht, liegt nahe bei dem Modell
einer Presse, deren Diskurse, eingebettet in vielfltige politische Institutionen, von
diesen begrenzt und gezgelt werden.
Fr die deutsche Presse ist dies Modell He zufolge untauglich. Die deutsche
Tagespresse kann nicht von der Praxis, sondern nur von der Theorie ausgehen.
In Deutschland fehlt nicht nur ein differenziertes parlamentarisches Leben, um das
sich die Presse gruppieren knnte, vielmehr hat positiv die Theorie in Deutschland
einen besonderen Status. Nur die ausgewirkte Idee, nicht die verwirklichte Tat, ist
hier der von den Geistern erkannten Wahrheit entsprechend. Niemand, der die
deutschen Verhltnisse kennt, wird bestreiten, da die Deutschen in der Theorie
konsequent, wahr und klar, konsequenter als irgendeine andere Nation, da sie
dagegen in der Praxis sehr inkonsequent, irr und wirr sind. He greift hier einen
weitverbreiteten Topos auf und versucht, Argumentationsstrategien zu entfalten,
um die Dichotomie aufzulsen.
Das Problem ist, einen Modus der Distribution der Vernunft zu finden, der dem
deutschen Praxisdefizit gerecht wird. Pragmatische Parteipolitik kann immer nur
an vorgegebene Praxisrume anknpfen, aber was ist zu tun, wenn die ausgebildete
269
Theorie sich nicht ber politisch institutionelle Medien verbreiten lt? Zunchst
verkehrt sich das Theorie-Praxis-Verhltnis in dem Sinne, da das sogenannte
Praktische in Deutschland gerade das Unpraktischste von der Welt, das Theoreti-
sche dagegen hier das wahrhaft Praktische ist. Marx greift diesen Gedanken auf.
Gegen diejenigen, die auf einer politischen Praxis insistieren, von der Theorie aus-
zugehen habe, ist die Formulierung gerichtet: Ihr verlangt, da man an wirkliche
Lebenskeime anknpfen soll, aber ihr verget, da der wirkliche Lebenskeim des
deutschen Volkes bisher nur unter seinem Hirnschdel gewuchert hat.
78
Die These von der Existenz einer ausgebildeten Theorie in Deutschland - die
philosophische Schule konnte sich in dieser These uneingeschrnkt selbst bespie-
geln, die politische Partei mute schon um der Handlungsfhigkeit willen auf
einige allzu ausladende Verzierungen der Theorie verzichten - den junghegeliani-
schen Zeitungskorrespondenten wird sie zur Last. Denn wo ist der ebenbrtige
Leserkreis fr das, was sie schreiben? Eine schrittweise Reform der staatlichen
Institutionen, eine Demokratisierung und Parlamentarisierung der Stndever-
sammlung htte ihnen publizistische Mglichkeiten erffnet, aber mit dem Verbot
der Zeitungen sind sie Publizisten ohne Publikum, Distributeure der Vernunft
ohne Adressaten.
Der Vergleich zwischen der Tagespresse in Deutschland und Frankreich, den
M. He vornimmt, ist keine blo kontrastierende Illustration, vielmehr ist er Teil
einer umfassenden geschichtsphilosophischen Konstruktion, die an die Thesen sei-
ner Schrift >Die europische Triarchie< (1841) anschliet. Deutschland und Frank-
reich treten hier als weltgeschichtliche Reprsentanten zweier revolutionrer Prin-
zipien auf: der Revolution des Geistes und der Revolution des politisch-sittlichen
Bereichs. Deutschland ist der eine Arm der Vorsehung, welcher das innerste
Wesen, den Geist erfat und frdert, Frankreich der andere, der in die uere
Gestaltung des Lebens eingreift, um diese zeitgem zu reformieren.
79
Die Ursprnge dieses Dualismus werden weit zurck verlegt. Die ursprngliche
Einheit der Menschheit im Orient zerbricht, weil sie sich vermehrt, und es setzt ein
geschichtsbegrndender Wanderungsproze von Osten nach Westen ein, bei dem
die >negativ unruhigem Charaktere nach Westen wandern, sich von den kontem-
plativen stlichem Charakteren trennen. So habe nur die westliche Welt eine
bewegte Geschichte, im Gegensatz zur in sich gekehrten Ruhe des Ostens. Mit der
Entdeckung Amerikas sei nun Europa gleichsam in die Mitte gerckt, eine Mitte,
in der sich der Ost-West-Dualismus am strksten reibe. Die deutsche Reformation
gilt dabei als mehr dem Osten verpflichtete Innerlichkeit, die Franzsische Revolu-
tion reprsentiert den westlichen Bewegungstypus.
80
Fr einen geschichtsphilosophischen Dialektiker liegt es auf der Hand, da hier
eine Vermittlung stattfinden mu. Deutschland und Frankreich mssen sich ergn-
zen. Und das dritte Prinzip, das entsteht, hat auch schon einen nationalen Repr-
sentanten. Fr He ist England der Trger der Vermittlung. Hier soll nach der
deutschen Emanzipation des Geistes und der franzsischen Emanzipation der Sit-
ten die dritte knftige Emanzipation, die der sozialen Freiheit, stattfinden, die den
Gegensatz von Pauperismus und Geldaristokratie aufhebt.
81
In England steht
die letzte, abschlieende, die soziale Revolution auf der geschichtsphilosophischen
Tagesordnung, die die europische Triarchie vervollstndigt.
270
Spekulative Ost-West-Symboliken und ihre zentristischen Auflsungen haben
eine lange Tradition.
82
Aber nicht sie interessiert uns hier, sondern die Funktion,
die sie bei He fr die Lsung der Distributionsprobleme der Vernunft hat.
Geschichtsphilosophie vergewissert sich der Zukunft. Sie bietet sozialem Handeln,
das sich in der Zeit vergewissern will, einen Erwartungshorizont. Aber sie zielt nicht
nur auf Zukunft, sondern definiert auch die geographischen Orte, an denen rele-
vantes Geschehen stattgefunden hat, stattfindet und stattfinden wird. Sie gibt Ant-
wort auf die Frage, wohin die Distributeure der Vernunft ihre Aktivitten richten
sollen.
Sosehr die Hesche Konstruktion buchstblich richtungsweisend ist: in England
wre das ideale Publikum fr die Presse zu finden - man kann die Konstruktion
auch miverstehen. Denn die drei nationalen Emanzipationen sollen sich zwar
weltgeschichtlich vereinen, auch kann man sich vorstellen, da ein einzelner Intel-
lektueller zur kulminierenden Emanzipation nach England geht, aber einen
Exodus der deutschen Intelligenz nach England als Gruppenregel aufzustellen,
eine solche Konsequenz wre wohl kaum akzeptabel. Es mu also dabei bleiben,
da das reelle Handeln jedes an seinem Orte
83
stattfindet, also auch an Orten
eines vielleicht minderen geschichtsphilosophischen Ranges.
Fr He in Kln heit das:
Allein wir drfen, um die Frchte der englischen oder franzsischen Revolution zu ernten,
nicht indifferent zusehen, wie sich unsere Nachbarn in blinder Wut zerfleischen; wir drfen
das Licht, womit uns die Vorsehung begnadigt hat, nicht untern Scheffel halten, sonst
mchte sich unser Egoismus gar bald an uns selbst rchen! Es ist, wie gesagt, noch immer
unser Beruf, an der Grundlage der Neuzeit, an der Geistesfreiheit weiter zu bauen. Die Idee
der einigen, freien Menschheit, die Idee der Humanitt mssen wir immer weiter, immer
konkreter ausbilden.
84
Im Europa der >Triarchie< bleibt Theorie eine deutsche Aufgabe, aber es ist eine
Aufgabe, die partiell ist. Falsch wre der Schlu, sich fatalistisch nur auf die Spitze
der Emanzipationsgeschichte zu fixieren, falsch der Schlu, die Theorie aufzuge-
ben, sie ist noch immer unser Beruf, aber es ist ein Beruf, dessen Sinn an die
Gesamtkonstruktion gebunden ist.
He' Zentrierung auf England als die Synthese dauert bis Mitte 1842. Im Beitrag
ber die Tagespresse wird noch entsprechend der triarchischen Konstruktion die
deutsche Presse der englischen nahegerckt. Was das Verhltnis zur Theorie
angeht, gilt ihm der Englnder (.. .) theoretischer, deutscher als der Franzose.
85
In einer Korrespondenz vom Juni 42 erwartet He in England eine soziale Revolu-
tion.
86
He' Naherwartungen werden enttuscht. Die Bewegung der Chartisten,
die politische Petitionen ins Parlament einbringen, kann er nicht theoretisch als
soziale Revolutionen identifizieren, zumal der politische Sektor seiner Konstruk-
tion fr Frankreich reserviert ist. So wird die Triarchie geruschlos auf die Diarchie
reduziert
87
, wie Na'aman schreibt. Der Dualismus von deutscher Theorie und
franzsischer Praxis wird nunmehr zur entscheidenden Denkfigur.
Bedeutete franzsische Praxis in der triarchischen Konstruktion nur die politi-
sche Revolution der Sitten, so ordnet He in der Rest-Diarchie den Inhalt der sozia-
len Revolution auch der franzsischen Seite zu. Franzsische Praxis meint nun
die sozialistische und kommunistische Bewegung in Frankreich. ber sie berichtet
271
He als Redakteur der >Rheinischen Zeitung<, und nach deren Verbot geht er selbst
nach Paris.
Die Existenz einer blhenden Pressekultur in Paris, die sich ganz der sozialen
Frage widmet, mu auf den Junghegelianer He, der nach dem Scheitern seiner
Orientierung auf den preuischen Reformstaat, die in der >Triarchie< noch unge-
brochen zum Ausdruck kommt, ohne Handlungsperspektive ist, einen nachhaltig
faszinierenden Eindruck gemacht haben. Hatte der Geschichtsphilosoph He die
Lsung des sozialen Widerspruchs von Geldaristokratie und Pauperismus als
krnenden Abschlu der modernen Emanzipation gefordert, so fhrte ihm die
kommunistische Presse Frankreichs ein intellektuelles Ttigkeitsfeld vor, das die
Chance bot, sich im Zentrum der geschichtlichen Entwicklung zu wissen.
Der geschichtsphilosophische Dualismus der nunmehr neugefaten franzsi-
schen Praxis< und der >deutschen Theorie< lt sich jedoch nicht umstandslos auf
die Realitten anwenden, denn die Handwerker- und frhe Arbeiterbewegung in
Frankreich besteht nicht nur aus >Praxis<, sondern hat eigene Theoretiker, und sie
hat eine eigene Literatur, eine eigene Tagespresse. Wie kann He dieses Problem
lsen? An der kommunistischen Presse Frankreichs interessiert zunchst das
Modell: die Distribution der Vernunft durch kommunistische Publizisten. He
spricht zwar noch von Parteien, aber es geht schon nicht mehr um die dramati-
sche Darstellung von Prizipien, sondern um das Problem von Masse und Theorie.
Jedoch konfrontiert mit dem, was in der kommunistischen Presse Frankreichs zu
lesen steht, mu He feststellen, da es sich dort nicht um den >Geist< handelt, der
es wert ist, verbreitet zu werden. So wolle zum Beispiel eine fourieristische Zeitung
Dinge vereinigen, die entweder ihrer inneren Natur nach nicht zu vereinigen sind,
oder deren Natur ihm (dem Blatt der Fourieristen, d. V.) ganz unbekannt ist. (. . .)
Z. B. den Absolutismus mit der Freiheit, das Bourgeoisieregiment mit der Gleich-
heit. Zwar shen die Fourieristen ein, da ihnen eine Beschftigung mit Deutsch-
land nottut, aber ihre intellektuelle Potenz reiche dazu nicht aus, sie wrden
alles ohne Kritik loben, was Deutschland angehrt, namentlich die deutschen Professoren
und Potentaten - als ob solche wohlmeinenden Urteile allein hinreichten, Deutschlands und
Frankreichs Geschichte dauerhaft zu verschmelzen! Ist es nicht zum Lachen, in einem und
demselben Blatte einen deutschen Frsten und Arnold Rge, den >Begrnder der neuhegel-
schen Schule< (!) auf die freundlichste Weise, die man sich nur denken kann, behandelt zu
sehen?
88
Theorie und Praxis, ausgehend von ihren geschichtsphilosophischen Orten
Deutschland und Frankreich, zu verbinden, heit fr He, da nur das deutsche,
philosophisch geschulte, kritisch gewordene Denken in der Lage ist, die franzsi-
sche Praxis vor Fehlern zu bewahren. Darum mu die deutsche Theorie Einflu auf
die kommunistische Presse Frankreichs gewinnen. Der Konkurrenzkampf mit den
franzsischen Theoretikern ist so unausweichlich.
Es sind zwei widersprchliche Ebenen der Argumentation, die He zusammen-
bringen mu. Einmal gilt es, die franzsische Praxis< der >deutschen Theorie<
unterzuordnen, zum anderen mssen die franzsischen Theoretiker irgendwie
depotenziert werden, ein Unternehmen, das viel Takt erfordert, das getarnt werden
mu, weil anders ein reeller Einflu auf die Presse Frankreichs nicht zustande
kme. Die Offenheit, mit der ber die geschichtsphilosophisch definierte nationale
272
>Arbeitsteilung< gesprochen wurde, weicht sukzessiv einer auf Empfindlichkeiten
Rcksicht nehmenden Balanceargumentation.
In Sozialismus und Kommunismus< (1843) wird die Arbeitsteilung bald
geschickt zu einem Problem des 18. Jahrhunderts antiquiert. Damals ging es um
eine >vernnftige< Religion und >rechtliche< Politik.
Wie die Aufgabe des vorigen Jahrhunderts eine doppelte war, sich einem doppelten Zweck
zuwandte, einem religisen und einem politischen, so teilen sich auch zwei Nationen in diese
Arbeit: die deutsche warf sich hauptschlich auf das religise, die franzsische vorzglich auf
das politische Gebiet. Dort bildete Kant, hier die Revolution das Ziel und Ende des vorigen
Jahrhunderts.
Seitdem beginnt die Neuzeit, eine neue Periode, die fr das aktuelle Handeln
bestimmend ist. Hier mssen fr beide Nationen vorsichtigere Formulierungen
gefunden werden, denn He will ja Einflu auf die kommunistische Presse gewin-
nen. So avancieren die praktischen Franzosen< zunchst zu >Theoretikern<. Stand
der Denker Kant noch der ttigen Revolution gegenber, so wird Fichte Babeuf
zugeordnet.
In Deutschland sprach Fichte zuerst, freilich noch etwas roh und wild, die Autonomie des
Geistes aus; in Frankreich sehen wir in Babeuf die erste und daher ebenfalls noch rohe
Gestalt eines einheitlichen Soziallebens auftauchen. Oder populr ausgedrckt: Von Fichte
datiert in Deutschland der Atheismus - von Babeuf in Frankreich der Kommunismus,
89
Atheismus und Kommunismus sind fr He zwei Bewegungen, die sich auf die
neuen Grundprinzipien beziehen, die das 19. Jahrhundert verwirklichen soll: die
Freiheit und die Gleichheit als eine Einheit. Bei Fichte und Babeuf werden diese
Grundprinzipien in roher Form entwickelt. Das nchste Paar, Schelling und
Saint-Simon gelangen als Gefhlsmenschen durch unmittelbare Anschauung zu
ihren Resultaten und geben sie als solche, ohne sie zuerst durch die Dialektik der
Spekulation zu vergeistigen, der erstaunten Welt preis, welche mehr durch berre-
dung, als durch berzeugung fr dieselben gewonnen wird. Den Abschlu der
Trias von Paaren bilden Hegel und Fourier, die Freiheit und Gleichheit auf eine
wissenschaftliche Hhe bringen.
Durch Fourier und Hegel wurde der franzsische und deutsche Geist zu dem absoluten
Standpunkte erhoben, auf welchem die unendliche Berechtigung des Subjekts, die persnli-
che Freiheit oder die absolut freie Persnlichkeit, und das Gesetz der nicht minder berech-
tigten objektiven Welt, die absolute Gleichheit aller Personen in der Gesellschaft, keine
Gegenstze mehr, sondern die beiden sich gegenseitig ergnzenden Momente eines und des-
selben Prinzips sind, des Prinzips der absoluten Einheit alles Lebens.
90
Die Konstruktion verspricht die Gleichrangigkeit von deutscher und franzsi-
scher Theorie. Die alte >Arbeitsteilung< scheint darin aufgelst zu sein. Es handelt
sich auch, bezogen auf die inhaltlichen Aspekte, nicht um eine willkrliche Grup-
pierung. Fichte/Babeuf, Schelling/Saint-Simon, Hegel/Fourier - diese Paare
knnte man noch heute theoriegeschichtlich in dieser Zusammenstellung diskutie-
ren. Im Kontext der sozialen Auseinandersetzungen von Intellektuellen liegt der
neuralgische Punkt in diesem Heschen Verfahren nahe bei dem Problem, das uns
im ersten Kapitel dieser Arbeit bei der Analyse der innerschulischen Positionstafeln
273
beschftigt hat. He definiert die Gleichrangigkeiten im Rahmen eines hegeliani-
schen Stufenmodells, und hier ist entscheidend, wer das Prinzip der absoluten
Einheit alles Lebens formuliert. Die Formulierung selbst ist schon der Anspruch
einer intellektuellen Hegemonie.
He' Unsicherheit darber, ob er eine Konstruktion gefunden hat, die seinen
intellektuellen Konkurrenten und Mitstreitern akzeptabel ist, wird dem Leser nicht
entgehen, wenn er liest:
Es ist eine wesentlich gleiche Arbeit, die der deutsche und franzsische Geist ber sich
genommen, und wem noch ein Zweifel ber das einige Grundprinzip brig bleibt, aus dem
in Deutschland die Lehre von der absoluten Geistesfreiheit, in Frankreich jene der absolu-
ten sozialen Gleichheit mit allen ihren Konsequenzen entstanden, der gehe einen Schritt
weiter, als diese Theorien, der verfolge noch die praktischen Wirkungen derselben, wie sie
sich eben jetzt und gerade hier auf der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich mani-
festieren - und auch der letzte Zweifel ber die gleichen Bestrebungen Deutschlands und
Frankreichs, mu, wie Nebel vor der Sonne dahinschwinden.
91
Bleiben wir einen Moment beim Nebel dieser Stze. Auf der Ebene des >Gei-
stes< ist eine >gleiche Arbeit< zu verrichten, d.h. franzsische theoretische Kommu-
nisten stehen deutschen Philosophen nicht nach. Aber diese theoretische
Gleichrangigkeit, die im einigen Grundprinzip begrndet ist, wird einen
Schritt weiter herabgesetzt zugunsten einer Praxis, die ihren Ort gerade hier auf
der Grenze, d. h. bei den Klner Junghegelianern hat.
He' Argumentationen bewegen sich in der Tat auf der Grenze. Die Ergn-
zung von Deutschland und Frankreich bedeutet fr He zweierlei: einmal ist die
kommunistische Presse Frankreichs ein publizistisches Modell, das sich fr die
Distribution der Vernunft deshalb so hervorragend eignet, weil es sich auf den
geschichtsphilosophisch relevanten Kern, die soziale Frage, bezieht; diese Form
der Publizistik fhrt den Philosophen ins Zentrum der Geschichte. Zum anderen
ist die kommunistische Bewegung Frankreichs das ideale Objekt der Aufklrung
durch die deutsche Theorie. Strend sind nur die konkurrierenden Theoretiker.
Wie sie entkrften, ohne da der in der Konkurrenz liegende Machtanspruch
sich verrt? Denn die Forderung eines bloen Austauschs der intellektuellen Fh-
rungsgruppen wre allzu durchsichtig. Die Lsung lautet: in einer argumentativen
Figur die franzsische Theorie der deutschen zu assimilieren und gleichzeitig das
Distributionsverhltnis von Theorie und Masse umzubauen. Wenn es gelnge,
einen Typ von theoretischer Fhrung zu erfinden, dessen Fhrung nicht sichtbar
wre, eine gleichsam antiautoritre Fhrung, knnte das den Erfolg bringen.
In >Die Eine und die ganze Freiheit< (1843) werden in der Auseinandersetzung
mit den bisherigen Distributionsvorstellungen die ersten Umrisse der Zauberfor-
mel einer antiautoritren Fhrung sichtbar. Zwei gegenlufige Bewegungen ms-
sen vollzogen werden: Die Depotenzierung der Theorie allgemein und die Poten-
zierung besonders der Theorie, die die Depotenzierung betreibt. Das liest sich so:
Das philosophische Deutschland hat in den letzten Jahren eine jener groen Umwandlun-
gen erfahren, welche nicht nur in der Geschichte der Philosophie, sondern auch in der Welt-
geschichte Epoche machen. Die Philosophie als solche ist sogar an dieser Umwandlung
weniger beteiligt, als die Geschichte der Menschheit berhaupt, und wie der Fortschritt,
von dem wir sprechen, weniger ein philosophischer als ein weltgeschichtlicher, so ist er auch
274
weniger von der Philosophie oder deren Reprsentanten, also nicht so, wie die bisherigen
Fortschritte in der Philosophie, von bestimmten Personen oder gar von einem einzigen phi-
losophischen Genie, als vielmehr von Vlkern und zwar nher vom Genius des deutschen
und franzsischen Volkes ausgegangen.
92
Damit ist auf einer allgemeinen Ebene der Theorie ihre geschichtsmchtige Kraft
abgesprochen. He redet schon nicht mehr als >Philosoph<, sondern aus der Per-
spektive der Massen, der >Vlker<, die zwar einen >Genius< haben, aber dies ist ein
Platz, der nicht besetzt werden soll. Er stimmt seinen junghegelianischen Kampfge-
fhrten zu, da die Freiheit kein Monopol der Philosophen sei, da sie allgemei-
nes Gut werden mu. Aber das reiche nicht aus. Ihr ganzer Fortschritt, den sie
bisher gemacht haben, beschrnkt sich auf das Bestreben, der Philosophie beim
Volke Eingang zu verschaffen. Wollen sie aber wirklich das Volk gewinnen, so ms-
sen sie vor allen Dingen auch den Volkswnschen bei sich selber Eingang verschaf-
fen. Die alte Distributionsvorstellung, die Theorie in der Masse zu verbreiten,
gengt nicht, es mu sich auch aus der Masse heraus etwas in der Theorie verbrei-
tern. Das heit, die junghegelianischen Korrespondenten werden auf die sozialisti-
sche Thematik verwiesen, die genuin von den Massen ausgehe. Es ist ein nutz- und
fruchtloses Unternehmen, das Volk geistig freimachen zu wollen, ohne ihm
zugleich die wirkliche, soziale Freiheit zu geben.
Diese Kritik lt sich aber auch wie ein Handschuh umkrempeln, und dann wird
daraus eine Kritik der franzsischen Kommunisten.
Die dem Volke die soziale Freiheit ohne die geistige geben wollen, unternehmen ein ebenso
unmgliches Werk, wie die Philosophen, die die Geistesfreiheit allein vorbereiten mchten.
Indem sie neben der sozialen Freiheit die geistige Knechtschaft, die Religion, bestehen las-
sen, heben sie mit dieser Knechtschaft jene Freiheit in dem Augenblicke selbst wieder auf,
wo sie dieselbe als wirklich setzen.
93
Den franzsischen Sozialisten wird vorgeworfen, sie propagierten religis-dog-
matische Systeme, sie machten den Versuch, die Lcken im Dictionnaire philoso-
phique und Contract social durch Bibelstellen zu ergnzen, (. . .) die Besten frch-
ten sich vor einer >Anarchie der Meinungen<, die sie nur durch den Autorittsglau-
ben besiegen zu knnen sich einbilden.
94
In der Kritik nach zwei Seiten zeichnet sich der Typ einer antiautoritren Fh-
rung ab. Die allgemeine Philosophie wird depotenziert, das ist gegen die deutschen
Kampfgefhrten gerichtet, die nicht sozialistische Praxis in ihr Denken hinein las-
sen, aber diese Depotenzierung fhrt zu Potenzierung der Theorie, die auf dem
Boden sozialistischer Praxis fr die Geistesfreiheit eintritt.
Marx greift diese Formel auf.
95
Auch ihm geht es um die beiden Seiten: der Exi-
stenz der leidenden Menschheit, die denkt, und der denkenden Menschheit, die
unterdrckt wird. Eine Theorie, die sich nicht auf die Existenz des Leidens
bezieht, kommt nicht in Frage. Aufgabe der Theorie ist, an wirkliche Kmpfe
anzuknpfen und (uns) mit ihnen zu identifizieren. Diese Identifikation wird
dann abgesetzt gegen jeden Versuch, dogmatisch die Welt (zu) antizipieren. Das
ist in erster Linie gegen die franzsischen Kommunisten gerichtet. Ich bin (. . .)
nicht dafr, da wir eine dogmatische Fahne aufpflanzen, im Gegenteil. Wir ms-
sen den Dogmatikern nachzuhelfen suchen, da sie ihre Stze sich klarmachen.
275
Diese Wendung kann generalisiert werden: gegen jeden Theoretiker, der sich zum
Lehrer der Massen aufwirft.
Ihre klassische Formulierung hat die Zauberformel ber das neue Verhltnis von
Theorie und Masse in den Worten gefunden:
Wir treten dann nicht der Welt doktrinr mit einem neuen Prinzip entgegen: hier ist die
Wahrheit, hier knie nieder! Wir entwickeln der Welt aus den Prinzipien der Welt neue Prin-
zipien. Wir sagen ihr nicht: La ab von deinen Kmpfen, sie sind dummes Zeug; wir wollen
dir die wahre Parole des Kampfes zuschreien. Wir zeigen ihr nur, warum sie eigentlich
kmpft, und das Bewutsein ist eine Sache, die sie sich aneignen mu, wenn sie auch nicht
will.
Es ist nicht einfach, die Paradoxie dieser Position zu beschreiben. Theorie und
Masse stehen sich nicht schlicht gegenber, sondern die Theorie als selbstndiger
Bereich wird depotenziert. Sie taucht in den praktischen Kmpfen gleichsam unter.
Sie hat sich in einem gewissen Sinne aufgegeben. Und diese Selbstaufgabe wird zu
einer Kampfformel gemnzt gegen alle, die auf der Theorie fr sich insistieren.
Aber die Theorie, die so untergegangen ist, feiert ihre Auferstehung in potenzierter
Form, nmlich als konkurrenzlose Theorie. Sie ist konkurrenzlos, weil sie sich
schon aufgelst hatte in einem Opfergang.
Bleiben wir zunchst beim ersten Schritt. Der in der Masse aufgelste Intellektu-
elle definiert sich als organischer Bestandteil des historischen Subjekts. Kopf und
Herz der Emanzipation sind Philosophie und Proletariat als eine Einheit.
96
Weder eine unintelligente Masse, noch eine herzlose Spekulation kommen als
Bezugspunkt in Frage. Die Formel vom Bndnis der Intellektuellen mit dem Prole-
tariat, die bekanntlich aus diesen Debatten erwachsen wird, ist viel zu grob, weil sie
den Kernpunkt: die Auflsung des Intellektuellen, bersieht.
Es ist ein Aspekt des Feuerbachschen bergangs von der Philosophie zum
Leben, der hier besonders akzentuiert fr die Begrndung der Auflsungsbewe-
gung, die der Intellektuelle vollziehen soll, eingebracht wird. Auch in einem theore-
tischen Sinne >wahres< Denken entspringt nur einer Existenz, die in sich die Zerris-
senheiten, Entfremdungen und Abspaltungen als tendenziell berwundene voraus-
setzt. Nur dort, wo der Intellektuelle nicht mehr als Intellektueller, mge er nun
noch so sinnvolle Ideen verbreiten wollen, sondern als Gattungswesen sich
begreift, ereignet sich Wahrheit. Der Wille zur Wahrheit wird hier paradoxer-
weise in eine Richtung gelenkt, die am anderen Ende dessen liegt, was dem Streben
der Intelligenz vor Augen ist. Die Maxime lautet: je mehr der Intellektuelle ein
Intellektueller sein will, um so mehr gert er mit seinem Streben ins Abseits; und
umgekehrt: je weniger der Intellektuelle sich als Intellektueller definiert, um so
mehr wchst zusammen mit den Qualitten des Gattungswesens auch seine
Potenz, Wahrheit zu sagen.
97
Distribution der Vernunft ist in dieser Selbstdeutung schon nicht mehr bloe
Aufgabe, ein Sollen, sondern bereits eine geschichtsphilosophisch angenommene
Selbstlufigkeit, ein Sein. Daher sind auch besondere Darstellungsebenen von
Prinzipien wie Parteien im Kern entbehrlich, weil sie in das >totale Gattungswesen<
Spaltungen einfhren, die es gerade zu vermeiden gilt. Ebensowenig, wie in dieser
vorausgesetzten Identitt von Masse und Theorie der Intellektuellenstatus etwas
276
besonderes darstellt, so wenig ist Platz fr eine besondere politische Fhrerfunk-
tion. Parteien haben Doktrinen, sie verbreiten die wahre Parole des Kampfes,
der in der Masse aufgelste Intellektuelle zeigt nur Grnde auf, die ihrer Bewe-
gung nie uerlich sein knnen, weil der Intellektuelle selbst Teil der Masse ist.
In der Geschichte der Arbeiterbewegung lieen sich viele Beispiele dafr finden,
welch groe Faszinationskraft von der Figur des in der Bewegung der Masse aufge-
lsten Intellektuellen ausgegangen ist.
98
Die hier untersuchten Zusammenhnge
knnen diese Faszinationskraft ein Stck weit aufhellen. Indem der Intellektuelle
auf eine aparte Existenz verzichtet, entgeht er seiner Selbstdeutung nach dem
Geschick der Ohnmacht seiner Ideen. Als Teil der Massenbewegung haben seine
Ideen schon virtuell eine gesicherte Existenz im Leben auer ihm. Sie sind in den
Massen >verankert<, erhalten >Gewicht< und >Substanz<. Die Massen bieten der
Lust des Denkens ein >Realittsprinzip<, mit dem der gefhrliche berschwang der
Spekulation begrenzt werden kann. Die Trume von der Wirklichkeit der Vernunft
sind so keine Trume mehr. Das Gericht der ffentlichkeit, dem sich der kommu-
nistische Publizist aussetzt, ist ein wohlwollendes Gericht, weil gem der identi-
ttslogischen Verschmelzung des Intellektuellen mit der Masse die Kontingenz des
mglichen Urteils ein Stck weit gebannt ist.
Aber es gibt auch Schattenseiten bei diesem Modell. Was den in der Masse aufge-
lsten Intellektuellen gravierend irritieren mu, ist die Erinnerung an seine Her-
kunft, an das, was davon noch nicht >aufgelst< ist. Sei es, da die Massen selbst ihm
dies in Erinnerung rufen, ihn nicht voll als einen der Ihren akzeptieren, oder sei es,
da andere Intellektuelle, die nicht diesen Weg gehen, ihn dazu zwingen, die
Selbstverleugnung des eigenen Status noch weiter zu treiben und sich in immer
erneuerten Anlufen von der aparten Intelligenz abzusetzen. Auflsung der Intelli-
genz in der Masse oder aparte ohnmchtige Existenz, diese beiden Bilder gehren
zusammen, sei tauschen einander aus in dem Schrecken, den sie freinander dar-
stellen. Der Begriff der journalistischen Boheme verweist auf diese Intimitt. Wo
die Junghegelianer ihre Korrespondentenexistenz geschichtsphilosophisch absi-
chern, beziehen sie sich auf das historische Subjekt, sei es als allgemeines Gat-
tungswesen oder sei es als konkretes Gattungswesen in der Gestalt der Massen, des
Proletariats. Der Preis dieser Sicherung ist die Auflsung der aparten Intellektuel-
lenexistenz, die jedoch als bedrohlicher Schatten der Auflsung folgt, eine aparte
Existenz, die als randstndige, subkulturelle Boheme zum Gegenbild sich verdich-
tet.
Was den Erfolg der Bemhungen von He angeht, in der kommunistischen
Bewegung Frankreichs Fu zu fassen, so sei das Urteil von Na'aman zitiert:
He mute es erfahren - und andere Radikale deutscher Herkunft muten die gleiche
Erfahrung machen: die Franzosen waren nicht bereit, ihre hausbackenen menschenrechtli-
chen Begriffe von Freiheit, Gleichheit und Brderlichkeit durch spekulative Begriffe, bei
denen der moralische Gehalt oft sehr schwankend war, abzulsen; sie wollten sich auch nie
zum Atheismus bekehren. He hat zeitlebens wenig Kontakt mit Franzosen gehabt, aber
soweit er ihn hatte, haben die Franzosen sich ihm nie genhert; sie haben ihm nur gestattet,
sich ihre Ziele zurecht zu legen, wie es ihm pate. Aber Marx ist es nicht anders gegangen;
es ist deshalb verstndlich, wenn er vom Krieg 1870 die Ablsung der franzsischen Hege-
monie durch die deutsche innerhalb der internationalen Arbeiterbewegung erwartete.
99
277
Aber die am deutsch-franzsischen Projekt gewonnenen Formeln von Theorie
und Masse konnten auch unabhngig von ihren geschichtsphilosophischen Orten
wirksam werden. Wenn auch die Verbindung mit der kommunistischen Presse
Frankreichs scheiterte, das Modell ist berall anwendbar, wo Massen entstehen.
He und den Junghegelianern, die ihm folgen, gelingt es ein Stck weit, als kommu-
nistische Publizisten in Verschmelzung mit den Handwerkerkommunisten Rume
einer proletarischen ffentlichkeit in Deutschland zu etablieren. Zeitschriften,
wie das >Westflische Dampfboot<, der >Gesellschaftsspiegel<, das >Deutsche Br-
gerbuch<, die >Rheinischen Jahrbcher fr gesellschaftliche Reform< stehen fr die-
sen Typus proletarischer ffentlichkeit. Fr einen Moment, und vielleicht ist das
Jahr 1845 dieser Moment, sieht es so aus, als ob sich He und Marx mit einer prole-
tarischen ffentlichkeit zufrieden geben knnten. Es sieht so aus, als ob die Theo-
rie untergetaucht sei in einem groen Konzert proletarischer Stimmen, und als sei
die Hoffnung in Erfllung gegangen, da es dieser proletarischen ffentlichkeit
gelnge, die politischen Begrenzungen brgerlicher ffentlichkeit und ihres Par-
teiwesens zugunsten einer noch umfassenderen Kommunikationsgemeinschaft auf-
zuheben. Umfassender der Sache nach, weil das Thema der sozialen Frage an die
erste Stelle rckt, und umfassender der Zahl nach, weil hier das immense Gattungs-
wesen sein Gesprch mit sich selbst fhrt. Selbstverstndigung ( . . . ) der Zeit ber
ihre Kmpfe und Wnsche, schreibt Marx, und er fat dies ganz bescheiden: Es
handelt sich um eine Beichte, um weiter nichts. Um sich ihre Snden vergeben zu
lassen, braucht die Menschheit sie nur fr das zu erklren, was sie sind.
100
Aber im Moment des Untertauchens geschieht schon die Wiederauferstehung
der Theorie als einer besonderen Einrichtung. Auch bei einer Kollektivbeichte gibt
es grere und kleinere Snder, und wer sollte sie unterscheiden? Seit 1845 bildet
sich in Brssel ein Exilzentrum heraus, zu dem sich Marx, He und Engels zusam-
menschlieen. Das kommunistische >Korrespondenz-Komitee<, das die drei
Anfang 1846 in Brssel grnden, es bedeutet nichts weniger als die Keimform einer
politischen Partei neuen Typus. Die Form ist in dieser Zeit noch ganz geheimbnd-
lerisch. Das >Korrespondenz-Komitee< arbeitet Anweisungen aus, die jeder Kom-
munist zu befolgen hat, und er selbst hat die Aufgabe, Lageberichte zu erstatten
und an die Zentrale zu senden.
101
Ziel des Komitees ist die Gesinnungssteuerung in
der internationalen kommunistischen Bewegung. Es geht jetzt nicht mehr nur um
die Distribution des Geistes ber die bloe Teilnahme an der proletarischen
ffentlichkeit, sondern um die Distribution des Geistes ber eine Machtstruktur
hinter der ffentlichkeit.
Das politisch-dezisionistische Arkanum, das der brgerlichen ffentlichkeit ihre
politische Unschuld sichern sollte, taucht hier noch einmal wieder auf. Ein Beispiel
fr die Kommunikation innerhalb der Fhrungsspitze des Korrespondenz-Komi-
tees mag gengen. Anfang 1845, anllich der Entstehung der >Rheinischen Jahr-
bcher<, schreibt He an Marx: Pttmann, der als Herausgeber >unter Mitwir-
kung< von uns auf dem Titel figurieren wird, ist eigentlich eine stumme Person in
diesem neuen Drama und wird uns diejenigen Sachen, die nicht von uns ihm zuge-
schickt werden, zur Durchsicht resp. Zensur vorlegen.
102
In der proletarischen ffentlichkeit ist die Schere des Zensors wieder auferstan-
den. Das von dem Brsseler Trio der autoritren Sichter, wie Na'aman Marx,
278
Engels und He in dieser Zeit nennt,
103
entwickelte Modell des Verhltnisses von
Theorie und Masse wird bekanntlich in der Geschichte der Arbeiterbewegung
einen prominenten Platz einnehmen. Es handelt sich um ein zweideutiges Modell.
Theoretisch wird der in der Masse aufgelste Intellektuelle vorausgesetzt, und
diese Figur kann gegen jeden gewendet werden, der auf der Selbstndigkeit der
Theorie, d. h. einer speziellen Aufgabe der Intelligenz insistiert. Der auferstandene
Intellektuelle dagegen steht schon auf einem anderen Boden, konkurrenzlos. Die
Zauberformel einer antiautoritren Fhrung, die Eine und die ganze Freiheit,
erweist sich jedoch als Illusion. Der Atheismus des Kopfes und die soziale Frage des
Herzens, sie gehen im 19. Jahrhundert nicht zusammen ohne eine politische
Machtstruktur, die der Distribution der Vernunft diskret nachhilft.
5. Theorie statt Masse
Im Dezember 1843, ein Jahr nach der Spaltung der Redaktion der RhZ, erscheint
das erste Heft der von B. Bauer herausgegebenen Allgemeinen Literatur-Zeitung<
(ALZ). Das Heft beginnt:
In einer Zeit, in welcher unter allen Vlkern eine Menge gescheiterter Existenzen von der
Schwche menschlicher Vorstze und Absichten Zeugnis ablegen und die Armut der bishe-
rigen Weltbildung sich in aufgespreizten Worten und in Vorschlgen verrt, die berall
anders nur nicht in dieser Welt ihre Ausfhrung finden knnen, mu man sich fast schmen,
mit dem Bewutsein eines soliden Willens aufzutreten, oder gar ein ausgefhrtes Werk in
die ffentlichkeit hinzustellen. Eine der ausgebreitetsten jener gescheiterten Existenzen ist
die Masse - die Masse in jenem Sinne, in welchem das Wort auch die sogenannte gebildete
Welt umfat.
104
Die Masse, unter diesen Terminus fallen: 1. die politischen Parteibestrebun-
gen, sowohl die der Liberalen wie die der Junghegelianer, und 2. die Intellektuel-
len, die dem Heschen Modell von Theorie und Masse folgen, wie auch die Masse,
in die sie sich aufgelst haben. Sie alle sind gescheiterte Existenzen. Noch vor
wenigen Monaten glaubte sich die Masse riesenstark und zu einer Weltherrschaft
bestimmt, deren Nhe sie an den Fingern abzhlen zu knnen meinte. War sie doch
im Besitz so vieler Wahrheiten, die sich ihr so sehr von selbst verstanden, da sie
keines Beweises, keiner Prfung, keines Studiums zu bedrfen schienen. Wo lie-
gen die Ursachen des Scheiterns? War die Distribution der Vernunft noch nicht
weit genug fortgeschritten? Handelte es sich um eine >falsche< Wahrheit?
B. Bauer dreht die Argumente derer, die dem Heschen Modell von Theorie und
Masse folgen, geradezu um. Nicht eine defizitre Distribution des Geistes, eine
nicht weit genug reichende Verbreitung der Theorie in den Massen habe zum
Scheitern gefhrt, sondern das ganze Konzept der Vermassung der Theorie sei im
Ansatz falsch.
Wahrheiten aber, die der Masse so sonnenklar zu sein scheinen, da sie sich von vornherein
von selber verstehen, Wahrheiten, die der Masse in dem Grade einleuchten, da sie den
Beweis fr berflssig hlt, sind nicht wert, da die Geschichte noch ausdrcklich ihren
Beweis liefert; sie bilden berhaupt keinen Teil der Aufgabe, mit deren Lsung sich die
279
Geschichte beschftigt. Und: Das schlimmste Zeugnis gegen ein Werk ist der Enthusias-
mus, den ihm diese Masse schenkt.
Modern gesprochen, ist das Ma der Akzeptanz einer Theorie durch die Massen
ein Beweis fr die Falschheit der Theorie. Wahre Theorie kann nicht vermasst
werden. Theorie und Masse schlieen einander aus. Diese Antinomie ist nicht
durch einen Austausch der Theorien zu lsen. Auch mit einer >besseren< Theorie
wre das Distributionsmodell nicht zu realisieren, weil in der Form der Masse jede
Vernunft nur zu einer unvernnftigen Existenzweise gelangen kann.
Fr die Gruppe sind B. Bauers Thesen ungeheuerlich. Lag es nicht offen zu
Tage, da zwischen Ideen und Bewegungen ein unzertrennliches Band besteht?
Sind nicht Ideen daraufhin angelegt, da sich die Vielen ihnen anschlieen, sie zu
ihrer Sache machen und so einen wirklichen Fortschritt erzielen knnen? Und
wenn die parteipolitischen Formen nicht ausreichen, um die Ideen allgemein zu
machen, ist nicht in der aufgelsten Intelligenz eine substantielle Garantie gegeben,
da Vernunft eine allgemeine Existenz gewinnt? Von >rechts< bis >links< ist die Ver-
massung von Ideen im Vormrz eine gefrchtete oder erhoffte, aber in jedem Fall
eine reelle Mglichkeit. Diese Selbstverstndlichkeit des Vormrz, vielleicht auch
eine Selbstverstndlichkeit des 19. Jahrhunderts, stellt B. Bauer in Frage, wenn er
schreibt:
In der Masse - nicht anderwrts, wie ihre frheren liberalen Wortfhrer meinen ist der
wahre Feind des Geistes zu suchen. Alle groen Aktionen der bisherigen Geschichte waren
deshalb von vornherein verfehlt und ohne eingreifenden Erfolg, weil die Masse sich fr sie
interessiert und enthusiasmiert hatte oder sie muten ein klgliches Ende nehmen, weil die
Idee, um die es sich in ihnen handelte, von der Art war,da sie sich mit einer oberflchlichen
Auffassung begngen, also auch auf den Beifall der Masse rechnen mute. Sie scheiterten,
weil ihr Prinzip oberflchlich, also auch nicht gegen die Oberflchlichkeit der Masse gerich-
tet war. Der Geist wei jetzt, wo er seinen einzigen Widersacher zu suchen hat - in den Phra-
sen, in den Selbsttuschungen und in der Kernlosigkeit der Masse.
105
Die Junghegelianer haben sich zu entscheiden: entweder tauchen sie mit Moses
He und dem deutsch-franzsischen Projekt in der Masse unter, wissend, da hier
eine Grundlage gegeben ist, ein gleichsam fruchtbar leidender Boden, der emp-
fnglich ist fr Theorie, weil der Theoretiker aus dem gleichen Boden gewachsen
ist, oder sie verteidigen mit B. Bauer die Theorie selbst, dann mssen sie wissen,
da jede Verbindung mit der Masse die Theorie in ihrer Hrte aufweicht, sie dem
Beifall ausliefert und die Kapitulation einleitet. Denn woher sollten sie ein Recht
ableiten, zur Masse eine legitime Differenz geltend zu machen? Wichtig fr die Dis-
kussionssituation in der Gruppe ist, da die Hesche Position grere Kontinuitt
mit der Gruppenvergangenheit besitzt als die B. Bauersche Position. Parallel zum
Projekt der politischen Partei und verstrkt nach ihrem Scheitern lag es nahe, das
Distributionsmodell nun weiter zu fassen. Der in der Masse aufgelste Intellektu-
elle steht am Ende dieser >Konsequenz<. B. Bauers Positionen in der ALZ markie-
ren dagegen einen Bruch.
106
In einigen Aspekten deckt sich die Spaltung der Junghegelianer, die im Herbst
1842 anllich der Reise Herweghs aufbricht, mit der Alternative, die sich zwischen
B. Bauer und He fr die Junghegelianer auftut. Aber nicht alle Berliner Junghege-
280
lianer schlieen sich der Massen-Kritik von B. Bauer an. E. Meyen z. B., der 1842
im Streit um die politisch-taktischen Rcksichten der politischen Partei gegen
Marx Stellung nimmt, ist bei der Alternative in der Massenfrage auf der Seite von
He und Marx. Der Streit, ob dem deutsch-franzsischen Projekt von He, Marx
und Ruge u. a. zu folgen ist oder der neuen Wendung B. Bauers, die nach dem
Verlagsort der ALZ als Charlottenburger Kritik debattiert wird, zieht sich durch
alle regionalen Teilgruppen.
107
In diesem Streit liegt die Rechtfertigungsschuld bei B. Bauer. Seine Kritik der
Masse bedeutet gegenber den Positionen des Jahres 1842 eine vllige Kehrtwen-
dung. Er und die sich ihm Anschlieenden geraten unter den Verdacht des Verrats
an der gemeinsamen Sache. Bei der Spaltung des Jahres 1842 ging es um die Frage,
ob auf parteipolitische Taktik verzichtet werden kann oder nicht. Die gemeinsamen
>Grundstze< waren davon nicht tangiert. Jetzt, mit dem Streit um das Verhltnis
von Theorie und Masse, ist die vitale Frage der Existenzmglichkeit von >Geist< in
der Gesellschaft in einer schroffen Alternative formuliert.
In Was ist jetzt Gegenstand der Kritik? vom Juni 1844 rechtfertigt B. Bauer
seine Wendung. Seine junghegelianischen Kampfgefhrten, die der Heschen
Position folgen, nimmt er so, wie sie sich definieren: als in der Masse aufgelste
Intellektuelle, die seit Ende 1842 die Theorieentwicklung als besondere Ttigkeit
nicht mehr verfolgen.
Wie die Menge, deren Organ zu sein ihre tgliche Bemhung ist, mit der Entwicklung der
letzten Jahre unbekannt, fhlen sie sich durch die neue Wendung der Dinge einfach nur
befremdet: - sie sind also auch nur imstande, diese fr sie befremdende berraschung mehr
oder weniger naiv oder indolent oder mit einigem Poltern auszusprechen. >Wunderliche
Richtung !< >Ein Standpunkt, bei dessen Gedanken es einem schon frstelt !< >Hochmut, vor
dessen Anblick die ganze Nation sich mit Widerwillen abwenden mu!< - das ist die ganze
Skala von Redensarten, aufweicher diese Redner der Menge auf- und niedersteigen.
Woher stammt diese tiefe Kluft, die ein >paar hochmtige Egoisten< von der
Menge scheidet? Der Grund liegt darin, da die, die die Verbreitung von Ideen
sich um Ziel gesetzt htten, in einzelnen literarischen Produkten, also auch in
einem einzelnen Werke, in einer Zeitung, in einer Zeitschrift - also auch wohl in
einem einzelnen Aufsatze eine Entscheidung sehen, die unumstlich, fr alle Zeit
ausreichend, also unfehlbar von einem nahen Siege begleitet sein msse. Der Irr-
tum war, die Entwicklung der Kritik fr beendet zu erklren und das Defizit ledig-
lich in der Verbreitung zu sehen. Lest, lest, rief man, gebt es allen zu lesen, und ihr
werdet sehen, da wir gewonnen haben. Man hoffte, durch das praktische Ver-
hltnis der Freude, des Enthusiasmus und der Approbation der Resultate vom Stu-
dium und der eingehenden theoretischen Beschftigung sich loskaufen zu kn-
nen.
Aber hatte B. Bauer selbst nicht auch an diesen Bestrebungen teilgenommen?
Handelt es sich nicht um einen Verrat an den gemeinsamen Prinzipien? Die Kritik
der Masse tritt ja nicht im Auen der Gruppe auf, es ist einer der Ihren, der sie for-
muliert. Wie kann B. Bauer die neue Wendung der Kritik gegen die Masse in die
Kontinuitt der Gruppenentwicklung einbetten? Er erklrt:
Diese Wendung war aber nicht einmal eigentlich neu. Die Theorie hatte bestndig an der
Kritik ihrer selbst gearbeitet und sich immer bemht, keine Stichworte aufkommen zu las-
281
sen sie hatte der Masse nie geschmeichelt und ber ihren Beifall sich keine Illusionen
gemacht - sie hatte sich immer davor gehtet, sich in die Voraussetzungen ihres Gegners zu
verstricken. Man hatte ihr Bemhen nur nicht bemerkt, und es gab auerdem ein Stadium
ihrer Entwicklung, wo sie gezwungen war, sich auf die Voraussetzungen ihres Gegners auf-
richtig einzulassen und sie fr einen Augenblick ernstzunehmen, kurz, wo sie noch nicht
vollstndig die Fhigkeit hatte, der Masse die berzeugung zu nehmen, da sie mit ihr eine
Sache und ein Interesse habe. Trotzdem, da sie den Liberalismus selbst einer auflsenden
Kritik unterwarf, durfte man sie noch fr eine besondere Art desselben, vielleicht fr seine
extreme Durchfhrung halten: trotzdem, da ihre wahren entscheidenden Entwicklungen
ber die Politik hinausgingen, mute sie doch noch dem Schein verfallen, da sie politisiere,
und dieser unvollkommene Schein hatte ihr die meisten der oben bezeichneten Freunde
gewonnen.
108
Es handelt sich um eine komplexe Reinterpretation der Gruppengeschichte, die
B. Bauer vornimmt. Der bergang der Theorie zur Praxis, d. h. von der philoso-
phischen Schule zur politischen Partei, und die Auflsung des Theoretikers in den
Massen werden gerechtfertigt, aber nicht in dem Sinne, da hier ein dauerhaft
abgeschlossenes Konzept der Selbstdefinition der Gruppe vorgelegen htte. Viel-
mehr war der Gegensatz von Theorie und Masse latent in der Weise vorhanden,
da eine Schwche der Theorie gegeben war. B. Bauer reinterpretiert das, was 1842
gerade als die Strke der Theorie gegolten hatte, als Mangel. Wo sich die Theorie
auf dem Sprung zur Verwirklichung befindet, luft sie Gefahr, das Moment der
Selbstkritik zu vergessen. Es kann immer nur zu einem momentanen Einklang von
Theorie und Masse kommen, einem Einklang, der Schein ist. Daher bleibt dem
Intellektuellen nichts anders brig, als sich als einzelner immer wieder auf seine
selbstkritische Reflexion zurckzuziehen, wenn er die Existenz kritischen und ver-
nnftigen Denkens sicherstellen will. Es gibt niemanden, der ihm diese Aufgabe
abnehmen kann.
Fr He liegt die Sicherheit der Existenz der Theorie in der geschichtsphiloso-
phischen Garantie der Ergnzung von franzsischer Praxis und deutscher Theorie.
Das Aufgehen der Intelligenz in der Masse verbrgt die Verbreitung und letztlich
Verwirklichung der Philosophie. Fr die Junghegelianer der B. Bauerschen Rich-
tung ist dies ein Modell von Tarnungen. Das deutsch-franzsische Projekt wird in
den >Norddeutschen Blttern< (NB) hart kritisiert, wobei auch Gegenstimmen zu
Wort kommen.
109
Bezugspunkt der Kritik ist Rge, der in dieser Zeit in den Grup-
penkontexten mehr Prominenz besitzt als He und Marx.
Ruge hatte formuliert, die Erfahrung der Zeitungsverbote habe gezeigt, wie
weit in Deutschland die Philosophie noch davon entfernt ist, Nationalsache zu sein.
Sie mu es werden. Ein Autor der NB fragt dagegen:
Was ist denn in Deutschland Nationalsache? Es ist Nationalsache, d. h. Sache der Regie-
rung, der Volksvertreter und des Volks, die Kategorien des Bestehenden, des Staats, des
Gesetzes, der Religion als absolut und von vornherein feststehend zu betrachten. Mit dieser
Auffassung harmoniere aber auch Ruge, denn er wie die bestehenden Mchte stimmen
vollkommen darin berein, da dem konkreten Bestehenden erst dann eine wirkliche und
begriffsmige Existenz zu vindizieren sei, wenn solche auf dem Fundament der Vernunft,
Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Sittlichkeit basiert werde.
110
Aber Ruge meine ja wohl nicht diese Philosophie, die mit dem Bestehenden im
Einklang sei. Wenn er aber die Kritik meine, so sei zu fragen: Aber mu die Kritik,
282
kann die Kritik eine Nationalsache werden? Auch hier gibt der Autor einen nega-
tiven Bescheid, denn die Kritik an den bestehenden Mchten und ihrer Philosophie
berwand
die nationalen Unterschiede, indem sie es nicht zur Nationalsache der Deutschen machte,
als einen Nationalruhm bezeichnete, da sie die Freiheit - die ja die allgemein menschliche
ist - als Deutsche durch die Kritik eroberten. Das wre auch eine schne Kritik, die von den
nationalen Interessen der Deutschen ausginge, die bornierte Bildung eines einzelnen Volkes
zum Modell nhme, eine Angelegenheit des nationalen Egoismus, der nationalen Absonde-
rung und Verschlossenheit wre. Die Kritik ist die gemeinsame Sache der Menschheit, aber
nicht eine besondere Nationalangelegenheit.
Das Konzept der Deutsch-franzsischen Jahrbcher komme ber den Stand-
punkt der Nationen nicht hinaus, und die Vorstellung sei zu simpel: dadurch, da
Herr Ruge nach Paris geht und dort die Deutsch-franzsischen Jahrbcher heraus-
gibt, geht eine >Fraternisierung der Prinzipien< vor sich.
111
Der Standpunkt der Nationen, der hier kritisiert wird, hat - wie oben darge-
stellt - einen geschichtsphilosophischen Hintergrund: er diente zur Absicherung
der Existenz der Vernunft im geographisch-historischen Raum. Diese Sehnsucht
nach einer Absicherung erweist sich fr den Autor der NB als ein illusionres
Unternehmen. Ruge suche zwar eine neue Grundlage, aber der Autor fragt:
Worin besteht nun diese >neue Grundlage^ Das berschreiten der deutsch-franzsischen
Grenze, der pltzliche Eintritt in die wahre Pressefreiheit^ die Gelangung zur vollkomme-
nen Freiheit^ die wirkliche Vereinigung des deutschen und franzsischen Geistes im Prin-
zipe des Humanismus<, die Fortentwicklung des >Nationalismus< zum deutsch-franzsi-
schen Kosmopolitismus -: dies alles zusammen begreift er unter dem Ausdruck >neue
Grundlagen Aber ist das auch >wirklich< eine >neue Grundlage<?
Die Pressefreiheit als NichtVorhandensein der Zensur knne doch hchstens
ein uerliches Mittel sein, aber keine Grundlage, und die franzsische Frei-
heit sei doch eine monarchisch-konstitutionelle Freiheit mit Chatte, Kammern,
Wahlzensus, Septembergesetzen, Jurys, ffentlichkeit und Mndlichkeit der
Gerichtsverfassung, Theaterzensur usw.: ist das keine >neue Grundlage< ? Vielleicht
fr die brgerliche Existenz des Herrn Ruge, aber nicht fr seine unterbrochene
Arbeit.
112
Die Anspielung auf die brgerliche Existenz trifft den vitalen Kern
der Kontroverse. Der Autor der NB enttarnt die Parole von der wirklichen Existenz
der Vernunft als eine Camouflage der brgerlichen Existenz, die weit hinter den
Stand des Durchdiskutierens des Staates zurckgefallen ist. Darber hinaus spricht
der Autor aus der Perspektive einer Radikalitt, fr die brgerliche Existenz
schlechthin zum Makel geworden ist.
Der Angriff auf das deutsch-franzsische Projekt fhrt zu einer Leserdiskussion
in den NB, in deren Zentrum die Frage steht, welchen Stellenwert die Zensur fr
die selbstkritische Entwicklung bzw. Distribution der Theorie hat, d.h. implizit fr
die Existenz der Publizisten und ihr Verhltnis zur Masse. Ansto hatte die Passage
erregt:
Herr Ruge kennt eben nur jenen uerlichen Kampf gegen Zensur und Regierung, jene
uerlichen Fesseln, die des Zensors Rotstift durch seine Manuskripte gemalt hat: diesen
283
Kampf nennt er eine >Verhhnung des Gefesselten<, whrend es ihm doch freistand, die
innerlich Gefesselten zu verhhnen, vorausgesetzt, da er vorher mit sich selber einen
Kampf bestanden, seine Selbstfesselung verhhnt htte und da es ihm gelungen wre, auch
ohne uerliche Pressfreiheit den kritischen Gedanken so ruhig und klar zu entwickeln, da
er durch die majesttische Ruhe, Klarheit und Einfachheit seines Stils den Zensor zwingen
konnte, ihn reden zu lassen.
11
'
Solch eine Position ist fr einen Klner Radikalen unzumutbar. Ruge
mute nach Frankreich emigrieren, wollte er nicht fr immer schweigen, er mute zur Ver-
ffentlichung von Gedanken, an deren Aussprache ihn die deutsche Zensur hinderte, sich
der franzsischen Presse bedienen, und mit der letztern folglich die deutsche Presse ergn-
zen. Durch diese Verschmelzung allein konnte es ihm gelingen, auch die letzten Resultate,
welche aus den jngsten Literaturbewegungen dies- und jenseits des Rheins hervorgegangen
sind, zu amalgieren, und hiermit eine neue auf den kombinierten Krften zweier Literaturen
begrndete organische Schpfung vorzubereiten. Die Position des Autors der NB sei eine
Apologie der Zensur, die mir noch widerlicher geworden ist, seitdem ich erfahren habe,
welche Kmpfe Ihre Bltter (die NB, d. V.) mit der Zensur zu bestehen haben. Ich mu
daher dem Berliner Korrespondenten der Weser- und der Trierschen Zeitung beistimmen,
die es fr ntig erachten, den zitierten Passus des Aufsatzes ber die Deutsch-franzsischen
Jahrbcher den liberalen und radikalen Zeitungslesern zu denunziern und ich halte es auch
meinerseits fr Pflicht und Schuldigkeit, der gleichen unfruchtbaren Abstraktionen, wo ich
ihnen begegne, krftig entgegenzutreten.
114
Kppen verteidigt die Position der NB. Deutlich wird, da es in der Kontroverse
um die Autonomie der Intellektuellen gegenber der politischen und sozialen Mas-
senbewegung geht. Koppen wirft dem Klner vor:
Jedes neue Buch soll ein Gliedermann sein, den der Radikale nach seiner Pfeife hpfen,
tanzen, stampfen, springen, Mnnerchen machen und Gesichter schneiden lassen kann:
dann ist es gut, gediegen, grndlich. Jeder kritische Aufsatz soll ein Echo sein, das die prak-
tischen, weltbewegenden Worte, die >gesinnungsreichen< Phrasen des Radikalen getreu
nachspricht: dann >trifft er den Geist der Zeit und der wahren kritischen Bildung und ist
dem Radikalen willkommene
Dagegen msse die Arbeit der Kritik Vorrang haben vor einem diffusen >Stre-
ben< nach Pressfreiheit. Politische Forderungen ersetzen nicht die Notwendigkeit
einer Selbstkritik des Radikalismus.
ber sein >Streben< hat er (der Radikale, d. V.) gnzlich vergessen, ber sich und sein
Geschwtz nachzudenken und das anstrengende Streben nach Pressfreiheit, Lehrfreiheit,
ffentlichkeit und Mndlichkeit usw. erfllt und erschpft ihn so sehr, da er Leute, die
nicht blo streben wie er, sondern arbeiten und etwas Neues leisten, gar nicht begreifen
kann und mit dem Zorn des strebenden Biedermanns anschnauzt. Und: Der Radikale ver-
steht es, den schweren Klumpen unklarer Vorstellungen, welcher die Masse berall drckt,
belstigt, behinderlich ist und im Wege steht, durch einige kurz abgebrochene Phrasen zu
erleichtern, als da sind: Pressfreiheit! ffentlichkeit und Mndlichkeit! Geschworenenge-
richte! Justizreform! Assoziation! Organisation der Arbeit! Wahre Bildung! Harmonie!
soziale Ideen! - Dabei braucht niemand etwas zu denken: und doch kann sich jeder, der
diese Phrasen in den Mund nimmt, mit leichter Mhe berreden, er wisse nun ganz grnd-
lich, was er wolle: er strebe nach Pressfreiheit usw. Aber z. B. nur ber die Voraussetzungen
und Bedingungen nachzudenken, unter denen Pressfreiheit mglich ist und vernnftiger-
weise gedacht werden kann: das fllt ihm ebensowenig ein, wie der Masse. Dagegen ist er so
284
kindisch anmaend, der Kritik, die an den literarischen Erscheinungen nachgewiesen hat,
welche Art von Pressfreiheit bei den bestehenden Verhltnissen mglich ist und wie die
Pressfreiheit beschaffen ist, welche die unfreiesten Vorstellungen zu ihren Voraussetzungen
hat, den Vorwurf zu machen, sie verteidige das Schreiben unter der Zensur.
113
Ahnlich argumentiert E. Bauer. Fr ihn gilt die These Nauwercks Die Zeitung
macht frei und gleich nicht mehr. In Auseinandersetzung mit der Ttigkeit des
Berliner Korrespondenten der >Mannheimer Abendzeitung< zeigt E. Bauer die
Phrasenhaftigkeit der Intellektuellen, die Zeitungsschreiber geworden sind.
E. Bauer will in den Zeitungsproduktionen nur die Gedankenlosigkeit der ffent-
lichen Meinung und das traurige Schicksal desjenigen darstellen, den seine eigene
Schwche, sein eigener Anteil an der ffentlichen Meinung dazu treibt, sich ihr zu
opfern (!), indem er sich zu ihrem Ausdruck macht.
116
Die Fixierung auf den Zensor verleite den Zeitungsschreiber, anzunehmen, in
der Zensur lge das Haupthindernis fr eine Emanzipation.
Diese ffentliche Meinung, die sich nur auf eine Weise ausdrcken kann und aufs Maul
geschlagen ist, so wie sie ihre Schlagwrter nicht gebrauchen darf, fhlt sich natrlich fort-
whrend durch die Zensur geniert: ewig steht der Zensor hinter ihr und sieht ihr auf die Fin-
ger, unfhig, einen schlufesten Gedanken zu produzieren, ist sie aufgebracht gegen denje-
nigen, der dem rauschenden Quell ihrer Redensarten das Flieen verbieten will.
Die polemische Zusammenstellung von Zeitungszitaten des Berliner radikalen
Korrespondenten mndet bei E. Bauer in den Ausruf: Himmel, was knnten wir
>radikalen< Korrespondenten alles mit Prefreiheit machen! Wir haben so viele
Gedanken in petto! Demgegenber sei es ntig, kritische intellektuelle Arbeit zu
tun, ohne positive oder negative Rcksicht auf Pressefreiheit oder Zensur. Die
>Masse< sei nicht per se das kritische Moment, dem nur Pressefreiheit gegeben wer-
den msse. Es ist auch Kritik unter den Bedingungen der Zensur mglich: Der
Korrespondent sollte lieber seinem Schpfer danken, da es Zensur gibt: hat er an
ihr doch ein kritisches Ma gewonnen, berhebt sie ihn doch der Mhe, einen Auf-
satz zu studieren, weil sie ihn mit der fixen Idee beschenkt hat, da unter ihr doch
nichts Rechtes zustande komme. Zwei Monate spter mu sich E. Bauer gegen
den Vorwurf verteidigen, es handele sich um eine persnliche Querele mit dem
angegriffenen Korrespondenten. E. Bauer wiederholt daraufhin seine Kritik,
indem er sie ausschlielich an den Texten expliziert, die er selbst 1842 in der RhZ
publiziert hatte.
117
Autonomie der Kritik, auf diesen Zielpunkt laufen alle Thesen und Auseinander-
setzungen der Berliner Teilgruppe um B. Bauer zu. Die Frage der Distribution von
Ideen ist dabei seltsam unbeantwortet. Die intellektuelle Ttigkeit ist zwar bezogen
auf die Vorstellungen, die die Kritik zerstrt, aber dieser Bezug ist nicht das Ent-
scheidende. Denn der Kritiker will sich nicht abhngig machen von seinem kriti-
sierten Gegenstand. Die Autonomie der Kritik ist sowohl ohne bestimmten gesell-
schaftlichen Ort, wie sie zugleich in alle mglichen gesellschaftlichen Orte sich ein-
nistet, um sie dann zu verlassen, wenn sie sie kritisiert hat. Selten ist in der
Geschichte der Intelligenz der Versuch unternommen worden, Kritik als Selbst-
zweck auch dort zu denken, wo die Existenz der Zensur das unbersteigbare Sze-
nario intellektueller Ttigkeit zu sein scheint.
285
In den NB heit es:
Die Kritik erklrt sich weder fr, noch gegen die Zensur. Sie dialogisiert nicht freund-
schaftlich mit der Zensur: aber ebenso wenig schimpft und schmht sie diese. Kritik ist ber
Affekt und Empfindung erhaben. Sie kennt weder Vorliebe fr, noch Ha gegen eine Sache.
Daher stellt sie sich nicht der Zensur gegenber, um mit dieser zu ringen, daher kmpft sie
nicht persnlich mit rohen Fusten oder blanken Schwertern, wie der Faustkmpfer, der
Gladiator, der bald jhlings mit der Waffe niederfhrt, um den Gegner zu erschrecken, bald
diplomatisch schlau unbedeutende Seitenhiebe fhrt, um ihn einzuschlfern, bald aber
pltzlich wieder einhaut, um ihm den Garaus zu machen. Die Kritik steht nicht auf demsel-
ben Boden mit der Zensur; daher kann sie gegen diese nicht kmpfen, aber auch von dieser
nicht bekmpft werden. Dadurch, da sie alle jene Voraussetzungen, denen die Zensur ihr
Bestehen verdankt, auf den Grund untersucht und das Wesen derselben rein und unver-
mischt dargestellt hat, ist sie mit der Zensur fr immer fertig geworden: sie hat sie theore-
tisch berwunden und wird von ihr bei ihrem Schaffen und Arbeiten nicht mehr gestrt. Die
Kritik verfhrt nicht praktisch und kann ihrer Natur nach nicht praktisch verfahren; daher
ist es widersinnig von ihr zu verlangen, sie solle die Zensur praktisch vernichten und der
Presse die ihr gebhrende Freiheit verschaffen. Pressfreiheitsbestrebungen bewegen sich
innerhalb einer Schranke; denn sie sind eine bloe nationale Angelegenheit und sind nur auf
Erweiterung dieser Schranke gerichtet. Darum hat die Kritik, welche von vornherein ber
den beschrnkt nationalen Standpunkt hinaus ist, nichts mit ihnen gemein.
118
Der Gleichgltigkeit der Kritik gegenber der Zensur entspricht ihrer Gleich-
gltigkeit gegenber der >Masse<. Die Zensur lenkt ebenso wie die Masse den Intel-
lektuellen von seiner selbstgesetzten Aufgabe ab. Einmal wird er zu einer konfron-
tativen Haltung gezwungen, weil die Zensur den Schriftsteller mit einschrnkenden
Drohungen umgibt, das andere Mal sieht er sich Zustimmungen ausgesetzt, die die
Kraft zur Differenz schwchen. Die negative Fixierung auf die Zensur ist ebenso
wie die positive Fixierung auf die Massen dazu geeignet, den Fortschritt der sich
kritisierenden Kritik zu bremsen.
Was die Junghegelianer um B. Bauer mit ihrem Konzept eines Gegensatzes zwi-
schen Theorie und Masse entwickeln, ist auf den ersten Blick gesehen das genaue
Gegenteil des Konzepts von He, Marx und Engels. Whrend bei diesen die Aufl-
sung des Intellektuellen in die soziale Bewegung gefordert wird, insistiert B. Bauer
auf einer prinzipiellen Asozialitt der Kritik. Aber trotz dieser zentralen Differenz
der Begrndung der Intellektuellenexistenz darf nicht bersehen werden, da in
beiden Fllen die Intellektuellenexistenz uerst prekr geworden ist. Denn mit
beiden Definitionen ist schwer eine kollektive Perspektive zu entwickeln. Beide
Positionen sind in hohem Mae dazu geeignet, Gruppenzusammenhalt berhaupt
zu zerstren. Ein in den Massen aufgelster Intellektueller kann ebenso wenig For-
men einer Intellektuellengruppe begrnden, wie ein Intellektueller, dem die
Menge der Intellektuellen schon ein Massenproblem ist.
Die Lsungsformen, die der sich in der Masse auflsende Intellektuelle fr das
Gruppenproblem der Intelligenz, die Konkurrenz auf dem Gebiete des Geistigen,
gefunden hat, wurden im letzten Abschnitt im Zusammenhang mit He' Argumen-
tation dargestellt. Aber auch fr den Intellektuellen, der B. Bauer folgt, ergeben
sich erhebliche Schwierigkeiten. Wie sehr die B. Bauersche >neue Wendung< das
Gruppen-Wir belastet, zeigt die Korrespondenz B. Bauers mit einem Tbinger
Junghegelianer, die in der ALZ abgedruckt ist.
119
286
Der Tbinger berichtet B. Bauer von einem Berliner Junghegelianer, der sich
ber das Berliner Gruppenklima beklagt, das ihn so demoralisiert habe, da er
nach Amerika auswandern wolle.
Sind Euch die Gedanken ausgegangen, da ihr vor eurer Deutschen Gedankenlosigkeit
nach Amerika fliehen mt, so fahre ich ihn an, nun fngt er an zu erzhlen. An die Stelle des
alten Zusammenhaltens sei eine gegenseitige Unzufriedenheit, an die Stelle der Partei, in
welcher man sich gegenseitig zu tragen und zu ertragen habe, die Ausschlielichkeit getre-
ten. Gar keine Gesellschaft mehr, gar kein Gesprch mehr, gar keine Diskussion mehr! Er
knne gar nicht begreifen, wie Leute, wie ihr beide (die Brder Bauer, d. V.), die doch dem
Humanittsprinzip huldigten, sich so abschlieend, so abstoend, ja hochmtig benehmen
knnten. Er habe fast alle Lust verloren, etwas zu schreiben, denn er wisse gar nicht mehr,
fr wen er schreibe, nirgends finde er Anklang: man werde gar noch von seinesgleichen ver-
hhnt; brigens habe er selber das drckende Bewutsein, lange nichts Rechtes zustande
gebracht zu haben. Ich wei gar nicht, fuhr er fort, warum es einige unter uns gibt, die, wie
es scheint, absichtlich eine Spaltung hervorrufen. Wir stehen doch alle auf demselben Stand-
punkt, wir huldigen alle dem Extrem, der Kritik, sind alle fhig, einen extremen Gedanken,
wenn auch nicht zu erzeugen, so doch aufzufassen und anzuwenden. Wie gesagt, ich finde
bei dieser Spaltung kein anderes leitendes Prinzip als Egoismus und Hochmut.
120
Der Tbinger will sich nun bei B. Bauer vergewissern, was an diesen Eindrcken
stimmt. Er fragt:
Ich will nichts von der Notwendigkeit des Zusammenhaltens sagen - das ist ein hinlnglich
abgedroschenes Thema. Aber sage mir, behauptest du denn nicht auch, da der Mensch
zum gesellschaftlichen Leben geschaffen sei und du willst die Gesellschaft derer, mit denen
du frher zusammenarbeitetest, meiden? - da er zum Gedankenaustausch geschaffen sei,
und du willst in anderen keinen Gedanken anerkennen? - da er sich nicht aristokratisch
abschlieen drfe, und du willst nicht einmal durch die Gedanken, welche du schrfer zu
haben glaubst, gesprchsweise belehren? Ich begreife das nicht.
121
Eine heikle Frage. Was sollen Ideen, wenn sie sich nicht austauschen? Eine ganze
Anthropologie der Rede und der Kommunikation gert ins Wanken. Intelligenz ist
auf Austausch angewiesen, wenigstens auf ein soziales Minimum, auf den Einen
Dialogpartner. Wenn dieser Dialog abreit, kann dann berhaupt noch von Intelli-
genz gesprochen werden? Was unterscheidet den Monolog, der keine Hrer haben
will, von sinnlosen Geruschen? Der absolute Kommunikationsabbruch, nicht der
zeitweise Rckzug in die Einsamkeit, steht zur Debatte.
B.Bauer weicht in seiner Antwort nicht aus. Er wolle von zwei
Standpunkten der Kritik sprechen, oder vielmehr von Denen, welche die Kritik in der
Tasche zu haben glauben, und von Denen, welche wirklich die Macht der Kritik kennen und
sie anwenden. Wer die Kritik in der Tasche zu haben glaubt, beziehe sich nur auf die
Form der Kritik. Er hantiere mit Begriffen wie >unfrei, beschrnkt, unmenschlich, er for-
dere zum >Extrem<, zum >Weitergehen< auf, aber all diese Formulierungen seien fr ihn
>Redensarten<, ein formalisierter Habitus, der auf alles Mgliche anwendbar ist. Die Macht
der Kritik lerne dagegen nur der kennen, der sich nur auf den Inhalt konzentriere, der den
Inhalt, den Grund, das Wesen der Dinge studiert, kennenlernt, im Menschen und in der
Geschichte auffindet und ihn so erst wahrhaftig besiegt. Die erstere (Weise der Kritik, d. V.)
ist unwissend, >klug<, die zweite ist lernend. Die Schuld der Spaltung lge bei denen, die
nicht bereit waren, die Stichworte, wie Freiheit, Volk, Volkssouvernitt, ffentlichkeit,
Pressfreiheit kritisch zu untersuchen. In diesen Stichworten war es leicht sich zu einigen;
jene Begriffe waren absolut, waren verehrt, man untersuchte sie nicht.
287
Diese Untersuchung der lernenden Kritik gert notorisch in Kollision mit dem
formalisierten Gestus des Kritischen, weil dieser ein Effekt der Gruppensituation
ist. Die kritische Gruppe kann nur auf der Basis eines formalisierten kritischen
Gruppen-Wir existieren. B. Bauer kommt zu dem Resultat, da zwischen beiden
Weisen der Kritik
keine Beziehung, kein Gedankenaustausch, keine Diskussion, keine Geselligkeit mglich
ist und da die wahre Kritik hchstens das Geschft des >olympischen Gelchters< auf sich
nehmen kann. Denn wer ist der Egoistische? Derjenige, der zurckgeblieben und alle Weis-
heit zu haben glaubt, oder derjenige, welcher der Lernbegierde der Kritik nachgegeben?
brigens sage ich dir, da der Terrorismus des kritischen Auslachens und Auf-das-Maul-
schlagens wirklich notwendig ist, wo man sieht, da die boshaft-gemtliche Unfhigkeit sich
in sich selbst verstockt hat. Dieses Auslachen ist kein Hochmut, es ist nur der Proze, den
der Kritiker mit Behagen und Seelenruhe gegen einen untergeordneten Standpunkt, der sich
ihm gleich dnkt, anwenden mu.
122
Bei diesem kritischen Auslachen geht es nicht mehr um Polemik, wie sie fr die
philosophische Schule bestimmend war. Bei der Polemik wurde ein Gegner her-
ausgefordert, in einen Streit verwickelt, gezwungen, seine Argumente mit gegneri-
schen zu messen. Das >Auslachen< ist dagegen mehr ein Kommunikationsabbruch,
der mit Behagen und Seelenruhe einhergeht.
Ebensowenig wie die Kommunikationsregeln der philosophischen Schule noch
Gltigkeit haben, so wenig kann die B. Bauersche lernende Kritik fr politische
Parteibildung herhalten.
Die Kritik macht keine Partei, will keine Partei fr sich haben, sie ist einsam - einsam,
indem sie sich in ihren Gegenstand vertieft, einsam, indem sie sich ihm gegenberstellt. Sie
lst sich von allem ab. Jede gemeinsame Voraussetzung, die zur Bildung einer Partei immer
notwendig ist, wrde sie als feindseliges Dogma betrachten, wenn sie, wie es innerhalb der
Parteien ntig ist, sich gehindert sehen sollte, dieselbe zu kritisieren und aufzulsen. Jedes
Band ist ihr eine Fessel, jede verbindende Voraussetzung gilt ihr als die Sirene, die sie auf
ihrer Fahrt aufhalten wollte, als die schmeichlerische Tuschung: >nun sind wir fertig, wir
haben das Verstndnis gewonnen, wir wissen nun, woran wir sind.<
123
Aber die heikle Frage des Tbingers ist noch nicht ganz beantwortet. Gibt es
nicht unterhalb der politischen Partei mit ihren doktrinren und pragmatischen
Zwngen eine soziale Form fr die Kritik? Wre es nicht mglich, die Diskriminie-
rung beider Weisen von Kritik dergestalt sozial wirksam werden zu lassen, da sich
der Kritiker nur mit denen bespricht, die auch lernende Kritik betreiben? Es geht
um das alltgliche soziale Minimum. Das Wort gesellschaftliches Leben< aufgrei-
fend, antwortet B. Bauer:
Ja, der Mensch ist dafr geschaffen; aber kann der Kritiker in derjenigen Gesellschaft
leben, die er kritisiert? Mte er dann nicht auch ihre Vorstellungen, ihre Kategorien, ihre
Gesetze zu den seinigen machen? Ebensowenig kann er mit einer Clique leben, denn so
wrde er, sich selbst zu einem Mitglied einer Gesellschaft machend, der Gesellschaft ein
Recht des Krieges ber sich geben, whrend er selbst sein Recht der unbefangenen Kritik
ber sie aufgeben wrde. ( . . . ) So entbehrt der Kritiker aller Freuden der Gesellschaft; aber
auch ihre Leiden bleiben ihm fern. Er kennt weder Freundschaft noch Liebe; dafr aber
prallt die Verleumdung machtlos an ihm ab: nichts kann ihn beleidigen; ihn berhrt kein
Ha, kein Neid; Migunst, rger und Grimm sind ihm unbekannte Affekte.
124
288
Ist diese Position auszuhalten? Ein Ideal, das noch die stoische Ataraxie zu ber-
bieten sucht! L'esprit abhorre les groupements? Ich mchte nicht diskutieren,
inwieweit es dem Einsiedler von Rixdorf gelungen ist, diesen Entwurf einer Intel-
lektuellenexistenz lebensgeschichtlich zu realisieren, ich mchte darauf hinweisen,
wie sehr an beiden Enden der Theorie-Masse-Debatte hybride Entwrfe stehen.
125
Denn der in der Masse aufgelste Intellektuelle ist ebenso hybrid wie die absolute
Ablsung der Intelligenz vom Sozialen. Im Heschen Entwurf kann sich der mit
der Masse verschmolzene Intellektuelle auch nur einen Moment halten, einen
Moment der Aufopferung, um dann mit Hilfe einer arkanen, politischen Machtor-
ganisation als berlegener Theoretiker wieder aufzuerstehen. Auflsung im Sozia-
len und Ablsung von ihm, die Intimitt der Bewegungen verweist bei aller Drama-
tik der Kontroverse auf ein gemeinsames Problem: die Existenz von Intelligenz zu
sichern, im Angriff auf oder in der Flucht vor jenen Geistlosigkeiten, die gesell-
schaftliches Leben mit sich fhrt.
6. Das Treiben der Bohme
a) Skandalpraxis
Weit mehr als der Hesche in der Masse aufgelste Intellektuelle ist die Einsamkeit
der B. Bauerschen Kritik Zielscheibe des Spotts geworden. Vielleicht liegt ein
Grund dafr darin, da die Einsamkeit der Kritik, so sehr sie sich auf die Wrde
des Eremiten berufen kann, schnell tragisch und, gemessen am Anspruch des einsa-
men Kritikers, noch schneller tragikomisch interpretiert werden kann. B. Bauer hat
dies berdeutlich gesehen: Ja, der Kritiker darf es nicht einmal wagen, sich per-
snlich in die Gesellschaft einzulassen; denn, sie auslachend, sich an ihre Gesetze
nicht kehrend, und von ihr nicht verstanden, wrde sein Betragen nur zu demjeni-
gen ausarten, was gewhnlich >Unsinn machen< heit.
126
Dies ist eine Passage, die viel aufschlsselt. Die Entfernung fortgeschrittener Kri-
tik vom allgemeinen Bewutsein der Gesellschaft ist so gro, da schon der Kon-
takt mit, aber mehr noch das Handeln in der Gesellschaft uerst problematisch
wird. Die Treue zur rcksichtslosen Kritik hat den Preis, da ihr Handeln Unsinn-
machen wird. 1842 schreibt E. Bauer an seinen Bruder ber die Reaktionen der
Kollegen und Bekannten auf B. Bauers Verhalten:
Es ist ihnen unbequem und ein Mirakel, wenn jemand einen hheren Standpunkt einneh-
men will als sie, wenn jemand sich ber ihre Lebensfragen erheben will. Das nennen sie denn
Skandal. Was du willst, ist nichts als Skandal machen, du willst zeigen, da jemand auch
selbstndig existieren kann, und solche Umwlzer mu eine hohe Policey sehr in Obacht
nehmen.
127
Fr einen einzelnen Intellektuellen mag es noch durchzuhalten sein, zum
Schtze der fortgeschrittenen Theorie nicht allzu viel sozial aufzutreten und das
unausweichliche Unsinn machen zu verhindern. Aber fr eine Gruppe ist das
Praxisverbot der Kritik kaum durchzuhalten. Gruppensituationen erzeugen einen
spezifischen Handlungsdruck. In einer Gruppe mu gehandelt werden, sei es im
Medium des Sprachhandelns, in der Gruppendiskussion, oder im Auftreten der
289
Gruppe gegenber Auenstehenden. Wenn die avantgardistische Position der
Entfernung von Gesellschaftlichkeit schlechthin trotzdem als Gruppenhandeln
sichtbar werden soll, kann nur Unsinnmachen daraus werden. Handeln wird
zum Skandalmachen,
Die Praxis des Skandals hat der Berliner Gruppe eine zweifelhafte Berhmtheit
eingebracht. Die Informationen ber diese Skandale sind sprlich, aber was ber-
liefert ist, gibt schon einen exemplarischen Eindruck. Ihre Differenz zu Auenste-
henden lassen die Junghegelianer um B. Bauer hemmungslos all jene spren, die sie
besuchsweise aufsuchen. An dies >Foppen< von Besuchern erinnert sich G. Wei:
Hatte sich zufllig ein Fremdling aus der Provinz dort eingefunden, der in seinem Heimat-
stdtchen als ein Erzradikaler galt und der auf diesen Titel hin glaubte, den Herren in hchst
lehrhaftem Tone seine neuen Ideen und Vorschlge vortragen zu mssen, so erwachte der
Berliner in all seiner drolligen Bsartigkeit und strzte sich ber den Unglcklichen her. Der
eine bewies ihm im vornehmsten Professorenstil aus echten, geflschten oder erfundenen
Zitaten in den verschiedensten alten Sprachen, da die Griechen und Rmer schon diese
sogenannten neuen Vorschlge gekannt, erprobt und fr Unsinn erklrt htten. Der andere
spielte den begeisterten Anhnger des Fremdlings und entwickelte die weltbewegenden Fol-
gen, die die neue Entwicklung haben msse, in so abenteuerlicher Weise, da der entsetzte
Urheber sich jede solche Ausdeutung seiner Idee feierlich verbat. Ein Dritter sprach ihm
vertraulich zu, er mge doch seine Idee sofort schriftlich aufsetzen und an die >Staatszeitung<
schicken, da kmen sie vor das Auge des Ministers, und der sei gar nicht so schlimm, als man
ihn male. Zwar sei das, was dabei herauskomme, bisweilen etwas anderes, als was man
gemeint habe, aber die neue Idee sei und bleibe doch immer die immanente Urheberin.
Wenn der so gefoppte Mann dann ber diesen Abend nach Hause schrieb, so war es wohl
kein Wunder, wenn er geneigt war, die ganze Gesellschaft fr Gassenjungen zu erklren.
128
hnliche Erfahrungen machte Hoffmann von Fallersleben, der mit einigen
Freunden und Bekannten die Gruppe besuchte: Als wir eintreten, finden wir die
beiden Bauer, Bruno und Edgar, in einem unzurechnungsfhigen Zustande. Bei
ihren rohen, gemeinen uerungen wird uns so unbehaglich, da wir bald auswan-
dem.
129
Die Aktivitten der Gruppe nach auen standen dem Verhalten Besuchern
gegenber nicht nach. Mit von der Partie war die Gruppe bei dem Skandal um den
Fackelzug fr den konservativen Theologen Neander, als die Berliner Studenten
zur Feier seines Geburtstages die Wissenschaft ins Leben fhrten und ihren Fackel-
zug durch eine Schlacht mit der Berliner Straenjugend belebten.
130
Opfer wur-
den auch die Berliner >Lichtfreunde<, eine protestantische Reformbewegung, die
weiter unten zur Sprache kommen wird. Unter einer ffentlichen Erklrung zugun-
sten der >Lichtfreunde< konnte man die Namen der prominenten junghegeliani-
schen Berliner Atheisten finden, die unterschrieben hatten, um die Erklrung
lcherlich zu machen.
131
Skandals fr das protestantische Berlin war die unverfrorene Praxis, in Grup-
pen auszuschwrmen und Passanten direkt um Geld fr alkoholische Getrnke
anzubetteln.
132
Nicht verschont wurden die Berliner Bordelle der alten Knigs-
mauer, wohin die Gruppe sptabendlich ging, um dann so lange den grten Ulk
zu treiben, bis man hinaus geworfen wurde.
133
Besonders entsetzt mu es die Zeit-
genossen haben, da an diesen Ausflgen auch Junghegelianerinnen wie Marie
290
Dhnhardt teilnahmen, die sich zu diesem Zweck Mnnerkleider angezogen hat-
ten. Vielleicht stand bei dieser Idee der von der Gruppe intensiv diskutierte Roman
Sues >Die Geheimnisse von Paris< Pate, in dem der Held Rudolf, von Szeliga in
einer Rezension als Protagonist der Kritik behandelt, die Pariser Unterwelt auf-
sucht, um das Geheimnis der Verwilderung inmitten der Zivilisation zu enthl-
len.
134
Die Junghegelianerinnen galten als gefeit und gepanzert gegen die schlimmsten
Waffen des Zynismus.
135
Der Wahrsozialist O. Lning charakterisiert sie als
Frauen, welche man in diesen Kreisen >emanzipierte< nennt, welche ihr Vergn-
gen daran haben, mit ihren Freunden, Liebhabern und Mnnern die Wirtshuser
zu besuchen, Bier zu trinken, Zigarren zu rauchen, und die sich gern in mnnlicher
Kleidung mit Sporen und Reitpeitschte bewegen. Louise Aston, Tochter eines
magdeburgischen Geistlichen, geschieden von einem Englnder, von Freunden die
deutsche >George Sand< genannt, wurde 1846 polizeilich aus Berlin ausgewiesen,
weil ihre Ansichten ber die Ehe die brgerliche Ordnung der Residenz gefhrde-
ten. Fr den Wahrsozialisten Lning handelt es sich bei dem Treiben von Frauen
wie Louise Aston um Geschmacksachen, um die sich die Polizei keinesfalls zu
kmmern hat (. . .). Wenn die Mnner und Liebhaber Bedenken dabei htten, so
wrden wir das eher in Ordnung finden.
136
Als Gipfelpunkt des >Treibens< der Gruppe gilt die blasphemische Inszenierung
der Trauung zwischen Marie Dhnhardt und Max Stirner. Um dies Geschehen, das
der Stirnerbiograph Mackay herunterspielt und andere - wie Dronke - dramatisie-
ren, ranken sich zahllose Gerchte und Legenden.
137
Nicht in der Kirche, sondern
in Stirners Privatwohnung wurde die Trauung vollzogen. Inmitten der demonstra-
tiven Teilnahmslosigkeit der Anwesenden, teils kartenspielenden, teils zum Fenster
heraussehenden Gruppe, vollzog der herbeigeholte Geistliche die Trauung. Als
Trauringe dienten zwei Messingringe, die Bruno Bauer in der Situation von seiner
gehkelten Geldbrse abzog. Als abgeschmacktes Hnseln eines wehrlosen Geist-
lichen
138
ist diese Episode zur Kennmarke der Praxis des Skandals der Berliner
Gruppe geworden.
Eine wichtige Quelle fr die Freude am Skandalmachen und an tumultarischer
Selbstparodie sind K. Schmidts unter dem Pseudonym Karl Brger erschienene
Liebesbriefe ohne Liebe.
139
Von den Texten, die vermutlich aus der Zeit bis l845
stammen und verschiedene Autoren haben knnen, sei eine Passage wiedergege-
ben. Der Text knnte im Kreise der Berliner Gruppe, vielleicht auch der Kthener
Kellergesellschaft, entstanden sein. Die berschrift Wigands Kuhstall bezieht
sich auf den Leipziger Verleger Otto Wigand, in dessen Verlag eine Vielzahl der
jungehegelianischen Schriften erschienen sind und der selbst in engstem Kontakt
zu den Junghegelianern stand.
Wigands Kuhstall. (Mel. Ich hab ihn gesehn, ich ihn gesehn, ich habe den gttlichen Kuh-
stall gesehn.)
Ich David Strau, ich habs heraus,
Das Genie ist unser Gott, mit dem Glauben ists aus.
Chor (der Rtligesellschaft).
Ohi ohu! Ohi ohu! Ohi ohu! hu! hu! (durch die Nase)
291
A. Genius? Nein B. Gattung ist Leben nach
der Religion derZukunft des Feuerbach.
Chor (der Nachtwchter).
Tuttu - Tuttutu - Tutututuuuu. -
Und Bauer heit, der Dir beweist,
Die Gattung sei Masse ohne den Geist.
Chor (der Emanzipierten).
Bier her! Bier her!
Oder ich fall' um -Juchhe!
Geist? Gattung? Gespenst! Als Einziger tritt
Mit Fen alles der Stirner-Schmidt.
Chor (brennender Damen-Cigarren).
Wir nehmen, was wir brauchen
Und sollts vom Blute rauchen.
Weicht, nicht-Vieh-Dumme, Pfui da bumm, bumm,
Dem Letzten, dem Dmmsten, dem Individuum!
(Es ffnen sich die Salons eines >begterten Literaten<. Alle Kuhstallbewohner bilden einen
Halbkreis. Frulein von H. singt mit Gefhl Solo:)
Und wers weiter treibt und sich drunter schreibt,
Der jedenfalls dann der Dmmste bleibt.
Chor (der Ochsen im Hintergrunde).
Reit aus, Kameraden, reit aus, reit aus!
Dort kommt ein preuisches Irrenhaus.
(Alle reien aus. Bengalische Flammen, welche die Hinterteile der Ausreienden magisch
beleuchten. -)
140
Geselligkeiten, aus denen heraus Texte wie dieser entstehen, sind schon sehr
weit entfernt von anderen Manifestationen, die in dieser Arbeit zur Sprache gekom-
men sind. Die Feier auf dem Picheisberg war getragen vom burschenschaftlichen
Freiheitspathos, Lehrer und Schler vereinten sich unter der Parole Alles Bruder,
alles Mensch. Der festliche Rausch diente der berwindung der Statusgrenzen,
die ein verbrdertes Freiheitsstreben behinderten. Die Serenade fr Welcker, die
die politische Partei organisiert, findet nicht auerhalb der Stadt, sondern in ihrem
Zentrum statt. Auch hier, wie auf dem Picheisberg, Gesang und Festgelage, aber
nicht auf den akademischen Kreis beschrnkt, sondern als ffentliche Massende-
monstration, auf Verbreitung von Doktrinen berechnet. Was in Wigands Kuh-
stall passiert, ist auerhalb nicht mehr kommunizierbar. Wird es bekannt, ist es
Skandal, Unsinn-machen.
Die ersten Reaktionen innerhalb der Junghegelianer auf die Skandalpraxis zeich-
nen sich bei dem Berlin-Besuch Ruges anllich der Reise Herweghs ab. Hier
wurde deutlich, da sich in Berlin Verhaltensweisen ausgebildet haben, die >unter
aller Partei< sind. ber die Reaktion Ruges berichtet sein Bruder, da die Diskus-
sion in der Gruppe zunchst ganz stille begonnen htte. Mit der Zeit sei es jedoch
den Jngeren zu langweilig geworden, sie opponierten
und verfielen in ihren alten gewohnten Ton. Die freie Stimmung steigerte sich bis ins
Unglaubliche. Ich sah wie Arnold (Rge, d. V.) stumm und wie versteinert dasa. Ein Sturm
mute ausbrechen, denn es kochte und siedete in ihm. Mit einem Male sprang er auf und rief
292
mit lauter Stimme: >Ihr wollt frei sein und merkt nicht, da ihr bis ber die Ohren in einem
stinkenden Schlamm steckt! Mit Schweinereien befreit man keine Menschen und Vlker! -
Reinigt Euch zuerst selbst, bevor Ihr an eine so groe Aufgabe geht!<
141
Ruge fat sein Urteil in einem Brief an Marx zusammen:
Trinken, Schreien, ja, ich sage es, selbst PRugeleien knnte man Leuten hingehen lassen, die
das alles trieben, abgesehen von einem ernsten Inhalt, und ohne ihn zu besudeln. Was er in
Berlin erlebt hat, ist fr ihn das ganze tobende, mit Atheismus, Kommunismus, Ausschwei-
fung, Kpfen und Guillotinieren um sich werfende, gesellige und schriftstellerische Unwe-
sen.
142
hnliche Urteile lassen sich noch vermehren. Der Tbinger Junghegelianer
A. Schwegler schreibt ber
das abschreckende Treiben namentlich der beiden Bauer (. . .): aus dem Parteimachen
wird ein Rottenmachen, aus einem besonnenen, stetigen, die Mglichkeit einer praktischen
Verwirklichung nie aus den Augen verlierenden Wirken fr wissenschaftlichen politischen
Fortschritt wird ein nutzloses, die Freiheitsbestrebungen berhaupt verdchtigendes und
selbst die Bessergesinnten anwiderndes Spektakel.
14
' Und fr den Knigsberger L. Wales-
rode haben sich die Berliner um B. Bauer selbst zu einer literarischen Pariakaste konstitu-
iert und scheinen nicht wenig eitel darauf zu sein. So wollen die Leute auf die Gegenwart
wirken!
144
Schriftstellerisches Unwesen, anwiderndes Spektakel, literarische Pariaka-
ste - Umrisse einer Boheme zeichnen sich ab. Es handelt sich aber nicht nur um
ein auf die Berliner Gruppe beschrnktes Phnomen. He' >wilde Ehe< entsprach
in dieser Zeit durchaus den Mastben der Berliner.
145
Und im April 1842 mieteten
sich Marx und Bauer in Godesberg ein paar Esel und galoppierten auf ihnen wie
rasend um den Berg herum und durch das Dorf. Die Bonner Gesellschaft sah uns
verwunderter wie je an. Wir jubelten, die Esel schrien.
146
Auch kann man den
Angaben von F. Sa vertrauen, da Rutenberg nach dem Tode der Rheinischen
Zeitung von Kln wieder nach Berlin zurckgekommen ist und vom Rheine eine
groe Lust am dortigen Narrentume und Faschingstreiben herbergeholt hat.
147
Und wie wurde die >Beerdigung< der RhZ in Kln begangen? Die Redaktion lud
den Zensor Saint-Paul zu einem Totenmal ein. Die Feier geriet zu einem skanda-
lsen Happening: ein mit Trauerflor umwundener Band der Zeitung wurde mit
Ketten an den Stuhl des Zensors gefesselt, und unter Pereat-Rufen auf die Zensur
schnitt man dem Zensor eine Locke ab. Die Presseberichterstattungen ebenso wie
die ffentlichen Richtigstellungen Saint-Pauls zu diesem Ereignis zeugen von der
Klner Skandalpraxis.
148
Den Zensor Saint-Paul schlielich, wir finden ihn - welch
eine Wendung! - wieder als prominentes Mitglied der literarischen Pariakaste in
Berlin.
149
In diesem Fall hat sich die politikfreie Kommunikationsgemeinschaft mit
dem Zensor zumindest in der Hippeischen Weinstube in Berlin realisiert.
Versucht man, die Skandalpraxis, das Unsinnmachen, aus dem Bannkreis des
Anekdotenhaften herauszulsen, so kann der inszenierte Skandal als eine Hand-
lungsweise verstanden werden, die sich in spezifischer Weise auf die ffentliche
Kommunikation richtet. Der Skandalpraktiker rechnet mit der Reaktion der
ffentlichkeit, aber er tut dies nicht wie jemand, der an der ffentlichen Kommuni-
kation problemlos teilnimmt. Vielmehr agiert er von einer Position aus, die gleich-
293
sam schon auerhalb der Kommunikationsgemeinschaft liegt. Er stellt sich blo,
um Blostellungen zu provozieren. Im Skandal wird etwas schockartig zur Schau
gestellt, was im >normalen< Kommunikationsreglement tabu ist.
Das Laborieren an den Tabugrenzen kann nun funktional reinterpretiert werden
als ein Mittel, auf Probleme aufmerksam zu machen, die ffentlich zu diskutieren
ntig wre. Die Skandalpraxis wre dann ein unschn lrmendes Prludium fr
eine vernnftige ffentliche Debatte. Aber die funktionale Reinterpretation, kann
sie der Skandalpraktiker selbst noch leisten? Er mte sich, wollte er dies tun, in
irgendeiner Form fr den Skandal entschuldigen: >Glaubt mir, ich habe diese
Tabuverletzung nur begangen um dieser vernnftigen Sache willen.< Was aber,
wenn der Skandalpraktiker sich nicht entschuldigt? Wenn er die Frage, ob es eine
funktionale Reinterpretation des Skandals gibt, selbst offen lt? Wenn er darber
hinaus sogar bestrebt ist, den Skandal zu perpetuieren, gleichgltig, ob es einen
sozialen Sinn dafr geben knnte oder nicht? Wenn sich die Skandalpraxis verste-
tigt zu einer kontinuierlich skandalsen Art des Auftretens? Es sind dies Fragen,
die auf die Schwierigkeiten verweisen, dem Pnomen der Bohme gerecht zu wer-
den.
b) Literarische Darstellungen
Das Treiben der Bohme ist ein prominentes Thema zahlreicher literarischer Dar-
stellungen, die ihr Auftreten nicht nur begleiten, sondern verstrkend dazu beige-
tragen haben, ihr Bild auszustatten. Man kann von einer spezifischen Affinitt lite-
rarischer Produktion und Boheme sprechen, nicht nur, weil Boheme selbst zu
einem groen Teil aus Literaten besteht, sondern auch, weil die Distanz der
Boheme zu unsicher gewordenen Lebensformen ebenso wie der berhhte avant-
gardistische Anspruch ihrer Gestalten, ihr luxurierendes Herausfallen aus der Ord-
nung des Sozialen auf Probleme knstlerischer Existenz verweisen, die sich am
Thema Boheme besonders gut darstellen lassen. Mehr noch als wissenschaftliche
Untersuchungen sind es Romane und Erzhlungen gewesen, die das, was Boheme
sein kann, konturiert haben.
Dies gilt nicht nur fr Frankreich, wo die Werke Murgers und Valles' den Typus
Bohme definiert haben, sondern gerade auch fr Deutschland, wo seit den 40er
Jahren nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Treibens der junghegelianischen
Bohme zahlreiche Werke erscheinen, die sich dieses Motivs zentral oder in
Nebenepisoden annehmen. Die wichtigsten literarischen Darstellungen seien kurz
skizziert.
150
In W. Elias' Novelle Shne der Zeit (1840) gert der Student Leopold unter
den Einflu der Hegelschen Philosophie und entwirrt grandiose Programme fr
eine welterschtternde literarische Bewegung. Die Existenzbedingungen der
>Lohnliteraten< sind Thema des Romans Alfred von A. v. Sternberg (1841). Kon-
trastierend werden zwei Verlegertypen dargestellt: Nehrmann, ein >solider<
Geschftsmann, der im alten Stil mit seinen Autoren umgeht, und Potter, der die
Schriftsteller skrupellos in seine Abhngigkeit bringt und sie zwingt, entgegen
ihren berzeugungen zu schreiben, was finanzkrftige Interessenten lesen wollen
und was sich auf dem Markt verkaufen lt. In S. Brunners Des Genies Malheur
und Glck (1843) treten junghegelianische Intellektuelle auf, die zunchst mit
294
einem blasphemischen Atheismus Skandal machen, um dann zum Katholizismus
zu konvertieren. Die spteren biographischen Entwicklungen E. Bauers und Marie
Dhnhardts sind hier literarisch antizipiert. Das Spektrum der intellektuellen Posi-
tionen zwischen dem Radikalismus und Frhsozialismus der 40er Jahre wird in
Klenckes Roman Das deutsche Gespenst (1846) dargestellt. In besonderer Weise
stilbildend fr die literarische Verarbeitung des Bohememotivs wurde Marcards
Ein Literatenleben (1847). In dieser Erzhlung verdirbt sich der Held Wilhelm
durch das Studium von Hegel und Feuerbach seine gesicherte brgerliche Existenz
und wird Journalist. Er gert in notorische Geldnot und wird als lumpenproletari-
sche, moralisch unzuverlssige Existenz dargestellt. Wilhelms Literatenleben endet
mit Krankheit und Hungertod. Diese Motive finden sich auch in H. Raus Roman
Genial (1844).
Nach der Revolution setzt zu Beginn der 50er Jahre eine zweite Konjunktur von
literarischen Produktionen ein, in denen Motive der junghegelianischen Boheme
thematisiert werden. In seinem Roman Der Tannhuser (1850) stellt der preui-
sche Ministerialbeamte A. Widmann, der sich nach 1849 ganz der Romanschreibe-
rei widmete, in seinen Helden Friedrich und Muhr zwei gegenstzliche Bohemety-
pen dar. Friedrich, der sich selbst den Titel Ich, als der Vollzieher des Weltgei-
stes zulegt, tritt als prophetischer Sektengrnder auf, der kraft seines Geistes zur
Weltherrschaft strebt, aber schlielich scheitert, weil die Brger an der Verwirkli-
chung seiner Theorien ber die freie Liebe Ansto nehmen. Dagegen setzt der Lite-
rat Muhr ganz auf das Negative: An der Auflsung der Welt arbeiten, heit From-
mes tun und: Vernichtung aller herrschenden Begriffe von Staat und Gesell-
schaft, so heit die Parole.
151
Friedrich ist der genialische Weltverbesserer, der wie
ein Knig Hofhlt und sich von seinen Jngern kritiklos verehren lt. Muhr dage-
gen reprsentiert einen rckhaltlosen Nihilismus, dessen Skandalpraxis allein der
Erzeugung chaotischer Unruhe dient. In positionellen Abschattierungen gruppie-
ren sich noch weitere Intellektuellenfiguren um die beiden Protagonisten, die ihre
Konturen verstrken helfen.
Als gezielte Polemik gegen die Tbinger Junghegelianer hat Wilhelmine Canz
ihren dreibndigen Roman Eritis sicut deus (1854) geschrieben. Hinter der
Romanfigur Robert Schrtel steht der Junghegelianer F. Th. Vischer. Die Endek-
kung, da der menschliche Geist der Gttliche ist: da es auer dem Menschen
keinen weiteren gttlichen Geist gibt, fhrt bei Schrtel zu einem bersteigerten
Geniekult, in dessen Zentrum er sich selbst setzt. An Schrtels Ehe zeigt die Auto-
rin die destruktiven Folgen der hegelianischen Spekulation auf. Schrtels Ehefrau
wird schlielich wahnsinnig angesichts einer Philosophie, die die zum tollen
Tanze des Widerspruchs verkehrte Welt reflektiert.
152
Schrtel geht von der Phi-
losophie zur Politik ber und beteiligt sich mit Gleichgesinnten an konspirativen
Aktivitten. Die politische Phraseologie dieser Gruppe wird von Canz dem herab-
lassenden Verhalten gegenbergestellt, das diese >Anwlte des Volkes< den unteren
Gesellschaftsschichten alltglich entgegenbringen.
Aus dem Kreise der Junghegelianer hat W. Jordan 1851-53 in seinem dreibndi-
gen Versepos Demiurgos zahlreiche Motive der junghegelianischen Szene der
40er Jahre verarbeitet. In einer heute schwer lesbaren philosophischen Lyrik entfal-
tet Jordan weniger das pittoreske Bild der Boheme als vielmehr das Spektrum der
295
spekulativen und kritischen Positionen der Gruppendebatten. Den Rahmen der
sprlichen Handlung bildet das Theodizeeproblem, dargestellt in allegorischen
Gestalten: Luzifer schliet als Demiurgos mit seinem Gegenpart, dem absolut
guten Prinzip Agathodmon, eine Wette ber die Mglichkeit der Verwirklichung
des Guten ab. Agathodmon nimmt Menschengestalt an und beginnt, als idealisti-
scher Jngling Heinrich der Reihe nach alle mglichen Entwrfe eines vollkomme-
nen Lebenslaufs durchzuexperimentieren. Vom Entwurf hellenistischer Liebe
ber soziale Philanthropie, die verschiedensten frhsozialistischen und junghege-
lianischen Positionen, den Versuch eines politischen Pragmatismus im Kampf fr
ein Parlament bis hin zur Vertiefung in die Naturwissenschaften reichen die Expe-
rimente Heinrichs, der in jedem Entwurf nach anfnglichem Aufschwung rasch
wieder weit- und lebensmde wird. Auch in der vollkommenen Utopie Nirgend-
heim verliert er seine Wette gegen den luziferischen Demiurgos, den Jordan der
gnostischen Tradition entnommen hat.
153
Die skizzierten literarischen Darstellungen von Motiven der junghegelianischen
Boheme sind sowohl, was ihre literarische Qualitt, wie auch, was ihre mehr oder
weniger bohemekritische Intention angeht, sehr heterogen. Aber mag es sich um
eine moralisierende Warnliteratur wie bei Marcard, um eine neupietistische Pole-
mik wie bei Canz oder um ein spekulativ allegorisches Gemlde wie bei Jordan han-
deln - was zur literarischen Darstellung reizt, ist das Don Quichottehafte der
Genies, ihr Behaupten von Mglichkeiten, ihre Exzentrik. Die literarische Darstel-
lung kann es sich auf der fiktionalen Ebene leisten, diesen Dimensionen weit mehr
Raum zu geben als dies auf anderen Aussageebenen mglich ist.
Soziologisch relevant gemacht werden knnen dabei in besonderer Weise litera-
rische Darstellungen, die mit den Mitteln der Satire arbeiten. Die satirische Zeich-
nung von Charakteren selbst liegt nahe bei dem Verfahren soziologischer Typenbil-
dung. Hier wie in der Satire werden Verkrzungen und Stilisierungen vorgenom-
men, quasi idealtypische Bndelungen von Phnomenen, die nicht als abgebildete
Wirklichkeit behauptet werden, sondern von denen gewut wird, da sie so >rein<
nicht in der Wirklichkeit vorkommen. Wie die Satire bertreibt soziologische
Typenbildung bestimmte Phnomene, um sie begrifflich abgrenzbar zu machen. Es
handelt sich in beiden Fllen um ein konstruktivistisches Verfahren.
154
Geht man
den soziologischen Typendefinitionen gerade der Boheme nach, so wird man zahl-
reiche Affinitten zu satirischen Bohemedarstellungen finden. Ein Grund hierfr
knnte auch darin liegen, da beide Verfahren, auf den Gegenstand Boheme ange-
wandt, dem Auftreten dieses Phnomens insoweit entgegenkommen, als der Bohe-
mien im Versuch, seinen Entwurf auch gegen die >Realitt< zu leben, selbst einen
Groteil der Stilisierungsarbeit leistet. Wo Satire wie Soziologie andere Lebensfor-
men wie z.B. die bestimmter Proletariergruppen oder brgerlicher Schichten typi-
sieren, beziehen sie sich auf Gestalten, die in der Regel kein derart bewut entwurf-
haftes Verhltnis zu ihrer Existenzweise haben wie die Boheme.
Die literarischen Darstellungen der junghegelianischen Boheme abschlieend
mchte ich auf zwei Romane ausfhrlicher eingehen, in denen satirische Elemente
besonders prsent sind.
Klara Mundt, an die sich R. Gottschall spter als eine etwas verwilderte George
296
Sand erinnert,
1
'
5
verffentlicht 1844 unter dem Pseudonym Luise Mhlbach
Eva. Ein Roman aus Berlins Gegenwart. Verflochten mit der vormrzlichen
>Emanzipations-Story< der Hauptfigur Eva wird das Schicksal ihres Bruders, des
Buchdruckergesellen Fritz Wendt, dargestellt, der sich entscheidet, Literat zu wer-
den:
Nein, statt Bcher zu drucken, lasse ich jetzt die Eingebungen meines Genius drucken
(. . .). Die goldene Zeit der Freiheit, der Gerechtigkeit, der Macht des Volkes mit heraufzu-
beschwren, dazu hat mich das Schicksal berufen, das Volk hat mich zu einem seiner Vertre-
ter aufgerufen und ich bin seinem Ruf nicht taub gewesen!
Nach dem Vorbild G. Herweghs schickt er sich an zu einer jener Triumphrei-
sen, wie sie die glorreichen Dichter unserer Tage durch ganz Deutschland machen,
nachdem ihre Lieder mit Enthusiasmus berall aufgenommen werden.
156
In Berlin trifft er, der das wohlklingende Pseudonym Bonaventura von Otters-
heim angenommen hat, auf die Junghegelianer Weinherr und Rautenweg (letzterer
spielt wohl auf Rutenberg an). In zahlreichen satirisch gestalteten Szenen macht
Klara Mundt die Phrasenhaftigkeit der politischen Bekenntnisse deutlich, hinter
denen nur das selbstzweckhafte Karussel einer sich gegenseitig bespiegelnden intel-
lektuellen Gruppe steht. So stellt sich Weinherr mit den Worten vor:
Ich widme mein Leben, meine Zeit, dem einzigen hohen Ziel, der Befreiung Deutschlands,
und wenn ich morgens mindestens drei Stunden Zeitungsartikel geschrieben, finde ich noch
Kraft und Mut in mir, nachmittags mehrere Stunden hintereinander in den Kaffeehusern
und Lesekabinetten zu sein, um durch lebendiges Wort und eifernde Rede den Mut meiner
Freunde zu beleben und ihre Kraft anzufachen.
157
Die Kommunikation der Gruppe handelt entweder von einem eintrchtigen
gegenseitigen Rezensieren, oder es geht um ein berbieten der Schreibleistung des
anderen.
Je extravaganter und ausschweifender seine (d. h. Bonaventuras, d. V.) Gedichte waren,
desto mehr wurden sie erhoben und gepriesen, und desto mehr beeiferte sich Herr Wein-
herr, dieselben in lobenden Zeitungsartikeln zu preisen, und solches Lob pflegte dann
Bonaventura wieder mit einem Lobgedicht auf Herrn Weinherr zu erwidern. Dann sorgte
Rautenweg, da dies in einem andern Journal abgedruckt ward, wofr Herr Weinherr dann
wieder zum Lobe Rautenwegs anderswo einen >Artikel< verfate. Es war ein stetes Hin- und
Wieder-Loben, bei dem jeder gewann, und sich den anderen verpflichtete, und wobei jeder
doch wohl nur zum Wohl des Landes, zur endlichen Befreiung Deutschlands zu wirken vor-
Die Satire akzentuiert die Bewegungsformen einer Intellektuellengruppe, deren
einzige Praxismglichkeit die politische Schriftstellerei ist. Im Verlauf der Erzh-
lung treten politische Sinngebung und kollektive Abhngigkeit von der Schriftstel-
lerei zunehmend auseinander.
Zum Gruppenkonflikt kommt es, als der Literat Sylvius den Literaten Weinherr
in einem Artikel angreift, er sei nichts als ein aufgeblasener Schreier, ein kleiner
unbedeutender Hegeling, der sich nur der heiligen Sache der Freiheit hingegeben
mit hohlem Wortgeklingel und migen Redensarten, und um eine Art Bedeutung
dadurch zu erlangen.
159
Sylvius verteidigt seine Auffassung in der Gruppe und
fragt:
297
Was sind eure Artikel, mit denen ihr euch brstet, denn weiter anders als grelle Aushnge-
schilder eures Gewerbes? und weil euch denn das Erhabenste, weil euch die Freiheit nur ein
Gewerbe ist, darum werdet ihr mit Recht verspottet und verschmht, und darum wendet
sich jeder Mann ab von eurem hohlen Wortgeklingel und euren hochtnenden Phrasen,
jeder Mann, dessen Wahlspruch ist: nicht sprechen, sondern handeln! Hier schwieg Sylvius
und noch einen glhenden stolzen Blick auf die Versammlung werfend, verlie er hochauf-
gerichtet das Gemach. - Man hatte geschwiegen, wie erstarrt vor Schreck ber solch uner-
hrte Frechheit. Jetzt aber brach der Sturm los, und man hrte ihre Flche und Verwn-
schungen, Rachegeschrei und Verachtung gegen Sylvius. Er ist ein Legitimer! Ein berlu-
fer! Wer nicht fr uns ist, ist wider uns! Schande ber diesen Abtrnnigen, der die heilige
Sache der Freiheit verlassen und ein Knecht der Tyrannei geworden ist!
160
Vorlage fr diese Szene ist vermutlich Ruges Besuch bei den Berliner Junghege-
lianern im November 1842 gewesen. Die Sympathien der Autorin liegen deutlich
bei der Figur des Sylvius, den sie - eine politische Ortsbestimmung - nach Knigs-
berg abreisen lt. Was der Satire entgeht, ist der Umstand, da die Reden des Syl-
vius mit ihrem glhenden politischen Pathos sich nur wenig von den Reden der
anderen unterscheiden, allein die Thematisierung des Gewerbecharakters der poli-
tischen Schriftstellerei der Gruppe gibt ihm die Sonderstellung dessen, der das
Geheimnis der Gruppe lftet.
In der Gruppe kommt es zu einem makaberen Ausstoungsritual: an der Tafel
steht mit Kreide >Sylvius, Ausgestoener !< geschrieben, und Weinherr fordert die
Gruppenmitglieder auf, einzeln diesen Spruch mit einem Kreidekreuz an der Tafel
zu besiegeln. Mit dem Ausschlu von Sylvius geht die Gruppe zu einem gesteiger-
ten Radikalismus ber. Die Freiheit darf nichts gemein haben mit dem Gesetz, die
Freiheit mu gesetzlos sein, eine gesetzliche Freiheit ist schon wieder eine bedingte,
beschrnkte, eine in sich gefesselte, die Freiheit mu aber eine absolute, ber das
Gesetz erhabene sein!
162
Die Geschichte der radikalen Protagonisten endet damit, da Polizei und Regie-
rung Weinherrs journalistisches Talent entdecken und ihm einen eintrglichen
Posten bei einer regierungstreuen Zeitung verschaffen. Rautenberg dagegen wird
aus Berlin ausgewiesen. Gegen Weinherr fhlt er sich jedoch ungerecht behandelt:
Mich, der ich bedeutend mehr Talent habe, mich verbannt man und ihm (Wein-
herr, d. V.) gibt man so bedeutendes Gehalt! Ich wrde diese Artikel viel besser
geschrieben haben! Aber so sind die Regierungen, sie machen bestndig Mi-
griffe!
163
Bonaventura schlielich gert an eine polnische Grfin, die von seinen
Freiheitsliedern begeistert ist, vor allem aber seinem aristokratischen Pseudonym
vertraut. Als der Namensschwindel auffliegt, will sich die Frstin mit der Knute
rchen. Dem entgeht der Freiheitsdichter nur dadurch, da er sich darauf einlt,
eine Hymne an die Knute zu dichten. Nach dieser Demtigung schlgt er die ange-
botene Pistole aus und flieht aus Berlin, um sich in Hamburg als Inhaber einer Leih-
bibliothek unter seinem brgerlichen Namen niederzulassen.
Ihre Spannung bezieht die Satire aus der Gegenlufigkeit zweier Profilierungs-
weisen der Intellektuellenexistenz: einmal sind die politisierenden Literaten oppor-
tunistische Gestalten, die ihre Schreibttigkeit >gesinnungslos< ausben, verfgbar
fr alle mglichen sich widersprechenden Ziele, zum anderen sind es >authenti-
sche< Charaktere wie Sylvius, die glaubwrdig profiliert werden. Indem beide in
298
eine dramatische Kollision gebracht werden, entfaltet die Satirikerin eine Binaritt
von bedeutungloser, selbstzweckhafter Phraseologie und bedeutungsvoller
>authentischer< Rede. Es handelt sich um eine heikle Binaritt, die herzustellen
nicht einfach ist. So gilt z. B. in einem Fall das Broschrenverbot durch die Regie-
rung als ein knstlich provoziertes Geschehen, das dem Ziel, bloes Aufsehen zu
erregen,- dient, im Falle des Verbots der Broschre des Sylvius handelt es sich dage-
gen um ein Geschehen, das auf eine >echte< Oppositionshaltung verweist. Zur Dis-
kriminierung beider Intellektuellentypen ist eine sorgfltig kalkulierte Zufuhr von
Motivation ntig. Diese Psychologisierung der Charaktere behindert jedoch, wenn
sie zu stark erfolgt, die satirische Intention der Darstellung. Denn um typisieren zu
knnen, mu die Satire Psychologisierungen zurckdrngen.
Weitaus gelungener als K. Mundts Satire ist der dreibndige Roman Moderne
Titanen. Kleine Leute aus groer Zeit, den der 23jhrige Robert Giseke 1850 ver-
ffentlicht.
164
Giseke verzichtet auf die Hereinnahme zur Identifikation einladen-
der Gegengestalten, alle Figuren, die er auftreten lt, erscheinen im Lichte der
Satire. Held des Romans ist Ernst Wagner, der, als Theologiestudent von den reli-
gionskritischen Debatten angesteckt, sich nicht in die provinzielle Enge einer
Landpfarrei eingliedern lt. Er gert in Konflikt mit seinen Amtsbrdern, nach-
dem er ein religionskritisches Buch publiziert hat. Aus der Provinz flieht er nach
Berlin, wo er sich der junghegelianischen Boheme anschliet.
Die Berliner Genies, die Giseke im zweiten Band seines Romans auftreten lt,
treffen sich in der Hippelschen Weinstube.
Die Philosophen der absoluten Kritik bildeten den Kern, Zeitungskorrespondenten,
Knstler, emanzipierte Frauen, ltere Studenten und eine Anzahl bummelnder und verbum-
melter Individuen - das Gros dieser Gesellschaft. (. . .) Es war das der freie Berliner Geist,
in seiner reinsten Abklrung, ungetrbt vom Bodensatze des Besitzes oder Amtes, ungetrbt
von Glauben oder Grundsatz, ohne von sich selbst abgezogen zu sein durch die Teilnahme
am ffentlichen Leben, nur sich selbst angehrend und der fortschreitenden Dialektik sei-
ner Entwicklung. Es war derselbe >Geist<, der in der christlichen Religion vor noch nicht
zehn Jahren die Offenbarung der absoluten Vernunft sich rhmte begriffen zu haben; dann
dieselbe als einen poetischen Mythos des Menschengeistes belchelte, dann als eine Ver-
rcktheit verhhnte und durch die kritische Ttigkeit alle Verrcktheiten, Religion, Staat,
Recht, Wissenschaft, Sittlichkeit, in ihr Nichts aufzulsen vermocht hatte, bis er diese Kritik
selbst als eine Verrcktheit entdeckte, das menschliche Denken fr beendet erklrte, und
nichts mehr behielt als den Grundsatz: leben und leben lassen!
165
Die Passage verweist auf zentrale Probleme, Boheme literarisch darzustellen. Die
pittoreske Vielfalt der versammelten Gestalten kann aufgezhlt werden, aber han-
delt es sich bei dem Abri der intellektuellen Odyssee der Gruppe um denselben
Geist? Dies kann nur gelten, wenn Boheme gleichsam als eine >Endstation< stili-
siert wird, als ein Zustand, von dem aus keine Entwicklungen mglich sind. Auch
die einzelnen Gestalten der junghegelianischen Boheme, die Giseke auftreten lt,
sind in je verschiedener Weise als Figuren profiliert, in deren Verhltnis zur Zeit
Geschichte problematisch geworden ist.
In der Weinstube tritt an jedem Samstag der groe Kritiker auf, eine Figur,
deren Zge auf B. Bauer hinweisen.
Der Prophet dieser gottlosen Sekte (!) pflegte an diesem Abend die Zusammenkunft seiner
299
unglubigen Glubigen durch seine Gegenwart zu verherrlichen. Die ganze Woche hin-
durch lebte er, fast ohne auszugehen, der Kritik; erst des Sonnabends machte er Feierabend,
begab sich unter seine Jnger und erfllte seine geselligen Bedrfnisse; des Sonntags ver-
schwand er und verweilte im Kreise seiner Familie, um in heimlicher Snde gegen den Geist
auch seinem Gemte Rechnung zu tragen.
Nach der Rede B. Bauers, in der er zwischen zwei Zgen auf dem Schachbrett
eine abschlieende weltgeschichtliche Einschtzung der deutsch-katholischen
Bewegung gibt, kommt E. Bauer kurz zu Wort. >Pereat Gott! < bramarbasierte der
burschikose Bruder des Groen, indem er auf den Tisch schlug, tiefsinnig in sein
Seidel starrte und es dann zur Hlfte leerte.
166
Zu den Berliner Genies gehrt auch der reiche franzsische Maler Caesar, der
in kurzem Sammetrocke, einen roten Schal malerisch um den Hals geschlungen,
auftritt. Caesar bemht sich ebenso wie Ernst um die Schauspielerin Delphine, die
unter Weltschmerz-Langeweile leidet. Fr Doktor Horn, eine Romangestalt,
hinter der sich Max Stirner verbirgt, ist Langeweile und Weltschmerz das Leiden
des Zeitalters. Die Ehe und die Polizei sind daran schuld. Kuriert die Welt von die-
sen beiden Epidemien, und wir werden glcklich sein, wie die Gtter. Caesar hin-
gegen will nicht so lange warten, bis die Welt aus lauter Junghegelianern besteht
(. . .). Ich dchte, Delphinchen, wir kmmern uns um das Prinzip und um die Welt
nicht, sondern wir lieben das Leben, und - leben, wie wirs lieben. Und Caesar
fragt gelangweilt zurck: >Sagen Sie, Doktor (Horn, d. V.), wie weit ist die
Menschheit heute? Wieviele Standpunkte sind seit vorgestern berwunden?<
167
Ob es sich um B. Bauers redundanten Wochenrhythmus, um E. Bauers letztes
>Pereat<, um die Langeweile Delphines oder den Hedonismus Caesars handelt, die
Figuren stehen gleichsam am Ende der Zeit, eine Position, die Giseke auch dadurch
symbolisiert, da er seinen Dr. Horn (Stirner) mit dem Selbstmord enden lt.
Diese >Endstation< erscheint als Konsequenz der Philosophie. In Horns
Abschiedsbrief heit es: Ich erklrte im Leben die Selbstbestimmung, die Selb-
stndigkeit, die Selbstliebe fr mein Prinzip; ich bin konsequent im Tode, wie ich's
im Leben war: ich sterbe durch Selbstmord. Sein ganzes Leben stellt sich ihm dar
als ein einziger schlechter Witz, der niemandem Spa gemacht hat, am wenigsten
mir selbst. Ein schlechter Witz und doch die Wahrheit selbst.
168
Was er durchlebt
hat, ist die Tragdie der Narrheit, wie er sie in einer gerafften Hamletinterpreta-
tion in der Hippeischen Weinstube vorgetragen hatte. Die Narrheit ist der allge-
meine Weltzustand.
Nur Hamlet, der Denker, der Philosoph, erkennt diese allgemeine Narrheit und will kein
Narr sein. Er denkt und denkt, will besser und gescheiter sein als alle die Andern, will nur
handeln aus Grnden der Vernunft, und - was wird er anders als wieder ein Narr? Von dem
Gedanken, kein Narr sein zu wollen, lt er sich zum Narren haben. Der Narr seines Den-
kens ! wei er doch nicht, da der Mensch kein Gott sein kann, und, wenn er kein Narr sein
will, entweder ein Teufel, oder - ein Toller sein mu. Zum Teufel fehle ihm der Mut, gereizt
von den anderen Narren wird er Narr seiner Wut und Rachsucht. Und so ist er der rgste
Narr von Allen. Die Andern sind simple Narren und wissen nicht anders zu sein, er wird
Narr in der zweiten Potenz. (. . .) Und die Moral von der Geschichte ist: die menschliche
Weisheit besteht darin, Tor zu sein mit Bewutsein, und die grte Torheit der Welt ist das
Bewutsein, kein Tor sein zu wollen.
169
300
Fr die Narren der zweiten Potenz gibt es keine Steigerungsmglichkeit mehr.
Ihr >Unsinnmachen< ist die Einholung der geschichtsphilosophisch entworfenen
Endzeit im Jetzt der Gegenwart. Was zur Satire reizt, ist, da hier eine letzte Posi-
tion behauptet wird, die dem Prinzip satirischer bertreibung selbst entgegen-
kommt. Seiner Natur nach ist das Genie geduldig, je unsterblicher es ist, desto
besser versteht es zu warten, schreibt Rosenkranz im Zusammenhang seiner Theo-
rie der Karikatur.
170
Fr die in der Satire erscheinenden Genies gibt es allenfalls ein
leeres Warten, die Langeweile.
c) Zum Begriff >Bohme<
Die erste Arbeit zur Bohme in Deutschland stammt von Julius Bab. Er kndigt sie
1904 als eine Vorstudie zu einer groen historischen Arbeit, an, in der das Kul-
tur-Zigeunertum, d. i. die zentrifugalen Elemente der Menschheit eine Betrachtung
finden sollen, die sich zum Grundri einer neuen Wissenschaft auswachsen drfte:
der Asoziologie.
171
Die annoncierte Arbeit ist nie erschienen, und auch die neue
Wissenschaft hat ihre Stimme im Konzert der Disziplinen noch nicht erhoben.
Dennoch, die Bezeichnung Asoziologie verweist auf eine eigenartige Spannung
zwischen dem Phnomen Bohme und soziologischer Denkweise.
Zu nennen sind hier zunchst die klassentheoretischen Probleme. Sie finden sich
schon in der Marxschen Auskunft von 1852:
Neben zerrtteten Roues mit zweideutigen Subsistenzmitteln und von zweideutiger Her-
kunft, neben verkommenen und abenteuernden Ablegern der Bourgeoisie Vagabunden,
entlassene Soldaten, entlassene Zuchthausstrflinge, entlaufene Galeerensklaven, Gauner,
Gaukler, Lazaronis, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Maquereaus, Bordellhalter,
Lasttrger, Tagelhner, Orgeldreher, Lumpensammler, Scherenschleifer, Kesselflicker,
Bettler, kurz die ganze unbestimmte, aufgelste, hin- und hergeworfene Masse, die die Fran-
zosen la Bohme nennen.
172
Berufsbezeichnungen, lebensgeschichtliche Krisensituationen, die Situation der
Armut, die fahrende Knstlerexistenz, kriminelles und halbkriminelles Verhalten
aller Arten - keine Bestimmung reicht allein aus, lediglich die Summation: Aus-
wurf(e), Abfall, Abhub aller Klassen fhrt zu einer Kategorie: das Lumpenprole-
tariat. Als >Abfall aller Klassen< genau besehen eine >Unklasse<, die im Kontext der
Marxschen Argumentation dann aber wieder die einzige Klasse ausmacht, auf
die sich der bonapartistische Staatsstreich von 1851 sttzt.
173
Uns interessiert in diesem Zusammenhang nicht das aufschlureiche Zusam-
mentreffen zweier Schwachstellen der Marxschen Theorie (der Staatstheorie einer-
seits und der zweifelhaften Differenz eines geschichtsmchtigen Proletariats und
geschichtsohnmchtigen Lumpenproletariats andererseits), festzuhalten ist:
unter klassentheoretischen Gesichtspuntken ist Bohme eine zweifelhafte Residu-
alkategorie, die auch schichtungstheoretisch kaum zu vereindeutigen ist. Immer
bleibt ein >Bodensatz<, eine Restkategorie, in der sich seltsame Vermischungen,
Symbiosen, bizarre Kombinationen von alter Armut und Kriminalitt mit extre-
mem sozialem Abstieg und >Aussteigern< aller Art finden.
Bohme als ein konturiertes Phnomen gibt es erst seit den 30er Jahren des
19. Jahrhunderts in Paris. Die franzsischen Romantiker Petrus Borel, Theophile
301
Gautier und Gerard de Nerval definierten sich als Bohemiens. Mit Henry Murgers
>Scenes de la Vie de Bohme (1851) wird der Name Bohme popularisiert. Aber
>Bohme< ist nicht auf die literarisch-sthetische Komponente hin zu vereindeuti-
gen. Mit Jules Valles >Les Refractaires< (1865) verbindet sich eine Bohme, die sich
aus widerspenstigen Arbeitsverweigerern aller Schichten zusammensetzt, vorran-
gig aus einem intellektuellen Proletariat^ das keine Chance und keinen Willen hat,
sich den Standards der >Normalgesellschaft< anzupassen.
Fr Deutschland mag man sich streiten, inwieweit romantische Knstlerverbin-
dungen wie die zwischen E. T. A. Hoffmann und dem Schauspieler Devrient oder
das provokative Auftreten Grabbes in Berlin zur Bohme zu rechnen sind, unstrit-
tig in der Forschung ist die Feststellung Babs, da es sich bei den junghegeliani-
schen >Freien< bei Hippel um eine Gruppe gehandelt hat, die einen echten und
rechten Bohmecharakter trug.
174
Die naturalistische Berliner Bohme des ausge-
henden 19. Jahrhunderts um die Brder Hart, Bruno Wille und J. H. Mackay ent-
deckt in den Junghegelianern ihre legitimen Vorgnger. Die Stirner-Renaissance
der 90er Jahre steht nicht zuletzt im Zeichen der Bohme; Stirners Formulierungen
von den extravaganten Vagabonden, deren vagabundierende Lebensart dem
Brger mifalle, werden enthusiastisch aufgenommen.
173
Sofern man nicht ahistorisch den soziologischen Begriff des abweichenden Ver-
haltens< als einer sehr groben Ordnungskategorie berstrapazieren will, bietet es
sich an, Bohme nheren abgrenzbaren historischen Phnomenen festzumachen.
H. Kreuzer hat in seiner grndlichen Untersuchung zur Bohme bereinstimmend
mit anderen Autoren darauf aufmerksam gemacht, da die >Geburt< der Bohme
im Zusammenhang mit den Auswirkungen der kapitalistischen Wirtschaftsform
auf die literarische Produktion zu sehen ist.
176
Bei der Herausbildung eines Marktes
fr Literatur handelt es sich zwar um einen Proze, der schon im 16. Jahrhundert
einsetzt, aber die dem Markt korrespondierende Figur eines Schriftstellers, der sei-
nen Lebensunterhalt ausschlielich durch den Verkauf von literarischen Produk-
tionen bestreitet, ist in Deutschland erst mit der Generation der Schriftsteller des
Jungen Deutschland greifbar.
177
Zwar haben z. B. Gottsched, Klopstock, Goethe,
Novalis und Eichendorff auch fr einen Markt produziert, aber sie sind nicht in
ihrer wirtschaftlichen Existenz vom Markt abhngig gewesen.
Die Entstehung der Idee eines freien Schriftstellers, die im 18. Jahrhundert
anzusiedeln ist, reicht fr die Konstituierung der Bohme nicht aus. Entscheidend
ist die Entstehung eines Lohnliteratur.
178
Sie steht im Zusammenhang mit der
Ausbreitung der Massenpresse, die einen kontinuierlichen Zuflu von Texten
bentigt und entsprechend der stckweise abgelieferten Artikel auch einen konti-
nuierlichen Rckflu von Geld an die Autoren ermglicht. Auch grere Roman-
werke erscheinen in der Erstverffentlichung nicht geschlossen als Buch, was bei
den Produktionszeiten eines Romans zu gravierenden Kreditproblemen bei den
marktabhngigen Autoren fhrt, sondern als Fortsetzungsroman in Zeitungen.
Die in den 30er und 40er Jahren entstehende Lohnliteratur verschrft das Pro-
blem der Diskriminierung von >anspruchsvoller< und >einfacher< Literatur. Zwar
hat es von den Zeitgenossen entsprechend klassifizerte >Trivialliteratur< schon
zuvor mit der Entstehung des Literaturmarktes gegeben, aber mit der Abhngig-
keit der schriftstellerischen Existenz vom Markt tritt auch fr Autoren, die zu
302
anspruchsvollen Leistungen von ihren schriftstellerischen Fhigkeiten her in der
Lage sind, mitunter die konomische Notwendigkeit ein, Texte schneller zu produ-
zieren, was zu Qualittsminderungen fhren kann. Die Form der Zeilenentlohnung
hat darber hinaus einen wichtigen Einflu auf die sthetischen Formprinzipien
gehabt. Sainte-Beuve berichtet: Es gibt Schriftsteller, die ihre Romane in Feuille-
tons nurin Dialogform schreiben, weil auf diese Weise bei jedem Gedanken, oft
schon bei einem Worte, eine neue Zeile angefangen werden mu.
179
Die Lohnliteratur ist in dieser Zeit ein neu auftauchendes Massenproblem. So
schtzt die Leipziger Buchhndlerzeitung die Zahl derer, die in London nur vom
literarischen Erwerbe leben, auf 4.000 Personen. Da von diesen viele die halbe
Woche Hunger leiden mssen, brauchen wir nicht hinzuzusetzen. Wollte man
die noch dazu rechnen, welche davon (vom literarischen Erwerb, d. V.) zu leben
den Versuch gemacht haben, ihn aber wieder aufgeben muten, weil sie dabei nicht
soviel verdienten, um Leib und Seele zusammenzuhalten, so knnten wir die
Summe verdoppeln. Angesichts des Elends der Literaten - auch denen weiblichen
Geschlechts, wie der Autor betont - und angesichts der Unberechenbarkeit des
Marktes mahnt der Autor: Es ist gut, wenn junge Leute sich zum Vergngen mit
literarischen Arbeiten beschftigen; allein wer einem jungen Freunde den Rat gibt,
sich ganz darauf zu legen, bernimmt wahrlich keine geringe Verantwortlichkeit.
Die Wahrscheinlichkeit ist wie tausend gegen eins, da, wer diesen Rat befolgt, sich
ein Leben voller Elend bereiten wird.
180
Aber woher kommen die vielen Litera-
ten?
Da es allein die grere Nachfrage nach Literatur gewesen sein sollte, die zur
Vermehrung schriftstellernder Existenzen gefhrt hat, ist schon Zeitgenossen zwei-
felhaft gewesen. Auf den Vorschlag, die Schrifsteller sollen knftig im Leben
einen besonderen unabhngigen Stand einnehmen, die freie Kunst solle zu der
Wrde eines Berufs erhoben werden, antwortet die Redaktion der Leipziger
Buchhndlerzeitung mit einem charakteristischen Hinweis auf die Ursachen des
Massenproblems:
Vor dreiig Jahren wurden die meisten Studenten, die auf Universitten nichts gelernt hat-
ten und im Examen verunglckten, Soldaten; zehn Jahre spter Komdianten, dann Dem-
agogen und jetzt Schriftsteller, vorzglich Journalisten. -Vor dreiig Jahren fiel von zwanzig
Einer durch im Examen, jetzt von zwanzig wenigstens fnf, und fnf Andere machen es lie-
ber gar nicht, sondern werden gleich Autoren. - Daher die furchtbare Masse in unserer Jour-
nalistik, die jeden redlichen Mann zum Errten zwingt.
181
Diesem durchaus glaubwrdigen Hinweis zufolge ist die Schriftstellerexistenz
massenhaft geworden, weil sie zu einer Art modischem Ausweichberuf fr diejeni-
gen geraten ist, die innerhalb der Ausbildungsinstitutionen scheitern oder keine
Anstellung erhalten haben, d. h. die Masse der Schriftsteller verweist auf das Pro-
blem des intellektuellen Proletariats.
Es wre jedoch unzulssig, >Bohme< mit dem intellektuellen Proletariat einach
zu identifizieren. R. Michels hat bereits Anfang der 30er Jahre beide Begriffe gegen-
einander abgesetzt.
182
Bei der Bohme< mag es sich zwar zum Teil um Angehrige
des intellektuellen Proletariats handeln, aber auch wirtschaftlich relativ erfolgrei-
che Literaten oder Knstler knnen Bohmiens sein. Was den armen Bohmien
303
und den reicheren >Edel-Bohmien< zusammenschliet, ist nicht mit rein konomi-
schen Kriterien zu bestimmen. Es handelt sich vielmehr um einen kulturellen Habi-
tus, einen selbstgewhlten Lebensstil, der fr die Bohme charakteristisch ist.
Die Beziehungen zwischen intellektuellem Proletariat und Bohme sind nicht
leicht zu klren. So sehr man darauf insistieren mu, da zur Bohme gehrt, ihre
Existenz nicht nur als eine unbrgerliche, sondern auch als eine von alter oder
neuer >Normalarmut< differente zu entwerfen, der selbstgewhlte Lebensstil, auch
der exzentrischste, ist immer bedroht, ein Massenphnomen im Bereich des intel-
lektuellen Proletariats zu werden. Der Zusammenhang zwischen einem betont
Bohmehaften Auftreten und den skizzierten sozialstrukturellen Entwicklungen
hin zu einer marktabhngigen schriftstellerischen Existenz und ihrem massenhaf-
ten Auftreten besteht gerade darin, da die sozial wahrgenommene Vielzahl
>gescheiterter< oder randstndiger Intellektueller das Bedrfnis nach gruppenm-
iger und kultureller Differenzierung bei den Betroffenen herausfordert. Wer
Bohme und wer intellektuelles Proletariat ist, ist daher sowohl unter denen, die
jeweils dazu gerechnet werden knnten, wie bei denen, die von auen die Szene
betrachten, in hohem Mae umstritten. Gerade in diesem Bereich ist der Abgrund
zwischen Selbstdefinition und Fremddefinition kaum zu berbrcken.
So weist z.B. Ruge den Vorwurf, die Junghegelianer seien nur wenige prolatre
Individuen, besitzlose belwollende Unruhestifter, ebenso entschieden zurck
wie die Meinung, als seien die freien Schriftsteller darum so frei, weil sie nur br-
gerliche Proletarier wren, oder als seien die zensurwidrigen Schriftsteller wis-
senschaftliche Proletarier. Nur der Intellektuelle sei solide, der seine geistige
Zahlungsfhigkeit (!), das Liquidmachen des Gewuten beweisen knne, und das
seien nur die prinzipiellen und fundamentalen Neuerer, eben jene Verachte-
ten.
183
- Dennoch, so sehr sich Ruge auch bemht, seinen Entwurf fr eine freie
Schriftstellerexistenz gegenber stigmatisierenden Zuschreibungen zu immunisie-
ren, und versucht, dem verachteten Neuerer geschichtsphilosophisch eine promi-
nente Rolle zuzuschreiben, allein die Menge der Intellektuellen, die hnliches ver-
suchen, gibt der Bohmekritik immer neue Nahrung. Fr die Tbinger Jahrbcher
steht fest: Das Heer der Literaten, das seine Leerheit und Unbedeutendheit hinter
dem Interesse und dem Feldgeschrei fr eine groe Sache verbergen wollte, zog
jene Philosophie (die Hegelsche, d. V.) auf die Stufe seiner Bildung herab.
184
Zwi-
schen Ruges Selbstdefinition und den Angriffen des Tbinger Junghegelianers ist
keine Vermittlung denkbar.
Der Positionenstreit der philosophischen Schule war trotz aller Labilitten
gegenseitig noch kohrent >verstehbar<, ebenso ist im bergangsfeld zur politi-
schen Partei immer noch eine Kommunizierbarkeit zwischen radikaleren, weniger
radikalen, nicht ganz gemigten und gemigten Positionen denkbar gewesen
und hat sich auch den lokalen Diskussionsspektren entsprechend z. T. hergestellt.
Der Streit um den Wert der Bohme dagegen verweist auf eine Kommunikations-
grenze und markiert in der Tat ein Phnomen, das mit J. Bab asoziologisch
genannt werden knnte. Zwei Versuche ber die Bohme mgen das Phnomen
verdeutlichen.
1846 gibt E. Dronke in seinem Berlin-Buch eine Charakteristik der Bohme, die
304
sich aus verschiedenen Gruppen zusammensetzt. Von der Gruppe der Freien
oder Emanzipierten schreibt er: Sie begngen sich nicht damit, die Unsittlich-
keit der heutigen Moralittsbegriffe erkannt zu haben, und die veranlassenden Ver-
hltnisse derselben in der ihnen zustehenden Weise zu bekmpfen: sie wollen viel-
mehr im ffentlichen Leben beweisen, da sie darber >hinaus< sind. ber die
adquate Erkenntnis mag man streiten wie in einer philosophischen Schule, fr die
Vernderung der Verhltnisse im Rahmen einer Partei sich praktisch engagieren,
aber die Bohme tut etwas anderes, sie beweist, da sie in spezifischer Weise
nicht dazu gehrt.
Das, was sie in sich, in der Kritik durchgemacht und erkannt haben, gilt ihnen fr berwun-
den; es >existiert< nicht mehr fr sie. Dies Negieren einer Existenz, welche, wenn auch ver-
werflich, doch noch in der Gesellschaft vorhanden ist, mu in dem tatschlichen Ausdruck
des Lebens kindisch und lcherlich erscheinen. Allein die Emanzipierten kehren sich nicht
daran, wenn sie mit Philister- und Polizeiwelt in Konflikt kommen, ja es ist ihnen vielmehr
ein erhebender Beweis ihres eigenen fertigem Bewutseins.
185
Es ist, als ob man es mit Wahnsinnigen zu tun htte, die jeden Realittsbezug ver-
loren haben. Sie erklren Normen fr nicht existierend und beweisen dies durch ihr
Auftreten.
Dies mag vielleicht angehen, wenn ein Philosoph auf dem Katheder die mensch-
liche Willensfreiheit damit beweist, da er nach ausfhrlichen Errterungen, er
werde jetzt aus freiem Willen seinen Bleistift fallen lassen, dies auch wirklich tut
und erklrt, es stehe ihm frei, dies jetzt gleich zu wiederholen. Aber das Beweisen
der Bohme spielt sich nicht an einem Orte ab, der fr Beweise eingerichtet ist,
sondern an einem Ort, wo zweifelhaft ist, ob hier berhaupt ein Terrain fr Beweise
dieser Art gegeben ist.
So rtselt Dronke, was denn jene Zigarren rauchenden, Bier trinkenden emanzi-
pierten Frauen, die wie Marie Dhnhardt und Louise Aston auftreten, wollen:
Sie wollen damit keineswegs gegen eine Sitte, welche sie als borniert und philisterhaft
erkannt, mit der allgemeinen Waffe des heutigen, friedlichen Bewutseins der >Demonstra-
tion< zu Felde ziehen; es fllt ihnen nicht ein etwas zu bekmpfen, was fr sie nicht existiert.
Sie wollen nur ihre innere berlegene >Fertigkeit< zur Schau tragen.
186
Der soziale Sinn, dem Dronke nachrtselt, ist kaum kommunizierbar. Fr ihn ist
der Sinn ein Zur-Schau-tragen, ein Sinn, der eben keinen Sinn machen kann,
wenn die Demonstration, wie er auch wei, gerade nicht beabsichtigt ist. Der
Begriff Skandalpraxis, den wir im letzten Abschnitt benutzt haben, wre, so gese-
hen, ein AntiBohmebegriff, der nicht mit der Intention derer, die so auftreten, zur
Deckung zu bringen ist, oder bei dem zumindest nicht sicher ist, ob er der Intention
entspricht oder nicht. Diesen Bohmetyp nennt Dronke die philosophischen Pos-
senreier und die philosophischen bermenschen, zu denen er namentlich
M. Stirner und B. Bauer rechnet.
187
Die zweite Gruppe, die Dronke anfhrt, ist der literarische Tro, der sich
berall als Anhngsel zu den politischen Parteien findet. Dieser wisse
nicht, um was es sich handelt, sondern greift nur vom Hrensagen die Stichwrter des
Tages auf und rasselt hiermit ber das geistige Schlachtfeld. (. . . ) In allen Parteien, in allen
Blttern, den kleinsten und den grten, und in den letzteren noch am meisten treibt der
305
literarische Tro sein Wesen. (. . .) In der Sicherheit der Borniertheit urteilt die Ignoranz des
literarischen Trosses mit der grten Keckheit die Hauptfragen des Lebens ab, indem sie
sich die philosophische Possenreierei zum Vorbild nimmt, welche alles >berwunden< und
>aufgelst< hat.
188
Zum literarischen Tro rechnet Dronke Mitarbeiter der ALZ, wie Faucher
und Reichhard, und er wrdigt Marx' und Engels' Heilige Familie als eine ange-
messene Verspottung dieses Literatentyps.
Hinzuweisen ist auf eine Nuance der Differenzierung: die philosophischen Pos-
senreier werden als singulre Gestalten eingefhrt, die etwas beweisen oder
zur Schau tragen, der literarische Tro ist ein Massenphnomen. Dronke ist
gezwungen, die Bohme doppelt darzustellen: als singulre Absurditten und als
kollektive Ignoranz. Die Doppelung des verachteten fundamentalen Neuerers
bei Rge und des Heeres der Literaten in der Tbinger Kritik wiederholt sich
hier.
Schlielich fhrt Dronke eine dritte Gruppe an: die Literaten des Mig-
gangs.
Die abstrakten Literaten, welche nichts gelernt haben und nichts lernen wollen, bezeich-
nen zum Zweck ihrer sog. Literatur den Stil und die Unterhaltung. Da sie mit ernsten Din-
gen sich zu beschftigen keine Kraft und keine Erkenntnis haben, so suchen sie den Ernst
und das hhere Bestreben in Mikredit zu bringen, indem sie offen aussprechen, da die
Literatur des Miggangs, die sog. Belletristik, keinen hheren Zweck und keinen tieferen
Grund haben drfe.
Dronke macht deutlich, da es bei dieser Gruppe um Autoren geht, die vom lite-
rarischen Markt abhngig sind. Ihr ganzes Dasein ist eine literarische Spekulation:
sie sehen nur dahin, wo sie Geschfte machen knnen, und streben nach dem aller-
dings >hheren< Ziel, sich einen Namen zu verschaffen. Sie betrachten die Presse
nicht als ein Mittel zum Ziel, sondern als das Ziel selbst. Sie wollen >Literaten<,
Schriftsteller sein. Hierzu rechnet Dronke wiederum in der charakteristischen
Doppelung alle berhmten >Schriftsteller<, deren Werke man von vorn bis hinten
durchlesen kann, ohne da man sich zu sagen vermchte, weshalb der Mann ber-
haupt schreibt, ohne ein bestimmtes Streben daran zu finden, ohne Interesse dafr
zu fhlen; und ebenso die ganze Horde der Schleppentrger dieser Gesinnungs-
losigkeit, jene dummen Jungen, welche in belletristischen Blttern und Feuilletons
ihr Wesen treiben und gleich der Gaminsliteratur des literarischen Trosses ber
alles urteilen, von dem sie ihrem Bildungsstand nach nichts verstehen knnen.
189
Das Dronkesche Bohmebild ist aus Gruppen und Figuren komponiert, die
soziale Dysfunktionalitten bezeichnen, die auf unterschiedlichen Ebenen liegen
und zu einem Bild zusammengefgt werden: die singulre Dysfunktionalitt eines
bersteigerten Intellektualismus, die kollektive Dysfunktionalitt einer viel zu
wenig durchdachten modischen Akklamation politischer Parolen, die singulr
erfolgreiche wirtschaftliche Spekulation auf dem Literaturmarkt und die Lohnlite-
ratur, die beide dysfunktional sind, weil sie Literatur als Selbstzweck, ohne andere
Referenz als die der Konjunktur, produzieren. Es handelt sich um Dysfunktionali-
tten, die bei aller Verschiedenheit im Bereich der ffentlichen Kommunikation
anzusiedeln sind.
306
Nicht abweichendes Verhalten schlechthin liegt dem Bohmebild Dronkes
zugrunde, sondern Strungen der Kommunikation, die entweder durch ein Zuviel
oder durch ein Zuwenig an >Intelligenz< hervorgerufen werden, die entweder durch
eine zu starke Bindung des kommunikativen Ausdrucks an die berzeugungen
oder durch ein viel zu schwaches Band zwischen Gesinnung und kommunikati-
ver Ttigkeit gekennzeichnet sind. Wenn ffentliche Kommunikation auf der Idee
der Wirksamkeit von Aussagen beruht, so strapaziert der philosophische Possen-
reier den Wirkungszusammenhang, weil er Selbstverstndlichkeiten voraussetzt,
die erst noch zu erklren wren. Der literarische Tro dagegen strapaziert den
Wirkungszusammenhang von ffentlicher Kommunikation, weil er ihn mit seinen
massenhaften und redundanten Akklamationen und Aburteilungen ber-
schwemmt. Die wenigen erfolgreichen und die vielen sich an diese anhngenden
Schriftsteller der Literatur des Miggangs strapazieren die ffentliche Kommu-
nikation, weil sie diese nicht mehr als Mittel fr kommunikative Zwecke, sondern
als Erwerbsquelle >mibrauchen<.
Angesichts dieser Strapazierungen der ffentlichen Kommunikation als eines
>Hauptnervs< der Gesellschaft wird die Spannung zwischen soziologischem Verste-
hen und asoziologischem Phnomen deutlich. In der Bohme kristallisieren sich
unter diesem Blickwinkel all jene extremen Dysfunktionalitten, die dem Projekt
der Distribution der Vernunft inhrent sind. Sowohl die geschichtsphilosophische
Thematik des avantgardistischen Darber-hinaus-Seins, die rasch in ein Nach-
hinken (Tro) umschlagen kann, wie auch die sich verschrnkenden Thematiken
der >Existenz von Vernunft< in der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Exi-
stenzprobleme der >Vernunfttrger< finden sich in den Stcken wieder, aus denen
das Bohmebild zusammengesetzt ist.
Der Beitrag zur Bohme, den der Soziologe P. Honigsheim 1923 verffentlicht
hat, unterscheidet sich nicht nur in Bezug auf die Professionalitt von den Ausfh-
rungen Dronkes.
190
Dieser hatte in den 40er Jahren die Berliner junghegelianische
journalistische Bohme vor Augen, Honigsheim kann sich schon auf die entfaltete
Vorkriegs-Bohme beziehen. Honigsheim hat seine Primrbeobachtungen im
berhmten Heidelberger >Cafe Hberlein< in dem Aufsatz mitverarbeitet. Wh-
rend Dronke die Bohme gleichsam als Summation verschiedener Dysfunktionali-
tten zusammensetzt, versucht Honigsheim, Bohme als reinen Typus im Sinne
Webers zu beschreiben, in dem sorgfltig Mischformen und Sonderflle aussortiert
werden.
Zur Bohme reinen Typs gehren Honigsheim zufolge keine Angehrigen von
Pariaklassen, auch nicht wandernde Unterhaltungsknstler. Die Form der Bohme
wird abgesetzt vom weinseligen Philologen- und Historikerkreis ebenso wie von
Stammtischen, Klubs, Salons, Knstlerzeitschriften, Fnfuhrtees etc. Auch die
esoterische Gemeinde von Dichtern und Gemeinschaften der Jugendbewegung
sind von der Bohme zu sondern. Fr Honigsheim stellt Bohme
einen Gegenschlag gegen Formen dar, die als typischer Ausdruck des Gemeinschaftsda-
seins angesehen werden, z. B. gegen die Familie, privilegierte Stnde usw. Andererseits
erscheinen uns diese als Gebilde, die in den Zeiten, in denen wir es mit Bohme zu tun
haben, zwar tatschlich weitgehend zweckrational und vergesellschaftet worden sind, die
307
aber noch mit dem Anspruch auf absolute Gltigkeit und auf verpflichtende Bindung des
Individuums auftreten. Gegen diesen Rest von Gemeinschaft oder gegen diese Pseudoge-
meinschaft wendet sich die Bohme.
191
Die bei Honigsheim dahinterstehende Tnniessche Unterscheidung von
>Gemeinschaft< und Gesellschaft< wird man heute nicht unbesehen bernehmen
knnen; wichtig an seinen Ausfhrungen ist die Beobachtung, da sich Bohme
kritisch gegen soziale Formen richtet, die als Pseudogemeinschaft erlebt werden.
Das >asoziale< Moment von Bohme, die Abwehr von gesellschaftlichen Bindun-
gen, richtet sich in erster Linie gegen >hochgehaltene< Formen des Sozialen. Wo es
im Proze der Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilsysteme und der >Rationa-
lisierung< gesellschaftlicher Beziehungen zu Reaktionsbildungen kommt, die Rck-
besinnungen auf bedrohte, stark werthaft erlebte soziale Formen fordern, Reak-
tionsbildungen, die einen sozialen Zusammenhalt >einklagen<, ergreift die Bohme
Partei gegen derartige Rettungsversuche.
Fr Honigsheim besteht unter religionssoziologischer Perspektive eine Kausal-
relation zwischen Katholizismus und Bohme. Bohme habe sich zunchst auer-
halb des protestantischen Kulturkreises entwickelt und sei mit zunehmender Inter-
nationalisierung und Interkonfessionalisierung auch in protestantischen Stdten
aufgetreten. Diese These kann hier nicht ausfhrlich errtert werden. Aber die von
Honigsheim bemerkte Bindung des Auftretens der Bohme an gegenreformatori-
sche Bestrebungen trifft fr die junghegelianische Bohme in Berlin durchaus zu,
wenn man bedenkt, da es gerade die katholisierenden Tendenzen im preuischen
Protestantismus gewesen sind, auf die die junghegelianische Bohme mit ihrer
blasphemischen Verspottung reagiert. Die Debatte um den christlichen Staat,
die Einfhrung einer strengeren Sonntagsfeier, wird von den Junghegelianern
nicht nur theoretisch als Gegenreformation eingestuft, sondern auch als Etablie-
rung von >Pseudogemeinschaft<, deren Unglaubwrdigkeit blogestellt wird.
Mit Hilfe der Honigsheimschen berlegungen lt sich auch das Spannungsver-
hltnis zwischen einer Bohmekritischen >Soziologie< und Bohmeaffirmativen
>Asoziologie< erhellen. Wo die Bohme sich von existierenden sozialen Formen
absetzt, sie nicht aus der Not eines intellektuellen Proletarierdaseins, sondern mit
Bewutsein >negiert<, korrespondiert sie mit Tendenzen, die sich der sozialen For-
men, die als bedrohte unverzichtbare Sinnreservoire erscheinen, besonders verge-
wissern wollen. Bohme reagiert auf eine besondere Betonung des Sozialen, auf dis-
kursive Zudringlichkeiten, die entstehen, wenn im Proze der Modernisierung das
soziale Feld sich umstrukturiert.
Die Bohme >beweist<, da man auch anders leben kann. Sie negiert den Zwangs-
aspekt sozialen Lebens. Insofern erscheint sie als Gegenstand einer >Asoziologie<.
Wo der Soziologe auf der prinzipiellen Unbersteigbarkeit der Tatsache >Gesell-
schaft< insistiert, gert ihm die Bohme zu einem schwer greifbaren asozialen Rest.
Um dem zu entgehen, mte der Soziologe einsehen, da es nicht zuletzt vielleicht
auch sein eigener Diskurs ist, der, weil er das Soziale besonders dringlich heraus-
stellt, weil er auf die Absolutheit von Gesellschaft und ihrer unentrinnbaren Imma-
nenz pocht, gerade den asoziologischen Schatten mitbewirkt. Eine Soziologie der
Bohme gelingt nur, wenn sich der Soziologe zumindest einmal gedankenspiele-
308
risch darauf einlassen knnte, da er mit seinem professionellen Gegenstand auch
einem Phantasma folgt, das Konterphantasmen auf den Plan ruft.
Der Vorwurf der Pseudogemeinschaft lt sich vom Soziologen auf die
Bohme und von dieser auf soziologisch hervorgehobene soziale Formen hin- und
herschieben. Honigsheim, der von der Bohme ebenso angezogen wie abgestoen
ist, kommt zum Schlu seines Aufsatzes zu einer charakteristischen Formulierung.
Wo es fr ihn um die Entwicklung neuer sozialer Formen geht, die er sich als Syn-
these aus Gesellschaft und Gemeinschaft vorstellt, mu die Bohme, d. h. bei ihm
jedes Sichheraussondern aus der Kampffront (!), jedes Esoteriertum, ja sogar infolge der
Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit der Aufgabe, zu der es sonst rettungslos zu spt sein
knnte, eine Hervorhebung des Privatlebens als eines Eigenwertes und Selbstzwecks abge-
lehnt werden. Mag also fr vergangene Kulturperioden, mag ferner, von einem anderen
Blickpunkte aus betrachtet, Bohme und so manche angrenzende (...) esoterische Lebens-
form, die vielleicht etwas eminent Geistiges an sich hat, als besonders sinnvoll erscheinen, -
von dem oben skizzierten Standorte (der Notwendigkeit einer Synthese aus Gesellschaft
und Gemeinschaft, d. V.) aus geschaut, mu sie als Kraftentziehung bedauert werden.
192
Trotz aller sozialen Einfhlung, die Honigsheims Text kennzeichnet, sein Urteil
ist eindeutig: die Bohme ist dort nicht zu gebrauchen, wo noch gesellschaftliche
Probleme gelst werden mssen. Bohme entzieht sich nicht blo Bestimmungen
eines gesellschaftlichen Funktionszusammenhangs, sie widersetzt sich auch der
Rede von historischen Aufgaben.
Was sich in der Analyse der literarischen Darstellungen abzeichnete, wird auch
hier deutlich. Die Bohme reinen Typs bricht mit der geschichtsphilosophischen
Thematik, in deren Auffaltungen sich die Korrespondenten des >Weltgeistes< zu
verorten suchten. Fr die Bohme steht die Zeit still, und die Existenz der Vernunft
in der Gesellschaft ist mit ihrem Auftreten je schon gesichert. Diese luxurierende
Selbstgengsamkeit fllt ihrem Selbstverstndnis nach aus der Geschichte und der
Gesellschaft heraus, weil sie als Pseudogeschichte und Pseudogesellschaft erlebt,
was anderen - und gerade auch Soziologen - unverzichtbare Referenzen eigener
intellektueller Selbstvergewisserung sind.
7. Die schiefe Stellung der Intelligenz
Das Treiben der Berliner Teilgruppe um B. Bauer ist in den Augen der Zeitgenos-
sen wie auch der Junghegelianer, die He oder Ruge folgen, frivol. Was heit
frivol? In der junghegelianischen Polemik hat das Wort bis 1842 eine klar umris-
sene Bedeutung. Frivolitt meint zunchst die aristokratische Geselligkeit des
18. Jahrhunderts. Fr He ist das 18. Jahrhundert gekennzeichnet durch die
Nchternheit der Aufklrung und die Frivolitt der Aristokratie. Die >Nch-
ternheit< war es gerade, die der >Frivolitt< Ende des 18. Jahrhunderts heilbringend
entgegentrat. Die verstndige, menschliche Besonnenheit setzte der alles Ma
berschreitenden Frivolitt Schranken. Eine Wiederauferstehung der Frivolitt
sieht He in der romantischen mittelalterlich-reaktionren Partei, die sich wie-
der rcklings in jene malose Frivolitt, in jene tierische Willkr strzen
mchte.
193
309
He greift hier die Analyse der Romantik auf, die Ruge 1839/1840 zusammen mit
Echtermeyer in einem umfangreichen Artikel in den HJ dargelegt hatte. Die
romantische Praxis des raffinierten Kitzels (der fr nichts erglhenden und nie bei
der wahren Sache beteiligten ironischen Subjekte) ist fr Ruge das frivole
Bewutsein, welches nur >Spaes halber< und des Egoismus halber stilisierte und
Bulletins schrieb. Die Form, in der diese Frivolitt ins Leben tritt, ist der Salon,
eine Aristokratie der Geistreichen, eine exclusive Geselligkeit mit stereotypen For-
men sthetischer Convenienzen. Die Beschftigung mit literarischer Tradition ist
hier nur ein konventionelles und soziales Phnomen. (. . .) Sie ist ein Rezept, in 24
Stunden geistreich zu werden. Motor der Gruppenbildung sei der Reiz der Eitel-
keit, durch ihn erreicht es die exklusive hochmtige Genialitt, anstatt die Men-
schen, wie man vermuten sollte, abzustoen, sie vielmehr anzuziehen und einen
ansehnlichen Kreis von Nachtretern und Anbetern um sich zu versammeln. Diese
Gemeinde der Rezeptiven widersetze sich aber trotz aller Hierarchie und
Unfreiheit dennoch keineswegs gegen das Neue; nur ist das Neue in ihrem Sinne
vielmehr das Aparte, das ganz Besondere, das Exklusive.
194
In Ruges Perspektive gert diese Geselligkeit notwendigerweise in eine realitts-
inadquate, fiktive Position.
Nicht an die wirkliche Substanz des jetzt mchtigen Geistes, sondern an die fingierte und
vorgebliche Substanz des jetzt bereits ohnmchtigen Geistes geben diese feinen, nur auf das
freie Spiel ihres genialen Ich bedachten, nach aparter und ganz besonders pikanter Speise
lsternen Subjekts sich hin.
Auer der fiktiven Ebene zhlt nichts. So bestehe die Gesellschaft von Tiecks
Phantasus nur aus
Dichtern (. . .), aus lauter Leuten, die ihr Gedicht, ihr Mrchen, ihr Drama machen knnen,
sodann aus blo Setenden; keiner hat eine Stellung, ein objektives Verhltnis, ein Geschft;
sie sind smtlich Diletanten des Lebens. Dieser Theodor, Friedrich, Lothar usw., blasse
Namen ohne Charaktere tragen uns ihre Rsonnements und Schrullen vor; alles bleibt dabei
im Dmmer und in der Schwebe; es wird viel Anstalt gemacht, aber nur um vorbergehen-
der psychologischer Pointen willen; kein einziger der Sprechenden hat eine Geschichte,
nicht einmal eine Physiognomie. "
5
Nach diesem Muster seien auch die romantischen Salons eingerichtet. Die Fri-
volitt des 18. Jahrhunderts kehrt fr Ruge in der romantischen Ironie wieder,
nicht nur bei Tieck, auch bei Heine, dessen Dichtung Poesie des Indifferentis-
mus ist.
196
Geschichtslosigkeit, Oberflchlichkeit, mangelnde Fundierung, locke-
rer Umgang mit sittlichen Moralgeboten, Apartheiten - diese Charakteristika der
Diletanten des Lebens gehen schlielich ber in die Typisierung der Berliner
junghegelianischen Boheme.
Nicht bersehen werden darf jedoch, da der Vorwurf der Frivolitt, so sehr
er auch, zunchst von der Debatte um das Verhltnis von Theorie und Masse ausge-
hend, von den Junghegelianern um He und Rge den Berlinern gemacht wird,
sich rasch in den Debatten ausbreitet. Zge einer geschichtslosen, oberflchlichen
Frivolitt werfen die Berliner auch den Klnern vor. So wehrt sich z. B. Koppen
in einer Korrespondenz in den NB gegen das Schreiben eines Klners, der die ste-
rile Weise der Bauerschen Abstraktion angreift. Dem Klner wird erwidert:
310
Du hast keine Ahnung davon, wieviele Stimmen bei einem Worte, einer Phrase laut werden
und wie ganze Chre radikaler Korrespondenten, die, whrend ich dieses schreibe,
irgendwo in einer Wein- oder Bierstube >hausen<, Bier von Potsdam trinken und Zigarren
von Havanna rauchen, pltzlich emportaumeln und in wstem Auf- und Niederwogen feier-
lich durcheinander murmeln: Bauersche Abstraktion!
197
Der Berliner Kppen macht den Klner darauf aufmerksam, da dessen Formu-
lierungen auch nicht dagegen zu immunisieren sind, von einer frivolen Bohme
oberflchlich aufgegriffen zu werden.
Oberflchlichkeit und >Frivolitt< sind umstrittene Zonen auch in der Korres-
pondenz, die B. Bauer von einem Sympathisanten erhlt, der Bauer von seiner Aus-
einandersetzung mit einem Bauer-Gegner berichtet:
>Auch sind, fuhr er (der Bauer-Gegner, d. V.) fort, die Bauers zu frivol; ein bichen mehr
Ernst in der Behandlung der so wichtigen Fragen knnte ihnen nicht schaden.< - Siehe
Deutsche Jahrbcher, erwiderte ich, letzter Jahrgang, eine der letzten Nummern. >Jawohl,
antwortete er, nur hat Ruge die Sache noch nicht tief genug aufgefate Wie tief er selber sie
einfasse, konnte ich nicht herausbekommen: Denn natrlich ist ihm die Frivolitt nur noch
mehr zur Redensart geworden, als dem Rge, dem es damals noch wenigstens ernst mit der
Sache war. Mein Freund aber, damals selbst einer von den >Frivolen< und jetzt natrlich,
weil seine Frivolitt nur eine selbstgemachte Gtzin war, auf den Standpunkt des gesin-
nungsreichen Ernstes herabgesunken, hat auch den Ausdruck >Frivolitt< sich nur ange-
schafft, um sich vor dem Denken zu wahren: es wre ja frivol, den Sachen auf den Grund zu
sehen, man mu immer mit einer gewissen heiligen Scheu sich ihrer Betrachtung berlassen,
d. h. sich mit ihrem Namen und ihrer Auenseite begngen und betrgen, die man dann
auch nicht einmal hat, weil man ihren Inhalt nicht durchdenkt. Frivolitt scheint ihm an
Euch (die Brder Bauer, d. V.) die die Sache beherrschende und durchdringende Leichtig-
keit der Behandlung, die Beherrschung der Kategorien, die durch Studium gewonnene Ein-
sicht, kurz und gut, die Herrschaft ber die Gegenstnde; er macht es sich mit den Sachen
leicht, ihr macht die Sachen leicht. Bei all seinem Es-Sich-Leicht-Machen drckt ihn doch
das dunkle Gefhl, da ihm die Sachen ebenso schwer und undurchgeistet bleiben, wie vor-
her, da sie ihm undurchdrungen, unberwunden gegenberstehen: Da trstet er sich aber
mit dem Worte >Gesinnung<, diese Phrase hat ihn ber die kindische Art, sich ber Sachen
zu setzen, hinweggeholfen.
198
Der Diskurs hat sich verdoppelt. Der Vorwurf der Frivolitt wird selbst ober-
flchlich, zur >selbstgemachten Gtzku. Und das ganze wird noch einmal verdop-
pelt, indem dieser Brief in der ALZ abgedruckt wird. Die Phrase der >Gesinnung<
ist auch nur ein oberflchlicher bersprung, ein bersprung ber den anderen
bersprung, sich >kindisch< ber Sachen hin-wegzusetzen.
199
Woher rhrt diese Ubiquitt des Frivolittsverdachts in den junghegelianischen
Debatten? Mit den Positionen in der Debatte um das Verhltnis von Theorie und
Masse schien eine eindeutige Verteilung der Attribute gesichert: >emsthaft<,
>authentisch< sind jene Intellektuelle, die sich im geschichtsphilosophisch ausge-
machten historischen Subjekt< verankern, hier ihren Boden haben, der sie vor den
tckischen Verselbstndigungen des Intellektualismus bewahrt; >frivol<, >ober-
flchlich< sind jene Intellektuelle, die die Einsamkeit der Kritik notgedrungen
wenigstens zeitweise aufgeben mssen und deren gruppenmiges Auftreten zum
Skandalmachen fhrt. Was diese eindeutige Verteilung der Attribute, die in der
Literatur hufig wiederholt wird, verdeckt: in beiden Versionen, der Heschen
311
>Theorie und Masse< und der B. Bauerschen >Theorie statt Masse< handelt es sich
um eine Verarbeitung der Aporien eines geschichtsphilosophisch definierten
Selbstverstndnisses als Avantgarde.
Ein Anonymus >aus Berlin< hat in den >Anekdota< die Aporien so beschrieben:
Die Mnner der kritischen Bewegung werden wohl darauf resigniert haben, da sie auf
jedem Schritt und Tritt von dem Beifall der Masse werden begleitet werden. Die Masse ( . . . )
schenkt zwar anfangs, wenn etwas Neues auftaucht, demselben eine augenblickliche Auf-
merksamkeit, aber wenn der Ernst der Bewegung grer wird, tritt sie zurck, wird sie
schwankend, oft irre, und erst wenn das Resultat fertig auftritt, wird ihre Teilnahme wieder
lebhafter erregt, weil sie sich nun fr oder gegen entscheiden mu. Es gehrt daher ein gro-
er sittlicher Ernst dazu, wenn Mnner eine Aufgabe bernehmen sollen, deren Durchfh-
rung sie so vielen Gefahren und selbst der Gefahr, da sie fr lngere Zeit allein dastehen,
aussetzt. Diese Sittlichkeit ist durchaus anzuerkennen. Die grte Prfung, die sie bestehen
mssen, besteht darin, da selbst Leute, die mit ihnen anfangs gemeinsam arbeiteten, aus
Indolenz, Schwche, Klugheit oder Berechnung zurcktreten - ja wohl gar auf die andere
Seite hinbergeworfen werden.
200
Jeder Intellektuelle, der sein Denken in irgendeiner Weise als geschichtlich
bedeutsam ansieht, steht vor dem Problem der Anpassung bzw. des Aushaltens der
Nichtangepatheit seiner Ideen im Verhltnis zu den brigen Mitgliedern der
Gesellschaft. Es liegt im Begriff der Avantgarde, da zwischen ihren Vorstellungen
und denen der Massen ein Abstand liegt. Streitpunkt innerhalb einer avantgardisti-
schen Intellektuellengruppe wird daher immer das Ma des Abstands sein. Es geht
um die Fragen: Wie stark darf oder soll die Avantgarde ihre Lernprozesse gegen-
ber denen der Massen beschleunigen? Ist sie verpflichtet, sich pdagogisch zu
assimilieren und die Weiterentwicklung der Kritik sich zeitweise zu versagen, bis
die geschichtliche Nachhut< sich weiterbewegt hat? Was heit Strke und Schw-
che in diesem Zusammenhang? Ist die grere Entfernung von der Masse ein Zei-
chen der Strke der Avantgarde, wie die Gruppe um B. Bauer annimmt, eine
Strke, die geschwcht wrde, wenn pdagogische Kompromisse gemacht wr-
den? Oder ist die Nhe zu den Vorstellungen der Massen ein Zeichen der Strke,
weil der Intellektuelle sich die harte Probe der berwindung auch noch der rck-
stndigsten Ansichten auferlegt?
Fr geschichtsphilosophisch orientierte Intellektuelle ist dies Problem beson-
ders gravierend. Der Geschichtsphilosoph wei um das Ziel der Geschichte, aber
er kann dies Wissen nur in der von ihm identifizierten >Vorstufe< an den Mann brin-
gen. He mu fr die Theorie jetzt eintreten, obwohl er wei, da Theorieproduk-
tion als abspaltender Sektor >in letzter Instanz< falsch ist, Marx mu fr die Ent-
wicklung des Kapitalismus und der brgerlichen Gesellschaft eintreten, obwohl er
wei, da diese Politik nicht seinem Bewutsein entspricht. Bauer dagegen mu
umgekehrt die Kritik asozial werden lassen, um sein Wissen ber den Ausgang der
Geschichte sicherzustellen. Individuell mgen diese Dilemmata noch auszuhalten
sein, aber eine Gruppe mu an ihnen zerbrechen, weil eine diskutierende und Ent-
scheidungen fllende Gruppe sich nicht nur ber die jeweilige Stufe, auf der man
sich befindet, einigen mu. Das wre vielleicht noch kollektiv mglich, aber sie
mu sich gleichzeitig auch noch gegenseitig des Arkanums versichern, das das Ziel
der Geschichte ist. Die Gruppe steht so vor dem Problem der doppelten Loyalit-
312
ten. Geschichtsphilosophisch gesprochen: Der Loyalitt der Stufe gegenber und
der Loyalitt dem letzten Ziel gegenber. Und weil die Gruppe beide Loyalitten
nur gemeinsam besprechen kann, ist der Verdacht der Illoyalitt unausweichlich.
Engels hat spter in >Der deutsche Bauernkrieg< am Beispiel Thomas Mnzers
das Problem der Avantgarde rckblickend beschrieben. Es ist das Schlimmste,
was dem Fhrer einer extremen Partei widerfahren kann, wenn er gezwungen wird,
in einer Epoche die Regierung zu bernehmen, wo die Bewegung noch nicht reif ist
fr die Herrschaft der Klasse, die er vertritt, und fr die Durchfhrung der Mare-
geln, die die Herrschaft dieser Klasse erfordert. Dieser Intellektuelle befindet sich
notwendigerweise in einem unlsbaren Dilemma: Was er tun kann, widerspricht seinem
ganzen bisherigen Auftreten, seinen Prinzipien und den unmittelbaren Interessen seiner
Partei; und was er tun soll, ist nicht durchzufhren. Er ist, mit einem Wort gezwungen, nicht
seine Partei, seine Klasse, sondern die Klasse zu vertreten, fr deren Herrschaft die Bewe-
gung gerade reif ist. Er mu im Interesse der Bewegung selbst die Interessen einer ihm frem-
den Klasse durchfhren und seine eigene Klasse mit Phrasen und Versprechungen, mit der
Beteuerung abfertigen, da die Interessen jener fremden Klasse ihre eigenen Interessen sind.
Wer in diese schiefe Stellung gert, ist unrettbar verloren.
201
In eine schiefe Stellung geriet aber auch Marx mit seiner Forderung nach einer
brgerlichen Revolution gegenber den Junghegelianern um B. Bauer, fr die das
brgerliche Parteiwesen schon mit dem 18. Brumaire bankrott gemacht hatte. In
eine schiefe Stellung geriet B. Bauer mit seinen Thesen ber die Einsamkeit der
Kritik gegenber den Klnern, die darin einen Verrat an der geschichtlichen Praxis
sahen. Der latente Vorwurf des Verrats aus Schwche, Schwche der Anpassung an
die Massen, Schwche der Einsamkeit des Theoretikers, weist auf ein der Gruppe
gemeinsames Muster hin, das durch die gegenseitige Polemik verdeckt wird.
>Schwche< ist ein gemeinsamer Ausgangspunkt und Erfahrungshorizont der
Gruppe. Die Massen, auf die He und Marx zur Strkung der Theorie reflektieren,
sind lediglich virtuell starke Mchte. 1843/44 sind es arme, elende, hilflose Proleta-
rier. Ebenso ist bei Bauer die Schwche der Kritik der Ausgangspunkt. Der Kritiker
offenbart die Bekenntnis einer schwachen Seele, der er selbst ist.
202
Kritik wie
Proletariat sind jedes fr sich blo virtuelle Strken, es handelt sich um Imaginatio-
nen der Strke. Auch ihr mgliches Zusammenfallen ist eine geschichtsphilosophi-
sche Konstruktion, die ihre Wirklichkeit zunchst nur in dem hat, der sie entwirft.
Nach herkmmlicher Weise wird man sagen knnen: Der gemeinsame Boden, auf
dem solche Imaginationen wachsen knnen, ist die soziale Lage einer deklassierten
Intelligenz. Wenn He das Eintauchen des Intellektuellen in die Massen fordert, so
ist die Form der Auflsung des Status der Intelligenz nicht weit entfernt von der
Einsamkeit der Bauerschen Kritik. Es handelt sich um parallele Bewegungen der
Definition eines Deklassiertenstatus. Das Hesche Extrem der Selbstaufgabe in
den Massen und das Bauersche Extrem der Ablsung von allem Sozialen fllt
zusammen in der auf die Spitze getriebenen Selbstkritik der Intelligenz. Dem ent-
spricht, da der Vorwurf des >Bankrotts< gegenseitig ist. Ebenso wie Bauer Selbst-
kritik der Gruppe fordert, heit es bei He: Der Junghegelianismus hat alles kriti-
siert, nur sich selber nicht.
203
Die schiefe Stellung der junghegelianischen Intelligenz ist verantwortlich fr
den von allen Seiten aufbrechenden Vorwurf der Frivolitt. Als Avantgarde
313
nimmt jede Teilgruppe qua geschichtsphilosophischer Selbstvergewisserung
bestimmte Elemente der Realitt nicht mehr so ernst, sie setzt sich darber hinweg,
aber dies kann ihr ebenso als Frivolitt ausgelegt werden. Umgekehrt kann jeder
Bezug zu Elementen der Realitt, der vorgenommen wird, als rckstndiges Ver-
harren in Konventionalismen kritisiert werden, das einer Avantgarde unwrdig ist.
Die Bewegungen der Auflsung des Intellektuellenstatus sind in diesem Zusam-
menhang als Immunisierungstechniken verstehbar, die mithelfen, die geschichts-
philosophische Selbstverortung dem Strudel der Diskussion zu entziehen.
Die Aporien der junghegelianischen Avantgarde sind von E. Bauer in einer
Romanszene literarisch gestaltet. Es handelt sich um einen fiktiven Dialog ber
Bequemlichkeit, in dem die Unsicherheit ber das, was authentische >Gesinnung<
und was >Frivolitt< ist, im Austausch der Argumente exemplarisch entfaltet
wird.
204
Ccilie und Ernst streiten sich darber, ob Bequemlichkeit eine Konse-
quenz der Gesinnung oder der Frivolitt sei.
Ccilie mitraut dem >frivolen< Treiben, weil aus ihm heraus keine zuverlssige
Bindung entstehen kann. Sie befrchtet, eines Tages mit dem Spruch: Alles auf
der Welt ist Illusion verlassen zu werden. Fr Ccilie ist die Desillusionierungs-
Strategie eine Bequemlichkeit.
Es gehrt Kraft dazu, zu lieben, da mut Du Ausdauer in Freud und Leid, da mu Deine
Seele die Kraft besitzen, in einen Himmel voll Seligkeit hinanzusteigen, da mu Dein Geist
fhig sein, durch die Hlle der Mutlosigkeit und des Verzagens hindurchzuwandern. (. . .)
Siehst Du, mein Freund, diese Kraft, diese Ausdauer, dies Nachdenken der Liebe, scheuest
Du und Deine Frivolitt ist nichts als feige Bequemlichkeit.
Ernst antwortet:
Du hast nicht die Erfahrungen gemacht, welche ich machte, ich habe die Menschen ken-
nengelernt. Du wirfst mir Bequemlichkeit vor: Nun gut ich habe gefunden, da alle jene
Prinzipien, mit denen man grotut, nichts als die Erfindungen bequemer Phantasie sind. Sie
alle schienen mir Vorspielungen, spanische Wnde, hinter denen sich die Leidenschaften
des niedrigsten Egoismus, der beschrnktesten Sinnlichkeit verbergen.
Ccilie gibt sich nicht geschlagen und erwidert:
Wenn alles so wre, wie es Dein von so bequemen Zweifeln angesuerter Verstand zu sehen
glaubte, hast Du nicht einen Trugschlu getan? (. .. ) Tor, Du glaubtest Dich im Kampfe, im
Gegensatz zu der Gesellschaft; und Du wrdest doch weiter nichts getan haben, als da Du
in erhhter Steigerung ihren Charakter Dir angeeignet httest.
Ccilies Gegenargument entspricht der Position, die z. B. He in den Letzten
Philosophen gegenber B. Bauer und Stirner ausfhren wird. Einen Ausweg fin-
det Ernst, indem er sich auf das B. Bauersche Selbstbewutsein zurckzieht:
Nicht doch (. . .), glaube nicht, da ich ganz ohne Sttze, ganz sonder Prinzip durch das
Leben dahintaumele. An mir selbst habe ich meinen Halt. Nachdem ich die Menschen ken-
nen gelernt, nachdem ich gesehen, wie sie, gleichsam berauscht, von einem Interesse in das
andere taumeln, ohne einen Mittelpunkt finden zu knnen, habe ich in mich selbst mich
zurckgezogen, an meinem Ich habe ich mir einen Kern gebildet; an meinem Ich habe ich
das Orakel gefunden, welches mir alle Fragen beantwortet, alle Kollisionen lset, ber alle
314
Kmpfe mich hinwegsetzt; mein Ich wrde mir Absolution geben, wenn ich deren
bedrfte.
Ccilie dreht den Spie um und greift Argumente auf, wie sie Marx und Engels
in der Heiligen Familie formuliert haben:
Ei wie, der Frivole entdeckt sich ja mit einem Male als ein Schwrmer, als ein Fanatiker, ja
als der schlimmste Fanatiker, als Ich-Fanatiker. Dieser Unglubige, wie glubig ist er, wie
hat er an seinem Ich den Gott, vor dem alles Endliche nicht besteht, vor dem alles Feste sich
auflset, vor dem alles menschliche Interesse unbedeutend ist. O, wieviel widerlicher ist dies
Ich als alle Frivolitt, wieviel widerlicher dieser Kern als die taube Nu. Mein Lieber, Du
glaubst einen Zepter in der Hand zu haben und Du hast doch nichts, als eine Narrenprit-
sche.
Der Streit setzt sich anhand des Themas Menschenliebe fort, die fr Ernst
nichts anderes ist, als Bequemlichkeit. Du wagst es nicht, das Leiden in seiner ganzen
schrecklichen Gestalt zu erkennen und zu untersuchen; durch Dein phantastisches Wirken
willst Du dich ber dasselbe hinwegsetzen, zufrieden, hie und da geholfen, befriedigt, aus
dem Gesichtskreise deiner Augen den schwrenden Lazarus vertrieben zu haben.
Die Auseinandersetzung gewinnt eine neue Qualitt, als Ccilie darauf insistiert:
Und doch hast Du nicht das Recht, mir diese Menschenliebe zu nehmen. Ccilies
humanistischer Glaube an die Entwicklungsmglichkeiten der Gattung ist eine
ebenso unanfechtbare Position, wie Ernsts freies Selbstbewutsein. Der Erzhler
E. Bauer kommentiert die Situation:
Ccilie hatte Ernst bei seiner schwachen Seite getroffen. Die Unsicherheit seiner Frivolitt
fhlte sich augenblicklich gereizt, sowie ihr ein Glaube, wie der Cciliens in seiner ganzen
Reinheit und Kraft gegenbertrat; er ahnte es, da er keine Waffen habe, um diesem Glau-
ben auf irgend einer Seite anzukommen, sein Spott prallte machtlos ab, seine Gleichgltig-
keit wurde bemitleidet.
Eine neue Runde der Auseinandersetzung beginnt. Ernst gibt zu, wie sehr er
Ccilie beneide: Du brauchst Dir nicht die Aufgabe zu stellen, den Grund eines
bels zu untersuchen, denn Dein Glaube hat Dir ein allgemeines Mittel gegen alles
bel an die Hand gegeben. Ccilie merkt die Zweideutigkeit dieser Klage.
Du tuschest mich nicht durch diesen Ton. Auch meine Lebensansicht willst Du als eine
solche schildern, welcher der Ernst des Bestehenden, der Grund der Dinge unbekannt und
die Untersuchung ein Gegenstand feiger Flucht ist. Du meinst ich suchte mich durch einen
bequemen Glauben ber die Furchtbarkeit vorhandener Gebrechen hinwegzusetzen.
Ccilie insistiert auf den humanen Wirksamkeiten, die ihre Auffassung hervor-
bringen kann. Sie fordert Ernst auf, sich als schiffbrchigen Robinson zu denken.
Nun hast Du aber Werkzeuge und Unglcksgefhrten bei Dir. Wrst Du nicht ein
Tor, wenn Du, statt diese Werkzeuge anzuwenden, statt diese Gefhrten zu
gemeinsamer Arbeit aufzumuntern, Dich hinsetzen und nur Deinem Hohn ber
jene Wildnis Luft machen wolltest. Notwendig sei doch vielmehr, eine zivilisie-
rende Praxis zu entfalten, die mit >Gesinnung< einhergeht. Geschichtsphilosophi-
sche Gewiheit sei kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug, wie Phantasie und
Zivilisation.
315
Ccilie erlutert ihr Robinson-Beispiel:
Merktest Du, was ich mit diesem Vergleiche sagen will? Fr Dich ist das Leben diese wste
Insel und bleibt es; Deinem verzweifelnden Auge, Deinen hhnischen Blicken zeigen sich
Abgrnde und Morste und Klippen und Wildnisse, ist es mir aber zu verdenken, wenn ich
die Werkzeuge anwende, welche mir gegeben sind, um den Aufenthalt in diesem Leben
annehmlich zu machen? Und diese Werkzeuge sind der Glaube, die Phantasie und die Zivi-
lisation: Du mit Deiner bequemen Frivolitt wirst die Welt nicht anders machen, als sie ist:
ich mit meiner Religion, meiner Poesie und meiner Bildung mache sie vielleicht nicht anders,
aber ich bringe es doch wenigstens dahin, sie anders zu sehen.
Hier bahnt sich die 11. These ber Feuerbach von Marx an: Aus Ccilies die
Welt vielleicht nicht anders machen aber wenigstens anders sehen wird Marx'
sicheres Diktum vorn nur verschieden Interpretieren, das zu Gunsten des Vern-
derns der Welt aufzugeben sei. Aber Robinsons Insel ist nicht die Welt. Hier setzt
Ernst ein und wirft Ccilie vor, sie wrde sich nur abschirmen, rumlich und zeit-
lich, indem sie eine geschichtliche Zielbestimmung fixiere. Ist es die Bestimmung
des Menschen, fr sich und abgeschlossen ein bequemes Leben zu fhren, so hast
Du Deine Bestimmung erfllt, ist er allein mit seiner verchtlichen Glckseligkeit
nicht das Ziel der Schpfung, so bist Du auch nicht weiter gekommen als ich.
Ccilie lt sich nicht beirren. E. Bauer gibt ihr das letzte Wort, indem sie,
gleichsam die Argumente der Klner Gruppe zusammenfassend, die absolute Halt-
losigkeit und Unglaubwrdigkeit der Auffassung ihres Kontrahenten zum Aus-
druck bringt.
Das wute ich schon, antwortete Ccilie, da Du auf Dein gewhnliches Steckenpferd, auf
die Zivilisation zurckkommen wrdest. Das sind so Eure Redensarten von nicht allgemein
genug, von Egoismus, von Ausschlielichkeit, aber einleuchtend knnt Ihr die Sachen nie-
manden machen, Ihr knnt nicht weiter als bis zu jenen ganz bequemen und gelufigen
Redensarten. Ich dchte, Ihr mtet nachgerade der Sache mde sein, abgesehen davon,
da es wirklich schimpflich bequem ist, mit ein paar Worten, wie Freiheit, Gleichheit,
Humanitt, Gesinnung, Deine ganze Gesellschaft umstrzen zu wollen. Doch, was sage ich
denn, Du bist ja auch, wie Du Dich rhmst, schon lngst ber diese Dinge hinaus und -
ungeheures Ergebnis! - Du verstehst es jetzt, ber dieselben ebenso gut zu spotten und ihre
Beschrnktheit nachzuweisen, wie Du frher durch sie die Nichtigkeit des Bestehenden
demonstriertest. Jetzt bist Du ein bloer Schwtzer geworden, ber die geringste Kleinigkeit
weit Du Auskunft zu geben, das heit, ber sie mit einem Schwall von Worten abzuspre-
chen; und ich gestehe es Dir zu, Du hast den Gipfel der Bequemlichkeit erstiegen. - Und Du
stehst neben mir. Kennst Du denn die Menschen?
In eine schiefe Stellung gert Avantgarde nicht nur in ihrem Verhltnis zur
Majoritt der Gesellschaftsmitglieder. Nicht weniger gravierend ist, da sie auch
untereinander einem rotierenden Verdacht ausgeliefert sind, in dem sich die Vor-
wrfe, es sich zu leicht machen und frivol den Sinn von Avantgarde zu verspie-
len, austauschen. Was in der philosophischen Schule und der politischen Partei
noch mit Anstrengung gelang, nmlich Positionalitt sich gegenseitig zuzuschrei-
ben und >ernst< zu nehmen, in der journalistischen Boheme steht der Sinn von Posi-
tionalitt berhaupt in Frage.
316
8. Intelligenz in der groen Stadt
Fr die politische Partei der Junghegelianer ist Berlin ein defizitrer Ort gewesen.
Berlin hat bis jetzt noch nicht gewagt, einen scharfen Gedanken zu haben; es hat
vielmehr dies Geschft den Provinzen berlassen, schreibt E. Bauer ber den
politischen Charakter der Hauptstadt.
205
Fr die junghegelianische Bohme
gewinnt dagegen die Erfahrung der groen Stadt berragende Bedeutung. Um sie
aufzufalten, bietet es sich an, zunchst auf R. Gisekes Moderne Titanen zurck-
zukommen.
Die letzten zehn Tage vor dem geplanten Antritt seines Predigeramtes lt der
Autor seinen junghegelianischen Helden Ernst in Berlin verbringen.
Wie nach einer alten Sitte der Todeskandidat vor der Hinrichtung sich an Speis und Trank
etwas zu Gute tun darf, so wollte der Predigtamtskandidat vor seiner Weihe sich Kenntnis
des groen Lebens und Einsicht in die Zustnde des Tages erwerben, um dann wenigstens
mit Recht in seinem einsamen Dasein sich darber erhaben zu fhlen. Das Leben einer gro-
en Stadt, das Treiben so unzhliger Menschen, gleicht dem weiten, wsten Ozean. Nir-
gends kommt sich der Mensch verlassener vor als hier. Wer zu vergessen oder vergessen zu
werden sucht, hier kann er es so leicht wie nirgends.
206
Der Widerspruch ist leicht zu berlesen: Kenntnis und Einsicht sollen gerade
dort gefunden werden, wo das Vergessen leicht gemacht wird. Was diese Passage
signalisiert, das ist das seltsame Doppelgesicht der groen Stadt: sie ldt zur Zer-
streuung ein und fordert zugleich die angestrengteste Aufmerksamkeit heraus.
Gisekes Romanstelle mag durch den Briefwechsel in den NB angeregt sein, in
dem die Erfahrung der groen Stadt, die ein Junghegelianer aus der Provinz in Ber-
lin macht, thematisiert wird. Ich sah auch in den ersten Tagen (des Berlin-Aufent-
halts, d. V.) schon mit Freude den Sturm und Drang in Dir aufsteigen, sah Dich
wild und gierig in den ganzen Rausch der grostdtischen Bewegung strzen,
schreibt ein Berliner Junghegelianer seinem in die Provinz zurckgekehrten
Freund, und er fordert ihn auf, ber die Eindrcke zu schreiben, die die grostd-
tischen Zustnde berhaupt auf Dich gemacht haben. Du bist ja stundenlang ganz
einsam durch Berlin gewandert und mut da viel Interessantes beobachtet und
erfahren haben.
207
Auch hier widersprchliche Haltungen: sich in den Rausch
der grostdtischen Bewegung strzen, einsames Umherwandern, Aufforderun-
gen zu distanzierter Beobachtung.
Das Schreiben ber die groe Stadt hat in den 40er Jahren Konjunktur.
208
Noch
bevor die Junghegelianer selbst zur Feder greifen, erscheinen Glabrenners Schil-
derungen aus dem Berliner Volksleben (1841). Exemplarisch sei auf seine
Beschreibung der Knigsstrae verwiesen:
In diesem schlangenartig sich windenden, von hohen Husern gebildeten Engpa hrt das
Gewhl von Menschen, das Toben der Wagen vom frhen Morgen bis spten Abend nicht
auf. In dieser Reprsentantin desjenigen Stadtteils, welchen ich den Magen Berlins nannte,
und in ihrer nchsten Nhe, liegt alles, was die Leute herbeizieht und zusammendrngt, was
das Leben der Residenz bedingt, ihre Nahrung und ihre Verdauung. Hier ist die Post, - das
Land- und Stadtgericht (welches tglich seine Tausende fordert), - Rathaus, das Vormund-
schaftsgericht, das Kriminalgericht, die Polizei, die brillanten Katakomben der Nchtern-
heit, die frequentesten Destillationsanstalten von Eulner und Krcher, die Sparkasse, das
317
Gewerbeinstitut, Faust's Wintergarten, die Knigsmauer (das Asyl der Freudenmdchen)
und das Knigsstdtische Theater. Hier ist Gewlbe an Gewlbe, Boutique an Boutique,
und in bunt wechselnder Folge Hotels erster und zweiter Klasse, Restaurationen, Kondito-
reien, Bierstuben, Ausspannungen und Viktualienkeller! Hier laufen die Menschenameisen
durcheinander und Gott lchelt ob der ernsten Miene, welche sie machen, ob der Eile, die
sie haben. - Alles ist lcherlich und Alles wichtig in dieser Welt, und das eben ist ihr
Humor.
209
Die groe Stadt - wie kann sie adquat beschrieben werden? Mit dieser Frage
verbindet sich zugleich diejenige nach den mglichen Weisen des Begreifens dieses
Phnomens. Welches knnte der integrierende Sinn einer groen Stadt sein, ein
Sinn, der ber die bloe Reihung von Eindrcken hinausginge? Wie kann sich
begreifende Ttigkeit in der grostdtischen Welt verorten, in der alles lcherlich
und zugleich wichtig ist? Was Glabrenner beschreibt, ist ein Panorama, dessen
Einzelheiten jede fr sich >interessant< sind, deren Zusammenschau er aber nur
noch einem verblassenden Gott zuweisen kann. Die beiden Mglichkeiten: Rena-
turalisierung der groen Stadt als urtmliche Wildnis, als weiter, wster Ozean,
und die faszinierte Zuwendung, die ein oder eine Reihe >interessanter< Details, es
mag sich um aparte Perspektiven oder auffallende Gestalten handeln, erfahren -
beide Mglichkeiten gehren in vielfltigen Variationen zum rhetorischen
Standardrepertoire, mit denen seit dem 19. Jahrhundert die groe Stadt der Spra-
che zugnglich gemacht wird.
Was dagegen nur schwer zu gelingen scheint, ist die Vermittlung beider Mglich-
keiten. Legt man die Intellektuellengruppendefinitionen der philosophischen
Schule und der politischen Partei zugrunde, so wird man sagen mssen, da an der
groen Stadt dasjenige philosophische Bemhen, das auf eine Vermittlung von All-
gemeinem und Besonderem, von Wesen und Erscheinung sich richtet, in eigentm-
licher Koinzidenz ebenso scheitert, wie eine Perspektive der politischen Partei, die
in der groen Stadt allzu Vieles >unter aller Partei:, d. h. in einem politischen Sinne
nicht Reprsentierbares, finden wird.
Die Ohnmacht dialektischer Philosophie und Politik gegenber der groen
Stadt zeigt sich nicht zuletzt bei einem Autor, dessen monumentales Fragment ber
das Paris des 19. Jahrhunderts den unabgeschlossenen Versuch darstellt, die groe
Stadt begreifbar zu machen. W. Benjamins erste Ausarbeitungen zum Komplex
des sog. >Passagen-Werks< (ein berarbeiteter Teil erschien 1940 in der Zeitschrift
fr Sozialforschung<) fhrten zu einem aufschlureichen Briefwechsel zwischen
Adorno und Benjamin.
210
In unserem Zusammenhang ist jene Kritik von Bedeu-
tung, die Adorno an Benjamins erster Fassung gebt hat. Adorno wirft Benjamin
vor, dieser habe Motive versammelt, aber nicht durchgefhrt. Und er fragt:
Panorama und >Spur<, Flaneur und Passagen, Moderne und immer Gleiches, ohne theore-
tische Interpretation - ist das ein >Material<, das geduldig auf Deutung warten kann, ohne
da es von der eigenen Aura verzehrt wrde? Verschwrt sich nicht vielmehr der pragmati-
sche Gehalt jener Gegenstnde, wenn er isoliert wird, in einer fast dmonischen Weise
gegen die Mglichkeit seiner Deutung?
211
Die Vermaurung hinter undurchdringlichen Stoffschichten, die Adorno kriti-
siert, mag man im Benjaminschen Text durchaus finden, aber umgekehrt betrach-
318
tet sind es gerade die stofflichen Vielheiten, alle gleich belanglos und gleich wichtig,
die die groe Stadt versammelt. Sie drohen eine kohrente theoretische Durchdrin-
gung zu verunmglichen. Bei den faszinierenden Details und Motiven, die in der
groen Stadt zu finden sind, handelt es sich fr den Dialektiker um Phantasmago-
rien. Adorno geht nicht so weit, Benjamin vorzuwerfen, da dessen Arbeit selbst
phantasmagorischen Charakter annehme. Aber er fordert, die Liquidation
kann in ihrer wahren Tiefe nur dann gelingen, wenn die Phantasmagorie als objek-
tiv geschichtsphilosophische Kategorie und nicht als >Ansicht< von Sozialcharakte-
ren geleistet wird.
212
Was das Begreifen der groen Stadt gerade Intellektuellen, die dialektischer
Denkweise verpflichtet sind, so enorm schwer macht, ist der Umstand, da
geschichtsphilosophische Vergewisserung in den >Phantasmagorien< der groen
Stadt sich buchstblich verluft. Fr Marx entspringen gerade dem Milieu der
grostdtischen Bohme jene zweifelhaften Gestalten, die es als ihre Aufgabe anse-
hen, dem revolutionren Entwicklungsproze vorzugreifen, ihn knstlich zur
Krise zu treiben, eine Revolution aus dem Stegreif, ohne Bedingungen einer Revo-
lution zu machen.
213
Das heit, sie handeln ohne geschichtsphilosophische Verge-
wisserung, aufs Geratewohl. Wo es Rezepte gibt, in 24 Stunden geistreich zu wer-
den (A. Rge), welche Chancen haben da geschichtsphilosophische Bildungspro-
gramme mit ihren wohldefinierten Stufen? ber Baudelaire schreibt Benjamin:
Die Stereotypen in Baudelaires Erfahrungen, der Mangel an Vermittlung zwi-
schen seinen Ideen, die erstarrte Unruhe in seinen Zgen deuten daraufhin, da die
Reserven, die groes Wissen und umfassender geschichtlicher berblick (!) dem
Menschen erffnen, ihm nicht zu Gebote standen.
214
Nicht einmal der Minimal-
voraussetzungen geistiger Arbeit - Benjamin nennt Bibliothek und Wohnung -
kann Baudelaire sicher ein. Ohne Bibliothek und Wohnung ist aber Geschichtsphi-
losophie nicht zu entwerfen. Jene erffnet den Zugang zur Geschichte, diese sym-
bolisiert die Sicherheit eines Ortes, von dem aus ber die Bewegung der Geschichte
gedacht wird. Der Flaneur dagegen liefert sich der Bewegung der Strae aus. Auf
dem Boulevard hielt er sich dem nchstbesten Zwischenfall, Witzwort oder
Gercht zur Verfgung.
215
Das Schlendern auf der Strae folgt einer Zeitstruktur, die geschichtsphiloso-
phisch kaum bestimmbar ist. Bezeichnend ist die Schildkrtenmode, die in Paris
um 1840 zeitweise sich verbreitet, an die Benjamin erinnert: Der Flaneur lie sich
gern sein Tempo von ihnen vorschreiben. Wre es nach ihm gegangen, so htte der
Fortschritt diesen pas lernen mssen. Bezeichnend auch die Mode des noctambu-
lisme, derzufolge den Flaneurs zwar Haltepunkte und Stationen erlaubt sind;
aber er hat nicht das Recht zu schlafen.
216
Flanieren ist zu allererst Zeitvertreib,
eine Kategorie, die fr Geschichtsphilosophie, weil sie der geschichtlichen Zeit
einen prgnanten Sinn gibt, nicht zu gebrauchen ist. Das Reich der Zeit wird in der
Bohmeerfahrung der groen Stadt ebenso erweitert wie verknappt: es gibt koexi-
stent ein Zuwenig an Zeit, das Geschwindigkeiten hervorruft, und ein Zuviel an
Zeit, das Langeweile anfallen lt.
Fr die junghegelianische Bohme ist die Schere, die sich zwischen dem Streben
nach geschichtsphilosophischer Selbstvergewisserung und der Erfahrung der gro-
en Stadt auftut, besonders gravierend, weil sie sich als Korrespondenten des
319
Weltgeistes< dazu berufen fhlen, die Existenz von Vernunft in der Geschichte
sicherzustellen. So streiten sie sich, ob in Sues intensiv diskutiertem Roman die
geschichtlich wirksame Macht der Intelligenz bei dem Helden Rudolf liegt, wie
Szeliga ausfhrt, oder ob es das arme Mdchen Fleur de Marie ist, an die man seine
emanzipatorischen Hoffnungen knpfen sollte, wie dies Stirner und Marx vor-
schlagen.
217
Unsicherheit besteht auch, ob la flnerie in Berlin mglich ist. Fl-
neur! Es liegt ein gewisser Stolz in dem Wort; schreibt F. Wehl 1843,
ich mchte gern einer sein, ich fhle ein gewisses Talent dazu, aber leider ist Berlin kein
>vaste thtre< dafr; es hat keine rechten Kulissen dazu, die Huser, die Straen, die Pltze,
es ist Alles so langweilig darin. Man findet keine historischen Daten, keine historische Phy-
siognomien. Man kann den ganzen Tag durch die langen, graden Straen laufen, ohne da
sich einem von auen her ein Gedanke aufdrngt, der von einer innern, geschichtlichen
Bedeutung wre.
Zwar fange Berlin erst jetzt an, sich ein wenig herauszuputzen, aber das Auge
wird zu wenig gelockt.
218
Und: Sie hat so viel Stille die Stadt, so viel Einsamkeit,
so viel Langeweile, die Weltgeschichte geht auf Krcken durch ihre Straen.
219
Der Mangel an Flnerie hat Konsequenzen fr die intellektuelle Ttigkeit: Die
Kunst zu denken ist eine schwierige Kunst; in Deutschland lernt man sie nur in der
Stube, hinter vier Wnden, an Tischen und Bnken, aus Bchern und Pergamen-
ten; in Paris lernt man sie auf der Strae, mitten im Lrm des Gewhls, im Wagen-
gerassel, an Gebuden und Menschen. Was als Differenz von deutschen und fran-
zsischen Gedanken bei Wehl entwickelt wird, markiert wortspielerisch nicht
nur die Differenz des Philosophen und des Bohemiens, sondern zugleich auch die
Differenz in der Stellung zur Geschichtsphilosophie.
Der Deutsche kann nur in Gedanken gehen, der Franzose aber im Gehen denken. Es ist
das ein gewichtiger Unterschied, man mu es nicht verwechseln. Bei dem Franzosen hngen
die Gedanken vom Gehen ab, bei dem Deutschen das Gehen von den Gedanken. Ein Deut-
scher geht, was er denkt, ein Franzose denkt, was er geht. Ein Franzose denkt sein Laufen
ab, ein Deutscher luft sein Denken ab.
220
Fr den Junghegelianer L. Eichler ist Berlin schon eine Stadt, die wie Paris zum
Schreiben von Physiologien herausgefordert.
221
Die Putzmacherin, der
Executor und der Bankier, sie fhren den Leser in die heterogenen rumlich-
gesellschaftlichen Sektoren der Stadt, in den Tanzsaal des Collosseums, wo
erfolgreiche Bekanntschaften geknpft werden, in die Huser derer, die vor dem
finanziellen Ruin stehen, in die Salons und Soireen der Reichen, wo Geiz und Ver-
schwendungssucht oszillieren. Fr E. Meyen ist es beunruhigend, da in unserer
Zeit, die so groe Erfahrungen als ihre Vorfahren anerkennt und so unmittelbar auf
der Revolution fut, der ganze Trdelkram der vergangenen Jahrhunderte sich
noch einmal breit machen will. Es handelt sich um eine den Geschichtsphiloso-
phen irritierende Gleichzeitigkeit historischer Stufen. E. Meyen versucht, der Lage
Herr zu werden, wenn er die Physiologie als eine gewaltige Revolutionrin
bezeichnet; sie macht alles gleich, indem sie alles auf die Gleichheit der Nichtig-
keit reduziert.
222
Aber es ist nur ein kleiner Schritt, in die Reihe der >Ansichten<
von Sozialcharakteren auch den Literaten Meyen aufzunehmen.
Im Berlin-Buch des Junghegelianers F. Sa findet sich denn auch neben denen
320
anderer Junghegelianer die Physiologie E. Meyens als einer Literatengestalt, die
mit der Konditorei Stehely innig verwachsen ist. Auch Sa' Urteil ber Berlin ist
kaum zu vereindeutigen. Angesichts von Bestrebungen, an berkommenen stndi-
schen Schranken festzuhalten, schreibt er: Berlin ist dagegen gottlob eine groe
Stadt, d. h. sie bietet in den verschiedensten Lebensrichtungen einen glcklichen
Ersatz. Dennoch ist das gesellschaftliche Leben in der groen Stadt falsche Zivi-
lisation. Fr Sa zerreit immer mehr das Band, welches zwischen Geist und
Gesellschaft bestehen soll. Die Konsequenz ist: in Berlin vermehren sich die
modernen Anachoreten; denn die Einsamkeit in Lybiens Wste kann nicht grer
sein, als fr den, der sie sucht, in den groen tobenden Stdten. Die geschichtsphi-
losophische Hoffnung auf neue geschichtliche Fluten (. . .), welche den ganzen
Bau der alten Pyramide (!) durchbrechen, wird schon vom literarischen Bild her
desavouiert.
223
Die groe Stadt knnte fast eine verwirklichte Utopie, ein neues Jerusalem, sein:
Ein vielseitiges, allgemeines Gesellschaftsleben, - dies ist der Eindruck, welchen
das bewegte Treiben der Hauptstadt auf den Fremden macht, schreibt E. Dronke
in seinem Berlin-Buch. Die Ungezwungenheit, die Selbststndigkeit des Einzel-
nen, der nicht ntig hat, sich vor kleinstdtischen, philosophischen Vorurteilen in
Acht zu nehmen, sie wird ermglicht durch das Heraustreten der Individuen aus
ihren Verhltnissen. Aber die Sicherheit, mit welcher dies allenthalben geschieht,
hat etwas Unheimliches, fast Grauenhaftes. Sie lst die Bande ruhig und geru-
schlos, ohne da man von auen sie doch gelst sehen knnte.
224
Es ist die Stille
der stdtischen >Revolution<, ihre Unmerklichkeit, die den Sozialisten Dronke irri-
tiert.
Die Stadt verweist auf Umwlzungen grten Ausmaes, aber es ist dies nicht
der Typ von Revolution, wie ihn Geschichtsphilosphie vorsieht. Dronkes Blick
richtet sich daher auf jene stdtischen Randbezirke, wo das Elend in seiner letzten
furchtbaren Gestalt anzutreffen ist. Diese Parias hren nichts von dem Branden
und Brausen des inneren Lebens der Hauptstadt, und wenn sie hineinkommen, so
bezeichnet das Blut der Wachen und Polizeisoldaten und die Angriffe gegen das
Eigentum und Leben der Inwohner die Spuren ihres Weges.
225
Die Erfahrung der groen Stadt zwingt die junghegelianische Intelligenz, das
geschichtsphilosophische Muster zu modifizieren. Im stdtischen Raum, wo die
Gleichzeitigkeit der verschiedenen historischen Stufen prsent ist, wo Mglichkei-
ten und Blockierungen ganz nahe zusammengerckt sind, bedarf es einer beson-
ders gelagerten Aktivitt, um Emanzipationschancen ausfindig zu machen. Die
geschichtlich relevante Geographie kann nicht mehr spekulativ entworfen werden,
wie dies bei He' europischer Triarchie< der Fall gewesen ist. Vielmehr wird der
geschichtlich relevante Ort zu einem Fund dessen, der die Straen durchwandert.
So wenden sich die NB gegen die Miachtung des Schriftstellers, der das mhe-
volle Geschft unternimmt, durch alle gesellschaftlichen Kothaufen und Smpfe
hindurch zu waten, um sie zu studieren und die Quellen ihrer Existenz aufzusu-
chen.
226
Der Intellektuellentyp, der sich hier abzeichnet, entspricht der Figur des Detek-
tivs, wie sie von Kracauer beschrieben wurde. Der Detektiv schweift in dem Leer-
raum zwischen den Figuren als entspannter Darsteller der ratio (. . .). Er richtet sich
321
nicht auf die ratio, sondern ist ihre Personifikation. Die ratio ist hier nicht die vor-
gegebene Ordnung der Geschichte, nach der der Akteur sich zu richten htte, son-
dern der Detektiv nimmt den Anspruch der ratio auf Autonomie ernst, seine
umherschweifende Bewegung ist die Bewegung der Vernunft.
227
Der Sache nach ist es eine detektivische Haltung, die den Berliner Skizzen von
Frnkel und Kppen zugrunde liegt.
228
In He' >Gesellschaftsspiegel< wird dies
Buch den Lesern ausdrcklich zur Lektre empfohlen. Es handele sich nicht um
triviale Geheimnisliteratur oder moderne Kriminal- und Polizeiromantik, viel-
mehr wrden in einer bunten Reihe der mannigfaltigsten Bilder ( . . . ) die verschie-
densten Seiten und Sphren des grostdtisch-modernen Gesellschaftslebens vor-
gefhrt ( . . . ) in lebensvollen wirklichen Gestalten und Verhltnissen.
229
In der
ersten Novelle der Berliner Skizzen werden die Flneurs, geschftslosen
Umhertreiber und Pflastertreter, das ausgebildete Miggngertum Berlins
gewrdigt. Fr die junghegelianischen Autoren handelt es sich dabei um Mitglieder
einer ebenso ntzlichen als interessanten Gesellschaftsklasse.
Denn ein tchtiger und unermdlicher Pflastertreter zu sein, ist eine gar groe Kunst, und
nur die groen Stdte haben den Vorzug, solche Knstler zu erzeugen und zu bilden. Sie
mssen einen weiten Raum haben, auf dem sie sich ausbreiten knnen, sie mssen Geist,
Gewandtheit, Erfindungsgabe, und besonders eine beinahe fabelhafte Uneigenntzigkeit
besitzen, sich gerade um all die Dinge zu bekmmern, die sie am wenigsten angehn.
23
Diese detektivischen Knstler bewegen sich im Szenarium von Gestalten, die
nur einen bestimmten Stadtteil, eine bestimmte Strae, ein bestimmtes Lokal zum
Schauplatz ihres ffentlichen Lebens gemacht haben. (. . .) Sie sind gleichsam die
stereotypen Figuren der Strae oder des Ortes, an dem sie sich aufhalten, sie geh-
ren ihm an, wie seine Huser und Steine, oder seine Tische und Bnke. Diese
zweite Klasse von Menschen fordert das entspannte Interesse der detektivischen
Knstler heraus. Diese Menschenklasse gehrt zwar zum Interieur der Stadt,
aber es handelt sich um ein geheimnisvolles Interieur, das es zu entziffern gilt. Mit
einer erstaunenswerten Sicherheit gehen sie ber das Pflaster, dessen Steine sie
schon unendliche Male gezhlt haben (. . . ). Kommen und verschwinden aber sieht
man sie niemals - man wei wenigstens nicht, woher sie kommen und wohin sie
gehen - man findet sie nur hier und morgen wieder hier, und in einem Jahr wieder
nur hier.
231
Die groe Stadt ist fr den detektivischen Knstler ein geschichtsloser
Raum, ein Perpetuum mobile von Kommen und Gehen, dessen >Ursache< und
>Ziel< Geheimnis bleibt.
Haltepunkte fr den Flaneur sind Konditoreien, Weinstuben, Kneipen. Hier
ruhen sich die Pflastertreter aus, denen der Boden unter den Fen brennt,
wenn sie zu hause kaum den Morgenkaffee eingenommen haben.
232
Es gibt
geschichtlich bedeutsame< Lokale, die in keiner Stadtbeschreibung Berlins fehlen.
An erster Stelle steht die rothe Stube der Konditorei Stehely, von der Sa
schreibt:
eine Geschichte der Stehely'schen Konditorei schreiben, hiee nichts anderes, als die
Geschichte der Berliner Literaturzustnde geben. (. . .) Hier war es, von wo aus die eine Par-
tei im jungen Deutschland die andere zu bekmpfen suchte, hier war es, wo der >Standpunkt
des jungen Deutschlands< zuerst berwunden wurde, hier war es, von wo aus die >Hallischen
322
Jahrbcher< und die Rheinische Zeitung< ihr Geschtz bezogen, und hier eben waltet der
Kreis, von dem Deutschlands Zeitungen die Berliner Korrespondenzen erhalten. (. . .) Man
kann es ohne Anmaung sagen, das junge Volk, die neue Zeit hat gesiegt bei Stehely.
233
Die rothe Stube ist ein >geschichtstrchtiger< Ort, weil sich hier die personifi-
zierte Vernunft trifft. Aber dieser besondere Raum ist nicht vor der ansteckenden
Krankheit der Zeit: der Langeweile geschtzt: Da ihr lauter Mirabeaus, Dantons,
Marats und Robesspierres seid, wenn ihr einen Fingerhut voll getrunken - das ist
auch schon in der ganzen Welt bekannt, schreibt Kppen.
234
>Interessanter< sind
fr ihn andere Kneipen.
Hier kehren auf Augenblicke jene namenlosen Frauenzimmer ein, welche die Strae, in der
sich der Schnapsladen befindet, zu ihrem Jagdrevier erkoren. Alte abgedankte Schreiber,
vierzehnjhrige Laufburschen, aus dem Arbeitshause endassene Strflinge, durch die Kon-
kurrenz ruinierte Handwerker und Kaufleute seht ihr hier neben schbigen, plebejischen
Dandys und leichenblassen, spindeldrren Ex-Schulmeistern.
Der >Geist<, der diese Orte beherrscht, ist nicht philosophischer Natur. Ins Zen-
trum rckt bei Kppen die Gestalt des Schenkmdchens. Ihre >Distributionen<
halten diese kunterbunte Gesellschaft zusammen. Bruchstcke ihrer Geschichte
erzhlt der Autor. Es handelt sich um Szenen von Mglichkeiten und Ungewihei-
ten: beinahe htte sie Baronin werden knnen, von allen Seiten eilte man herbei,
um sie zu sehen. Alle Welt buhlte um ihre Gunst. Auch eine kleine Rolle in der
Geschichte des Berliner Liberalismus ist ihr zugedacht. Wo sie jetzt sein mag!
Vielleicht ist sie die Geliebte eines Geheimraths, Assessors, Lieutenants, Malers,
Studenten oder aller fnf zusammen. (. . .) Vielleicht hat sie das Zndhlzchen
geschnitten, an dem ich soeben die Zigarre anzndete; oder vielleicht gar die Feder
gesotten, die ihren Lebenslauf flchtig skizzierte.
233
Wo liegt der integrierende Sinn der groen Stadt? Da der Konsum das allge-
meine Band ist, das die Individuen hier zusammenbindet, ist nicht nur von Benja-
min und Adorno herausgestellt worden. Auch den Junghegelianern ist bewut
gewesen: In unserer Gesellschaft mu sich jeder prostituieren: das ist die
Regel!
236
Das Problem besteht darin, in der Welt des Konsums die >Destribution
der Vernunft< zu sichern. Der Flaneur ist eine Lsung dieses Problems, er gleicht
sich selbst der Bewegung der Ware an, hoffend, da seine Zirkulation wenigstens
ein Minimum von Vernunftexistenz garantiert. Was in dieser Bewegung schwindet,
ist die geschichtsphilosophische Ortsbestimmung. Sein Fortschreiten ist kein Fort-
schritt, Auf einer belebten Strae ist Avantgarde unmglich.
Fr Prutz ist das eigentliche Charakteristische, (. . . ) zugleich das Bedenkliche,
das wahrhaft Gefhrliche unserer gegenwrtigen Epoche, da die Interessen bei
uns, so rasch sie sich entznden, ebenso rasch auslschen und verschwinden; wie
lebhaft sie sind, so flchtig, wie zahlreich, so unfruchtbar. Alle Metaphorik, die
Prutz aufbietet, um diesem Unbehagen zu begegnen: das Bild vom hervorbrechen-
den Quell, der zuerst Blasen treibt, das Bild von der Krankheit, die der Gesun-
dung vorausgeht, das Bild von der prickelnden Grung aller Sfte, wenn der
Baum blht, die Frucht reifen soll, kurz alle Metaphorik der Krise, die auf eine
glckliche Wendung hindeutet, nimmt sich in der groen Stadt verloren aus.
237
Der
Intellektuelle wird zum Beschwrer eines geschichtsphilosophischen Sinnes, der
sich dem Auf- und Abflackern der Moderne entziehen soll.
323
Diese Aporie wiederholt sich im Benjaminschen Passagen-Werk: Langeweile
haben wir, wenn wir nicht wissen, worauf wir warten. Da wir es wissen oder zu
wissen glauben, das ist fast immer nichts als der Ausdruck unserer Seichtheit oder
Zerfahrenheit. Die Langeweile ist die Schwelle zu groen Taten. - Nun wre zu wis-
sen wichtig: der dialektische Gegensatz zur Langeweile?
238
Die Frage trifft den
Kern der Aporie: zur Langeweile gibt es keinen dialektischen Gegensatz. Die gro-
en Taten, die die Langeweile abbrechen, sind eher ganz undialektische Kurz-
schlsse. Wartezeiten knnen mit geschichtsphilosophischer Gewiheit ertrglich
gestaltet werden, aber sie steht in der groen Stadt fast immer unter dem Ver-
dacht der Seichtigkeit oder Zerfahrenheit. Langeweile dagegen entsichert den Zeit-
sinn. Skandal, schockhaftes Erleben, Katastrophe und Krieg knnen zu Antworten
auf die Langeweile werden - aber auch dies ist nicht sicher.
239
Die Benjaminsche
Hilfskonstruktion vom messianischen Aufsprengen des Kontinuums der
Geschichte mag ein Ausweg sein, aber er fllt aus dem Problembereich der in die-
sem Kapitel diskutierten Intellektuellendefinition journalistischer Boheme heraus
und verweist in den Kontext des letzten Kapitels dieser Arbeit.
Wo ihr der Glaube nicht zu Hilfe kommt, bleibt der journalistischen Boheme
nichts brig, als sich der Zeit zu vertreiben. Sie kann die Sensationen, die ihr begeg-
nen, verkaufen oder sich der allgemeinen Prostitution, fr Geld zu arbeiten, ver-
weigern und Skandal machen, oder beides tun. Ihr Glaubensbekenntnis wird sich
wie das des Dr. Horn in Gisekes Moderne Titanen anhren:
Kann der Mensch etwas Besseres tun, als dumme Streiche machen? Sieh nur, ich besitze
schon lange keinen roten Heller mehr und existiere doch immer noch ganz menschlich,
mache feine Toilette und trinke ein gutes Glas Wein. Wie kann sich ein groer Geist um die
Lappalien von Schulden bekmmern! Paff, das Gold ist nur Chimre! Setz dich darber
hinweg, und die Schranke ist fr dich nicht da. Ja, wenn der liebe Gott selbst zu mir kme,
und mir sagte: lieber Doktor, Sie tun mir leid, ich will mich Ihrer erbarmen und Ihre Schuld
bezahlen, aber machen Sie mir keine dummen Streiche mehr bei Gott, ich mte ihm ant-
worten: lieber Herr Gott, Sie sind sehr gtig. Aber du Heber Gott, du hast nun einmal den
Menschen und die Zeit geschaffen, die sich gegenseitig vertreiben wollen. Wenn ich durch
meine dummen Streiche mir nicht mehr die Zeit vertreiben darf, dann wird sie mich mit
ihrer frchterlichen Tochter, der Langeweile, vertreiben von dieser schnen Erde. Darum -
bezahle meine Schulden, aber la mir meine dummen Streiche! Amen!
240
Anmerkungen
1 Vgl. Seite 131 dieser Arbeit.
2 J. Venedey, Preuen und Preuentum, 1839, S. 2, 88 f. und 73. - Venedey schrieb auch
in den HJ. Seine Distanzierung vom Bund der Gechteten wurde in der RhZ 332 v.
28. 11. 1842 abgedruckt. (Vgl. J. Hansen, Rheinische Briefe, 1919, S. 386)
K. Mager zufolge haben die Junghegelianer von K. Heinzen gelernt, auf die Brokratie
zu schelten. (Ebd. S. 480) Heinzen, dessen Vater jakobinischen Ideen anhing, war selbst
einige Zeit in der peuischen Steuerverwaltung ttig gewesen und begann 1842, seine
Erfahrungen als Beamter publizistisch auszuwerten. In >Die geheimen Konduitenlisten
der Beamten< (1842) griff er das Befrderungswesen an, und 1843 verffentlichte er einen
Aufruf, in dem er eine Recherche ankndigt, ob Preuen im ganzen wie im einzelnen
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
IV. Atheistische Sekte
bersicht
An Luthers Kirchenlehre anschlieend verstehen sich die Junghegelianer als
>unsichtbare Kirche<. Sie kann als Hohlform begriffen werden, die entweder sku-
lar aufgelst oder mit Inhalten religiser Unterstrmungen aufgefllt wird (1).
Gnostischen und chiliastischen Traditionen werden zwei intellektuelle Haltungen
zugeordnet, die als Muster religiser Selbstdeutung fr die Gruppe in Frage kom-
men. Der chiastische Habitus verweist zurck auf die geschichtsphilosophische
Problematik der journalistischen Boheme (2). Die gnostische >Erlsung durch Wis-
sen< bildet das zentrale Element der junghegelianischen >neuen Religion<. Aber die
Gruppe kann sich dieser - ohne charismatischen Fhrer - nur vergewissern, wenn
sie Denkformen ausbildet, mit denen archaisch unvermischste Glubigkeit und
Wissensreligion gegeneinander ausgespielt werden knnen (3). In berlegungen
zum ambivalenten Charakter der religisen Erneuerungsbewegungen der 40er
Jahre und zum Verhltnis von Intelligenz und Kirche in der ersten Hlfte des
19. Jahrhunderts wird die These von dem folgenreichen Defizit eines staatsunab-
hngigen kirchlichen Gemeindelebens als Konsequenz von Luthers unsichtbarer
Kirche< aufgegriffen. In diesen Zusammenhang wird auch der Neupietismus
gestellt, mit dessen Vordringen die Gruppe zunchst konfrontiert ist (4). Die
Ablehnung kirchlicher Selbstverwaltung bildet den Ausgangspunkt fr die Debatte
ber den christlichen Staat<, in der B. Bauer, ber das liberale Modell einer
Tren-
nung von Staat und Kirche hinausgehend, in kirchlichen Oppositionen ein Indiz
fr die Mangelhaftigkeit des Staates entdeckt. Mit dem bergang zur Diskussion
der >Judenfrage< konzentriert sich das Interesse auf die in bestimmten religisen
Inhalten >reprsentierten< Mngel des Gemeinwesens (5). Angesichts des Auftre-
tens der freireligisen Bewegungen der Lichtfreunde und Deutschkatholiken (6 a)
versuchen >immanente< Junghegelianer wie Bayrhoffer, die freien Gemeinden in
>unsichtbare Kirchen< bzw. sozialistische Vereine zu transformieren (6 b), whrend
die >atheistischen< Junghegelianer um B. Bauer in der sich verweltlichenden freire-
ligisen Massenbewegung einen Typ von informeller Religion ausmachen, die sich
in der Willkr letzter Werte verbarrikadiert (6 c). Die Unsicherheit, ob es sich um
religise oder politisch-soziale Bewegungen handelt, verschrft den Gruppenstreit,
ob die die Gruppe integrierende Religionskritik beendet oder weitergetrieben wer-
den soll. Der Verdacht, da der andere noch Reste religiser Befangenheit hte, die
der >Konfession des Atheismus< widersprechen, ist kommunikativ nicht mehr zu
bewltigen (7). Die Gruppe zerfllt, weil der soziale Zusammenhang von Gewi-
heit und Gruppe< weder auf der Ebene der Glaubensgewiheit, noch auf der der
Gewiheit des Wissens, noch auf der der geschichtsphilosophischen Gewiheit
ertrglich stabil gehalten werden kann (8).
338
1. Die unsichtbare Kirche
Es ist blich geworden, Arbeiten ber die Junghegelianer mit einer Analyse der
Auseinandersetzungen der Schule mit der Hegelschen Religionsphilosophie zu
beginnen. Diese stillschweigende Konvention hat gute Grnde.
Inhaltlich stellt der Schulstreit um die von Hegel vorausgesetzte Identitt von
Religion und Philosophie, bei der die Religion die Wahrheit auf der Ebene der
Symbole, die Philosophie die Wahrheit auf der Ebene der Begriffe ausspricht, den
Ausgangspunkt der Fraktionierungsprozesse der Schule dar.
1
Die Hegelsche
>Rechte<, >Linke< und das >Zentrum< differenzieren sich zunchst lngs der unter-
schiedlichen Auffassungen in Fragen der Christologie. Und auch innerhalb der sich
konstituierenden >Linken< dreht sich der Schulstreit um die von der Evangelienkri-
tik ausgehende Frage, ob mit D. F. Strau die Substanz oder mit B. Bauer das
Selbstbewutsein das entscheidende Agens der Weltgeschichte sei.
2
Mit der junghegelianischen Religionskritik zu beginnen, hat darber hinaus auch
seinen guten Sinn, wenn der intellektuelle Politisierungsproze der Gruppe darge-
stellt werden soll als ein Proze, in dem das religionskritische Instrumentarium von
der Religion ausgehend auf die Bereiche Politik, Gesellschaft und konomie ange-
wandt wird. Unter dieser Fragestellung kann man mit Marx fr die Interpretation
der junghegelianischen Entwicklung davon ausgehen, da die Kritik der Religion
die Voraussetzung aller Kritik sei. Diese geschichtliche Aufgabe ist fr Marx
Ende 1843 im wesentlichen beendigt. Erforderlich sei jetzt der bergang zur
Kritik der unheiligen Gestalten auf der Ebene von Politik, Gesellschaft und
konomie.
3
Wo diesem Ansatz gefolgt wird, gilt denn auch jenes Marxsche Dik-
tum ber die Junghegelianer, die nicht von der Religionskritik loskommen, sie seien
darauf aus, in die Kategorie der Theologie zurckzuwerfen, was aus der Theologie
hervorgegangen war.
4
In dieser Arbeit werden die philosophiegeschichtlichen Aspekte ebenso wie die
Fragen nach der Entwicklung gesellschaftskritischer Kategorien in den Zusammen-
hang von Gruppendeutungen gestellt. Fr die Analyse der bisher behandelten
Gruppentypen und ihre Zwischen- und bergangsformen war der Rekurs auf die
junghegelianische Religionskritik entbehrlich. Im Kontext von philosophischer
Schule, politischer Partei und journalistischer Boheme ist die Religionskritik zwar
auch immer Thema der Auseinandersetzung, aber in strengem Sinne nicht grup-
penkonstituierend. Aber vielleicht sind hier doch Zweifel angebracht. Suchte man
auf religionssoziologischer Ebene nach einem entsprechenden Gruppentypus, so
stellt sich die Frage, inwieweit die Junghegelianer Zge einer Sekte besitzen. Diese
Frage wird in meiner Arbeit im Zusammenhang des letzten Kapitels behandelt, weil
die Gruppe selbst schlielich an der Aporie einer atheistischen Sekte< zerbricht.
Der Sektenverdacht gegenber den Junghegelianern ist nicht neu. Er wird schon
frh von auen an die Gruppe herangetragen. So handelt es sich fr Leo 1838 um
belberatene Jnglinge der Sekte, die darauf aus seien, ihre radikale Hegelinter-
pretation als eine neue Religion vorzutragen und dennoch zugleich mittels einer
betrgerischen Redeweise der bisher geltenden Religion unterzuschieben.
5
hn-
lich uert sich H. Marggraff, fr den 1839 die Hegelianer begonnen haben, eine
339
Sekte, eine Partei zu bilden, die berall, wo sie es vermag, unterkriecht und auf
ffentlicher Strae ihre Bekehrungspredigten hlt. Charakteristisch fr die
Hegelsche Sekte sei ihre Anmalichkeit und Ausschlielichkeit, womit sie alles
miachten, was ihrer Sekte nicht angehrt.
6
Der <Pseudohegelianer< Weie mag
1841 weder den Alt- noch den Junghegelianern den Titel Schule zubilligen. Die
zerstrittenen Hegelianer knnten sich erst dann zu einer Schule entwickeln, wenn
sie die allgemeinen Bedingungen der Freiheit des Philosophierens (. . .) wenig-
stens in abstracto anerkennen wrden. Davon sei jedoch nicht auszugehen, diese
Gruppe msse vielmehr eine Sekte als eine Schule genannt werden.
7
In den Par-
teidebatten ist der Sektenvorwurf ebenso prsent gewesen wie in den Schilderun-
gen der journalistischen Bohme.
Es wre voreilig, die Sektenvorwrfe als reine Polemik gering zu achten. Sie ent-
springen zwar dem polemischen Feld, aber zahlreiche Selbstzeugnisse geben Anla
zu der Vermutung, da sich die Junghegelianer ber ihre Religionskritik hinaus
selbst in einer historischen Kontinuitt mit bestimmten Sektentraditionen gesehen
haben. Zum anderen sind gerade die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts in Deutsch-
land gekennzeichnet durch eine weitverzweigte religise Erneuerungsbewegung,
die sowohl die katholischen wie protestantischen Gebiete umfat. In diese religise
Bewegung mssen auch die Junghegelianer hineingestellt werden, weil ihre Reli-
gionskritiken mit den Themen dieser Bewegung zu eng verflochten sind, als da sie
als abzutrennender Widerpart zu isolieren wren.
Wo setzt die religise Selbstdeutung der Gruppe ein? Zunchst mu daran erin-
nert werden, da die Junghegelianer von Hegels Interpretation des Protestantis-
mus ausgehen. Kernpunkt dieser Interpretation ist eine spezifische Fassung der
lutherischen Idee der Glaubensgewiheit. Fr Hegel wurde in der Reformation
erkannt,
da das Religise im Geist des Menschen eine Stelle haben mu und in seinem Geiste der
ganze Proze der Heilsordnung durchgemacht werden mu: da seine Heilung seine eigene
Sache ist und er dadurch in Verhltnis tritt zu seinem Gewissen und unmittelbar zu Gott,
ohne jene Vermittlung der Priester, die die eigentliche Heilsordnung in ihren Hnden
haben.
8
Die Pointe der Hegelschen Interpretation besteht darin, die unmittelbare Glau-
bensgewiheit in eins mit der Freiheit des Geistes zu setzen.
Dieses Konstrukt ist fr die Junghegelianer der erste Interpretationsrahmen. Bei
Rge heit es 1838: Das liegt in der Reformation, da es von nun an schlechter-
dings keine andere Autoritt als die Autoritt des Geistes gibt, und keine andere
Beglaubigung als die seines eigenen Zeugnisses.
9
Protestantismus ist fr die Jung-
hegelianer identisch mit der Autonomie >des Geistes<. Das Licht des Protestantis-
mus ist das Licht der Welt, sein Geist ihr Herr und ihre Zukunft, sein Genu noch
erhhter und bewuter, als schon die Gegenwart ihn geniet.
10
Entscheidend fr unseren Zusammenhang ist nun, welche mglichen Gruppen-
definitionen aus dieser Interpretation hervorgehen. Religionssoziologisch zentral
ist, da die als Geistesfreiheit gedeutete Glaubensgewiheit fr die Spaltung von
Priestern und Laien kaum Raum lt. Die protestantische Gemeinde wird radikal
begriffen als eine Gemeinde, die nicht polizeilich ist und die nicht in Satzung und
340
Regiment, sondern im Geiste und seiner gemeinsamen Erhebung begrndet ist.
11
Im Anschlu an Hegel radikalisieren die Junghegelianer die Luthersche Miach-
tung der ueren Einrichtungen der Kirche, die fr Luther lediglich einen Notbau
darstellten. Vorrangig fr ihn war die Gemeinschaft der Heiligen, die unsichtbare
Kirche. Sie wird zum zentralen Bezugspunkt der Diskussion.
1838 gibt Vatke in den HJ noch eine balancierte hegelianische Interpretation des
Verhltnisses von sichtbarer und unsichtbarer Kirche:
Die wahrhaft allgemeine und als solche ber die Erscheinung erhabene (unsichtbare) Kir-
che existiert in der partikularisierten und empirisch gegebenen (sichtbaren) Kirchengemein-
schaft, negiert aber zugleich die blo uerliche Existenz als Schein, als unwahres Moment
in der Bewegung des absoluten Selbstbewutseins, und ist daher auch in der Existenz, der
wahren Wirklichkeit nach, in sich verborgen. Die wahrhaft Glubigen knnen nicht blo ein
rein innerliches religises Leben fhren, was so fr sich gesetzt, eine leere Abstraktion und
etwas Unwirkliches wre, sie leben vielmehr auch in uerer Kirchengemeinschaft und ihr
Zusammenhang untereinander ist vermittelt durch den Zusammenhang mit der ueren
Kirche; aber nicht umgekehrt haben alle Mitglieder der letzteren auch am innern Wesen der
Kirche teil.
12
Fr Ruge hat sich 1839 schon der Akzent verschoben. Die wahre Wirklichkeit
der Gemeinde ist die geistige, darum die unsichtbare.
13
Im protestantischen Kontext definieren sich die Junghegelianer zunchst als Teil
der unsichtbaren Kirche. So feiert Ruge Kppens Jubelschrift ber Friedrich II. als
eine Schrift, die tief in die Herzen aller Patrioten dringen und eine unberwindli-
che unsichtbare Kirche grnden wird.
14
Dieses Projekt richtet sich explizit gegen
die zeitgenssischen Versuche neupietistischer Kreise, der institutionellen Seite der
Kirche mehr Gewicht zu geben. So heit es in der EKZ bezogen auf die Aufgaben
der Gegenwart: Es gilt nicht mehr, allein das Innere der christlichen Wahrheit zu
suchen und zu beleben, es gilt, ihren ueren, schn gegliederten Organismus wieder
herzustellen.. Fr die HJ ist dies nichts geringeres als die Zerstrung des echten,
innerlichen Christentums.
15
Auf die Stellung der Junghegelianer im Kontext der religisen Strmungen der
40er Jahre wird noch weiter unten einzugehen sein. Hier soll zunchst auf die Her-
ausforderung aufmerksam gemacht werden, die die >unsichtbare Kirche< fr den
Soziologen darstellt. Zu fragen ist, ob diese Selbstbezeichnung berhaupt sinnvoll
bernommen werden kann, wenn es um die Analyse von Gruppenformen geht.
Wie knnte ein religiser Gemeinschaftstyp nachgewiesen werden, der seinem
Selbstverstndnis nach auf uere Formen der Bekundung von Religiositt verzich-
tet? Bei der philosophischen Schule, der politischen Partei, der journalistischen
Boheme kann man sich an sichtbarem sozialen Handeln orientieren. Fr die
unsichtbare Kirche fehlen solche Bezugspunkte.
Das Problem stellt sich aber nicht nur fr den Soziologen. Sofern es sich um eine
Selbstdefinition der Gruppe handelt, mssen ja auch fr die einzelnen Gruppen-
mitglieder Kriterien vorhanden sein, die es ihnen ermglichen, sich als Dazugeh-
rige zu erkennen. Da eine spezielle, Sakramente verwaltende Priesterorganisation
nicht in Frage kommt, bleibt nur der Weg, die unsichtbare Kirche in anderen
Sozialbeziehungen verankert zu sehen, deren uere Zeichen gleichsam zur Kennt-
lichmachung der unsichtbaren Kirche mitbenutzt werden.
341
Die Junghegelianer haben diesen Weg, der bei Hegel vorgezeichnet ist, beschrit-
ten. In den >Anekdota< von 1843 stellt Ruge anllich der Auseinandersetzungen
um die Entlassung B. Bauers das Dilemma der unsichtbaren Kirche dar und gibt
den Ort an, wo sie zu finden sei. Ruge greift hier eine Definition der unsichtbaren
Kirche auf, wie sie von einem Autor der >Minerva< 1842 gegeben wurde: Die Kirche
solle existieren, aber nicht in staatlich-hierarchischen Formen. Die Kirche ist also
die unsichtbare, das geistige Reich des Glaubens, der Glaube an Christus ihr Sym-
bol, die Schrift seine Quelle, die jeder selbst auslegt, jeder ist sein eigener Priester,
und Christus das unsichtbare Oberhaupt der Kirche. Ruge stimmt dem zu und
treibt die Argumentation weiter:
Wir haben hier also eine Gemeinschaft, die unsichtbar, ein Oberhaupt derselben, welches
ebenfalls unsichtbar, und ein Gesetzbuch, welches nur ganz im allgemeinen heilig ist. Das
Gesetz, welches im einzelnen kein Gesetz ist, berlt alle Menschen frei sich selbst. Die
Religion ist hier eine Sache der Innerlichkeit, jeder einzelne hat sie fr sich, und da im Prote-
stantismus keine Gemeinschaft vorhanden ist, der sich der einzelne zu widmen htte, da es
nur auf sein egoistisches >Seelenheil< ankommt, so gibt es im Protestantismus nur einzelne,
nur Privatleute und keine andere Freiheit als die Gewissensfreiheit, d. h. innerliche Privat-
freiheit.
Die durch die Seelsorger reprsentierte Gemeinschaft zhlt fr Ruge wenig,
denn die Seelsorger gehren der Staatsverfassung an. Sie bilden daher keine
Gemeinschaft im Protestantismus. Wie ist das Dilemma der unsichtbaren Kirche
zu lsen? Ruge fhrt fort:
Die einzige reelle Organisation, zu der es gekommen, ist die Wissenschaft (. . .). Statt des
Kirchenstaates, den der Protestantismus auflst und in den weltlichen Staat aufgehen lt,
drngt er also zu einer Organisation des unsichtbaren Reiches, und dies ist das der Wissen-
schaft, dargestellt durch die Universitten und die Literatur.
16
Hier also wird die unsichtbare Kirche ein Stck sichtbar als eine reelle Organisa-
tion. An anderer Stelle wird die unsichtbare Kirche als die Begriffskirche der Wis-
senschaft bezeichnet.
17
Es kommt zu einer berlagerung des Selbstverstndnisses
als philosophischer Schule durch den Interpretationsrahmen der unsichtbaren Kir-
che, eine berlagerung, die ihren philosophischen Ausgangspunkt in der von
Hegel gesetzten Identitt von Glauben und Wissen hat.
Allerdings bleibt die Binaritt sichtbar/unsichtbar in eigentmlicher Weise
unbestimmt, denn in den Wissenschaften hat zwar die unsichtbare Kirche ihren
Ort, aber sie fllt nicht mit ihnen zusammen. Die unsichtbare Kirche ist dem Selbst-
verstndnis der Junghegelianer nach nicht eine sektenartige Randgruppe, sondern
virtuell die zentrale Kirche. Das heit, sie ist durch ein imaginres Band an die
jeweils als entscheidend begriffene Zentralitt gebunden. 1839 ist dies fr Ruge der
Staat. Er ist die einzige Sichtbarkeit fr alle Unsichtbarkeit des Geistes, die sicht-
bare Kirche ist er selbst in seinen Anstalten fr den Kultus und fr das Gttliche in
Wissenschaft und Kunst.
18
Da gerade diese Sichtbarkeit eine neue unsichtbare
Kirche herausfordert, liegt fr die Dialektiker auf der Hand.
Der Topos der unsichtbaren Kirche begleitet die junghegelianischen Debatten.
Er bietet immer wieder die Mglichkeit, gegenber als uerlich und erstarrt
erscheinenden sozialen Zusammenhngen eine neue Lokalisierung der Gewiheit
342
der Freiheit des Geistes vorzunehmen. Schlielich kann er auch noch fr die Spal-
tung der Junghegelianer mit herangezogen werden, wie dies G. Julius im Hinblick
auf die Marxsche Kritik an B. Bauer 1845 tut. Der Streit zwischen Marx und
B. Bauer ist fr ihn der Streit der sichtbaren mit der unsichtbaren Menschenkir-
che. So heit es bei Julius:
Whrend Bauer, in protestantischer Weise, die schlechte Welt, er hat dafr den Ausdruck
>die Masse<, die (wie Herr Marx es ihm vorrckt) >noch nicht kritisch wiedergeborene Welt<
aus Herzensgrunde verachtet, aber sie bestehen lt und zu dem gebraucht, wozu sie gut ist,
sich in sie schickt, indem er an ihr und fr sie arbeitet, um sie der Zukunft, der >neuen
Geschichte< an deren Schwelle die Kritik noch einsam steht, entgegenzufhren und selbst
einstweilen sich selig fhlt im Hinblick auf diese neue Welt - alles, wie gesagt ganz prote-
stantisch, - versetzt Marx den Himmel, das Reich >der vollbrachten Emanzipation der
Menschheit< die neue Welt der Gattungswesen, in rmisch-katholischer Weise, auf den
Boden der irdischen, materiellen Welt, als eine an die forces propres als Gesellschaftskrfte
glaubende, den bsen Geist des Egoismus durch den guten Geist des Gattungslebens (der
Liebe) aufhebende und die Freiheit der >Menschenkinder< (die humanistische Emanzipa-
tion) vollendende, allein selig machende, wohlorganisierte Kirche auf Erden , Auf diese Art
verwandelt Herr Marx >die theologischen Fragen in weltlichem Er glaubt nicht an die
unsichtbare, im Herzen, im Geiste wirkliche Kirche des Humanismus, er will eine organi-
sierte sichtbare Kirche des Humanismus haben.
19
Die sichtbare Kirche ist in dieser Diskussion ein gleichsam katholisches Prinzip,
dem die Vollendung der Reformation fehlt. Julius sieht bei Marx einen Abfall vom
protestantischen Prinzip. Da Marx umgekehrt B. Bauer zum katholischen Heili-
gen stilisiert, ist bekannt.
Die unsichtbare Kirche ist ein durchgngier Modus der Junghegelianer, sich in
der religisen Tradition zu verorten. Allerdings hat dieser Modus den Charakter
einer Hohlform. Denn in dem Mae, in dem das sichtbare kirchliche Moment zum
Verschwinden gebracht wird, ist auf dieser Ebene kaum mehr an spezifischen Kri-
terien herauszubringen, als da die Integration der unsichtbaren Kirche ber eine
radikal gefate Autonomie des Geistes in der Gruppe gefat wird.
Zwei Interpretationen bieten sich an: Einmal knnte man davon ausgehen, da
die Radikalisierung der Idee der unsichtbaren Kirche letztendlich zu einer Aufl-
sung der religisen Momente gefhrt hat. Hiernach bte die unsichtbare Kirche
gleichsam den Startpunkt fr eine Bahn, an dessen Ende skulare Positionen stn-
den. Wird die Hohlform der unsichtbaren Kirche nicht mit weiteren Elementen
der religisen Tradition ausgestattet, so wrde sie zunehmend bedeutungslos wer-
den. Und eine ganze Reihe von Indizien spricht fr diese Interpretation. Die Jung-
hegelianer emanzipieren sich mit der Entfaltung ihrer Religionskritik zunehmend
von religisen Gruppendefinitionen. Sie wollen aus der religisen Sphre heraus,
und sie formulieren schlielich radikal atheistische Positionen.
Eine andere Interpretation knnte annehmen, da die Hohlform der unsichtba-
ren Kirche, die im Bereich des Protestantismus dem Prinzip nach anerkannt ist,
gerade dazu eingeladen hat, sie mit weiterem Definitionsmaterial aus verschiede-
nen religisen Unterstrmungen aufzufllen. Auch fr diese Interpretation spre-
chen eine ganze Reihe von Indizien. Wer die Texte der Junghegelianer aufmerksam
343
liest, findet in ihnen eine Vielzahl von Gedankenfiguren und Symboliken, die sich
als dem weit verzweigten religisen Unterstrom von Schwrmertum und spiritualen
Gruppen angehrig zu erkennen geben.
Diese interpretatorische Alternative stellt sich nicht nur fr die Junghegelianer,
sie steht in Zusammenhang mit der lteren Kontroverse, ob die Weltanschauung
des deutschen Idealismus als eine natrliche moderne Umwandlung des Protestan-
tismus betrachtet werden mu oder vielmehr als eine Verkehrung in eine modern-
griechische Gnostik.
20
Und sie steht ebenso im Zusammenhang mit den Kontro-
versen, inwieweit heutige emanzipationstheoretische Bemhungen mit dem Hin-
weis auf ihre religise, namentlich schwrmerisch-chiliastische >Abstammung<
desavouiert werden knnen.
Die Junghegelianer stehen ideengeschichtlich am Ausgang des deutschen Idea-
lismus, und aus ihrem Kreise gehen theoretische Umrisse hervor, die bis in unsere
Gegenwart hinein Bezugspunkte der theoretischen Diskussion sind. Die Frage,
welche der beiden Interpretationen mehr zutrifft, ist von daher unausweichlich in
eine latente polemische Frontstellung eingebunden. Denn im Rahmen der neuzeit-
lichen Wissenschartstradition gelten weithin religise Voraussetzungen wenigstens
in den skularen Fakultten als Abfall von der Wissenschaftlichkeit. Den Nach-
weis, da es sich z. B. bei der dialektischen Methode um ein bestimmten religisen
Traditionen verhaftetes Denkmodell handle, wird innerhalb der latenten Frontstel-
lung derjenige Wissenschaftler bestreiten wollen, der sich dieser Methode bedient.
Vielleicht hat diese Frontstellung mit dazu beigetragen, da wichtige Partien des
religisen Lebens in der Zeit des Ausgangs des klassischen Idealismus in Deutsch-
land viel zu wenig untersucht wurden. H. Stuke weist zu Recht darauf hin, da es,
um der starken Lebendigkeit und tiefgreifenden Wirksamkeit biblisch-christli-
cher Glaubensinhalte und Heilserwartungen in den 30er und 40er Jahren gewahr
zu werden, nicht ausreiche, sich an der protestantischen Orthodoxie und der jung-
hegelianischen Religionskritik zu orientieren. Vielmehr mu man vor allem den
religisen Spiritualismus und das religise Schwrmertum dieser Jahre in den Blick
nehmen.
21
J. Gebhardt hat im Anschlu an F. Heer auf die hufig miachtete schwrmeri-
sche Unterstrmung aufmerksam gemacht.
Es gilt zu erkennen, da der aufsteigende Dritte Stand auch in Deutschland sein politisches
Bewutsein neben dem >Umweg< ber fremde Vorbilder gewinnt durch soziale und geistige
Kommunikation mit der Welt der Schwrmer, die latent vorhanden sind als eine >zweite
Nation<, die seit den Religionskriegen von den politischen und geistlichen Orthodoxien
lutherischer und katholischer Observanz nach unten abgedrngt wurde.
22
Dieser These von der zweiten Nation im Untergrund ist zuzustimmen. Aller-
dings sind Zweifel angebracht, wenn Gebhardt diese Strmungen verantwortlich
macht fr die sozialen und politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. In sei-
ner Betrachtung werden die Schwrmer umstandslos zu Vorlufern totalitrer Mas-
senbewegungen.
Polemische Frontstellungen dieser Art erschweren eine Analyse der Zusammen-
hnge. In unserem Kontext geht es nicht darum, die religise Unterstrmung ver-
antwortlich fr einen >deutschen Irrationalismus< zu machen. Dem Soziologen fllt
344
es vielleicht auch leichter, sich diesen Fragen zuzuwenden, weil er sich Urteilen
ber die Dignitt von religisen Glaubensinhalten und von wissenschaftlichen
Gruppennormen ein gutes Stck weit enthalten kann und auch enthalten mu, um
die sozialen Situationen der Individuen im Blick halten zu knnen. Wo er diese
Zurckhaltung lockert, wird er daraufhinweisen mssen, da im Bereich mytholo-
gischer Bilderwelten und religiser Deutungssysteme hufig eine weitaus komple-
xere geistige Anstrengung anzutreffen ist, als in wissenschaftlichen Arbeiten, die
sich auf dem Gegensatz von wissenschaftlicher Rationalitt und Irrational-Religi-
sem ausruhen.
2. Gnostischer und chiliastischer Habitus
Wenn man der Interpretation nachgeht, derzufolge sich die Hohlform der unsicht-
baren Kirche mit Definitionen aus verschiedenen religisen Traditionen auffllt, so
ergibt sich das Problem, den Charakter der einflieenden Traditionen soziologisch
genauer zu fassen. Zunchst mu anerkannt werden, da sich dieser Bereich einem
direkten Zugriff sperrt. Denn wir haben es hier mit vielfltig verzweigten, mehr
oder weniger esoterischen Glaubensformen zu tun, die sich insgesamt als abwei-
chendes religises Verhalten kennzeichnen lassen. Der gemeinsame Nenner ist
zunchst, da diese Haltungen aus dem Raster formell organisierter Glubigkeit
herausfallen und nur selten sich in konturierten Glaubensgemeinschaften offenba-
ren. Das abweichende religise Verhalten steht jedoch in spezifischen Spannungen
zu den hegemonialen religisen Verhaltensweisen. Und aus der Spezifitt der Span-
nungen ergeben sich Chancen, sinnvolle Kategorien zu bilden. Fr unseren Bereich
sind zwei Haltungen von Bedeutung, die ich den gnostischen und den chiliasti-
schen Habitus nennen mchte.
Der gnostische Habitus
23
entwickelt sich an der spezifischen Spannung, die zwi-
schen der hegemonialen Lehre und ihren anerkannten Reprsentanten und gleich-
sam inoffiziellen systematischen intellektuellen Bemhungen besteht. Historisch
entstand Gnosis vermutlich als religiser Laienintellektualismus, worauf Rudolph
im Anschlu an Weber hingewiesen hat.
24
Entscheidendes Merkmal des Laienin-
tellektualismus ist, da in diesem Bereich das Bestreben anzutreffen ist, ber die
anerkannten religisen Deutungen hinausgehende Abstraktionen komplizierterer
Art zu entwickeln. Der gnostische Habitus enthlt somit einen berschu an
Intellektualitt. Es werden dort Probleme gesehen und virtuose Konstruktionen
entfaltet, wo die Vertreter anerkannter Lehre keine Notwendigkeit sehen, sich
Gedanken zu machen. Die sozialen Ursachen fr die Entstehung von Laienintellek-
tualismus knnen vielfltig sein, durchgngig aber drfte die Situation einer ten-
denziell randstndigen Intelligenz gegeben sein, was Weber mit dem Begriff
Kleinbrgerintellektualismus andeutet.
Hinzu kommt, da sich im gnostischen Habitus gemeinsam mit dem ber-
schu an Intellektualitt eine schwer begrenzbare Entfremdungserfahrung aus-
breitet. Weil die religise Wahrheit nicht so leicht gefunden werden kann, wie dies
bei den offiziellen Vertretern der Fall ist, weil also der Intellekt kompliziertere
345
Umwege machen mu, entfernt sich mit der religisen Wahrheit zugleich die
Fhigkeit zur harmlosen Teilnahme an der je gegebenen >Welt<. Weltverachtung,
vertiefte Spekulation ber das >Bse<, Leiden an Entfremdung und die Ausbildung
schroffer Dualismen sind weit verbreitet.
Der chiliastische Habitus
25
entwickelt sich an der spezifischen Spannung, die zwi-
schen dem heilsgeschichtlichen Wissen um die Endzeit und dem Versuch besteht,
dies Wissen auf die jeweilige Jetztzeit anzuwenden, um den heilsgeschichtlichen
Ort der Gegenwart zu bestimmen. Ausgehend von Auslegungen der jdischen und
christlichen Apokalypsen und der Weissagungsliteratur bildeten sich heilsge-
schichtliche Modelle heraus, in denen zunchst der zu erwartende Ablauf des end-
zeitlichen Geschehens und schlielich die gesamte Geschichte als eine erkennbare
Sequenz von Ereignissen bzw. heilsgeschichtlichen Stufen bestimmt wurden. Die
Konjunkturen eines deutlichen Auftretens chiliastischer Vorstellungen sind wahr-
scheinlich abhngig von sozialen und kulturellen Krisen, in denen ein vermehrtes
Bedrfnis nach heilsgeschichtlicher Vergewisserung der beteiligten Individuen
besteht.
Die Pointe des Chiliasmus gegenber diffuseren Endzeit- und Weltuntergangs -
erwartungen besteht darin, da in chiliastischen Entwrfen vor dem Ende der Welt
ein letztes Zeitalter auf Erden erwartet wird, in dem sich utopische Hoffnungen von
Frieden und Glck realisieren werden. Seine geschichtlich wirksamste Fassung hat
der Chiliasmus in der Geschichtstheorie des calabresischen Abtes Joachim von
Fiore gefunden.
26
Bei ihm ist auch schon der soziologisch wichtige Unterschied
angelegt, der die Frage betrifft, ob das letzte Zeitalter lediglich zu erwarten sei, oder
ob Krfte in der Gegenwart bestehen, die seine Heraufkunft aktiv befrdern helfen
knnen.
Gnostischer und chiliastischer Habitus sind hier nur holzschnittartig vorgestellt.
In der langen Geschichte dieser untergrndigen religisen Traditionen existieren
vielfltige Nuancierungen und berschneidungen. Beide Haltungen beziehen sich
zwar auf zentrale Inhalte der hegemonialen religisen Kultur, gemeinsam ist ihnen
jedoch, da sie die Mysterien des Glaubens nicht einfach verwalten und tradieren,
sondern zum Problem machen. Der gnostische Habitus betont die Notwendigkeit,
den Glauben durch intellektuelle Abstraktionen zu vertiefen, um im Wissen Erl-
sung zu finden, der chiliastische Habitus betont die Notwendigkeit, sich zu verge-
wissern, in welchem Zusammenhang die eigene geschichtliche Existenz mit dem
gttlichen Heilsplan steht.
Historisch betrachtet, begrndet die Kontinuitt der hegemonialen Religion
zugleich auch die Kontinuitt der abweichenden religisen Haltungen. Dabei ist es
unter systematischem Gesichtspunkt nicht von entscheidender Bedeutung, ob die
Kontinuitt der abweichenden religisen Haltungen durch faktische berlieferun-
gen zustande kommt, oder ob auch ohne berlieferung die Eigenart der inhaltli-
chen Struktur unter den gegebenen Umstnden immer wieder zur >Neuerfindung<
derselben Abweichungen gefhrt hat. Wahrscheinlich ist, da beides stattgefunden
hat.
Im Bereich des Hegelianismus sind beide Haltungen weit verbreitet. Es sei hier
an zwei Hegeische Formulierungen erinnert, an denen sich der gnostische und chi-
liastische Habitus verdeutlichen lassen.
346
In der >Phnomenologie< schreibt Hegel: Das Leben Gottes und das gttliche
Erkennen mag also wohl als ein Spielen der Liebe mit sich selbst ausgesprochen
werden; diese Idee sinkt zur Erbaulichkeit und selbst zur Fadheit herab, wenn der
Ernst, der Schmerz, die Geduld und Arbeit des Negativen darin fehlt.
27
Das Abso-
lute geradewegs in den Blick zu nehmen, reicht nicht aus. Zwar trifft die Formulie-
rung Spielen der Liebe mit sich selbst das Wesen des Absoluten, aber diese Vor-
stellung, an der sich Glubige zu rasch beruhigen knnten, ist gnostisch defizitr.
Sie wird entwertet. Zur Erkenntnis Gottes sind kompliziertere Umwege ntig, eine
mhevolle Reise durch nicht enden wollende Entfremdungen hindurch, an deren
Ende erst das Absolute als gesichertes Resultat erscheint.
Als Indiz fr einen chiliastischen Habitus in Hegels Denken wird man nicht nur
an das berhmte Jugendwort an den Studienfreund Schelling erinnern mssen:
Das Reich Gottes komme, und unsere Hnde seien nicht mig im Sche.
28
Vielmehr sind gerade Ausgangspunkt und Aufbau der Hegelschen Geschichtsphi-
losophie von chiliastischen Motiven durchtrnkt. Von der als zerrissen erlebten
geschichtlichen Krisensituation her ergibt sich die Notwendigkeit, sich der Sinn-
haftigkeit der eigenen geschichtlichen Existenz in einer umfassenderen Deutung
der Geschehnisse zu vergewissern. Auf den ersten Blick stellt sich die Weltge-
schichte als ein Schauspiel der Leidenschaften, der Gewaltttigkeit und des
Unverstandes dar, dessen Betrachtung nur mit einer moralischen Betrbnis,
mit einer Emprung des guten Geistes, wenn ein solcher in uns ist, ber solches
Schauspiel enden kann. Man brauche nicht einmal rednerische bertreibung,
sondern allein mit richtiger Zusammenstellung des Unglcks liee sich die
Geschichte zu dem furchtbarsten Gemlde erheben und ebenso damit die Emp-
findung zur tiefsten, ratlosesten Trauer steigern. Diese Ausgangslage bildet den
Einstiegspunkt fr eine chiliastische Figur. Aber auch indem wir die Geschichte
als diese Schlachtbank betrachten, aufweicher das Glck der Vlker, die Weisheit
der Staaten und die Tugend der Individuen zum Opfer gebracht worden, so ent-
steht dem Gedanken notwendig auch die Frage, wem, welchem Endzwecke diese
ungeheuersten Opfer gebracht worden sind.
29
Die Entfremdungserfahrung zwingt zu geschichtsphilosophischen Sinngebun-
gen. Der Endzweck ist zweifellos ein chiliastisches Erbe, aber die Pointe der
Hegelschen Konstruktion besteht darin, da er den heilsgeschichtlichen Bruch, an
dem der Endzweck sich zeigt, ambivalent historisiert. Man kann Hegel lesen und
finden, da mit der Reformation bereits das dritte Zeitalter begonnen hat. Aber
dazu mu man in der Lage sein, den Endzweck in bestehenden Gestaltungen der
Welt realisiert zu sehen. Es wre dies die Stelle, an der die gnostische Erlsung
durch Wissen gleichsam die chiliastische Erwartung annullieren knnte. B. Bauer
bemerkt ber die Hegelschule nach Hegels Tod, da fr die Althegelianer die
Trume der Chiliasten von der Zeit der Vollendung ( . . . ) bereits in Erfllung getre-
ten zu sein schienen.
30
Fr die Hegelianer gehren gnostischer und chiliastischer Habitus zu vertrauten
Instrumentarien der Weltdeutung, und sie ordnen sich selbst den entsprechenden
untergrndigen Traditionen zu. Fr Rosenkranz sind der Sache nach die gnostische
und die chiliastische Thematik die beiden entscheidenden theologischen Strnge,
die sich aus der Reformation heraus entwickeln. Die Protestanten htten bewiesen,
347
da man fr die Vermittlung der Gewiheit bei der Heiligen Schrift als solcher nicht stehen
bleiben knne; man msse die Religion von dem freien Gedanken durch Auslegung ihrer
eigenen, immanenten Vernunft sich rechtfertigen lassen. So entstanden nun Systeme der
sogenannten natrlichen Religion und Auseinandersetzungen vom Unterschied des Mei-
nens, Frwahrhaltens, Glaubens und Wissens. - Auf der anderen Seite gaben sich viele dem
Studium der Weltgeschichte hin, um -wie Lessing, Herder, Iselin u. a. - aus dem Begriff des
Endzweckes unserer Geschichte die einzelnen Erscheinungen derselben und deren Not-
wendigkeit verstehen zu lernen.
31
Die vertiefte Spekulation ber das Verhltnis von Glauben und Wissen ist fr
den gnostischen Habitus zentral, weil Gnosis ja gerade voraussetzt, da intellektu-
elle Erkenntnis und gttliche Erlsung identisch sind. Auf der anderen Seite steht
die geschichtsphilosophische Spekulation gerade auch bei Lessing, den Rosen-
kranz anfhrt, in enger Kommunikation mit chiliastischen Traditionen.
32
Gnosti-
scher und chiliastischer Habitus sind die beiden positiven Traditionen, an die
gedacht werden mu, wenn man nach Elementen sucht, die in jenem Hohlraum der
unsichtbaren Kirche sich eingelagert haben.
33
Die Probleme geschichtsphilosophischer Selbstverortung habe ich im Zusam-
menhang der Diskussion der Entwrfe fr eine journalistische Boheme bereits
errtert. Auf religionssoziologischer Ebene spiegelt sich die Blockierung
geschichtsphilosophischer Lsungen angesichts der groen Stadt in der Frage, ob
die chiliastische Hoffnung sich schon erfllt hat oder ob die Erfllung noch bevor-
steht. Auch dort, wo die Junghegelianer sich als unsichtbare Kirche definieren, ist
diese Frage umstritten.
Die unsichtbare Kirche hat fr Ruge eine doppelte Seite. Einmal ist es die infor-
melle Gemeinschaft des Geistes, die sich in der Andacht verwirklicht, bezogen
auf das Bibelwort: Wo drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten
unter ihnen. Die andere Seite der unsichtbaren Kirche bezieht sich auf ihre Funk-
tion fr den letzten Weltzustand.
Die Andacht des Gottesdienstes ist nicht die einzige Form der Erscheinung des christlichen
Geistes. Er durchdringt das ganze Leben, die Erlsung und Vergtdichung der Welt ist
wirklich und das Himmelreich ist zu uns gekommen; wehe denen, die es antasten, theore-
tisch antasten oder praktisch - sie sind ausstzig unter den Gesunden!
34
Diesem Status quo einer im Kern erfllten Endzeit setzt B. Bauer die chiliastische
Weissagung entgegen: es werden Staaten kommen, die sich zuversichtlich auf die
Freiheit des Selbstbewutseins grnden werden. Sie werden die Sache des kirchli-
chen Bewutseins vollends entscheiden. Es gibt viele Weissagungen der letzten
fnfzig Jahre, die ihrer Erfllung harren. Heil den Staaten, die sich nicht frchten
werden vor diesen Weissagungen.
35
Bauers Metaphorik der Posaune des jng-
sten Gerichts gehrt ebenso in diesen Zusammenhang wie Marx' Rede vom deut-
schen Auferstehungstag.
36
Die Ambivalenzen der Historierung der Endzeit werden in den Debatten nicht
offen ausgetragen. Deutlicher ist der chiliastische Habitus dort greifbar, wo die
Junghegelianer ihre neue Religion des Diesseits der alten, nur auf das Jenseits
bezogenen Religion gegenberstellen. Die Religion des Diesseits entspricht des-
348
halb dem chiliastischen Geschichtsmodell, weil eine Phase angenommen wird, in
der sich die auf das Jenseits gerichteten Heilserwartungen in der weltlichen
Geschichte realisieren.
Fr Ruge ist die alte Religion der Kultus oder die Verehrung eines schlechthin
jenseitigen Heiligen, dessen Offenbarung wohl in die Zeit fllt, aber immer auch in
dieser noch das Unerreichbare, das berschwengliche und Unbegreifliche, also
nach wie vor sie jenseitig bleibt. Dagegen fllt die neue Religion vollstndig in die
Zeit, sie wird zur Praxis. Diese beiden Formen der Religion bekmpfen sich
jetzt, oder richtiger geredet, sie stehen sich gegenber, wie die alte und die neue
Zeit.
37
Was ist an der junghegelianischen Religion des Diesseits noch religis? Wie
grenzen sich die Junghegelianer, die zuerst noch nicht offen atheistische Positionen
vertreten, gegenber dem Atheismusvorwurf ab? Ein anonymer Berliner Junghege-
lianer argumentiert:
Das Christentum selbst gibt das Kriterium an die Hand, woran ihr erkennen knnt, ob eine
neue religise Theorie der Menschheit gefhrlich oder heilbringend sei. Wiedergeburt durch
den Geist - ist die Kategorie, die in keiner wahren, das Heil der Menschheit frdernden, reli-
gisen Doktrin fehlen darf. Wre das Diesseits, auf welches die modernen Kritiker dringen,
das empirische, die Huldigung des krassen Materialismus, dann wrde auch ich mit euch ein
Anathema ber sie ausrufen: aber es ist das durch den Geist wiedergeborene Diesseits, was
sie anerkannt wissen wollen; - ihre Tendenz ist also gerade die echt christliche.?
1
Die Wiedergeburt durch den Geist entspricht dem Dritten Zeitalter des Heili-
gen Geistes in der fioritischen Konstruktion, in dem die gttliche Wahrheit sich
nicht mehr ber priesterliche Vermittlung verbreitet, sondern quasi spontan in den
Individuen entsteht.
Ruge wei, da es sich bei solchen Auffassungen um Ketzerisches handelt. .
Das Aufgeben des Christentums und der alten dualistischen Religion (d. h. die Spaltung
von Diesseits und Jenseits, d. V.) ist die erste Ketzerei (. . .). Die zweite Ketzerei ist die der
alten entgegengesetzte neue Religion, die Religion der Sittlichkeit, die Religion des Diesseits,
und der Grund von allen beiden ist der Gott, welcher der Geist und nicht transmundan, son-
dern die ewiggegenwrtige als das geistige und natrliche Universum ausgelegte Idee (Sub-
jekt, Begriff) ist.
39
Die Religion eines innerweltlichen Gottes ist jedoch ein labiles Deutungsmuster,
vor allem, weil in ihr das Verhltnis von skularer Geschichte und Heilsgeschichte
oszilliert.
Was passiert, wenn die skulare Eigengesetzlichkeit des Diesseits die Konturen
des Reiches Gottes auf Erden zu irritieren beginnt? An dieser Frage zerbricht der
chiliastische Habitus der Junghegelianer. Sei es, da die groe Stadt die Uner-
schpflichkeiten eines neuen Jerusalem bertrifft, oder da die Herausforderun-
gen des innerweltlichen Gottes, - da die Geschichte anfngt, die chiliastischen
Trume zu korrigieren. In diesem bergangsfeld zerbrechender chiliastischer
Erwartungen hat die Vergewisserung der religisen Erfahrung Konjunktur. Mag
gesteigerte Religiositt oder militanter Atheismus dabei herauskommen, diese
Alternative ist weniger dringlich als eine haltbare Gewiheit, mit der das Oszillie-
ren von skularer Geschichte und Heilsgeschichte beendet werden kann.
349
3. Erlsung durch Wissen
Im gnostischen Habitus wird der verbreitete Glaube defizitr erlebt. Die religise
Lehre wird nicht als selbstverstndlich hingenommen, sondern sie mu umstndli-
cher spekulativ begrndet werden. Die intellektuelle Gotteserkenntnis erhlt den
Vorrang vor dem bloen Glauben. Ihm wird die Erlsung durch Wissen entgegen-
gestellt. Durchgngig ist der gnostische Habitus der Junghegelianer dort zu greifen,
wo sie die Differenz von Glauben und Wissen systematisch ausbauen und radikali-
sieren. Dabei erscheint das Wissen zunchst im Anschlu an Hegel nicht als eine
dem Glauben widersprechende Haltung, sondern als die gleichsam hhere Form
des Glaubens.
Fr Rugeist die glubige Frmmigkeit der Gegenpol, bei dem anzusetzen ist.
Die Kategorie der Frmmigkeit ist jetzt veraltet, denn sie ist die gute, gehorsame, sanfte
Unterwrfigkeit unter den heiligen Willen des jenseitigen Gottes, sie ist Tugend aus Reli-
gion, denn in der alten Form der Religion ist Tugend und Religion zweierlei, weil es einen
doppelten Willen gibt, den Willen Gottes, zu dem sich die Religiositt gehorsam verhlt,
und den Willen des Menschen, dessen Tugend in diesem Gehorsam besteht und dann
Frmmigkeit genannt wird. Die Frmmigkeit, dieser Rest einer unmndigen Vorzeit
(. . .), darf von ihrer Negation nichts wissen, sie darf nicht gebildet, sie mu wirklich noch
kindlich sein.
Die hhere Form des Glaubens dagegen geht nicht vom Kindverhltnis aus, son-
dern von der Gemeinschaft; freier Menschen. Es handelt sich um Bildung des
Charakters und des Geistes, um den Kampf der Freiheit mit der Endlichkeit, und
dieser Kampf ist der Kampf und das Leben des absoluten Wesens selbst. Wer den
Freiheitskampf in geistiger Weise versteht und treu die Folgen seines Verstndnis-
ses auf sich nimmt, den kann man im wahren Sinne religis nennen.
40
L. Buhl zufolge will auch der extremste Kritizismus (. . .) die Religion nicht
berhaupt negieren, sondern nur an die Stelle der positiven Religion die des Geistes
setzen.
41
Auch bei Feuerbach tritt die neue Philosophie an die Stelle der Religion,
sie hat das Wesen der Religion in sich, sie ist in Wahrheit selbst Religion.
42
Und
Rugedefiniert emphatisch: Der neue Glaube aber, nach dem mit Recht alles fragt
und strebt, die ganze Gesinnung dieser neu entdeckten Welt, ist keine andere, als
der Glaube an die alles durchdringende Seele des Wissens oder an die Wahrheit.^
Uns interessieren die sozialen Formen, in denen sich der >neue Glaube< zeigen
knnte. Da das Gottkindschaftsverhltnis, das sich in einer Hierarchie darstellen
liee, nicht mehr gilt, sondern die innere Gewiheit der stetigen Entwicklung des
Einen Geistes den Ausgangspunkt bildet, stellt sich die Frage nach Formen fr
den >neuen Glauben< besonders dringlich.
Nach auen tritt der >neue Glaube< bei Rugeals Herrschaft der wahrhaft Wis-
senden auf. Eine kontemplative, spekulative Versenkung in ein gttliches Wissen
steht nicht zur Debatte, sondern der >neue Glaube< wird kmpferisch nach auen
gewendet. Gott liebt es, sich den Menschen in einem brennenden Busche zu
offenbaren; der Feuerbrand, in dem er sich uns gezeigt hat, ist die Revolution,
schreibt E. Bauer
44
, und fr die Jetztzeit gilt nach Rge: auch der Gebildetste
gebraucht das Gefhl der todesverachtenden Idealitt, das Fieber der rcksichtslo-
350
sen Begeisterung, den reellen Gottesdienst der Freiheit; keine Theorie ersetzt diese
Praxis.
45
Bezeichnend die Analogie, die Jachmann beschwrt: Aber ohne Mrty-
rer wre die Religion Christi nicht zur Weltreligion geworden; ohne die blutigen
Taufzeugen derer, die ihr Leben fr ihre berzeugung lieen, hat noch kein Kind
der Wahrheit seinen Namen erhalten. Auch der Liberalismus erfordert solche
Opfer.
46
Eine spezielle soziale Form ist in diesem glubigen Pathos selbst nicht
mitgegeben, vielmehr wird die Form der Partei oder der Schule mit religionskriege-
rischen Elementen aufgeladen.
47
Der gnostische Habitus wirft fr die Innenseite der Gruppentypen erhebliche
Probleme auf. Die Referenz dem >Wissen< gegenber mag die einzelnen noch so
sehr zusammenhalten, die Bindung des Erlsungsglaubens an das Wissen ist
schwer kollektivierbar. Schon fr die philosophische Schule ist die kollektive Inte-
grationsebene wissenschaftliche Wahrheit schwierig gewesen. Nun tritt mit dem
gnostischen Habitus noch das Moment religiser Gewiheit hinzu.
Man knnte von der spiegelverkehrten Innenseite des charismatischen Dilem-
mas sprechen, das darin besteht, da Charisma immer nur einzelnen anhaften
kann. Die reine und unvermischte Glubigkeit als ein theoretisches Konstrukt ent-
nehmen die Junghegelianer der Hegeischen Religionsphilosophie. Religion ist hier,
wie Rosenkranz schreibt, von Gott unmittelbar zu wissen.
48
Die Struktur dieser
Definition hat sich bis in M. Webers Begriff des Charisma erhalten, mit dem eine
schlechthin an dem Objekt oder der Person, die es nun einmal von Natur besitzt,
haftende, durch nichts zu gewinnende Gabe gemeint ist.
49
Der unmittelbare
Bezug ist aber nur ein konstruierter Ausgangspunkt, der empirisch erst greifbar
wird in der Bewhrung des Charisma. Auf diese Bewhrung und auf ihre sozialen
Voraussetzungen und Chancen usw. hat sich Webers soziologisches Interesse kon-
zentriert.
Im gnostischen Habitus liegen nun zwei Mglichkeiten, mit der Annahme eines
reinen, unvermischten Glaubens umzugehen. Hegel vollzieht einen gigantischen
Zirkel, um den unmittelbaren Bezug des Glaubens durch differierende Bewut-
seinsformen, den Stufen des Geistes, die sich als Vermittlung darstellen, aufzuf-
chern, und schlielich am Ende seines Systems im absoluten Wissen die Versh-
nung von Glauben und Wissen zu feiern. Im Weberschen Sinne knnte man sagen,
da Hegel spekulativ die Bewhrungen so angelegt hat, da sie erfolgreich durch-
gestanden werden. Die Junghegelianer weichen hier ab, und sie mssen abweichen,
weil die Hegeische Vershnung von Glauben und Wissen nur individuell haltbar
ist.
Bei Ruge stellt sich dies Problem so dar:
Wer die Mission erfllt, das Wort des neuen Geistes auszusprechen, das heit, den
geschichtlichen Ruck und Bruch mit der Vorzeit auszufhren, der sitzt mit hohen Ehren am
Webstuhl der Zeit, er schafft, wie im Denken das Erkennen des Vorliegenden die neue
Bestimmung schafft; es wird aber ebenso der Idee, dem wahren Sein des Begriffs, zugestan-
den werden mssen, da sie im Reich des Geistes am wahrsten und vllig, berall zu Tage
liegend, nirgends >zu Grunde liegen bleibend< sein msse.
Die gttliche Erkenntnis mu berall zu Tage liegen, weil dies die Vorausset-
zung ist, ber gttliche Erkenntnis in der Gruppe kommunizieren zu knnen. Die
351
einzelnen sind keine prometheischen Feuerbringer, welche die Wahrheit aus dem
jenseitigen Himmel zu holen bevorzugt wren. Eine kollektive Erleuchtung wre
zwar spekulativ zu entwerfen, aber die Junghegelianer sind gnostisch genug, um
sich mit dem Wunder eines Pfingstens der Gruppe nicht beruhigen zu knnen. So
kommt Ruge zu dem Schlu:
Das wirklich Zeugende ist hier allerdings der Einzelne, der Genius, der aber aus dem allge-
meinen Geist hervorgeht, und, indem er seinerseits das Selbstbewutsein des allgemeinen
Geistes ausspricht (!), in Wort und Tat nichts tut, als die Mission der sich selbst (!) einfh-
renden Freiheit erfllen. Er ist der Gottgesandte, nicht der Gott. Die soziale Form, die hier
antipiziert wird, nennt Ruge die geistige Demokratie, die im Besitz des Gttlichen die
Genien nicht verehrt, denn sie sind von ihr bestellt, sondern sie nur ehrt, indem sie sie
bestellt, in der Verehrung aber, die sie wirklich ausbt, in ihrem wirklichen Kultus, eben den
Genu ihrer Wrde und die Ehre des besten Seins besitzt.
50
Wie kann so eine prekre Situation in der Gruppe ausgehalten werden? Das
Geheimnis besteht darin, da zur Lsung dieses Knotens der gnostische Habitus
den Dualismus von Glauben und Wissen entgegen der Intention, beides zusam-
menfallen zu lassen, fortlaufend neu reproduzieren mu. Da die Hierarchie als eine
Konsequenz des Charismas vermieden werden soll, bleibt nur die Chance, in einer
Interaktion den Glauben durch die Erkenntnis und die Erkenntnis durch den Glau-
ben in Schach zu halten. Wer den Verlockungen einer zu hervorragenden glubigen
Selbstgewiheit zu unterliegen droht, kann durch eine Verkomplizierung der
Erkenntniswege zur >geistigen Demokratie< gezwungen werden. Umgekehrt dient
das Insistieren auf der Existenz eines agnostischen unvermischten Glaubens dazu,
denjenigen, der aus der Binaritt ausbrechen will, wieder in eine Beziehung zur
Gewiheit zu bringen. Erst wenn es gelingt, das Moment der Gewiheit generell zu
antiquieren, ist der Bann des gnostischen Habitus gebrochen.
In diesem Zusammenhang erscheint der eigenartige Zug der Junghegelianer, sich
immer wieder auf strenge altchristliche Glaubenselemente zu beziehen, in einem
neuen Licht. Zeitgenossen wie der deutsch-katholische Pfarrer Hieronymi urteilen
ber diese Tendenz: Da einmal die Kirche in mnchischer Asketik das gegen-
wrtige Leben miachtet, und nur nach dem jenseitigen getrachtet hat, ist wahr,
aber da man der Gegenwart diesen Vorwurf machen knne, will mir nicht ein-
leuchten. So hatte Bayrhoffer die Taufe in dem Sinne altchristlich gedeutet, da
der Geistliche das Kind durch die Taufe in eine jenseitige Welt aufnehme und mit
Feuerbachschem Pathos auf der Mutterliebe insistiert, der es zuwider sei, da ihr
Kind der wirklichen Welt soll entrissen werden. Fr den erfahrenen Geistlichen
ist diese altchristliche Radikalisierung unverstndlich.
Wren diese Worte nicht so ernst gehalten, ich mte lachen, das nenne ich in Hyperbeln
reden! Solche Wunderkraft, das Kind in eine jenseitige Welt aufzunehmen, hat selbst die
orthodoxeste Kirchenlehre der Taufe niemals zugeschrieben, sie meinte nur, das Kind
werde durch die Taufe von Erbsnde und Teufel frei, wollte das Kind also gerade von der
jenseitigen Welt freimachen. Eine Mutter, die da gedacht habe, man wolle ihr Kind der wirk-
lichen Menschheit entreien, ist mir nie vorgekommen. Die Taufe ist bei allen vernnftigen
Leuten schon lange nichts weiter als ein Symbol der Aufnahme in den Christenbund.
51
352
Der Pseudohegelianer Fichte wirft den Junghegelianern vor: Aber auch das
Christentum mt ihr zur entstellten Karikatur herabsetzen, um mit eurer Polemik
gegen desselbe gerecht zu werden.
32
Fichte bezieht sich dabei auf Feuerbach, bei
dem in der Tat die Tendenz zur Identifizierung des Christentums mit altchristli-
chen Auffassungen extrem deutlich wird. Der Verfnglichkeit des gnostischen
Habitus in diesem Punkt ist schwer zu entgehen. Aschen nimmt z. B. Feuerbachs
Wiederaufwertung der dem Christentum ursprnglichen Prinzipien auf morali-
scher Ebene ernst und sieht bei Feuerbach eine Rckkehr und Suche nach dem
wahren ursprnglichen Christentum.
53
So eindeutig lt sich die Ambivalenz des
gnostischen Habitus aber nicht auflsen.
So wendet sich Feuerbach z. B. gegen den christlichen Arzt, der zwar auf das
Gebet fr die Heilung des Kranken nicht verzichtet, aber dieses religise Mittel mit
profanen Mitteln der rztlichen Kunst untersttzen will. Er
rumt also dem Gebete, berhaupt den geistlichen Mitteln, eine entsndigende Kraft ein;
aber warum nicht auch eine entkrankheitende? Er beginnt also nur die Heilung mit dem
Gebet, aber vollbringt sie nicht mit ihm? Erst luft der Herr Obermedizinalrat in die Kirche
und dann in die Apotheke? (...) Wenn nun aber das Gebet der unmittelbare Kontakt mit
dem Urquell aller Macht, alles Lebens ist, wenn wir uns durch dasselbe in ein richtigeres
Verhltnis zu Gott und Natur setzen, wenn es gegenwrtige bel heilt, ja, die Quelle alles
bels, die Trennung von Gott, aufhebt, (...): Warum macht er denn nicht das Gebet zum
Prinzip seiner Therapie?
Dem christlichen Arzt< hlt Feuerbach die Heilungen entgegen, die der
Hl. Bernhard und der Hl. Malachias aus ihrem Glauben heraus vollbracht haben.
Haben sie bei ihren Kuren zugleich die Hostie und die Klistierspritze, das Kruzifix
und den Blutegel appliziert?
54
Die polemische Ironie, mit der Wunderglaube und altchristliche Demut ins Spiel
gebracht werden, ist nicht zu berhren. Jedoch ist zu bezweifeln, ob damit das
Phnomen erklrt ist. Die polemische Ironie ist seltsam schwankend. In der Rheto-
rik Feuerbachs, wie auch in der anderer Junghegelianer spricht sich auch eine
Bewunderung des Berge versetzenden altchristlichen Glaubens aus. Diese Glau-
benskraft ist der prominente Bezugspunkt Feuerbachs:
Wenn daher der Verfasser vom Christentum redet, so redet er nicht von dem charakterlo-
sen, laxen, schlappigen Christentum der neueren Zeit, dessen Glaube ein durchaus erloge-
ner, sich selbst widersprechender, willkrlicher, unglubig-glubiger Glaube ist, nicht vom
Christentum in einem unbestimmten Sinne, in jenem Sinne, in welchem es nur noch ein
inhaltsloser Name ist und heutigentags von so vielen genommen wird, sondern vom Chri-
stentum in seinem eigenen, schlechtweg determinierten Sinne.
Der altchristliche Glaube verfllt gerade nicht der Kritik. Gegen den stillen,
unmittelbaren, lebendigen, einfachen, in Handlungen sich bettigenden Glauben,
wer sollte sich da kehren? Wer sollte ihn, sein Inhalt sei auch welcher er wolle, nicht
schonen, nicht anerkennen, nicht ehren?
53
Die Hervorkehrung des altchristlichen Glaubens ist nach zwei Seiten gewendet:
einmal wird die Kraft dieses Glaubens bewundert, ausgehend von bestimmten
Glaubensinhalten Wirklichkeitsdeutung und menschliches Verhalten in berra-
gender Weise zu bestimmen, zum andern mu auf dieser Folie das moderne aufge-
353
klrte Christentum als ein kaum wirkungsvolles Unternehmen erscheinen, demge-
genber vielleicht erst auf einer hheren Stufe die >neue Religion< jene Durch-
schlagskraft wieder erringen knnte, die der altchristliche Glaube besessen hat.
Entsprechend werden der Erlsung durch Wissen jene Attribute zugeschrieben,
die dem gttlichen Wirken angehren. Die Kritik verleiht dem menschlichen
Bewutseins alle Gewalt, alle Macht zu binden und zu lsen, alle Schlssel zum
Himmelreich der Freiheit, heit es bei E. Bauer.
56
Wenn es im gnostischen Habitus darum geht, den Dualismus von Glauben und
Wissen immer wieder als sich verstrkende Binaritt zu entfalten, um durch ver-
tiefte Spekulation den Spannungsrahmen aufrechtzuerhalten, so bietet sich gerade
der altchristliche Glaube dazu an, verweist er doch die Vertreter des hegemonialen
Christentums, die sich fr die Junghegelianer in der offiziellen Theologie der Zeit
zeigen, auf die Fragwrdigkeiten einer Vermittlung von Glauben und Wissen, die
ohne komplizierte Umwege auszukommen glaubt. Den Theologen der Zeit wirft
Feuerbach vor:
Die Strenge der alten Christen, d. h. ihre Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit, ist euch nur
bertreibung oder gar Miverstand der christlichen Wahrheit und Tugend. Natrlich, man
mu, wie theoretisch ein Mittel zwischen Glauben und Unglauben, so auch praktisch ein
schnes juste-milieu zwischen der christlichen Moral und dem Epikureismus der modernen
Welt innehalten. (. . . ) Whrend die alten Christen auf den Knien ber dornige und steinige
Pfade zum Himmel emporklimmten, wollt ihr, auf den Lorbeeren des Unglaubens ausru-
hend, auf Eisenbahnen und Dampfwagen ins himmlische Jerusalem hineingleiten.
57
Whrend fr Feuerbach das alte vorreformatorische Christentum der entschei-
dende Bezugspunkt ist, von dem aus die gnostische Spannung von Glauben und
Wissen angelegt wird, reproduziert B. Bauer die Position einer ins Extrem gestei-
gerten neupietistischen Orthodoxie, um den gnostischen Habitus zu sichern. Wah-
ren Glauben findet B. Bauer nicht in der zeitgenssischen, vom Rationalismus
gefrbten Theologie, sondern im strengsten Pietismus, dessen Strenge er noch zu
berbieten sucht.
Der wahrhaft Glubige ist gewi, da es nur Eines Wortes bedarf, da die Kraft des Gttli-
chen, der Wille und die Allmacht Gottes mit ihm ist. So wie der wahrhaft Glubige will, so
steht es da, wie er verneint, so ist es ein vernichtendes Nein, er ist ein Zauberer: Ein Blick
seines Auges hat es dem Gegner angetan! Der rationalistische Glubige dagegen hat keinen
Glauben mehr: Ihm scheint es Vermessenheit, wenn ein Mensch glauben wollte, sein Wille
knne so weit mit dem Gttlichen eins sein, da er lsen und binden knne. Sein Gott hat
nicht mehr die Kraft, das Gottlose zu vernichten.
58
Zu den wahrhaft Glubigen gehren fr B. Bauer Gestalten wie der Bremer
Neupietist Krummacher. Ihn versucht B. Bauer in Hegels Lehre von der Religion
und Kunst vom Standpunkt des Glaubens aus betrachtet (1842) noch zu bertref-
fen. Man kann diese Schrift als eine Karikatur lesen und diese Seite noch verstr-
ken, wie Rge es in seiner Rezension tut: Krummacher msse als Autoritt aner-
kannt werden,
und man mu gestehen, da ihn im Bekenntnis des Christentums mit allen seinen Konse-
quenzen keiner der jetzt lebenden Menschen, selbst der Heilige Vater in Rom nicht ber-
trifft. Krummacher ist klassisch in seiner Art und verdiente allgemein gekannt zu sein. An
354
ihm wrde sich jeder sogleich orientieren; denn er handelt und feilscht mit nichts und mit
niemand, er ist radikal und das schnste, entscheidenste Extrem, das man nur wnschen
kann.
59
Dieser Wunsch ist auf den ersten Blick natrlich ironisch, wie das ganze Spiel der
neupietistischen Maskeraden, das die Junghegelianer treiben. Aber der Wunsch
nach dem schnsten, entscheidensten Extrem hat nicht die skulare Leichtigkeit,
mit der etwa das Junge Deutschland, namentlich Heinrich Heine, die Religion per-
sifliert haben. Wie bei Feuerbachs Apotheose der alten Christen, so ist auch bei
B. Bauers Hervorkehrung des radikalen Neupietismus eine andere Tendenz spr-
bar. Es geht um die beharrliche Konstruktion einer reinen und unvermischten
Glubigkeit, die so pur in keiner Realitt aufzufinden ist, die aber fr den gnosti-
schen Habitus eine bewutseinsmige Voraussetzung ist. Die reine und unver-
mischte Glubigkeit ist als theoretisches Konstrukt unverzichtbar. Sie mu immer
wieder ins Spiel gebracht werden, weil sie als Extrem hilft, die andere Seite, nmlich
die reine und unvermischte Vernunft, darzustellen. Die Gewiheit der >neuen Reli-
gion nhrt sich untergrndig von der strukturnotwendigen Beschwrung einer
alten reinen und unvermischten Glubigkeit.
So gerstet tritt die unsichtbare Kirche der Junghegelianer auf das Schlachtfeld
der religisen Bewegungen des Vormrz.
4. Religise Erneuerungsbewegungen
Bei den religisen Erneuerungsbewegungen des Vormrz handelt es sich um ein
komplexes Geflecht religiser Gemeinschaftsbildungen, dessen Erforschung
gerade erst begonnen hat.
60
Die berwiegende Zahl der Arbeiten zum Junghegelia-
nismus geht nur beilufig darauf ein, obwohl es an sich sehr nahe lge, die religions-
kritische Debatte der Junghegelianer auf dem Hintergrund dieses Phnomens zu
untersuchen.
Was den Blick auf die religisen Bewegungen im Vormrz verstellt, ist eine selt-
same Verschrnkung der mglichen Perspektiven. Aus der Perspektive der Revolu-
tion von 1848 erscheinen die religisen Bewegungen als parapolitischer Vorlauf des
Kampfes um Restauration oder Demokratie. Den Zeitgenossen wird ein skulares
Bewutsein unterstellt zu einem Zeitpunkt, an dem ein Skularisationsschub ein-
setzt. Aber war es ein Skulatisationsschub, oder war es eine Transformation des
religisen Bewutseins? Ging es unter der Hlle der Religion um etwas ganz ande-
res, oder war die Religion der Kern, der sich politisch-skular verhllte?
Nach 1848 scheint diese Alternative geklrt zu sein.
In dem Anfang der 40er Jahre schien es fast, als solle sich die erregte Teilnahme der Laien
an den theologischen Hndeln, die im siebzehnten Jahrhundert Deutschland in seiner Ent-
wicklung so sehr aufgehalten hat (!), noch einmal erneuern. Wir sind sehr damit zufrieden,
da diese Gefahr von unserer Bildung abgewandt ist, da die politische Aufregung die reli-
gise verdrngt hat.
61
355
Dies nachmrzliche Urteil J. Schmidts ist fr den Religionssoziologen herausfor-
dernd, weil er darauf aufmerksam gemacht wird, da es selbst fr einen dezidiert
konservativen Intellektuellen eine grere Gefahr als die einer Revolution gegeben
hat, eine Gefahr, im Vergleich zu der die politische Aufregung nachgerade als
Beruhigung erscheinen mu. Die Erleichterung darber, da die politische Thema-
tik die religise verdrngt hat - ist sie in der Forschung habitualisiert worden, die
die religisen Bewegungen des Vormrz nur noch in politischen Horizonten zu
deuten vermag?
Die Gruppe der Junghegelianer steht noch inmitten der Alternative, ob die Reli-
gion die Politik substituiert oder die Politik die Religion. Sie sind sich nicht sicher,
ob sie es mit dem Ende oder der Vollendung der Religion zu tun haben. Weder gno-
stischer noch chiliastischer Habitus machen dieses Problem entscheidungsfhig,
weil von ihnen auch gesagt werden knnte: entweder sie verenden in diesem Sku-
larisierungsschub, oder sie vollenden sich in einer Transformation des religisen
Bewutseins. Da diese Frage nicht im direkten Zugriff zu lsen ist, ist ein Umweg
ntig.
Halten wir uns zunchst an Beobachtungen von Zeitgenossen. Durchgngig ist
der Topos der Orientierungslosigkeit. Bereits 1838, anllich des Klner Kirchen-
streits, bemerkt Th. Mundt: Wir haben gesehen, wie in dem gegenwrtigen
Moment auf keiner Seite (der protestantischen und der katholischen, d. V.) eine
reine und ungetrbte Weltanschauung besteht, sondern die ehemals schneidensten
Gegenstze waren vielmehr bis jetzt im Begriff, fast tumultuarisch ineinander ber-
zulaufen.
62
1841 klagt H. Merz:
So ist denn jetzt die Verwirrung, die Ungewiheit und Unklarheit grer als je. Der Glaube
und das Wissen, die Freiheit und die Knechtschaft, die Duldung und die Verfolgung, die
Bildung und die Barbarei durchkreuzen sich in allen Richtungen und Punkten - man knnte
irre werden an der Zukunft, wenn man nicht zu der Urkraft des deutschen und reformatori-
schen Geistes den zuversichtlichsten Glauben halten drfte.
63
Ein dnischer Prediger schreibt:
Die eisige Gleichgltigkeit gegen Religion, welche, durch Spott und Zweifel erzeugt, so
viele Gemter gefangen genommen hatte, schmilzt immer mehr vor den Eindrcken eines
lebendigen Glaubensbekenntnisses hinweg. Und so sehr die religise Erneuerung begrt
wird, der geschulte Prediger sieht sich schon gentigt, den religisen berschwang zu
dmpfen: Doch voreilig wrde die Hoffnung auf eine alsbald sich vollendende Darstellung
des Gottesreiches auf Erden sein. Die Geschichte lehrt vielmehr: Da gerade in solchen Zei-
ten der Erneuerung, gegenber dem Durchdringen evangelischer Wahrheit auch die Macht
des Wahns sich mehrt. Er erinnert an die >Auswchse< der Reformation und der Zeit Spe-
ners und der Pietisten.
64
Der Junghegelianer F. Sa, der ber die Glaubenskonflikte seiner Zeitgenossen
>hinaus< ist, will sich in seinem Berlin-Buch gar nicht erst auf eine detaillierte Dar-
stellung der religisen Bewegungen einlassen;
mit welchem unerquicklichen Material htten wir uns hier zu beschftigen, wenn wir alle
die einzelnen religisen Parteien Berlins, die muckerhaften, die orthodoxen, die halbathei-
stischen und die pietistischen, die ultramontanen und die deutsch-katholischen, die talmu-
356
dischen und die reformjdischen, die Hengstenbergianer bis zu den Atheisten, welche unter
die Lichtfreunde gegangen sind, genau darstellen wollten! In dem Lande der ausgebreitet-
sten Sektenfreiheit, in Nordamerika, kann der religise Parteikampf zwar wohl uerlich
freier, aber nicht intensiver gefhrt werden, als bei uns.
65
Wie fr Sa ist auch fr Prutz' mundanen Blick die religise Bewegung der 40er
Jahre ein gespenstisches Unternehmen:
Wir disputieren ber die Dreieinigkeit, errtern die Glaubhaftigkeit des Evangelisten
Lukas und schreiben dicke Bcher darber, ob der Weg in den Himmel links geht oder
rechts, ob man zu Pferde oder zu Esel sicherer dahin gelangt, und ob die Hlle eine Treppe
tief liegt oder zwei. Da haben wir in Summa die Nationalinteressen des deutschen Volkes
Anno vierzig bis sechsundvierzig: der rote Faden, der sich durch das Gewirre dieser Jahre
hinzieht, er ist aus geistlicher Wolle gezupft, die Dogmatik ist unser contract social, Geistli-
che sind unsere Volkshelden, theologische Streitfragen die Fragen der Gegenwart, die Fra-
gen der Nation! - ( . . . ) So auch, wohin einer jetzt in Deutschland fliehen mchte, von
Knigsberg bis Konstanz, von Breslau bis Cleve, berall, aus allen Gesellschaften, allen
Wirtshusern, allen Dampfwagen tnt ihm die kirchliche Melodie unserer Tage entgegen;
( . . . ) du kannst keine Zeitung in die Hand nehmen: Das erste, worauf dein Auge fllt, ist eine
theologische Kontroverse, kein Beefsteak essen: dein Nachbar unterhlt dich von Uhlich
und fragt, ob dir Ronge oder Czerski besser gefllt - keine Zigarre anznden: man reicht dir
einen Fidibus aus der >evangelischen Kirchenzeitung<. Deutschland gleiche nur noch
einem groen kirchlichen Konzile.
6
*
Und Jacoby stellt fest: Wahrhaftig! Religion ist die epidemische Krankheit
unserer Zeit; niemand ist vor Ansteckung sicher.
67
Die Reihe der Aussagen von Zeitgenossen liee sich beliebig vermehren. Ob nun
emphatisch teilnehmend oder distanziert beobachtend: der Vergleich der 40er
Jahre mit der Reformationszeit drngt sich allen Zeitgenossen auf.
68
Diese religise
Bewegung mndet in die Revolution von 1848. Nach ihrer Niederlage ist die
Reformation des 19. Jahrhunderts weitgehend vergessen. Es ist wenig ntzlich,
diese Bewegungen aus einer nachmrzlichen Perspektive zu betrachten, weil damit
die Frage nach der Skularisierung bzw. der Transformation der Religion vorab
entschieden wrde. Vielmehr gilt es, die religise Bewegung der 40er Jahre als
einen Proze zu begreifen, in dem paradoxerweise religise Erneuerung und Sku-
larisierung miteinander verschrnkt sind.
Fr diese Verschrnkung hat der zitierte dnische Prediger einige treffende For-
mulierungen gefunden. Er sieht zwei Richtungen, die geeignet sind, die ruhige
Entwicklung des Christentums zu stren.
Die Anhnger der einen dieser Richtungen gehen vorzugsweise darauf aus, das Christen-
tum und seinen Inhalt ihrem menschlichen Bewutsein mglichst nahe zu bringen, indem
sie dasselbe mehr oder weniger seiner gttlichen Erhabenheit entkleiden, es gewaltsam vl-
lig in die Sphre des natrlichen Denkens nach der menschlichen Ordnung hinabzuziehen
suchen. Die von der anderen Richtung dagegen betrachten es vielmehr als ein himmlisches,
heiliges, von allen irdischen Wesen fernzuhaltendes Gotteserbe, das an sich allem rein
menschlichen Wissen und Wirken fremd sei; (. . . ). Die einen verkndigen eine Weltreli-
gion, welche der Erkenntnis des Menschengeistes berhaupt verwandt sein, mit dieser im
vlligen Einklang stehen msse, und sie seien bemht, eine dereinstige Auflsung der
Religion in Philosophie und der Kirche in Staat als das notwendige Ziel des geistigen Fort-
schrittes darzustellen. Dagegen dringen die anderen auf eine innerliche im Gemte wur-
357
zelnde Frmmigkeit, welche, unbekmmert um Formen und Bewegungen des Weltlebens,
in ihrer ursprnglichen eigentmlichen Selbstndigkeit und Unmittelbarkeit zu verharren
habe.
69
Es wre voreilig, wollte man diese erste Richtung als Motor der Skularisierung
und die zweite als religisen Widerstand dagegen vereindeutigen. Denn beide
Richtungen wirken skularisierend: die eine, indem sie die religise Thematik mehr
als zuvor in profane Zusammenhnge einbringt, sie im doppelten Sinne darin >auf-
gehen< lt; die andere, indem sie die religise Thematik mehr als zuvor den Gestal-
tungen des profanen Lebens entzieht und sich nur noch eines arkanen >Restes< ver-
sichert. Aber beide Bewegungen befrdern auch eine Intensivierung des religisen
Erlebens: die eine, indem sie das Handeln in profanen Zusammenhngen zum ent-
scheidenden Gottesdienst macht; die andere, indem sie das religise Erleben einem
unangreifbaren individuellen Bereich zuweist, in dem die Berufung auf letzte
Werte sich einnistet.
Diese Verschrnkung von Skularisierung und Intensivierung religisen Erle-
bens ist ein Erbe der Aufkrung und ihres Doppelgngers, des aus der spirituali-
stischen Tradition hervorgehenden Pietismus.
70
Beide bedrngen im 17. und
18. Jahrhundert die protestantische Orthodoxie, die sich unter den Bedingungen
einer im hohen Mae staatsabhngigen Kirche schwer tut, Kultus und Dogmatik
dem sozialen Wandel anzupassen.
Entscheidend fr die Entwicklung des Protestantismus in Deutschland ist
bekanntlich, da das absolutistische Landeskirchenregiment die Entfaltung eines
staatsunabhngigen kirchlichen Gemeindelebens, in dem die religisen Gegen-
stze sich htten ausdrcken und so sozial verarbeitet werden knnen, stark behin-
derte. F. Fischer weist im Anschlu an Jellinek, Weber und Troeltsch daraufhin,
da zu dem westeuropischen Verfassungsstaat eine Linie von der kalvinistischen
Reformation und vom Tufertum hin fhrt, eine Linie, die entsprechend den
Resultaten der Reformation (trotz nicht zu unterschtzender Einflsse des Calvinis-
mus auf Verhaltensmuster preuischer Oberschichten) in Deutschland vergleichs-
weise schwach ausgebildet war. Der Effekt dieser Ausgangslage auf die geringe
Verwurzelung demokratischer Tradition und auf die Dominanz obrigkeitsstaatli-
cher Haltungen in Deutschland ist oft errtert worden.
71
Fr die deutschen Intellektuellen des 17. und 18. Jahrhunderts bestand die trotz
aller differenten Haltungen und Wandlungen strukturell relativ konstante Situa-
tion, da sie sich in einem segmentierten religisen Terrain bewegen muten, wenn
sie ber die offizielle Orthodoxie hinausgehende Intentionen verfolgten. Entweder
versuchten sie, als Rationalisten in die Kirchen das Licht der Aufklrung hineinzu-
tragen, indem sie etwa den altprotestantischen Teufels- und Hexenglauben
bekmpften und die religisen Mysterien Vernunftgrnden zugnglich machten,
oder sie zehrten von den religisen Unterstrmungen spiritualer und mystischer
Frmmigkeit, die unter dem weiten Mantel des Pietismus
72
fortlebten, oder sie
bewegten sich alternierend in beiden Segmenten. Der Unzufriedenheit mit dem
herrschenden Kirchenleben sind sie selten entgangen.
Diese strukturelle Lage trifft auch fr die Vertreter des deutschen Idealismus
zu.
73
Hufig hatten sie von der Mutter in der Familie eine intensive religise Erzie-
358
hung erhalten, Bibellesen und husliche Andachtstunden waren die Regel, in der
Schule wurde der Katechismus gewissenhaft gelernt, aber die kirchlich bestimmte
Religiositt endete oft mit der Konfirmation. Als Steffens 1799 nach Berlin kam,
erzhlte er: Die Kirchen waren leer und verdienten es zu sein, die Theater waren
gedrngt voll und mit Recht. Schleiermacher, der es wissen mute, urteilt: Der
protestantische Gottesdienst hat zu wenig Flle und Konsequenz, als da er die
Gemeinde zusammenhalten knnte.
74
Die Liturgie entsprach nicht dem knstleri-
schen Bedrfnis vor allem der >Gebildeten<, und die Predigt mit ihren erstarrten
Konventionalismen taugte schon gar nicht.
Die Segmentierung, in der sich die Intelligenz bewegte, wurde verstrkt durch
eine schichtenspezifische Komponente. Kirchliche Religiositt galt als ausreichend
und notwendig fr das einfache Volk, fr die Intelligenz war sie entbehrlich. Aber
diese >Entkirchlichung< der Intelligenz hat nichts mit einer Abkehr vom Christen-
tum schlechthin zu tun, wie dies in den 20er Jahren Ltgert und andere darstellten,
die im deutschen Idealismus eine Bedrohung fr das Christentum sahen, die der
einstigen gnostischen Bedrohung vergleichbar gewesen wre.
75
Entscheidend ist,
da Kirche und Religion im Bewutsein der Intelligenz auseinandertreten und da
diese Spaltung zugleich als Spaltung zwischen >Gebildeten< und >Volk< affirmiert
wird.
Vielleicht ist es gerade diese Spaltung, auf deren Hintergrund die zahlreichen
Suchbewegungen der Intelligenz erklrt werden knnten, doch noch in Teilen des
Volkes eine Religiositt zu finden, die mit der Religion der Intelligenz kompatibel
ist. So gilt fr eine ganze Reihe von Vertretern des Idealismus die Herrenhuter Br-
dergemeine als ein beeindruckendes Muster christlichen Lebens. So z. B. fr
Goethe, der in Dichtung und Wahrheit schreibt:
Seit meiner Annherung an die Brdergemeine, hatte meine Neigung zu dieser Gesell-
schaft, die sich unter der Siegesfahne Christi versammelte, immer zugenommen. Jede posi-
tive Religion hat ihren grten Reiz, wenn sie im Werden begriffen ist; deswegen ist es so
angenehm, sich in die Zeiten der Apostel zu denken, wo sich alles noch frisch und unmittel-
bar geistig darstellt, und die Brdergemeine hatte hierin etwas Magisches, da sie jenen
ersten Zustand fortzusetzen, ja zu verewigen schien. Sie knpfte ihren Ursprung an die fr-
hesten Zeiten an, sie war niemals fertig geworden, sie hatte sich nur in unbemerkten Ranken
durch die rohe Welt hindurchgewunden.
76
Die deutsche Intelligenz um 1800 ist fasziniert von Sekten wie den Herrenhu-
tern, die Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie des radikalen Pietisten
Gottfried Arnold gehrt zur Standardlektre, im Idealismus soll wie im Urchristen-
tum oder der Reformation eine neue Religion auferstehen. Aber dieses gesteigerte
religise Interesse sieht kaum eine Chance, sich in einem breiteren kirchlichen
Gemeindeleben zu artikulieren.
Die Ausgangslage fr die religisen Bewegungen in der ersten Hlfte des
19. Jahrhunderts wre unzureichend skizziert, wenn die eigentmliche Erwek-
kungsbewegung, die sich vielleicht ausgehend vom Kampf der katholischen Kirche
in Frankreich gegen Atheismus und antikirchlichen Geist der Revolution ber ganz
Europa ausbreitet, ausgespart bliebe.
77
Unter einem politischen Blickwinkel mag es
gerechtfertigt sein zu versuchen, Idealismus und Erweckungsbewegung auseinan-
derzudividieren, religionssoziologisch betrachtet handelt es sich um Vermischun-
359
gen, in denen religis gesteigertes humanistisches Pathos vom Neubau der Welt
und alte Glaubensinhalte wie Bue und Gnade, Sndenfall und Erlsung ineinan-
derflieen. Paradigmatisch fr diesen >erweckten Idealismus< ist das Pathos der
Befreiungskriege, fr das bezeichnend ist, da Worte wie Erlsung, Wiederge-
burt, Auferstehung, Offenbarung umgedeutet werden aus dem genuin religisen in
einen politischen und nationalen Sinn.
78
Fischers Formulierung verweist auf das
Problem, das bis zu den religisen Bewegungen der 40er Jahre bestimmend sein
wird. Handelt es sich um eine Sakralisierung der Politik oder um eine Politisierung
religiser Glaubensinhalte?
Das Problem wre leichter zu lsen, wenn die politische und die religise Ebene
sich in greifbareren Institutionalisierungen dargestellt htten, in einem leistungsf-
higem Gemeindeleben und in politischen Vereinen. Auch konnte es so erscheinen,
da in den Befreiungskriegen fr einen Moment die Spaltung zwischen dem Bil-
dungsbrgertum und den >Volksmassen< aufgehoben wre, aber Schleiermachers
vaterlndische Predigten und Fichtes patriotische Reden konnten ein kontinu-
ierlich von unten gewachsenes Gemeindeleben nicht ersetzen. Die Bindung der
Erweckungsbewegung an den Krieg stempelt sie ohnehin schon zu einer Ausnah-
mesituation. Die politisch-religisen Hoffnungen, die an die Befreiungskriege
geheftet waren, wurden enttuscht. Grob gesprochen kristallisierten sich drei Hal-
tungen heraus, mit denen auf das Scheitern reagiert wurde. Nach der Ermordung
Kotzebues blieb fr diejenigen, die an den jakobinisch-patriotischen Wiederge-
burtsidealen festhielten, nur die Illegalitt der Konspiration. Eine zweite Mglich-
keit war, sich dem Idealismus in der Hegeischen Fassung zuzuwenden, der gen-
gend Zweideutigkeiten besa, um mit ihm in der Restaurationszeit berleben zu
knnen.
79
Die dritte Mglichkeit schlielich war, sich auf die religise Erweckung
zu konzentrieren und auf alle politischen Reformversuche zu verzichten.
Den dritten Weg gingen die sog. Neupietisten, Mnner wie z.B. Tholuk, Harms,
Perthes, Below, Kottwitz und Hengstenberg. ber sie distanziert zu schreiben, fllt
nicht leicht. W. Nigg urteilt: Man kann sich diese Reaktionstheologie nicht
unsympathisch genug vorstellen.
80
Dabei ist ihr Ausgangspunkt nicht so ohne wei-
teres von der Hand zu weisen. Die Befreiungskriege waren ja auch eine religise
Bewegung und das hie, auch ohne die ersehnten politischen Resultate ging die
Erweckung weiter. Hunderte von Jnglingen werden an allen Orten durch den
Geist Gottes geweckt. In allen Orten treten die Bekehrten in genauere Verbindun-
gen. Selbst die Wissenschaft wird Dienerin und Freundin des Gekreuzigten,
schreibt Kottwitz.
81
Und F. Fischer weist daraufhin: Selbst ein glhender Enthu-
siast wie Arndt unterwirft sich in lutherischer Demut der Zerstrung seiner hch-
sten Hoffnungen: >Das mssen wir aber Gott anheimstellen, er hat es so gewollt;
denn er hat die Herrscher und Frsten sein lassen wie sie sind< (1815).
82
Nicht von der Hand zu weisen ist der Ausgangspunkt der Neupietisten, weil sie
deutlich das Defizit eines freien kirchlichen Gemeinschaftslebens spren, ein Defi-
zit, das zu den strukturellen Problemen der Intelligenz seit der Reformation in
Deutschland gehrte. Steffens erklrt, nachdem er sich der Erweckungsbewegung
angeschlossen hatte: Ich habe die Auferstehung des Herrn innerlich erlebt, ich
habe ihn erschttert sterben und begraben sehen. Aber das reicht nicht, er fgt
360
hinzu: Ich sehnte mich nach einer Gemeinde.
83
Gegen diese Sehnsucht nach
einer Kirche mit einem funktionsfhigen Gemeindeleben stand der lutherische Kir-
chenbegriff, den vor allen Neander verteidigte. In diesem Sinne schrieb ein Freund
an Perthes: Die Protestanten haben keine Kirche und knnen keine haben, und
das ist kein Unglck, denn lieber keine Kirche, als den freien Geist des Christen-
tums aufgeben.
84
Jahre spter werden Ruge und B. Bauer dies Argument aufgreifen und gegen die
Neupietisten wenden, die Einflu auf die staatliche Kirchenpolitik gewinnen wol-
len. Der Erweckungsbewegung und dem Neupietismus ist die Ausbildung eines
staatsunabhngigen Gemeindelebens entgegen ihren ursprnglichen Anstzen
letztendlich nicht nur nicht gelungen, vielmehr gerieten sie unter dem Einflu
Hengstenbergs und seiner 1827 gegrndeten aggressiven >Evangelischen Kirchen-
zeitung< (EKZ) mehr und mehr zu einem Kirchenbegriff, der sich nur administrativ
realisieren lie. Hengstenberg tilgte die mystischen Elemente der Erweckungsbe-
wegung und gelangte zu einem vollendet orthodoxen Kirchenbegriff. Die Kirche
wurde fr ihn eine auf Einheit der Lehre begrndete uere Gemeinschaft, diese
Kirche war nur mglich als Polizeikirche.
85
Trotz aller begrndeten Kritik an dem unerquicklichen Fanatismus der neupieti-
stischen Orthodoxie und ohne Abstriche zu machen an der Erkenntnis, wie sehr
diese Bewegung mit dazu beigetragen hat, demokratisches Bewutsein in Deutsch-
land zu blockieren, mu hier auch an die berlegung R. Wittrams erinnert werden,
der darauf aufmerksam gemacht hat, da es die Erweckungsbewegung gewesen ist,
die das berleben des Protestantismus in Deutschland als einer Glaubensgemein-
schaft erst ermglicht habe. Es sei ihr erbitterter Widerstand gewesen, der den Pro-
testantismus vor dem Aufgehen in eine skularisierte Nationalreligion bewahrt
habe.
86
Sicherlich ist dies nur ein innerreligiser Aspekt. Aber der Ha auf die Revolu-
tion und die Demokratie, der die Neupietisten beseelte, hatte auch seine religisen
Motive, die nicht auf politische Klasseninteressen reduzierbar sind. Die Revolution
bedroht nicht nur Privilegien, sie ist in einem religisen Sinne auch der Versuch,
einen Zustand der Vollendung herzustellen, indem der Mensch sich der Geschichte
bemchtigt, einer Geschichte, die dem religisen Bewutsein immer Heilsge-
schichte ist. Auch die neupietistische Orthodoxie orientiert sich an der Verheiung
eines Reiches der Gerechtigkeit und Liebe, aber im Unterschied zum chiliastischen
Habitus ist fr sie dies Reich nicht >machbar<, weder von Auserwhlten noch durch
humanistische Anstrengung. Revolution ist hier Snde, weil sie virtuell gegen das
Verbot der Selbstvergottung verstt. Auf den Nenner >Selbstvergottung< lt sich
nicht nur der neupietistische Vorwurf des Pantheismus gegenber Hegel reduzie-
ren, auch Leos Anklagen gegen die Junghegelianer finden ihre Spitze in dem Ver-
weis: sunt et erunt sicut Deus.
87
Das verstrkte Auftreten der Neupietisten zu Beginn der 40er Jahre und ihre
Forderung nach einem christlichen Staat< zwingt die Gruppe der Junghegelianer,
ihren Platz in der religisen Bewegung prziser zu bestimmen.
361
5. Der christliche Staat
Auf dem Hintergrund der exkursartig skizzierten Entwicklung ist vielleicht schon
abschtzbar, was das Thema der religisen Bewegungen der 40er Jahre ist: es geht
um die Alternative eines staatsabhngigen oder staatsunabhngigen Gemeindele-
bens. In der Reformation des 19. Jahrhunderts kulminieren die Ambivalenzen
des Protestantismus, insbesondere die Ambivalenz der Idee der unsichtbaren Kir-
che< und der >Landeskirche<, die seit 1808 als uere Kultus- und Sakralgemein-
schaft, als >Union< von Lutheranern und Reformierten installiert war.
1840 verteidigt B. Bauer die >Union<: Die Kirche als solche, die Kirche, die not-
wendig bis zur Sichtbarkeit fortgehen mu, ist in der Union untergegangen. Das
heit, mit der Aufgabe konfessioneller Kirchlichkeit ist Religion Angelegenheit des
Staates, der sich mit der unsichtbaren Kirche< gut vertrgt. Damit wird jede Aus-
einandersetzung um eine kirchliche Selbstverwaltung fr B. Bauer zur Tu-
schung, denn Synoden unterhielten in der Gemeinde eine bestndige Unruhe,
sie nhrten die Einbildung, da die Kirche vollkommen unabhngig vom Staat
ihre Angelegenheiten leiten und durch Gesetze ordnen msse, und sie entfrem-
den (...) die besten Krfte des Geistes den vernnftigen und sittlichen Mchten
der Wirklichkeit.
88
Es mu daran erinnert werden, da die Presbyterial-Verfassung ein Erbe der
Reformierten ist, die weit mehr als Luther einen Sinn fr die Institutionen des
Gemeindelebens besaen. Diese reformierte Tradition, die ihren Hauptsttzpunkt
in den niederrheinischen Gebieten hatte, wo eine Presbyterial- und Synodalverfas-
sung nach dem Muster der Niederlande lebendig war, hat fr B. Bauer nur schdli-
che Folgen. Aus seiner Perspektive fhrt diese Tradition nicht zum modernen
Staat, sondern gerade umgekehrt entzieht sie diesem die besten Krfte des Gei-
stes.
Um den Startpunkt zu markieren, von dem aus die Junghegelianer den religisen
Bewegungen der 40er Jahre begegnen, ist es wichtig, B. Bauers Angriffe auf die sich
verstrkende Forderung nach einem selbstverwalteten kirchlichen Leben ken-
nenzulernen.
Kirchliches Leben ist fr ihn die ungeheuer drftige, bestimmungslose und durch ihre
Leerheit fast zur Verzweiflung bringende Abstraktion. Solch eine Forderung ist nichts als
die schwindschtige Scheu dessen, der mit der nicht nur lebensvollen, sondern bestimmt
und groartig gestalteten Wirklichkeit nicht mehr harmonieren kann, ist der Ha gegen die
Vernunft, die im Staat nicht nur lebt und vegetiert, sondern denkt, will, handelt und ent-
scheidet, (. . .), ja es ist der letzte Angriff der Hierarchie eines leergewordenen Jenseits gegen
die Gttlichkeit und vollendete Organisation des Diesseits, das ja die Krfte des Jenseits in
sich aufgenommen und verzehrt hat.
89
B. Bauer insistiert darauf, da die Gemeinde der Glubigen die unsichtbare
Kirche ist, die nichts mit Presbyterien und Synoden zu tun hat, die dieser Formen
nicht bedarf, und wenn sie erscheint, in der Sitte des Staates erscheint. Mit beien-
dem Hohn ergiet sich B. Bauers Polemik, wenn die kirchliche Selbstverwaltung
damit begrndet wird, da in der Gemeinde Arbeiten, wie etwa Kirchenreinigung
und Friedhofspflege, anfallen, deren Erledigung eigener Verwaltung bedrfe.
362
Nun wissen doch Presbyterien und Synoden, was sie zu tun, und worber sie Gesetze zu
geben haben. Fegt die Kirchen, reinigt die Kirchensthle, gebt Gesetze ber die Verzierung
der Grber >durch Bume, Blumen< und vergesset die >Strucher< nicht. Wie rcht sich die
Vernunft! Was der Staat seinen untersten Polizeidienern berlt, ist jetzt der wichtige
Gegenstand der kirchlichen >Gesetzgebung<.
90
Ruge feiert in seiner Rezension die B. Bauerschen Thesen zur evangelischen Lan-
deskirche. Wie B. Bauer geielt Ruge die Beschrnktheit des leeren Synodal- und
Presbyterial Getreibes, die Union sei die eigentliche Vollendung der Reforma-
tion durch die definitive Konstituierung der unsichtbaren Kirche.
91
Es handelt sich hier um einen folgenreichen Startpunkt, von dem aus die Gruppe
ihre Auseinandersetzungen mit den religisen Bewegungen beginnt. Die Junghege-
lianer bringen nmlich keine Voraussetzungen mit, an die demokratischen Poten-
tiale, die in der Idee einer formell selbstverwalteten Gemeinde liegen, anzuschlie-
en. Da jedoch die Frage eines staatsunabhngigen kirchlichen Lebens in allen
Fraktionen der religisen Bewegung der Zeit implizit oder explizit an erster Stelle
steht, bleibt die Haltung der Gruppe, trotz aller Entschiedenheit, die ihr Pathos
zeigt, in der Hauptsache unsicher.
In den 40er Jahren ist die Gruppe zunchst mit dem Vordringen des neupieti-
schen Zirkel- und Vereinswesens konfrontiert. Dronke berichtet, die
Propaganda der Pietisten ziehe unter der Hefe der Massen einher und nistet versteckt in
dem Scho des innersten Familienlebens. Durch die Hefe des Volks zieht sie zumeist in dem
Schafspelz von Trakttchen und kleinen Broschren ber ffentliche Fragen, welche die
Zeit bewegen. Und: In den Husern der Armen zeigt sich ein gnstiger Boden fr die
Berhrungen der Pietisten. Sie verkehren hier still und geruschlos, da niemand sonst in
diese Regionen dringt; sie sen hier unbemerkt den Samen der Lebensverzweifelung der
Religion aus, sie stellen Betbungen, Erbauungsgesprche und fromme Betrachtungen an,
und wo sich der Erfolg im Glauben scheinbar gnstig gestaltet, geben sie Untersttzung, um
das Elend des Erdenlebens nicht zur Auflsung kommen zu lassen.
92
Wo liegt fr die Junghegelianer die Bedrohung, die von dieser religisen Bewe-
gung ausgeht? Unter dem Mantel der >unsichtbaren Kirche< wre fr diese Erschei-
nung doch Platz genug gewesen, zumal die Junghegelianer auch wissen, da mit
einem volkstmlichen Pietismus nicht notwendig das Interesse verbunden ist, eine
neue Kirche zu stiften. Der Tbinger Hegelianer E. Zeller, dem der schwbische
Pietismus vertraut ist, macht jedoch deutlich, da die pietistischen Gemeinschaf-
ten, aufgrund ihrer Ttigkeit, entgegen ihrer Intention auf die Bahn geraten, sich
formell als Kirche zu konstituieren.
Zunchst ginge es - so Zeller - den Pietisten nur um gemeinschaftliche Erbau-
ung, darum, jene lebendige Frmmigkeit zu erfahren, die sie in der Kirche vermi-
ten: deswegen sind Erbauungsstunden, collegia pietatis, Konventikel immer das
erste, wodurch sich das Vorhandensein einer pietistischen Richtung bettigt. Aber
im Ansatzpunkt der Frmmigkeit liege schon ein weiterer Zweck: das fromme
Leben, die Sittenzucht. Da schon die Erbauung an der besonderen religisen
Eigentmlichkeit des Pietisten orientiert gewesen sei, so msse es um so mehr die
Sittenzucht sein.
363
Hiermit ist nun aber der Pietismus mit der Welt nicht nur im innern Gegensatz, sondern
auch in uere Spannung gekommen, und wenn schon in seinem ursprnglichen Streben
nach Frmmigkeit zugleich die Aufforderung gesetzt war, diese, als das allein Wesentliche
im menschlichen Leben, in aller Welt auszubreiten, so fhlt er sich auch uerlich hierzu
gedrngt. So ist die dritte Hauptttigkeit der pietistischen Gemeinschaft die fr die Ausbrei-
tung des Reichs Gottes.
Zeller kommt zu dem Schlu:
Durch diese Ttigkeit hat der Pietismus, welcher davon ausging, von allem Weltlichen zu
abstrahieren, die Weltlichkeit nun selbst in sich aufgenommen und in seinen Dienst gezo-
gen; er hat seine eigentmliche Organisation in religisen Gemeinschaften, Vereinen und
Instituten, eine eigentmliche Beaufsichtigung seiner Mitglieder, eine eigentmliche Erbau-
ung. Hiermit ist er in der Tat nicht mehr die ecclesiola in ecclesia, sondern er ist selbst eine
uere Kirche, welche der bestehenden feindlich gegenbertritt, er wird separatistisch.
93
Der Gedankengang Zellers lt sich fortsetzen: wenn die Frmmigkeit, sobald
sie ttig wird, ihre Weltflchtigkeit aufgibt und wirksam wird, so ist sie zu einer Art
berstieg gezwungen. In hnlicher Weise hat M. Weber den Zusammenhang von
innerweltlicher Askese und dem Geist des Kapitalismus gesehen. Fr den pietisti-
schen Ansatz der Frmmigkeit gestaltet sich dieser berstieg jedoch so, da er zu
einer rigoristischen Affirmation des Lehrbegriffs fhrt, der eben >frommer< erfah-
ren werden soll. Der Weg des Neupietismus zu einer Orthodoxie der Lehre und des
Kultus, wie er in Hengstenbergs Kirchenbegriff greifbar wird, kann so ein Stck
weit erklrt werden.
94
Aus der Perspektive der Junghegelianer sind die Pietisten geradezu strukturell
unfhig, die Idee der unsichtbaren Kirche< zu fassen. Was die Junghegelianer
jedoch vorrangig beunruhigt, ist die Tatsache, da es diesen Zirkeln unter dem
neuen Knig Friedrich Wilhelm IV. gelingt, Einflu auf die staatliche Kirchenpoli-
tik zu gewinnen.
Friedrich Wilhelm IV. war schon als Kronprinz fr die schlesischen Altluthera-
ner eingetreten, die gegen die Union opponiert hatten und die landeskirchliche
Staatsgewalt zu spren bekamen, als das Militr ihre Kirche aufbrach und ihr Pfar-
rer vom Altar weg verhaftet wurde. Das landeskirchliche Kirchenregiment ent-
sprach nicht seiner von der Erweckungsbewegung bestimmten Idee einer Kirche,
der nur wirklich Glubige angehren sollten. Ihm schwebte eine Art Rckkehr zur
Verfassung der Urkirche vor, das Kirchenregiment sollte in den Hnden einer gro-
en Zahl von Bischfen liegen, an deren Spitze der Erzbischof von Magdeburg als
Primas Germaniae stehen sollte. Anglikanische oder schwedische Bischfe sollten
die Bischofsweihe vornehmen und so die authentische apostolische Suksession
garantieren. Das presbyteriale Element sollte verschwinden zugunsten bischflich
bestellter Kirchendiener. Seine Rolle als Landesherr wollte Friedrich Wilhelm IV.
beschrnkt wissen als advocatus ecclesiae, der die Beschlsse der Bischofssynode
besttigt. Nach Hintze war es ein Phantasiegebilde, das keine Aussicht auf Ver-
wirklichung hatte.
95
Dennoch kommt in diesen Trumen auch der Wunsch nach
einer Emanzipation der Kirche aus dem staatlichen Zwangsverband zum Aus-
druck, ein Wunsch, den kurze Zeit spter Lichtfreunde und Deutschkatholiken
gegen den Willen des Knigs -uf andere Weise zu realisieren versuchen werden.
364
Weniger Staat und mehr Unabhngigkeit fr die Kirche - aufgrund der landes-
kirchlichen Verfassung konnten staatliche Aktivitten kaum zu diesem Ziele fh-
ren. Die Doppelstellung, in der die Neupietisten sich befanden, wird deutlich in
den Initiativen zur Neugestaltung der >Sonntagsfeier<. Einmal wird Kirchenbesu-
chem am Neujahrstag 1842 eine Schrift von Geistlichen berreicht, in der die Ent-
weihung der kirchlichen Feiertage beklagt wird, auch ein Verein zur Frderung
einer wrdigeren Sonntagsfeier konstituiert sich, zum andern taucht das Gercht
auf, die Regierung bereite ein neues Religionsedikt vor, mit dem eine strengere Kir-
chendisziplin von oben verordnet werden sollte.
96
Fr die Junghegelianer, die davon ausgehen, da mit der Union die >sichtbare
Kirche< im Staat schon aufgegangen ist, stellt sich der Streit um die >Sonntagsfeier<
doppelt dar. Den >Basisinitiativen< aus den neupietistischen Zirkeln gegenber
affirmieren sie als Frmmler maskiert die Diagnose eines >Verfalls der Kirche<.
Gleichzeitig verschrfen sie parodistisch die Forderungen nach einer >Wiederher-
stellung< uerer kirchlicher Formen, um den Nachweis zu fhren, da dies nur
unter Zuhilfenahme der Staatsgewalt Erfolg haben knnte.
97
Mglichkeiten eines staatsunabhngigen kirchlichen Lebens kommen den Jung-
hegelianern ebensowenig in den Blick wie ihren neupietistischen Kontrahenten.
Auf beiden Seiten ist die Vorstellung einer Insertion der religisen Gehalte in die
staatliche Sphre beherrschend. Fr die Junghegelianer als >Aufgehen< der Religion
im Staat, und fr die Neupietisten als Idee eines christlichen Staates.
98
Liberale
Positionen einer entschiedenen Trennung von Staat und Kirche finden sich zwar
auch in den junghegelianischen Debatten, wie z. B. bei He und Jachmann", aber
sie werden nicht bestimmend, weil der verbreitete gnostische Habitus, in dem Wis-
sen und Glauben gegeneinander ausgespielt werden, kaum dazu geeignet ist, halt-
bare Trennungen herzustellen.
Wo von einer Trennung von Staat und Kirche ausgegangen wird, kann der je
besondere Inhalt der Religion gleichgltig sein. In der Debatte ber den neupieti-
stischen christlichen Staat< knnen die Junghegelianer aber nicht auf eine Qualifi-
zierung der religisen Gehalte verzichten, weil von ihrem Konzept eines >Aufge-
hens< der Religion im Staat her gesehen - gerade fr eine Gruppe - bestimmbar
gemacht werden mu, um welche religise Qualitten es sich handelt.
Bahnbrechend fr die junghegelianische Debatte ist B. Bauers Schrift: Der
christliche Staat und unsere Zeit von 1841, deren Analyse Marx noch 1844 mit den
Worten wrdigt: Bauer verstndigt ber das Wesen des christlichen Staates, alles
dies mit Khnheit, Schrfe, Geist, Grndlichkeit in einer ebenso przisen als kerni-
gen und energievollen Schreibweise.
100
Von Bedeutung ist B. Bauers Kritik des
christlichen Staates< - darauf sei hier schon hingewiesen - fr die sptere Transfor-
mation der Kritik des christlichen Staates< in eine Kritik der kapitalistischen
Gesellschaft, die Marx vornehmen wird.
Der ausufernden Diskussion um den christlichen Staat< zum Beginn der 40er
Jahre begegnet B. Bauer mit den Worten: Geschichtliche Kategorien werden
gewhnlich erst Stichworte einzelner Parteien, wenn die Sache, die sie bezeichnen,
lngst untergegangen ist. Den christlichen Staat<, den die neupietistische Ortho-
doxie fordere, habe es nur zweimal gegeben: in Byzanz und im Rom des Mittelal-
365
ters. Hier sei der Staat nach religisen Prizipien gestaltet worden. In der Reforma-
tion dagegen habe der Staat die Landeshoheit in den kirchlichen Angelegenheiten
gewonnen. Der Kampf zwischen Staat und Kirche sei jedoch damit nicht beendet
gewesen: Byzanz und Rom wurden von neuem im protestantischen Staate aufge-
baut, und dieser kmpfte nun als theologischer und hierarchischer Staat mit sich
selbst als wahrhaftem, freiem Staate.
101
Der Widerspruch zwischen Staat und Kirche sei so in den Bereich des Staates sel-
ber gefallen. Und B. Bauer zufolge kann es nur eine Wohltat genannt werden, da
die Reformation in diese Widersprche fiel, den christlichen Staat, indem sie ihm
die oberste Kirchengewalt gab, zerspaltete und ihn als den christlichen und geistlo-
sen in inneren Zwiespalt setzte. Die Alternative eines identischen Ganzen htte
die Wiederholung aller Greuel von Byzanz bedeutet. Aber die Gefahr einer Wie-
derkehr des christlichen Staates< sei nicht gebannt. In den Bestrebungen der
Reformierten nach selbstndiger Vertretung der Kirche gegenber dem Staate, in
Stahls Theorie des protestantischen Kirchenrechts und in den unionsfeindlichen
separatistischen Bestrebungen der Altlutheraner sieht Bauer die neue Restaura-
tion des christlichen Staates.
102
Marx schliet sich dieser Seite der Kritik des christlichen Staates< an, er geielt
die Konfusion des politischen und christlich-religisen Prinzips, die offizielle
Konfession geworden sei.
103
Er greift B. Bauers These auf: Der byzantinische
Staat war der eigentliche religise Staat, denn die Dogmen waren hier Staatsfragen,
aber der byzantinische Staat war der schlechteste Staat. Der Akzent liegt bei Marx
1842 auf der Forderung einer Trennung von Kirche und Staat. Sobald ein Staat
mehrere gleichberechtigte Konfessionen einschliet, kann er nicht mehr religiser
Staat sein, ohne eine Verletzung der besonderen Religionskonfessionen zu sein.
104
Die liberale Lsung gibt jedoch keine Antwort auf die Frage, welche Bedeutung die
Existenz von Glaubensgemeinschaften haben knnte.
Fr B. Bauer stt die neue Restauration des christlichen Staates< auf andere
Bedingungen, als sie vor der Reformation existiert haben. Im politischen Absolutis-
mus seien die hierarchischen Elemente der Kirche vom Staat aufgesogen und die
Aufklrung habe sich der Kernstcke des Glaubens bemchtigt, denn sie mute
endlich dahinterkommen, da sie sich nicht mehr als vergleichendes Bewutsein
auf den Glauben zu beziehen brauche. Sie war der Glaube an ihr selbst. Absolutis-
mus und Aufklrung sind zwei historische Prozesse, die unumkehrbar sind und die
Restauration des christlichen Staates< prinzipiell verhindern.
Das Territorialsystem, die absolute Monarchie und die Aufklrung sind es, die die Kirche
gestrzt und ihren Inhalt in sich aufgenommen haben. Sie haben das Positive der Kirche in
sich verdaut; wer also die Kirche wiederhaben wollte, wrde nicht einmal, was er sucht, fin-
den, wenn er die Wissenschaft totschlge und aus ihrem Leibe das verschlungene Allerhei-
ligste, das Positive herausschneiden wollte.
105
Aber der je existierende Staat, wie die jeweils erreichte Stufe der Aufklrung sind
fr B. Bauer nicht Fixpunkte, auf denen sich geschichtliche Entwicklung stillstellen
liee. Solange der existierende Staat noch nicht zum >freien Staat< umgebildet sei,
trete die Opposition in einer zweifachen Form des Bewutseins auf: als wissen-
schaftliche Theorie und als das Postulat der Kirche.
366
Hervorzuheben ist, da B. Bauer trotz aller Gegnerschaft zur neupietistischen
Orthodoxie einrumt: Tritt nun das Postulat der Kirche und ihrer Selbstndigkeit
gegen die Regierung auf, so ist es als berechtigt anzuerkennen, solange es seine
Opposition nur gegen die bestimmte Form des Bestehenden richtet und dagegen
den berschu an Inhalt (!), den es noch fr sich besitzt und im Staat noch nicht
wiederfindet, geltend macht. Dieses Recht der Kirche werde aber weit berzogen,
wenn das Politische des Staats vollends dem je berschssigen speziellen religisen
Gehalt untergeordnet wrde. Die Kirche versieht sich also in ihrer Opposition,
wenn sie in einem Punkte das Ganze bekmpft. Analog existiere auch noch eine
Berechtigung der Kirche gegenber der Wissenschaft, wo diese noch nicht die
Unendlichkeit religiser Inhalte >verdaut< habe. Aber diesen Rckstand knne die
Kritik aufholen, wenn sie sich als dialektische Theorie vollendet hat.
106
B. Bauers Thesen gehen weit ber die Idee einer Trennung von Staat und Kirche
hinaus. Nicht eine kirchliche Bevormundung des staatlichen Handelns ist das Pro-
blem des christlichen Staates<, sondern die Defizienz des Staates zeigt sich darin,
da noch Kirchen existieren. Wo kirchliche Opposition vorkommt, wo religise
Bewegungen sich zeigen, ist der Staat gerade im Hinblick auf die Inhalte >geistlos<,
die im religisen Bereich thematisiert werden. Gegen diese Oppositionen vorzuge-
hen hat der Staat ein Recht, wenn sie die Idee des >freien Staates< schlechthin ber
Bord werfen, aber gegenber dem existierenden Staat haben die religisen Opposi-
tionen so lange ein Widerstandsrecht, wie ihr berschu noch keine skulare
Gestaltung gefunden hat.
An dieser Konstruktion ist zweierlei hervorzuheben, was die Haltung gegenber
der religisen Bewegung der 40er Jahre betrifft. Einmal wird die Erweckungs- und
Bekenntnistheologie nicht einfach beiseite geschoben, sondern ihre Inhalte werden
zum Prfstein fr den existierenden Staat gemacht. Zum anderen bleibt der Ziel-
punkt eines >skularisierten< Staates unangefochten, der keiner Kirche mehr
bedarf, weil die dialektische Theorie dann die Funktion erfllt, die dem Christen-
tum in entfremdeter Form eignete: den unendlichen Inhalt des menschlichen
Selbstbewutseins zur Geltung zu bringen.
Eine entscheidende Wendung erhlt die Debatte um den christlichen Staat< in
dem Augenblick, wo die Emanzipation der Juden Thema wird. Nach der Auseinan-
dersetzung mit den Neupietisten entznden sich die junghegelianischen Debatten
an der >Judenfrage<. Auch hier versuchen sie, ber die liberalen Forderungen nach
einer brgerlichen Gleichstellung der Juden hinauszugehen.
107
Fr B. Bauer ist diese Frage von besonderer Bedeutung, weil er sich nicht damit
beruhigen kann, Religion als eine Beliebigkeit aufzufassen, die nur vom Staat tole-
riert werden mte. Da die Existenz von Religion fr ihn ein Mangel des existieren-
den Staates ist, stellt sich ihm die implizite Frage, welchen Mangel denn die jdi-
sche Religion reprsentiere.
In Die Fhigkeit der heutigen Juden und Christen, frei zu werden geht
B. Bauer zunchst von der Idee des >freien Staates< aus und definiert die Emanzipa-
tionsfrage als eine allgemeine: Juden wie Christen wollen emanzipiert werden.
Von Emanzipation knne erst gesprochen werden, wenn allgemein anerkannt ist,
da das Wesen des Menschen nicht die Beschneidung, nicht die Taufe, sondern, die
367
Freiheit ist. Aber in diese allgemeine Fassung der Emanzipationsfrage fhrt
B. Bauer eine Differenz ein, die sich auf die inhaltliche Bestimmtheit beider Religio-
nen bezieht. Er fragt nach den Emanzipationschancen, bzw. den Hindernissen, die
sich aus den Glaubensgehalten selbst ergeben. Das Ergebnis lautet:
Der Christ und der Jude mssen mit ihrem ganzen Wesen brechen: aber dieser Bruch liegt
dem Christen nher, da er aus der Entwicklung seines bisherigen Wesens unmittelbar als
seine Aufgabe hervorgeht; der Jude dagegen hat nicht nur mit seinem jdischen Wesen, son-
dern auch mit der Entwicklung der Vollendung seiner Religion zu brechen, mit einer Ent-
wicklung, die ihm fremd geblieben ist und zu der er nichts beigetragen hat, so wie er auch
die Vollendung seiner Religion als Jude weder herbeigefhrt noch anerkannt hat. Der Christ
hat nur eine Stufe, nmlich seine Religion zu bersteigen, um die Religion berhaupt aufzu-
geben; der Jude hat es schwerer, wenn er zur Freiheit sich erheben will. Vor dem Menschen
ist aber nichts unmglich.
108
Man stelle sich diese Konstruktion in einer Intellektuellengruppe vor, der auch
jdische Intellektuelle angehren. Ihnen wird damit praktisch eine konstitutionelle
Behinderung in Sachen Emanzipation zugeschrieben. Die komplizierten ambiva-
lenten Haltungen, die z. B. He und Marx gegenber der >Judenfrage< eingenom-
men haben, sind von Na'aman fr He und von Hirsch fr Marx prgnant heraus-
gearbeitet worden. Whrend fr He B. Bauers Thesen inakzeptabel gewesen
sind
109
, ist Marx' Postition uerst brchig.
110
Dabei ist die B. Bauersche Konstruk-
tion im Rahmen hegelianischer Spekulation durchaus naheliegend. Denn eine spe-
kulative Stufengeschichte religisen Bewutseins vorausgesetzt, liegt das Christen-
tum nher an den antizipierten zuknftigen Bewutseinsformen als die jdische
Religion. Dies ist in der Gruppe eine spekulative Selbstverstndlichkeit.
Dennoch treibt B. Bauer seine Thesen auf die Spitze, wenn er behauptet, selbst
die Vertreter der neupietistischen Orthodoxie, die gegen die Kritik auftreten, seien
engagierter als die Vertreter der jdischen Religion, denn:
diese christlichen Eiferer glaubten, gegen die Kritik kmpfen zu mssen, weil sie fhlen,
da es sich in diesem Kampfe um die Sache der Menschheit handelt; der Jude aber glaubt
sich in seinem Egoismus geborgen, denkt nur an seinen Feind, das Christentum, und hat
doch noch nie etwas Entscheidendes gegen ihn vollbracht.
111
Warum aber bringen Juden im Kampf mit den christlichen Staat< nicht die
erforderliche >Energie< auf? Die Antwort ist in der strukturell anderen Problemlage
ihrer Religion zu suchen. B. Bauer schliet hier implizit an die Hegelsche Deutung
der jdischen Religion an, derzufolge im jdischen Monotheismus das Geistige
sich vollkommen gereinigt gegenber der Natur zeige. Natur wird jetzt herab-
gedrckt zum Geschpf; und der Geist ist nun das Erste. Spezifisch fr die jdi-
sche Religion ist Hegel zufolge: das reine Produkt des Denkens, das Sichdenken
kommt zum Bewutsein, und das Geistige entwickelt sich in seiner extremen
Bestimmtheit gegen die Natur und gegen die Einheit mit derselben.
112
Whrend sich die Christen fr B. Bauer im Kampf um die Emanzipation auf ihre
eigene Religion sttzen knnen, weil es (das Christentum, d. V.) den allgemeinen
Begriff des menschlichen Wesens, also seinen eigenen Feind, wenn auch allerdings
in religiser Form, enthlt, fehle den glubigen Juden dieser Bezugspunkt.
368
Das Christentum sagt: der Mensch ist Alles, ist Gott, ist das Allumfassende und Allmch-
tige, und drckt diese Wahrheit nur noch religis aus, wenn es sagt: Nur Einer, Christus ist
der Mensch, der Alles ist. Das Judentum befriedigt dagegen nur den Menschen, der es
immer mit einer Auenwelt, mit der Natur, zu tun hat, und befriedigt eben in religiser
Form sein Bedrfnis, wenn es sagt, die Auenwelt sei dem Bewutsein untenan, d. h. Gott
hat die Welt geschaffen. Das Christentum befriedigt den Menschen, der sich in allem, im all-
gemeinen Wesen aller Dinge - religis ausgedrckt - auch in Gott, wieder sehen will; das
Judentum will den Menschen, der sich nur von der Natur unabhngig sehen will.
113
B. Bauers Analyse ist hegelianisch gesehen durchaus korrekt - 1843, zu einem
Zeitpunkt, da, wie wir oben gezeigt haben, der Streit um den Anschlu der Junghe-
gelianer an das liberale Lager auf seinem Hhepunkt ist, fr die Gruppe jedoch
politisch uerst unpassend. Aber genau in der Frage des Bndnisses mit den Libe-
ralen wirkt die Diskussion um die >Judenfrage< als ein nachhaltiges Ferment.
Marx nimmt in den Deutsch-franzsischen Jahrbchern eine eigenartige
Umdeutung der Bauerschen Thesen vor, eine Umdeutung, die einerseits den libera-
len Ideen der Trennung von Staat und Kirche entgegenkommt, die aber anderer-
seits auf die Frage nach der Bedeutung von bestimmten religisen Gehalten neuar-
tige Antworten findet.
Fr Marx besteht Bauers Fehler darin, da er nur den christlichen Staat<, nicht
den >Staat schlechthin< der Kritik unterwirft, da er das Verhltnis der politischen
Emanzipation zur menschlichen Emanzipation nicht untersucht.
114
Genau betrach-
tet trifft dies nicht zu, denn B. Bauer kennt die Differenz zwischen dem existieren-
den und dem >freien< Staat, d. h. im Hegelschen Sinne berhaupt erst >wirklichen<
Staat. Marx annulliert diese Differenz und nimmt B. Bauers Ideal des >freien< Staa-
tes als ein reduziert politisches Phnomen, das die Frage der menschlichen Emanzi-
pation unbercksichtigt lasse. Fr B. Bauer war jene Differenz entscheidend, weil
erst im >freien< Staat die Spaltung von Religion und Staat auf einer menschlichen
Basis aufgehoben sein sollte. In Marx' Augen berfrachtet er damit die politische
Ebene. Er stellt Bedingungen, die nicht im Wesen der politischen Emanzipation
selbst begrndet sind.
115
Aber B. Bauer geht es ja auch nicht um die politische
Emanzipation, seine Bedingungen sind andere; trotzdem reduziert Marx ihn auf
dieses Thema.
In einer ersten Bewegung erhebt Marx liberale Einwnde: Man msse sich den
entwickelten politischen Staat schlechthin vorstellen, hier, wie z. B. in Teilen der
nordamerikanischen Freistaaten,
verliert die Judenfrage ihre theologische Bedeutung und wird zu einer wirklich weltlichen
Frage. Nur wo der Staat in seiner vollstndigen Ausbildung existiert, kann das Verhltnis
des Juden, berhaupt des religisen Menschen, zum politischen Staat, also das Verhltnis
der Religion zum Staat, in seiner Eigentmlichkeit, in seiner Reinheit heraustreten.
116
Diese Argumentationsstrategie fhrt zur Annullierung der theologischen Frage.
Der Unterschied der Religionen spielt keine Rolle mehr.
Da dieser politische Staat in seiner vollstndigen Ausbildung nichts mit
B. Bauers >freiem< Staat zu tun hat, liegt auf der Hand. Auch Marx mu konstatie-
369
pDennoch ist Nordamerika vorzugsweise das Land der Religiositt. Aber Marx zieht -
wenigstens terminologisch - den umgekehrten Schlu: Finden wir selbst im Lande der
vollendeten politischen Emanzipation nicht nur die Existenz, sondern die lebensfrische, die
lebenskrftige Existenz der Religion, so ist der Beweis gefhrt, da das Dasein der Religion
der Vollendung des Staats nicht widerspricht.
117
B. Bauer wre widerlegt, wenn diese vollendete politische Emanzipation sein
Ideal wre. Aber wie Marx selbst Bauer referiert, denkt dieser ganz anders, nm-
lich: Der Staat, welcher die Religion voraussetzt, ist noch kein wahrer, kein wirkli-
cher Staat.
118
Die erste Argumentationsstrategie von Marx, die die Spezifitt der Religionen
aufhob, wird jedoch von einer zweiten Argumentationskette abgelst, in der das,
was zuvor eskamotiert wurde, in verwandelter Form wieder herein kommt.
Zunchst heit es: Da aber das Dasein der Religion das Dasein eines Mangels ist,
so kann die Quelle dieses Mangels nur noch im Wesen des Staats selbst gesucht wer-
den. Die Religion gilt uns nicht mehr als der Grund, sondern nur noch als das Ph-
nomen der weltlichen Beschrnktheit.
119
Genau besehen handelt es sich um eine
einfache Umkehrung der B. Bauerschen Thesen zum >christlichen Staat<. Ein
Gemeinwesen mit Religion ist ein defizientes Gemeinwesen. Die Religion behlt
ihren Indizcharakter. Ist damit die >Judenfrage< enttheologisiert, wie Marx behaup-
tet? Sie wre es sicherlich, wenn der Text hier abbrche, aber es bleibt ein zu kl-
render Rest, der sich auf die Spezifitt der religisen Gehalte bezieht. Indiziert jede
Religion den gleichen Mangel? Marx steht vor dem Problem, seine Enttheologisie-
rungsstrategie durchzufhren und gleichzeitig die Besonderheit religiser Gehalte
zu erklren.
Die folgenreiche wie fatale Lsung, zu der Marx greift, ist bekannt:
Den Widerspruch des Staats mit einer bestimmten Religion, etwa dem Judentum, ver-
menschlichen wir in den Widerspruch des Staats mit bestimmten weltlichen Elementen,
schreibt Marx, d. h.: Die Frage nach der Emanzipationsfhigkeit des Juden verwandelt
sich uns in die Frage, welches besondere gesellschaftliche Element zu berwinden sei, um das
Judentum aufzuheben?
120
Fr einen geschulten Hegelianer - daran mu erinnert werden - kann es kein
besonderes weltliches Element geben, das mit der jdischen Religion zusammen
aufgehoben werden kann. Der religise Gehalt einer rigorosen monotheistischen
Transzendenz, womit sollte er korrespondieren? Dennoch mu nach den Gesetzen
der Gruppendiskussion der Junghegelianer Marx den Junghegelianer B. Bauer
berbieten, und er tut dies, indem er zu einem antisemitischen Topos greift: >Der
Jude treibt Schacher, sein weltlicher Gott in das Gekk H. Hirsch bemerkt tref-
fend: Marx, glauben wir, schlgt, ja zerfetzt den jdischen Sack, meint jedoch den
brgerlichen Esel.
121
Diese Marxsche Quidproquo-Technik
122
mag die Diskussionssituation fr den
Moment gerettet haben. Es mag sich hier auch um eine Schaltstelle handeln, an der
sich die Kritik der Religion und die Kritik der brgerlichen Gesellschaft platzwech-
selnd austauschen; aber ein sichernder Sinn fr eine kohrente Position der
Gruppe in der >Judenfrage< ist nicht gelungen.
370
Aus der junghegelianischen Kritik des christlichen Staates<, der von der neupie-
tistischen Orthodoxie propagiert wird, geht ber die >Judenfrage< von B. Bauer
und Marx die Kritik der kapitalistischen Gesellschaft hervor. Was beide Themen
verbindet, ist mehr als der situative Zusammenhang. Ausgangspunkt der Debatte
um den christlichen Staat< war die Frage nach einem staatsunabhngigen kirchli-
chen Leben. Alle junghegelianischen Kritiken des christlichen Staates< variieren
das Thema der Staatsunabhngigkeit von Kirche, Gemeinde und Religion, sie grei-
fen im Kern das Thema der neupietistischen Orthodoxie auf. Sei es mit der libera-
len Wendung, bei der durch strikte Trennung von Staat und Kirche das Religise
einfach freigelassen werden soll, oder sei es mit der weitergehenden Frage nach
dem skularen Sinn der Existenz von Glaubensgemeinschaften. Bei B. Bauer ist die
Religion ein anerkannter Indikator fr die Mangelhaftigkeit des Staates, bei Marx
ist die Religion ein anerkannter Indikator fr die unvollendete menschliche Eman-
zipation. Beiden geht es nicht einfach um Beliebigkeit von Religion und um Reli-
gionsfreiheit, sondern um die besonderen Inhalte, auf die spezielle Religionen hin-
weisen. In der >Judenfrage< sind alle Probleme fr einen Moment der junghegelia-
nischen Debatten gebndelt. Die jdische Religion ist fr die Junghegelianer ein-
mal der klassische Fall einer besonderen Religion, die zu Liberalitt herausfordert.
Sie ist zugleich in der hegelianischen Interpretation die Stufe der Religionsentwick-
lung, auf der Geist und Natur unvermittelt auseinandertreten, d. h. mit dem Inhalt
dieser Religion wird das Verhltnis von gttlichem Gesetz und irdischen Bedrfnis-
sen thematisch. Dieser religise Inhalt verhlt sich zur neupietistischen Orthodoxie
geradezu spiegelverkehrt, geht es dieser doch um das Verhltnis von religisen
Bedrfnissen und weltlichem Staat.
Knnen diese Spiegelverkehrtheiten aufgelst werden? Solange die Gruppe sich
nicht sicher ist, ob es sich um theologische oder um weltliche Fragen handelt, hat
ihre >unsichtbare Kirche< in den religisen Bewegungen der Zeit noch keinen Platz
gefunden. 1843 hat sie auch noch nicht ihre letzte Probe bestanden: nach Neupie-
tismus und >Judenfrage< werden sie mit einer anderen religisen Bewegung kon-
frontiert.
6. Junghegelianer und freireligise Massenbewegung
a) Lichtfreunde und Deutschkatholiken
Mitte der 40er Jahre sieht sich die Gruppe der Junghegelianer, in deren unsichtba-
rer Kirche< die Frage nach dem Verhltnis und den Verkehrungen religiser und
profaner Perspektive hin- und herdebattiert wird, mit dem Aufbruch der Parallel-
bewegungen der protestantischen Lichtfreunde und der Deutschkatholiken kon-
frontiert.
123
Die Lichtfreunde verdanken ihre Entstehung dem Skandal um den Magdeburger
Pfarrer Sintenis, der ffentlich die Anbetung Christi als Aberglaube anprangerte
und deswegen vom Konsistorium einen Verweis wegen Glaubensabweichung
erhielt. Der Pfarrer Uhlich organisierte daraufhin im Juni 1841 ein Treffen von 16
Theologen in Gnadau, die mit Sintenis sympathisierten. Aus diesem Treffen ent-
371
stand die Bewegung der Lichtfreunde, deren Wachstum sich an den Teilnehmer-
zahlen der halbjhrlichen Treffen ablesen lt. Im Setember !"#! waren es bereits
$% The&l&gen, im 'r(hjahr !"#) *amen )++ ,ers&nen, die -lfte da.&n Laien,
zusammen, zur ,fingst.ersammlung in /0then !"## *amen %++, im -erbst waren
es "++. 1itte der #+er 2ahre waren die Lichtfreunde nach .&rmrzlichen 1ast-
ben eine religi0se 1assenbewegung, die an zahlreichen 3rten 'u gefat hatte.
4ie Lichtfreunde waren the&l&gische 5ati&nalisten. Sie standen in der Traditi&n
der W&lffschen ,hil&s&hie des !". 2ahrhunderts, die zwar nicht die g0ttliche
3ffenbarung bestritt, aber die 5eligi&n dem 6rteil und der 7uslegung durch die
menschliche 8ernunft unterstellte. 4er the&l&gische 5ati&nalismus erreichte seine
Breitenwir*ung in den ersten 2ahrzehnten des !9. 2ahrhundert und ist .erbunden
mit den the&l&gischen 7uffassungen .&n ,aulus, Brettschneider, 5&ehr und Weg-
schneider. 4er the&l&gische 5ati&nalismus beherrschte den 5eligi&nsunterricht an
den Schulen, die weitgehend .&n der :rwec*ungsbewegung unber(hrt geblieben
waren. :s handelte sich um eine b(rgerliche 1assenbildung, die auf die Bed(rf-
nisse .&n Beamten, /aufleuten und -andwer*ern zugeschnitten war. 4er the&l&gi-
sche 5ati&nalismus war dazu geeignet, auf immer wieder auftretende religi0se
;bersteigerungen .&n Wunder- und Teufelsglauben migend zu wir*en, er b&t
f(r '&rtschrittsh&ffnungen gen(gend 5aum, &hne zu chiliastischen 7benteuern zu
.erf(hren, und schlielich war es auf seiner <rundlage auch m0glich, nicht nur die
5eligi&n, s&ndern auch den Staat und die ,&liti* der r(fenden 8ernunft zugng-
lich zu machen. In diesem Sinn hat -. 5&senberg .&m the&l&gischen 5ati&nalismus
als dem .&rmrzlichen =8ulgrliberalismus> gesr&chen.
!)#
<egen(ber dem *&ntinuierlichen Wachstum der Lichtfreunde erreichte der
Deutschkatholizismus sch&n innerhalb eines 2ahres eine die ?eitgen&ssen (berra-
schende ,&ularitt. Im S&mmer !"## wurde in einem im&santen 'esta*t auf dem
-&chaltar der 4&m*irche in Trier die 5eli@uie des s&g. heiligen ungenhten 5&*-
*es 2esu ausgestellt. 4er Bisch&f 7rn&ldi stellte denen, die in den sechs W&chen der
5&c*ausstellung zur 8erehrung des 5&c*es nach Trier wallfahrten w(rden, *raft
sa*ramentaler <ewalt den .&ll*&mmenen 7bla ihrer S(nden in 7ussicht, den
,ast Le& A. !$!# f(r die 5&c*wallfahrten .erliehen hatte. 4em 7ufruf des
Bisch&fs wurde in einer Weise '&lge geleistet, da die B8&ssische ?eitungC =an der
8ernunft des !9. 2ahrhunderts .erzweifelte>. 7llein in der Dacht .&m )). zum
)E. 7ugust !"## waren )+.+++ ,ilger in Trier.
!)E
7ls hist&rischer 8ergleich fielen BaFrh&ffer nur die mittelalterlichen /reuzz(ge
ein. =4a z&gen sie hin, die -underttausende, und suchten Ghristum, wie einst in
/reuzz(gen in seinem Grabe, s& jetzt in einem toten Gewnde, welches Betrug und
7berglaube untergesch&ben hatte.>
!)%
4ie B1annheimer 7bend-?eitungC .er-
sucht, den staunenden ?eitgen&ssen das ,hn&men .&n Trier zu er*lren, und
schreibtH
=?u einer ?eit, w& die /riti* auch die /irche angreift, mu diese sich auf ihren ursr(ngli-
chen Begriff zur(c*ziehen, sie darf die ?ugestndnisse nicht ber(c*sichtigen, die sie im
Laufe der ?eit dem ?eitgeiste gemacht, und s& ist es er*lrlich, da Strau, 'euerbach und
der wunderttige 5&c* zu Trier fast zu gleicher ?eit eIistieren.>
!)J
4ie 5ea*ti&n auf diese B,r&.&*ati&nC lie nicht lange auf sich warten. =<egen
372
diese tetzelsche Ablakrmerei tritt ein zweiter Luther auf, schreibt der deutsch-
katholische Pfarrer Eduin Bauer.
128
Der zweite Luther hie Johannes Ronge, ein
schlesischer Priester, der bereits zwei Jahre zuvor in Konflikt mit dem Breslauer
Domkapitel geraten war. Ronge forderte den Bischof Arnoldi ffentlich auf, die
Rockausstellung zu beenden. Der Protest Ronges fhrte zur Trennung vieler Glu-
biger voit der rmischen Kirche und zu Grndungen freier deutschkatholischer
Gemeinden. Ronge schlo sich mit dem Schneidemhler Kaplan Czerski zusam-
men, der seinen Abfall vom rmischen Katholizismus durch eine Hochzeit besie-
gelt hatte.
Ronge und die Schneidemhler Dissidenten sind berzeugt, die >Reformation
des 19. Jahrhunderts< eingelutet zu haben, eine Reformation, die sich nicht nur auf
theologische Fragen bezieht, sondern auch politische Dimensionen im Blick hat. So
predigt Ronge: Die Reformation des 19. Jahrhunderts, die Reformation, die vom
Volke ausgeht, mu nicht blo das geistige und sittliche Wohl, sie mu auch das
uere Wohl der Menschheit ins Auge fassen und die Kluft zwischen Arm und
Reich durch die Hand der Liebe ausgleichen.
129
Das Pathos der reformatorischen
Erweckung erreicht in den Jahren 1844/1845 seinen Hhepunkt. Gegenseitige
Ermutigungs- und Jubelbotschaften werden von Gemeinde zu Gemeinde gesandt.
So feiert K. E. Theodul die Schneidemhler Gemeinde:
Ja, mit weithin tnendem Jubel mute sie begrt werden als eine echt-christliche, segens-
verheiende Tat allberall da, wohin das noch zur Zeit unsichtbare Licht-Zentrum, der
durch Christi Geist von aller Beknechtung des Glaubens bereits frei gewordenen Gotteskin-
der seine beseligenden Strahlen ergossen hatte.
130
Ostern 1845 kommt es in Leipzig zum ersten deutschkatholischen Konzil, auf
dem sich die Dissidenten in dem Bewutsein treffen, eine reformatorische Tat
getan zu haben, die der des 16. Jahrhundert vergleichbar ist:
Freilich ist eine jede Reformation lngst vorbereitet und angelegt, und derjenige, welcher
das khne Wort ausspricht, darf wohl auf eine Anzahl Gleichgesinnter rechnen; aber wer
vermag es, vorher zu sagen, ob die Zeit reif ist, ob der Funke zndet, ob wirklich eine neue
Gemeinschaft zusammentreten, oder ob die treulose Zeit den einzelnen preisgeben wird?
Eine Reformation ist immer etwas schlechthin Unberechenbares, die reformatorische Tat
immer eine rcksichtslose Khnheit. - Aber dafr wird sie auch, wenn sie durchschlgt,
getragen und begleitet von den ganzen Sympathien des Volkes. So war es ja zur Zeit unserer
Reformation vor 300 Jahren. Welche Krfte strmten ihr zu von unten her aus dem Volke?
und wie erstarkten die Fhrer an dem jubelnden Zuruf der Massen!
131
Verglichen mit der junghegelianischen Avantgarde sind die deutsch-katholi-
schen Pfarrer nicht in eine >schiefe Stellung< geraten.
Der Deutschkatholizismus entwickelt sich rasch zu einer Massenbewegung.
1848, vier Jahre nach dem ersten Konzil, hat die Kirche etwa 80.000 Mitglieder in
259 Gemeinden. Es kommt zwar zu vielfltiger Kooperation zwischen Deutschka-
tholiken und Lichtfreunden, aber die organisatorische Selbstndigkeit der Parallel-
bewegungen bleibt gewahrt, bis sich 1859 Deutschkatholiken und freie protestanti-
sche Gemeinden zum >Bund frei religiser Gemeinden Deutschlands< zusam-
menschlieen.
132
373
Die Ziele des Deutschkatholizismus sind weitgehend mit denen der Licht-
freunde identisch. Beide fuen auf dem theologischen Rationalismus. Roehr, Brett-
schneider und Paulus verteidigen die Lichtfreunde ebenso, wie sie fr Forderungen
der Deutschkatholiken eintreten. Freie Wahl der Seelsorger und die Abkehr von
jeder Art >Glaubenszwang< sind fr beide Bewegungen charakteristisch. In den
inneren Auseinandersetzungen der freireligisen Bewegung kommen noch einmal
die Themen zur Sprache, die insgesamt die religise Erneuerung seit der Erwek-
kungsbewegung bestimmt haben. Es geht um zwei widersprchliche Ansprche,
die abgegolten werden sollen. Die Freireligisen wollen eine staatsunabhngige
Kirche, bzw. eine Kirche, die nicht mehr unter der Kontrolle der rmischen Hier-
archie steht. Wert gelegt wird auf organisatorische Selbstndigkeit und die Ausbil-
dung von Institutionen, die Selbstverwaltung ermglichen sollen. In dieser Hin-
sicht trgt die freireligise Bewegung durchaus jene Zge nachreformatorischer
Kirchen- und Sektenbildung, die in Westeuropa die Ausbildung des modernen
Verfassungsstaates mit mglich gemacht haben. Den Zeitgenossen ist dieser
Zusammenhang durchaus bewut, wie R. Blums Leiziger >Vorwrts< beweist: Die
Stifter der freien Gemeinde hofften durch dieselbe, wie einstens das englische Inde-
pendententum, das gesamte Staatsleben umzugestalten.
133
Auf der anderen Seite
ist das Erbe von Luthers unsichtbarer Kirche< nicht so einfach abzuschtteln, und
die antiinstitutionelle Tendenz, die die neue Religion als eine frei schwebende
Menschheitsreligion gem idealistischer Tradition verstehen will, lebt in den Rei-
hen der Dissidenten wieder auf.
Deutlich werden diese Spannungen im Bereich des Deutschkatholizismus schon
bei der Frage, ob die neue Kirche ein Glaubensbekenntnis brauche und wie ver-
bindlich dies sein sollte. Ronge selbst ist unsicher, ob es berhaupt sinnvoll ist, ein
Glaubensbekenntnis zu fixieren, er gibt schlielich dem Druck der Gemeinden
nach Selbstvergewisserung nach. Das Ergebnis ist ein Glaubensbekenntnis, in dem
verzweifelt versucht wird, das Undogmatische selbst dogmatisch zu formulie-
ren.
134
Auch bei den Lichtfreunden bricht diese Spannung auf, als auf der Kthener
Pfingstversammlung 1844 der Pastor Wislicenus die Frage aufwirft, ob die Heilige
Schrift oder der Heilige Geist als Norm des protestantischen Glaubens zu betrach-
ten sei, und sich fr das letztere entscheidet.
135
Eine staatsunabhngige Kirche,
ohne ein verbindliches Glaubensbekenntnis und ohne die verpflichtende Bindung
an die Heilige Schrift, wre aber kaum zu institutionalisieren. Die >institutio religio-
nis< (Calvin) steht auf dem Spiel, wenn soziologisch gesehen die Launen des Heili-
gen Geistes Vorrang vor schriftlich fixierten Offenbarungen erhalten sollen. In die-
sen Spannungen tritt wenige Jahre vor der Revolution von 1848 noch einmal das
Muster der politisch-religisen Konstellationen hervor, das fr die deutsche
Geschichte seit der Reformation bestimmend gewesen ist.
b) Die Immanenten
Damals war die Zeit gekommen, in welcher der wissenschaftlich-religise Geist,
die Schranken gelehrter Werke und akademischer Hrsle durchbrechend, sich
ber das Volk ergo, schreibt der Aktivist und Historiker der freireligisen Bewe-
374
gung Kampe und erinnert an die Bedeutung, die die junghegelianische Religions-
kritik fr das Entstehen der freireligisen Bewegung hatte.
136
Insgesamt trifft Gott-
schall den Sachverhalt, wenn er schreibt: Die zahlreiche Uhlich-Ronge-Rupp-
Literatur war nun der in weitesten Kreisen sich ausbreitende Wogenschlag, den
Kritik (gemeint ist Bruno Bauer, d. V.) und Anthropologie (gemeint ist Feuerbach
und Stirner, d. V.) hervorgerufen.
137
Eine ganze Reihe von freireligisen Predi-
gern bekannte sich insbesondere zu Feuerbachschen Grundstzen. Wie hoch die
junghegelianische Evangelienkritik auf dem Konzil zu Leipzig geschtzt wurde,
lt sich daran ablesen, da z. B. die Frage der Gottheit Christi nicht zur Entschei-
dung gebracht werden konnte, weil die wissenschaftliche Forschung in dieser
Frage noch nicht gesicherte Ergebnisse gezeitigt habe.
138
Aber auch umgekehrt schliet sich ein Teil der Gruppe der Junghegelianer der
freireligisen Bewegung an. Nauwerck, Bayrhoffer und Ruge sind hier ebenso zu
nennen wie der Hegelianer Hinrichs, der am Leipziger Konzil teilnimmt und die
Sache der Dissidenten engagiert verteidigt.
139
Ruge erklrt programmatisch: Die
Bildung und die Philosophie des Jahrhunderts ist durch diese Bewegung zur Her-
zenssache des Volkes, d. h. zur Religion geworden.
140
Nach dem bergang der
philosophischen Schule zur politischen Partei, nachdem der Philosoph Zeitungs-
korrespondent geworden war, nun noch ein bergang: die >unsichtbare Kirche<
der Junghegelianer geht in die freireligise Massenbewegung ein.
Dieser bergang ist nicht ohne Probleme, denn von ihrer Genese und von ihrer
Haupttendenz her gesehen, sind Lichtfreunde und Deutschkatholiken eben jenem
theologischen Rationalismus verbunden, den Hegel heftig bekmpft hatte. Fr den
theologischen Rationalismus ist Christus das Urbild einer autonomen Sittlichkeit,
und seine von den Evangelisten berlieferten Worte sind Anleitungen fr eine sitt-
liche Lebensfhrung. Spekulative Fragen nach der Immanenz Gottes in seiner
Schpfung, das Problem der Theodizee und das heilsgeschichtliche Werden des
Reiches Gottes nehmen dagegen weniger Raum ein. Gerade diese Fragen sind es
jedoch, die die Junghegelianer in die freireligise Bewegung einbringen. Mit
Kampe kann man daher von zwei differierenden Fraktionen der Freireligisen
sprechen: dem populr-rationalistischen Standpunkt und dem immanent-
christlich-religisen Standpunkt.
141
Die Junghegelianer, die sich der Bewegung
anschlieen, verstrken die Fraktion der >Immanenten<.
Als Beispiel fr das Eindringen der Junghegelianer in die freireligise Bewegung
sei das Engagement von Bayrhoffer in Marburg genannt. Die dortige deutschkatho-
lische Gemeinde wird zunchst von der staatlichen Verwaltung verboten, aber im
Herbst 1845 grndet Bayrhoffer, der entschieden fr die Deutschkatholiken ein-
tritt, einen protestantischen Leseverein, deren Mitglieder sich im Streit zwischen
Uhlich und Wislicenus ber die Frage, ob die Heilige Schrift oder der Heilige Geist
fr die Gemeinde mageblich sein sollte, auf die Seite von Wislicenus stellen.
142
Bayrhoffer identifiziert die religionskritischen Inhalte der junghegelianischen
Debatten mit dem >wahren Wesen< der religisen Bewegung. Zum einen sei die Kri-
tik von Strau ber B. Bauer zu Feuerbach zu der Erkenntnis gelangt, da der
Mensch der verborgene Inhalt der Religion sei, zum anderen sei
375
auch nicht zu verkennen, da die deutsch-katholischen und die freien protestantischen
Gemeinden, welche in der Bildung begriffen sind, von dem Prinzip jener reinen Menschlich-
keit im innersten getrieben werden. Aber noch ist dieses Prinzip in seiner Erscheinung ver-
hllt, und es ist Zeit, da das eigendiche Wesen der jetzigen religisen Ghrung unverhllt
vor die Welt hintrete. Die Bekenner dieses Wesens knnten es dann ruhig erwarten, ob die
Kirche sie als ihre eigene letzte Frucht anerkennen und begren, oder als feindliches Ele-
ment ausscheiden will.
143
Die Reaktion auf diese >immanente< Herausforderung kommt von dem deutsch-
katholischen Pfarrer Hieronymi, der Bayrhoffer und den Marburger Lichtfreun-
den vorwirft, was sie
eigentlich wollen ist: gar keine Kirche. Denn nach ihren Prinzipien gehrt der ganze gegen-
wrtige Kultus mit allen seinen Formen, vernnftigen oder unvernnftigen, einer berwun-
denen Stufe des Kinderglaubens an. Sie wollen die Kirche in einen Disputiersaal der Wissen-
schaft verwandeln, d. h. sie aufheben; denn wissenschaftliche Disputier- und Experimen-
tier-Institute haben wir schon anderweitig.
Versuche, diese Ideen zu realisieren, werden nichts ergeben als etwa eine philo-
sophische Qukergemeinde. Hieronymi erklrt, die Mehrheit der Lichtfreunde
wollen keine Philosophenschule grnden, sondern eine religise Gemeinschaft,
und das protestantische Volk ist aus bekannten Ursachen nur zu sehr von dem
Wunsche nach einer besseren kirchlichen Gestaltung erfllt. Das Programm der
unsichtbaren Kirche< sei fr diese Bedrfnisse ungeeignet.
Auch die freie Gemeinde wird gentigt sein, sich eine besondere Form zu geben, wo nicht,
so existiert sie nicht, sondern nur Menschen, welche den Gedanken einer freien Gemeinde
im Kopfe tragen; also die ecclesia invisibilis (unsichtbare Kirche der protestantischen Sym-
bole), an welche sich aber niemand kehrt, eben weil er sie nicht sieht und kennt, whrend
dem die sichtbare Kirche (als) eine Macht dasteht, fhlbar genug fr Freie und Unfreie.
Selbst der Freimaurerorden hat seine Symbole, und wrde ohne diese gar nicht existieren.
Die Marburger knnten ja ihren spekulativen Neigungen frnen, aber
so macht wenigstens kein unntiges scandalum in ecclesia, setzt euch in euren Saal, wo
Rede und Gegenrede gebruchlich ist, denn nur auf solche Weise kann die verborgene
Wahrheit ans Licht kommen. Aber vor allem richtet euer Augenmerk nicht auf die Dogmen,
sondern auf eine notwendige freie Kirchenverfassung, worin das Volk ein Organ gefunden,
nicht den toten Glauben der alten Bcher, sondern den lebendigen Glauben seines Herzens
auszusprechen.
144
Die Kontroverse zwischen Bayrhoffer und Hieronymi trifft das Kernproblem der
freireligisen Bewegung. Junghegelianer wie Bayrhoffer sind >immanent< in einem
doppelten Sinne: einmal beziehen sie sich auf die Feuerbachsche Immanenzphi-
losophie, die die religisen Gehalte vermenschlicht, und zum anderen drngen sie
innerhalb der freireligisen Bewegung auf eine radikale Entkirchlichung, die jede
Erinnerung an Transzendenz verblassen lt. Hieronymi macht dagegen die >insti-
tutio religionis< zum Prfstein. Aber ist fr die >Immanenten< das Institutionalisie-
rungsproblem zu umgehen? Ihre vermenschlichte Religion, in welchen Formen
und Symbolen knnte sie sich ausdrcken? Die Vorschlge fr den Kultus der
neuen Religion reichen vom gegenseitigen Vortrag selbstgedichteter Stcke ber
sozialpdagogische Initiativen bis zu erbaulichen philosophischen und
politischen Debatten.
145
376
Das Problem, vor dem die >Immanenten< wie ihre theologisch-rationalistischen
Gegner stehen, ist, ob das, was sich in einer vermenschlichten Religion ausdrckt,
noch Religion genannt werden kann, ob der vom Gottesdienst in den Menschen-
dienst transformierte Kultus noch Unterscheidungsmerkmale aufzuweisen hat, die
Profanes und Heiliges trennen.
Von zentraler Bedeutung ist, da innerhalb der freireligisen Bewegung nicht
zuletzt durch die Aktivitten der >Immanenten< sozialistische Programme sich her-
ausbilden. In Breslau propagiert Nees von Esenbeck einen urchristlichen
Gemeinde-Sozialismus.
146
Der Prediger Julius Rupp, der zu den eigenartigsten
Gestalten der freireligisen Bewegung gehrt und dem ein eigener Exkurs gewid-
met werden mte, schockiert die brgerlichen Mitglieder der Knigsberger freien
Gemeinde durch seine Vorschlge zur Umgestaltung der sozialen Verhltnisse und
durch die Einfhrung des sozialistisch-brderlichen >Duzkomments<.
w
Es kommt
zu zahlreichen Verschmelzungen wahrsozialistischer und freireligiser Initiativen.
Rckblickend kann R. Gottschall 1851 von der freireligisen Bewegung sagen:
Die freien Gemeinden sind die einzige tatschliche Existenz des Sozialismus auf
deutschem Boden.
148
Das sozialistische Vereinswesen als Realisierung der Idee der unsichtbaren Kir-
che<? Handelt es sich hier nicht um einen Verrat an den Prinzipien der Gruppe,
nicht um eine Rekatholisierung, den Aufbau einer >sichtbaren Kirche<, die man bei
den Neupietisten erbittert bekmpft hatte? Eine Neigung zur sichtbaren Kirche<
glaubt 1845 G. Julius bei Marx und Engels feststellen zu knnen. Bevor wir uns
dem Streit in der Gruppe zuwenden, sei noch die Position der >Atheisten< um
B. Bauer dargestellt.
c) Die Atheisten
Zunchst stehen die Junghegelianer um B. Bauer vor dem Problem zu erklren,
warum den Aufrufen des Priesters Ronge so viele folgten, whrend zwei Jahre zuvor
ihre eigenen Parteiaufrufe keinen derartigen Widerhall fanden.
Fr den Ronge'schen Brief kann weder der Inhalt, noch die Khnheit, noch der anspre-
chende Stil die laute umfangreiche Sympathie hervorgerufen haben. Wo blieb sie, als Werke
erschienen, deren Wert durch jene Eigenschaften bei weitem nicht erschpft wird?, fragt
ein Autor der NB, und er kommt zu dem Ergebnis: Da Ronge seine Stellung als katholi-
scher Priester aufs Spiel setzte, das imponierte der Menge. Ein anderer htte immerhin den-
selben Brief an den Bischof Arnoldi schreiben knnen, er wre unbeachtet geblieben, aber
der geweihte Rock des Priesters erregte Aufsehen.
Unverkennbar schwingt die Erinnerung mit, da 1842 die Entlassung B. Bauers
nicht zu einer derartigen Volksbewegung gefhrt hat. Aber B. Bauer wre damals
auch im Nachteil gewesen, denn er konnte keinen >heiligen Rock< anbieten, wie
Ronge, der sich deshalb als wahrer Gegner der Trierschen Ausstellung zeigen
konnte, weil er selbst einen entsprechenden Rock besessen habe.
149
Diese Konkurrenz mit den Fhrern der freireligisen Bewegung kommt noch
rckblickend bei B. Bauer zum Ausdruck, wenn er 1849 schreibt:
Als die Radikalen des Jahres 1842 am Ende ihrer Weisheit standen und mit ihren Forderun-
gen an der Sprdigkeit des Bestehenden abprallten, trumten sie davon, wie schn es doch
377
sein mte, wenn Philosophie und Bildung zur Gemts- und Willenssache, zur Religion und
weltbewegenden Leidenschaft geworden wren - die Forderung zur reformatorischen Tat, das
Sollen zur lebendigen Leidenschaft, die sich der Welt unwiderstehlich mitteilt und sie in
neue Bahnen mit sich fortreit. Es war einer jener Jugendtrume, deren Erfllung nur dem
reifen Alter gewhrt wird. Nachdem die Radikalen sich vergeblich abgemht hatten, das
zndende Wort zu finden, stand auf einmal der Mann (Ronge, d. V.) da, in welchem die For-
derung Fleisch und Blut geworden und eine Macht der Leidenschaft entwickelte, die alle bis-
herigen Eroberungen der Bildung und >Philosophie< in Einen Willensakt zusammenballte
und in Ein Wort zusammenfate.
130
Die freireligise Bewegung ist ein Erbe des junghegelianischen Radikalismus von
1842. Aber indem B. Bauer dies konstatiert, nimmt er zugleich eine Umwertung
vor. 1844 uert er seine Zweifel in einem Artikel ber die >Lichtfreunde in K-
then<. Er analysiert die inneren Konflikte der Lichtfreunde, den Streit zwischen
Uhlich und Wislicenus und die Auseinandersetzung der Lichtfreunde mit
offiziel-
len Theologen und kommt zu dem Ergebnis, da die Innigkeit des Verhltnisses
zwischen den Lichtfreunden und den Anhngern der glubigen Theologie auer
Zweifel stehe. Gemeinsam sei den streitenden Parteien, da ihre Positionen Posi-
tionen der Unbestimmtheit seien.
Der Unbestimmtheit, die den Verein der Lichtfreunde gestiftet hat, mag ein Ende gemacht
werden, wenn der Bund der Freunde durch den Kampf gegen seine Widersacher nur
gezwungen wird, sich auf einer tieferen Grundlage neu zu konstituieren! Allein er kann nur
mit Widersachern kmpfen, die selbst so arm an Leben sind, da der Streit mit ihnen kein
Lebensfeuer entznden kann.
151
>Unbestimmtheit< ist der Hauptvorwurf der Gruppe um B. Bauer gegenber der
freireligisen Bewegung, eine >Unbestimmtheit<, die sie auf mehreren Ebenen fin-
den: politisch ist es die Unbestimmtheit des Liberalismus, des juste-milieu, gesell-
schaftlich ist es die Unbestimmtheit der Masse, und auf der religisen Ebene
ist
Unbestimmtheit Zeichen einer vollendeten Religion.
Die politische Ebene wird in Terminis kritisiert, wie sie E. Bauer in seinen Juste-
Milieu-Artikeln in der RhZ entwickelt hatte.
132
Der theologische Rationalismus
wolle zweien Herren dienen, dem Gott in der jenseitigen und dem Leben in der
diesseitigen Welt. So seien die Lichtfreunde dazu verdammt, sich stets zu wider-
sprechen, heit es in den NB
153
, und fr Jordan gehrt der freireligise Prediger
Rupp zu den Januskpfigen, welche die Wirksamkeit der absoluten Kritik am
strksten paralysieren, die Herkulesarbeiten des modernen Geistes zur Hlfte wie-
der ungetan machen.
154
Wo liegen die Ursachen fr den massenhaften Erfolg des Pastors Uhlich? Den
NB zufolge gelingt ihm eine eigentmliche Mischung von Entschiedenheit und
Milde.
Man sieht es auf jedem Punkte seiner >Entschiedenheit< an, da sie an der >Milde< ihre
Grenze hat, und der >Milde<, da sie >entschieden< ist. So konnte Uhlich Stifter einer Ver-
sammlung von 600 Menschen werden (. . .). Wre er entschiedene er htte es nicht ver-
mocht. Wre er blo >milde<: sein Dorf Pmmelte nennte allein seinen Namen. Aber seine
Entschiedenheit und Milde< macht ihn zum Volksmann.
Uhlich wird mit O'Connell verglichen, jenem charismatischen Volksfhrer der
378
national-katholischen irischen Volksbewegung, der die Zeitgenossen enorm faszi-
niert.
155
Aber ist die freireligise Bewegung berhaupt mit politischen Kategorien zu fas-
sen? Religise Massenbewegungen beginnen sich fr einen Teil der Junghegelianer
als ein selbstndiges, neuartiges Phnomen abzuzeichnen, das Reflexionen heraus-
fordert. A. "Frnkel versucht in den NB B. Bauers Kritik der Masse auf die religi-
sen Bewegungen anzuwenden. Er thematisiert die Auflsung der stndischen Bin-
dungen und der herkmmlichen Lebenskreise, aus denen die Individuen als
unverbundene Privatexistenzen heraustreten. Was als Gesamtbewegung der
Masse erscheine, ist nur die Bewegung der vereinzelten Atome mit ihren besonde-
ren Interessen und Bedrfnissen, das, was innerhalb ihrer kmpft, ist nur der
Kampf und die Konkurrenz dieser Unendlichkeit von Einzelinteressen.
156
Han-
delt es sich bei den Massenbewegungen berhaupt um ein einheitliches Phno-
men?
Frnkel schliet an die B. Bauersche These von 1844 vom unausbleiblichen
Krieg der Menge gegen den Geist und das Selbstbewutsein an und konstatiert
bei der freireligisen Bewegung einen gemeinschaftlichen Gegensatz gegen alle
Taten der Forschung und Wissenschaft, berhaupt gegen alles Bestimmte. Dieser
Gegensatz werde gespeist aus der Bewegung der Auflsung aller bestimmten For-
men, eine Bewegung der Unbestimmtheit, die schlielich in der Wissenschaft ihren
letzten Gegner finden werde, weil diese auf dem spezifischen Unterschied von Kri-
tik und Nichtkritik insistiere. Und als eine Art >Vorformulierung< von Paul Valerys
Diktum L'esprit abhorre les groupements knnte man Frnkels Satz lesen: Es
gibt keinen bestimmten Gedanken, der sich in der Form einer tausendkpfigen
Massenhaftigkeit entwickeln, gestalten und darstellen knnte.
Aber dies ist nur der negative Aspekt. Gemeinsam ist der Massenbewegung auch
die allgemeine Verschwommenheit der geschichtlichen Schranken, die ihre
Vollendung noch nicht erreicht (hat), solange sie sich innerhalb der bisher so scharf
gesonderten Gebiete nur als Mifallen an der Trennung, als Wunsch der Versh-
nung und des friedlichen Nebeneinanderstehens, als gegenseitige Sympathie und
Anerkennung, als gleiches oder hnliches Streben zeigt. Entscheidend ist jedoch,
da die atomisierten Individuen selbst zu einer positiven Haltung ihrer Massenexi-
stenz gegenber kommen mssen, d. h. sie bedrfen einer Art Ideologie, deren
charakteristisches Merkmal es ist, keine charakteristischen Merkmale aufweisen zu
knnen.
Wie aber der Punkt, in dem die sonst vereinzelten und getrennten Individuen zusammen-
stimmen und einig sind, nur immer der allgemeinste und unbestimmteste sein kann, stellt
sich diese bereinstimmung auch nur in der allgemeinen unbestimmten Form des Gefhls,
und zwar in dem gesteigerten Gefhl eines allgemeinen Enthusiasmus, oder einer allgemei-
nen Emprung dar. Diese Gefhle - deren Inhalt umso unbestimmter sein mu, je ausge-
breiteter und ansteckender sie sind sind die einzigen Krfte, mit denen die Masse als solche
agiert und reagiert Krfte, die eben nur dann von Gewicht sind, wenn sie in massenhafter
Weise auftreten.
157
Diese Unbestimmbarkeit des Gefhls identifiziert Frnkel als Religion.
Die Einstimmigkeit des Bekenntnisses ist es, welche eine Masse von Individuen zu Beken-
nern einer und derselben Religion macht: ein einzelner kann fr sich keine Religion bilden,
379
(. . .). Whrend alle die anderen Interessen die Individuen auseinanderreien und verein-
zeln, ist ihre Religion ( . . . ) dasjenige Interesse, in dem sie sich als ein Allgemeines darstellen.
Die Berhrung des religisen Interesses berhrt und bewegt daher auch nicht blo den ein-
zelnen, sondern das gemeinsame Interesse vieler einzelnen. Darum sind alle religisen Bewe-
gungen wenn sie als solche geschichtlich hervortreten notwendig immer massenhafte
Bewegungen.
158
Was in Frnkels durchaus noch heute diskutablen Thesen aufscheint, ist eine
Korrespondenz zwischen der entwickelten brgerlichen Gesellschaft und einer
eigenartigen Formlosigkeit der Religion. In ihr sind die konfessionellen Unter-
schiede, die Bestimmtheiten der Bekenntnisse aufgelst. In der unbestimmten Reli-
gion ist die Frage: warum zerschlagen die heutigen Christen die heidnischen Gt-
terbilder nicht mehr?
159
unsinnig geworden. Die Unbestimmtheit der Religion
gibt keinen Anla mehr. Wenn man will, entdecken die Junghegelianer um
B. Bauer in der religisen Massenbewegung die unsichtbar gewordene Religion.
Was den >Immanenten< fehlt, das Gespr fr den geschichtlichen Form- und
Funktionswandel von Religion in einem Skularisierungsschub, ist bei den >Athei-
sten< besonders stark ausgebildet. Fr B. Bauer ist die Auflsung bestimmter Dog-
men und Symbole, soziologisch gesprochen, die Informalisierung von Religion zu
einem unkenntlichen Restbereich des Gemts, kein Ende der Religion, sondern
die Vollendung der Religion, die reine und vollendete, d. h. beziehungs- und
gegenstandslose Abhngigkeit - das reine, dumpfe Erzittern des Innern. Die
moderne Religiositt ist berhaupt erst als Massenreligion denkbar, sie ist fr
B. Bauer das Resultat einer Bewegung, die sie nicht geleitet hat und die sie nicht
aufhalten konnte. Denn paradoxerweise ist die moderne Massenreligiositt ein
Resultat von Aufklrung, Philosophie und Kritik, weil diese Bewegungen das zer-
setzt haben, was in der modernen Religiositt in eine breiartige Masse ausgegos-
sene Auflsung des geschichtlichen Stoffes ist.
160
Der Konflikt zwischen theologischen Rationalisten und >Immanenten< verliert
unter dieser Perspektive seine Bedeutung. Beide Tendenzen gehen in eine gemein-
same Richtung. Der theologische Rationalismus fhrt zur Vollendung des Chri-
stentums, weil er das Christentum von aller speziellen, lokalen und temporren
Verwicklung mit dem Volkswesen entlastet hat, um reine und abstrakte Reli-
gion zu werden. Darum ist auch der Widerwille des Rationalismus gegen die
inhaltsvollsten Dogmen ( . . . ) echt religis.
161
Aber auch die >Immanenten< befr-
dern die Vollendung der Religion. Je mehr die Gottheit sich vollendet, je mehr sie
nmlich menschlich wird und die Menschheit in ihr sich selbst wieder findet, um so
reiner wird der Ausdruck ihrer Willkr. Die Vollendung der Religion ist der abso-
lute Sieg der Willkr.
162
Eine Religion, die Dogmen kennt, ist eine sich bestimmende Religion, die Unbe-
stimmtheit der vollendeten Religion kennt keine Dogmen, sondern nur Willkr.
Auf gesellschaftlicher Ebene entspricht die dogmatische Bestimmtheit den gefg-
ten und bornierten Lebenskreisen der traditionellen Gesellschaft, der Auflsung
dieser Schranken und der Entlassung der Individuen in die arbeitsteilige brgerli-
che Gesellschaft entspricht die uerste Unbestimmtheit und Willkr der Religion,
(nebenbei bemerkt, eine Unbestimmtheit und Willkr, die Marx spter auf das
Medium des Geldes projezieren wird). An dieser Form moderner Religiositt, die
380
von dem unbestimmten letzten Rest, der letzten Willkr regiert wird, entzndet
sich der Atheismus B. Bauers. Was heute als Massenatheismus erscheint, nmlich
die verbreitete Auffassung, da ber die letzten Werte keine bestimmten Aussagen
gemacht werden knnen, wre fr B. Bauer das sicherste Indiz einer vollendeten
Religion.
163
Auf die von Deutschkatholiken und Lichtfreunden erneut aufgeworfene Frage
nach einer staatsunabhngigen, selbstverwalteten Kirche haben weder >Imma-
nente< noch >Atheisten< eine Antwort gefunden, die dem Problem gerecht gewor-
den wre. Den >Immanenten< ging es darum, mglichst rasch die theologisch-kirch-
lichen Formen und Inhalte abzustreifen, den Gottesdienst in Menschendienst zu
transformieren, die religisen Bedrfnisse umzubiegen, um die verschwenderische
Sehnsucht nach einer Transzendenz zur Antriebskraft fr ein philanthropisches
oder sozialistisches Vereinsleben zu nutzen. Den >Atheisten< kam die Institutionali-
sierungsproblematik berhaupt nicht in den Blick. Sie diagnostizierten zwar die
Transformation der Religion, ihren eigentmlichen Rckzug in das immer unsicht-
barer werdende dumpfe Erzittern des Inneren,aber dieser letzten Formlosigkeit
der Religion wuten sie nur die heroische Tat einsamer Forschung entgegenzuset-
zen.
7. Vollendung der Religion, Ende der Religion?
Was ist nun die religise Bewegung der 40er Jahre? Erfllt sich in ihr der Traum
von der >neuen Religion des Geistes<, ist sie die wahre Gestalt des Sozialismus, die
Wiedergeburt urchristlicher Gemeinden, oder ist sie die Vollendung der alten Reli-
gion, die letzte Stufe der Entfremdung des Menschen? Oder handelt es sich, trotz
des Eindruckes, da Deutschland einem groen Konzil gleicht, schon gar nicht
mehr um Religion, sondern um Politik und Wirtschaft? Deutungsprobleme beste-
hen auf allen Seiten. Aber wie hngen sie zusammen: Religion, Politik, Wirtschaft
und Industrie?
Zweifel, da es sich bei der religisen Bewegung berhaupt um eine religise
handele, hat R. Prutz. Er fragt,
wer es denn eigentlich gewesen, der diese ganze Angelegenheit zuerst in Gang gebracht,
wer es ferner ist, der sie gegenwrtig am meisten in Gang erhlt, wer das meiste Leben, die
meiste Ttigkeit zeigt, ja wer recht eigentlich Seele und Kern der ganzen Bewegung ist: die
Glubigen oder die Unglubigen? die Kirchlichen oder die Unkirchlichen? die Frommen
oder Ketzer? Das (wie man es so gern nennt) >religise Leben der Gegenwart sei gar
nicht so tief aus der Mitte des Volks hervorgewachsen, gar kein solch ursprngliches,
autochthonisches Element unseres Volkslebens ( . . . ) , wie man uns wohl berreden
mchte. Vielmehr sei es erst von auen hinein getragen worden. Es seien die Unglubi-
gen gewesen, welche diese religise Bewegung veranlat haben; nicht in majorem, vielmehr
in minorem ecclesiae gloriam ist der Kampf entbrannt, nicht den Glauben schtzen will man
- nein, man mchte gern das bichen, das man noch etwa hat, sich mit guter Manier vllig
entledigen.
164
381
Aber wie steht es mit dem Einwand, der Kampf gegen religise Traditionen sei
an sich schon eine Religion, ein Gottesdienst, der hchste, edelste sogar, den es
gibt: ein Gottesdienst der Freiheit? Prutz' Antwort ist zwiespltig. Was ihn ver-
shnen knnte mit diesen theologischen Trivalitten der religisen Bewegung,
wre ein unerschrockenes Wahrheitsbekenntnis. Aber den Titel Gottesdienst
der Freiheit mag er der freireligisen Bewegung nicht zusprechen.
Uhlich und Wislicenus, Ronge und Czerski, pret sie aus, miteinander, destilliert sie in eins
und schttet noch alle Lgen, alle Verdrehungen, alle Entstellungen dazu, welche die Heng-
stenberg und Gerlach, die Philipp's und Ritter ber sie ausgegossen: ihr kriegt doch aus der
ganzen Gesellschaft noch nicht den zehnten, nicht den hundersten, den tausendsten Teil
heraus von dem Freimut, der Aufklrung, der (wenn es doch einmal (!) so heien soll) >freien
Religion<, welche seit hundert Jahren alle grten Geister unseres Volkes, einen Kant und
Fichte, einen Lessing und Schler erfllt haben!
165
Die Anschlsse an die nur noch zgernd als >freie Religion< bezeichnete klassi-
sche Periode sind zweifelhaft geworden.
Gibt es berhaupt rein religise Angelegenheiten? Es gbe sie zwar, aber nur
in den inneren Krisen des Individuums selber, fr die gelte, ein jeder macht sie
mit sich selber ab. Solche - so knnte man Prutz modern bersetzen - existenziel-
len psychischen Krisen sind fr die Konstitution sozialen Sinnes unerheblich. Und
heute knnte hinzugefgt werden, wer sie nicht mit sich selber abmachen kann,
dem steht der Weg zum Psychiater offen.
166
Die >rein religise Angelegenheit im
Innern des Individuum kommt fr Prutz berhaupt erst zu einer tatschlichen Exi-
stenz, wo sie als
plastisches Gebilde, lebendig in die Welt schreitet, da erst ist sie wirklich vorhanden, da
erst kommt sie in Betracht, da erst zwingt sie uns auf, auf sie zu achten. Und: es gibt, im
Bereich des Menschen, keine andere wahrhafte Existenz, als allein die Existenz im Staate, es
gibt kein anderes lebendiges Dasein, als allein politisches Dasein. Was nicht im Staate zu exi-
stieren wei, existiert berhaupt nicht; was sich nicht politisches Dasein verschafft, ist ber-
haupt nicht da.
167
Prutz' Sicherheit der Gedankenfhrung bricht sich dort, wo er nach Worten
sucht, die politische Daseinsebene zu umschreiben: Diese Welt des Wirklichen
nun aber, diese allgemeine Verkrperung der Idee, dies (um es recht eigentlich zu
bezeichnen) Reich Gottes auf der Erde ist nun eben - der Staat] die brgerliche
Welt, die Welt des Rechten, als der verwirklichten Freiheit!
168
Vollendung der
Religion, weil das Reich Gottes auf Erden >recht eigentlich< da ist, oder Ende der
Religion, weil es nur eine politische Daseinsebene gibt?
Und wie sind die religisen Bewegungen in dieser Alternative unterzubringen?
Prutz konstatiert: Alle religisen Bewegungen
von den Altlutheranern bis zu den Neukatholiken, von den Pietisten zu den Lichtfreunden,
allesamt stimmen sie darin zusammen, da sie freie Religions&jg haben, da sie unabhn-
gig religise Krperschaften, mit einem Worte: da sie freie selbstberechtigte Gemeinden bil-
den wollen. Der Kern ihrer Forderungen sei ein politischer: diese vermeintliche religise
Bewegung der Gegenwart ist gar keine religise, sie ist eine politische Bewegung. Daraus
folgt: Politik treiben wir, auch indem wir lichtfreundliche und pietistische und deutschka-
tholische Versammlungen halten: warum nicht auch die Politik treiben als Politik? warum,
nicht die theologische Kapuze abwerfen?
169
382
Aber wie soll die Kapuze abgeworfen werden, wenn die in der religisen
Bewegung Engagierten die Hlle fr den Kern nehmen? Was Prutz schlielich
brig bleibt, ist ein Appell, der wieder dementiert, da die Bewegung politisch ist:
fhrt Eure Kriege wenigstens im Stillen, beschrnkt Euch, wie es geschrieben steht, auf
Euer Kmmerlein, tragt Euern innerlichen Wirrwarr nicht auf Gassen und Mrkte, pumpt
Eure kleinen quakenden theologischen Frsche nicht auf zu Riesen -: wenn nicht um der
Freiheit, nicht um des Vaterlandes, nicht um Eures Vorteils - o so wenigstens um des guten
Geschmacks willen!! Denn sonst verschlingt diese theologische Barbarei uns alle.
170
Offensichtlich mu die Analyse anders angelegt werden, um jenes Versteckspiel
auflsen zu knnen. Auch fr Jordan steht fest, da es sich unter der Maske der
Religion um Politik handelt, da hinter dem Schild der Glaubensfreiheit der
Unglaube sich verbirgt. Aber die Angelegenheit sei komplizierter, nmlich so,
da jene Maske zugleich eine Maske fr den Maskierten ist und da dieser Schild zugleich
auf die, die ihn fhren, wie eine Tarnkappe wirkt, d. h. da sie selbst es nicht einsehen, wie
die Glaubensfreiheit, die sie meinen, nicht eine Freiheit im Glauben, sondern eine Freiheit
vom Glauben ist; wie sie zwar unter dem Zeichen des Kreuzes zu siegen trachten, aber in
Wahrheit gegen das Kreuz selbst.
171
Angesichts der rckwirkenden Maskierungen mu das Phnomen Religion
genauer erklrt werden. Woher kommt die gedoppelte Tarnung?
Zur selben Zeit, als Marx und Engels in der >Deutschen Ideologie< die Grundli-
nien des historischen Materialismus fixieren, schreibt Jordan ber die objektiven
Krfte, die der Religion ein Ende bereiten:
Man verkennt immer noch viel zu sehr die Leiblichkeit und Sinnlichkeit, die materiellen
Grundmotive der Geschichte. Nicht aus dem Hirn einsamer Denker blht ungezeugt und
durch ein mystisches Wunder dasjenige hervor, was einen neuen Umschwung in die
Menschheitsschicksale bringt, und nicht allgemeine, erst zum Bewutsein kommende und
dann umgestaltend in die Wirklichkeit eingreifende Prinzipien sind die Hebel neuen
Geschehens, sondern umgekehrt: erst nachdem naturgem und allmhlich enstandene
neue Bedrfnisse die Vlker in eine neue Ttigkeitsrichtung hineingezogen und so andere
Zustnde erzeugt haben, bewirkt der berblick derselben das Bewutsein, welchem dann
alles zufllt, so bald es ausgesprochen wird.
172
Schon die Naturgeschichte kenne Revolutionen, aber die praktische Ttigkeit
der Menschen habe zu einer weit greren Umgestaltung der Welt gefhrt. Der
Mensch
vernichtet, indem er die Naturgegenstnde und seine eigenen Verhltnisse zu ihr (der
Natur, d. V.) umbildet, nicht allein d
;
e handgreiflichen Wesen und Dinge der Welt, sondern
unvermerkt auch die ganze frhere Welt seiner eigenen Gedanken, denn diese ist ja nichts,
als das zusammenfassende Spiegelbild von jenen, das notwendig mit ihnen zugleich aus sei-
ner Vorstellung verwischt werden mu.
Aus dieser Perspektive legitimiert sich die Rede vom Ende der Religion, denn es
mte einsichtig sein, da die Geistesform, Sitte, Gesetz, Religion vergehen
msse, wenn die ueren Verhltnisse, wenn der Wohnort, die Bedrfnisse, die
Ttigkeit des Volks durch seine eigene Arbeit oder durch die Macht anderer Vlker
verwandelt sind.
173
383
Was Jordan 1845 entwirft, ist ein veritabler historischer Materialismus. Zwei Fra-
gen schlieen sich an: 1. welchen ueren Verhltnissen entsprach die Religion?
Antwort: Der Boden, auf dem das Christentum erwachsen, und die Bedingung,
unter der allein es noch gedeihen konnte, war das menschliche Elend und die
Unwissenheit ber die Natur. 2. Sind diese Bedingungen heute noch gegeben?
Die Antwort lautet: perspektivisch gesehen nein. An Wunder glaube niemand
mehr so recht, die Verbreitung der Ergebnisse der Naturforschung sei nicht aufzu-
halten. Und das Elend? Mitten in den Auseinandersetzungen um den >Pauperis-
mus< diagnostiziert Jordan: es gbe zwar noch genug Elend in der Welt. Aber ich
meine, doch lange nicht mehr genug zum guten Fortgedeihen des Christentums.
Er verweist auf die Aufhebung der Leibeigenschaft und auf die ins unglaubliche
gestiegene Industrie. Sie habe
mit wohlttiger Hand eine Menge von Bedarfsbefriedigungen und Genssen, die frher
nur den Mchtigen der Erde zu Gebote standen, der groen Masse zugnglich gemacht und
wieviel Jammer und Not auch noch ungestillt bleibt, das kann niemand bestreiten: die
Summe des allgemeinen Wohlseins ist nicht blo gegen frhere Jahrhunderte, sondern
selbst gegen eine weit jngere Zeit unermelich gewachsen und die Zahl derer um ein
betrchtliches zusammengeschmolzen, welche die Erde mit Fug und Recht ein Jammertal
nennen drfen.
174
Was die Gegenwart als religise Bewegung erlebe, sei der Todeskampf des
Christentums. Dies sei ein verdeckter Proze, weil fast alle den Todeskampf leug-
nen, obgleich sie alle unbewut mit Hand anlegen, es desto schneller unter die
Erde zu bringen. Politisch betrachtet sei der Deutschkatholizismus nichts weiter
als Liberalismus unter religiser Vermummung, und angesichts der Forderung
von Teilen der Lichtfreunde, die Erde zum Himmelreich zu machen, was man nur
durch Vereine erreichen knne, stellt Jordan fest: Glaubt man nicht franzsische
Sozialisten sprechen zu hren, die bekanntlich aufs klarste nachweisen, da das
Christentum weiter nichts sei, als reiner Sozialismus und Kommunismus?
175
Religion, Politik, Industrie - wie ist dies magische Dreieck aufzulsen?
B. Bauers Vollendung der Religion ist fr Prutz und Jordan ihr Ende. Fr Prutz,
weil jeder Glaube unter dem Gesetz des ffentlichen Lebens steht, fr Jordan, weil
Industrie und Naturerkenntnis den Wurzeln der Religion, Elend und Unwissen-
heit, keine Nahrung mehr geben. Fr Jordan stirbt die Religion geradeso in der
Industrie, wie sie bei Prutz in der Politik verendete.
Der Streit wre zu lsen, wenn die >Atheisten< um B. Bauer sich damit zufrieden
gben, die Vollendung der Religion nur als Informalisierung, als Unbestimmtheit
letzter Werte zu diagnostizieren. Aber der religise unkenntliche Rest, lt er sich
einsperren in das Prutzsche Kmmerlein? Mu er nicht wieder herhalten fr die
Lsung der skularen Probleme? B. Bauer schreibt:
Man hat in der neuern Zeit selbst unter denen, die fr den Fortschritt kmpfen, das Wort
>Religion< gehrt - entweder so, da gesagt wird, jedem sei der Beruf und das Geschft, dem
er sich widme, seine Religion, msse wenigstens seine Religion sein, oder so, da gefordert
wird, die Begeisterung fr die allgemeinen Ideen, Staat, Freiheit, Kunst, Wissenschaft,
msse die Form der Religion annehmen oder die Religion der Menschen bilden.
176
384
Der religise Rest wird wieder bestimmend fr die Formfrage. Auf den Staat
bezogen fragt B. Bauer: Soll die Hingabe und Begeisterung als Religion wieder das
Verdunsten des wirklichen bestimmten Gedankens sein? Und was die Industrie
angeht, fragt er: Soll der Mensch darin seine Religion finden, da er zeitlebens
nichts anders tut, als diese bestimmte Maschine fr die Zubereitung einer bestimm-
ten Schraube zu beaufsichtigen?
177
Ende der Religion? Vollendung der Religion? Ein Streit um Worte, ganz ohne
Zweifel. Und dieser Streit um Worte dauert an. Er ist das zentrale Problem reli-
gionssoziologischer Theoriebildung.
178
Haben wir es im Zusammenhang der Her-
ausbildung der modernen Gesellschaft mit einem irreversiblen Proze der Skula-
risierung zu tun, oder tuschen wir uns, wenn wir die greifbaren Erscheinungen
von Entkirchlichung mit Entchristlichung gleichsetzen
179
, oder gibt es gar keine
Skularisierung, weil sich eine unabdingbare Religiositt heute in anderen symboli-
schen Wirklichkeiten zeigt, die die Leistungen religiser Sinngebung bernommen
haben
180
, oder ist gar in gegenwrtigen Gesellschaften ein berschu an religisen
Glaubenssystemen vorhanden, denen nur sozialwirksame Vermittlungsformen
fehlen?
181
Und was soll bei alledem noch Religion genannt werden?
Diese Arbeit ist nicht der Ort, detailliert auf die heutige Debatte einzugehen, sie
ist gleichwohl der Ort, nach dem sozialen Sinn des Streits um Worte und gerade der
Worte in dieser Sache zu fragen. Wenn wissenssoziologische Bemhungen ber die
traditionelle Vorlage, der Frage nach sozialer Lage und Bewutseinsformen, hinaus-
kommen sollen, so darf der Streit um Worte gerade nicht als belanglos abgetan wer-
den. Jede diskutierende Intellektuellengruppe steht vor dem Problem, Modi auszu-
bilden, mit denen der Unterschied zwischen einem Streit mit Worten ber Sachen
und einem Streit, der mit Worten blo ber Worte gefhrt wird, fundamentalisiert
werden kann. Da dieser Unterschied in der Diskussionspraxis fortlaufend unter-
miniert wird, da die Rufe Zurck zur Sache! und Zurck zu den Worten!
nicht enden wollen, gehrt ebenso zum Alltag von Intellektuellengruppen.
Wo es jedoch darum geht, festzustellen, was noch Religion genannt werden
kann, geraten auch jene Regulative in Bedrngnis, die den genannten Unterschied
fundamental sichern sollten. Die Gruppe mu entscheiden, ob sie sich noch weiter
ber die Sache oder das Wort >Religion< streiten will. Fr die Gruppe der Junghe-
gelianer stellt sich die dramatische Frage, ob die Religionskritik vertieft fortzuset-
zen ist oder ob das bisher geleistete ausreicht.
Diese Weichenstellung ist gravierender als alle Entscheidungen, die zuvor
getroffen werden muten. Der bergang von der Schule zur Partei wurde einhellig
gefordert. Die Differenzen in der Einschtzung des Liberalismus fhrten zwar zur
Spaltung der Gruppe, aber weil es hier auch um pragmatische Dimensionen und
taktische Bndnisfragen ging, enthielt dieses Problem noch Spielrume eines ver-
deckteren oder offeneren Radikalismus. Die Alternative >Theorie und Masse< ver-
sus >Theorie statt Masse< ri tiefere Grben auf, aber es handelte sich hier noch um
Suchbewegungen nach einem gesellschaftlichen Ort der Intelligenz, der auf beiden
Seiten, der Seite des in der Masse aufgelsten Intellektuellen und der Seite des ein-
samen Kritikers, kein gesicherter Ort war. Die Kritik der Religion war jedoch das
geheime Band der Gruppe, sie war ja berhaupt, angefangen mit Strau' >Leben
Jesu<, das Konstitutionsmerkmal der Gruppe.
385
Ende 1843 beginnt Marx die >Einleitung zur Kritik der Hegeischen Rechtsphi-
losophien Fr Deutschland-ist die Kritik der Religion im wesentlichen beendigt,
und die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Jetzt geht es um
anderes, jetzt, nachdem das jenseits der Wahrheit verschwunden ist und nach-
dem die Heiligengestalt der menschlichen Selbstentfremdung entlarvt ist. Es geht
um eine Transformation: Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die
Kritik der Erde, die Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theo-
logie in die Kritik der Politik.
1
*
2
Ebenso urteilt Rge im selben Jahr in seiner Rezension von Feuerbachs >Wesen
des Christentums^ Fr Rge steht fest, da die Kritik und Phnomenologie des
bestimmten und entschiedenen, d. h. des wirklichen und inhaltsvollen christlichen
Glaubens, hiermit vollendet ist. Feuerbach beende einen Proze der Religionskri-
tik, der mit der Aufklrung begonnen habe. Die Aufklrung sei ein Kampf gegen
die Religion gewesen, ohne das Wesen der Religion zu ergrnden, mit Feuerbach
sei dagegen die Religion endgltig erklrt. Der Kampf der Aufklrung habe sich
nur auf das bse Wesen der Religion gerichtet. Feuerbachs Darstellung ist
gerecht, denn sie behandelt beide Seiten, das gute und das bse Wesen der Reli-
gion, mit gleicher Grndlichkeit. Feuerbachs Kritik ist das begriffene Wesen,
whrend die Kritik der Aufklrung nur das begriffene Unwesen darstellt.
183
Gegen die Rede vom Ende der Religionskritik erhebt sich Widerspruch. Feuer-
bach habe keineswegs die Religionskritik vollendet, meint Stirner, und bemerkt,
da die Religion noch bei weitem nicht in ihrem Innersten verletzt wird, solange
man ihr nur ihr bermenschliches Wesen zum Vorwurfe macht. Und die voreili-
gen Gruppenmitglieder weist er darauf hin:
Das Heilige lt sich keineswegs so leicht beseitigen, als gegenwrtig Manche behaupten,
die dies >ungehrige< Wort nicht mehr in den Mund nehmen. Werde Ich auch nur in Einer
Beziehung noch >Egoist< gescholten, so bleibt der Gedanke an ein Anderes brig, dem Ich
mehr dienen sollte als Mir, und das Mir wichtiger sein mte als Alles, kurz ein Etwas, worin
Ich Mein wahres Heil zu suchen htte, - ein >Heiliges<. Mag dies Heilige noch so menschlich
aussehen, mag es das Menschliche selber sein, das nimmt ihm die Heiligkeit nicht ab, son-
dern macht es hchstens aus einem berirdischen zu einem irdischen Heiligen, aus einem
Gttlichen zu einem Menschlichen.
184
Auf die Anmerkung der Redaktion der EB zu B. Bauers religionskritischen
Schriften, die kommende Generation wrde es lcherlich finden ( . . . ) , gegen
solche Lcherlichkeiten (gemeint sind die Prinzipien der Theologie, d. V.) noch
mit Ernst und Pathos zu protestieren, reagiert B. Bauer:
diese Zukunft war fr die Radikalen schon lngst vorhanden: sie fanden die Ausfhrung
der Kritik, d. h. die wirkliche Kritik selbst schon berflssig und lstig. Aber: Diejenigen
Radikalen, die das Ende der Religion und Kirche schon erlebt zu haben glaubten, hatten sich
allerdings geirrt und zu frh auf die Sympathien eines glaubenslosen Volkes gerechnet.
185
Warum tangiert die Frage, ob Religionskritik weiterhin an erster Stelle stehen
soll oder ob sie berflssig ist, die Gruppe in besonderem Mae? Eine mgliche
Antwort wre: die tief erliegende soziale Identitt der Junghegelianer, die einige
Metamorphosen der Gruppenidentitt mitgemacht hatte, kommuniziert durch
386
ihre Wandlungen hindurch mit der religionskritischen Thematik. So wre der
Widerspruch zu erklren, da auf allen Seiten, auch jenseits des Streits ber das
Ende der Religionskritik, der Vorwurf, noch an Resten der Religion festzuhalten,
die Auseinandersetzung dominiert.
B. Bauer sagt von Strau: Das Werk von Strau ist nicht das uerste, weil es
noch theologisch, noch orthodox, also auch noch gegen die Geschichte gewaltttig
und noch nicht die reine Erkenntnis der Geschichte war.
186
Und B. Bauer wirft
Feuerbach vor: Die Gattung Feuerbachs ist das Absolute Hegels, die Indifferenz
Schellings, das Fichtische Ich, das Kantische Ding an sich, die Urmonade des Leib-
niz', die Substanz Spinozas der Gott des Christentums - Religion, Philosophie.
Auch die Gattung Feuerbachs existiert nirgends und nimmer als nur im Himmel
des Gemts und auf dem bestirnten Wolkengrunde der Phantasie. Feuerbach
begeht und hegt und pflegt den Grundirrtum der Religion und das Unheil und
Unglck aller religisen Anschauung, nmlich, da der Mensch nicht Er selber ist.
Gelangte Feuerbachs Gattung irgendeinmal zur Wirklichkeit, kme der Feuer-
bachsche Gattungsmensch in irgendeinem Individuum zur Existenz, so wre der
jngste Tag, die Vollendung, das Ende des Menschengeschlechts erschienen. Und
nicht fehlen darf die klassische Frage: Hat er die Religion aus einem anderen
Grunde vernichten wollen, als nur da er seine Religion an ihre Stelle setze?
187
Marx und Engels dagegen verteidigen Feuerbachs Auflsung der Religion; fr
sie bilden umgekehrt B. Bauer und seine Anhnger die Heilige Familie. Der Vor-
wurf religiser Befangenheit kann hin und her geschoben werden. Fr G. Julius hat
jedoch gerade B. Bauer die Leistung vollbracht,
die in nichts geringerem besteht, als in der Verweltlichung der Theologie, (. . .). Was Feuer-
bach fr den einzelnen Menschen getan hat, indem er ihm sein wahres Wesen wiedergege-
ben, das hat Bauer fr die menschliche Gemeinschaft, fr die Geschichte getan; in der Ent-
fremdung, die Feuerbach in der religisen Anschauung des Menschen erkannt hat, sieht
Bauer das gemeinsame Prinzip der Zustnde, der Institutionen, des ganzen Lebens in der
christlichen Welt; whrend die Theologie bei Feuerbach sich in Anthropologie auflst, lst
sie sich bei Bauer in der Erkenntnis des gesamten menschlichen Wesens in seinen verschie-
densten Erscheinungen, also vornehmlich in Geschichte auf. Marx habe das Bauersche
Prinzip, in dessen Anwendung auf den Staat noch konsequenter ausgefhrt und dazu noch
grndlicher von der theologischen Fassung befreit, als Bauer selbst getan hat.
188
B. Bauer wird dem nicht zustimmen. Marx sei ein Feuerbachscher Dogmati-
ker.
Er mu die Kritik verdrehen, er mu sie zu einer kristallinischen Formation umgestalten,
er mu sie versteinern, aus ihrer flssigen Form heraus und den Kritiker aus seiner Mensch-
lichkeit weg in den Himmel der Substanz erheben, die Kritik zum Blauen, zum Himmel, und
den Kritiker zum Schaume und Traume, zum Gott machen, also er mu eine Kritik in sei-
nem Kopfe aushecken und einen Kritiker aus seinem Gehirne zusammenkneten, um gegen
diese und diesen, d. h. gegen seinen eigenen Schatten und gegen sein eigenes Gespenst zu
Felde zu ziehen.
189
Stirner entdeckt bei Feuerbach, B. Bauer und Marx imposante Reste religiser
Befangenheit und mu sich im Gegenzug dafr von Feuerbach sagen lassen, sein
Einziger sei ein unverdauter Rest des alten christlichen Supranaturalismus.
190
B. Bauer schilt Stirner einen Dogmatiker, der nicht weiter und nicht vom
387
Flecke kommt. Der Einzige ist der letzte Zufluchtsort in der alten Welt, der letzte
Schlupfwinkel, von wo aus sie ihre Angriffe auf eine von ihr ganz verschiedene, und
darum von ihr unverkennbare Gestaltung machen kann. Der Einzige ist die Sub-
stanz, fortgefhrt zu ihrer abstraktesten Abstraktheit.
191
Und fr Marx ist Stirner,
Sankt Max, derjenige unter den Religionskritikern, der die Welt en bloc heilig-
sprechen und sie damit ein fr allemal abfertigen konnte.
192
Die gegenseitigen Vorwrfe, noch religis zu sein, durchziehen alle Kontrover-
sen, niemand bleibt verschont, selbst gesicherte Lager zerreiben sich in diesem
veritablen Intellektuellenkrieg aller gegen alle. Handelt es sich bei diesem Grup-
pengeschehen um die Aufrechterhaltung einer Konfession des Atheismus, von
der B. Bauer an Rge schreibt?
193
Aber der Begriff >Atheismus< entzweit, selbst die
Brder Edgar und Bruno Bauer. Fr Edgar ist
>Atheist< noch ein viel zu religiser Ausdruck (...). Der Kritiker will aber nicht blo immer
in Gegensatz, im Kampf mit dem religisen Bewutsein bleiben: er will siegen, jenes ganz
von sich abwerfen: er will Mensch sein; sagen wir also fortan nicht mehr: der Kritiker ist ein
Atheist, sondern: der Kritiker ist ein freier Mensch.
194
Umgekehrt ist fr Bruno Bauer im gleichen Jahr der Name >Atheismus< unver-
zichtbar.
Wir nennen uns Atheisten; solange wenigstens mssen wir uns auch diesen Namen der
Verneinung beilegen, als es nottut, gegen die Aufdringlichkeit der Religion uns zu wehren,
und als es noch nicht lcherlich geworden ist, gegen die Vergangenheit und die Gefangen-
schaft, die bisher als die Bestimmung der Menschheit galt, zu protestieren.
195
Die mikroskopische Suche nach Resten von Religion hat soziologisch betrachtet
den Auflsungsproze der Gruppe zur Folge. Das Verfahren erinnert zwar an die
gesteigerte Aufmerksamkeit glubiger Sekten, die berall, auch in feinsten Spuren,
das Wirken bser Mchte vermuten, aber der junghegelianische Kampf gegen die
Religion hat nichts Einigendes, im Gegenteil: er ist der wuchernde Spaltpilz der
Gruppe. Der religise Rest wird gleichsam von Hand zu Hand gereicht, ausgesto-
en und hereingeholt. Er kursiert in einer geschlossenen Kette von Tauschakten. In
diesem gegenseitigen Tausch, in dem der eine seine befreite Position gegen die
Unfreiheit des anderen austauscht, verdampfen die gnostischen und chiliastischen
Muster. Die Erlsung durch Wissen wird zur leidenschaftlichen Sophistik, und das
Jngste Gericht ist nur noch ein komisches Motiv.
196
Wenn K. Korsch spter von der Marxschen Theorie sagen wird, da die ber-
windung der Religion selbst noch die Form einer Religion habe
197
, so trifft er damit
sicherlich einen Aspekt, der gerade fr die Junghegelianer zutrifft, die relativ frh
die religionskritische Debatte fr beendet erklren. Der Vorwurf des Nihilismus
bzw. des Sophismus wird die treffen, die nicht auf die Extermination auch der
nachwachsenden Gtter verzichten wollen. Dies ist aber eine Frage der Wirkungs-
geschichte.
Fr den Gruppenzusammenhang liegen die Probleme noch etwas anders. Die
Frage stellt sich: wie ist Skularisierung in dieser Gruppe mglich? Wer einer reli-
gisen Gemeinschaft angehrt und sprt, da seine Einstellungen sich verweltli-
chen, wird aus der Kirche oder der Gemeinde austreten. Und der Austritt aus der
388
Kirche war ja auch - wie erinnerlich - das groe provokative Thema der >Freien<.
Kann aber eine Gruppe, die Religionskritik treibt, deren Mitglieder mit der Kon-
fession des Atheismus< umhergehen, sich skularisieren? Brche der Selbstdeutung
der Gruppenmitglieder sind hier unvermeidlich. Denn fr die >konsequenten Jung-
hegelianer< bleiben nur zwei Mglichkeiten: entweder war die Gruppe immer und
von Anfang an ein skulares Unternehmen, dann ist die Hrte der Religionskritik
in den eigenen Reihen schwer verstndlich, oder die Gruppe war doch so etwas wie
eine unsichtbare Kirche, dann hatte die Religionskritik die Funktion, sie noch
unsichtbarer zu machen.
Die eine Deutung wchst sich aus zu der These, auf einer tieferen Ebene sei es
den Junghegelianern gar nicht um die Kritik der Religion gegangen, sondern diese
sei nur ein der Gruppe verfgbares Substitut fr skulare Probleme gewesen. Die
andere Deutung entdeckt gerade in der Verlagerung und im Austausch des religi-
sen Restes< die Kontinuitt eines sich transformierenden, neu verkleidenden Got-
tes, eine Kontinuitt, die es zu erkennen gelte, um die Kritik der Religion zu vollen-
den. Entweder es bleibt ein >Rest< als gespensterhafter Schatten, der das Bewut-
sein vernebelt, oder unter diesem Rest liegt eine skulare >letzte Instanz<, die das
Ma der Verhaltensmglichkeiten bestimmt.
Alle Typen junghegelianischer Gruppenbildung sind bergangsformen. Daher
wre diese Alternative nur dann zu entscheiden, wenn man die Spezifitt einer
bergangssituation auer acht liee. Im Moment des bergangs jedoch sind beide
Alternativen koprsent, durchkreuzen sich und tauschen einander aus. Dieser Grup-
penzustand ist weit entfernt von einer lhmenden Paralyse, im Gegenteil fhrt
gerade die Nichtentscheidbarkeit zu einer Vertiefung und Anreicherung der gegen-
stzlichen Positionen, die ohne diese spezifischen bergangszustnde der Gruppe
gar nicht denkbar gewesen wre.
8. Gewiheit und Gruppe
Wenn es eine >Konsequenz< in der Gruppe der Junghegelianer gibt, in einer Intel-
lektuellengruppe, fr die Konsequenz ein zentraler Wert ist, so ist es die Konse-
quenz der Auflsung. Konsequent ist die Forderung Herweghs, man msse die
Freiheit bis zum Wahnsinn lieben
198
, und konsequent ist die Einsicht B. Bauers,
da die Verrcktheit des Geistes wissenschaftlich nicht widerlegt werden
kann.
199
An der Forderung wie an der Einsicht haben mehr oder weniger je nach
Temperament alle Junghegelianer festgehalten. Jeder stand vor dem Problem der -
wie es Rge hegelianisch formuliert - Aufnahme der absoluten Mchte des Gei-
stes ins Gemtsinteresse und in den Willen, und Rge nannte dies eine intensi-
vere und hhere Religiositt.
200
Ich mchte dies >Gewiheit< nennen - ein Termi-
nus, der fr den Soziologen mehr aufschlieen kann, wenn er sich an L. Wittgen-
steins Bemerkung hlt: Die Gewiheit ist gleichsam ein Ton, in dem man den Tat-
bestand feststellt, aber man schliet nicht aus dem Ton darauf, da er berechtigt
ist.
201
Der Ton der Gewiheit ist in der junghegelianischen Rhetorik kaum zu
berhren. Wer in der Gruppe erfolgreich mitmusizieren will, mu diesen Ton
anschlagen.
389
Die Gewiheit der Junghegelianer ist mehrdimensional. Zunchst weist sie auf
einen >religisen Unterbaue ein Erbe Hegels, der die Gewiheit des Glaubens mit
der Gewiheit des Geistes identifizierte. Die Gewiheit der Junghegelianer hat
aber zugleich auch eine rationale Seite, wenn es um die Gewiheit des Wissens
geht. Sie verschaffen sich durch intellektuelle Arbeit eine Gewiheit der Kompe-
tenz, die sie nach auen und gegeneinander offensiv zur Schau stellen. Verzicht auf
Analyse, die glubige Hinnahme der Wahrheiten ist der Selbstmord des Geistes.
Die >Waffe der Gelehrsamkeit gibt Sicherheit.
202
Die Gewiheit bezieht sich aber
auch noch auf eine dritte Seite. Es ist die Gewiheit, in einem Bunde mit der
geschichtlichen Entwicklung zu stehen, sei es >objektiv<, indem Wandlungen der
Gesellschaft ihren Thesen besttigend entgegenkommen, oder >subjektiv<, da sie
selbst relevante Geschichte machen oder sie doch wenigstens entscheidend vorbe-
reiten.
Wie aber funktioniert Gewiheit, wenn sie nicht als Gewiheit eines einzelnen
in den Blick genommen wird, sondern wenn mehrere Individuen mit einer hnlich
strukturierten mehrdimensionalen Gewiheit eine Gruppe bilden? In diesem
Sachverhalt liegen viele Geheimnisse des Junghegelianismus beschlossen. Die
gegenseitige beredte oder schweigende Versicherung, da die sich kenntlich
machende subjektive Gewiheit akzeptabel ist, mchte ich >Sozialisierung von
Gewiheit< nennen.
Gehen wir den einzelnen Dimensionen nach. Wir hatten oben daraufhingewie-
sen, da unter religionssoziologischem Aspekt die religise Unmittelbarkeit eine
Seite des gnostischen Habitus darstellt, gleichsam den Gegenpol zur systematisch-
intellektualistischen Gotterkenntnis. Eine gegenseitige Versicherung von Heilsge-
wiheit und Glaubensgewiheit durch sakramentale Formen oder solche, die
daran erinnern, scheidet aus. Ohne diese Formen ist diese Ebene der Gewiheit
aber schwer zu sozialisieren, weil sie nur als eine je situative gegenseitige Anerken-
nung realisierbar ist. In den pathetischen Formulierungen, die gerade der Organi-
sator Rge gefunden hat, mgen fr die Gruppenmitglieder vielleicht kurze
Momente eines Gefhls von Integration der Gewiheiten auf dieser Ebene stattge-
funden haben.
Um von Dauer zu sein, htten diese Augenblicke auch einer tiefergehenden
Anerkennung bedurft. Aber der Gedanke einer Gemeinde der Wissenden ist in
der Gruppe nicht unangefochten, denn es lauert hier der junghegelianische Erz-
feind: die Dogmatik. Wozu noch denken? Die absolute Wahrheit ist ja gefunden,
jetzt gilt es daher, begeistert von ihr, das tausendjhrige Reich zu begrnden.
203
Und da gerade die religise Gewiheit der Gruppenbildung entgegen kommen
knnte, ist zweifelhaft, denn:
Religions-Differenzen - und zwar die reinen, wahren Religions-Differenzen, die Differen-
zen in dem reinen, geoffenbarten Religions-Glauben - sind ewig und unausgleichbar. Jede
Partei glaubt, der wahre Ausdruck des menschlichen Wesens zu sein, jede mu daher die
andere verleugnen, fr unmenschlich erklren und in der Entfremdung gegen sie so weit
gehen, bis sie ihr so fremd ist, wie eine Tiergattung der anderen.
204
Kann die Gewiheit des Wissens in einer Gruppe sozialisiert werden? Betrach-
390
ten die Junghegelianer das religise Bewutsein in erster Linie als ein individuelles,
gemtvolles Phnomen, so ist fr sie Vernunft und Kritik ein kollektives Phno-
men. Gewiheit des Wissens ist von vornherein eine Gruppenangelegenheit. Hier
knnte Ruges Idee von der geistigen Demokratie wirksam werden. Besser als
situative glubige Unmittelbarkeit knnen die Prozesse der Kritik gruppenfrder-
lich sein, zumal hier Formen der Versachlichung mglich sind. Sozialisierbar wre
die kritisch sich vergewissernde Gewiheit des Wissens, wenn in der Gruppe gilt:
Willkr - ( . . . ) solch eine tyrannische Macht wrde bald aus der Republik der
Wissenschaft hinausgeworfen werden. Es ist vielmehr das Charakteristische der
Kritik, da sie sich ganz genau - sie allein ganz genau - auf das Wesen der Gegen-
stnde einlt und dasselbe erklrt.
205
Welchen Modus der Kritik setzen die Junghegelianer voraus? Die Kritik erkenne
nichts, nichts von vornherein als wahr an, ja, sie richtet sich gerade gegen alles das,
was darum weil es ist, heilig, unverletzlich und der Vergnglichkeit entzogen sein
will.
206
Dieser Modus der Kritik richtet sich nicht nur nach auen, sondern wird
auch innerhalb der Gruppe praktiziert, denn es besteht die Gewiheit, da - wie
B. Bauer schreibt - eine Unternehmung deshalb nicht glcklicher wird, wenn
zufllig zu ihr zusammenkommende fr einen Augenblick ihre Differenzen verges-
sen.
207
Die Kritik richtet sich gegen sich selbst und ihre eigenen Anhnger, denn
um Verbndete ist es der Philosophie nicht zu tun.
208
Dieser Modus der Kritik fhrt zu dem, was man >Narzimus der kleinsten Diffe-
renz< nennen knnte. Versachlichung beruhigt das Gruppenfeld keineswegs. Die
Genauigkeit der Kritik entdeckt fortlaufend Widersprche und Risse, die zur Spra-
che gebracht werden mssen, um nicht sachlich ungenau zu werden. Das soziologi-
sche Problem der Gewiheit des Wissens besteht darin, da sie sich nur in einer
sachlich argumentierenden Gruppe einstellen kann, da aber die diskutierte Sache,
als symbolische Wirklichkeit, der Zeit entrissen werden mu. Es sind endlose Dis-
kussionen, die die Junghegelianer fhren.
Die Zeit, die sich die Gruppe nimmt, hlt die Individuen zusammen, auch wenn
sie, dem Narzimus der kleinsten Differenz folgend, heillos zerstritten sind. Wie
wir oben im Zusammenhang der philosophischen Schule errtert haben, verhin-
dert jedoch die dialektische Logik, die jeder praktiziert, (die Logik, differierende
Standpunkte als Einheit zu begreifen, we sie hegelianisch nur Momente einer
Sache sind), eine rasche Ausstoung von Positionen. Sich-in-Widerspruch-setzen
ist der >Moral< der Gruppe nicht abtrglich, sondern geradezu gruppenkonform.
Der Begriff >Toleranz< wre hier zu ungenau, denn in der junghegelianischen Argu-
mentation erscheint Toleranz nur als ein zeitweilig akzeptables Verhalten. Toleranz
belt die differenten Positionen im Kern, wie sie sind, und zgelt nur die Leiden-
schaftlichkeit der uerung. Was B. Bauer in anderem Zusammenhang formuliert
hat, kann auch fr die Gruppe gelten: Wir nennen es nicht mehr Toleranz, son-
dern: die aus dem Ha, aus znkischer Tobsucht und aus der Verfolgung in den
Begriff erhobene Dialektik der Gegenstze, die innerlich zusammengehren und
innerlich sich verstndigen mssen.
209
Warum funktioniert dieses Konzept nicht? Einen wichtigen Hinweis gibt G. Ju-
lius in seiner Charakteristik B. Bauers. Julius spricht psychologisch bei Bauer von
einem Vereinzelungstrieb. Dieser habe sich zunchst nur als negative Bezie-
hung auf Gegenstze dargestellt, aber er
391
mute endlich die positive Voraussetzung hervorkehren, nmlich da dieses bestimmte
Individuum das wahrhaft Allgemeine vertrete, da seine Ansichten Entscheidungen des
geschichtlichen Geistes seien. Mit dieser ungeheueren Zuversicht wchst auch die Hrte
gegen andere, die sich nicht unbedingt unterwerfen wollen, ihr Widerstand wird als in Ver-
finsterung und Beschrnktheit gegrndet, angesehen.
So erklrt sich fr Julius die Genauigkeit der Kritik, der Narzimus der kleinsten
Differenz:
Diese Weise hat sich immer bei Bauer erhalten, da er, um seine Selbstndigkeit, seine Ein-
zigkeit zu wahren, den ihm am nchsten stehenden Standpunkt zum Gegner hinberschiebt
und als die eigentliche Vollendung des Gegensatzes ansieht; die nchste Nhe wird solcher-
weise zur ungeheuersten Ferne.
210
Dasselbe kann man auch von anderen Gruppenmitgliedern sagen. Feuerbach
und Marx, He und E. Bauer, Stirner und B. Bauer, und wie immer man die Paare
zusammenstellen mag, sie trennen nicht ganze Welten, sondern sie trennt eine win-
zige Differenz. Ihre gegenseitige Polemik ist notorisch haarspalterisch. In der
Gewiheit des Wissens liegt ein abgrndiges Paradox, auf das Julius aufmerksam
macht:
Man wrde hier allerdings mit Recht von Selbstvergtterung reden knnen, nie scheint sie
entschiedener, zuversichtlicher hervorgetreten zu sein, denn nicht nur die allgemeine
Ansicht, sondern jede einzelne uerung derselben wird als untrglich gestempelt. Aber
andererseits ist diese Selbsterhebung auch Selbstverleugnung, die nichts wissen will, als was
der Gegenstand selbst gibt, nichts Apartes, nichts Besonderes.
211
Wo die Gewiheit des Wissens sozialisiert wird, entstehen zwei gegenlufige
Bewegungen. Eine Bewegung der >Entindividualisierung<: nur die Sache zhlt, ver-
sachlicht wird alles, nicht zuletzt die Wandlungen in den Auffassungen, die zur
>Identitt< gehren. Es kann vergessen werden, wer da jeweils spricht. Wert hat,
was an den Stzen, die fallen, mit der symbolischen Wirklichkeit der Sache harmo-
nieren knnte. Die >Selbstverleugnung< hrt auf, wo ich mich erinnere, da ich es
war, der diese Stze sagte, die - wie mir die Zeichen der anderen signalisieren - mit
der symbolischen Wirklichkeit der Sache fr einen Augenblick harmonierten.
Diese Erinnerung erfllt mich mit einer erhebenden subjektiven Gewiheit, die um
so grer ist, je mehr ich mich zuvor, mich selbst verleugnend, der Sache >hingege-
ben< hatte.
Diese Gegenlufigkeit von >Selbsterhebung< und >Selbstverleugnung< passiert
allen in der Gruppe, sofern sie angespannt diskutieren. Wer aussteigt, mu sich -
sofern er nicht glaubhaft machen kann, da er zu mde zum Weiterdiskutieren ist
- den Vorwurf der Nichtauflsungswilligkeit von Bornierungen gefallen lassen,
den er nur entkrften kann, wenn er wieder in den Proze einer Extermination aller
Bestimmtheiten an sich selber einsteigt. Da ich aber nicht genau wei, wann in der
Ewigkeit der Debatte der andere sich >erhebt< oder sich >verleugnet<, ist die Gewi-
heit des Wissens in ihren eigenen Bewegungsformen nicht sozialisierbar. Andere
soziale Einrichtungen mssen hier zu Hilfe kommen, die der sachlichen Debatte
entzogen sind.
Ist die dritte Ebene der Gewiheit, die geschichtsphilosophisch fundierte
392
Gewiheit, eher dazu geeignet, die Gruppe zusammenzuhalten? Auf den ersten
Blick knnte man dies annehmen. Im Bunde mit dem Fortschritt, dem Weltgeist zu
sein, in dieser Gewiheit knnen Gruppenspannungen auf die, Zukunft verlagert
werden. Und in ihren letzten utopischen Trumen finden sich kaum Differenzen in
der Gruppe. Bei allen ist das Ziel die Emanzipation der Menschheit, deren
geschichtliche Notwendigkeit auer Frage steht. Sie sind sicher, in einer revolutio-
nren Zeit zu leben, die ihren Gedanken entgegenkommt, und sie sind sicher,
Avantgarde zu sein. Dennoch bleibt die Frage, ob die Umgangsweisen mit der Kon-
tingenz der Zukunft kollektivierbar sind. Fr Rge gehrt die ganze Strke der
Philosophie dazu, an die Realisierung der Vernunft mitten in der Unvernunft zu
glauben. Um diese im religionskritischen Terrain des Jahres 1843 etwas unpas-
sende Formulierung zu bestrken, setzt Rge hinzu: Wir meinen dies ernst-
lieh.
212
Woher kommt die >Kraft< fr die geschichtsphilosophische Gewiheit vom
schlielichen Sieg der Vernunft? Sie zehrt von einem Widerspruch:
Es ist offenbart, aber es ist verborgen nach wie vor. Dieser Widerspruch ist der Trieb der
Geschichte, diese Not die Lust des Kampfes, seine Phasen die Probleme der Zeiten, ihre
Lsung die Jubelperioden groer Siege, und das Mitgefhl dieser Kmpfe, dieser Zweifel
und dieser Siege die Religion und die hchste Befriedigung des Menschen.
213
Die geschichtsphilosophische Gewiheit allein wre kaum durchzuhalten, wenn
nicht die Befriedigung im Mitgefhl der geschichtlichen Kmpfe hinzutritt.
Anders geht E. Bauer mit dem Problem um. Er schliet sein Hauptwerk mit den
Worten:
Und wenn Ihr sagt, unsere Theorien mchten sich vielleicht in zweitausend Jahren, wenn
die Menschheit eine ganz andere geworden ist, verwirklichen, so antworten wir: geschichtli-
che Ereignisse lassen sich nicht nach Jahreszahlen berechnen: und wenn manchmal hundert
Jahre der Tyrannei und Stumpfheit die Menschheit kaum merkbar vorwrts brachten, so ist
oft ein Jahr hinlnglich, durch neue Gedanken einen Umschwung anzuregen und hervorzu-
bringen. Die Tage wiegen, aber zhlen nicht - das ist der Trost des freien Mannes.
214
Mit diesen beiden Positionen ist die Spannbreite der Mglichkeiten geschichts-
philosophischer Gewiheit angegeben. Entweder kontinuierliche Teilnahme an
der Geschichte, dauerndes Mitgefhl, oder qualitative Zeitwahrnehmung von
Tagen, die zhlen, und solchen, die nicht zhlen. In dieser Spannbreite ist
geschichtsphilosophische Gewiheit eher gruppenzersetzend als einheitsstiftend.
Denn der, fr den sich diese Gewiheit im kontinuierlich mitgefhlten Tageskampf
realisiert, mu dem, fr den es eine qualitative geschichtsphilosophische Zeiterfah-
rung gibt, als ein nur zeitweilig Mitbeteiligter erscheinen. Umgekehrt kann letzte-
rem die hchste Befriedigung in der Kontinuitt des Kampfes geradezu als eine
Form von geschichtsphilosophischer Ungewiheit erscheinen, weil die Differenz
zwischen geschichtsphilosophisch relevantem Handeln und diffuser Betriebsam-
keit verwischt ist. Der Flaneur hlt sich bereit in der Langeweile seiner Tage, von
denen nicht gewi ist, ob sie zhlen oder nicht. Der kommunistische Agitator hat
jeden Tag etwas-zu tun.
Auf allen drei Ebenen von Gewiheit entwickeln die Junghegelianer Selbst- und
393
Gruppendeutungen, die Gruppenkohrenzen fortlaufend unterminieren. Den-
noch stehen wir vor einem Paradox, wenn wir anerkennen mssen, da im Ver-
gleich zu anderen Gruppenbildungen sich die Junghegelianer gerade durch die
Intensitt und Dichte ihres Zusammenhangs auszeichnen. Sich aus diesem Zusam-
menhang zu lsen, hat allen enorme Anstrengungen abverlangt, Anstrengungen,
von denen bemerkenswerte Partien noch heute fr diskutabel gehalten werden
knnen.
Das Beispiel Marx ist sicher das bekannteste. Sein stufenweiser Lsungsproze:
die Trennungen von B. Bauer, von Feuerbach, von E. Bauer und Stirner, von He
und Rge haben mageblich das profiliert, was als seine Leistung in die Geschichte
eingegangen ist. - B. Bauers Trennung von den Junghegelianern, die 1844 mit der
Forderung nach der >Einsamkeit der Kritik< beginnt, erforderte nicht weniger
Anstrengung. Das Resultat der Trennung ist ein anderes als bei Marx, aber nicht
weniger beeindruckend. Die Figur des >Einsamen Kritikers< ist fr sptere Genera-
tionen, fr Nietzsche ebenso wie fr Adorno, stilbildend geworden. - Stirners
Abrechnung mit den Junghegelianern in >Der Einzige und sein Eigentum< gab nicht
nur Marx und Engels den entscheidenen Ansto zur Konturierung ihres histori-
schen Materialismus, seine Denkfiguren, nach 1848 vergessen, sind von existentia-
listischen Philosophen des 20. Jahrhunderts wieder aufgegriffen worden, nachdem
die literarische Boheme zu Beginn dieses Jahrhunderts in ihm ihren Apostel gefun-
den hatte.
Die Reihe liee sich fortsetzen, aber die Wirkungsgeschichte junghegelianischer
Ideen ist nicht das Thema dieser Arbeit. Bleibt zu fragen, warum die Lsung von
der Gruppe so schwer war, warum solche intellektuellen Leistungen vollbracht
werden konnten und muten, um mit den Verbindlichkeiten der Gruppe zu bre-
chen oder sie zu berwinden.
Vielleicht kann einer der spten Junghegelianer, Karl Schmidt, hierber Aus-
kunft geben. K. Schmidt schliet sich als Student den Junghegelianem zu einem
Zeitpunkt an, da die Gruppenaktivitten schon ihre ersten Hhepunkte hinter sich
hatten. 1843 ist ihm Hegel der Gott des Denkens, er strzt sich in die Lektre:
Fast Tag und Nacht habe ich seit einem halben Jahre Hegel studiert und - ich
glaube jetzt einen Schritt in's Heiligtum getan zu haben. 1844 wird seine Gewi-
heit gebrochen, er schreibt in sein Tagebuch, da Strau gegen Hegel Recht habe.
Er geht ber zu Feuerbach, kritisiert ihn und verfolgt intensiv die Wendungen der
Debatte.
215
Das Resultat erscheint 1846 anonym unter dem Titel Das Verstandes-
tum und das Individuum.
K. Schmidt zeichnet die Logik der Gruppenauseinandersetzungen akribisch
nach: Der Lehrer der Schule, Hegel, sei der Gipfelpunkt der Philosophie, aber er
habe auch die Schlange am Busen erwrmt und genhrt, die ihn und mit ihm alle
Philosophie mit giftigem Todeshauche treffen mute. Er war als der absolute Philo-
soph zugleich die Negation der Philosophie.
216
In der Konsequenz der Kritik
berwinden sich alle Standpunkte sukzessiv: Strau'>Leben Jesu<, B. Bauers Evan-
gelienkritik, Feuerbachs Religionskritik, die Debatte um die Judenfrage, E. Bauers
Kritik des Staates, die reine Kritik der ALZ, Marx' und Engels' Kritik der kriti-
schen Kritik, Feuerbachs Humanismus, Stirners >Einziger<, - sie alle bilden eine
Kette von berwindungen. Die junghegelianische Kritik ist fr K. Schmidt ein
394
nicht enden wollender Proze. Wie aber kann mit ihm selbstgewi abgerechnet
werden?
Was K. Schmidt aufzeigen will, ist die Logik des Verstandestums. Der Kritiker
darf sich nie irren und nie geirrt haben, weil er nichts Apartes, nicht Selbstndiges, nichts
Besonderes, nichts Einzelnes ist, weil er sich selbst verleugnet und in seinem Sprechen nicht
mitspricht, weil er alle Endlichkeit und Beschrnktheit aufgegeben und sich ergeben und
hingegeben hat an die heilige Gttin >Kritik<. -
>Der Kritiker< war der Totengrber der alten Zeit, der Totenanzeiger von dem, was kein
Leben mehr hatte. Er ward von dem allgemeinen Tode, der ber den Erdkreis ging, nicht
erwrgt, bis der Tod Alles erfat hatte und der Kritiker gestorben war, weil er nichts mehr
zu begraben hatte. - Die Kritik ist der Tod, der alles alte und morschgewordene Leben ver-
zehrt; hat er's verzehrt, dann ist er selbst nicht mehr. Sie ist der Weg, der passiert werden
mute, um den siebenten Himmel, die Geistigkeit in Person, die Heiligkeit in ihrem vollen
Pathos, das Geister- und Verstandestum in seinem ganzen Umfange und damit und dadurch
die ebene Erde zu erreichen: wer aber immer passiert, kommt nimmer an!
Halt! . . .?
11
Halt!, d. h. Gewiheit ist fr K. Schmidt nur im Bruch mit der Gruppe zu
erreichen, in einer Gewiheit, die sich den Gruppenzumutungen der Kritik verwei-
gert. Im Bruch wiederholt er noch einmal die Geste Stirners:
Ein Ruck tut Mir die Dienste des sorglichsten Denkens, ein Recken der Glieder schttelt
die Qual der Gedanken ab, ein Aufspringen schleudert den Alp der religisen Welt von der
Brust, ein aufjauchzendes Juchhe wirft jahrelange Lasten ab. Aber die ungeheure Bedeutung
des gedankenlosen Jauchzens konnte in der langen Nacht des Denkens und Glaubens nicht
erkannt werden.
218
Aber konstitutiert der Bruch nicht doch wieder einen Zusammenhang? Ist nicht
auch Stirners gedankenloser >Einziger< wieder nur eine Fortsetzung des >Verstan-
destums<? Und ist das >Individuum<, das K. Schmidt nach seinem Halt! im zwei-
ten Teil seines Werkes all dem entgegensetzt, nicht auch eine Verlngerung des kri-
tischen Prozesses? Wie aus den >Gesetzen< der Gruppenkommunikation heraus-
kommen?
K. Schmidt hat dies Problem in einer Weise gelst, die deutlich macht, welche
Dramatik das Verhltnis von Gewiheit und Gruppe bei den Junghegelianern
erreicht hatte. Sein Bruch endet mit einer Wendung an die perspektivischen jung-
hegelianischen Kritiker:
Du meinst, ich habe nun >erklrt<, was das Individuum sei, und Du wollest mich nun wie
einen Dogmatiker oder Kritiker zerledern und zerfleischen. Nimm Dir die Mhe nicht.
Oder ich will Dir die Mhe nehmen, wenn ich sage, da das Individuum nicht Individuali-
tt ist, weil >Individualitt< das Extrakt aus dem Individuum, der Geist ist, sondern da das
Individuum nur die Beschreibung und Charakteristik eines, dieses ganz bestimmten Indivi-
duums war und auch nicht war. Ich nehme meine Charakteristik zurck, weil sie wahr und
falsch ist, weil ich in der Sprache und mit >der Sprache< eine Charakteristik dieses Individu-
ums nicht geben konnte, weil ich darin die absolute Flle und die absolute Leere des Indivi-
duums nicht erschpft, und weil mir nichts daran liegt, da Du >weit<, oder vielmehr viel
daran liegt, da Du >nicht weit<, ob ich bin und wer ich bin und wer ich nicht bin. Das Indi-
viduum ist die Kritik, nicht reine, nicht kritische, nicht historische, sondern individuelle,
395
eigene, einzige Kritik. Das Individuum ist nicht zu fassen und nicht zu haben, steht keine
Rede und keinem Rede. >Ich bin ich selbst allein.<
219
Der auf mehrdimensionaler Gewiheit aufgebaute Gruppenzusammenhang
kann erst ohne Abstriche am erreichten Niveau der Sprachspiele verlassen werden,
wenn der Autor sich weigert, berhaupt noch Rede und Antwort zu stehen, wenn
er die Spannungen zwischen sozialisierbaren und nicht sozialisierbaren Elementen
der Gewiheiten annulliert. Und um das Ma voll zu machen und keinen Zweifel
an der Ernsthaftigkeit seiner Annullierung aufkommen zu lassen, verffentlicht
K. Schmidt in der von den Junghegelianern erbittert angefeindeten EKZ Heng-
stenbergs eine Rezension seines Buches.
220
K. Schmidt bezeichnet sein eigenes Buch als einen Beitrag zur Geschichte -
menschlicher Narrheit. Es sei an sich allerdings nicht wert, da man auch nur ein
Wort darum verlieren sollte, geschweige denn die Durchlesung desselben zu emp-
fehlen. Hchstens sei es ein Kompendium fr die Geschichte der neuesten Philo-
sophie, die eine philosophische Komdie von 1835 bis 1845 darstelle. Das hal-
tungslose Subjekt schuf Hirngespinste und zerstrte diese ebenso schnell wieder.
Endlich wird es an sich selbst und seinem Geist irre. Die Selbstrezension schliet
mit den Worten: Die Philosophen wrden sich knftighin einen Wald zum Auf-
enthalte whlen, und da mit Gebrdenspiel (!) eine Unterhaltung fhren, wenn
auch dies nicht Inkonsequenz wre.
221
Selten hat ein Autor sein Werk zugleich mit seinem Erscheinen wieder annulliert.
Von Verrat gegenber der Gruppe zu sprechen wre viel zu ungenau. Der Verrat
an den Gruppenprinzipien ist in allen bergngen und berlagerungen der Grup-
pendefinitionen prsent und manifest gewesen. Diese >absurde< Tat hat auch wenig
mit dem >Unsinn machen< der Boheme gemein, die >ber alles hinaus< ist. Eher ist
an eine Konversion zu denken. Jedenfalls sprechen K. Schmidts nachfolgende
Arbeiten davon.
222
Kann das Phnomen >Konversion< in einen sinnvollen Zusammenhang mit den
errterten Problemen, mehrdimensionale Gewiheiten zu sozialisieren, gebracht
werden? Ntig wre, zunchst angesichts der Konversion den Blick nicht in erster
Linie auf den neuen Glauben zu richten und ihn in Korrespondenz mit der neuen
sozialen Figuration, in der der Konvertit sich bewegt, zu betrachten, sondern den
Blick auf das verlassene Gelnde zu richten.
Fr die Intellektuellengruppe, in der Argumente getauscht und zugleich Defini-
tionen entworfen werden, mit denen der Tausch begrenzt werden kann, stellt Kon-
version sich als ein Abbruch des Austausches und als ein Abbruch der Anstrengun-
gen dar, Begrenzungsregeln fr den Tausch zu finden und aufrechtzuerhalten.
Bezogen auf die Gewiheitsfrage vereinfacht der Konvertit die Mehrdimensionali-
tten, es scheint, als ob er vor dem Sozialisierungsproblem mit einer dramatischen
Geste kapituliert.
Aber diese Kapitulation - kann sie nicht auch als eine letzte Herausforderung
interpretiert werden, eine Herausforderung, mit der eine Entgrenzung des Tau-
sches erzwungen werden soll? Unser Erschrecken angesichts pltzlicher Konver-
sion, die mit einem >Identittswechsel< einhergeht, den wir auch aus der Nhe nicht
haben heraufziehen sehen, verweist vielleicht auf die dunkle Ahnung, da sich der
Tausch von Argumenten, die Begrenzungen der Diskurse, die gegenseitigen Befrie-
396
digungen der Gewiheit - da sich diese sozialen Formen und Prozesse um die
gegebene Unvorhersehbarkeit von Ereignissen lagern, die, gleich wie eine unerwar-
tete Konversion, nicht geheuer sind. Eine Soziologie von Intellektuellengruppen
hat nicht zuletzt dies Erschrecken der entspannten Vernunft zugnglich zu
machen.
Anmerkungen
1 Die einschlgige Literatur zu den religionsphilosophischen Debatten ist in der Einleitung
dieser Arbeit aufgefhrt. An dieser Stelle sei hingewiesen auf F. W. Graf, F. Wagner
(1982 b). Die Edition enthlt eine ausfhrliche Bibliographie. Aus der neueren theologi-
schen Diskussion ist zu nennen: F. Wagner (1976 a).
2 Bekanntlich wies Strau auf den Widerspruch in der Hegelschen Religionsphilosophie
hin, der mit der orthodoxen Deutung der Christologie gegeben sei. Auf der einen Seite
wrde Hegel behaupten, da sich das Wesen Gottes im Proze der Weltgeschichte ber-
haupt erst offenbare, auf der anderen Seite hielte Hegel aber an der Figur Christus als
Gott-Mensch und Verknder der absoluten Wahrheit fest. Strau folgerte nun aus die-
sem Widerspruch, da, wenn sich das Wesen Gottes im Laufe der gesamten Geschichte
sukzessiv prozehaft offenbare, der historische Christus logischerweise nur einen Teil
dieser Gesamtoffenbarung bilden knne. Die Konsequenz dieser Interpretation war, da
das, was in den Evangelientexten ber Christus gesagt worden ist, was als Konstituens
der christlichen Religion galt, eben keinen ewigen absoluten Wert mehr haben konnte.
Strau' berlegungen gingen aber noch weiter.
Wenn die Texte, in denen ber Christus berichtet wird, nur ein vorbergehendes
Moment der Gesamtoffenbarung waren, wie stand es dann berhaupt mit der Figur
Jesus Christus? Strau kam schlielich zu dem Schlu, da es ein Irrtum sei, zu glauben,
Jesus habe als Mensch tatschlich existiert. Die Evangelien waren fr Strau gleichsam
Schilderungen von Phantasie-Geschehnissen, die aus einer Art Kollektivbewutsein her-
vorgegangen waren. Gott war fr Strau nicht mehr der persnliche Jesus Christus, son-
dern ein quasi unpersnlicher Gott, philosophisch gesprochen: die Substanz der gesam-
ten Weltgeschichte, die sich hier im Christentum vorbergehend Mythen gebildet hatte.
Strau bestritt berhaupt die Mglichkeit, da sich Gott als Substanz in einer einzelnen
Person offenbaren knne. Den Christuskult interpretierte Strau als ein Symbol der Idee
der Menschheit, der Idee der Gattung. In vielen Punkten finden wir Gemeinsamkeiten
zwischen Strau und Feuerbach: der Strausche Substanzbegriff hat mit Pate gestanden
beim Feuerbachschen Materialismus ebenso wie Strau' Christologie (Christus als
Menschheitssymbol) fr den Feuerbachschen Begriff der Gattung und der Anthropolo-
gie.
B. Bauer greift Strau' Thesen auf, legt aber gegenber der Idee einer kollektiven
mythenbildenden Substanz mehr den Akzent auf die Verfasser der Evangelien als ein-
zelne Autoren. Nach umfangreichen Studien, die er in den Arbeiten >Kritik des Johan-
nes< 1840 und >Kritik der Synoptiker< 184142 verffentlichte, kam B. Bauer zu dem
Resultat, die Evangelien seien nur der jeweilige freie Ausdruck der Verfasser, also Mat-
thus, Markus, Lukas und Johannes. Hinter den einzelnen Evangelien stnden jeweils
deutlich unterscheidbare Einzelpersonen. Die Evangelisten seien aber nicht einfach nur
Chronisten, die etwas aufgeschrieben htten, was ihnen erzhlt worden wre, sondern
die Evangelisten seien gleichsam Schriftsteller oder Theoretiker, die das Christentum
schpferisch erfunden htten. Die Urchristen selbst htten nur ganz vage Vorstellungen
397
von Leben und Tod und Auferstehung Christi gehabt, die als kollektive Mythen existier-
ten, aber es sei die gedankliche Leistung des einzelnen Evangelisten gewesen, fr die
Gemeinden ein System von Aussagen zu produzieren, das ihren Intentionen und
zugleich der gesamten Situation der Zeit entsprach. Der einzelne Schriftsteller ist dabei
zugleich ein Moment des allgemeinen menschlichen Selbstbewutseins, das sich
B. Bauer zufolge in der Geschichte schrittweise entfaltet. Treffend hat R. Gottschall for-
muliert: B. Bauer kritisiert die Evangelien wie Produktionen schriftstellerischer Kolle-
gen in einer Literaturzeitung. (R. Gottschall, Die deutsche Nationalliteratur, 1872,
Bd. 2, S. 168)
In der religionsphilosophischen Differenz, Gott mehr als >Substanz< oder mehr als
>Selbstbewutsein< zu begreifen, liegt theoriegeschichtlich gesehen schon die Spaltung
der Gruppe in mehr auf Kollektivitt, >Gattung< und >Masse< bauende Emanzipations-
theoretiker und solche, die dem einzelnen produktiven kritischen Bewutsein den Vor-
zug geben.
Zum theologiegeschichtlichen Kontext vgl. A. Schweitzer (
6
1951); H. Weinel (1914);
E. Barnikol (1958). Wie sehr die christologische Thematik heute wieder ins Zentrum der
Auseinandersetzung zwischen Theologie und Soziologie rckt, zeigt der Beitrag von
F. Wagner (1976 b).
3 MEW Bd. 1, S. 378 und 379.
4 MEWBd. 3,S. 159.
5 H. Leo, Die Hegelingen, S. 43 und 5.
6 H. Marggraff, Deutschlands jngste Literatur- und Culturepoche, 1839, S. 355 und 424.
7 Ch. H. Weie, Die philosophische Literatur der Gegenwart. 2. Artikel, in: ZPsT 7
(1841) S. 108.
8 G. W. F. Hegel, Vorlesungen ber die Geschichte der Philosophie, Bd. 3, S. 171 f. Vgl.
K. Lwith (1964) S. 33.
9 A. Ruge, Sendschreiben anj. Grres, in: HJ 1838 Sp. 1195.
10 A. Ruge, Der Pietismus und die Jesuiten, in: HJ 1839 Sp. 287. U. Otto (1968) weist zu
recht darauf hin, da es sich bei der schlichten Gleichsetzung von Reformation und
Gedankenfreiheit um eine historische Illusion handelt (S. 36). Zu den vormrzlichen
Reformationsdeutungen siehe H. H. Brandhorst (1981).
11 A. Rge, SenschreibenanJ. Grres, Sp. 1199.
12 W. Vatke, Rezension: R. Rothe, Die Anfnge der christlichen Kirche, in: HJ 1838
Sp. 1147.
13 A. Ruge, Der Pietismus und die Jesuiten, in: HJ 1839 Sp. 275.
14 A. Ruge, Rezension: Friedrich der Groe und seine Widersacher, in: HJ 1840 Sp. 999.
15 EKZ 1840 Nr. 75 zit. nach: anonym, Der Jesuitismus der evangelischen Kirchenzeitung,
in: HJ 1840 Sp. 1967.
16 Alle Zitate, einschlielich des Autors der >Minerva<: A. Ruge, Bruno Bauer und die Lehr-
freiheit, in: An 1843, Bd. 1, S. 135 und 136.
17 anonym, Kritik und Partei, in: DJ 1842, S. 1177. Die Unsicherheit der Lokalisierung
der unsichtbaren Kirche im Felde der Philosophie wird deutlich bei Bayrhoffer: Die
bestehende Gemeinde der Idee, dieses Geisterreich, nennt man nun die Hegeische Schule,
welcher mithin jene Arbeit der allseitigen Offenbarung und Verwirklichung der Idee
obliegt. Auf den Ausdruck >Schule< ist kein Gewicht zu legen, da sich die Glieder der Idee
vielmehr als deren lebendiges Dasein, wenn auch mit individueller Beschrnktheit wissen.
So wie vielmehr die christliche Gemeinde und die Gemeinschaft der Geister keine christ-
liche Schule ist, so auch nicht die Gemeinschaft und Gemeinde der absoluten Idee, da sie
ihrem Wesen nach der Beschrnktheit der Schule entnommen ist, obschon allerdings
jeder auch hier eine Schule durchzumachen hat und viele nie ber die Schlerschaft hin-
auskommen. Die freien Mnner der absoluten Philosophie in ihrer Gemeinschaft mgen
398
und wollen lieber genannt sein als >Geisterreich der Idee<. (Bayrhoffer, Die Idee und
Geschichte der Philosophie, 1838, S. 487 f.).
Das Geisterreich ist bei Hegel der historisch lange Zug von Geistern, wie er sich in
der Geschi cht e der Phi l osophi e darst el l t . (G. W. F. Hegel , Vorl esungen ber di e
Geschichte der Philosophie, Bd. 3, S. 629) Mit Gemeinde der Idee versucht Bayrhf-
fer, eine synchrone Perspektive dem Hegeischen Begriff anzunhern. Fr die Rezensen-
ten handelt es sich dabei um eine neuralgische Stelle. Pfannkuch stt sich am unpassen-
den Ausdruck >Gemeinde der Idee< (in: JWK 1841, Nr. 51, Sp. 402), und der Erfurter
Schmidt urteilt: Hiermit haben wir ihm (Bayrhoffer, d. V.) zugleich unsere Ansicht aus-
gesprochen ber das >Geisterreich der Idee<, welches, so gl nzend auch der Ausdruck
gewhlt ist, so ngstlich auch das Prdikat der Gemeinde und der Schule zurckgewiesen
wird, doch zuletzt nichts anderes als Schule, ja nach der tiefern Eigentmlichkeit unseres
Verfassers zu urteilen, sogar Gemeinde bedeutet. Allein die Bahn der Philosophie liegt
hoch ber Gemeinden und Gemei nde, und schreitet geistesfrei und gei stesfroh ber die
Hupter der Schulen weg. (i n: HJ 1840, Sp. 560).
Bemerkenswert i st in diesem Zusammenhang die von Price (1963) gewhl te Formul ie-
rung invisible College fr eine informelle Gruppe von Wissenschaftlern, die sich wech-
selseitig konsultieren.
18 A. Ruge, Der christliche Posit i vismus und das Leben, in: HJ 1839 Sp. 2184. - Bezogen
auf di e prot est ant i sche Ki rche schrei bt B. Bauer: wi r werden ni e di e Mut t er , di e uns
geboren, gesugt und zuerst aufgezogen hat, vergessen, aber erwachsen sind wir in eine
hhere Schul e ber gegangen, i n di e Gemei nde der Wi ssenschaft und der Rel i gi on, di e
sich ber die Beschrnkt hei t der besonderen Kirche und Konfession erhoben hat . Nicht
di e l ut heri sche Ki rche, auch ni cht di e ref ormi ert e i st unt ergegangen, sondern nur di e
Schranke, die sie zu dieser besonderen Kirche macht, ist aufgehoben ( . . . ) . Das Unsterb-
liche beider Kirchen ist in uns auferstanden. (B. Bauer, >Landeskirche<, S. 14).
19 G. Julius, Der Streit der sichtbaren mit der unsichtbaren Menschenkirche oder Kritik der
Kritik der kritischen Kritik, in: WVjs 1845 Bd. 2, S. 330 f.
20 H. Holborn (1966) S. 94.
21 H. Stuke (1963) S. 74.-Seit dem Ende der 70erJahre zeichnet sich ein verstrktes Inter-
esse von Historikern an religionsgeschichtlichen Fragestellungen ab, das deutlich an die
rel i gi onssozi ol ogi sche Forschung und Theori ebi l dung anschl i et . Exempl ari sch sei en
zwei met hodologi sch-t heoret ische Arbeiten genannt: W. Schi eder (1977): R. v. Dl men
(1980). Eine historische Arbeit, die sich ausfhrlicher gerade mit den religisen >Intellek-
t uel l ensekt en< i n der er st en Hl ft e des 19. Jahrhundert s befat , st eht fr Deut schl and
noch aus. Fr Frankreich vgl. B. Viatte (1928).
22 J. Gebhardt (1963) S. 14.
23 Bei der Profilierung des gnostischen Habitus sttze ich mich auf: H.Jonas (1934);
G. Quispel (1951); C. Colpe (1961); K. Rudolph (1978). Der Schwerpunkt dieser Arbei-
ten liegt auf der Erforschung der Gnosis als einer sptantiken Religion. Das Ende der
Gnosis kann historisch in das 4. Jahrhundert gelegt werden.
Die Wirkungsgeschichte der Gnosis ist uerst komplex, teils finden Assimilierungen mit
christlichem Gedankengut statt, teils gehen gnostische Elemente in die freigeistige oder
hretische Spekulation ein. K. Rudolph (1978) bemerkt: Im einzelnen ist der Nachweis
historischer Kontiuitt schwierig zu fhren, da es sich vielfach um >unterirdische< Kanle
handelt oder um einfache ideengeschichtliche Konstruktionen von Zusammenhngen,
wie sie auf philosophisch-historischem Gebiet hufig vorgenommen worden sind.
(S. 392) Gnostische Zge finden sich bei den Bogomilen, deren Lehre seit dem 8. Jahr-
hundert zunehmend auch auf westeuropische Lnder ausstrahlt und die Ketzerbewe-
gungen des Mittelalters beeinflut. Hier finden komplexe Vermischungen von gnosti-
schen, mystischen und chiliastischen Systemelementen statt, die es erschweren, in jedem
399
Fall eine eindeutige Diskriminierung von gnostischen und chiliastischen Elementen vor-
zunehmen.
Weniger im Zeichen einer religionsgeschichtlichen Erforschung der Gnosis, als vielmehr
im Zeichen einer Kritik moderner Emanzipationsphilosophie stehen die Arbeiten von
E. Voegelin. Er greift ein allerdings zentrales gnostisches Systemelement heraus: die Erl-
sung durch das Wissen. Dieser Aspekt der gnostischen Soteriologie setzt auf die zu erken-
nende Identitt von realem Proze des Seins und der Erlsungsbewegung selbst. Diese
Bindung fhrt Voegelin zufolge zu einem nicht mehr auflsbaren Willen zur Beherr-
schung des Seins. Philosophie entspringt der Liebe zum Sein; sie ist das liebende Bem-
hen des Menschen, die Ordnung des Seins zu erkennen und sich auf sie einzustimmen.
Gnosis will Herrschaft ber das Sein; um sich des Seins zu bemchtigen, konstruiert der
Gnostiker sein System. Das System ist eine gnostische Denkform, nicht eine philosophi-
sche. (E. Voegelin (1958) S. 54) Die Erlsung durch das Wissen wird bei Voegelin abge-
setzt gegen das liebende Tun, das sich in der agnostischen christlichen Tradition verortet.
Vgl. auch: G. Sebba (1981)
Gegen die Thesen Voegelins hat H. Blumenberg (1974) neuzeitliches Denken als endgl-
tige berwindung der Gnosis dargestellt, nachdem der erste Versuch ihrer berwindung
am Anfang des Mittelalters milungen war. Die humane Selbstbehauptung der Neuzeit
grndet Blumenberg zufolge nicht in einer Skularisierung religiser Gehalte, sondern
wird als absoluter Anfang (S. 88) gefat. - Da die Gnosis-Diskussion keineswegs ein-
fach zu beenden ist, zeigen erneut die Beitrge in J. Taubes (1984).
24 K. Rudol ph (1978) S. 310; M. Weber (1964) S. 399; H. Ki ppenberg (1981).
25 Bei der Pr of i l i erung des chi l i ast i schen Habi t us st t ze i ch mi ch auf fol gende Arbei t en:
Zum mit t elalt erli chen Chil iasmus: B. Tpfer (1964); E. Benz (1934); A. Dempf (
2
1954).
Zum Gesamt kompl ex: W. Ni gg (1944) ; J. Taubes ( 1947); K. Lwi t h (
4
1961) ; E. Benz
(1973). Fr di e Rezept i on chi l i ast i scher El ement e i m deut schen Ideal i smus vgl . darber
hinaus: E.v. Sydow(1914); W. Christian (1961); E. Benz(1955 a). Zur neueren theologi-
schen Diskussion vgl. G. F. Borne (1979).
26 H. Grundmann (1950); H. Mottu (1980).
27 G. W. F. Hegel, Phnomenologie des Geistes, S. 20.
28 Hegel an Schell ing, Brief v. Jan. 1975, i n: J. Hoffmeister (Hg), Bri efe von und an Hegel,
Bd. 1, S. 18.
29 G. W. F. Hegel, Vorlesungen ber die Philosophie der Geschichte, S. 26 uznd 27.
In diesem Bestreben, den Endzweck der Geschichte zu erkennen, sind zwei religise Fra-
gen verflochten. Einmal geht es darum, die Einsicht zu gewinnen, da das von der ewi-
gen Weisheit Bezweckte wie auf dem Boden der Natur so auf dem Boden des in der Welt
wirklich ttigen Geistes herausgekommen ist. (Ebd. S. 20) Es handelt sich hier um das
Problem der Theodizee, der Rechtfertigung Gottes im Hinblick auf das bel in der
Welt, das geschehen ist. Im strengen Sinne ist der Theodizeegedanke nicht notwendig
mit dem chiliastischen Habitus verbunden, weil jener sich auf die Befriedung mit der Ver-
gangenheit, dieser darber hinausgehend mit der Projektion des zuknftigen Endzwecks
der Geschichte befat.
Bei Hegel erscheint nun in eigenartiger Weise der chiliastische Habitus zunchst nicht als
Verlngerung des Theodizeeproblems, sondern als dessen Voraussetzung., Wenn man
nmlich nicht den Gedanken, die Erkenntnis der Vernunft, schon mit zur Weltgeschichte
bringt, so sollte man wenigstens den festen, unberwindlichen Glauben haben, da Ver-
nunft in derselben ist, und auch den, da die Welt der Intelligenz und des selbstbewuten
Wollens nicht dem Zufall anheim gegeben sei, sondern im Licht der Sivu rissenden Idee
sich zeigen msse. (Ebd. S. 14) Dieser Glaube kann chiliastisch oder gnostisch verstan-
den werden, als >Sich-zeigen< in der knftigen Geschichte oder im erlsenden Wissen.
Da dieser Glaube im Widerstreit mit der skularen Form des Wissens steht, hat Hegel
400
deutli ch gemacht, indem er sich selbst als Phil osophen von diesem Glauben ausni mmt
und ihn zu einer motivationalen Quelle herabsetzt. Hegel fhrt unmittelbar fort: In der
Tat aber habe i ch solchen Gl auben ni cht zum voraus in Anspruch zu nehmen. Was ich
vorlufig gesagt habe und noch sagen werde, ist nicht blo, auch in Rcksicht unserer
Wissenschaft, als Voraussetzung, sondern als bersicht des Ganzen zu nehmen, als das
Resultat der von uns anzustellenden Betrachtung, ein Resultat, das mir bekannt ist, weil
ich bereits das Ganze kenne. (Ebd.) Hier hat die philosophische Lsung des Theodizee-
Problems den chiliastischen Glauben gleichsam aufgesogen.
Aber wie prekr diese Situation ist, zeigt der Fortgang der Argumentation, in der beide
Strnge erneut auseinandertreten: Es hat sich also erst aus der Betrachtung der Weltge-
schichte selbst zu ergeben, da es vernnftig in ihr zugegangen ist, da sie der vernnf-
tige, notwendige Gang des Weltgeistes gewesen, des Geistes, dessen Natur zwar immer
eine und dieselbe ist, der aber in dem Weltdasein diese seine eine Natur expliziert. Dies
mu, wi e gesagt , das Ergebni s der Geschi cht e sei n. Di e Geschi cht e aber haben wi r zu
nehmen, wie sie ist; wir haben historisch, empirisch zu verfahren. (Ebd.) Zwischen dem
Mssen des Endzwecks der Geschi cht e und i hr er hi nzunehmenden Fakt i zi t t , zwi -
schen chiliastischem Habitus und Rechtfertigung in einer Theodizee versucht Hegel eine
riskante Balance herzustellen.
30 B. Bauer, >Landeskirche<, S. 2.
31 K. Rosenkranz, Rezension: G. W. F. Hegel' s Vorlesungen ber die Philosophie der Reli-
gion, in: JWK April 1833 Sp. 566.
32 Eri nnert sei hi er nur daran, da i n Lessi ngs Er zi ehung des Menschengeschl echt s das
fi ori t i sche Geschi cht smodel l i n di e zent ral en Aussagen Ei ngang gefunden hat . Lessi ngs
Kritik der revolutionren Ungeduld< steht in einer langen Tradition. Charakteristisch
sein Hinweis: Vielleicht, da selbst gewisse Schwrmer des dreizehnten und vierzehnten
Jahrhunderts einen Strahl dieses neuen ewigen Evangeliums aufgefangen hatten, und nur
darin irrten, da sie den Ausbruch desselben so nahe verkndigten. (G. E. Lessing,
Gesammelte Werke, Bd. 9, 1856, S. 423)
33 Der Tbinger Hegelianer F. Ch. Baur verbindet in seinem Werk, Die christliche Gnosis,
1835, nicht nur Religionsphilosophie und Gnosis, fr ihn sind Schelling und Hegel
gleichsam die zeitgenssischen Reprsentanten einer kontinuierlichen gnostischen Spe-
kulation seit der hellenistischen Zeit. Zuvor erschien von Baur: Das manichische Reli-
gionssystem, 1831. Ob Jakob Bhme zu den Gnostikern zu rechnen ist, wie dies Baur tat
(vgl.: Die christliche Gnosis, S. 557 ff.), ist in den HJ umstritten. Fr einen Rezensenten
zeitgenssischer Bhme-Literatur ist Bhme Philosoph, die Gnostiker dagegen sind
Theologen. Die Gnostiker bemchtigen sich des Positiven als eines an sich unwahren,
verstandlosen Krpers, dem sie die Seele erst einhauchen (. . .), whrend Bhme seine aus
dem eigenen Innern entsprossenen Gedanken in die gegebenen Formen einer geoffen-
barten Religion hineingiet (Schnitzer, Rezension: W. L. Wullen, Jakob Bhmes Leben
und Lehre, in: HJ 1839 Sp. 2119). Die Differenz bezieht sich auf den Unterschied zwi-
schen freigeistiger und hretischer Spekulation, der sozial bedeutsam ist, weil mit ihm
unsichtbare Kirche< verschieden lokalisiert wird.
Einen interessanten rezeptionsgeschichtlichen Hinweis gibt Schnitzer, wenn er schreibt,
Bhme werde kaum erst seit 2 Jahrzehnten in dem Bereiche der Wissenschaft mit Ach-
tung genannt. Vorher sei er nur in asketischen Vereinen der niederen Klasse gekannt
und gelesen (. . .). Ref(erent) erinnert sich noch aus seinen Schuljahren, wie er als Lateiner
von zwei Verehrern Bhmescher Geheimnisse, beide Damastweber (!), um Erklrung
der fremden Ausdrcke in Bhmes Schriften angegangen wurde. (Ebd. S. 2108)
Bekanntlich war die Ketzerei bereits im Hochmittelalter gerade unter Webern weit ver-
breitet.
Aus der Flle von Aufnahmen chiliastischer Traditionselemente seien hier einige Zeilen
401
aus R. Gottschalls Gedicht Lehrfreiheit wiedergegeben. Auf die Gruppe der Junghe-
gelianer bezogen heit es:
Auf dem Tabor der Geschichte,
Mit verklrtem Angesichte,
Stehn die echten Gottgesandten,
Die Verjagten, die Verbannten,
Stehn in brnstigem Gebete
Hingewandt zur Morgenrte (. . .)
(R. Gottschall, Censur-Flchtlinge, S. 35)
ber die Arbeiten von Stuke und Gebhardt hinaus sei zu diesem Komplex hingewiesen
auf: P. Cornehl (1971); L. Krner (1979).
34 A. Ruge, Sendschreiben an J. Grres, in: HJ 1839, Sp. 1198 ff.
35 B. Bauer, Rezension: Th. Kliefoth, Einleitung in die Dogmengeschichte, in: An 1843,
Bd. 2, S. 150.
36 MEW Bd. 1, S. 391. - Wie aber knnte die Endzeit aussehen? In spekulativer Terminolo-
gie beschreibt sie Bayrhoffer: Ist die Vollendung im Ganzen erreicht, so entlt sich die
ganze Idee nur noch in die Unmittelbarkeit der Welt, hat Alles im Begriffe verklrt, aber
mit dem hchsten Losreien der Idee von der Welt hat sich auch der Erd- und Mensch-
heitsgeist allmhlich losgerissen von der Materie oder ist im Extreme dazu versenkt in sie
- und so hat sich die Weltgeschichte in dieser Bestimmtheit vollendet, die produktive
Kraft erlischt, der Greis stirbt - aber Gott lebt unendlich, und offenbart sich in ewig-
unendlicher Herrlichkeit stets von Neuem. Die Vollendung ist: Der Untergang der
Menschheit und der Erde al s Durchgang zu einem neuen Rei che der Ent wi ckl ung.
(K. Th. Bayrhoffer, Die Idee, 1838, S. 495 und 494).
Konkreter ist die Vision von G. Maurer. Seine Weltvershnung spielt in Paris, auf das
der erzrnte Gott als unmigste(n) aller Sammelpltze des Lasters herabblickt. Er
hrt die Stimmen der Staatsmnner, Weltweisen und reichen Lstlinge, die die Stim-
men der Armen bertnen. Eines Morgens erlischt die Sonne in einer vlligen Sonnenfin-
sternis. Das Entsetzen stieg von Minute zu Minute. Straen, Ufer und Spaziergnge fll-
ten sich mit Menschen an, die sich befragten, umarmten, sich ermutigten, oder miteinan-
der weinten. Der Starke lieh dem Schwachen seine Kraft; der verzweifelte Gelehrte bat
den Unwissenden um sein Dafrhalten. Jeder fhlte das Bedrfnis, sich an ein anderes
Wesen anzulehnen. Alles drckte sich die Hnde, Reiche und Arme ohne Unterschied
versammelt en sich in dem groen Bruderkreis. Damit begann die erste Frage der
Einigkeit und Gleichheit sich zu lsen. In den folgenden Tagen der katastrophischen
Dunkelheit lsen die Pariser sukzessive alle Konflikte und Spannungen untereinander
auf, und ei n junger Morgen l chelt e herab auf die wi edergeborene Menschheit .
(G. Maurer, Gedichte und Gedanken eines Deutschen in Paris, 1844, Bd. 2, S. 48-63,
ZitateS. 58 und 63).
37 A. Rge, Die Restauration des Christentums, in: DJ 1841, S. 609.
38 anonym, Zwei Vota ber das Zerwrfnis zwischen Ki rche und Wi ssenschaft, in: DJ 1842,
S. 29. Der Anonymus fhrt aus: Was unsere Vorvter, was die ganze bisherige Kirche
fr ein ueres, Fremdes, Jenseitiges, Zuknftiges, berweltliches, bernatrliches und
bermenschliches gehalten, ist seiner Wahrheit nach ein Inneres, Eigenes, diesseitiges,
Gegenwrtiges, Innerweltliches, Natrliches und Menschliches; ihr habt nicht zu warten,
bis es euch von auen eingegossen, bis die Wahrheit euch geoffenbart und die
Sittlichkeit
als Gnadengeschenk eingeflt werden wird; vielmehr habt ihr in euch zu gehen, in die
eigene Menschenbrust zu greifen, in Vernunft und Gewissen das Gttliche zu ergreifen
und von innen heraus zu gestalten -: frwahr, wenn diese Ansicht allgemein wird, dann
wird erst ein neues, freudiges, tatkrftiges Leben sich regen, und der Mensch wird ber
den Himmel nicht die Erde, ber der Zukunft nicht die Gegenwart verlieren, sondern das
402
Himmelreich wird Gewalt leiden, es wird auf die Erde herabgezogen und eben damit die
Erde zum Himmel erhoben werden; die Seli gkeit wird gegenwrtiger Genu werden.
(Ebd.)
39 A. Ruge, die Restauration des Christentums, in: DJ 1841, S. 619.
40 Ebd. S. 610.
41 L. Buhl, Der Beruf der preuischen Presse, 1842, S. 5.
42 LFW Bd. 3, S. 322.
43 A. Ruge, Rezension: D. F. Strau, Die christliche Glaubenslehre, in: HJ 1840, Sp. 2494.
Die folgenden Zitate Ebd.
44 (E. Bauer), Das Juste-Milieu. Erster Artikel, in: RhZ 156 v. 5. 6. 1842 (Beiblatt).
45 A. Rge, Wer ist und wer ist nicht Partei?, in: DJ 1842, S. 192.
46 (K. R. Jachmann), Preuen, in: EB 1843, S. 14.
47 Da den Junghegelianern der historische Zusammenhang zwischen den nachreformatori-
schen Religionskri egen und den Anfngen der Parteibi ldung i n England durchaus ver-
traut ist, zeigt Rutenbergs Artikel ber Radikalismus im Rotteck-Welckerschen Staats-
lexikon.
48 K. Rosenkranz, Rezension: G. W. F. Hegel' s Vorlesungen ber die Philosophie der Reli-
gion, in: JWK 1833, Sp. 568.
49 M. Weber (1964) S. 318, auch S. 179.
50 A. Ruge, Rezension: D. F. Strau, Die christliche Glaubenslehre, in: HJ 1840 Sp. 1000
und 1001.
51 W. Hieronymi, Die Hegelianer als Lichtfreunde, 1847, S. 12 und S. 33, Bayrhoffer zit.
Ebd.
32 (I. H. Fichte), Die philosophische Literatur der Gegenwart. 5. Artikel, in: ZPsT 9 (1842)
H. 1, S. 137.
53 C. Ascheri (1969) S. 77 f. , auch S. 102. - Wie sich Feuerbach in der gnostischen Tradi-
tion verortet, zeigt sein Verweis auf den spanischen GnostikerPriscillianin der Auseinan-
dersetzung mit Leo (LFW, Bd. 2, S. 270 f.). Auf dem >Leipziger Konzil<, das Marx und
Engels entwerfen, mu sich Feuerbach wegen ei ner schweren Anklage des Gnostizis-
mus verantwort en. (MEW, Bd. 3, S. 79)
54 LFW Bd. 3, S. 118, 119 und 121. - Bei spi el e f r di ese Hervorkehr ung al t chr i st l i cher
Prinzipien finden sich bei Feuerbach zuhauf. Von christlichen Mineralogen fordert er:
Wi e wr di g ei nes chr i st l i chen Mi ner al ogen, nur i n der Anschauung der St ei ne des
himmlischen Jerusalems oder des Tempels Salomonis zu leben! - In der Tat, warum sollte
der christli che Mineralog, wenn auch nicht all e Steine unserer lieben Erde in der Bibel
enthalten sind, sich nicht demtig auf die Steine beschrnken, welche in der Bibel enthal-
ten sind, aber dadurch allein schon einen unendlichen Wert in den Augen des christlichen
Mineralogen haben? (LFW, Bd. 2, S. 280 f. )
55 LFW Bd. 2, S. 266 und 267. - H. Blumenberg (1974) fat Ambivalenzen, wie die hier
behandelten, als rhetorischen Stilwillen auf, der ganz in den Bereich sthetischer Selbstar-
tikulation des neuzeitlichen Bewutseins falle. (S. 199 ff.) Den Streit, ob es sich um echte
Glubigkeit oder um ein sthetisches Spiel handelt, kann der Soziologe ein Stck weit
erhellen, wenn er die Selbstdefinitionsanstrengungen einer interagierenden Gruppe in
den Blick nimmt.
36 E. Bauer, Der Streit der Kritik, 1843, S. 63.
57 LFW Bd. 2, S. 317.
58 B. Bauer, Rezensi on: Bremi sches Magazi n fr evangel i sche Wahrhei t gegenber dem
modernen Pietismus, in: An 1843 Bd. 2, S. 114.
59 A. Ruge, Das Selbstbewutsein des Glaubens oder die Offenbarung unserer Zeit, in:
DJ 1842, S. 580.
60 Auf das gravierende Forschungsdefizit im Bereich der Fragen des Verhltnisses von Kir-
403
ehe, Gemei nde und Gesel l schaft i m Vormrz hat R. v. Thadden (1983) auf merksam
gemacht . So habe sich z. B. die Erforschung des Liberalismus berwiegend auf dessen
verfassungs- und gesellschaftspoli t i sche Vorstellungen konzentriert und kirchenpolit i-
sche Fragen kaum bercksichtigt (S. 95). Wichtige Anregungen fr meine Problemstel-
lung verdanke ich R. v. Thadden (1980).
61 J. Schmidt, Geschichte der deutschen Literatur, 1855, Bd. 3, S. 383.
62 Th. Mundt , Gr r es und di e kat hol i sche Wel t anschauung, i n: Der Fr ei haf en 1 ( 1838)
H. 2, S. 193.
63 H. Merz, Philosophie, Christentum und Kirche, in: Der Freihafen 4 (1841) H. 4, S. 18.
Merz sympathisierte zunchst mit junghegelianischen Ideen und konvertierte dann zum
Neupietismus. Zwischen ihm und den Tbinger Junghegelianern kam es zu einer ffent-
lichen Fehde. Vgl. E. Zeller, Zur Charakteristik der modernen Bekehrungen, in: JG 3
(1845), S. 14-32. Weitere Beitrge zu dieser Affre, die typisch fr die Konversionspro-
blematik und ihre Bewltigung in Intellektuellengruppen ist, finden sich im gleichen
Jahrgang der JG.
64 P. F. Anderson, Die neuesten anabaptistischen Bewegungen in Dnemark, 1845. Zitate
S. 139 und 140. Die neue ra des Dombaus zu Kln beschftigt die Gemter. Nicht
nur der pr eui sche Kni g sagt sei ne Unt erst t zung zu, auch di e RhZ beschft i gt si ch
intensiv mit dem Dombau, der zu den differentesten Deutungen Anla gibt: Da will der
ei ne den Dom zum Tempel der Ver nunf t ei ngewei ht wi ssen; ei n ander er , nachdem er
kurz zuvor auf die Franzosen weidli ch l osgeschimpft , stiehlt ihnen ihre Pant heonsidee
und lt sodann die 58 freitragenden Pfeil er i m Innern des Domes, eben so viel groen
Gei st er n, al s i hm z. B. si nd Reuchl i n, boehme, Noval i s, Spee, Franz von Si cki ngen
u. dgl. m. dedizieren, whrend ein dritter, der sich schon mehr zu migen wei, ihn blo
fr di e demnchst zu grndende deut sche Nat i onal ki rche al s Kat hedral e i n Vorschl ag
bringt , wo denn natrlich, im Geiste einer aufgeklrten Toleranz, neben Winfried auch
Hermann der Cherusker und seine Thusnelda ihre Altre bekommen wrden, und immer
so wei t er . (anonym, der Dom zu Kl n, i n: RhZ 9 v. 9. 1. 1842 ( Bei bl at t ); vgl . auch
Th. Ni pperdey (1979) sowie weiterfhrend H. C. Seeba (1983).
63 F. Sa, Berlin in seiner neuesten Zeit und Entwicklung. S. 178.
66 R. Prutz, Theologie oder Politik?, S. 14 f. und 19.
67 J. Jacoby an L. Wal esrode, Bri ef v. 26. 3. 1846, i n: Jacoby BW 1816-1849, S. 334.
68 Zu Ref or mat i ons ver gl ei chen und der Geschi cht e der These von der >unvol l endet en
Reformat i on< vgl . H. H. Brandhorst (1981) S. 28 ff. ; si ehe auch Hegel s Ident i fi zi erung
von Reformat i on und brgerl i cher Revol ut i on S. 146 Anm. 76 di eser Arbei t . Ei ne Paral -
lelisierung von B. Bauer und Thomas Mnzer findet sich bei Th. Mundt, ber die Ver-
gleichung unserer Zeit mit der Zeit der Reformation, in: Der Freihafen 7 (1844), H. 1,
S. 5.
69 P. F. Anderson, Die neuesten anabapt isti schen Bewegungen, 1845, S. 141 und 142.
70 W. Ni gg(1937)S. 93. Hingewi esen sei auf das Urt ei l Adornos (1955), da der Pieti smus
selber, wi e alle Gestalt en von Restaurati on, die Krfte dersel ben Aufklrung in si ch ent-
hielt, der er sich entgegensetzte. (S. 134)
71 F.Fischer (1951) S. 473. Vgl. auch G. Oestreich (1981) S. 1270; H. Plessner (1982)
S. 50 ff. und 73 ff.
72 Das grundlegende Werk ber den Pietismus stammt von einem Mitglied der Tbinger
Schule: A. Ritschi (1880-1886). Eine Krisenreligion nennt M. Scharfe (1980) den Pie-
tismus in seiner auf viele offene Probleme hinweisenden Arbeit. (S. 134) Von einem wei-
ten Mantel< des Pietismus mu gesprochen werden, weil es sich um eine aus vielen ver-
schiedenen Richtungen, sowohl >schwrmerischer< als auch >realistischer< Haltungen,
zusammengesetzte Erscheinung handelt, die kaum auf einen gemeinsamen Nenner zu
bringen ist.
404
73 Als informative und materialreiche Arbeit ist mir hilfreich gewesen: W. Ltgert (1923-
1930), zum folgenden vgl. bes. Bd. 1, S. 221 f.
74 H. Steffens und F. D. E. Schleiermacher, zit. nach: W. Ltgert (1923) Bd. 1, S. 227 und
S. 235.
73 Zu dieser Debatte um W. Ltgert und andere vgl. W. Nigg (1937) S. 116 f.
76 J. W. v.. Goethe, Dichtung und Wahrheit, in: Goethes Werke, Bd. 10,
5
1964, S. 42. -
Was hindert Goethe, Herrenhuter zu werden? Goethe sprt, da die Brder ihn nicht als
Christen gelten lassen wollen. Was mich nmlich von der Brdergemeine, so wie von
andern werten Christenseelen absonderte, war dasselbige, worber die Kirche schon
mehr als einmal in Spaltung geraten war. Ein Teil behauptete, da die menschliche Natur
nur durch den Sndenfall dergestalt gestorben sei, da auch bis in ihren innersten Kern
nicht das mindeste Gute an ihr zu finden, deshalb der Mensch auf seine eigenen Krfte
durchaus Verzicht zu tun, und alles von der Gnade und ihrer Einwirkung zu erwarten
habe. Der andere Teil gab zwar die erheblichen Mngel der Menschen gern zu, wollte
aber der Natur inwendig noch einen gewissen Keim zugestehen, welcher, durch gttliche
Gnade belebt, zu einem frohen Baume geistiger Glckseligkeit emporwachsen knne.
(Ebd. S. 43 f.)
Letzeres war Goethes berzeugung, die er als Christentum zu meinem Privatgebrauch
(Ebd. S. 45) ausbildete; Privatgebrauch, weil innerhalb der kirchlichen Orthodoxie diese
berzeugung keinen Raum fand. Mute es Goethe doch erleben, da er in einem geistli-
chen Gesprch eine groe Strafpredigt erdulden mute. Dies sei eben, behauptete man
mir entgegen, der wahre Pelagianismus, und gerade zum Unglck der neueren Zeit wolle
diese verderbliche Lehre wieder um sich greifen. Ich war hierber erstaunt, ja erschrok-
ken. Ich ging in die Kirchengeschichte zurck, betrachtete die Lehre und die Schicksale
des Pelagius nher und sah nun deutlich, wie diese beiden unvereinbaren Meinungen
durch Jahrhunderte hin und her gewogt, und von den Menschen, je nachdem sie mehr
ttiger oder leidender Natur gewesen, aufgenommen und bekannt wurden. (Ebd. S. 44)
Allerdings knnten jetzt die bekehrten Wilden uns selber wieder Heidenbekehrer
zuschicken schreibt Jean Paul 1809, und er weist auf die kleinen Qukergemeinden hin,
in denen sich die Religiositt konzentriere. Besorgten Lesern hlt er entgegen: brigens
wird man doch nicht in Zeiten religise Rasereien frchten, wo es nur noch irreligise
gibt. (J. Paul, ber die jetzige Sonnenwende der Religion (1809), in: Jean Paul Werke,
Bd. 10,1975, S. 1025 und 1031)
77 Zu di esem Komplex vgl. H. Hermelink (1951); Bd. 1; W. O. Shanahan (1954).
78 F. Fischer (1951) S. 474. Vgl. auch G. Kaiser (1961).
79 Da auch di e Rezeption der Hegelschen Philosophie mit erweckungshnli chen Konver-
sionserlebnissen verbunden gewesen ist, stellt J. Gebhardt (1963) S. 49 ff. heraus. Geb-
hardts Intention, hier speziell den Hegelianismus disqualifizieren zu wollen, trifft kaum:
Konversionen und Bekehrungserlebnisse sind in dieser Zeit kein spezielles nur die Hegel-
schule umfassendes religises Erfahrungsmuster.
80 Zum Neupi et i smus vgl . K. Bart h (1947) S. 462 ff. ; R. M. Bi gl er (1972) S. 47 ff. , 128 ff.
u. a. Zitat; W. Nigg (1937) S. 144.
81 H. E. Frhr. v. Kottwitz, zit. nach: W. Ltgert (1925) Bd. 3, S. 124.
82 F. Fischer, Der deutsche Protestantismus . . . S. 478.
83 H. Steffens, zit. nach: W. Ltgert (1925) Bd. 3, S. 133.
84 zit. nach: W. Ltgert (1925) Bd. 3, S. 133.
85 Zu Hengstenberg vgl. R. M. Bigler (1972) S. 88 ff. In der EKZ wird der alte Pietismus kri-
tisiert als die abstrakt praktische, vom Kirchentum abgewendete Richtung des Pietis-
mus, die zur Gleichgltigkeit gegen die Bestimmtheit und gegen die Tiefen der christli-
chen Glaubenslehren verleitet und dem Rationalismus den Weg gebahnt habe. Dagegen
versteht sich die EKZ als die Partei des Fortschritts, des Fortschritts nmlich vom Pietis-
405
mus zum evangelischen Kirchentume. (anonym, Die Partei der Evangelischen Kirchen-
Zeitung, in: EKZ 1846 Sp. 167)
86 R. Wittram (1949) S. 49.
87 H. Leo, Die Hegelingen, S. 25. Wilhelmine Canz hat >Eritis sicut deus< zum Titel ihres
im Kapitel III, S. 296 dieser Arbeit aufgefhrten Romans gemacht.
Das Problem ist auch in unserer Zeit nicht verschwunden. F. W. Grafs 1982 erschienene
umfangreiche Arbeit ber D. F. Strau mndet in eine Straukritik, die im Vorwurf der
Selbstvergottung gipfelt. An Strau exemplifiziert Graf: Der christologische Subjekten-
tausch stellt somit ein Paradigma von Emanzipation berhaupt dar (Ebd. S. 601). Aber
i n di eser dur ch den chri st ol ogi schen Subj ekt ent ausch erf fnet en Emanzi pat i on werde
das Freiheitsbewutsein notwendig unterbestimmt. Denn fr die Realisierung von Frei-
hei t durch Emanzi pat i on mu das Vermgen zur Fr ei hei t al s gegeben (!) i n Anspruch
genommen werden. (Ebd. S. 604) Wo Frei hei t ni cht al s gegeben aner kannt werde,
komme es zu einer fragwrdi gen Erschlei chung von Aut onomi e (Ebd. S. 605). Die
Abkehr von dieser Selbstvergott ung i st Graf zufolge nur durch einen Rcktausch mg-
lich: Das Interesse der Freiheit aller gebietet es, das neue christologische Subjekt gegen
das >alte< rckzutauschen. (Ebd. S. 606) Grafs Arbeit schliet mit einer nachgerade klas-
sischen Bekenntnisformel ab, die mich dazu verleitet, an eine Auferstehung neupietisti-
scher Orthodoxie zu gl auben.
Hinweise dazu, da es sich bei dem Eritis sicut deus um eine Bibelstelle handelt, die
gerade auch von Gnost i kern i mmer wi eder ausgel egt wurde, fi nden sich bei E. Benz
(1961) S. 49.
88 B. Bauer, >Landeskirche<, S. 47 und 68.
89 Ebd. S. 79.
90 Ebd. S. 91 und 84. - Da B. Bauer nicht nur mi t der calvinistisch- synodalen Tradition
>abrechnen< will , sondern zugleich auch mit zentralen Gruppentradit ionen der Intell i-
genz bricht , zeigt sein Vergl eich: Da der wesentliche Gehalt des kirchl ichen Lebens
unbekannt bleibt, kommt diese ganze >psychologisch-moralische Einwirkung< auf jene
Idee der Aufklrung hinaus, welche Verbindungen st ift ete, den Mitgliedern die Einbi l-
dung gab, sie wirkten fr groe Zwecke mit, aber eben dieser Zweck war unbekannt,
war ein Geheimnis, natrlich, weil er selbst Nichts war, Nichts sein konnte, da alle ver-
nnfti gen Interessen drauen i n der Wissenschaft l agen und hier ffentlich genug ver-
handelt wurden. (Ebd. S. 83)
91 A. Ruge, Rezension: Die evangelische Landeskirche, in: HJ 1840 Sp. 1829 und 1827.
92 E. Dronke, Berlin, 1846, Bd. 2, S. 131 f. und 133.
93 E. Zeller, Rezension: Chr. Mrklin, Darstellung und Kritik des modernen Pietismus, in:
HJ 1839 Sp. 1878 f.
94 Zu den junghegelianischen Pietismusinterpretationen vgl.: J. A. Massey (1978).
95 Vgl. die Darstellung bei O. Hintze (1906) S. 108 ff.
96 Zur Sonntagsfeier vgl. die Darstellung bei G. Mayer (1913) S. 52 f. Die prominenteste
junghegelianische Schrift zu dieser Frage stammt von Stirner: Gegenwort eines Mitglie-
des der Berliner Gemeinde wider die Schrift der siebenundfnfzig Berliner Geistlichen:
Die christliche Sonntagsfeier. Ein Wort der Liebe an unsere Gemeinden, in: ders.,
KISchr, S. 2647; siehe auch die kommentierte Edition des Gegenwort von B. Kst
(1977). Anonym erschien (L. Buhl), Die Not der Kirche und die christliche Sonntags-
feier. Ein Wort des Ernstes an die Frivolitt der Zeit, 1842. Aus Knigsberg meldete sich
Jachmann zu Wort: Sabbath und Sonntag oder die christliche Sonntagsfeier, 1842. Eine
bisher unbekannte Rezension dieser Schrift von Stirner hat B. Kst gefunden (M. Stirner,
Gegenwort, 1977, S. 43-44). R. Prutz dichtete in der RhZ 17 v. 17. 1. 1842 ber die
>Sonntagsfeier<. Vgl. darber hinaus: (W. Btticher), Worte eines Laien ber die christli-
che Sonntagsfeier an ihre Gegner und Verchter, 1842; anonym, Ein Wort gegen Wort
406
und Gegenwort in der Berliner Sonntagsfeier-Angelegenheit. Von einem prakt. Geistli-
chen, 1842.
97 So z. B. (L. Buhl), Die Not der Kirche, 1842, S. 20. - Exemplarisch ist auch die Affaire
um den neupietistischen Bund fr den historischen Christus in Berlin, weil dieser Ver-
ein in engem Zusammenhang mit der Nachricht ber den Verein der Freien steht. (Vgl.
RhZ 227 v. 15. & 1842; E. Dronke, Berlin, Bd. 1, S. 217)
Aufgeschreckt durch die Ankndigung eines Vereins der Freien im Sommer 1842
ersuchten Berliner Theologie-Studenten den akademischen Senat, einen theologisch-
wissenschaftlichen Verein zuzulassen, der sich zum Ziel gesetzt hatte, den Glauben an
den geschichtlichen Erlser zu festigen. Es handelte sich bei dieser Initiative um eine
neupietistische Reaktion auf die junghegelianische Evangelienkritik. Der akademische
Senat der Berliner Universitt anerkannte wohl die Lblichkeit des Zweckes, verwei-
gerte aber die Zulassung des Vereins, weil bei dem Zwiespalt, der gegenwrtig in Hin-
sicht theologischer Ansichten stattfinde, ein solcher Verein unter anders denkenden Stu-
dierenden voraussichtlich die Bildung eines Vereins mit entgegengesetzter Tendenz her-
vorrufen mchte, dem alsdann die Erlaubnis des Bestehens ebenfalls nicht fglich werde
versagt werden knnen.
Eichhorn jedoch mibilligte die Haltung des Senats und drngte die Universittsverwal-
tung, den Bund fr den historischen Christus zuzulassen. Der Glaube an den histori-
schen Christus sei wesentlicher Lehrstoff der evangelisch-theologischen Fakultten,
daher knne man einen formlosen wissenschaftlichen Verein, der nichts anderes sich zum
Ziel gesetzt habe, nicht verbieten. Dagegen knne ein Verein mit entgegengesetzter Ten-
denz nicht geduldet werden, (anonym, Der Minister Eichhorn, in: EB 1843, S. 200)
Charakteristisch ist die Reaktion der Junghegelianer in der RhZ 232 v. 20. 8. 1842. Senat
und Ministerium werden sorgsam abgestuft kritisiert: Der Senat handelte wie ein Vater,
welcher dem Sohne etwas abschlgt, damit er es dem Stiefsohne nicht auch gewhren
msse. Obwohl es sich um eine Angelegenheit der theologischen Fakultt handele, habe
der gesamte Senat auf theologischem Sessel gesessen, als er sich von der Furcht vor
einer Gegengrndung habe bestimmen lassen. Haben wir in Berlin eine oder vier theo-
logische Fakultten? fragt der Korrespondent . Di e Haltung Eichhorns, die partiell e
Freigabe religiser Vereinsaktivitten, wird als unzulssige Parteinahme gewertet. In
der Antwort des Ministeriums ist aber geradeheraus gesagt, in welches Verhltnis sich das
Ministerium der geistlichen etc. etc. Angelegenheiten zur Kirche, zur Theologie und zur
Wissenschaft berhaupt stelle. Es nimmt Partei, und wendet seine Amtsgewalt gegen eine
andere Partei an. Die Staatsregierung ist aber verpflichtet, alle Parteien in ihren Rechten
zu schtzen. (Ebd.)
98 Vgl. in diesem Zusammenhang: W. Jaeschke (1979) S. 368 ff. und 373 f.
99 He zufolge soll die RhZ Philosophie und Religion, Staat und Kirche entschieden ausein-
anderhalten. Die Rheinische Zeitung< ist ein politisches Journal und jede religise und
theologische Frage liegt als solche gewi auerhalb ihres Bereiches. (RhZ 196
v. 15. 7. 1842) Diese Trennung sei zuerst von den Gegnern der Zeitung aufgegeben, und
die Polemik, die hierdurch zwischen diesen und uns entstanden ist, hat unsererseits
keine andere Bedeutung, als eine unselige Vermengung der Begriffe abzuwehren. Es
waren die Gegner, die den Staat mit der Religion identifizieren wollten.
Je mehr diese Theorie vom >christlichen< Staate gegenwrtig en vogue ist, desto mehr ist
es Beruf der Presse, derselben jene der Vernunft entgegenzustellen. Das haben wir getan.
Wir haben gezeigt, da der Staat so wenig als die Weltweisheit mit der Religion, die nicht
von >dieser Welt< ist, etwas zu schaffen habe. Und wer wollte uns deshalb tadeln? (.. .)
Die >christlichen< Staatsphilosophen berufen sich auf die allgemeine Religion. Hat es aber
bis jetzt eine allgemeine Religion auer der Philosophie (!) gegeben? Gibt es berhaupt,
auer dem Vernnftigen und Reinmenschlichen etwas Allgemeines? Entkleidet die Reli-
407
gion ihrer Mysterien, so bleibt eben nichts brig, als das allgemein Erkannte und Aner-
kannte. Ihr habt also zu whlen, ob ihr den Staat auf Mysterien oder auf ffentlichkeit
grnden wollt. Wollt ihr das Erstere, so grndet ihn auf Religion; wollt ihr aber das Letz-
tere, so mt ihr ihn auf Vernunft grnden. (Ebd.)
Aber diese Vernunft ist von anderer Art, als die Verwaltungsrationalitt eines Polizei-
staates, es handelt sich um eine Vernunft, die dem Staat einen religis-sittlichen Wert
verleiht. So heit es bei Jachmann: Die Ansicht, die den Staat fr nichts anderes als eine
Art polizeiliche Anstalt hlt, und, seine sittliche Grundlage verkennend, seine durchaus
ideelle, alles umfassende Bestimmung leugnet, wird in jeder Zeit in die schlimmsten Ver-
wicklungen mit den verschiedenartigsten geistigen Erscheinungen fhren, die sich not-
wendigerweise geltend machen mssen. (K. R. Jachmann, Preuen seit der Einsetzung,
in: EB 1843, S. 21) Zu den Aufgaben des Staates, gehrt in dieser Argumentation ein
direktiver Einflu auf die Gesinnungen, nmlich die Aufgabe, alles was die Interessen
des Geistes nach den verschiedensten Richtungen hin berhrt, zu ordnen, zu leiten und
zum Zweck einer hheren sittlichen Entwicklung des Menschengeschlechts zu durch-
dringen. (Ebd.)
Das groe Rtsel der Staatsphilosophie ist fr Jachmann gelst, wenn es gelnge, zwei
Extreme zu vermeiden. Zwischen zwei Extremen, von denen das eine die Religion ganz
und gar in den Staat und zu dessen Zwecke aufgehen lt, wie das in dem alten Rom der
Fall war, das andere umgekehrt, wie in der jdischen Theokratie, den Staat in eine reli-
gise Anstalt verwandelt, mu er (der Staatsphilosoph, d. V.) sein Staatsgebude auffh-
ren, in welchem unbeschadet der religisen berzeugung jedes einzelnen die Religion
dem sittlichen Staatszwecke folgt. Daher gelte der Grundsatz der grten Freiheit auf
dem religisen Gebiet im Glauben und im Worte, der unbeschrnktesten Mannigfaltig-
keit des religisen Vereinslebens, aber des unbedingtesten Gehorsams gegen das Gesetz
des Staates. (Ebd.) hnliche Auffassungen vertritt auch K. Nauwerck in: Vorlesungen
ber Geschichte der philosophischen Staatslehre, in: WVjs 1845, Bd. 1, S. 67 ff.
100 MEW Bd. 1, S. 348. - B. Bauer, Der chrisdiche Staat und unsere Zeit, in: HJ 1841,
S. 537-558. Hier zit. nach B. Bauer, >Feldzge<, S. 7^3.
101 B. Bauer, Der christliche Staat, S. 7 und 13.
102 Ebd. S. 14 und 17.
103 MEWBd. 1,S. 12.
104 MEWBd. 1,S. 102und 101.
105 B. Bauer, Der christliche Staat, S. 23 und 27.
106 Ebd. S. 32,33,34 und 35.
107 Zur >Judenfrage< bei den Junghegelianern vgl. vor allem H. Hirsch (1980) und Sh. Na'a-
man (1982). Zur Kontroverse zwischen B.Bauer und Marx siehe Z.Rosen (1977)
S. 229 ff. Darber hinaus seien genannt: R. Rrup (1975); S. S. Prawer (1983) bes.
S. 47 ff.; W. Grab, J. H. Schoeps (1983); hervorzuheben in diesem Band ist der Beitrag
von H. Hirsch, Karl Marx zur >Judenfrage< und zu Juden - Eine weiterfhrende Meta-
kritik, S. 199-213.
108 B. Bauer, Die Fhigkeit der heutigen Juden und Christen, frei zu werden, in: EB 1843,
S. 56-71. Hier zit. nach B. Bauer >Feldzge< S. 175 und S. 195.
109 Sh. Na'aman(1982)S.93.
110 H. Hirsch (1983) S. 200 ff. Fr andere Radikale wiej. Waldeck istB. Bauers Schrift fr
jeden, der sie versteht, von entschiedenem Werte, jedenfalls der Kritik G. Riesseners
berlegen, der primr fr brgerliche Gleichstellung der Juden eintritt. (Jacoby
BW 1816-1849, S. 211)
111 B. Bauer, Die Fhigkeit der heutigen Juden, S. 178.
112 G. W. F. Hegel, Vorlesungen ber die Philosophie der Geschichte, S. 238.
113 G. Bauer, Die Fhigkeit der heutigen Juden, S. 179. - G. Steiner (1972) hat die These
408
aufgestellt, da die jdische Religion einer radikalen Transzendenz Gottes fr die euro-
pische Kultur eine permanente berforderung gewesen sei. Die an den Geist gestell-
ten Anforderungen sind, ebenso wie der Name Gottes, unaussprechlich (S. 45). Die
Forderungen des Monotheismus htten sich historisch als nahezu untragbar erwiesen.
Wo nicht, wie bei Nietzsche, der Gottesmord individuell durchgestanden sei, habe es
eine leichter vollziehbare Rache gegeben, nmlich: durch Ttung der Juden wrde
die westliche Kultur diejenigen austilgen, die da Gott >erfunden< hatten und, bei aller
Unvollkommenheit und Auflehnung gegen Sein Gebot, doch die Verknder Seiner
unertrglichen Absenz gewesen waren. (Ebd. S. 48 f.)
MEWBd. 1.S.350.
Ebd.
Ebd. S. 351.
Ebd. S. 352.
Ebd. S. 350.
Ebd. S. 352.
Ebd. S. 352.
H. Hirsch (1983) S. 202.
Zur Quidproquo-Technik vgl. MEW Bd. 23, S. 86.
Ich sttze mich bei der Darstellung dieser Bewegungen auf: J. Brederlow (1976);
F. W. Graf (1978 b). Die Arbeit von Graf enthlt ausgewhlte Dokumente und eine
umfangreiche Bibliographie. Siehe auch: W. Nigg (1937) S. 176-202; J. Gebhardt
(1964); G. Kolbe (1972); R. M. Bigler (1972) S. 187 ff. u. a. Als klassische Darstellung
ist immer noch unverzichtbar F. Kampe, (1852-1860).
Zum theologischen Rationalismus vgl. H. Rosenberg (1972) S. 1850, sowie die Ausfh-
rungen von Graf (1978 b) S. 69 ff.
Vgl. F. Kampe (1852) Bd. 1, S. 46 ff.; W. Schieder (1974); R. Lill (1978). Die>Vossische
Zeitung< zit. nach: B. Bauer, Die brgerliche Revolution in Deutschland, 1849, S. 2.
K. Th. Bayrhoffer, ber den Deutsch-Katholizismus,
2
1845, S. 7.
Mannheimer Abend-Zeitung v. 12. 9. 1844, zit. nach: F. Kampe (1852) Bd. 1, S. 52.
Eduin Bauer, Geschichte der Grndung und Fortbildung der deutsch-katholischen Kir-
che, 1845, S. 12.
J. Ronge, Rede, gehalten den 23. 9. 1845, in der Mnsterkirche zu Ulm, 1845, S. 9.
K. F. Theodul, Die christlich-apostolisch-katholische Gemeinde Schneidemhl, 1845,
S.5.
R. Blum, F. Wigard (Hg), Die erste allgemeine Kirchenversammlung der deutsch-katho-
lischen Kirche 1845, S. 200 f.
Vgl. K. Algermissen (1959) S. 182-221; Zur weiteren Entwicklung vgl. H. Wunderer
(1980).
anonym, Lebensbeschreibung freisinniger Mnner. Julius Rupp, in: Vorwrts!, 1847,
S. 198.
F. W. Graf (1978 b) S. 44.
Vgl. G. A. Wislicenus, Ob Schrift? Ob Geist?,
2
1843. Zur Wislicenus-Debatte vgl.
R. M. Bigler (1972) S. 202 ff, 233 ff., 256 ff. u. a.
F. Kampe (1856) Bd. 3, S. 204.
(R. Gottschall), Die deutsche Philosophie seit Hegel's Tod, 1851, S. 339.
R. Blum, F. Wigard (Hg), Die erste allgemeine Kirchenversammlung, 1845 S. 121 ff.
Zu Nauwercks Engagement vgl. B. Bauer, Die brgerliche Revolution, S. 48 und 60. Zu
Hinrichs vgl. R. Blum, F. Wigard (Hg), Die erste allgemeine Kirchenversammlung,
S. 201 u. a.; siehe auch die Schriften: H. F. W. Hinrichs, Trier-Ronge-Schneidemhl,
1845; ders., Trutz-Rom-und-Jesuiten, 1845.
409
A. Rge, Drei Briefe ber die deutsche religis-politische Bewegung von 1845, in: ders.,
SW Bd. 9, S. 337.
Vgl. die Gliederung des 1. Bd. von F. Kampe (1852 ff.) sowie Bd. 2, S. 209 ff.
Ebd. Bd. 2, S. 209 ff.
K. Th. Bayrhoffer, Das wahre Wesen der gegenwrtigen religisen Reformation in
Deutschland, 1846, S. 12.
W. Hiernoymi, Die Hegelianer als Lichtfreunde, 1846, S. 6 f., 17, 33 f. und 35 f. - Die
Antwort lie nicht lange auf sich warten: K. Th. Bayrhoffer, Der praktische Verstand
und die marburger Lichtfreunde, 1846.
Vgl. die Darstellung bei J. Schmidt, 1855, Bd. 3, S. 410 ff.
Zu G. D. Nees von Esenbeck vgl. F. W. Graf (1978 b) S. 79 ff. u. a. Nees von Esenbeck
ist auch in den EB mit einem Beitrag vertreten.
Zu J. Rupp vgl. R. M. Bigler (1972) S. 233 ff.; C. Schieler (1903).
(R. Gottschall), Die deutsche Philosophie seit Hegel's Tod, 1851, S. 337. - Diese Ein-
schtzung verwundert heute. Aber der auch aus der junghegelianischen Religionskritik
hervorgegangene Sozialismus war fr die Zeitgenossen in erster Linie ein religises Ph-
nomen. Der Humanismus, den die freie religise Bewegung predigte, wurde als innerster
Kern der christlichen Religion verstanden, der dann hervortreten knne, wenn die
>uerlichkeit< der alten hierarchischen Religion abgestreift werde.
Auf diesen Zusammenhang zielt die >Adresse der deutschen Arbeiter in London an
Johannes Ronge< (in: Rheinische Jahrbcher, Bd. 1,1845, S. 326-9). Der Deutschkatho-
lik Eduin Bauer soll an He' >Gesellschaftsspiegel< mitarbeiten (vgl. Moses He BW,
1959, S. 118 f.). Aus dem wahrsozialistischen WD sind in diesem Zusammenhang fol-
gende anonyme Beitrge hervorzuheben: Wislicenus und seine Gegner, in: WD 1845,
S. 321-326; Die freie Gemeinde in Halle, in: WD 1846, S. 502-506; Die freie Gemeinde
zu Marburg, in: WD 1847, S. 196-200.
Es kommt aber auch zu Auseinandersetzungen zwischen Wahrsozialisten und Freireli-
gisen. Vgl. (anonym), Die religise Bewegung und der Sozialismus, in: Triersche Zei-
tung 21. 5. 1847, S. 2; R. M. Bigler (1972) S. 257 ff. hnliche Kontroversen finden im
>Bund der Gerechtem statt. Vgl. J. Grandjonc (1975) S. 90 ff.
Als Beispiel fr die sozialistische Programmatik der >Immanenten< knnenBayrhoffers
Ausfhrungen gelten. Er schreibt: Die hauptschliche Beziehung aber ist die des Men-
schen zu den Menseben, die Sozialitt und Assoziation der einzelnen. Sie herzustellen,
ist das Ziel. An dieser Aufgabe arbeitet jetzt die Menschheit: Alle politischen, sozialisti-
schen, kommunistischen, religisen Erscheinungen haben dieses Ziel. Die wesentlichen
besonderen Aufgaben, welche ihre Lsung verlangen, sind folgende:
1) die materielle Zerrissenheit, den Gegensatz des Reichtums und der Armut der einzel-
nen, des Kapitals und der Arbeit auszugleichen, das kommunistische Problem, wel-
ches jedenfalls eine Gesamtgarantie des freudigen und materiellen Daseins aller einzel-
nen fordert;
2) die Entgegensetzung in Wissende und Unwissende durch Gesamt-Intelligenz, nament-
lich durch Hervorbringung der einheitlichen Weltanschauung, in allen einzelnen zu
vernichten, das Problem der allgemeinen Schule und Bildung, welches mit dem erste-
ren durchaus ineinandergreift, in dem keins ohne das andere realisiert werden kann.
Denn nur der materiell sicher gestellte Mensch kann zu grndlicher Bildung, nur der
gebildete Mensch zu wahrer Gesamtgarantie gelangen.
Der so materiell und geistig befreite Mensch wird dann aus sich selbst einen wahren,
schnen Organismus menschlichen Gemeinlebens entfalten, und dadurch jenen bei-
den Momenten Sicherheit und Dauer verschaffen. Er wird
3) die Familie in schner Menschlichkeit verwirklichen, sie wird sich nur durch ihre
eigene Harmonie erhalten, er wird
410
4)ein freies sich selbstbestimmendes Gemeindeleben, und
5)einen freien, sich selbstbestimmenden Staat, wie
6)einen wahren wahrhaften Vlker- und Staatenbund grnden, welcher immer mehr eine
freie Gesamt-Menschheit darstellen wird.
Diese Tendenz der gegenwrtigen Menschheit ist nun zwar berall in den gebildeten
Vlkern wirksam; doch nimmt sie in verschiedenen Vlkern und Individuen verschie-
dene Ausgangspunkte. In Deutschland ist ihr originaler Ausgangspunkt die religise
Bewegung. Von dieser geistigen Tiefe der Weltanschauung aus beginnt hier eine Umwl-
zung der bisherigen beschrnkten Ideen und Formen. Wir sehen in diesen Tagen dieBil-
dung freier Gemeinden; wir sehen, da dieselben in friedlicher, intelligenter Weise das
freie Menschentum erstreben und beginnen. (Bayrhoffer, Wesen, Geschichte und Kri-
tik der Religion, in: Jahrbcher f. spekulative Philosophie u. d. philosophische Bearbei-
tung der empirischen Wissenschaften, hg. v. L .Noack 2(1847), S. 1133 und 1335 f.)
Bei Bayrhoffer sind noch freie Gemeinden das entscheidende Organisationsprinzip der
sozialistischen Bewegung. Mit der Hegemonie der politischen Form der Arbeiterpartei,
die sich nach 1848 sukzessiv herausbildet, >verschwinden< religis-kirchliche Aus-
drucksformen. Da die Ablsung des christlichen Liebeskommunismus durch einen
szientifischen Sozialismus keineswegs geeignet war, Sozialformen und Verhaltensweisen
zu frdern, die den Anforderungen, denen sich die deutsche Arbeiterbewegung gegen-
ber sah, gengten, zeigt eindringlich E. Lucas (1983) S. 71 ff.
Im bergangsfeld zwischen Freireligisen, >immanenten< Junghegelianern und Wahrso-
zialisten werden Positionen formuliert, die die Idee der Volksreligion, wie sie der
junge Hegel entwickelt hat, aufgreifen. J. Habermas' Projekt der kommunikativen Ver-
nunft schliet an diese Idee an. Habermas (1985) ist zuzustimmen, da der junge
Hegel, der junge Marx und spter der Heidegger von Sein und Zeit und J. Derrida in
der Auseinandersetzung mit Husserl die mgliche Alternative, die in einer Sakralisie-
rung kommunikativer Vernunft gelegen htte, nicht aufgegriffen haben. (S. 345, siehe
auch S. 35 ff., 54, 94 u. a.) Dies haben jedoch andere, wie die hier untersuchte Fraktion
der >immanenten< Junghegelianer so ausgiebig getan, da Intellektuelle, wie die im fol-
genden zu behandelnden >Atheisten<, durchaus Erfahrungsgrnde hatten, sich von der
Sakralisierung des ausgelaugten Verstndigungsparadigmas abzuwenden
anonym, Ronge, in: NB H. 6, S. 71 f.
B. Bauer, Die brgerliche Revolution in Deutschland, 1849, S. 9.
B. Bauer, Die Lichtfreunde in Kthen, in: NB H. 5, S. 66 und 75.
Vgl. S. 195 ff. dieser Arbeit.
E. Sander, Die protestantischen Freunde und ihre Gegner, in: NB H. 7, S. 42 und 37.
W. Jordan, Die unbewute Heuchelei und Dr. Rupp, in: BM 1844, S. 56.
anonym, Uhlich, in: NB H 9, S. 75, 80 und 74. Zur Bedeutung O'Conells vgl. E. Hobs-
bawn (1962) S. 275 ff.
A. Frnkel, Die religisen Bewegungen, in: NB H. 7, S. 61 und 62.
Ebd. S. 62 f. und 64. - Auf der Basis der arbeitsteiligen brgerlichen Gesellschaft ent-
steht fr Frnkel unausweichlich eine Art Ideologie. Bei einer bestimmten Ttigkeit -
es sei die gewhnlichste Handarbeit - mu der Mensch auch notwendig seine produkti-
ven Krfte auf eine bestimmte Weise wirken lassen, er mu die bestimmte Sache, mit der
er sich beschftigt, eben erst machen und schaffen, mu also denken und arbeiten, wh-
rend er die allgemeinen, als fertig berkommenen Gter, die nicht erst erarbeitet, nicht
produziert und expliziert zu werden brauchen, als ein vorausgesetztes, nur in seinen
unbestimmten Gefhlen hat. Gehen nun die Individuen, aus denen sich zufllig eine
Masse zusammengehuft hat, mit aller ihrer bestimmten, d. h. mit ihrer wirklichen, pro-
duktiven Ttigkeit, in ihre auseinanderlaufenden, vereinzelten Interessen auf, so wird
das, was bei derselben nicht mitwirken kann und zurcktreten mu, das unproduktive
411
Gefhl eben, als die Macht, die alles Unwirkliche und Unbewiesene in sich trgt, allein
dasjenige sein, das, eben seiner Unbestimmtheit wegen, leicht ineinander flieen und
sich als ein Gemeinsames uern kann. So aber ist die bestimmte und wirkliche Existenz
der Individuen in der Tat nur ihre vereinzelte, whrend ihre unbestimmte und illusori-
sche Existenz eben die als Masse ist. (Ebd. S. 66)
Der Inhalt des Massenbewutseins ist strukturell nicht greifbar. Es sind unbestimmte
Phrasen (... ), in denen die Masse ihre allgemeinen Wahrheiten aufbewahrt. Sie sind der
eigentliche Ausdruck, die einzig mgliche Schpfung der Masse, ihre Lieblingskinder,
an die sich jeder einzelne mit seinen unbestimmten Gefhlen hngen kann, die Worte,
die ihren Inhalt nicht darzustellen, auseinanderzusetzen und bestimmt zu gestalten
haben, deren Ton vielmehr nur gehrt zu werden braucht, um berall anzuschlagen und
Sympathien zu erwecken. Die Masse hat ber einen ganzen Schatz solcher alten und
neuen Substantive und Adjektive mit allen ihren Komparativen und Superlativen zu
gebieten, in denen sie das ausdrckt, was sie, trotz der Vereinzelung ihrer Elemente,
noch als ein Gemeinsames (? hat, d. V.), in denen sie sich also so recht als Masse fhlt.
(Ebd. S. 67 f.)
Ebd. S. 70.
anonym, Ein Wort ber die Regierungen und die protestantischen Freunde, in:
WVjs 1845, Bd. 4, S. 326.
B. Bauer, >Parteikmpfe<, Bd. 2, S. 66. - In der Perspektive B. Bauers von 1847 schlie-
en sich der Neupietismus, der Radikalismus von 1842, die freireligise Bewegung und
die sozialistische Bewegung zu einer amorphen Massenbewegung zusammen. Neupieti-
sten und Radikale seien sich darin einig geworden, da allein auf politisch-staatlicher
Ebene die Probleme nicht zu lsen seien.
Der Kirchlich-Gesinnte ( . . . ) flchtete sich in den Scho der Mutter, die fr die Lei-
denden immer das Wort des Trostes bereit hat. Die Bewegungsmnner, die den Staat zur
einzigen Gemtsangelegenheit machen wollten, erweiterten ihn zu einer Art Gottesreich,
berechtigten also auch den Glubigen, um so mehr auf das geschichtliche Reich Gottes
zu vertrauen. (B. Bauer, >Parteikmpfe<, Bd. 2, S. 27) In der freireligisen Bewegung
feierte das religise Gefhl ( . . . ) seine Auferstehung in einem Schamanentum, welches
sich durch das einfrmige Aussprechen der Phrase betubte, in einem ewigen Lebehoch
auf >Geisteslicht und Geistesfreiheit, auf Recht und Wahrheit, auf alle Helden des Gei-
stes und der Kraft< (Ebd. S. 39 f.).
Der bergang der Radikalen zum Sozialismus passe ebenfalls zur Vollendung der Reli-
gion. Die Mutlosigkeit und Schwche kommt bei dem Anblick der Armen, die sich
selbst nicht helfen knnen, wieder zu sich selbst. Endlich, endlich also kann der Radikale
>mit dem lang verhaltenen Wnschen seines Herzens ernstmachen< >die Armen, die
Gequlten, die Zertretenen, die Arbeiter, die alles schaffen und nichts erhalten, die
nichts sind und alles werden mssen< ruft er zu sich heran: >kommt zu mir, wer ihr auch
seid, zeigt mir eure Wunden, ich will euch sagen, wie ihr sie heilen knnt< - den Armen,
den Mut- und Hoffnungslosen bringt er sein >Evangeum der Freiheit, welches die
eigenntzige Welt verschmht hatte: >kommt alle her, die ihr arbeitet, die ihr mhselig,
beladen, arm, verachtet, verspottet und unterdrckt seid - dies Evangelium wird euren
Mut von neuem sthlen und eure Hoffnung frische Blten treiben.< (Ebd. S. 80 f.)
Die religise Bewegung, die in vielfltigsten Formen zum Ausdruck kommt, ist kein
deutsches Spezialproblem. B. Bauer stellt sie in den Zusammenhang mit religisen
Bewegungen, wie sie sich parallel z. B. in Polen, Ruland, Grobritannien und Frank-
reich entwickeln. (Ebd. S. 28-31) Ihm rckt 1847 das in den Blick, was nach 1848 zuneh-
mend in Vergessenheit geriet, nmlich: die 30er ebenso wie die 40er Jahre des 19. Jahr-
hunderts erlebten keineswegs ein kontinuierliches Abflachen religisen Interesses, es
handelte sich nicht allein um sanfte Schritte der Skularisierung und Dechristianisie-
412
rung. Vielmehr ist diese Zeit ebenso gekennzeichnet durch Wellen von sich erneuernden
>Erweckungen<, in denen sich ein stark gefhlsbetontes, individualisiertes und sektiere-
risches Verhltnis zum Glauben ausspricht. Hobsbawn (1962) spricht von einem
Zusammentreffen zunehmender Skularisierung und religiser Gleichgltigkeit mit
einem Wiedererwachen der Religiositt in ihren extremsten emotionalen Formen.
(S. 445 f.).
B. Bauer, Rezension: Bremisches Magazin fr evangelische Wahrheit, in: An 1843,
Bd. 2, S. 121 und 122.
B. Bauer, Das entdeckte Christentum, 1843; Neuausgabe hg. v. E. Barnikol, 1927,
S. 103.
Das Postulat der Irrationalitt bildet fr G. Dux (1982) den Ausgangspunkt fr seinen
soziologischen Versuch, Weltbilder einsichts- und begrndungsfhig zu machen und sie
der heute verbreiteten absolutistischen Begrndungslosigkeit zu entziehen. (S. 13-15)
Am Schlu seiner Darstellung der Evolution der Weltbilder bricht die Frage nach dem
Ende der Religion oder der Mglichkeit eines letzten berstiegs ber alles Wibare,
der Religion genannt werden knnte, auf. (Ebd. S. 304 ff.) Im Hinblick auf seine mun-
dane und >immanente< Argumentation trifft Dux die Feststellung, da die Frage Ist die
Religion am Ende? zu einem Streit um Worte zu werden droht. (Ebd. S. 306) Das
Phnomen ist nicht neu, wie die Debatte der Gruppe zeigen wird. Herausfordernd ist
die Frage, warum droht gerade in diesem Punkt der >Streit um Worte< zu entbrennen?
R. Prutz, Theologie oder Politik? Staat oder Kirche?, 1847, S. 21 f. 24 f. und 25.
Ebd. S. 31,32 und 33.
Vgl. die Bemerkungen von I. Fetscher (1980) S. 86 f.
R. Prutz, Theologie oder Politik?, S. 36 f. und 37.
Ebd. S. 37.
Ebd. S. 37 f., 40 und50.
Ebd. S. 51.
W. Jordan, Die religise Bewegung der Gegenwart, in: WVjs 1845, Bd. 4, S. 156.
Ebd. S. 161.
Ebd. S. 157.
Ebd. S. 159 und 160.
Ebd. S. 171 und 188.
B. Bauer, Das entdeckte Christentum, S. 111.
Ebd. S. 112 und 111.
Vgl. die Problemstellungen bei: J. Matthes (1967); P. Berger (1973). Darber hinaus:
H. Lbbe (1965); H. Blumenberg (1974); A. Baruzzi (1978); J. Taubes (1983).
z. B.T. Rendtorff(1966).
z. B. T. Luckmann (1963).
A.Hahn (1974). Vgl. in diesem Zusammenhang auch W. Oelmller (1984) sowie
W. Ebach (1985 c).
MEW Bd. 1, S. 378 und 379. - Sensationell fr die Gruppe ist diese Forderung nicht
gewesen. Monote zuvor hatte E. Bauer erklrt: Die Kritik hat sich bis jetzt hauptsch-
lich auf dem Felde der Religion und Theologie bewegt. Sie hat mit der Hauptsache ange-
fangen. Denn in der Religion ist gleichsam die Theorie der menschlichen Schwche und
Abhngigkeit enthalten. (E. Bauer, Der Streit, S. 8 f.) Jetzt gehe es darum, die Heilig-
keit politischer Einrichtungen als nichtig nachzuweisen. (Ebd. S. 9 f.) E. Bauer erlu-
tert sein Vorgehen: Vor allem habe ich mich bestrebt, in der Kritik der bestehenden
Staatsverhltnisse genauer zu sein, weil ich berzeugt bin, da die Kritik berhaupt sich
mehr und mehr von den theologischen, den politischen und gesellschaftlichen Fragen
zuwenden wird. (Ebd. S. 12)
A. Ruge, Neue Wendung der deutschen Philosophie, in: An 1843 Bd. 2, S. 42, 44, 45
und 46.
1
413
M. Stirner, EE S. 50 und 38 f.
anonym, Der Minister Eichhorn, in: EB 1843, S. 200 und B. Bauer, >Parteikmpfe<
Bd. 2, S. 72 und 58.
B. Bauer, Rezension: Th. Kliefoth, Einleitung in die Dogmengeschichte, in: An 1843
Bd. 2, S. 155.
(B. Bauer), Charakteristik Feuerbachs, in: WVjs 1845 Bd. 3, S. 105, 111, 106 und 115.
(G. Julius), Bruno Bauer und die Entwicklung des theologischen Humanismus unserer
Tage, in: WVjs 1845 Bd. 3, S. 55 und 75.
(B. Bauer), Charakteristik Feuerbachs, S. 139.
LFWBd. 4, S. 74.
(B. Bauer), Charakteristik Feuerbachs, S. 138 und 124.
MEWBd. 3, S. 19.
B. Bauer an A. Rge, Brief v. 6. 12. 1841, in: MEGAI. Abt. Bd. 1/2, S. 263.
E. Bauer, Der Streit, S. 31 f.
B. Bauer, Das entdeckte Christentum, S. 125.
Vgl. MEWBd. 2, S. 222 f.
K. Korsch (1966) S. 161.
G. Herweghs BW mit seiner Braut,
2
1906, S. 34.
B. Bauer, Rezension: Bremisches Magazin, S. 126.
A. Rge, Neue Wendung der deutschen Philosophie, S. 29.
L. Wittgenstein (1970) S. 17. Viel ber das, was >Gewiheit< sein knnte, habe ich bei
H. P. Duerr (1974) gelernt.
B. Bauer, Rezension: v. Ammon, Die Geschichte des Lebens Jesu, in: An 1843, Bd. 2,
S. 182 und LFW Bd. 2, S. 212.
anonym, Rezension: Leben und Wirken Friedrich von Sallet's, in: ALZ H. 8, S. 27 und
28.
B. Bauer, Das entdeckte Christentum, S. 89.
E. Bauer, Der Streit, S. 26 f.
Ebd. S. 27.
B. Bauer, Rezension: D. Schulz, Das Wesen und Treiben der Berliner ev. Kirchen-Zei-
tung, in: JWK 1839 Nr. 31 Sp. 247.
B. Bauer, Rezension: Bremisches Magazin, S. 134.
B. Bauer, >Landeskirche<, S. 135.
(G. Julius), Bruno Bauer und die Entwicklung, in: WVjs 1845 Bd. 3, S. 78 und 71.
Ebd. S. 56.
A. Rge, Neue Wendung der deutschen Philosophie, S. 60 f.
Ebd. S. 61.
E. Bauer, Der Streit, S. 324.
Karl Schmidt, Eine Weltanschauung, 1850, S. 198 und 199 f.
(Karl Schmidt), Das Verstandestum und das Individuum, 1846, S. 60.
Ebd. S. 244 f.
M. Stirner, EE, S. 164.
(K. Schmidt), Das Verstandestum und das Individuum, S. 307 f.
(Karl Schmidt), Die neueste Gestaltung der Philosophie, in: EKZ 1846 Sp. 854-864. Die
Verfasserschaft K. Schmidts kann als gesichert gelten. So schreibt Stirner in seiner Anti-
kritik gegen K. Fischer: wir hoffen, da man so.honett sein wird, uns nicht zuzumuten,
von einem Buche, wie >Verstandestum und Individuum< mehr als Eine Seite zu lesen,
geschweige denn noch eine Kritik desselben anzuhren. Doch wollen wir Herrn Kuno
Fischer zur geflligen Kenntnisnahme mitteilen, da der Verfasser von >Verstandestum
und Individuum< eine Kritik in der evangelischen Kirchenzeitung gegen sich selbst
geschrieben. Vielleicht aber ist Kuno Fischer dieses burleske Handeln eines Mannes, der
414
tout prix berhmt werden will, besser bekannt, als uns. (M. Stirner, KISchr S. 415)
Zur Frage der Verfasserschaft vgl. auch B. Bauer, Das entdeckte Christentum, S. 40
(Ausfhrungen von Barnikol) und P. Wtzel, Karl Schmidt als Theologe, S. 174 ff.
Ebd. Sp. 855, 861 und 864.
Vgl. K. Schmidt, Uhlich und die Kirche, 1847. Zur Konversion siehe die Ausfhrungen
der Vorrede S. III ff.
415
V. Thesen zu einer Soziologie
von Intellektuellengruppen
1. Nach der sozialen Lage von Intelligenz, ihrer Stellung im Schichtaufbau der
Gesellschaft oder der Nhe ihrer Auffassungen zu Klasseninteressen zu fragen,
heit, einen Untersuchungsrahmen abzustecken, der au fond einen soziologischen
Zugang zum Phnomen >Intelligenz< blockiert. Die Vernderungen in den Auffas-
sungen, die Intellektuelle von den Gegenstnden, mit denen sie sich befassen, oder
von ihrer Stellung in der Gesellschaft haben - Vernderungen von kleinen inhaltli-
chen Verlagerungen bis zu groen Konversionen - Vernderungen also, die das
betreffen, was an intellektueller Produktion kulturell relevant ist, knnen erst dann
ins soziologische Blickfeld geraten, wenn man sich auf die Stelle konzentriert, an
der geistige Arbeit und Sozialitt einen untersuchungsfhigen Zusammenhang bil-
den. Einer dieser untersuchungsfhigen Zusammenhnge ist die Intellektuellen-
gruppe.
2. Intellektuelle, die behaupten, nur der Sache zu folgen, sind soziologisch ernst-
zunehmen, weil die Sache selbst - als der untrgliche Referent der Wahrheit - ein
soziales Phnomen bestimmter Art ist. Die Sache selbst, auf die sich Intellektuelle
beziehen, ist keine Illusion, die durch den redundanten Topos von der Sozialver-
mitteltheit von Wahrheit zu verscheuchen wre. Nicht die >soziale Bedingtheit< der
Wahrheit, sondern ihre soziale Unbedingtheit, ihre im Prinzip uneinholbare soziale
Ereignishaftigkeit ist zum Leitfaden der Geschichte der Wahrheit zu machen. Der
Anfall wahrer, sachhaltiger Erkenntnis ist ein soziales Ereignis. Ob allein oder in
der Gruppe: Intellektuelle hocken sich um die Sache herum wie um einen Gegen-
stand, dessen Nichtgeheuerlichkeit zum sozialen Ereignis wird.
3. Beim Tausch von Argumenten, beim Reden und Gegenreden, in der Ausein-
andersetzung, im Streit mit Worten und um Worte passiert Unvorhersehbares.
Kein Satz kann so genau gesagt oder geschrieben werden, als da nicht doch noch
eine unvorhersehbare Bedeutung anfllt. Damit mssen Intellektuelle leben, und
diese Not macht sie erfinderisch. Die Umgangsweisen, die Intellektuelle ausbilden,
um den unvorhersehbaren Anfall von Bedeutungen zu bewltigen, gehren zur
Eigenkultur der Intelligenz. Diese Eigenkultur mu zunchst in ihrer eigensinnigen
Regelhaftigkeit begriffen werden und darf nicht je schon vorab gesamtgesellschaft-
lich abgeleitet werden. Zur Eigenkultur der Intelligenz gehren Modi der Ermch-
tigung der Wahrheitsereignisse und der Verstndigung in Interaktionen, -
Ermchtigungen, die nach Magabe von Selbstdefinitionen der Intelligenz erfol-
gen.
4. Die eigenkulturellen Umgangsweisen der Intelligenz, mit denen sie das intel-
lektuelle Geschehen bewltigt, sind greifbar in den Definitionen, mit denen sie
ihrem Tun einen Sinn geben. Diese Gruppendefinitionen reizen den Austausch an
416
und begrenzen ihn. Sie legen fest, was gesagt werden mu und was nicht gesagt wer-
den darf, in welchem Sinn etwas verstanden werden soll und welche Bedeutung kei-
nen Sinn gibt. Dennoch bleibt die eigenkulturelle Formbestimmung im prakti-
schen Vollzug labil. Soziale Ereignisse - auch das Ereignis einer nichtgeheuren
Qualitt der Sache, um die es geht - sind attraktiv, und Attraktivitt ist nur sehr
schwer in einer Gruppe zu bannen. Die Suche nach Ritzen und Spalten in den
Gruppendefinitionen beginnt. Vor aller >Ableitung< der Funktion der Intelligenz
aus den >Interessen der Gesamtgesellschaft < ist methodisch gesehen der Zwang von
Intellektuellengruppen zu setzen, ihre berschsse in andere gesellschaftliche
Bereiche ableiten zu mssen. Wie knnte man bersehen, da Intelligenz sich fr
andere gesellschaftliche Bereiche unentbehrlich machen will!
5. Sind Gruppendefinitionen nach innen Mittel, den Bedeutungsanfall im intel-
lektuellen Arbeitsproze zu steuern, so falten sie nach auen vorzeigbare Symbol-
welten auf, die die Ereignisqualitt intellektueller Arbeit soweit vereindeutigen,
da sie einen Platz erhalten kann. Gruppendefinitionen ermglichen die Sehaftig-
keit von Intelligenz in der Gesellschaft. Auf die vorzeigbare Symbolwelt knnen
sich Zumutungen, die von anderen gesellschaftlichen Gruppen ausgehen, bezie-
hen. Aber zwischen den berhmten Erfordernissen der Gesellschaft und den Se-
haftigkeitsbestrebungen der Intelligenz besteht kein Zusammenhang, der
irgendwo fundamental garantiert wre. Miverstndnisse und Illusionen sind auf
beiden Seiten ebenso die Regel wie mehr oder weniger haltbare Kompromisse und
Notlsungen.
6. Sowohl der Umgang mit den gesellschaftlichen Zumutungen, denen eine
Intellektuellengruppe ausgesetzt ist, als auch der Umgang mit den Wahrheitsereig-
nissen finden ihren Ausdruck in der Profilierung der Gruppendefinition. Grup-
pendefinitionen sind umkmpfte Grenzziehungen, weil sie unter dem Doppel-
aspekt von Innen und Auen sowohl der Gruppe wie auch denen angehren, die
der Gruppe etwas zumuten. Daher die wache Sorge, Gruppendefinitionen wie ein
Gesicht zu wahren und ihnen eine wie auch immer gelagerte Evidenz zuzuschrei-
ben.
7. So sehr Intellektuellengruppen bemht sein mgen, die Stellung der Intelli-
genz in der Gesellschaft* mit dem Schleier der Selbstverstndlichkeit zu umgeben,
in historischen bergangszeiten, in der Konfrontation mit neuartigen, verwirren-
den Erfahrungen wird es schwer, die Symbolwelt ihrer Gruppendefinition heil zu
halten. Gelingt dies einer Gruppe nicht, laufen gar noch verschiedene Gruppen-
definitionen tumultuarisch ineinander ber, so stellt sich auf allen Seiten die Frage
nach den Mglichkeiten der Vernunfterhaltung. Es kommt zu einer ungefilterten
Konfrontation zwischen dem intellektuellen Geschehen, den Wahrheitsereignissen
in der Gruppe und ihrem Auen. Andere soziale Gruppen knnen nun, vermge
der erffneten Transparenz, auch die Entbehrlichkeit dieser Intellektuellengruppe
ins Auge fassen, und die Intellektuellengruppe wird Vernunfterhaltung nur um den
Preis des Wagnisses ihrer eigenen Nichtigkeit durchfhren knnen. Die
Geschichte der Junghegelianer ist dafr ein Beispiel.
417
8. Die Geschichte der Junghegelianer ist fr uns das Beispiel einer Intellektuel-
lengruppe, die, an der Schwelle zu unserer modernen Gesellschaft, in wenigen Jah-
ren intensiver Diskussion eine Enzyklopdie mglicher Entwrfe fr die Definition
von Intelligenz erarbeitet hat. Daher ist es kein beliebig substituierbares Beispiel.
Die Frage, ob die Junghegelianer reprsentativ fr andere Intellektuellengruppen
stehen knnen, verkennt in ihrer Naivitt den Sachverhalt, da uns erreichbare
Typisierungen, die als reprsentative Kandidaten in Frage kommen, allererst der
Fremdheit verwirrender Erfahrungen abgerungen werden mssen, bevor sie als
reprsentative erscheinen knnen. Die Junghegelianer sind in diesem Sinne keine
reprsentative Intellektuellengruppe, wohl aber - und dies ist weitaus relevanter -
sind die Definitionen von Intelligenz, die sie entworfen, diskutiert und praktiziert
haben, als reprsentativ fr die nachfolgenden Intellektuellengruppen anzuspre-
chen. Die Junghegelianer haben Verallgemeinerungen produziert, von denen die
Intelligenz selbst, wie nicht zuletzt die Soziologie der Intelligenz, bis heute zehren.
9. Die junghegelianische Enzyklopdie der Intelligenz enthlt nicht weniger als
die Gestalten
- des Intellektuellen, der sich dem modernen Staat bereit hlt und die Rationali-
tt der Herrschaft in den verschiedenen Zweigen des Wissens befrdert,
- des Intellektuellen-Politikers, der auf dem Felde parteipolitischen Handelns
Vernunft ansssig macht,
- des Publizisten-Intellektuellen, der das gesellschaftliche Kommunikations-
definzit abarbeitet,
- des in Massenbewegungen untertauchenden revolutionren Intellektuellen,
- des einsamen Kritikers, der Gruppen schlechthin verachtet,
- des schockproduzierenden Intellektuellen
- des detektivisch-wachen oder blasiert-indifferent umherschweifenden Intel-
lektuellen,
- des mit Sektengrndung liebugelnden Intellektuellen,
- des im Wissen Erlsung suchenden Intellektuellen,
- des die nachwachsenden Gtter exterminierenden Intellektuellen,
- des konvertierenden Intellektuellen.
Die junghegelianische Enzyklopdie der Intelligenz enthlt diese Definitionen
samt ihren Abschattierungen und Zwischenformen. Sie enthlt zugleich die Apolo-
gien und die Kritiken zu den einzelnen Konzeptualisierungen in seltener Transpa-
10. Die Junghegelianer haben fr lange Zeit die Diskussion um Aufgaben und
Stellung der Intelligenz in der modernen Gesellschaft prfiguriert. Ob man nun
nach 1848 in den unangreifbaren Stellungen des Spezialistentums seine Zuflucht
suchte oder aus der Enzyklopdie einige Artikel herausri, um sie weiterzuschrei-
ben, in der Abwehr oder Aufnahme junghegelianischer Konzepte war eine Zeitge-
nossenschaft mit dieser Intellektuellengruppe gegeben, die bis weit in unser Jahr-
hundert hineinreicht. - Heute sind wir dessen nicht mehr ganz sicher. Wir sind
ungewi, ob wir in den tiefgreifend technisierten und sthetisierten Lebenswelten
ein Verschwinden des universellen Intellektuellen zu diagnostizieren haben oder
418
ob die Machtbernahme einer intellektuellen Priesterherrschart ansteht. Wir sind
ungewi, ob wir die berkommenen Grenzen der wissenschaftlichen, politischen,
sthetischen und religisen Intelligenz, die gegebenen Weisen der Vernunfterhal-
tung erneuern oder dekonstruieren sollen. Das heit, wir sind ungewi, ob wir
noch Zeitgenossen der Junghegelianer sind. Diese Ungewiheiten sind Anla
genug, sich gelassen jener Transparenz zu erinnern, die nur in bergngen und
Zwischenrumen sich einstellt.
419
Literaturverzeichnis
bersicht
A Primrliteratur
1 Zeitschriften und Zeitungen
2 Werkausgaben, Bcher, Broschren, Aufsatze, Artikel, Memoirenliteratur,
Textsammlungen
B Sekundrliteratur
(Die vorliegende Arbeit wurde Anfang 1984 fertiggestellt Zu einem spteren Zeit-
punkt erschienene Sekundrliteratur wurde nur punktuell bercksichtigt)
A. Primrliteratur
1 Zeitschriften und Zeitungen
Allgemeine Literatur Zeitung Monatsschrift Hg v Bruno Bauer, Charlottenburg, Dezem
ber 1843 bis Oktober 1844, H 1-12, Zit ALZ
Andekdota zur neuesten deutschen Philosophie und Pubhcistik Hg v Arnold Ruge 2 Bde,
Zrich und Winterthur 1843, Zit An
Athenum Zeitschrift fr das gebildete Deutschland Redigiert von Karl Riedel, Berlin
1841, Zit Ath
Berliner Blatter Von Karl Nauwerck, Berlin 1844, H 1-6
Berliner Monatsschrift Hg v Ludwig Buhl, Mannheim 1844, Zit BM
Berliner Wespen Von Feodor Wehl, Leipzig 1843, H 1-5
Das Westphahsche Dampfboot Redigiert von Dr Otto Luning, Bielefeld 1845-1846,
Paderborn 1847-1848, Zit WD
Der Freihafen Galerie von Unterhaltungsbildern aus den Kreisen der Literatur, Gesell
Schaft und Wissenschaft Altona 1 (1838)-7(1844)
Deutsche Jahrbucher fr Wissenschaft und Kunst Hg v Arnold Ruge und Theodor Ech-
termeyer, Leipzig 1841-1843, Zit DJ
Deutsche Viertelsjahrschrift Stuttgart Tubingen 1838-1847, Zit DVjs
Deutsch franzosische Jahrbucher Hg v Arnold Rge und Karl Marx, Paris 1844
Deutsches Brgerbuch Hg v Hermann Puttmann, Bd 1 Darmstadt 1845, Bd 2 Mann-
heim 1846
Die Epigonen Leipzig 1846-1848
Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz Hg v Georg Herwegh Zrich und Winterthur
1843, Zit EB
Evangelische Kirchen Zeitung Hg v Ernst Wilhelm Hengstenberg, Berlin 1838-1846,
Zit EKZ
Gesellschaftsspiegel Organ zur Vertretung der besitzlosen Volksklassen und zur Beleuch
tung der gesellschaftlichen Zustande der Gegenwart Redigiert von Moses He, Eiber
feld 1845-1846, H 1-12
420
Grenzboten Eine deutsche Revue Redigiert von Ignaz Kuranda, Leipzig 2(1843)-6(1847)
Hallische Jahrbucher fr deutsche Wissenschaft und Kunst Hg v Arnold Rge und Theo
dor Echtermeyer, Leipzig 1838-1841, Zit HJ
Jahrbucher der Gegenwart Hg v Albert Schwegler, Stuttgart 1(1843), Tubingen 2(1844)-
5(1847), Zit JG
Jahrbucher fr spekulative Philosophie und die philosophische Bearbeitung der empin
sehen Wissenschaften Hg v Ludwig Noack, Darmstadt 1(1846)2(1847)
Jahrbucher fr wissenschaftliche Kritik Hg v der Societat fr wiss Kritik zu Berlin, 1836
1842, Zit JWK
Leipziger Allgemeine Zeitung fr Buchhandel und Bucherkunde, Leipzig 1(1838)2(1839),
Zit LAZfB
Norddeutsche Blatter fr Kritik, Literatur und Unterhaltung, Berlin 1844-1845, H 1-11,
(= Beitrage zum Feldzuge der Kritik Norddeutsche Blatter fr 1844 und 1845 Mit Bei
tragen von Bruno und Edgar Bauer, A Frankel, L Koppen, Szeliga u a , 2 Bde, Berlin
1846) Zit NB
Rheinische Jahrbucher zur gesellschaftlichen Reform Hg unter Mitwirkung Mehrerer von
Hermann Puttmann, Bd 1 Darmstadt 1845, Bd 2 Belle Vue bei Constanz 1846
Rheinische Zeitung fr Politik, Handel und Gewerbe, Kln (vom 1 Januar 1842 bis Ende
Mrz 1843), Zit RhZ
Theologische Jahrbucher In Verbindung mit mehreren Gelehrten Hg v Eduard Zeller,
Tbingen 1(1842)-3(1844)
Vorwrts' Volkstaschenbuch Hg v Robert Blum und Friedrich Steger, Leipzig 1843
1845 Hg v Robert Blum 1846-1847
Wigands Vierteljahrsschrift, Leipzig 1844-1845, Zit WVjs
Zeitschrift fr Philosophie und spekulative Theologie Hg v Immanuel Hermann Fichte,
Bonn 1(1837)-16(1846), Zit ZPsT
Zeitschrift fr spekulative Theologie, in Gemeinschaft mit einem Verein von Gelehrten hg
v Bruno Bauer, Berlin 1(1836)-3(1838)
2 Werkausgaben, Bucher, Broschren, Aufsatze, Artikel, Memoiren,
Textsammlungen
(Kleine Korrespondenzen, Notizen u a sowie nicht mehrfach zitierte Rezensio
nen sind nur in den Anmerkungen aufgefhrt)
ANONYM Adresse der deutschen Arbeiter in London an Johannes Ronge, in Rheinische
Jahrbucher, Bd 1, 1845, S 326-329
-, Allgemeine publizistische bersicht der neuesten Zeitereignisse und sozialen Zustande,
in Der Freihafen 3(1840) H 2, S 240-279
-, Briefe aus Berlin, in NB August 1844, Heft 2, S 20-27
-, Briefe ber das konomische und wissenschaftliche Leben eines Studierenden mit
besonderer Rucksicht auf die theologischen Vorlesungen in Halle von einem Freunde
der Wahrheit und des Lichtes, Braunschweig 1828
-, Bucher und Literaten in London, in LAZfB 1(1838) Sp 28-29
-, Correspondenzen, in NB August 1844, H 2, S 79-94
-, Das Glaubensbekenntnis der Norddeutschen Blatter, in Die Epigonen 1846, Bd 1,
S 303-311
-, Das System der Bevormundung gegenber der freien Staatsentwicklung, in RhZ 160 v
9 6 1842
-, Der Dom zu Kln, in RhZ 9 v 9 1 1842 (Beiblatt)
-, Der Jesuitismus der evangelischen Kirchenzeitung, in HJ 1840 Sp 1966-1967
421
Der Liberalismus Rheinpreuens und Ostpreuen, in RhZ 163 v 12 6 1842 (Beiblatt)
Der Minister Eichhorn, in EB 1843, S 197-206
Der Posaunist und das Centrum der Hegeischen Philosophie, in DJ 1842, S 542-550
Der Streit des Diesseits und des Jenseits in der deutschen Philosophie (oder vom kriti-
schen und vom absoluten Wissen), in DVjs 1843, H 2, S 1-73
Der Zeitgeist oder das Geld, Dortmund 1834
Deutschlands politische Zeitungen, Zrich und Winterthur 1842
Die destruktiven Tendenzen, in RhZ 123 v 3 5 1842 (Beiblatt)
Die deutsche Presse im Jahre 1842, in Vorwrts
1
Volkstaschenbuch fr das Jahr 1843,
Leipzig 1843, S 100-112
Die freie Gemeinde in Halle, in WD 1846, S 502-506
Die freie Gemeinde in Marburg, in WD 1847, S 196-200
Die literarische Zeitung ber Prefreiheit, in RhZ 40 v 9 2 1843 (Beiblatt)
Die Jiteransche Zeitung< und der >Liberalismus<, in RhZ 1 v 1 1 1843
Die Partei der Evangelischen Kirchen-Zeitung, in EKZ 1846, Sp 129-274
Die philosophische Kritik und die deutschen Jahrbucher, in An 1843,Bd 2,S 209-214
Die preuische Presse, in RhZ 6 v 6 1 1843
Die religise Bewegung und der Sozialismus, in Tnersche Zeitung v 215 1847
Die Schamhaftigkeit der deutschen Journale, in NB Dezember 1844, H 6, S 77-80
Die Stellung der Brokratie zur Presse, in RhZ 19 u 22 v 19 u 22 1 1843
Die Trianer, D F Strau, L Feuerbach und A Rge und ihr Kampf fr die moderne
Geistesfreiheit Ein Beitrag zur letztvergangenen deutschen Geistesbewegung Von
einem Epigonen, Kassel 1852
Die Voraussetzungen des Hegeischen Systems, in ZPsT4(1839)H 2, S 291-306
Edgar Bauer ber die liberalen Bestrebungen in Deutschland, in JG 1(1843), S 261-
266
Ein Wort gegen Wort und Gegenwort in der Berliner Sonntagsfeier Angelegenheit Von
einem praktischen Geistlichen, Glogau 1842
Ein Wort ber die Regierung und die protestantischen Freunde, in WVjs 1845, Bd 4,
S 325-326
Fanatismus, in RhZ 116 v 26 4 1842
G G Gervinus Eine Charakteristik, in HJ 1838 Sp 1329-1349
Kritik und Partei - Der Vorwurf gegen die neueste Geistesentwicklung, in DJ 1842,
S 1175-1182
Lebensbeschreibung freisinniger Manner Julius Rupp, in Vorwrts
1
Volkstaschen
buch, Leipzig 1847, S 191-200
Neue kritische Zeitschriften, in NB Juli 1844, H 1, S 1-21
Notiz zum wahren philosophischen Styl, in Grenzboten 3(1844) 1 Sem, No 26,
S 834
Opposition und Reaktion, in RhZ 191 v 10 7 1842
Politische Schlagworter, in Grenzboten 6(1847) 2 Sem Bd 3,No 33, S 276-79
Pressproze Edgar Bauers ber das von ihm verfate Werk Der Streit der Kritik mit
Kirche und Staat Aktenstucke, Bern 1844
Ronge, in NB Dezember 1844, H 6, S 71-75
ber die Hegeische Philosophie und Hegeische Schule, in Ath 1841, S 447-453
ber die jetzige Stellung des Schriftstellers zum Buchhndler in Deutschland, nament
lieh in materiellen Beziehungen, m LAZfB 1(1838) Sp 588-608
ber die Lesevereine in Deutschland, in DVjs 1839, H 1, S 239-251
ber Stellung und Verhltnis der Gymnasiallehrer in Preuen, in DJ 1842, S 708-719
Uhhch.in NB Mrz 1845, H 9, S 73-80
Wislicenus und seine Gegner, in WD 1845, S 321-326
422
-, Zeitungs-Korrespondenten, in: RhZ 42 v. 11.2.1842
-, Zwei Vota ber das Zerwrfnis zwischen Kirche und Wissenschaft, in: DJ 1842, S. 25-
35
ADLER, HANS (Hg): Literarische Geheimberichte. Protokolle der Metternich-Agenten,
1840-1848, 2 Bde, Kln 1977
ANDERSEN,. PETER FRIEDRICH: Die neuesten anabaptistischen Bewegungen in Dne-
mark, Leipzig 1845
ANHALT, EMIL: Die deutsche Einheit und die religisen Bewegungen der Gegenwart, in:
Vorwrts! Volkstaschenbuch, Leipzig 1846, S. 99-108
(BAKUNIN, MICHAIL): Die Reaktion in Deutschland. Ein Fragment von einem Franzo-
sen, in DJ 1842, S. 985-1002
BAUER, BRUNO: Feldzge der reinen Kritik, hg. v. HANS-MARTIN SASS, Frankfurt/M
1968. Zit.: >Feldzge<
-, Kritik der Geschichte der Offenbarung, 2 Bde, Berlin 1838
-, Rezension: D.F. Strau: Streitschriften zur Verteidigung meiner Schrift ber das Leben
Jesu und zur Charakteristik der gegenwrtigen Theologie, Tbingen 1837, in: JWK
1838 Sp. 817-838
-, Herr Dr. Hengstenberg. Kritische Briefe ber den Gegensatz des Gesetzes und des
Evangeliums. Ein Beitrag zur Kritik des religisen Bewutseins, Berlin 1839
-, Rezension: D. Schulz, Das Wesen und Treiben der Berliner evangelischen Kirchenzei-
tung, Breslau 1839, in: JWK 1839 Sp. 247-259
, Die evangelische Landeskirche Preuens und die Wissenschaft, Leipzig 1840, Zit.:
>Landeskirche<
-, Der christliche Staat und unsere Zeit, in: HJ 1841, S. 537-558, auch: >Feldzge<, S. 7-43
-, Die Posaune des jngsten Gerichts ber Hegel den Atheisten und Antichristen. Ein
Ultimatum, Leipzig 1841, Zit.: >Posaune<
-, Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker und des Johannes, 3 Bde, Leipzig
1841/1842
-, Die Parteien im jetzigen Frankreich, in: RhZ 23 v. 23.1.1842 (Beiblatt)
-, Die deutschen Sympathien fr Frankreich, in RhZ 37 v. 6.2. 1842 (Beiblatt)
-, Die Zersplitterung der Parteien in Frankreich, in: RhZ 41 v. 10.2.1842 (Beiblatt)
-, Rezension: Lebensbilder aus den Befreiungskriegen, 2 Abteilungen, Jena 1841, in: RhZ
60, 65, 72, 90 v. 1.-31.3.1842 (Beibltter)
-, Die Kollisionen in den konstitutionellen Staaten, in: RhZ 86 v. 27.3.1842 (Beiblatt)
-, Was ist Lehrfreiheit?, in: RhZ 102 v. 12.4.1842 (Beiblatt)
-, Hegels Lehre von der Religion und Kunst von dem Standpunkte des Glaubens aus beur-
teilt, Leipzig 1842
-, Die Mythe von Hegel, in: RhZ 167 v. 16.6.1842 (B. Bauer zugeschrieben)
-, Louis Philippe und die Juli-Regierung, in: RhZ 170, 172, 174 v. 19.-23.6.1842 (Beiblt-
ter)
-, Johann Christian Edelmann oder Spinoza unter den Theologen, in: DJ 1842, S. 1205-
1212
-, Die gute Sache der Freiheit und meine eigene Angelegenheit, Zrich und Winterthur
1842 (Auszge in: >Feldzge<, S. 91-152)
-, Rezension: D.F. Strau, Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwick-
lung und im Kampf mit der modernen Wissenschaft, 2 Bde, 1840-41, in: DJ 1843,
S. 81-95
-, Rezension: Bremisches Magazin fr evangelische Wahrheit gegenber dem modernen
Pietismus, Bremen 1841, in: An 1843, Bd. 2, S. 113-134
-, Rezension: Th. Kliefoth, Einleitung in die Dogmengeschichte, Parchim und Ludwigs-
lust 1839, in: An 1843, Bd. 2, S. 135-159
423
, Rezension: v. Ammon, Die Geschichte des Lebens Jesu mit steter Rcksicht auf die vor-
handenen Quellen, Leipzig 1842, in: An 1843, Bd. 2, S. 160-185
, Die Fhigkeit der heutigen Juden und Christen, frei zu werden, in: EB 1843, S. 56-71
(auch: >Feldzge< S. 175-195)
-, Die Judenfrage, Braunschweig 1843
-, Das entdeckte Christenum. Eine Erinnerung an das 18. Jahrhundert und ein Beitrag zur
Krisis des neunzehnten, Zrich und Winterthur 1843. Neuausgabe: E. BARNIKOL,
Das entdeckte Christentum im Vormrz, Jena 1927
-, Geschichte der Politik, Cultur und Aufklrung des achtzehnten Jahrhunderts, 2 Bde,
Charlottenburg 1843/45
-, Rezension: Neueste Schriften zur Judenfrage, in: ALZ Dezember 1843, H. 1, S. 1-17
-, Korrespondenz aus der Provinz, in: ALZ Mai 1844, H. 6, S. 20-38
, Briefwechsel zwischen Bruno Bauer und Edgar Bauer whrend der Jahre 1839-1842 aus
Bonn und Berlin, Charlottenburg 1844, Zit.: >Bauer-Briefwechsel 3942<
-, Was ist jetzt Gegenstand der Kritik?, in: ALZ Juli 1844, H., S. 18-26 (auch: >Feldzge<
S. 200-212)
-, Die Gattung und die Masse, in: ALZ Sept. 1844, H. 10, S. 42-48 (auch: >Feldzge<,
S. 213-23)
-, Innere Geschichte des Illuminaten-Ordens, in: ALZ Oktober 1844, H. 11/12, S. 1-25
-, Ludwig Feuerbach, in: NB Oktober 1844, H. 4, S. 1-13
-, Der Sturz des Illuminaten-Ordens, in: NB November 1844, H. 5, S. 35-49
-, Die Lichtfreunde in Kthen, in: NB November 1844, H. 5, S. 50-75
-, Charakteristik Ludwig Feuerbachs, in: WVjs 1845, Bd. 3, S. 86-146
-, EDGAR BAUER, ERNST JUNGNITZ: Geschichte der franzsischen Revolution bis
zur Stiftung der Republik, 3 Bde, Charlottenburg
2
1847
, Vollstndige Geschichte der Parteikmpfe in Deutschland whrend der Jahre 1842-
1846, 3 Bde, Charlottenburg 1847, Zit. als: >Parteikmpfe<
, Die brgerliche Revolution in Deutschland seit dem Anfang der deutsch-katholischen
Bewegung bis zur Gegenwart, Berlin 1849
BAUER, EDGAR: Wer ist ein Preue?, in: RhZ 66 v. 7.3.1842
, ber die Unmglichkeit eines deutschen Lustspiels, in: RhZ 70 v. 11.3.1842
, Kommentare zur Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts. I. Adam Weishaupt und
die Illuminaten, in: RhZ 125 v. 5.5.1842
-, Das Juste-Milieu. Erster Artikel, in: RhZ 156 v. 5.6.1842; Zweiter Artikel, in: RhZ 228,
230,233,235 v. 16., 18., 21., 28.8.1842
, Die Parteiungen in politischen Ansichten, in: RhZ 165 v. 14.6.1842
-, Fraktionen des Liberalismus, in: RhZ 170 v. 19.6.1842
-, Die wahren Liberalen, in: RhZ 171 v. 20.6.1842
-, Wechselwirkung zwischen dem politischen Leben und den Zeitungen, in: RhZ 175 v.
24.6.1842
-, Politischer Charakter der Hauptstadt, in: RhZ 191 v. 10.7.1842
-, Die Zeitungsredakteure, einem Staatsexamen unterworfen, in: RhZ 67 v. 8.3.1842
-, Anstndig und wohlmeinend, in: RhZ 269 v. 26.9.1842
-, Bruno Bauer und seine Gegner, Berlin 1842
-, Geschichte Europas seit der ersten franzsischen Revolution von Archibald Alison
(Rezension), in: DJ 1842, S. 1185-1195
, Staat, Religion und Partei, Leipzig 1843 (E. Bauer zugeschrieben)
, Die liberalen Bestrebungen in Deutschland, 1. Heft: Die Ostpreuische Opposition,
2. Heft: Die Badische Opposition, Zrich und Winterthur 1843
-, Der Streit der Kritik mit Kirche und Staat, Charlottenburg 1843
-, ber Sentimentalitt, in: BM 1844, S. 195-211
424
-, Die Zeitung macht frei und gleich, in: ALZ Mai 1844, H. 6, S. 41-49
-, 1842, in: ALZ Juli 1844, H. 8, S. 1-8
-, ber Bequemlichkeit. Ein Bruchstck aus einem Roman: Ccilie, in: NB August 1844,
H. 2, S. 27-33
-, Geschichte der konstitutionellen und revolutionren Bewegungen im sdlichen
Deutschland in den Jahren 1831-1834,3 Bde, Charlottenburg 1845
-, Die Reise auf ffentliche Kosten, in: Die Epigonen, Leipzig 1848, Bd. 5, S. 9-113
BAUER, EDUIN: Geschichte der Grndung und Fortbildung der deutsch-katholischen
Kirche, Meien 1845
BAUR, FERDINAND CHRISTIAN: Die christliche Gnosis oder die Geschichte der christ-
lichen Religionsphilosophie in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Tbingen 1835
-, Das manichische Religionssystem nach den Quellen neu untersucht und entwickelt,
Tbingen 1831
BAYRHOFFER, KARL THEODOR: Die Idee und Geschichte der Philosophie, Marburg
1838
-, ber den Deutsch-Katholizismus, Marburg
2
1845
-, Der praktische Verstand und die marburger Lichtfreunde. Eine Antwort auf die Schrift
des Herrn Pfarrer Hieronymi in Darmstadt: Die Hegelianer als Lichtfreunde, Darm-
stadt 1846
-, Das wahre Wesen der gegenwrtigen religisen Reformation in Deutschland, Mann-
heim 1846
-, Wesen, Geschichte und Kritik der Religion, in: Jahrbcher fr spekulative Philosophie
und die philosophische Bearbeitung der empirischen Wissenschaften, hg. v. LUDWIG
NOACK2(1847), S. 315-326; S. 563-579; S. 877-893; S. 1101-1136
BECKER, AUGUST: Geschichte des religisen und atheistischen Frhsozialismus. Einge-
leitet und hg. v. ERNST BARNIKOL, Kiel 1932
BIEDERMANN, KARL: Das preuische Staatsprincip kritisch beleuchtet, in: HJ 1839 Sp.
2177-2216
-, Die deutsche Philosophie in ihrer Stellung zum ffentlichen Leben und zur modernen
Gesellschaft, in: Der Freihafen 4(1841) H. 1, S. 217-251
BLUM, ROBERT; WIGARD, FRANZ (Hg): Die erste allgemeine Kirchenversammlung
der deutsch-katholischen Kirche, abgehalten zu Leipzig, Ostern 1845. Authentischer
Bericht. Leipzig 1845
(BTTICHER, W.): Worte eines Laien ber die christliche Sonntagsfeier an ihre Gegner
und Verchter, Berlin 1842
BRUNNER, SEBASTIAN: Des Genies Malheur und Glck, Leipzig 1843
(BUHL, LUDWIG): Hegels Lehre vom Staat und seine Philosophie der Geschichte in ihren
Hauptresultaten, Berlin 1837
-, Die europische Triarchie, in: Ath 1841, S. 161-165
-, Die Weltstellung der Revolution, in: Ath 1841, S. 463-482
-, Die Verfassungsfrage in Preuen nach ihrem geschichtlichen Verlaufe, Zrich und Win-
terthur 1842
-, Der Beruf der preuischen Presse, Berlin 1842
, Die Noth der Kirche und die christliche Sonntagsfeier. Ein Wort des Ernstes an die Fri-
volitt der Zeit, Berlin 1842
-, Offenes Bekenntnis, in: BM 1844, S. 1-14
-, Die Herrschaft des Geburts- und Boden-Privilegiums in Preuen, Mannheim 1844
-, Andeutungen ber die Noth der arbeitenden Klassen und ber die Aufgaben der Ver-
eine zum Wohl derselben, Berlin 1845
CANZ, WILHELMINE: Eritis sicut deus, 3 Bde, Hamburg 1854
CAROVE, FRIEDRICH WILHELM: Die Pressefreiheit und die Historisch-Politischen
Bltter von Grres und Philipps, in: RhZ 209 v. 28.7.1842 (Beiblatt)
425
CIESZKOWSKI, AUGUST von: Prolegomena zur Historiosophie. Mit einer Einleitung
von RDIGER BUBNER und einem Anhang v. JAN GAREWICZ, Hamburg 1981
-, Selected Writings. Essay by ANDRE LIEBICH: August Cieszkowski: Praxis and mes-
sianism as reform, Cambridge 1979
-, Gott und Palingenesie, Berlin 1842
COLLMANN: Quellen, Materialien und Commentar des gemein deutschen Prerechts,
Berlin 1844
KONER; WILHELM DAVID: Gelehrtes Berlin im Jahre 1845. Verzeichnis im Jahre 1845
in Berlin lebender Schriftsteller, Berlin 1846
DRONKE, ERNST: Berlin. 2 Bde, Frankfurt 1846
ECHTERMEYER, THEODOR: Der Vorwurf destruktiver Tendenzen^ in: HJ 1840 Sp.
763-766
-, RGE, ARNOLD, Der Protestantismus und die Romantik. Zur Verstndigung ber die
Zeit und ihre Gegenstze. Ein Manifest, in: HJ 1839: Erster Artikel Sp. 1953-2004;
Zweiter Artikel Sp. 2113-2164; Dritter Artikel Sp. 2401-2480; in: HJ 1840: Vierter Arti-
kel Sp. 417-512
EICHLER, LUDWIG: Berlin und die Berliner, Berlin 1840-1842, Folge 1-5
EGIDIUS, H.L.: Emigranten und Mrtyrer. Ein Beitrag zur Charakteristik der deutsch-
franzsischen Jahrbcher, in: Konstitutionelle Jahrbcher. Hg. v. KARL WEILL,
Stuttgart 1844, S. 110-171
ELIAS, WILHELM: Shne der Zeit. Eine Novelle, Halle 1840
ENGELS, FRIEDRICH: Schriften der Frhzeit. Aufstze, Briefe, Dichtungen aus den Jah-
ren 1838-1844 nebst einigen Karikaturen und einem unbekannten Jugendbildnis des
Verfassers. Gesammelt und hg. v. GUSTAV MAYER, Berlin 1920
ESTERMANN, ALFRED (Hg): Politische Avantgarde 1830-1840. Eine Dokumentation
zum Jungen Deutschland, 2 Bde, Frankfurt/M 1972
EXNER, FRANZ: Psychologie der Hegeischen Schule, 2 Hefte, Leipzig 1842/1844
FELDMANN, CHR.: Die materiellen Interessen und die Bildung der Zeit, zunchst in
Beziehung auf Deutschland, in: Der Freihafen5(1842) H. 2, S. 60-75
FEUERBACH, LUDWIG: Werke in sechs Bnden, hg. v. ERICHTHIES, Frankfurt 1975-
1976. Schriften von Ludwig Feuerbach werden nach dieser Ausgabe zitiert: LFW
, Ausgewhlte Briefe von und an Ludwig Feuerbach, aufgrund der von WILHELM
BOLIN besorgten Ausgabe neu hg. und erweitert von HANS-MARTIN SASS (= Bd.
12/13 der 2. Aufl. der Smtlichen Werke L. Feuerbachs, hg. v. W. BOLIN, F. JODL)
Stuttgart 1964, Zit.: LFB
FICHTE, IMMANUEL HERMANN: Die philosophische Literatur der Gegenwart.
5. Artikel, in: ZPsT 9 (NF 5) (1842) H. 1, S. 93-149
-, Die philosophische Literatur der Gegenwart. 9. Artikel, in: ZPsT 13 (1844) H. 2,
S. 298-334
FISCHER, KUNO: Moderne Sophisten, in: Die Epigonen 5(1848) S. 277-316
(FLEISCHER, MORITZ): Staat und Censur, in: RhZ 79 v. 20.3.1842 (Beiblatt)
FONTANE, THEODOR: Christian Friedrich Scherenberg und das literarische Berlin von
1840 bis 1860, Berlin 1885
-, Von Zwanzig bis Dreiig. Autobiographisches. Berlin
2
1898
FRNKEL, ALBERT: Skizzen aus Berlin, in: Grenzboten 3(1844) 1. Sem., No 26, S. 13-25
-, Die religisen Bewegungen, in: NB Januar 1845, H. 7, S. 60-71
-, KOPPEN, LUDWIG (= KARL FRIEDRICH KOPPEN): Berliner Skizzen. Bilder und
Charakteristiken aus dem Leben der Gesellschaft, 3 Bde, Berlin 1846
FRAUENSTDT, JULIUS: Rezension: 1. F.K. Biedermann, Fundamental-Philosophie,
Leipzig 1838. 2. K. Biedermann, Wissenschaft und Universitt in ihrer Stellung zu den
praktischen Interessen der Gegenwart. Eine Gegenschrift gegen Prof. K.H. Scheidler:
426
ber die Idee der Universitt in ihrer Stellung zur Staatsgewalt,, Leipzig 1839, in: HJ
1839 Sp. 2225-2280
FREY, ARTHUR: Lebensbeschreibungen freisinniger Mnner. Karl Heinzen, in: Vor-
wrts! Volkstaschenbuch, Leipzig 1847, S. 240-258
FRIEDENSBURG, W.: Bemerkungen ber Hegel'sche Philosophie, von einem Apostaten,
in: Grenzboten 3(1844) 2. Sem, No. 1, S. 34-39; No. 3 S. 108-114; No. 20, S. 296-307
-, Die Fortschrittstheorie in Deutschland, in: Grenzboten 3 (1844) 2. Sem., No. 22, S. 411
414
GANS, EDUARD: Vermischte Schriften, 2 Bde, Berlin 1834
-, Rckblicke auf Personen und Zustnde, Berlin 1836
(GELZER, HEINRICH): Die geheimen deutschen Verbindungen in der Schweiz seit 1833.
Ein Beitrag zur Geschichte des modernen Radikalismus und Communismus, Basel 1847
GERVINUS, GEORG GOTTFRIED: Die Mission der Deutsch-Katholiken, Heidelberg
1845
GISEKE, ROBERT: Moderne Titanen oder kleine Leute in groer Zeit, 3 Bde, Leipzig
2
1853
GLASSBRENNER, ADOLPH: Schilderungen aus dem Berliner Volksleben, Berlin 1841
GOETHE, JOHANN WOLFGANG von: Dichtung und Wahrheit, in: Goethes Werke
(Hamburger Ausgabe) Bd. 9 und 10 Hamburg
5
1964
GOTTSCHALL, RUDOLF: Lieder der Gegenwart, Knigsberg 1842
-, Censur-Flchtlinge. Zwlf Freiheitslieder, Zrich und Winterthur 1843
-, Die deutsche Philosophie seit Hegel's Tod, in: Die Gegenwart. Eine encyclopdische
Darstellung der neuesten Zeitgeschichte fr alle Stnde, Bd. 6, Leipzig 1851, S. 292-340
-, Die deutsche Nationalliteratur des neunzehnten Jahrhundert. Literarhistorisch und kri-
tisch dargestellt, 4 Bde, Breslau
3
1872
-, Aus meiner Jugend. Erinnerungen, Berlin 1898
GUTACHTEN der Ev.-theolog. Fakultten der Kgl. Preu. Universitten ber den Lic.
Bruno Bauer in Beziehung auf dessen Kritik der ev. Geschichte der Synoptiker. Im Auf-
trage des vorgesetzten hohen Ministeriums hg. v. der ev. theolog. Fakultt der Rhein.-
Friedrich-Wilhelm-Universitt, Berlin 1842
HANSEN, JOSEPH (Hg): Rheinische Briefe und Akten aus der Geschichte der politischen
Bewegung 1830-1850, Bd. 1, Essen 1919
HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH: Werke in zwanzig Bnden, hg. v. EVA
MOLDENHAUER und KARL MARKUS MICHEL (= Theorie Werkausgabe) Frank-
furt/M 1970 (die nachfolgend aufgefhrten Ausgaben ausgenommen, werden G.W.F.
Hegels Schriften nach dieser Ausgabe zitiert: HW)
-, Phnomenologie des Geistes, hg. v. JOHANNES HOFFMEISTER, in: Hegel, Smtli-
che Werke, Neue kritische Ausgabe, Bd. 5, Hamburg
6
1952
-, Die Philosophie des Rechts. Die Mitschriften Wannenmann (Heidelberg 1817/1818)
und Homeyer (Berlin 1818/1819) hg. v. KARL-HEINZ ILTING, Stuttgart 1893
, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im
Grundrisse. Mit Hegels eigenhndigen Notizen in seinem Handexemplar und den
mndlichen Zustzen. Hg. v. HELMUT REICHELT, Frankfurt/M 1972
-, Vorlesungen ber die Geschichte der Philosophie, hg. GERD IRRLITZ, 3 Bde, Leipzig
1971
-, Vorlesungen ber die Philosophie der Geschichte, in: G.W.F. Hegel's Werke. Vollstn-
dige Ausgabe durch einen Verein von Freunden des Verewigten, Bd. 9, Berlin
2
1840
-, Briefe von und an Hegel, hg. v. JOHANNES HOFMEISTER, 3 Bde, Hamburg 1952-
1954
HEILBRONN, ERNST: Die gute Stube. Berliner Geselligkeit im 19. Jahrhundert, Wien
Mnchen Leipzig 1922
427
HEINZEN, KARL: Die geheimen Konduitenlisten der Beamten, Kln 1842
-, Die preuische Breaukatie, Darmstadt 1845
HERMAND, JOST (Hg): Das junge Deutschland. Texte und Dokumente, Stuttgart 1974
HERWEGH, GEORG: Gedichte eines Lebendigen, Zrich und Winterthur 1841
-, Georg Herweghs Briefwechsel mit seiner Braut, hg. v. MARCEL HERWEGH, Stutt-
gart
2
1906
-, 1848, Briefe von und an Georg Herwegh, hg. v. MARCEL HERWEGH, Mnchen
1896
HERZEN, ALEXANDER: Erinnerungen. Aus dem Russischen bertragen, hg. und einge-
leitet von OTTO BUEK, 2 Bde, Berlin 1907
HESS, MOSES: Sozialistische Aufstze 1841-1847, hg. v. THEODOR ZLOCISTI, Berlin
1921,Zit.:SA
-, Philosophische und sozialistische Schriften 1837-1850. Eine Auswahl, hg. und eingelei-
tet v. AUGUSTE CORNU u. WOLFGANG MNKE, Berlin (Ost) 1961
-, Die heilige Geschichte der Menschheit. Von einem Jnger Spinozas, Stuttgart 1837
-, Die europische Triarchie, Leipzig 1841
-, Gegenwrtige Krise der deutschen Philosophie, in: Ath 1841, S. 623-625
-, Die Tagespresse in Deutschland und Frankreich, in: RhZ 163 v. 12.6.1842 (Beiblatt)
-, ber den Verein der Freien in Berlin, in: RhZ 181 v. 30.6.1842
-, Tendenz der Rheinischen Zeitung, in: RhZ 196 v. 15.7.1842
-, Religion und Sittlichkeit, in: RhZ 216 v. 4.8.1842 (Beiblatt)
-, Die politischen Parteien in Deutschland, in: RhZ 254 v. 11.9.1842 (Beiblatt)
-, Sozialismus und Kommunismus, in: EB 1843, S. 74-91
-, Die Eine und ganze Freiheit, in: EB 1843, S. 92-97
-, Philosophie der Tat, in: EB 1843, S. 309-331
-, Die letzten Philosophen, Darmstadt 1845
-, Briefwechsel, hg. v. EDMUND SILBERNER, 's-Gravenhage 1959
HIERONYMI, WILHELM: Die Hegelianer als Lichtfreunde oder zwei Dokumente der
neuesten marburger Kirchenphilosophie beleuchtet mit dem Lichte des praktischen
Verstandes und aus der hegelschen Sprache in die gewhnliche deutsche bersetzt,
Darmstadt 1846
HINRICHS, HERMANN FRIEDRICH WILHELM: Die Fragen der Gegenwart und Prof.
Michelet's Geschichte der letzten Systeme, in: HJ 1839 Sp. 457-476
, Rezension: Die Posaune des jngsten Gerichts wider Hegel den Atheisten und Antichri-
sten, 1841, in: JWK 1842 Sp. 409-438
-, Politische Vorlesungen. Unser Zeitalter und wie es geworden, nach seinen politischen,
kirchlichen und wissenschaftlichen Zustnden, mit besonderem Bezge auf Deutsch-
land und namentlich Preuen, 2 Bde, Halle 1843
-, Trutz Rom - und - Jesuiten. Ein Gedenkblatt fr rmisch- und deutsch-katholische
Christen, Halle 1845
-, Trier - Ronge - Schneidemhl. Ein fliegendes Blatt, Halle 1845
HOFFMANN von FALLERSLEBEN, AUGUST HEINRICH: Mein Leben. Aufzeichnun-
gen und Erinnerungen, Bd. 4, Hannover 1868
HUMBOLDT, WILHELM von: Der knigsberger und der litauische Schulplan, in: ders.,
Gesammelte Schriften, Bd. 13, Berlin 1920, S. 259-283
JACHMANN, KARL REINHOLD: Sabbath und Sonntag oder die christliche Sonntags-
feier. Eine Zeitfrage errtert, Knigsberg 1842
-, Preuen seit der Einsetzung Arndt's bis zur Absetzung Bauers, in: EB 1843, S. 1-32
JACOBY, JOHANN: Vier Fragen, beantwortet von einem Ostpreuen, Straburg 1841
-, Briefwechsel 1816-1849, Hg. v.EDMUND SILBERNER, Hannover 1974
JEAN PAUL: ber die jetzige Sonnenwende der Religion, in: Jean Paul Werke, hg. v. W.
MILLER, W. HLLERER, Bd. 10, Mnchen Wien 1975, S. 1025-1033
428
JORDAN, WILHELM: Irdische Phantasien, Knigsberg 1842
-, Die unbewute Heuchelei und Dr. Rupp, in: BM 1844, S. 50-81
-, Ihr trumt! Weckruf an das Rongeberauschte Deutschland, Leipzig 1845
-, Die religise Bewegung der Gegenwart, in: WVjs 1845, Bd. 4, S. 155-220
-, Demiurgos. Ein Mysterium, 3 Theile, Leipzig 1854
JULIUS, GUSTAV: Verteidigung der Leipziger Allgemeinen Zeitung, Braunschweig 1843
-, Theorie und Praxis, in: WVjs 1844, Bd. 1, S. 61-131
-, B. Bauer und die Judenfrage, in: WVjs 1844, Bd. 1, S. 278-286
-, Herr Hinrichs und die moderne Kritik, in: WVjs 1845, Bd. 1, S. 314-323
-, Der Streit der sichtbaren mit der unsichtbaren Menschenkirche oder Kritik der Kritik
der kritischen Kritik, in: WVjs 1845, Bd. 2, S. 326-333
-, Bruno Bauer und die Entwicklung des theologischen Humanismus unserer Tage. Eine
Kritik und Charakteristik, in: WVjs 1845, Bd. 3, S. 52-85
-, Arnold Ruge, in: Grenzboten 5(1846) 1. Sem, 2. Bd., No. 19, S. 221-234; No. 20,
S. 275-286
JUNG, ALEXANDER: Die Kritik in Charlottenburg oder die Gebrder Bauer, in: Knigs-
berger Literaturblatt v. 17., 20. und 24.7.1844 Sp. 449^168
-, Knigsberg und die Knigsberger, Leipzig 1846
JUNGNITZ, ERNST: Religion und Kirche in Frankreich bis zur Auflsung der Konstitu-
ierenden Versammlung, Charlottenburg 1843
-, Religion und Kirche in Frankreich seit der Auflsung der Konstituierenden Versamm-
lung bis zum Sturz Robespierres, 2 Bde, Charlottenburg 1844
, Rezension: ber die Teilnahme am Staat, v. Karl Nauwerck, Leipzig 1844, in: ALZ
1844, H. 4, S. 21-22
-, Geschichte des religisen Lebens in Deutschland whrend des 18. Jahrhunderts, Char-
lottenburg 1845
, Geschichte der franzsischen Revolution von 1787 und 1788, 2 Theile, Charlottenburg
1846
(KHNE, K.W.): Neuentdeckte Jesuitenbriefe. Beantwortet durch ein Sendschreiben an
Dr. Heinrich Leo, von B. HEGELING, Leipzig 1838
KAHNIS, KARL FRIEDRICH AUGUST: Ruge und Hegel. Ein Beitrag zur Wrdigung
Hegelscher Tendenzen, Quedlinburg 1838
KLENCKE: Das deutsche Gespenst, 3 Bde, Leipzig 1846
KNIG, GEORG FRIEDRICH: Das Verbot der LAZ fr den Preuischen Staat, in: RhZ 1
v. 1.1.1843
KOEPPEN, KARL FRIEDRICH: Friedrich der Groe und seine Widersacher, Leipzig 1840
-, Zur Feier der Thronbesteigung Friedrich's II, in: H 1840 Sp. 1169-1197
-, Fichte und die Revolution, in: An 1843, Bd. 1, S. 153-196
-, Broschren ber die Judenfrage, in: NB Mrz 1845, H. 9, S. 53-72
-, Die Religion des Buddha, 2 Bde, Berlin 1857/59
KOWALSKI, WERNER (Hg): Vom kleinbrgerlichen Demokratismus zum Kommunis-
mus. Zeitschriften aus der Frhzeit der deutschen Arbeiterbewegung (1834-1847), Ber-
lin 1967
KOSZYK, KURT und OBERMANN, KARL (Hg): Zeitgenossen von Marx und Engels.
Ausgewhlte Briefe aus den Jahren 1844-1852, Assen Amsterdam 1975
LEO, HEINRICH: Sendschreiben an Josef Grres, Halle 1838
-, Die Hegelingen, Halle
2
1839
LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM: Die Erziehung des Menschengeschlechts, in: ders.,
Gesammelte Werke, Bd. 9, Leipzig 1856, S. 399-425
LSER, W.: Die reine Kritik und ihre Bewegung. Zur Charakteristik der von Bruno Bauer
und seinen Anhngern in jngster Zeit eingeschlagenen Richtung, Leipzig 1845
429
LWITH, KARL (Hg): Die Hegelsche Linke. Texte aus Werken von Heine, Ruge, Hess,
Stirner, Bauer, Feuerbach, Marx und Kierkegaard ausgewhlt und eingeleitet v. K.
LWITH, Stuttgart Bad Cannstatt 1962
LBBE, HERMANN (Hg): Die Hegelsche Rechte. Texte aus den Werken von. F.W.
Carove, J.F. Erdmann, K. Fischer, E. Gans, H.F.W. Hinrichs, C.L. Michelet, H.B.
Oppenheim, K. Rosenkranz und C. Rssler. Ausgew, und eingel. von H. LBBE, Stutt-
gart Bad Cannstatt 1962
MARBACH, GOTTHARD OSWALD: Universitten und Hochschulen im auf Intelligenz
sich grndenden Staate, Leipzig 1834
-, Aufruf an das protestantische Deutschland wider unprotestantische Umtriebe und
Wahrung der Geistesfreiheit gegen Dr. H. Leo's Verketzerungen. 2 Artikel, Leipzig
1838/39
MARCARD, H.E.: Ein Literatenleben. Eine Erzhlung, Halle 1847
MARGGRAFF, HERRMANN: Deutschlands jngste Literatur- und Culturepoche. Cha-
rakteristiken, Leipzig 1839
MARR, WILHELM: Das junge Deutschland in der Schweiz. Ein Beitrag zur Geschichte der
geheimen Verbindungen unserer Tage, Leipzig 1846
MARX, KARL und ENGELS, FRIEDRICH: Historisch-kritische Gesamtausgabe, hg. v. D.
RJASANOV, Frankfurt/M 1927 ff. und Berlin 1930 ff.; hg. v. VLADIMIR ADO-
RATSKI1933 ff., Tit.: MEGA
-, Werke. Hg. v. Institut fr Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (nach der vom
Institut fr Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU besorgten 2. russischen Aus-
gabe) 39 Bde, (Bd. 27-39: Briefe) und ein Ergnzungsband (>Schriften, Manuskripte,
Briefe bis 1844<; 2 Halbbnde) Berlin 1961-1968, Zit.: MEW
MAURER, FRIEDRICH WILHELM GERMAN: Gedichte und Gedanken eines Deut-
schen in Paris, 2 Bde, Zrich und Winterthur 1844
MEISSNER, ALFRED: Geschichte meines Lebens, 2 Bde, Wien Teschen 1884
MELZER, FRIEDRICH E.: Denkschrift ber die wissenschaftlich notwendige Umgestal-
tung der weltlichen Fakultten auf den deutschen Universitten, Leipzig 1841
MERZ, HEINRICH: Philosophie, Christentum und Kirche, in: Der Freihafen 4(1841),
H. 4, S. 1-22
MEYEN, EDUARD: Heinrich Leo. Der verhauene Pietist, Leipzig 1839
-, Knigsberg in Preuen, in: Ath 1841, S. 209-212; S. 225-229
, Rezension: v. Schellings religionsgeschichtliche Ansicht. Nach Briefen aus Mnchen,
Berlin 1841, in: Ath 1841, S. 511-513
-, Die Stellung der deutschen Journalistik, in: Ath 1841, S. 631-633
-, Rezension: Die Posaune des jngsten Gerichts, in: Ath 1841, S. 719-722
-, Rezension: Berlin und die Berliner von Ludwig Eichler, in: RhZ 58 v. 27.2.1842
-, Blick auf den Ansto und die Richtung der deutschen Bewegung, in: BM 1844, S. 212-
239
MICHELET, CARL LUDWIG: Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in
Deutschland von Kant bis Hegel, 2 Bde, Berlin 1837-1838
-, Entwicklungsgeschichte der neuesten deutschen Philosophie mit besonderer Rcksicht
auf den gegenwrtigen Kampf Schellings mit der Hegeischen Schule, Berlin 1843
-, Wahrheit aus meinem Leben, Berlin 1884
MHLBACH, LUISE (= KLARA MUNDT): Eva. Ein Roman aus Berlins Gegenwart,
2 Bde, Berlin 1844
MGLICH, JOHANN KARL AUGUST: die Hegelweisheit und ihre Frchte, oder Arnold
Rge mit seinen Genossen in den Hallischen Jahrbchern und in der Paulskirche,
Regensburg 1849
MUNDT, THEODOR: Grres und die Katholische Weltanschauung, in: Der Freihafen 1
(1838) H. 2, S. 182-197
430
-, ber die Vergleichung unserer Zeit mit der Zeit der Reformation, in: Der Freihafen
7(1844) H. 1, S. 1-13
MURGER, HENRY: Scenes de la Vie de Boheme, Paris 1883
NAUWERCK, KARL: Ein Wort ber freie Staatsverfassung, Hamburg 1841
-, Conservatismus und Radicalismus. - Beitrag zur Philologie, in: DJ 1842, S. 787-788
-, Zur Verfassungsfrage, in: DJ 1842, S. 1126-1131
-, Rezension: Ein Blick in die inneren Zustne des preuischen Staates nebst einer Analyse
der Vier Fragen eines Ostpreuen und kurzer Kritik vier seiner Gegner, Berlin 1841,
in: An 1843, Bd. 1, S. 212-227
-, Woher und wohin? oder Der preuische Landtag im Jahre 1840, in: An 1843, Bd. 1,
S. 197-211
-, ber die Teilnahme am Staate, Leipzig 1844
-, Vorlesungen ber Geschichte der philosophischen Staatslehre, in: WVjs 1844, Bd. 1,
S. 1-17; Bd. 2, S. 91-133; Bd. 3, S. 178-215; Bd. 4, S. 268-302; 1845, Bd. 1, S. 9-73
OPITZ, THEODOR: Bruno Bauer und seine Gegner. Vier kritische Artikel, Breslau 1846
-, Die Helden der Masse, Charakteristiken, Grnberg 1847
PFEILSCHMIDT, ERNST HEINRICH: Der Proze der halleschen und deutschen Jahr-
bcher vor Regierung und Stndeversammlung des Knigreichs Sachsen. Ein actenm-
iger Beitrag zur Geschichte des Kampfs zwischen dem Christenthume und der neue-
sten Philosophie, Grimma 1843
PIETSCH, LUDWIG: Wie ich Schriftsteller geworden bin. Bd. 1. Erinnerungen aus den
Fnfziger Jahren, Berlin 1893
PRUTZ, ROBERT EDUARD: Herwegh und das deutsche Publikum, in: RhZ 80 v.
21.3.1843 (Beiblatt)
-, Gedichte. Neue Sammlung, Zrich und Winterthur 1843
, Theologie oder Politik? Staat oder Kirche? in: Kleine Schriften. Zur Politik und Litera-
tur, Merseburg 1847, Bd. 2, S. 3-51
-, ber die gegenwrtige Stellung der Opposition in Deutschland, in: Kleine Schriften.
Zur Politik und Literatur, Merseburg 1847, Bd. 2, S. 52-88
-, Geschichte des deutschen Journalismus, Hannover 1845
-, Zehn Jahre. Geschichte der neuesten Zeit, 1840-1850, 2 Bde, Leipzig 1850/1856
RAU, HERIBERT: Genial, Frankfurt/M 1844
RIEDEL, KARL: Staat und Kirche. Manuskript aus Norddeutschland, als Antwort an Rom
und seine Freunde. Beitrag zur Gedchtnisfeier der Thronbesteigung Friedrichs des
Groen, Berlin 1840
-, v. Schellings religionsgeschichtliche Ansicht. Nach Briefen aus Mnchen, Berlin 1841
RIEDEL, MANFRED (Hg): Materialien zu Hegels Rechtsphilosophie, 2 Bde, Frankfurt/M
1975
RIEHL, WILHELM HEINRICH: Ein Blick auf die deutsche Journalistik im Jahr 1843, in:
Grenzboten 3(1844) 2. Sem., No. 5, S. 208-218
RONGE, JOHANNES: Rede, gehalten den 23.9.1845 in der Mnsterkirche zu Ulm, Ulm
1845
ROSENKRANZ, KARL: Rezension: G.W.F. Hegel's Vorlesungen ber die Philosophie der
Religion, in: JWK 1833, Sp. 561-581; Sp. 641-656
-, Das Centrum der Speculation. Eine Komdie, Knigsberg 1840
-, ber den Begriff der politischen Partei, Knigsberg 1843
-, Georg Wilhelm Friedrich Hegels Leben, Berlin 1844
-, Aus einem Tagebuch. Knigsberg Herbst 1833 bis Frhjahr 1846, Leipzig 1854
-, sthetik des Hlichen, Knigsberg 1853
-, Politische Briefe und Aufstze, hg. v. PAUL HERRE, Leipzig 1919
-, ROTTECK, KARL WENZESLAUS RODECKER von / WELCKER, KARL THEO-
431
DOR: Das Staatslexikon oder Enzyklopdie der Staatswissenscharten, 15 Bde, Altona
1834-1843
RUGE, ARNOLD: Smtliche Werke, 10 Bde, Mannheim
2
1847-48, Zit.: Ruge SW
-, Rezension: Sendschreiben an J. Grres von Heinrich Leo, in: HJ 1838 Sp. 1169-1204
-, Die Denunciation der Hallischen Jahrbcher, in: HJ 1838 Sp. 1425-1440
-, Preuen und die Reaktion. Zur Geschichte unserer Zeit, Leipzig 1838
-, Der Pietismus und die Jesuiten, in: HJ 1839 Sp. 241-288
-, Karl Streckfu und das Preuenthum. Von einem Wrttemberger, in: HJ 1839 Sp.
2089-2107
-, Der christliche Positivismus und das Leben, in: HJ 1839 Sp. 2169-2184
-, Rezension: K.F. Koeppen, Friedrich der Groe und seine Widersacher. Eine Jubel-
schrift, Leipzig 1840, in: HJ 1840 Sp. 999-1000
-, Zur Kritik des gegenwrtigen Staats- und Vlkerrechts, in: HJ 1840 Sp. 1201-1244
-, Die abstracten Litteraten unserer Zeit, in: HJ 1840 Sp. 1230-1232
-, Das Manifest der Philosophie und seine Gegner, in: HJ 1840 Sp. 1420-1424
, Rezension: Karl Rosenkranz, Das Centrum der Speculation. Eine Komdie, Knigsberg
1840, in: HJ 1840 Sp. 1486-1488
, Rezension: Die evangelische Landeskirche Preuens und die Wissenschaft, Leipzig
1840, in: HJ 1840 Sp. 1825-1832
-, Politik und Philosophie. - Noch ein Wort mit den literarischen und kritischen Blttern
der Brsenhalle, in: HJ 1840 Sp. 2329-2344
-, Rezension: D.F. Strau, Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwick-
lung und im Kampf mit der modernen Wissenschaft, in: HJ 1840 Sp. 2489-2494
-, Die Hegel'sche Philosophie und der X Philosoph in der Augsburger Zeitung vom
11. Juni 1841, in: DJ 1841, S. 129-143
-, Die Restauration des Christentums, in: DJ 1841, S. 609-620
-, Der protestantische Absolutismus und seine Entwicklung, in: DJ 1841, S. 481-526
-, Wer ist und wer ist nicht Partei? - Das Morgenblatt und die schsischen Vaterlandsblt-
ter, in: DJ 1842, S. 190-192
-, Das Selbstbewutsein des Glaubens oder die Offenbarung unserer Zeit, in: DJ 1842,
S. 571-598
-, Die Hegeische Rechtsphilosophie und die Politik unserer Zeit, in: DJ 1842, S. 755-768
-, Der christliche Staat - Gegen den Wrtemberger ber das Preuentum, in: DJ 1842,
S. 1065-1072
-, Eine Selbstkritik des Liberalismus, in: DJ 1842, S. 1-12
-, Die Presse und die Freiheit, in: An 1843, Bd. 1, S. 93-116
-, Bruno Bauer und die Lehrfreiheit, in: An 1843, Bd. 1, S. 119-142
-, Neue Wendung der deutschen Philosophie, in: An 1843, Bd. 2, S. 3-61
-, Die historische Komdie unserer Zeit, in: An 1843, Bd. 2, S. 194-205
, Zwei Jahre in Paris, 2 Bde, Leipzig 1846
-, Politische Bilder aus der Zeit, 2 Bde, Leipzig 1847/1848
-, Aus frherer Zeit, Bd. 4, Berlin 1867
, Erinnerung an Michael Bakunin, in: Neue Freie Presse, Wien 28. u. 29.9.1876
-, Briefwechsel und Tagebuchbltter aus den Jahren 1825-1880. Hg. v. PAUL NERR-
LICH, 2 Bde, Berlin 1886, Zit.; >Ruge BW<
RUTENBERG, ADOLF: Zur Charakteristik von Rottecks, in: HJ 1841, S. 408-410
-, Radical, Radicalismus, in: K. v. ROTTECK, TH. WELCKER, Das Staatslexikon oder
Enzyklopdie der Staatswissenschaften, Bd. 13, Altona 1843, S. 408-420
SAINTE-BEUVE: Die Lohn-Literatur der Franzosen, in: LAZfB 2(1839) No. 130, S. 518-
519
SANDER, E.: Die protestantischen Freunde und ihre Gegner, in: NB Januar 1845, H.7,
S. 20-42
432
SASS, FRIEDRICH: Berlin in seiner neuesten Zeit und Entwicklung, Leipzig 1846
SCHALLER, JULIUS: Die Philosophie unserer Zeit. Zur Apologie und Erluterung des
Hegelschen Systems, Leipzig 1837
, Rezension: Zeitschrift fr Philosophie und spekulative Theologie, hg. v. J.H. Fichte.
Ersten Bandes, erstes Heft, in: JWK 1837 Sp. 913-917
-, Der historische Christus und die Philosophie, Leipzig 1838
SCHEIDLER, KARL HERMANN: Karl v. Rotteck ber Wesen und Studium des Ver-
nunftrechts, Jena 1841
SCHELLING, FRIEDRICH WILHELM JOSEPH: Schriften zur Gesellschaftsphiloso-
phie, hg. v. M. SCHRTER, Jena 1926
SCHMIDT, FRANZ (= FRIEDRICH HERMANN SEMMIG?): Die deutsche Philosophie
in ihrer Entwicklung zum Sozialismus, in: Deutsches Brgerbuch fr 1846. Hg. v. HER-
MANN PTTMANN, Mannheim 2 (1846) S. 57-81
SCHMIDT, JULIAN: Die gute Sache der Freiheit, in: Grenzboten 6 (1847) 1. Sem., Bd. 2,
S. 206-210
-, Geschichte der Deutschen Literatur im neunzehnten Jahrhundert, Bd. 3, Die Gegen-
wart, London Leipzig Paris
2
1855
(SCHMIDT, KARL) BRGER, KARL: Liebesbriefe ohne Liebe, Leipzig 1847
(SCHMIDT, KARL): Das Verstandestum und das Individuum, Leipzig 1846
-, Die neueste Gestaltung der Philosophie, in: EKZ 1846 Sp. 854-864
-, Uhlich und die Kirche. Eine Kritik, Potsdam 1847
-, Eine Weltanschauung. Wahrheiten und Irrthmer, Dessau 1850
SCHNITZER, KARL FRIEDRICH: Rezension: 1. W.L. Wullen, Dr., Jacob Bhme's Leben
und Lehre, Stuttgart 1836; 2. W.L. Wullen, Dr., Blthen aus Jacob Bhme's Mystik, in:
HJ 1839 Sp. 2108-2120
SCHN, THEODOR von: Woher und wohin?, Gumbinnen 1864
SCHOPENHAUER, ARTUR: Smtliche Werke. Nach der ersten, von JULIUS FRAUEN-
STDT besorgten Gesamtausgabe neu bearbeitet und hg. v. ARTHUR HBSCHER,
Bd. 5, Wiesbach 1946
-, Der handschriftliche Nachla, hg. v. ARTHUR HBSCHER, Bd. 4/1 Die Manuskript-
bcher der Jahre 1830-52, Frankfurt/M 1974
SCHWEGLER, ALBERT: Die >Revue de deux mondes< ber die junghegelsche Schule, in:
JG 2(1844) S. 466-489
-, Das preuische Cultministerium und die Hegel'sche Schule, in: JG 3(1845) S. 1-13
SPRINGER, ROBERT: Berlin's Straen, Kneipen und Clubs im Jahre 1848, Berlin 1850
STAHR, ADOLF: Kleine Schriften zur Literatur und Kunst, Bd. 1, Berlin 1871
(STEINMANN, FRIEDRICH): Bureaukratie und Beamtentum in Deutschland, Hamburg
1844
STEPELEVICH, LAWRENCE S. (Hg): The Young Hegelians. An Anthology, Cambridge
1983
STERNBERG, ALEXANDER von: Alfred, Dessau 1841
STEUSSLOFF, HANS (Hg): Die Junghegelianer. Ausgewhlte Texte. Zusammengest. und
eingel. von HANS STEUSSLOFF, Berlin 1963
STIRNER, MAX (= JOHANN CASPAR SCHMIDT): Kleinere Schriften und seine Ent-
gegnungen auf die Kritik seines Werkes >Der Einzige und sein Eigentums hg. v. JOHN
HENRY MACKAY, Stuttgart Bad Cannstatt 1976, Zit: M. Stirner, >KlSchr<
-, Gegenwort. Mit Anmerkungen und einem Nachwort von BERND KST, Telgte-West-
bevern 1977
-, Betrachtungen ber Liberalismus und Zensur, in: RhZ 24 v. 24.1.1843 (Beiblatt)
-, Der Einzige und sein Eigentum. Mit einem Nachwort hg. v. AHLRICH MEYER, Stutt-
gart 1972, Zit.: M. Stirner EE
433
STRAUSS, DAVID FRIEDRICH: Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet, 2 Bde, Tbingen
1835-36
-, Streitschriften zur Verteidigung meiner Schrift ber das Leben Jesu und zur Charakteri-
stik der gegenwrtigen Theologie, 3 Hefte, Tbingen 1837
-, Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Kampfe mit
der modernen Wissenschaft, 2 Bde, Tbingen Stuttgart 1840/1841
SUE, EUGENE: Die Geheimnisse von Paris. Mit einem Nachwort von NORBERT MIL-
LER und KARL RIHA, Hamburg 1970
SZELIGA (= FRANZ SZELIGA ZYCHLIN VON ZYCHLINSKI): Die Geheimnisse von
Paris, in: ALZ Juni 1844, H. 7, S. 8-48
-, Die Kritik, in: ALZ Oktober 1844, H. 11/12, S. 25-46
-, Die Langeweile in Allerwelt oder: Der ewige Narr. Lustspiel, in: NB Oktober 1844,
H. 4, S. 65-133
-, Die Universalreform und der Egoismus. Eine bersicht ber den Gang der Entwicke-
lung der neuesten Philosophie, Charlottenburg 1846
-, Die Organisation der Arbeit der Menschheit und die Kunst der Geschichtsschreibung
Schlossers, Gervninus', Dahlmanns und Bruno Bauers, Charlottenburg 1846
TAILLANDIER, SAINT-RENE: De la crise actuelle de la philosophie Hegelienne. Les par-
ties extremes en Allemagne, in: Revue des deux mondes, Tome XLX, Paris 15.7.1847,
S. 238-268
THEODUL, KARL FRIEDRICH: Die christlich-apostolisch-katholische Gemeinde
Schneidemhl und >die mit ihr sind< oder die Neukatholischen vor dem Richterstuhle
der heiligen Schrift, Erfurt 1845
TITTMANN, FRIEDRICH WILHELM: ber die Bestimmung des Gelehrten und seine
Bildung durch Schule und Universitt, Berlin 1833
UNGERN-STERNBERG, ALEXANDER von: Erinnerungsbltter, 4 Bde, Berlin 1855-
1858
VALLES, JULES: Die Abwegigen (Les refractaires), Hamburg 1946
VARNHAGEN VON ENSE, KARL AUGUST: Tagebcher, Bd. 1-3, Leipzig 1861-62
VATKE, JOHANN KARL WILHELM: Rezension: R. Rothe, Die Anfnge der christlichen
Kirche und ihrer Verfassung, Wittenberg 1837, in: HJ 1838 Sp. 1049-1166
VENDEDEY, JACOB: Preussen und Preussentum, Mannheim 1839
VESTER, MICHAEL (Hg): Die Frhsozialisten 1789-1848,2 Bde, Reinbek 1971
WALESRODE, LUDWIG: Glossen und Randzeichnungen zu Texten unserer Zeit,
Knigsberg 1842
WEDEMEYER, JOSEPH: Bruno Bauer und sein Apologet, in: WD 1846, S. 178-181
WEHL, FEODOR: Berlin und seine jetzige Stellung, in: Berliner Wespen, Leipzig 1843,
H. 1, S. 1-3
-, Das bermtige Stillschweigen, in: Berliner Wespen, Leipzig 1843, H. 1, S. 7-10
-, Wir Radikalen in Preuen, in: Berliner Wespen, Leipzig 1843, H. 3, S. 1-6
-, Flnerie, in: Berliner Wespen, Leipzig 1843, H. 5, S. 36-42
WEILL, ALEXANDER und BAUER, EDGAR: Berliner Novellen, Berlin 1843
WEISS, GUIDO: Die >Freien<, in: Vossische Zeitung, Nr. 293, 295, 297, 299, 301, Berlin
25.-30.6.1896
WEISSE, CHRISTIAN HERMANN: Die philosophische Literatur der Gegenwart. 2. Arti-
kel, in: ZPsT, Bd. 7(NF 3), (1841) H. 1, S. 103-150
(WESSENBERG, J.H. von): Die Reform der deutschen Universitten, Konstanz 1833
WIDMANN, ADOLPH: Der Tnnhuser, Berlin 1850
WISLICENUS, GUSTAV ADOLF: Ob Schrift? Ob Geist? Verantwortung gegen meine
Anklger, Leipzig
2
1843
(WOLFF, CM.): Heinrich Leo vor Gericht. Dramatische Scene, von A. HEGELING,
Leipzig 1838
434
ZELLER, EDUARD: Rezension: Chr. Mrklin, Dr., Darstellung und Kritik des modernen
Pietismus, Stuttgart 1839, in: HJ 1839 Sp. 1845-1880
-, Zur Charakteristik der modernen Bekehrungen, in: JG3(1845), S. 14-32
ZSCHIESCHE, KARL: Die deutsche Theologie. Ein polemisches Votum gegen Prof. Dr.
Heinrich Leo in Halle, Leipzig 1838
B. Sekundrliteratur
ABERCROMBIE, NICHOLAS (1980): Class, Structure and Knowledge. Problems in the
Sociology of Knowledge, Oxford
ABRAHAM, KARL (1955): Der Strukturwandel im Handwerk in der ersten Hlfte des
19. Jahrhunderts, Kln
ADLER, MAX (1914): Max Stirner, in: ders., Wegweiser. Studien zur Geistesgeschichte des
Sozialismus, Stuttgart, S. 173-199
ADORNO, THEODOR W (1955): Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft, Frankfurt/M
-, (1966): Negative Dialektik, Frankfurt/M
-, (1974): Kierkegaard, Frankfurt/M
ALGERMISSEN, KONRAD (1959): Konfessionskunde, Hannover
ANDREAS, BERT (1964/65): Marx et Engels et la gauche hegelienne, in: Annali 7, S. 353-
526
ANDREAS, BERT/WOLFGANG MNKE (1968): Neue Daten zur Deutschen Ideolo-
gie. Mit einem unbekannten Brief von Karl Marx und anderen Dokumenten, in: AfS 8
S. 5-159
APEL, KARL-OTTO (1972): Die Kommunikationsgemeinschaft als transzendentale Vor-
aussetzung der Sozialwissenschaften, in: Neue Hefte fr Philosophie H. 2/3, Gttingen,
S. 1-40
ARMANSKI, GERHARD (1974): Die Entstehung des wissenschaftlichen Sozialismus,
Darmstadt Neuwied
ARVON, HENRI (1951): Une polemique inconnue: Marx et Stirner, in: Les Temps Moder-
nes 7, S. 509-536
-, (1954): Aux sources de l'existentialisme: Max Stirner, Paris
-, (1957): Ludwig Feuerbach ou k transformation de sacre, Paris
ASCHERI, CARLO (1969): Feuerbachs Bruch mit der Spekulation. Kritische Einleitung
zu: Feuerbach, Die Notwendigkeit einer Vernderung (1842), Frankfurt/M
ASMUS, HELMUT (1977): Die >Rheinische Zeitung< und die Genesis des rheinpreui-
schen Bourgeoisliberalismus, in: BLEIBER, HELMUT (Hg), Bourgeoisie und brgerli-
che Umwlzung in Deutschland 1789-1871, Berlin (Ost), S. 135-168
BAB, JULIUS (1904): Die Berliner Boheme, Berlin Leipzig, 3. AuB.
BACK KURT W./DONNA POLISAR (1983): Salons und Kaffeehuser, in: KZfSS Sonder-
heft 25, S. 276-286
BAHRDT, HANS PAUL (1971): Wissenschaftssoziologie - ad hoc, Beitrge zur Wissen-
schaftssoziologie und Wissenschaftspolitik aus den letzten 10 Jahren, Dsseldorf
, (1980): Gruppenseligkeit und Gruppenideologie, in: Merkur 34, H. 2, S. 122-136
BALAZS, EVA H. u.a. (Hg) (1979): Befrderer der Aufklrung in Mittel- und Osteuropa -
Freimaurer, Gesellschaften, Clubs, Berlin
BALSER, FROLINDE (1959): Die Anfnge der Erwachsenenbildung in Deutschland in der
ersten Hlfte des 19. Jahrhunderts, Stuttgart
435
BARNIKOL, ERNST (1928): Bruno Bauers Kampf gegen Religion und Christentum und
die Spaltung der vormrzlichen preuischen Opposition, in: Zeitschrift fr Kirchenge-
schichte 46 (N.F. 9), H. 1, S. 1-34
-, (1958): Das Leben Jesu der Heilsgeschichte, Halle (Saale)
-, (1961): Das ideengeschichtliche Erbe Hegels bei und seit Strau und Bauer im W.Jahr-
hundert, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universitt Halle-Witten-
berg 10, S. 281-328
-, (1972): Bruno Bauer. Studien und Materialien. Aus. d. Nachla ausgewhlt und zusam-
mengestellt v. PETER REIMER u. HANS-MARTIN SASS, Assen
BARTH, KARL (1947): Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, Zrich
BARTH, PAUL (1890): Die Geschichtsphosophie Hegels und der Hegelianer, bis auf
Marx und Hartmann, Leipzig
BARUZZI, ARNO (1978): Skularisierung. Ein Problem von Enteignung und Besitz, in:
Philosophisches Jahrbuch 85, S. 301-316
BATAILLE, GEORGES (1975): Die Aufhebung der konomie. Das theoretische Werk
Bd. 1, hg. v. GERD BERGFLETH, Mnchen
BATKIN, LEONID M. (1981): Die italienische Renaissance. Versuch einer Charakterisie-
rung eines Kulturtyps, Frankfurt/M
BAUDRILLARD JEAN (1982): Der symbolische Tausch und der Tod, Mnchen
-, (1984): Das Jahr 2000 wird nicht stattfinden. Nach der Geschichte: Herrschaft der
Simulation, Vorlesung an der FU Berlin vom 24.1.1984 (Masch.Schr.)
BAUER, ILENA/ANITA LIEPERT (1982): Zum Differenzierungsproze im Liberalismus
des deutschen Vormrz. Das Verhltnis zwischen den Junghegelianern und dem >Staats-
lexikon<
;
in: ZfG 30, H. 5, S. 413^125
BAUMERT, DIETER PAUL (1928): Die Entstehung des deutschen Journalismus. Eine
soziologische Studie, Mnchen Leipzig
BECKJAMES H. (1981): Raffael, Kln
BEHRENS, WOLFGANG W./BOTT, GERHARD u.a. (1973): Der literarische Vormrz
1830-1847, Mnchen
BELOW, ANDREAS ANTON von (1978): Der soziale Status der Akademiker in der preu-
ischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Zur Entstehung und zum Wandel einer pri-
vilegierten Berufsschicht, Diss Bonn
BENJAMIN, WALTER (1974): Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapi-
talismus, in: ders., GS hg. v. ROLF TIEDEMANN und HERMANN SCHWEPPEN-
HUSER, Bd. I, Frankfurt, S. 509-690
-, (1982): Das Passagen-Werk, in: ders., GS, hg. v. ROLF TIEDEMANN und HER-
MANN SCHWEPPENHUSER, Bd. V, Frankfurt/M
BENNE, KENNETH D./SHEATS, PAUL (1948): Functional roles of group members, in:
The Journal of Social Issues 4, S. 4149
BENZ, ERNST (1934): Ecclesia Spiritualis. Kirchenidee und Geschichtstheologie der fran-
ziskanischen Reformation, Stuttgart
-, (1955a): Schellings theologische Geistesahnen, Mainz
-, (1955b): Hegels Religionsphilosophie und die Linkshegelianer, in: ZfRGG 7, H. 3,
S. 247-270
, (1961): Das Bild des bermenschen in der europischen Geistesgeschichte, in: ders.
(Hg), Der bermensch, Eine Diskussion, Zrich Stuttgart, S. 19-161
-, (1973): Endzeiterwartung zwischen Ost und West. Studien zur christlichen Eschatolo-
gie, Freiburg
BERGER, PETER L. (1973): Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft. Elemente einer
soziologischen Theorie, Frankfurt/M
436
BERGERON, LOUIS/FURET, FRANCOIS/KOSELLECK, REINHART (1969): Das
Zeitalter der europischen Revolution, Frankfurt/M
BERGH VAN EYSINGA, GUSTAV ADOLF van den (1947-55): Godsdienst-Weten-
schappelijke Studien, II, VII, VIII, IX, XII, XIV, XVII, Haarlem 1947, 1950-1953,
1955
-, (1963): Aus einer unverffentlichten Biographie von Bruno Bauer. Bruno Bauer in
Bonn in: Annali 6, S. 329-386
BERGNER, JEFFREY (1973): Stirner, Nietzsche, and the Critique of Truth, in: Journal of
the History of Philosophy, University of California San Diego, Vol. 11, S. 523-534
BERING, DIETZ (1978) Die Intellektuellen. Geschichte eines Schimpfwortes, Stuttgart
BEYER, WILHELM R. (1967): Hegel-Bilder. Kritik der Hegel-Deutungen, Berlin, 2. Aufl.
BIALAS, WOLFGANG/KLAUS RICHTER/MARTINA THOMI (1980): Marx - Hegel -
Feuerbach. Zur Quellenrezeption in der Herausbildungsphase des Marxismus, in: Zeit-
schrift fr Philosophie 28, S. 331-345
BIEBERSTEIN, JOHANNES ROGALLA von (1979): Geheime Gesellschaften als Vorlu-
fer politischer Parteien, in: P.C. LUDZ (Hg), Geheime Gesellschaften, Heidelberg, S.
429^460
BIGLER, ROBERT M. (1972): The Politics of German Protestantism. The Rise of the Pro-
testant Church Elite in Prussia 1815-1848, Berkeley
-, (1974): The Social Status and Political Role of the Protestant Clergy in Pre-March-Prus-
sia, in: Sozialgeschichte heute. Festschrift fr HANS ROSENBERG zum 70. Geburts-
tag, hg. v. HANS-ULRICH WEHLER, Gttingen, S. 175-190
BINGER, LOTHAR (1974): Kritisches Pldoyer fr die Gruppe, in: Kursbuch 37, S. 1-25
BLACKBOURN, DAVID/GEOFF ELY (1980): Mythen deutscher Geschichtsschreibung.
Die gescheiterte Brgerliche Revolution von 1848, Frankfurt/M Berlin Wien
BLASCHKE, FRIEDRICH (1919): Das Verhltnis Arnold Ruges zu Hegel, Diss Leipzig
(Masch.schr.)
BLUMENBERG, HANS (1974): Skularisierung und Selbstbehauptung (Erw. Neuausgabe
v. >Die Legitimitt der Neuzeit<, erster und zweiter Teil) Frankfurt/M
BLUMER, HERBERT (1973): Der methodologische Standort des symbolischen Interaktio-
nismus, in: AG Bielefelder Soziologen (Hg), Alltagswissen, Interaktion und gesellschaft-
liche Wirklichkeit, Bd. 1, Reinbek, S. 80-146
BOCK, HANS MANFRED (1976): Geschichte des >linken Radikalismus< in Deutschland.
Ein Versuch, Frankfurt/M
BOLDT, WERNER (1971): Die Anfnge des deutschen Parteiwesens. Fraktionen, politi-
sche Vereine und Parteien in der Revolution 1848, Paderborn
BOTTIGELLI, EMILE (1963): Karl Marx et la gauche hegelienne. Contribution l'etude
de leurs rapports, in: Annali 6, S. 9-33
BRADSHAW, STEVE (1978): Cafe Society: Bohemian Life from Swift to Bob Dylan, Lon-
don
BRANDENBERG, ALEXANDER (1977): Theoriebildungsprozesse in der deutschen
Arbeiterbewegung 183550, Hannover
BRANDHORST, HEINZ-HERMANN (1981): Lutherrezeption und brgerliche Emanzi-
pation. Studien zum Luther- und Reformationsverstndnis im deutschen Vormrz
(1815-1848) unter besonderer Bercksichtigung Ludwig Feuerbachs, Gttingen
BRANDT, HARTWIG (1974): Gesellschaft, Parlament, Regierung in Wrttemberg 1830-
1840, in: GERHARD ALBERT RITTER (Hg), Gesellschaft, Parlament, Regierung zur
Geschichte des Parlamentarismus in Deutschland, Dsseldorf, S. 101-118
BRANIG, HANS (1979): Wesen und Geist der hheren Verwaltungsbeamten in Preuen
in der Zeit des Vormrz, in: Neue Forschungen zur Brandenburgisch-Preuischen
Geschichte, Bd. 1, Kln Wien, S. 161-171
437
BRAZILL, WILLIAM J. (1970): The Young Hegelians, New Haven
BREDERLOW, JRN (1976): Lichtfreunde und Freie Gemeinden. Religiser Protest
und Freiheitsbewegung im Vormrz und in der Revolution von 1848/49, Mnchen
Wien
BRINKMANN, CARL (1932): Der Nationalismus und die deutschen Universitten im Zeit-
alter der deutschen Erhebung, Heidelberg
BORNE, GERHARD F. (1979): Christlicher Atheismus und radikales Christentum. Stu-
dien zur Theologie von Thomas Altizer im Zusammenhang mit Ketzereien der Kirchen-
geschichte, der Dichtung von Wiliam Blake und der Philosophie von G.F.W. Hegel,
Mnchen
BUBNER, RDIGER (1970): Philosophie ist ihre Zeit, in Gedanken gefat, in: ders. u.a.
(Hg), Hermeneutik und Dialektik I, Tbingen, S. 317-342
-, (1971a): Was ist kritische Theorie? in: Hermeneutik und Ideologiekritik. Mit Beitrgen
von K.O. APEL u.a., Frankfurt/M, S. 160-209
-, (197 lb): Theorie und Praxis - eine nachhegelsche Abstraktion, Frankfurt/M
BUCHBINDER, REINHARD (1976): Bibelzitate, Bibelanspielungen, Bibelparodien, theo-
logische Vergleiche und Analogien bei Marx und Engels, Berlin
BUSCH, OTTO/HERZFELD, HANS (Hg) (1975): Die frhsozialisitschen Bnde in der
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Berlin
BTTNER, GEORG (1912): Robert Prutz. Ein Beitrag zu seinem Leben und Schaffen von
1816-1842, Greifswald
BTTNER, WOLFGANG (1967): Georg Herwegh und die deutsche Arbeiterbewegung,
in: ZfG 15, S. 801-821
CARR, EDWARD HALLET (1937): Michael Bakunin, London
CARROLL, JOHN (1974): Break-Out from the Crystal Palace. The anarcho-psychological
critique: Stirner, Nietzsche, Dostojevsky, London Boston
CESA, CLAUDIO (1960): Bruno Bauer e la filosofia dell'autocoscienza (1841-1843), in:
Giornale Critico della Filosofia Italiana 39, S. 73-93
-, (1963): Figureeproblemidella storiografiafilosofica dellasinistrahegeliana 1831-1848,
in: Annali 6, S. 62-104
CLAESSENS, DIETER (1977): Gruppe und Gruppenverbnde. Systematische Einfhrung
in die Folgen von Vergesellschaftung, Darmstadt
CLAUSSE, ROGER (1962): Publikum und Information. Entwurf einer ereignisbezogenen
Soziologie des Nachrichtenwesens, Kln Opladen
COLPE, CARSTEN (1961): Die religionsgeschichtliche Schule, Gttingen
COMOTH, KATHARINA (1975): Die Verwirklichung der Philosophien Subjektivitt
und Verobjektivierung im Denken des jungen Marx, Bonn
-, (1975): Zur Negation des religisen Bewutseins in der Kritik Bruno Bauers, in:
NZSyThRPh 17, S. 214-24
COMSTOCK, RICHARD W. (1977): Young Hegelians and Radical Theologians Revisited,
in: Religion in Life 66, S. 343-356
CONZE, WERNER (Hg) (1962): Staat und Gesellschaft im deutschen Vormrz 1815-
1848, Stuttgart
CORNEHL, PETER (1971): Die Zukunft der Vershnung. Eschatologie und Emanzipa-
tion in der Aufklrung, bei Hegel und in der Hegeischen Schule, Gttingen
CORNU, AUGUSTE (1954-1968): Karl Marx und Friedrich Engels. Leben und Werk,
3 Bde, Berlin (Ost)
CRANE, DIANA (1972): Invisible Colleges; Diffusion of Knowledge in Scientific Commu-
nities, Chicago
DAELE, WOLFGANG van den (1977): Die soziale Konstruktion der Wissenschaft - Insti-
tutionalisierung und Definition der positiven Wissenschaft in der zweiten Hlfte des
438
17. Jahrhunderts, in: G. BHME u.a., Experimentelle Philosophie, Frankfurt/M,
S. 129-182
DANN, OTTO (1976): Die Anfnge politischer Vereinsbildung in Deutschland, in:
ENGELHARDT, ULRICH u.a. (Hg), Soziale Bewegung und politische Verfassung,
Stuttgart, S. 197-232
DANN, OTTO (Hg) (1981): Lesegesellschaft und brgerliche Emanzipation. Ein europi-
scher Vergleich, Mnchen
DANNENMANN, CHRISTOPHER (1969): Bruno Bauer. Eine monographische Untersu-
chung, Phil Diss Erlangen Nrnberg
DEMPF, ALOIS (1954): Sacrum Imperium. Geschichts- und Staatsphilosophie des Mittel-
alters und der politischen Renaissance, Darmstadt, 2. Aufl.
Deutsche Zeitschrift fr Philosophie (1972) 20, H. 9: Ludwig Feuerbach 1804-1872. Bei-
trge von FRIEDRICH RICHTER, ALFRED KOSING, OTTO FINGER, GOTT-
FRIED STIEHLER
DICKE, GERD (1960): Der Identittsgedanke bei Feuerbach und Marx, Kln Opladen
DIEDERICH, WERNER (Hg) (1974): Theorien der Wissenschaftsgeschichte. Beitrge zur
diachronen Wissenschaftstheorie, Frankfurt/M
DIEFENDORF, JEFFRY M. (1980): Businessmen and Politics in the Rhineland, 1789-
1834, Princeton
DOKTOR, WOLFGANG (1975): Die Kritik der Empfindsamkeit, Bern Frankfurt/M
DOWE, DIETER (1981): Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung,
sozialistischen und kommunistischen Bewegungen von den Anfngen bis 1863, Bonn
BadGodesberg,3.Aufl.
DROZ, JAQUES (1940): Le liberalisme rhenan. 1815-1848. Contribution l'histoire du
liberalisme allemand, Paris
DROZ, JAQUES/PIERREAYgOBERRY (1963): Structuressocialeset courantes ideologi-
ques dans l'Allemagne prerevolutionnaire 1835-1847, in: Annali, Mailand 6, S. 164-236
DUNK, HERMANN von der (1966): Der deutsche Vormrz und Belgien, Wiesbaden
DUERR, HANS PETER (1974): Ni Dieu - ni metre. Anarchische Bemerkungen zur
Bewutseins- und Erkenntnistheorie, Frankfurt/M
DLMEN, RICHARD van (1975): Der Geheimbund der Illuminaten. Darstellung, Ana-
lyse, Dokumentation, Stuttgart Bad Cannstatt
-, (1980): Religionsgeschichte in der Historischen Sozialforschung, in: GG 6, S. 36-59
DUVERGER, MAURICE (1959): Die politischen Parteien, Tbingen
DUX, GNTER (1982): Die Logik der Weltbilder. Sinnstrukturen im Wandel der
Geschichte, Frankfurt/M
ECK, ELSE von (1925): Die Literaturkritik in den Hallischen und Deutschen Jahrbchern
1838-1842, Mnchen
EDLER, ERICH (1932): Eugene Sue und die deutsche Mysterienliteratur, Diss Berlin
ELKAR, RAINER SIEGBERT (1979): Junges Deutschland im polemischen Zeitalter. Das
schleswig-holsteinische Bildungsbrgertum in der ersten Hlfte des 19. Jahrhunderts.
Zur Bildungsrekrutierung und politischen Sozialisation, Dsseldorf
ENGELSING, ROLF (1966): Massenpublikum und Journalistentum im 19. Jahrhundert in
Nordwestdeutschland, Berlin
ERDMANN, JOHANN EDUARD (1896): Grundri der Geschichte der Phosophie Bd.
2, Philosophie, der Neuzeit, Halle, 4. Aufl.
ESAU, LOTTE (1935): Karl Rosenkranz als Politiker. Studien ber den Zusammenhang der
geistigen und politischen Bewegung in Ostpreuen, Halle
ESSBACH, WOLFGANG (1982): Gegenzge. Der Materialismus des Selbst und seine
Ausgrenzung aus dem Marxismus - eine Studie ber die Kontroverse zwischen Max
Stirner und Karl Marx, Frankfurt/M
439
-, (1985a): Der Anteil des Einzigen am Verschwinden des subjektiven Faktors. Eine Fort-
setzung zu Marxismus und Subjektivitt, in: Concordia. Internationale Zeitschrift fr
Philosophie, Frankfurt/M, Nr. 7, S. 2-22
-, (1985b): Materialitt des Diskurses, in: GESA DANE, WOLFGANG ESSBACH,
CHRISTA KARPENSTEIN-ESSBACH, MICHAEL MAKROPOULOS (Hg),
Anschlsse. Versuche nach Michel Foucault, Tbingen, S. 207-214
-, (1985c): Der Umzug der Gtter. Auf den Spuren der Religionskritik, in: sthetik und
Kommunikation, Jg. 16, H. 60, Berlin, S. 101-111
-, (1986): Kompakte Klassen und Klasseneffekte. berlegungen zur Klassentheorie, in:
SOG. Konvergenz und Peripherie der Systeme, hg. v. REINER MATZKER, H. 2, Ber-
lin, S. 5-15
EUCHNER, WALTER (1982a): Karl Marx, Mnchen
-, (1982b): ber das Altern revolutionrer Ideen. Materialien zum bergang des Herz-
klopfens fr das Wohl der Menschheit in den Weltlauf und der Versuch eines Resmees,
in: Das Parlament v. 14.8.1982, Beilage: Aus Politik und Zeitgeschichte, S. 24-40
EVERKE, KARL FRIEDRICH (1974): Zur Funktionsgeschichte der politischen Parteien,
Baden-Baden
EWERT, MICHAEL (1982): Die problematische Kritik der Ideologie. Spekulativer Schein
(Kant, Fichte, Hegel, Marx) und seine politische Auflsung (die sozialdemokratische
Erbengemeinschaft), Frankfurt/M New York
FABER, KARL GEORG (1975): Strukturprobleme des deutschen Liberalismus im
19. Jahrhundert, in: Der Staat 14, S. 201-227
FAISAL, FARIS FANNER AL (1976): Max Stirner und die pluralistische Wirtschaftsge-
sellschaft, Diss, Graz
FANTO, IRENE (1937): Karl Marx und sein demokratischer Gegner Arnold Ruge, Diss
Wien
FAST, HEINOLD (Hg) (1962): Der linke Flgel der Reformation. Glaubenszeugnisse der
Tufer, Spiritualisten, Schwrmer und Antitrinitarier, Bremen
FEHRENBACH, ELISABETH (1983): Rheinischer Liberalismus und gesellschaftliche
Verfassung, in: W. SCHIEDER (Hg), Liberalismus in der Gesellschaft des Vormrz,
Gttingen, S. 272-294
FETSCHER, IRING (1980): Nihilismus, in: Probleme des Nihilismus. Dokumente der
Triester Konferenz 1980 (= Berliner Hefte 17) S. 86-96
FISCHER, FRITZ (1951): Der deutsche Protestantismus und die Politik im 19. Jahrhun-
dert, in: HZ 171, S. 473-518
FISCHER, HERMANN (1916): Die Hallischen Jahrbcher und die Schwaben, in: Wrt-
tembergische Vierteljahrshefte fr Landesgeschichte 25, S. 558-571
FISCHER, WOLFRAM (1964): Das deutsche Handwerk in den Frhphasen der Industria-
lisierung, in: Zeitschrift fr die gesamte Staatswissenschaft 120, S. 686-712
FOUCAULT, MICHEL (1977a): Die Ordnung des Diskurses, Mnchen
-, (1977b): berwachen und Strafen. Die Geburt des Gefngnisses, Frankfurt/M
-, (1978): Dispositive der Macht. ber Sexualitt, Wissen und Wahrheit, Berlin
FRANK, MANFRED (1975): Der unendliche Mangel an Sein. Schellings Hegelkritik und
die Anfnge der Marxschen Dialektik, Frankfurt/M
FRANKE, RICHARD WALTER (1930): Zensur und Preaufsicht in Leipzig 1830-1848.
Mit einem berblick ber die gleichzeitige schsische Pregesetzgebung, Diss Leipzig
GADAMER, HANS GEORG (1965): Wahrheit und Methode, Tbingen, 2. Aufl.
GALL, LOTHAR (Hg) (1976): Liberalismus, Kln
GAMM, GERHARD (1981): Der Wahnsinn in der Vernunft. Historische und erkenntnis-
kritische Studien zur Dimension des Anders-Seins in der Philosophie Hegels, Bonn
440
GARBER, KLAUS (1983): Gelehrtenadel und feudalabsolutistischer Staat, in: JUTTA
HELD (Hg), Kultur zwischen Brgertum und Volk, Berlin, S. 31-43
GAREWICZ, JAN (1967): August Cieszkowskis Einschtzung bei den Deutschen in den
dreiiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts, in: Der Streit um Hegel bei den Sla-
wen, Prag
GEBHARDT, JRGEN (1962): Karl Marx und Bruno Bauer, in: Politische Ordnung und
menschliche Existenz, Festgabe fr ERIC VOEGELIN, Mnchen
-, (1963): Politik und Eschatologie. Studien zur Geschichte der Hegeischen Schule in den
Jahren 1830-1840, Mnchen
-, (1964): Die pdagogischen Anschauungen der Lichtfreunde und Freien Gemeinden.
Ein Beitrag zur Einschtzung der kleinbrgerlich-demokratischen Bewegungen in
Deutschland im 19. Jahrhundert, in: Jahrbcher fr Erziehungs- und Schulgeschichte 4,
S. 71-113
GEIGER, THEODOR (1949): Aufgaben und Stellung der Intelligenz in der Gesellschaft,
Stuttgart
-, (1962): Arbeiten zur Soziologie, Neuwied Berlin
GERLACH, ANTJE (1975): Deutsche Literatur im Schweizer Exil. Die politische Propa-
ganda der Vereine deutscher Flchtlinge und Handwerksgesellen in der Schweiz von
1833-1845, Frankfurt/M
GERTH, HANS (1935): Die sozialgeschichtliche Lage der brgerlichen Intelligenz um die
Wende des 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Soziologie des deutschen Frhliberalis-
mus, Diss Frankfurt/M (Gttingen 1976)
GILLIS, JOHN R. (1971): The Prussian Bureaucracy in Crisis 1840-1860. Origins of an
Administrative Ethos, Stanford
GLOCKNER, HERMANN (1931): Friedrich Theodor Vischer und das 19. Jahrhundert,
Berlin
GOLDFRIEDRICH, JOHANN (1909): Geschichte des Deutschen Buchhandels, Bd. 3,
Leipzig
GRAB, WALTER (1979): Ein Mann, der Marx Ideen gab. Wilhelm Schulz (1797-1860)
Weggefhrte Georg Bchners, Demokrat der Paulskirche. Eine politische Biographie,
Dsseldorf
-, (1980): Die Kontinuitt der demokratischen Bestrebungen 1792-1848, in: OTTO
BUSCH (Hg), Die demokratische Bewegung in Mitteleuropa im ausgehenden 18. und
frhen 19. Jahrhundert. Ein Tagungsbericht, Berlin, S. 439-452
GRAB, WALTER/JULIUS SCHOEPS (Hg) (1983): Juden im Vormrz und in der Revolu-
tion von 1848, Stuttgart Bonn
GRFE, GERHARD (1936): Die Gestalt des Literaten im Zeitroman des 19. Jahrhunderts,
Diss Berlin
GRAF, FRIEDRICH WILHELM (1978a): D.F. Strau und die Hallischen Jahrbcher. Ein
Beitrag zur positioneilen Bestimmtheit der theologischen Publizistik im 19. Jahrhun-
dert, in: AKG 60, S. 383-430
-, (1978b): Die Politisierung des religisen Bewutseins. Die brgerlichen Religionspar-
teien im deutschen Vormrz: Das Beispiel des Deutschkatholizismus, Stuttgart
-, (1982a): Kritik und Pseudo-Spekulation. David Friedrich Strau als Dogmatiker im
Kontext der positioneilen Theologie seiner Zeit, Mnchen
GRAF, FRIEDRICH WILHELM/FALK WAGNER (1982b): Die Flucht in den Begriff.
Materialien zu Hegels Religionsphilosophie, Stuttgart
GRANDJONC, JAQUES (1975): Ideologische Auseinandersetzungen im >Bund der
Gerechter, in: O. BUSCH, H. HERZFELD (Hg), Die frhsozialistischen Bnde in der
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Berlin, S. 81-94
-, (1978): Les rapports des socialistes et neo-hegeliens de l'emigration avec les socialistes
441
francais 1840-1847. Aspects de relations franco-allemands 1830-1848. Actes du Col-
loque d'Otzenhausen 3.-5.10.1977, Metz, S. 73-86
GREBING, HELGA (1962): Geschichte der deutschen Parteien, Wiesbaden
GRIEWANK, KARL (1924): Vulgrer Radikalismus und demokratische Bewegung in Ber-
lin 1842-1848, in: Forschungen zur brandenburgisch-preuichen Geschichte 36, S. 14-
37
GROH, DIETER (1961): Ruland und das Selbstverstndnis Europas. Ein Beitrag zur
europischen Geistesgeschichte, Neuwied
-, (1964): Junghegelianer und noch kein Ende, in: Der Staat 3, S. 346-357
GROTH, GNTHER (1967): Arnold Ruges Philosophie unter besonderer Bercksichti-
gung seiner sthetik. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte Hegels, Diss Hamburg
GRUNDMANN, HERBERT (1950): Neue Forschungen ber Joachim de Fiore, Marburg
GNTHER, ALFRED (1920): Wilhelm Jordan als Freiheitssnger und Politiker. Neue Bei-
trge zur Geschichte seines dichterischen Schaffens und seiner politischen Bettigung
bis 1849 unter Benutzung des handschriftlichen Nachlasses, Diss Mnster
GUERIN, DANIEL (1967): Anarchismus. Begriff und Praxis, Frankfurt/M
HAACKE, WILMONT (1968): Die politische Zeitschrift 1665-1965, Stuttgart
HABERMAS, JRGEN (1965): Strukturwandel der ffentlichkeit, Neuwied u.a. 2. AuO.
-, (1985): Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwlf Vorlesungen, Frankfurt/M
HAFERKORN, HANS JRGEN (1964). Der freie Schriftsteller. Eine literatur-soziologi-
sche Studie ber seine Entstehung und Lage in Deutschland zwischen 1750 und 1800,
in: Archiv fr Geschichte des Buchwesens 5, Sp 523-712
HAHN, ALOIS (1974): Religion und der Verlust der Sinngebung. Identittsprobleme in
der modernen Gesellschaft, Frankfurt/M
HANSEN, JOSEPH (1906): Gustav von Mevissen. Ein rheinisches Lebensbild, Berlin
HARRIS, HORTON (1973): David Friedrich Strau and his Theology, London
-, (1975): The Tbingen School, Oxford
HARTMANN, FRITZ/RUDOLF VIERHAUS (Hg) (1972): Der Akademiegedanke im 17.
und 18. Jahrhundert, Bremen Wolfenbttel
HAUSER, ARNOLD (1957): Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, Mnchen
HAUSRATH, ADOLF (1876-78): D.F. Strauss und die Theologie seiner Zeit, 2 Bde, Hei-
delberg
HELLMANN, ROBERT JAMES (1977): Die Freien: The Young Hegelians of Berlin and
the Religious Politics of 1840 Prussia, Columbia University PhD
HELMS, HANS G. (1966): Die Ideologie der anonymen Gesellschaft. Max Stirners Einzi-
gen und der Fortschritt des demokratischen Selbstbewutseins im Vormrz bis zur
Bundesrepublik, Kln
HENDERSON, WILLIAM OTTO (1976): The Life of Friedrich Engels, 2 Bde, London
HENNING, HANS JOACHIM (1977): Sozialgeschichtliche Entwicklungen in Deutsch-
land 18151860.1. Das Bildungsbrgertum, Paderborn
HENRICH, DIETER (1971): Hegel im Kontext, Frankfurt/M
HENRICH, DIETER/ROLF-PETER HORSTMANN (1982): Hegels Philosophie des
Rechts. Die Theorie der Rechtsformen und ihre Logik, Stuttgart
HENRY, MICHEL (1972): La critique de la religion et le concept de genre dans l'essence
du christianisme, in: Revue internationale de philosophie 26 No. 101, S. 386-404
HEPNER, BENOLT-P. (1950): Bakounine et le panslavisme revolutionnaire. Cinq essais sur
l'histoire des idees en Russie et en Europe, Paris
HERMAND, JOST/MANFRED WINDFUHR (Hg) (1970): Zur Literatur der Restaura-
tionsepoche 1815-1848, Stuttgart
HERMANN, GEORG (1965): Das Biedermeier im Spiegel seiner Zeit, Oldenburg Ham-
burg
442
HERMELINK, HEINRICH (1951-1955): Das Christentum in der Menschheitsgeschichte,
3 Bde, Tbingen
HERTZ-EICHENRODE, DIETER (1957): Der Junghegelianer Bruno Bauer im Vormrz,
Diss Berlin
, (1962): >Massenpsychologie< bei den Junghegelianern, in: IRSH 7, S. 231259
HERZBERG, GUNTOLF (1968): Die Bedeutung der Kritik von Marx und Engels an Max
Stirner, in: Deutsche Zeitschrift fr Philosophie 16, H. 12, S. 1454-1471
HEYDORN, HANS JOACHIM (1971/72): Vom Hegeischen Staat zur permanenten
Revolution. Einleitung zur Neuherausgabe der Hallischen und Deutschen Jahrb-
cher (10 Bde) Glashtten in Ts
HILDEBRANDT, GNTHER (1973): Programme und Bewegung des sddeutschen Libe-
ralismus nach 1830, in: Jahrbuch fr Geschichte 9, S. 7-45
HINTZE, OTTO (1906): Die Epochen des evangelischen Kirchenregiments in Preuen, in:
HZ 97, S. 67-118
HIRSCH, HELMUT (1955): Karl Friedrich Koeppen, der intimste Berliner Freund Mar-
xens, in: ders., Denker und Kmpfer. Gesammelte Beitrge zur Geschichte der Arbei-
terbewegung, Frankfurt/M, S. 19-81
, (1961): Die Berliner Welcker-Kundgebung. Zur Frhgeschichte der Volksdemonstra-
tionen, in: AfS 1, S. 27-42
-, (1975): Moses He: Vorkmpfer der Freiheit, Kln
-, (1980): Marx und Moses: Karl Marx zur >Judenfrage< und zu Juden, Frankfurt/M Bern
Cirencester
-, (1983): Karl Marx zur Judenfrage und zu Juden - Eine weiterfhrende Metakritik? in:
WALTER GRAB, JULIUS H. SCHOEPS (Hg), Juden im Vormrz und in der Revolu-
tion von 1848, Stuttgart Bonn, S. 199-213
HOBSBAWN, ERIC (1962): Europische Revolutionen, Zrich
HOEFER, FRANK THOMAS (1981/82): Pressepolitik und Polizeistaat Mettemichs. Die
berwachung von Presse und politischer ffentlichkeit in Deutschland und den Nach-
barstaaten durch das Mainzer Informationsbro (1833-1848), Diss Tbingen
HLSCHER, LUCIAN (1979): ffentlichkeit und Geheimnis. Eine begriffsgeschichtliche
Untersuchung zur Entstehung der ffentlichkeit in der frhen Neuzeit, Stuttgart
HMBERG, WALTER (1975): Zeitgeist und Ideenschmuggel. Die Kommunikationsstra-
tegie des Jungen Deutschland, Stuttgart
HOLBORN, HAJO (1966): Der deutsche Idealismus in sozialgeschichtlicher Beleuchtung,
in: HANS ULLRICH WEHLER (Hg), Moderne deutsche Sozialgeschichte, Kln Ber-
lin, S. 85-108
HOMANS, GEORGE CASPAR (1965): Theorie der sozialen Gruppe, Kln Opladen
HONIGSHEIM, PAUL (1923): Die Boheme, in: Klner Vierteljahrshefte fr Soziologie 3,
H.1,S. 60-71
HOOK, SIDNEY (1936): From Hegel to Marx. Studies in the IntellectualDevelopment of
Karl Marx, New York
HORKHEIMER, MAX / THEODOR W. ADORNO (1956): Soziologische Exkurse,
Frankfurt/M
HOUBEN, HEINRICH HUBERTUS (1918): Hier Zensur - Wer dort? Antworten von
gestern auf Fragen von heute, Leipzig
-, (1924): Der gefesselte Biedermeier, Leipzig
-, (1978): Der ewige Zensor. Lngs- und Querschnitte durch die Geschichte der Buch-
und Theaterzensur. Mit einem Nachwort von CLAUS RICHTER u. WOLFGANG
LABUHN, Kronberg
HUBER, ERNST RUDOLF (1967/68): Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 1 u.
2, Stuttgart, 2. Aufl.
443
HUBER, HANS (1932): Karl Heinzen (1809-1880). Seine politische Entwicklung und
publizistische Wirksamkeit, Bern Leipzig
HUSUNG, HANS G. (1983): Protest und Repression im Vormrz. Norddeutschland zwi-
schen Restauration und Revolution, Gttingen
HUTH, ARMIN (1975): Prefreiheit oder Censur. Staatliche Pressepolitik und politische
Schriften in Wrzburg und Unterfranken zwischen Revolution und Reaktion 1847
1850, Wrzburg
IM HOF, ULRICH (1982): Das gesellige Jahrhundert. Gesellschaft und Gesellschaften im
Zeitalter der Aufklrung, Mnchen
Institut d'Etudes Slaves (Hg) (1979): Bakounine, Combats et debats, Paris
JACOBSON, MAX (1905): Zur Geschichte der Hegelschen Philosophie und der preui-
schen Universittsverwaltung in der Zeit von 1830-1860, in: Deutsche Revue 30/2,
S. 118-123
JAECK, HANS-PETER (1979): Die franzsische brgerliche Revolution von 1789 imFrh-
werk von Karl Marx. (1843-1846). Geschichtsmethodologische Studien, Berlin (Ost)
JAESCHKE, WALTER (1979): Staat aus christlichem Prinzip und christlicher Staat. Zur
Ambivalenz der Berufung auf das Christentum in der Rechtsphilosophie und der
Restauration, in: Der Staat 18, S. 349-74
JARAUSCH, KONRAD H. (1974): The Sources of German Student Unrest 1815-1848, in:
L. STONE (Hg), The University in Society, Bd. 2, Princeton, S. 533-569
JELTI, ARUN KUMAR (1981): The Role of the Critic and the Logic of Criticism in Hegel,
Bruno Bauer, and the Frankfurt School, The American University PhD
JOLL JAMES (1966): Die Anarchisten, Frankfurt/M Berlin
JONAS, HANS (1934): Gnosis und sptantiker Geist, Gttingen
KADUSHIN, CHARLES (1976): Networks and Circles in the Production of Culture, in:
American Behavioural Scientist 19, No. 6, S. 769-784
KAISER, BERND (Hg) (1948): Der Freiheit eine Gasse. Aus dem Leben und Werk Georg
Herweghs, Berlin
KAISER, GERHARD (1961): Pietismus und Patriotismus im literarischen Deutschland.
Ein Beitrag zum Problem der Skularisation, Wiesbaden
KALTENTHALER, ALBERT (1960): Die Pariser Salons als europische Kulturzentren
unter besonderer Bercksichtigung der deutschen Besucher whrend der Zeit von
1815-1848, Diss Nrnberg
KAMPE, FERDINAND (1852-1860): Geschichte der religisen Bewegung der neueren
Zeit, 4 Bde, Leipzig
KAUFMANN, WALTER (1974): Hegel, Frankfurt/M
KST, BERND (1979): Die Thematik des Eigners in der Philosophie Max Stirners. Sein
Beitrag zur Radikalisierung der ajithropolischen Fragestellung, Bonn
KEGEL, MAX (1908a): Bruno Bauer und seine Theorien ber die Entstehung des Christen-
tums, Leipzig
-, (1908b): Bruno Bauers bergang von der Hegeischen Rechten zum Radikalismus,
Erlangen
KEINEMANN, FRIEDRICH (1975): Preuen auf dem Wege zur Revolution. Die Provin-
ziallandtags- und Verfassungspolitik Friedrich Wilhelms IV von der Thronbesteigung
bis zum Erla des Patents vom 3. Februar 1847, Hamm
KELLER, HANS GUSTAV (1935): Die politischen Verlagsanstalten und Druckereien in
der Schweiz 1840-1848. Ihre Bedeutung fr die Vorgeschichte der deutschen Revolu-
tion von 1848, Bern Leipzig
-, (1938): Das Junge Europa 18341836. Eine Studie zur Geschichte der Vlkerbunds-
idee und des nationalen Gedankens, Zrich Leipzig
444
-, (1943): Das literarische Comptoir in Zrich und Winterthur. Der Bericht eines Preui-
schen Geheimagenten aus dem Jahr 1844, Aarau
KEMPSKI, JRGEN von (1962): ber Bruno Bauer. Eine Studie zum Ausgang des Hege-
lianismus, in: Archiv fr Philosophie 11, S. 223-245
KERN, HANS (Hg) (1932): Schpferische Freundschaft jena
KIPPENBERG, HANS G. (1981): Intellektualismus und antike Gnosis, in: Max Webers
Studien ber das antike Judentum, hg. v. WOLFGANG SCHLUCHTER, Frankfurt/
M, S. 201-218
KLOSSOWSKI, PIERRE (1981): Sade und Fourier, in: B. DIEKMANN, F. PESCATORE
(Hg), Lektre zu de Sade, Frankfurt/M, S. 213-234
KLUTENTRETER, WILHELM (1966): Die Rheinische Zeitung 1842/43 in der geistigen
und politischen Bewegung des Vormrz, 2 Bde, Dortmund
KOCKA, JRGEN (1974): Preuischer Staat und Modernisierung im Vormrz. Marxi-
stisch-leninistische Interpretationen und ihre Probleme, in: Sozialgeschichte heute.
Festschrift fr HANS ROSENBERG zum 70. Geburtstag, hg. v. HANS ULLRICH
WEHLER, Gttingen, S. 211-227
KOBYLINSKI, HANNA (1933): Die franzsische Revolution als Problem in Deutschland
1840 bis 1848, Berlin
KOCH, LOTHAR (1971): Humanistischer Atheismus und gesellschaftliches Engagement.
Bruno Bauers >Kritische Kritik<, Stuttgart
KNIG, RENE (1983): Die analytisch-praktische Doppelbedeutung des Gruppentheo-
rems. Ein Blick in die Hintergrnde, in: KZfSS Sonderheft 25, S. 36-64
KSTER, UDO (1972): Literarischer Radikalismus. Zeitbewutsein und Geschichtsphi-
losophie in der Entwicklung vom Jungen Deutschland zur Hegeischen Linken, Frank-
furt/M
KOIGEN, DAVID (1901): Zur Vorgeschichte des modernen philosophischen Socialismus
in Deutschland. Zur Geschichte der Philosophie und Socialphilosophie des Junghege-
lianismus, Bern
KOLBE, GNTER (1972): Demokratische Opposition im religisen Gewnde, in: ZfG 20,
S. 1102-1112
KONRAD, GYRGY/IVAN SZELENYI (1981): Die Intelligenz auf dem Weg zur Klas-
senmacht, Frankfurt/M
KOPPEN, WILHELM (1921): J. Venedey. Ein Beitrag zur Geschichte des demokratischen
Gedankens in Deutschland, Diss Frankfurt/M
KORNETZKI, HEINZ (1955): Die revolutionr-dialektische Entwicklung in den Halli-
schen Jahrbchern. Eine Untersuchung der Quellen des Sozialismus in der linkshegelia-
nischen Zeitschrift des 19. Jahrhunderts, Phil Diss Mnchen (Masch.schr.)
KORSCH, KARL (1966): Marxismus und Philosophie, hg. v. ERICH GERLACH, Frank-
furt/M
-, (1971): Krise des Marxismus, in: ders., Die materialistische Geschichtsauffassung und
andere Schriften, hg. v. ERICH GERLACH, Frankfurt/M, S. 167-172
KOSELLECK, REINHART (1959): Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogenese der br-
gerlichen Welt, Freiburg Mnchen
-, (1966): Staat und Gesellschaft in Preuen, 1815-1848, in: HANS ULLRICH WEHLER
(Hg), Moderne deutsche Sozialgeschichte, Kln Berlin, S. 55-84
-, (1967): Preuen zwischen Reform und Revolution, Stuttgart
-, (1979): Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt/M
KOSZYK, KURT (1966): Deutsche Presse im 19. Jahrhundert, Berlin
-, (1972): Vorlufer der Massenpresse, Mnchen
KRACAUER, SIEGFRIED (1963): Die Gruppe als Ideentrger, in: ders., Das Ornament
der Masse, Frankfurt/M, S. 123-156
445
-, (1971a): Soziologie als Wissenschaft. Eine erkenntnistheoretische Untersuchung, in:
ders. Schriften, Bd. 1, Frankfurt/M, S. 7-101
-, (1971b): Der Detektiv-Roman. Ein philosophischer Traktat, in: ders., Schriften Bd. 1,
Frankfurt/M, S. 103-204
-, (1971c): Geschichte - Vor den letzten Dingen, als: ders., Schriften Bd. 4, Frankfurt/M
-, (1972): ber die Freundschaft. Essay, Frankfurt/M
KRAHL, HANS-JRGEN (1971): Konstitution und Klassenkampf. Zur historischen Dia-
lektik von brgerlicher Emanzipation und proletarischer Revolution, Frankfurt/M
KRATZ, STEFFEN (1979): Philosophie und Wirklichkeit. Die junghegelianische Program-
matik einer Verwirklichung der Philosophie und ihre Bedeutung fr die Konstituierung
der Marxschen Theorie, Diss Bielefeld
KREUZER, HELMUT (1968): Die Boheme. Beitrge zu ihrer Beschreibung, Stuttgart
KRIEGER, LEONARD (1972): The German Idea of Freedom. History of a Political Tradi-
tion, Chicago, 2. Aufl.
KRLL, FRIEDHELM (1978): Die Eigengruppe als Ort sozialer Identittsbildung. Motive
des Gruppenanschlusses bei Schriftstellern, in: Deutsche Vierteljahresschrift fr Litera-
tur und Geistesgeschichte 52, S. 652-672
KRLL, FRIEDHELM/STEPHAN BATJES/RUDI WIENGARN (1982): Vereine. Ge-
schichte, Politik, Kultur, Frankfurt/M
KRNER, LUDWIG (1979): Eschatologie bei Karl Marx? Untersuchungen zum Begriff
Eschatologie und seiner Verwendung in der Interpretation des Werkes von Karl
Marx, Erlangen
KROHN, WOLFGANG (1976): Zur soziologischen Interpretation der neuzeitlichen Wis-
senschaft, in: E. ZILSEL, Die sozialen Ursprnge der neuzeitlichen Wissenschaft, hg. v.
WOLFGANG KROHN, Frankfurt/M, S. 7-43
KRN, FRIEDHELM (1976): Schriftstellerund Schriftstellerverbnde. Schriftstellerberuf
und Interessenpolitik 1842-1973, Stuttgart
KRGER, MARLIS (1981): Wissenssoziologie, Stuttgart
KRUCHEN, KARL (1922): Die Zensur und deren praktische Anwendung bei rheinischen
Zeitungen in der vormrzlichen Zeit (1814-1848) Diss Kln
KHNE, WALTER (1938): Graf August Cieszkowski, ein Schler Hegels und des deut-
schen Geistes, Leipzig
KUHN, AXEL (1980): Die Stellung der deutschen Jakobinerklubs in der Frhgeschichte
deutscher Parteien, in: OTTO BUSCH (Hg), Die demokratische Bewegung in Mitteleu-
ropa im ausgehenden 18. und frhen 19. Jahrhundert. Ein Tagungsbericht, Berlin,
S. 73-82
KUHN, THOMAS S. (1967): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt/M
KUPISCH, KARL (1953): Vom Pietismus zum Kommunismus, Berlin
LADEMACHER, HORST (1976): Die nrdlichen Rheinlande von der Rheinprovinz bis zur
Bildung des Landschaftsverbandes Rheinland (1815-1953), in: F. PETRI, G.
DROEGE, Rheinische Geschichte Bd. 2, Dsseldorf, S. 475-866
-, (1977): Moses He in seiner Zeit, Bonn
LAKATOS, IMRE/ALAN MUSGRAVE (1974): Kritik und Erkenntnisfortschritt, Braun-
schweig
LMMERMANN, GODWIN (1979): Kritische Theologie und Theologiekritik: die
Genese der Religions- und Selbstbewutseinstheorie Bruno Bauers, Mnchen
LANGE, MAX (1946): Der Junghegelianismus und die Anfnge des Marxismus. Diss Jena
, (1948): Arnold Rge und die Entwicklung des Parteilebens im Vormrz, in: Einheit.
Zeitschrift fr Theorie und Praxis des wissenschaftlichen Sozialismus 3, H. 7, S. 636-
644
LANKHEIT, KLAUS (1952): Das Freundschaftsbild der Romantik, Heidelberg
446
LAPASSADE, GEORGES (1972): Gruppen - Organisationen - Institutionen, Stuttgart
LAPIN, NIKOLAI (1974): Der junge Marx, Berlin (Ost)
LENK, KURT (1964): Ideologie. Ideologiekritik und Wissenssoziologie, Neuwied Berlin,
2. Aufl.
LENK, KURT/FRANZ NEUMANN (1968): Theorie und Soziologie der politischen Par-
teien, Neuwied Berlin
LENZ, MAX (1910-1918): Geschichte der Kniglichen Friedrich-Wilhelms-Universitt zu
Berlin, 4 Bde, Halle
LEPENIES, WOLF (Hg) (1981): Geschichte der Soziologie. Bd: 2: Theoriegruppen, Schu-
len und Institutionalisierungsprozesse, Frankfurt/M
LEPSIUS, M. RAINER (1964): Kritik als Beruf. Zur Soziologie der Intellektuellen, in:
KZfSS 16, S. 75-90
LIEBICH, ANDRE (1979): Between Ideology und Utopia. The politics and Philosophy of
August Cieszkowski, Dordrecht
LILL, RUDOLF (1978): Kirche und Revolution. Zu den Anfngen der katholischen Bewe-
gung im Jahrzehnt vor 1848, in: AfS 18, S. 565-575
LIPOWATZ, ATHANASIOS (1982): Diskurs und Macht. Jacques Lacan's Begriff des Dis-
kurses. Ein Beitrag zur politischen Soziologie, Marburg
LOBKOWICZ, NICHOLAS (1967): Theory and Practice: History of a Concept from
Aristotle to Marx, Notre Dame London
, Karl Marx and Max Stirner, (1969) in: Demythologizing Marxism, A Series of Studies
onMarxism. hg. v. FREDERICK J. ADELMANN, Chestnut Hill: Boston College
LWITH, KARL (1933): Die philosophische Kritik der christlichen Religion im 19. Jahr-
hundert (I), in: Theologische Rundschau NF 5, H. 3, S. 131-172
-, (1961): Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der
Geschichtsphilosophie, Stuttgart, 4. Aufl.
-, (1964): Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionre Bruch im Denken des neunzehnten
Jahrhunderts. Marx und Kierkegaard, Stuttgart, 4. Aufl.
-, (1970): P. Valerys Reflexionen zur Sprache, in: R. BUBNER, K. CRAMER, R. WIEHL
(Hg), Hermeneutik und Dialektik, Bd. 2, Tbingen, S. 115-144
-, (1971): Paul Valery. Grundzge seines philosophischen Denkens, Gttingen
LOSCH, PH. (1939): Karl Bayrhoffer, in: J. SCHNACK (Hg), Lebensbilder aus Kurhessen
und Waldeck, Bd. 1, Marburg, S. 8-9
LUCAS, ERHARD (1983): Vom Scheitern der deutschen Arbeiterbewegung, Frankfurt/M
LUCKMANN, THOMAS (1963): Das Problem der Religion in der modernen Gesellschaft,
Freiburg
LUDZ, PETER CHRISTIAN (1976): Ideologiebegriff und marxistische Theorie. Anstze
zu einer immanenten Kritik, Opladen
-, (Hg) (1979): Geheime Gesellschaften, Heidelberg
LBBE, HERMANN (1960): Die politische Theorie der Hegeischen Rechten, in: Archiv
fr Philosophie 10, S. 175-227
-, (1965): Skularisierung. Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs, Freiburg
LBBE, HERMANN/HANS-MARTIN SASS (Hg) (1975): Atheismus in der Diskussion.
Kontroversen um Ludwig Feuerbach, Mnchen Mainz
LDTKE, ALF (1980): Genesis und Durchsetzung des modernen Staates. Zur Analyse
von Herrschaft und Verwaltung, in: AfS 20, S. 470-491
, (1982):.Gemeinwohl, Polizei und Festungspraxis. Staatliche Gewaltsamkeit und
innere Verwaltung in Preuen, 1815-1850, Gttingen
LTGERT, WILHELM (1923-1930): Die Religion des deutschen Idealismus und ihr
Ende, 4 Bde, Gtersloh
447
LUKACS, GEORG (1926): Moses Hess und die Probleme der idealistischen Dialektik, in:
Archiv fr die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung 12, S. 105155
LUXEMBURG, ROSA (1968): Die russische Revolution, in: dies., Politische Schriften
Bd. 3, hg. v. O:K. FLECHTHEIM, Frankfurt/M, S. 106-141
MACHACKOVA, VERA (1961): Der junge Engels und die Literatur (1838-1844), Berlin
-, (1963): Einige Bemerkungen zur literarischen Seite der Anti-Schellingiana des jungen
Engels, in: Annali 6, S. 289-309
MACKAY, JOHN HENRY (1914): Max Stirner. Sein Leben und sein Werk, Berlin-Char-
lottenburg, 3. Aufl.
MADER, JOHANN (1968): Fichte, Feuerbach, Marx. Leib, Dialog, Gesellschaft, Wien
-, (1975): Zwischen Hegel und Marx. Zur Verwirklichung der Philosophie, Wien Mn-
chen
MAKROPOULOS, MICHAIL (1986): Modernitt als ontologischer Ausnahmezustand?
Studien zur Theorie der Moderne in den Schriften Walter Benjamins, Gttingen, Diss.
(Masch.schr.)
MALTZAHN, CHRISTOPH FREIHERR von (1979): Heinrich Leo (1799-1878). Ein poli-
tisches Gelehrtenleben zwischen romantischem Konservatismus und Realpolitik, Gt-
tingen
MANHEIM, ERNST (1933): Die Trger der ffentlichen Meinung. Studien zur Soziologie
der ffentlichkeit, Brunn
MANNHEIM, KARL (1952): Ideologie und Utopie, Frankfurt/M, 3. Aufl.
-, (1964): Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk, hg. v. K.H. WOLFF, Berlin Neu-
wied
MARCUSE, HERBERT (1965): Ethik und Revolution, in: ders., Kultur und Gesellschaft,
Bd. 2, Frankfurt/M, S. 130-146
-, (1962): Vernunft und Revolution. Hegel und die Entstehung der Gesellschaftstheorie.
Neuwied Berlin
-, (1969): Versuch ber die Befreiung, Frankfurt/M
-, (1973). Konterrevolution und Revolte, Frankfurt/M
MARTIN, ALFRED von (1932): Soziologie der Renaissance. Zur Physiognomie und Rhyth-
mik brgerlicher Kultur, Stuttgart
-, (1972): Intelligenzschicht, in: Wrterbuch der Soziologie, hg. v. WILHELM BERNS-
DORF, Bd. 2, Frankfurt/M, 2. Aufl. S. 377-380
MARUHN, JRGEN (1982): Die Kritik an der Stirnerschen Ideologie im Werk von Karl
Marx und Friedrich Engels. Max Stirners Einziger als Dokument des kleinbrgerli-
chen Radikalismus, Frankfurt/M
MASSEY, JAMES A. (1978): The Hegelians, the Pietist, and the Nature of Religion, in:
Journal of Religion 58, No. 2, S. 108-129
MATTHES, JOACHIM (1967/69): Religion und Gesellschaft. Einfhrung in die Religions-
soziologie, 2 Bde, Reinbek
MAYER, GUSTAV (1913): Die Anfnge des politischen Radikalismus im vormrzlichen
Preuen, in: ZfP 6, S. 1-113
-, (1920): Die Junghegelianer und der preuische Staat, in: HZ 121, S. 413-440
-, (1969): Radikalismus, Sozialismus und brgerliche Demokratie, Frankfurt/M
-, (1975): Friedrich Engels. Eine Biographie, 2 Bde, Frankfurt Berlin Wien
McLELLAN, DAVID (1974): Die Junghegelianer und Karl Marx, Mnchen
MEHLHAUSEN, JOACHIM (1965): Dialektik, Selbstbewutsein und Offenbarung, Diss
Bonn
-, (1975): Der Umschlag in der theologischen Hegel-Interpretation dargetan an Bruno
Bauer, in: Kirche und Theologie im 19. Jahrhundert, hg. v. G. SCHWAIGER, Gttin-
gen, S. 175-197
448
MEHRING, FRANZ (1960): Karl Marx. Geschichte seines Lebens, als: GS Bd. 3, Berlin
-, (1961a): Ein vormrzlicher Literat, in, ders., GS Bd. 10, Berlin, S. 390-394
-, (1961b): Sozialistische Lyrik. G. Herwegh - F. Freiligrath - H. Heine, in: ders., GS
Bd. 10, Berlin, S. 395-414
-, (1961c): Herwegh, Marx und die Freien, in: ders., GS Bd. 10, Berlin, S. 507-511
MEJA, VOLKER/NICO STEHR (Hg) (1982): Der Streit um die Wissenssoziologie, Frank-
furt/M
MESSMER-STRUPP, BEATRIX (1963): Arnold Ruges Plan einer alliance inteUectuelle
zwischen Deutschen und Franzosen, Bern, Phil. Diss.
MEYER, THOMAS (1973): Der Zwiespalt in der Marx'schen Emanzipationstheorie. Stu-
die zur Rolle des proletarischen Subjekts, Kronberg/Ts
MEYER-KALKUS, REINHART (1977): Werthers Krankheit zum Tode. Pathologie und
Familie in der Empfindsamkeit, in: Urszenen. Literaturwissenschaft als Diskursanalyse
und Diskurskritik, hg. v. F.A. KITTLER, H. TURK, Frankfurt/M
MICHELS, ROBERT (1932): Zur Soziologie der Boheme und ihrer Zusammenhnge mit
dem geistigen Proletariat, in: Jahrbuch fr Nationalkonomie und Statistik 136, S. 801-
826
MIELKE, HELLMUTH (1898): Der deutsche Roman, Berlin, 3. Aufl.
MIKULINSKIJ, SEMEN R. (Hg) (1977): Wissenschaftliche Schulen, Berlin
MILLER, SEPP/BRUNO SAWADZKI (ca. 1956): Karl Marx in Berlin, Berlin oj.
MILLS, CHARLES WRIGHT (1943): Sociological Account of Pragmatism, The University
of Wisconsin, PhD
-, (1964): Methodologische Konsequenzen der Soziologie des Wissens, in: KURT LENK
(Hg) Ideologie. Ideologiekritik und Wissenssoziologie, Neuwied und Berlin, S. 281-296
MILLS, THEODORE M. (1973): Soziologie der Gruppe, Mnchen, 4. Aufl.
MNKE, WOLFGANG (1963): ber die Mitarbeit von Moses He an der Deutschen
Ideologien in Annali 6, S. 438-509
-, (1964): Neue Quellen zur He-Forschung. Mit Auszgen aus einem Tagebuch, aus
Manuskripten und Briefen aus der Korrespondenz mit Marx, Engels, Weitling, Ewer-
beck u.a., Berlin
MRTH, INGO (1979): Religise Sinnstiftung und gesellschaftliches Bewutsein, in:
sterreichische Zeitschrift fr Soziologie 4, H. 1, S. 16-30
MOMMSEN, WOLFGANG J. (1981): Gegenwrtige Tendenzen in der Geschichtsschrei-
bung der Bundesrepublik, in: GG 7, S. 149-188
MONGARDINI, CARLO (1979): Die Dynamik des ideologischen Phnomens in der Bezie-
hung zwischen Gruppe und Klasse, in: KURT SALAMUN (Hg), Sozialphilosophie als
Aufklrung. Festschrift fr ERNST TOPITSCH, Tbingen, S. 89-107
MOOG, WILLY (1930): Hegel und die Hegeische Schule, Mnchen
MLLER, FRIEDRICH (1969): Korporation und Assoziation. Eine Problemgeschichte
der Vereinigungsfreiheit im deutschen Vormrz, Berlin
MLLER, GUSTAV E. (1948): Die Entwicklung der Religionsphilosophie in der Hegel-
schen Schule, in: Schweizerische Theologische Umschau 18, S. 49-68
MLLER, LOTHAR (1981): Zur Soziologie ideologischer Organisationen, in: sterreichi-
sche Zeitschrift fr Soziologie 6, H. 4, S. 67-72
NA'AMAN, SHLOMO (1978): Zur Entstehung der deutschen Arbeiterbewegung. Lern-
prozesse und Vergesellschaftung 1830-1868, Hannover
-, (1979) u.a.: Gibt es einen wissenschaftlichen Sozialismus<? Marx, Engels und das Ver-
hltnis zwischen sozialistischen Intellektuellen und den Lernprozessen der Arbeiterbe-
wegung, hg. v. M. VESTER, Hannover
-, (1982): Emanzipation und Messianismus: Leben und Werk des Moses He, Frankfurt/
M New York
449
NF, WERNER (1929): Das Literarische Comptoir Zrich und Winterthur, Bern
NEGT, OSKAR/ALEXANDER KLUGE (1972): ffentlichkeit und Erfahrung. Zur Orga-
nisationsanalyse von brgerlicher und proletarischer ffentlichkeit, Frankfurt/M
-, (1981): Geschichte und Eigensinn, Frankfurt/M
NEHER, WALTER (1933): Arnold Ruge als Politiker und politischer Schriftsteller. Ein Bei-
trag zur deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts, Heidelberg
NEIDHART, FRIEDHELM (1979): Das innere System sozialer Gruppen, in: KZfSS 31
H. 4, S. 639-660
, (Hg) (1983): Gruppensoziologie. Perspektiven und Materialien, als: KZfSS Sonderheft
25
NETTLAU, MAX (1901): Michael Bakunin. Eine biographische Skizze. Mit Auszgen aus
seinen Schriften. Nachwort von GUSTAV LANDAUER, Berlin
-, (1925): Der Vorfrhling der Anarchie. Ihre historische Entwicklung von den Anfngen
bis zum Jahre 1864, Berlin
-, (1927): Der Anarchismus von Proudhon zu Kropotkin. Seine historische Entwicklung
in den Jahren 1859-1880, Berlin
NEUSSS, ARNHELM (1968): Utopisches Bewutsein und freischwebende Intelligenz,
zur Struktur der Wissenssoziologie Karl Mannheims, Meisenheim/Glan
NIGG, WALTER (1937): Geschichte des religisen Liberalismus, Zrich Leipzig
-, (1944): Das ewige Reich. Geschichte einer Sehnsucht und einer Enttuschung, Erlen-
bach bei Zrich
NIPPERDEY, THOMAS (1965): ber einige Grundzge der deutschen Parteigeschichte,
in: ROLF DIETZ, HEINZ HBNER (Hg), Festschrift fr HANS CARL NIPPERDEY
zum 70. Geburtstag, Mnchen, S. 815-841
-, (1976): Verein als soziale Struktur in Deutschland im spten 18. und frhen 19. Jahr-
hundert. Eine Fallstudie zur Modernisierung I, in: ders., Gesammelte Aufstze zur
neueren Geschichte, Gttingen, S. 174-205
, (1979): Kirche und Nationaldenkmal. Der Klner Dom in den vierziger Jahren, in:
WERNER POLS (Hg), Staat und Gesellschaft im politischen Wandel. Beitrge zur
Geschichte der modernen Welt, Stuttgart, S, 175-202
-, (1983): Deutsche Geschichte 1800-1866. Brgerwelt und starker Staat, Mnchen
OBERMANN, KARL (1977): Zur Genese der brgerlichen Klasse in Deutschland von der
Julirevolution 1830 bis zum Beginn der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts, in: Jahrbuch
fr Geschichte 16, S. 33-69
OELMLLER, WILLI (Hg) (1984): Wiederkehr von Religion? Perspektiven, Argumente,
Fragen, Kolloquium Religion und Philosophie Bd. 1, Paderborn Mnchen Wien Zrich
OESTREICH, GERHARD (1981): Calvinismus, Neustoizismus, Preuentum, in: OTTO
BUSCH, WOLFGANG NEUGEBAUER, Moderne preuische Geschichte 1648-
1947, Bd. 3, Berlin, S. 1268-1293
OPITZ, PETER J./GREGOR SEBBA (Hg) (1981): The Philosophy of Order. Essays on
History, Consciousness and Politics (For ERIC VOEGELIN on His Eightieth Birthday,
Jan 3, Stuttgart
OSBORN, ALEXANDER F. (1953): Creative Imagination: Principles and Procedures of
Creative Thinking, New York
OTTMANN, HENNING (1977): Individuum und Gemeinschaft bei Hegel. Bd. 1 Hegel
im Spiegel der Interpretationen, Berlin New York
-, (1979a): Hegel und die Politik. Zur Kritik der politischen Hegellegenden, in: ZfP 25,
S. 235-253
(1979b): Hegels Rechtsphilosophie und das Problem der Akkomodation, in: Zeitschrift fr
Philosophische Forschung 33, S. 227-243
OTTO, ULLA (1968): Die literarische Zensur als Problem der Soziologie der Politik, Stutt-
450
PASCHEN, JOACHIM (1977): Demokratische Vereine und preuischer Staat. Entwick-
lung und Unterdrckung der demokratischen Bewegung whrend der Revolution von
1848/49, Mnchen Wien
PATERSON, ROBERT WILLIAM KEITH (1971). The nihilistic egoist Max Stirner, Lon-
don
PEPPERLE, INGRID (1971): Arnold Rge und Robert Eduard Prutz. Ihre ideologiege-
schichtliche Bedeutung innerhalb des Junghegelianismus. Die philosophischen
Anschauungen von Arnold Rge und Robert Eduard Prutz, Diss Berlin (Ost)
-, (1978): Junghegelianische Geschichtsphilosophie und Kunsttheorie, Berlin (Ost)
Philosophical Forum (1978): Feuerbach, Marx and the Left Hegelians, Vol 8, n. 2-4,
Boston (Mass.)
PLATON (1957): Menon, in: ders., SW Bd. 2. In der bersetzung v. F. SCHLEIERMA-
CHER, hg. v. W.F. OTTO u.a., Hamburg
PLESSNER, HELMUTH (1982): Die versptete Nation. ber die Verfhrbarkeit brgerli-
chen Geistes, in: ders., Gesammelte Schriften, hg. v. GNTER DUX, ODO MAR-
QUARD und ELISABETH STRKER, Bd. VI, Frankfurt/M, S. 7-223
-, (1985): Abwandlungen des Ideologiegedankens, in: ders., Gesammelte Schriften, hg. v.
GNTER DUX, ODO MARQUARD und ELISABETH STRKER, Bd. X, Frank-
furt/M, S. 41-70
POPITZ, HEINRICH (1967): Der entfremdete Mensch. Zeitkritik und Geschichtsphiloso-
phie des jungen Marx, Frankfurt/M, 2. Aufl.
-, (1968): Prozesse der Machtbildung, Tbingen
PRAWER, SIEGBERT SALOMAN (1983): Heine's Jewish Comedy. A Study of his Por-
traits of Jews and Judaism, Oxford
PRICE, DEREKJOHN de SOLLA (1963): Little Science, Big Science, New York
PROELSS JOHANNES (1892): Das junge Deutschland. Ein Buch deutscher Geistesge-
schichte, Stuttgart
-, (1909): Rudolf von Gottschall, der Letzte vom Jungen Deutschland, in: Gartenlaube,
Nr. 16, S. 343-344
PSYCHOPEDIS, KOSMAS (1984): Geschichte und Methode. Begrndungstypen und
Interpretationskriterien der Gesellschaftstheorie: Kant, Hegel, Marx und Weber,
Frankfurt/M New York
QUISPEL, GILLES (1951): Gnosis als Weltreligion, Zrich
RAMBALDI, ENRICO (1966): Le Origini della Sinistra Hegeliana, H. Heine, D.F. Strau,
L. Feuerbach, B. Bauer, Florenz
RASCH, WOLFDIETRICH (1936) Freundschaftskult und Freundschaftsdichtung im
deutschen Schrifftum des 18. Jahrhunderts, Halle
RAWIDOWICZ, SIMON (1931): Ludwig Feuerbachs Philosophie. Ursprung und Schick-
sal, Berlin
REDSLOB, ERWIN (1940): Die Welt vor hundert Jahren. Menschen und Kultur der Zei-
tenwende um 1840, Leipzig
REINALTER, HELMUT (Hg) (1983): Freimaurer und Geheimbnde im 18. Jahrhundert
in Mitteleuropa, Frankfurt/M
REISSNER, HANNS GNTHER (1965): Eduard Gans. Ein Leben im Vormrz, Tbingen
RENDTORFF, TRUTZ (1966): Zur Skularisierungsproblematik. ber die Weiterent-
wicklung der Kirchensoziologie zur Religionssoziologie, in: Internationales Jahrbuch
fr Religionssoziologie 2, S. 51-72
-, (1969): Christentum auerhalb der Kirche, Hamburg
RICHTER, CLAUS (1978): Leiden an der Gesellschaft. Vom literarischen Liberalismus
zum poetischen Realismus, Kronberg/Ts.
451
RIDDER, HELMUT K.J. (1954): Meinungsfreiheit, in: F. L. NEUMANN, H. C. NIP-
PERDEY, U. SCHEUNER (Hg), Die Grundrechte Bd. II, 2, Berlin, S. 243-290
RIEDEL, MANFRED (1967): Hegel und Gans, in: Natur und Geschichte. KARL
LWITH zum 70. Geburtstag, Stuttgart, S. 257-273
-, (1973): System und Geschichte. Studien zum historischen Standort von Hegels Philoso-
phie, Frankfurt/M
RIHA, KARL (1970): Die Beschreibung der >groen Stadt<. Zur Entstehung des Grostadt-
motivs in der deutschen Literatur (ca. 1750- ca. 1850), Bad Homburg Berlin Zrich
RIHS, CHARLES (1978): L'ecole des jeunes hegeliens et les penseurs socialistes francais,
Paris
RITSCHL, ALBRECHT (1880-1886): Geschichte des Pietismus, 3 Bde, Bonn
RITTER, GERHARD ALBERT (1973): Die deutschen Parteien vor 1918, Kln
RITTER, JOACHIM (1965): Hegel und die franzsische Revolution, Frankfurt/M
RTTGERS, KURT (1975): Kritik und Praxis. Zur Geschichte des Kritikbegriffs von Kant
bis Marx, Berlin
-, (1982): Kritik, in: Geschichtliche Grundbegriffe, hg. v. O. BRUNNER, W. CONZE,
R. KOSELLECK, Bd. 3, Stuttgart, S. 651-675
ROSEN, ZVI (1970): The Influence of Bruno Bauer on Marx's Concept of Alienation, in:
Social Theory and Practice 1, S. 50-69
-, (1971): The Radicalism of a Young Hegelian: Bruno Bauer, in: The Review of Poli-
tics 33, S. 377-404
-, (1977): Bruno Bauer und Karl Marx; the Influence of Bruno Bauer on Marx's Thought,
Den Haag
-, (1982): Bruno Bauers und Friedrich Nietzsches Destruktion der brgerlich-christlichen
Welt, in: Jahrbuch des Instituts fr Deutsche Geschichte, Tel Aviv 11, S. 151-172
-, (1983): Moses Hess' Einflu auf die Entfremdungstheorie von Karl Marx, in:
W. GRAB/J. H. SCHOEPS (Hg), Juden im Vormrz und in der Revolution von 1848,
Stuttgart Bonn, S. 169-198
ROSENBERG, HANS (1929): Geistige und politische Strmungen an der Universitt Halle
in der ersten Hlfte des 19. Jahrhunderts, in: Dt. Vierteljahresschrift fr Literaturwis-
senschaft und Geistesgeschichte 7, S. 560-586
-, (1972): Politische Denkstrmungen im deutschen Vormrz, Gttingen
ROSENZWEIG, FRANZ (1920): Hegel und der Staat, 2 Bde, Mnchen Berlin
ROTHFELS, HANS (1930): Ideengeschichte und Parteigeschichte, in: Deutsche Viertel-
jahresschrift fr Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 8, S. 753786
RUBEL, MAXIMILIEN (1957): Karl Marx. Essai de biographie intellectuelle, Paris
RUCKHBERLE, HANS-JOACHIM (Hg) (1983): Bdung und Organisation in den deut-
schen Handwerksgesellen- und Arbeitervereinen in der Schweiz, Tbingen
RUDOLPH, KURT (1978): Die Gnosis. Wesen und Geschichte einer sptantiken Religion,
Gttingen
RRUP, REINHARD (1975): Emanzipation und Antisemitismus. Studien zur >Judenfrage<
der brgerlichen Gesellschaft, Gttingen
RUNZE, GEORG (1931): Bruno Bauer, der Meister der theologischen Kritik, Neu Finken-
burg b. Berlin
RUZICKA, RUDOLF (1977): Selbstentfremdung und Ideologie. Zum Ideologieproblem
bei Hegel und den Junghegelianern, Bonn
SALOMON, ALBERT (1921): Der Freundschaftskult im 18. Jahrhundert in Deutschland,
Diss Heidelberg
SANDBERGER, JRG F. (1972): David Friedrich Strau als theologischer Hegelianer,
Gttingen
452
SARTRE, JEAN-PAUL (1967): Kritik der dialektischen Vernunft, Bd. 1 Theorie der gesell-
schaftlichen Praxis, Reinbek
SASS, HANS-MARTIN (1963): Untersuchungen zur Religionsphilosophie in der Hegel-
schen Schule 1830-50, Diss Mnster
-, (1967a): Emanzipation der Freiheit. Hegels Rechtsphilosophie als Strategie pragmati-
scher Politik- und Rechtskritik, in: Archiv fr Rechts- und Sozialphilosophie 53, S. 257-
276
-, (1967b): Feuerbach statt Marx. Zur Verfasserschaft des Aufsatzes Luther als Schieds-
richter zwischen Strau und Feuerbach, in: IRSH 13, S. 108 ff-119
-, (1967c): Bruno Bauers Idee der Rheinischen Zeitung, in: ZfRGG 19, S. 321-276
-, (1968): Nachwort zu: Bruno Bauer. Feldzge der reinen Kritik, Frankfurt/M
-, (1972): Feuerbachs Prospekt einer neuen Philosophie, in: Revue internationale de phi-
losophie 26, No. 101, S. 255-274
-, (1976): Die Emanzipation des Dialektikbegriffes von Karl Marx aus der Interpretation,
die Bruno Bauer und die Freien der hegelschen Dialektik gaben, in: Referate des
X. Internationalen Hegel-Kongresses in Moskau, Hegel Jahrbuch 1975, Kln, S. 554-
560
-, (1983): The >transition< from Feuerbach to Marx. A re-interpretation, in: Studies in
Soviet Thought, Vol 26, S. 123-142
SAUDER, GERHARD (1974): Empfindsamkeit. Bd. 1. Voraussetzungen und Elemente,
Stuttgart
SCHAEFER, ALFRED (1968): Macht und Protest, Meisenheim
SCHFERS, BERNHARD (Hg) (1980): Einfhrung in die Gruppensoziologie, Heidelberg
SCHARFE, MARTIN (1980): Die Religion des Volkes. Kleine Kultur- und Sozialgeschichte
des Pietismus, Gtersloh
SCHEEL, WOLFGANG (1964): Das Berliner Politische Wochenblatt und die politische
und soziale Revolution in Frankreich und England. Ein Beitrag zur konservativen Zeit-
kritik in Deutschland, Gttingen
SCHEIBERT, PETER (1956): Von Bakunin zu Lenin. Geschichte der russischen revolutio-
nren Ideologien 1840-1895, Bd. 1, Leiden
SCHELSKY, HELMUT (1959): Ist die Dauerreflexion institutionalisierbar? Zum Thema
einer modernen Religionssoziologie, in: Zeitschrift fr evangelische Ethik 3, S. 153-174
-, (1963): Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universitt und ihrer
Reformen, Reinbek
-, (1977): Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektu-
ellen, Mnchen
SCHIEDER, THEODOR (1954): Die Theorie der Partei im lteren deutschen Liberalis-
mus, in: Aus Geschichte und Politik. Festschrift fr L. BERGSTRSSER, Dsseldorf,
S. 183-196
SCHIEDER, WOLFGANG (1963): Anfnge der deutschen Arbeiterbewegung. Die Aus-
landsvereine im Jahrzehnt nach der Julirevolution von 1830, Stuttgart
-, (1974): Kirche und Revolution. Sozialgeschichtliche Aspekte der Trierer Wallfahrt von
1844, in: AfS 14, S. 419-455
-, (1977): Religionsgeschichte als Sozialgeschichte. Einleitende Bemerkungen zur For-
schungsproblematik, in: GG 3, S. 291298
-, (Hg) (1983): Liberalismus in der Gesellschaft des deutschen Vormrz, als: GG Sonder-
heft 9, Gttingen
SCHIELER, CARL (1903): Dr. Julius Rupp, ehemaliger Privatdozent, Oberlehrer und
Divisionsprediger zu Knigsberg in Preuen und die freie religise Bewegung in der
katholischen und evangelischen Kirche Deutschlands im 19. Jahrhundert. Ein Beitrag
zur Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts, Dresden
453
SCHINDLER, ALFRED (1978): Geistliche Vter und Hausvter in der christlichen Antike,
in: HUBERTUS TELLENBACH (Hg), Das Vaterbild im Abendland I, Stuttgart,
5. 70-82
SCHISSLER, HANNA (1978): Preuische Agrargesellschaft im Wandel, Gttingen
SCHLAWE, FRITZ (1959a): Friedrich Theodor Vischer, Stuttgart
-, (1959b): Die Berliner Jahrbcher fr wissenschaftliche Kritik. Ein Beitrag zur
Geschichte des Hegelianismus, in: ZfRGG 11, S. 240-258; 343-356
- (1960): Die junghegelianische Publizistik, in: Die Welt als Geschichte 20, S. 30-50
SCHMIDT, ALFRED (1973): Emanzipatorische Sinnlichkeit. Ludwig Feuerbachs anthro-
pologischer Materialismus, Mnchen
SCHMITT, EBERHARD (1979): Element einer Theorie der politischen Konspiration im
18. Jahrhundert. Einige typologische Bemerkungen, in: P.CH. LUDZ (Hg), Geheime
Gesellschaften, Heidelberg, S. 65-88
SCHMITT, CARL (1950a): Ex Captivitate Salus, Kln
-, (1950b): Donoso Cortes in gesamteuropischer Interpretation, Kln
SCHNABEL, FRANZ (1947-51): Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, 4 Bde, Frei-
burg, 2. Aufl.
SCHNEIDER, ERICH (1972): Die Theologie und Feuerbachs Religionskritik. Die Reak-
tion der Theologie des 19. Jahrhunderts auf Ludwig Feuerbachs Religionskritik, Gttin-
gen
SCHNEIDER, FRANZ (1966): Pressefreiheit und politische ffentlichkeit. Studien zur
politischen Geschichte Deutschlands bis 1848, Neuwied Berlin
-, (1967): Politik und Kommunikation, Drei Versuche, Mainz
SCHNEIDER, MANFRED (1980): Die kranke schne Seele der Revolution. Heine, Brne,
das Junge Deutschland, Marx und Engels, Frankfurt/M
SCHOLZ, PAUL (1930): Wilhelm Jordans Reden in der Paulskirche. Studien zur parlamen-
tarischen Beredsamkeit, Knigsberg
SCHRAEPLER, ERNST (1962): Geheimbndelei und soziale Bewegung. Zur Geschichte
des jungen Deutschland in der Schweiz, in: IRSH 7, S. 61-92
-, (1972): Handwerkerbnde und Arbeitervereine 1830-1853. Die politische Ttigkeit
deutscher Sozialisten von Wilhelm Weitling bis Karl Marx, Berlin New York
SCHUCKERT, LOTHAR (1978): Geistige Vter und Shne. Beobachtungen zum Wandel
pdagogischer Autoritt, in: H. TELLENBACH (Hg), Das Vaterbild im Abendland I,
Stuttgart, S. 124-148
SCHTZ, ALFRED (1981): Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die
verstehende Soziologie, Frankfurt/M
SCHUFFENHAUER, WERNER (1965): Feuerbach und der junge Marx. Zur Entste-
hungsgeschichte der marxistischen Weltanschauung, Berlin (Ost)
SCHUMPETER, JOSEF (1946): Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Bern
-, (1952): Aufstze zur konomischen Theorie, Tbingen
SCHWEITZER, ALBERT (1951): Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Tbingen,
6. Aufl.
SCHWEITZER, ARTHUR (1944): Ideological Groups, in: American Sociological
Review 9, S. 415^(26
SCHUSTER, GEORG (1906): Die Geheimen Gesellschaften, Verbindungen und Orden,
2 Bde, Leipzig
SEBBA, GREGOR (1981): History, Modernity and Gnosticism, in: P.J.OPITZ,
G. SEBBA (Hg), The Philosophy of Order. Essays on History, Consciousness and Poli-
tics, Stuttgart, S. 190-241
SEDATIS, HELMUT (1979): Liberalismus und Handwerk in Sdwestdeutschland. Wirt-
schafts- und Gesellschaftskonzeptionen des Liberalismus und die Krise des Handwerks
im 19. Jahrhundert, Stuttgart
454
SEEBA, HINRICH C. (1983): Der Klner Dom: Bastion des Mittelalters und National-
denkmal. Zur Kategorie der Geschichtlichkeit in den Kontroversen des Vormrz, in:
JAMES F. POAG, GERHILD SCHOLZ-WILLIAMS, Das Weiterleben des Mittelal-
ters in der deutschen Literatur, Knigstein/Ts., S. 87-105
SEEGER, REINHART (1935): Friedrich Engels. Die religise Entwicklung des Sptpieti-
sten und Erhsozialisten, Halle
SENGLE, FRIEDRICH (1971-1980): Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungs-
feld zwischen Restauration und Revolution 1815-1848, 3 Bde, Stuttgart
SENNETT, RICHARD (1983): Verfall und Ende des ffentlichen Lebens. Die Tyrannei der
Intimitt, Frankfurt/M
SHANAHAN, WILLIAM O. (1954): German Protestants Face the Social Question, Vol 1,
The Conservative Phase 181571, Notre Dame Indiana
SILBERNER, EDMUND (1958): The works of Moses Hess. An inventory of his signed and
anonymous publications, manuscripts and correspondence, Leiden
-, (1963): Beitrge zur literarischen und politischen Ttigkeit von Moses He 1841-1843,
in: Annali 6, S. 387^37
-, (1964): Moses He als Begrnder und Redakteur der Rheinischen Zeitung, in: AfS 4,
S. 5-44
-, (1966): Moses Hess. Geschichte seines Lebens. Leiden
, (1969): Zur Jugendbiografie von Johann Jacoby, in: AfS 9, S. 5-112
-, (1976): Johann Jacoby. Politiker und Mensch, Bonn-Bad Godesberg
SIMON, ULRICH (1982): Zur Kritik der Philosophie Max Stirners, Diss Frankfurt/M
SPEIER, HANS (1929): Zur Soziologie der brgerlichen Intelligenz in Deutschland, in: Die
Gesellschaft. Internationale Revue fr Sozialismus und Politik, hg. v. R. HILFER-
DING 6, S. 58-72
-, (1952): From Hegel to Marx: the Left Hegelians, Feuerbach and >True Socialism<, in:
ders., Social Order and the Risks of War. Papers in Political Sociology, New York,
S. 142-177
SPIEGELBERG, HERBERT (1953): Toward a Phenomenology of Imaginative Under-
standing of others, in: Proceedings of Xlth International Congress of Philosophy, Brs-
sel, Vol VIII, S. 235-239
-, (1964): Phenomenology Through Vicarious Experience, in: E. STRAUSS, Phenomeno-
logy: Pure and Applied, Pittsburg, S. 11-120
SPILKER, WERNER (1937): Robert Prutz als Zeitungswissenschaftler, Diss Leipzig
SPINNER, HELMUT F. (1985): Wissenschaft kommt nicht von Wissen, und Kunst kommt
nicht von Knnen, aber Wissenschaft ist trotzdem keine Kunst. ber die Wissenschafts-
wissenschaft und die Kochkunst, die Kriegskunst und die Zeit, als Feyerabend noch
recht hatte, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift fr europisches Denken 39, H. 9/10 (439/
440), Stuttgart, S. 859-878
STEHR, NICO/RENE KNIG (Hg) (1975): Wissenschaftssoziologie, als: KZfSS Sonder-
heft 18
STEHR, NICO/VOKERMEJA (Hg) (1980): Wissenssoziologie, als: KZfSS Sonderheft 22
STEINER, GEORGE (1972): In Blaubarts Burg. Anmerkungen zur Neudefinition der Kul-
tur, Frankfurt/M
STEPELEVICH, LAWRENCES. (1976): Hegel and Stirner: thesis and antithesis, in:
Idealistic Studies 6, S. 263-78
STEUSSLOFF, HANS (1963): Bruno Bauer als Jungehegelianer und Kritiker der christli-
chen Religion, in: Deutsche Zeitschrift fr Philosophie, Berlin (Ost), H. 9, S. 1122-1137
STORCK, JOCHEN (Hg) (1974): Fragen nach dem Vater. Franzsische Beitrge zu einer
psychoanalytischen Anthropologie, Freiburg
455
STRAUSS, HERBERT (1954): Zur sozial- und ideengeschichtlichen Einordnung Arnold
Ruges, in: Schweizer Beitrage zur Allgemeinen Geschichte 12, S. 162-173
STUKE, HORST (1963): Philosophie der Tat. Studien zur Verwirklichung der Philoso-
phie bei den Junghegelianern und den Wahren Sozialisten, Stuttgart
SYDOW, ECKARDT v. (1914): Der Gedanke des Ideal-Reichs in der idealistischen Philo-
sophie von Kant bis Hegel im Zusammenhang der geschichtsphilosophischen Entwick-
lung, Leipzig
TAUBERT, INGE/WERNER SCHUFFENHAUER (1975): Marx oder Feuerbach? Zur
Verfasserschaft von >Luther als Schiedsrichter zwischen Strau und Feuerbach<, in: Sit-
zungsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR, Nr. 20, Berlin (Ost), S. 32-
54
TAUBERT, INGE (1975): Karl Marx und die Rheinische Zeitung fr Politik, Handel und
Gewerbe<. Einleitung zum Reprint und Bibliographie der Artikel von Marx in der >Rhei-
nischen Zeitung<, Leipzig
TAUBES JACOB (1947): Abendlndische Eschatologie, Bern
-, (Hg) (1983): Der Frst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen. Religionstheorie und
politische Theologie Bd. 1, Mnchen Paderborn Wien Zrich
-, (Hg) (1984): Gnosis und Politik. Religionstheorie und politische Theologie Bd. 2, Mn-
chen Paderborn Wien Zrich
TENBRUCK, FRIEDRICH H. (1964): Freundschaft - Ein Beitrag zur Soziologie der per-
snlichen Beziehungen, in: KZfSS 16, S. 431456
, (1976): Zur Soziologie der Sophistik, in: Neue Hefte fr Philosophie, H. 10, Gttingen,
S. 51-77
TENBRUCK, FRIEDRICH H./RUOPP, WILHELM A. (1983): Modernisierung - Verge-
sellschaftung Gruppenbildung - Vereinswesen, in: KZfSS Sonderheft 25, S. 65-74
THADDEN, RUDOLF von (1980): Kirche im Schatten des Staates, in: J. PUHLE,
H. U. WEHLER (Hg), Preuen im Rckblick (GG, Sonderheft 6) Gttingen, S. 146-
175
-, (1981): Fragen an Preuen - Zur Geschichte eines aufgehobenen Staates, Mnchen
-, (1983): Protestantismus und Liberalismus zur Zeit des Hambacher Festes 1832, in:
W. SCHIEDER (Hg), Liberalismus in der Gesellschaft des Vormrz, GG Sonderheft 9,
Gttingen, S. 95-114
THEUNISSEN, MANFRED (1970): Hegels Lehre vom absoluten Geist als theologisch-
politischer Traktat, Berlin
THIES, ERICH (Hg) (1976): Ludwig Feuerbach, Darmstadt
THOMAS, PAUL (1975): Karl Marx und Max Stirner, in: Political Theory 3, H. 2, S. 159-
179
THURN, HANS PETER (1983): Die Sozialitt der Solitren. Gruppen und Netzwerke in
der Bildenden Kunst, in: KZfSS Sonderheft 25, S. 287-318
TIRYAKIAN, EDWARD A. (1981): Die Bedeutung von Schulen fr die Entwicklung der
Soziologie, in: WOLF LEPENIES (Hg), Geschichte der Soziologie, Bd. 2, Frankfurt/
M,S. 31-68
TPFER, BERNHARD (1964): Das kommende Reich des Friedens. Zur Entwicklung chi-
liastischer Zukunftshoffnungen im Hochmittelalter, Berlin (Ost)
TOEWS, JOHN EDWARD (1981): Hegelianism. The Path Toward Dialectical Humanism,
1805-1841, Cambridge University Press
TOPITSCH, ERNST (Hg) (1960): Probleme der Wissenschaftstheorie. Festschrift fr VIC-
TOR KRAFT, Wien
-, (1966): Logik der Sozialwissenschaften, Kln
TRAN VAN TOAN (1980): Theologie ou atheisme. La lecon de Ludwig Feuerbach, in:
Melanges de Science Religieuse 37, S. 239-252
456
TSCHIZEWSKIJ, DIMITRIJ (1961): Hegel bei den Slaven, Darmstadt, 2. Aufl.
VACCARO, G. BATTISTA (1980): Arnold Ruge e la lotta traprogresso e reazione in Ger-
mania (1838-1839), in: Annali dell'Istituto di Filosofia 2, Firenze, S. 243-87
VALERY, PAUL (1965): Herr Teste, Frankfurt/M
VALJAVEC, FRITZ (1951): Die Entstehung der politischen Strmungen in Deutschland,
Mnchen .
VALLAS, STEVEN P. (1979): The Lesson of Mannheim's Historicism, in: Sociology 13,
S. 459-474
VARRENTRAPP, CONRAD (1889): Johannes Schulze und das hhere preuische Unter-
richtswesen in seiner Zeit, Leipzig
VENEDEY, HERMANN (1930): Jacob Venedey. Darstellung seines Lebens und seiner
politischen Entwicklung bis zur Auflsung der ersten deutschen Nationalversammlung,
(Diss Freiburg 1930), Stockach
VIATTE, AUGUSTE (1928): Les Sources Occultes du Romantisme. Illuminisme - Theoso-
phie 1770-1820, 2 Bde, Paris
VIERHAUS, RUDOLF (1973) Geschichtswissenchaft und Soziologie, in: GERHARD
SCHULZ (Hg), Geschichte heute. Positionen, Tendenzen und Probleme, Gttingen,
S. 69-83
-, (Hg) (1980): Deutsche patriotische und gemeinntzige Gesellschaften, Mnchen
-, (1982): Liberalismus, in: Geschichtliche Grundbegriffe, hg. v. O. BRUNNER,
W. CONZE, R. KOSELLECK, Bd. 3, Stuttgart, S. 741-785
-, (1983a): Aufklrung und Freimaurerei in Deutschland, in: H. REINALTER (Hg), Frei-
maurer und Geheimbnde, im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa, Frankfurt/M, S. 115-
139
-, (1983b): Liberalismus, Beamtenstand und konstitutionelles System, in: W. SCHIEDER
(Hg), Liberalismus in der Gesellschaft des Vormrz, Gttingen, S. 3954
VOEGELIN, ERIC (1958): Wissenschaft, Politik und Gnosis, Mnchen
VOSS, JRGEN (1980): Die Akademien als Organisationstrger der Wissenschaften im
18. Jahrhundert, in: HZ 231, S. 43-74
VOSS, REINHARD (1977): Der deutsche Vormrz in der franzsischen ffentlichen Mei-
nung, Frankfurt/M Bern Las Vegas
WTZEL, PAUL (1949): Karl Schmidt als Theologe, Diss Halle Wittenberg (Masch. Sehr.)
WAGNER, FALK (1976a): Die Aufhebung der religisen Vorstellung in den philosophi-
schen Begriff, in: NZSyThRPh 18, S. 44-73
-, (1976b): Systemtheorie und Subjektivitt. Ein Beitrag zur interdisziplinren theologi-
schen Forschung, in: Internationales Jahrbuch fr Wissens- und Religionssoziologie 10,
S. 151-177
WALTHER, CHRISTIAN (1961): Typen des Reich-Gottes-Verstndnisses. Studien zur
Eschatologie und Ethik im 19. Jahrhundert, Mnchen
WARTOFSKY, MARX WILLIAM (1977): Feuerbach, Cambridge
WEBER, MAX (1964) Wirtschaft und Gesellschaft, Kln Berlin
WEIGLIN, PAUL (1942): Berliner Biedermeier. Leben, Kunst und Kultur in Alt-Berlin
zwischen 1815 und 1848, Bielefeld Leipzig
WEIL, HANS (1967): Die Entstehung des deutschen Bildungsprinzips, Bonn, 2. Aufl.
WEIN, HERMANN (1968): Kentaurische Philosophie. Vortrge und Abhandlungen,
Mnchen
WEINEL, HEINRICH (1914): Jesus im 19. Jahrhundert, Tbingen
WEINGART, PETER (Hg) (1973/74): Wissenschaftssoziologie, 2 Bde., Frankfurt/M
WENDE, PETER (1975): Radikalismus im Vormrz. Untersuchungen zur politischen
Theorie der frhen deutschen Demokratie, Wiesbaden
WENKE, ARTUR (1907): Junghegeltum und Pietismus in Schwaben, (Diss Bern) Dresden
457
WHITLOW, MAYNARD (1950): Max Stirner and the Heresy of Seif Abundance, in: ETC;
a reviewof general semantics, Chicago, Vol. 7, no. 4, S. 277-286
WIEGEL, KARL (1965): Otto Wigand, in: Leben und Werk deutscher Buchhndler, hg.
v. K. H. KALHFER, Leipzig, S. 76-81
WIEHL, RAINER (1972) Dialog und philosophische Reflexion, in: Neue Hefte fr Philoso-
phie, H. 2/3, Gttingen, S. 41-94
WILDERMUTH, ARMIN (1970): Marx und die Verwirklichung der Philosophie, Den
Haag
WILDT, ANDREAS (1970): Hegels Kritik des Jacobinismus, in: OSKAR NEGT (Hg),
Aktualitt und Folgen der Philosophie Hegels, Frankfurt/M, S. 265-292
WITTGENSTEIN, LUDWIG (1970): ber Gewiheit, Frankfurt/M
WITTKE, CARL FREDERICK (1945): Against the current. The life of Karl Heinzen, Chi-
cago
WITTKOP, JUSTUS FRANZ (1928): Jordans >Demiurgos<, Diss Mnchen
-, (1965): Der Boulevard oder Das vergngliche Leben des Brgers, Zrich Stuttgart
WITTRAM, REINHARD (1949): Kirche und Nationalismus in der Geschichte des deut-
schen Protestantismus im 19. Jahrhundert, in: ders., Nationalismus und Skularisation.
Beitrge zur Geschichte und Problematik des Nationalgeistes, Lneburg, S. 30-72
WOLFF, KURT H. (1968): Versuch zu einer Wissenssoziologie, Berlin Neuwied
WOLFF, MICHAEL (1970): Hegel im vorrevolutionren Ruland, in: OSKAR NEGT
(Hg), Aktualitt und Folgen der Philosophie Hegels, Frankfurt/M, S. 151-182
WOODCOCK, GEORGE (1963): Anarchism. A History of Libertarian Ideas and Move-
ments, Harmondsworth Middlesex
WRIGHT,EDMOND(1978): SociologyandthelronyModel.in: Sociology 12,S. 523-543
WUNDERER, HORTMANN (1980): Freidenkertum und Arbeiterbewegung. Ein ber-
blick, in: IWK 16, H. 1, S. 1-33
WURZBACHER, GERHARD (1971): Die ffentliche freie Vereinigung als Faktor sozio-
kulturellen, insbesondere emanzipatorischen Wandels im 19. Jahrhundert, in: W. RU-
EGG, O. NEULOH (Hg), Zur soziologischen Theorie und Analyse des 19. Jahrhun-
derts, Gttingen, S. 103-122
WYKOWSKI, IRMENTRAUD (1950): Die Kritik der deutschen Radikalen an den Begrif-
fen Nation, Nationalitt und Patriotismus, 'Diss Gttingen
XHAUFFLAIRE, MARCEL (1972): Feuerbach und die Theologie der Skularisation,
Mnchen
ZANARDO, ALDO (1965): Bruno Bauer hegeliano e giovane hegeliano. Estratto dalla
Rivista Critica di Storia della Filosofia, Firenze
-, (1969): Arnold Rge, giovane hegeliano 1824-1849, in: Annali 11, S. 189-382
ZEHNTER, HANS (1929): Das Staatslexikon von Rotteck und Welcker, Jena
ZELENY, JINDRICH (1968): Die Wissenschaftslogik und >Das Kapitals Frankfurt/M
ZIEGLER, THEOBALD (1899): Die geistigen und socialen Strmungen des neunzehnten
Jahrhunderts, Berlin
ZLOCISTI, THEODOR (1921): Moses Hess. Der Vorkmpfer des Sozialismus und Zionis-
mus 1812-1875, Berlin, 2. Aufl.
ZNANIECKI, FLORJAN (1940): The Social Role of the Man of Knowledge, New York
ZOCCOLI, HEKTOR (1909): Die Anarchie. Ihre Verknder - Ihre Ideen - Ihre Taten.
Versuch einer systematischen und kritischen bersicht, sowie einer ethischen Beurtei-
lung, Amsterdam
458
459
460
Edler, Erich 337,440
Eichendorff, Joseph von 303
Eichhorn, Johann Albrecht Friedrich 22,
125 f., 128, 408
Eichler, Ludwig 71,207,211, 321, 427
Elias, Wilhelm 295,427
Elkar, Rainer Siegbert 64, 440
Ely.Geoff 161,438
Engels, Friedrich 22 f., 41,52 f., 69, 72,
76,78 f., 82,150 f., 164,177,207 f., 211,
234,245 f., 279,287,307,314,316,331,
335 f., 378,384,388,395,404,427,431
Engelsing, Rolf 327,336,440
Erdmann, Johann Eduard 54 f., 78,86,
133,136,143 f., 155,440
Esau, Lotte 74,232, 440
D'Ester, Karl 69
Estermann, Alfred 427
Euchner, Walter 441
Everke, Karl Friedrich 238,441
Ewert, Michael 60,441
Exner, Franz 109,427
Faber, Karl Georg 240,441
Faisal, Faris Fanner al 441
Fanto, Irene 84,441
Fast, Heinhold 441
Faucher, Julius 42, 62, 72, 78, 307
Fehrenbach, Elisabeth 244, 441
Fein, Georg 245
Feldmann, Christian 228 f., 427
Fetscher, Iring 414,441
Feuerbach, Amselm Ritter von 68
Feuerbach, Ludwig 41,53,59, 62, 68-71,
77 f., 81 f., 84, 86,117,124,131,133,
155,161,169-174,177,236 f., 277,293,
330,335,351,354-356,376,387 f., 393,
395,404,427
Fichte, Immanuel Hermann 61, 85, 114,
133,148,331,354,422,427
Fichte, Johann Gottlieb 60, 70, 94 f.,
106 f., 134,165,274,328,361,383,388
Finger, Otto 440
Fiore, Joachim von 146,347, 350
Fischer, Fritz 359,361,405,441
Fischer, Hermann 61,441
Fischer, Kuno 81, 415, 427
Fischer, Wolfram 65, 441
Fleischer, Karl Moritz 69, 223,333, 427
Flottwell, Eduard 41,73,75,207,211,
244,333
Flottwell, Eduard Heinrich 75
Florencourt, Franz von 121
Frster, Friedrich Christian 95
Folien, August 75 f.
Fontane, Theodor 30, 65, 78, 333 f., 427
Foucault, Michel 21 f., 49 f., 58, 81 f.,
257 f., 441
Fourier, Charles 83, 274, 327
Frnkel, Albert 323,380 f., 412 f., 422,
427
Frank, Manfred 151,441
Franke, Richard Walter 441
Frantz, Constantin 71
Frauenstdt, Julius 146,159,427
Freiligrath, Ferdinand 219
Frese, Jrgen 87
Freud, Sigmund 98
Frey, Arthur 326,428
Freytag, Gustav 66
Friedensburg, W. 154, 248, 428
Friedrich II., Knig von Preuen
118-120,142,150,186,258 f.,
Friedrich Wilhelm III., Knig von Preuen
121 f., 192
Friedrich Wilhelm IV., Knig von
Preuen 26, 67, 120-123, 150, 152,
204,220 f., 246,260 f., 267,365
Frbel, Julius 66,69,72,75 f., 87
Fret, Francois 64, 438
Gabler, Georg Andreas 133,143
Gadamer, Hans Georg 28, 49,134,441
Gall, Lothar 240,441
Gamm, Gerhard 441
Gans, Eduard 41, 73, 117,122, 124,143,
149,155,428
Garber, Klaus 60,442
Garewiczjan 427,442
Gauthier, Theophile 302 f.
Gebhardt, Jrgen 56,85 f., 148,345,403,
406,410,442
Gehlen, Arnold 58
Geiger, Theodor 13,21 f., 442
Geizer, Heinrich 61, 428
Gerlach, Antje 76, 442
Gerlach, Ernst Ludwig von 122
Gerlach, Leopold von 122
Gerth, Hans 64, 94, 141, 442
Gervinus, Georg Gottfried 81, 105, 428
GillisJohnR. 65,150,442
Giseke, Robert 300 f., 318, 325, 335, 428
461
462
463
464
465
466
467
468
469
ber diese Reihe
Die Bnde der Reihe bergnge bewegen sich in einem Zwischenbereich, in dem
philosophische berlegung und sozialwissenschaftliche Forschung aufeinander sto-
en und sich verschrnken. Das thematische Schwergewicht sind Prozesse des-
gemeinsamen Handelns, Sprechens und leiblichen Verhaltens, die sich in einer
sozialen Lebenswelt abspielen und deren Strukturen bereichern und verndern.
Die Frage nach der Ordnung der Welt und Gesellschaft und nach den bergngen
von einer Ordnung zur andern stellt sich auf neue Weise, sobald man- von einer
Zwischensphre ausgeht, die auf die Dauer von keiner Einzelinstanz zu steuern und
durch keine bestimmte Ordnung zu erschpfen ist. In dieser Begrenzung liegt das
Potential zu einer Kritik, die nicht aufs Ganze geht.
In der Abfolge der Reihe, die der phnomenologischen Tradition verbunden, aber
nicht auf sie beschrnkt ist, soll die Errterung theoretischer und methodischer
Grundfragen abwechseln mit der Prsentation spezifischer Forschungsanstze und
geschichtsvariahler Untersuchungen. Bevorzugte Themen sind etwa die leibliche
Verankerung von Handeln und Erkennen, die Ausbildung und Ausgrenzung von
Milieus, Prozesse der Normalisierung und Typisierung, der Kontrast von Alltags-
und Forschungspraktiken, die Divergenz von Erkenntnis- und Rationalittsstilen,
der Austausch zwischen fremden Kulturen, Krisen der abendlndischen Lebens-
und Vernunftordnung u.a.
Um diesen Studien ein historisches Relief zu verleihen, werden thematisch relevante
Traditionsbestnde in reprsentativen Texten vergegenwrtigt. Diesem internatio-
nalen Programm entspricht auf deutscher Seite der Versuch, an die Forschungslage
vor 1933 wiederanzuknpfen und Vergessenes wie Verdrngtes zurckzuholen.
Erschienen sind:
Bandl
Richard Grathoff / Bernhard Waldenfels
(Hrsg.)
Sozialitt und Intersubjektivitt
Phnomenologische Perspektiven der
Sozialwissenschaften im Umkreis
von Aron Gurwitsch und Alfred Schtz.
1983.410 S. ISBN 3-7705-2187-0
Band 2
UlfMatthiesen
Das Dickicht der Lebenswelt und die Theorie
des kommunikativen Handelns
2. Aufl. 1985. 186 S. ISBN 3-7705-2188-9
Band 3
Maurice Merleau-Ponty
Die Prosa der Welt
Hrsg. v. Claude Lefort. Einl. z. dt. Ausg. v.
Bernhard Waidenfels. Aus d. Franz. v.
Regula Giuliani.
1984. 168 S. ISBN 3-7705-2189-7
Band 4
Alfred Schtz, Aron Gurwitsch
Briefwechsel 1939-1959
Hrsg. v. Richard Grathoff. Mit ein. Einl. v.
Ludwig Landgrebe.
1985. XXXX, 544 S. mit Frontispiz.
ISBN 3-7705-2260-5
470
471
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Von der Paradiesehe zur Gütergemeinschaft: Die Ehe in der mittelalterlichen Lebens- und VorstellungsweltVon EverandVon der Paradiesehe zur Gütergemeinschaft: Die Ehe in der mittelalterlichen Lebens- und VorstellungsweltNoch keine Bewertungen
- Bibliographie Band II 2Dokument606 SeitenBibliographie Band II 2Saskia Van SanteNoch keine Bewertungen
- Zeitschrift für interkulturelle Germanistik: 9. Jahrgang, 2018, Heft 1Von EverandZeitschrift für interkulturelle Germanistik: 9. Jahrgang, 2018, Heft 1Dieter HeimböckelNoch keine Bewertungen
- BOSBACH, GRÖNING, Hrsg. - Landschaftsgärten Des 18. Und 19. Jhdt.Dokument209 SeitenBOSBACH, GRÖNING, Hrsg. - Landschaftsgärten Des 18. Und 19. Jhdt.Peter HeerenNoch keine Bewertungen
- Grenzgänge zwischen Dichtung, Philosophie und Kulturkritik: Über Margarete SusmanVon EverandGrenzgänge zwischen Dichtung, Philosophie und Kulturkritik: Über Margarete SusmanNoch keine Bewertungen
- Handbücher Zur Sprach - Und Kommunikationswissenschaft Teilband 2Dokument1.190 SeitenHandbücher Zur Sprach - Und Kommunikationswissenschaft Teilband 2Viktor RiveraNoch keine Bewertungen
- Die Theorie der Praxis und die Praxis der Forschung: Ralf Bohnsack im Gespräch mit Vera SparschuhVon EverandDie Theorie der Praxis und die Praxis der Forschung: Ralf Bohnsack im Gespräch mit Vera SparschuhNoch keine Bewertungen
- (Heinrich Lausberg) Elemente Der Literarischen Rhe (BookFi) PDFDokument169 Seiten(Heinrich Lausberg) Elemente Der Literarischen Rhe (BookFi) PDFjesuspoloarrondoNoch keine Bewertungen
- SHCT 163 Moser - Die Dignität Des Ereignisses - Studien Zu Heinrich Bullingers Reformationsgeschichtsschreibung Band I 2012 PDFDokument1.124 SeitenSHCT 163 Moser - Die Dignität Des Ereignisses - Studien Zu Heinrich Bullingers Reformationsgeschichtsschreibung Band I 2012 PDFL'uomo della RinascitáNoch keine Bewertungen
- Die Philologische Frage. Kulturwissenschaftliche Perspektiven Auf Die Theoriegeschichte Der Philologie PDFDokument22 SeitenDie Philologische Frage. Kulturwissenschaftliche Perspektiven Auf Die Theoriegeschichte Der Philologie PDFLeonor SaroNoch keine Bewertungen
- Sprachliche Zweifelsfälle Im Deutschen: Wolf Peter KleinDokument368 SeitenSprachliche Zweifelsfälle Im Deutschen: Wolf Peter KleinIvanka ChepchurNoch keine Bewertungen
- (Sammlung Kurzer Grammatiken Germanischer Dialekte. B - Ergänzungsreihe 8) Karin Schneider - Paläographie Und Handschriftenkunde Für Germanisten. Eine Einführung-Walter de Gruyter (2014) PDFDokument260 Seiten(Sammlung Kurzer Grammatiken Germanischer Dialekte. B - Ergänzungsreihe 8) Karin Schneider - Paläographie Und Handschriftenkunde Für Germanisten. Eine Einführung-Walter de Gruyter (2014) PDFRené MateiNoch keine Bewertungen
- Halm. Verzeichniss Der Älteren Handschriften Lateinischer Kirchenväter in Den Bibliotheken Der Schweiz. 1865.Dokument68 SeitenHalm. Verzeichniss Der Älteren Handschriften Lateinischer Kirchenväter in Den Bibliotheken Der Schweiz. 1865.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNoch keine Bewertungen
- Makrizi Traktat Über Die MineralienDokument340 SeitenMakrizi Traktat Über Die MineralienKhalilou BouNoch keine Bewertungen
- Ben Sira's God - Proceedings of The International Ben Sira Conference, Durham - Ushaw College 2001 (PDFDrive)Dokument404 SeitenBen Sira's God - Proceedings of The International Ben Sira Conference, Durham - Ushaw College 2001 (PDFDrive)Verónica Guerra de AltamiranoNoch keine Bewertungen
- Hauptwerke Der Hebräischen Literatur: Edition Kindlers Literatur LexikonDokument118 SeitenHauptwerke Der Hebräischen Literatur: Edition Kindlers Literatur LexikonProfessor Rafael DaherNoch keine Bewertungen
- Book JAKOBI - Der Einfluss Ovids Auf Den Tragiker Seneca (1988)Dokument246 SeitenBook JAKOBI - Der Einfluss Ovids Auf Den Tragiker Seneca (1988)VelveretNoch keine Bewertungen
- I-2Dokument1.848 SeitenI-2Nelfi NurhariyantiNoch keine Bewertungen
- Wug 014 - Gadamer - Volk Und Geschichte Im Denken Herders (1942) - 1.00 PDFDokument30 SeitenWug 014 - Gadamer - Volk Und Geschichte Im Denken Herders (1942) - 1.00 PDFtechj100% (1)
- Tempus-Setzung in Thomas Bernhards Der Stimmenimitator PDFDokument110 SeitenTempus-Setzung in Thomas Bernhards Der Stimmenimitator PDFdr_benwayNoch keine Bewertungen
- Benjamin Werkausgabe SubskriptionDokument3 SeitenBenjamin Werkausgabe SubskriptionportoviaconmeNoch keine Bewertungen
- Boschenstein-Studien Zur Dichtung Des Absoluten PDFDokument178 SeitenBoschenstein-Studien Zur Dichtung Des Absoluten PDFTrad AnonNoch keine Bewertungen
- (9783770559275 - Geteilte Gegenwarten) Geteilte GegenwartenDokument328 Seiten(9783770559275 - Geteilte Gegenwarten) Geteilte GegenwartenNo NameNoch keine Bewertungen
- (Supplements To Novum Testamentum 006) Neotestamentica Et Patristica 1962Dokument352 Seiten(Supplements To Novum Testamentum 006) Neotestamentica Et Patristica 1962Novi Testamenti LectorNoch keine Bewertungen
- 1974 Book DasGesellschaftlich-KomischeDokument297 Seiten1974 Book DasGesellschaftlich-KomischeMantovani PedroNoch keine Bewertungen
- Norbert Bolz - Kunst Als Placebo PDFDokument10 SeitenNorbert Bolz - Kunst Als Placebo PDFmukixyz100% (1)
- Rita Rieger - Bewegungsszenarien Der ModerneDokument233 SeitenRita Rieger - Bewegungsszenarien Der ModerneLucySky7Noch keine Bewertungen
- Bajohr - 2016 - Code Und Konzept Literatur Und Das DigitaleDokument264 SeitenBajohr - 2016 - Code Und Konzept Literatur Und Das DigitaleceprunNoch keine Bewertungen
- Rivero, Rivero. Zur Bedeutung Des Begriffs Ontologie Bei Kant PDFDokument255 SeitenRivero, Rivero. Zur Bedeutung Des Begriffs Ontologie Bei Kant PDFMANUEL SANCHEZ RODRIGUEZNoch keine Bewertungen
- Aeneis Carl Thiel PDFDokument686 SeitenAeneis Carl Thiel PDFEiichiro TaniNoch keine Bewertungen
- Writing and Its Use (Schrift Und Schriftlichkeit) Part 1 - DeGruyterDokument1.014 SeitenWriting and Its Use (Schrift Und Schriftlichkeit) Part 1 - DeGruyterT. E.Noch keine Bewertungen
- Gesammelte Schriften Viii Band Weltanschauungslehre Abhandlungen Zur Philosophie Der Philosophie 3rdnbsped CompressDokument300 SeitenGesammelte Schriften Viii Band Weltanschauungslehre Abhandlungen Zur Philosophie Der Philosophie 3rdnbsped CompressJason KingNoch keine Bewertungen
- Hekalot Studien Peter PDFDokument320 SeitenHekalot Studien Peter PDFnsbopchoNoch keine Bewertungen
- Ntention Des Dichters Und Die Zwecke Der Interpreten Zu Theorie Und Praxis Der Dichterauslegung in Den Platonischen Dialogen Quellen Und StudieDokument345 SeitenNtention Des Dichters Und Die Zwecke Der Interpreten Zu Theorie Und Praxis Der Dichterauslegung in Den Platonischen Dialogen Quellen Und StudiebrysonruNoch keine Bewertungen
- Lehr, Adorno. Kleine Formen. Konstellation, Konfiguration Etc.Dokument268 SeitenLehr, Adorno. Kleine Formen. Konstellation, Konfiguration Etc.Ilias GiannopoulosNoch keine Bewertungen
- Das Argument 90Dokument205 SeitenDas Argument 90king_buzzoNoch keine Bewertungen
- (Theologische Bibliothek Topelmann) Ulrich Barth, Christian Danz, Friedrich Wilhelm Graf, Wilhelm Gräb (eds.)-Aufgeklärte Religion und ihre Probleme. Schleiermacher - Troeltsch - Tillich-De Gruyter (2.pdfDokument746 Seiten(Theologische Bibliothek Topelmann) Ulrich Barth, Christian Danz, Friedrich Wilhelm Graf, Wilhelm Gräb (eds.)-Aufgeklärte Religion und ihre Probleme. Schleiermacher - Troeltsch - Tillich-De Gruyter (2.pdfLucas SoaresNoch keine Bewertungen
- Grundprobleme Der Phänomenologie IDokument40 SeitenGrundprobleme Der Phänomenologie InukiduzNoch keine Bewertungen
- Fiktion, FiktionalitätDokument13 SeitenFiktion, FiktionalitätKatarina Eva PaczérNoch keine Bewertungen
- 1-2 (1976, N. Walter) Frag. Jüdisch-Hellenistischer Historiker.Dokument81 Seiten1-2 (1976, N. Walter) Frag. Jüdisch-Hellenistischer Historiker.sevasteNoch keine Bewertungen
- (Texte Und Kommentare 21) Müller, Carl Werner - Euripides - Philoktet - Testimonien Und Fragmente-De Gruyter (2013)Dokument468 Seiten(Texte Und Kommentare 21) Müller, Carl Werner - Euripides - Philoktet - Testimonien Und Fragmente-De Gruyter (2013)Valentina Dell'olioNoch keine Bewertungen
- Ex Pindaros22wilauoftDokument546 SeitenEx Pindaros22wilauoftAlec NiculescuNoch keine Bewertungen
- Bibliographie Werner HamacherDokument14 SeitenBibliographie Werner HamacherShigeo HayashiNoch keine Bewertungen
- Mandaeischer DiwanDokument26 SeitenMandaeischer DiwanDannieCaesarNoch keine Bewertungen
- (Arbeitsgemeinschaft Für Forschung Des Landes Nordrhein-Westfalen 72) Josef Pieper (Auth.) - Über Den Begriff Der Tradition-VS Verlag Für Sozialwissenschaften (1958) PDFDokument61 Seiten(Arbeitsgemeinschaft Für Forschung Des Landes Nordrhein-Westfalen 72) Josef Pieper (Auth.) - Über Den Begriff Der Tradition-VS Verlag Für Sozialwissenschaften (1958) PDFEugenio Muinelo PazNoch keine Bewertungen
- SkriptDokument215 SeitenSkriptMarie GrünterNoch keine Bewertungen
- Pseudo-Dionysius Areopagita - de Divinis Nominibus (Ed. Suchla) PDFDokument145 SeitenPseudo-Dionysius Areopagita - de Divinis Nominibus (Ed. Suchla) PDFGustavo RiesgoNoch keine Bewertungen
- Derrida, Jacques MemoiresDokument171 SeitenDerrida, Jacques MemoiresAbo Borape NinoNoch keine Bewertungen
- Einführung in Die Deutsche Literatur Des 20. Jahrhunderts - Band 3 - Bundesrepublik Und DDRDokument299 SeitenEinführung in Die Deutsche Literatur Des 20. Jahrhunderts - Band 3 - Bundesrepublik Und DDRKarl RoßmannNoch keine Bewertungen
- The Vienna Circle in Hungary/Der Wiener Kreis in UngarnDokument295 SeitenThe Vienna Circle in Hungary/Der Wiener Kreis in Ungarndeco070Noch keine Bewertungen
- Das Carmen Adversus Marcionitas Einleitung, Text, Übersetzung PDFDokument244 SeitenDas Carmen Adversus Marcionitas Einleitung, Text, Übersetzung PDFManticora 1120Noch keine Bewertungen
- PTS 26 Hilarius Von Poitiers Und Die Bischofsopposition Gegen Konstantius II (1984) PDFDokument420 SeitenPTS 26 Hilarius Von Poitiers Und Die Bischofsopposition Gegen Konstantius II (1984) PDFCvrator MaiorNoch keine Bewertungen
- Kroll, Wilhelm - Catull - Lateinischer Text Mit Deutschsprachigen Anmerkungen-De Gruyter (1989)Dokument330 SeitenKroll, Wilhelm - Catull - Lateinischer Text Mit Deutschsprachigen Anmerkungen-De Gruyter (1989)Petr OzerskyNoch keine Bewertungen
- Frege-Briefe An WittDokument30 SeitenFrege-Briefe An WittTrad AnonNoch keine Bewertungen
- Vonkantbishegel02kron PDFDokument560 SeitenVonkantbishegel02kron PDFGuillermo Navarro Ubeda100% (1)
- Grundriss AntikeDokument5 SeitenGrundriss AntikeЛеонид ЖмудьNoch keine Bewertungen
- SUHRKAMP Fruehjahr 2012Dokument110 SeitenSUHRKAMP Fruehjahr 2012lercheNoch keine Bewertungen
- Apion._dionysius._haas, Walter_Linke, Konstanze_Neitzel, Susanne_Tyrannion - Die Fragmente Des Grammatikers Dionysios Thrax. Die Fragmente Der Grammatiker Tyrannion Und Diokles. Apions Glossai HomerikDokument337 SeitenApion._dionysius._haas, Walter_Linke, Konstanze_Neitzel, Susanne_Tyrannion - Die Fragmente Des Grammatikers Dionysios Thrax. Die Fragmente Der Grammatiker Tyrannion Und Diokles. Apions Glossai HomeriktiagobentivoglioNoch keine Bewertungen
- Dissertation Gabriele MayerDokument272 SeitenDissertation Gabriele MayerIonut BăncilăNoch keine Bewertungen
- Sabine - Müller) - Das - Hellenistische - Königspaar - in MEDIALEN-PTOLEMAIOS II - ARSINOE II PDFDokument465 SeitenSabine - Müller) - Das - Hellenistische - Königspaar - in MEDIALEN-PTOLEMAIOS II - ARSINOE II PDFathanasios N papadopoulosNoch keine Bewertungen
- Claude Lévi-Strauss - Das Wilde Denken-Suhrkamp (1973) PDFDokument332 SeitenClaude Lévi-Strauss - Das Wilde Denken-Suhrkamp (1973) PDFIstván DrimálNoch keine Bewertungen
- Gregorius - PendelmagieDokument31 SeitenGregorius - PendelmagieBethy GarmesNoch keine Bewertungen
- Manfred Frank Der Unendliche Mangel An Sein Schellings Hegelkritik Und Die Anfänge Der Marxschen Dialektik 1992Dokument393 SeitenManfred Frank Der Unendliche Mangel An Sein Schellings Hegelkritik Und Die Anfänge Der Marxschen Dialektik 1992István DrimálNoch keine Bewertungen
- Zimmermann Magnetismus Und MesmerismusDokument726 SeitenZimmermann Magnetismus Und MesmerismusIstván DrimálNoch keine Bewertungen
- Düsing - Selbstbewußtseinsmodelle Zur Konkreten SubjektivitätDokument286 SeitenDüsing - Selbstbewußtseinsmodelle Zur Konkreten Subjektivitätshoeger100% (1)
- Uralte Weisheit Web 02Dokument162 SeitenUralte Weisheit Web 02SatyapremNoch keine Bewertungen
- Prokla 50Dokument166 SeitenProkla 50adorno65Noch keine Bewertungen
- Buchbesprechung Gottfried SchrammDokument10 SeitenBuchbesprechung Gottfried SchrammHajrullah KulvudhajNoch keine Bewertungen
- Rvo 9608 010622Dokument2 SeitenRvo 9608 010622M KNoch keine Bewertungen
- Programmheft Zur CSD Eröffnungsgala 2012 - Christopher Street Day (CSD) Stuttgart 2012Dokument40 SeitenProgrammheft Zur CSD Eröffnungsgala 2012 - Christopher Street Day (CSD) Stuttgart 2012Christoph MichlNoch keine Bewertungen
- Sure Al - Fatiha (Kommentar Auf Deutsch) سورة الفاتحةDokument6 SeitenSure Al - Fatiha (Kommentar Auf Deutsch) سورة الفاتحةalqudsulana89100% (2)
- Bologna WurdigkeitenDokument11 SeitenBologna WurdigkeitenAnonymous ckDC87Noch keine Bewertungen
- Der Zirkel Der Zinne: Struktur Und AufbauDokument9 SeitenDer Zirkel Der Zinne: Struktur Und AufbauSimón VelascoNoch keine Bewertungen
- Johannes Friede - Das JohanneslichtDokument96 SeitenJohannes Friede - Das Johanneslichtteesuser100% (1)
- Jakob Lorber - StichwortverzeichnisDokument160 SeitenJakob Lorber - StichwortverzeichnisAlpharius OmegataNoch keine Bewertungen
- Das System Der Lataif - Chakras - Nach Allauddawla SemnaniDokument4 SeitenDas System Der Lataif - Chakras - Nach Allauddawla SemnaniAssaduddinNoch keine Bewertungen