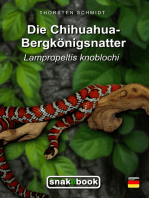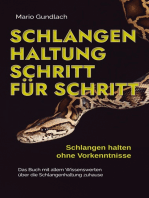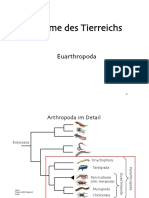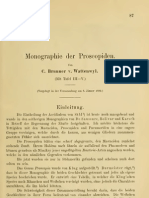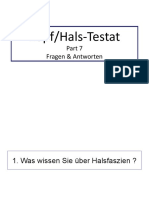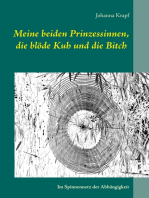Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Schmidt 2005 Tar 110 3 49
Hochgeladen von
Ferenc TörökOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Schmidt 2005 Tar 110 3 49
Hochgeladen von
Ferenc TörökCopyright:
Verfügbare Formate
Günter Schmidt
Neupublikation einiger von mir In "Arachnol. Mag." und
"r arantulas of the World" zwischen 2000 und 2005 veröf-
fentlichten Arbeiten
Abstract
Because some of my publications containing the names of new spe-
eies have no mention of a type depository, these names are not a-
vailable according to § 16.4.2 ICZN. Therefore the following new
description was indicated. In this connection it may be expressly
pointed to the fact that the publication of the new names
"Ornithoctonus aureotibialis" and "Haplopelma longipes" in the inter-
net by von WIRTH & STRIFFLER (2005) is invalid (§ 9.8. ICZN).
Einleitung
Bei einigen meiner insgesamt 32 zwischen 2000 und 2005 veröf-
fentlichten Arbeiten mit Neubeschreibungen wurde auf die Nennung
des Hinterlegungsorts der Typen verzichtet, was nach § 16.4.2 nicht
statthaft ist und zur Ungültigkeit bzw. Nichtverfügbarkeit der verwen-
deten Speziesnamen führt. Dies wurde It. von WIRTH &
STRIFFLER (zitiert nach der Internetversion einer unveröffentlichten
Arbeit, die in "Arthropoda" 13 (2) 2005 erscheinen soll) auf Anfrage
vom Präsidenten der Internationalen Kommission für Zoologische
Nomenklatrur, Evenhuis und dem Sekretär dieser Kommission, Po-
laszek, bestätigt. Aus diesem Grunde erfolgt hier eine Neupublikati-
on.
Im übrigen gelten die in dieser Internetversion enthaltenen neuen
Artnamen "Omithoctonus aureotibialis" und "Haplopelrna longipes"
nach Punkt 10 (a) der Einleitung und § 9.8 der ICZN als unveröffent-
licht und sind somit nicht verfügbar. Denn auf elektronischem Wege
verbreitete Texte und Illustrationen gelten nicht als Publikation. An-
fragen nach dem Auslieferungsdatum der Arbeit an den Herausge-
ber der "Arthropoda", Fritzsche, blieben ebenso unbeantwortet wie
die Bitte nach einem Belegexemplar. Auch Bemühungen, die betr.
Ausgabe auf normalem Wege zu erhalten, scheiterten, so daß da-
von auszugehen ist, daß sie nicht existiert."
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005 3
Günter SCHMIDT & Mare TESMOINGT
Eine weitere Acanthoscurria-Art aus Brasilien und Bolivien (Araneae:
Theraphosidae: Theraphosinae)
Abstract
Acanthoscurria acuminata sp. n., one of the smallest species of the genus, differs from all
other species by a carapax excrescence to the back. The tibial spur is inconspicuous. Male
with about 8 long and thin plumose stridulating bristles on trochanter of palp and leg I. Female
with stridulating bristles on trochanter of palp only. Femur 111 a little thickened in male. sper-
mathecae similar to A. stemalis POCOCK, 1903.
Keywords
Acanthoscurria acuminata, Cyrtopholis, Spaerobothria, Terahposidae, Brazil, Bolivia.
Einleitung
Am 15.12.1995 berichtete VERDEZ (Brief an SCHMIDT) zum ersten Mal von dieser eigen-
tümlichen bolivianischen Art. Am 10.4.1997 erhielt SCHMIDT eine weitere Nachricht darüber
von TESMOINGT. Im September 1997 teilte WEST SCHMIDT mit, er kenne diese Spezies.
Sie gehöre zur Gattung Acanthoscurria. Ungefähr um die gleiche Zeit erfuhr SCHMIDT von
PINZ, daß dieser ein Männchen der Spezies in Brasilien gefangen habe, das er als bisher
unbekannte Acanthoscurria bestimmen konnte. 1997 wies SCHMIDT in einem Bestimmungs-
schlüssel für die Gattungen der Theraphosinae auf das Vorkommen eines Carapaxaufsatzes
bei Acanthoscurria hin.
Amerikanische Vogelspinnen mit Carapaxaufsätzen waren bisher nur in den Gattungen Cyr-
topholis und Spaerobothria bekannt. Die neue Art ist der erste Vertreter der Gattung A-
canthoscurria, bei dem so eine Struktur nachgewiesen werden konnte.
Material und Methode
1 Weibchen (Holotyp) SMF, 1 Weibchen (Paratyp), leg. VERDEZ, November 1995 ca. 150 km
nördlich von Santa CruziBolivien, 1 Männchen (Allotyp) und seine letzte Exuvie, leg. PINZ
1997 bei Cuiaba/Mato GrossoIBrasilien. Das in Alkohol konservierte Material wurde getrock-
net. Die Untersuchung erfolgte mit der Stereolupe bei 30- und 60facher Vergrößerung. Taxo-
nomisch relevante Strukturen wurden gezeichnet. Der Allotyp befindet sich in der Kollektion
von PINZ, die Paratypen werden im Senckenbergmuseum, Frankfurt/M. deponiert. Zur Be-
schreibung des Männchens konnte nur die Exuvie verwendet werden.
Diagnose
Kleine Art mit horizontalem, nach hinten gerichtetem, sich verschmälemdem Carapaxaufsatz,
der dem Thoraxteil aufliegt (abb. 1), unauffälliger Tibia-Apophyse, etwas verdicktem Femur 111
beim Männchen und nur etwa 8 dünnen und langen Stridulationsbprsten an Trochanter von
Taster und Bein I, bei Weibchen nur am Tastertrochanter. Spermathek ähnlich wie bei A.
stemalis.
Dorivatio nominis
Von lat. acuminatus = zugespitz, wegen der Form des Carapaxaufsatzes.
Beschreibung des Weibehens (Holotyp)
Carapax 15x11, Chelizeren 7x3, Klaue 5,3. Bezahnung: 11 Zähne, 8. und 10. sehr klein. Labi-
um 2 lang, 3 breit, apikal mit mehreren Reihen engstehender kleiner Dömchen. Sternum 6x4.
4 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005
Abb. 1 - Acanthoscurria acuminata sp. n., Weib-
chen, Carapax lateral
Gliedmaßen in mm:
Femur Patella Tiba Metatarsus Tarsus Ges.-Länge
Taster 6,0 4,0 5,0 5,0 20,0
Bein I 10,0 4,0 6,0 6,0 4,5 29,0
Bein 11 9,0 4,5 5,0 5,0 4,5 27,0
Bein 111 7,0 3,0 4,0 6,0 4,5 24,5
Bein IV 9,0 5,0 6,0 8,0 5,0 33,0
Tasterfemur gebogen. Alle Tarsen und Metatarsen I, 11 voll, Metatarsus 111 mehr als 1/3 scopu-
liert. Tarsalklauen mit 2 oder 3 winzigen Zähnchen. Bestachelung: Taster: Tibia va 2. I: Mv b
1, a 1. 11: Ti v 0-1-3, Mv b 1, a 2.111: Ti va 2, pi 0-1-1-1, rl 0-1-1-1, Mv 0-1-3, pi 0-1-1, rlO-1-1.
IV: Ti v a 2, M v 1-1-1-1-2-1-1-1-1-1, d 0-1-1, pi 1-1-1-1, rl1-1-2. Clypeus wie beim Männchen.
Augenhügel flach. Augen: 1. Reihe procurv, 2. Reihe recurv. VMA 0,39, VMA-VMA 0,30, VSA
0,36, VMA-VSA 0,26, HMA 0,33, VMA-HMA 0,13, HSA 0,33, HMA-HSA 0,07, VSA-HSA 0,20,
HMA-HMA 0,86. Spinnwarzen: Basalglied 0,79, Mittelglied 2,20, Gesamtlänge 3,78. Stridulati-
onsorgan: Tastertrochanter mit etwa 8 schwer erkennbaren Sgtridulationsborsten. Trochanter
von Bein lohne Stridulationsborsten. Carapaxaufsatz und Färbung wie beim Männchen.
Spermathek Abb. 2.
Abb. 2 - Acanthoscurria acuminata sp. n., Weib-
chen, Spermathek
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world· Oktober 2005 5
Beschreibung des Männchens (Nach Exuvie des subadulten Allotyps, Maße in mm)
Carapax 13x11, am breitesten an der Basis des Aufsatzes. Chelizeren 7x3, Klaue 4,6. Bezah-
nung: 11 Zähne, 1. klein, 2.-4. groß, 5. mittelgroß, 6. und 7. kleiner, 8. mittelgroß, 9. groß 10.
klein, 11. groß. Labium 1,5 lang, 2,0 breit, apikal mit ca. 6 Reihen von Dörnchen. '
Gliedmaßen in mm:
Femur Patella Tiba Metatarsus Tarsus Ges.-Länge
Taster 6,0 4,0 6,0 5,0 21,0
Bein I 10,0 6,0 7,0
Bein 11 9,0 5,0 6,0
Bein 111 7,0 4,0 5,0 7,0 4,0 27,0
Bein IV 9,0 5,0 7,0 10,0 4,6 35,6
Tasterfemur gebogen. Fovea: -, Clypeus breiter als Durchmesser eines VMA. Augen: 1. Reihe
schwach procurv, 2. Reihe schwach recurv. VMA 0,39, VMA-VMA 0,33, VSA 0,42, VMA-VSA
0,20, HMA fast rund, 0,26, VMA-HMA 0,07, HSA 0,26, HMA-HSA 0,10, VSA-HSA 0,26, HMA-
HMA 0,99. Tibia-Apophyse sehr kurz und unauffällig (vidi!). Spinnwarzen: Basalglied 2,0,
Mittelglied 2,6, Endglied 2,6, Gesamtlänge 7,2. Bestachelung: Taster Ti v 2-2, pi 0-0-1, rI 0-0-
1.1: Ti vm a 1, a 1.11: Ti vm 1, a 1.111: Ti vm 1, a2, pl1, M v 1-0-0, pi 0-1-0, rI 0-1-0. IV: Ti v
0-1-0, pi 0-0-1, M va 2. Stridulationsorgan: Etwa 8 lange und dünne Stridulationsborsten an
Trochanter von Taster und bein I. Färbung: Carapax mittelbraun, Opisthosoma schwarzgrau
mit fuchsroten Haarborsten.
Diskussion
Die Gattung Acanthoscurria ist mit nunmehr 36 Arten nach Aphonopelma die zweitgrößte der
Theraphosinae. Sie ist durch nur 1 Tibia-Apophyse bei den Männchen, ein Stridulationsorgan
auf den Trochanteren der Taster (und meist auch des 1. Beinpaares) sowie eine Spermathek
mit hohem Basalteil gut charakterisiert (SCHMIDT, 1998). Aus dem Rahmen fällt bei den
Weibchen lediglich A. antillensis POCOCK 1903. Wir sind uns mit RUDLOFF (persönliche
Mitteilung an SCHMIDT 1997) darin einig, daß diese Art in eine andere Gattung gestellt wer-
den muß.
Die neue Art zählt zusammen mit A. cunhae MELLO-LEITAo 1923 und A. gomesiana MEL-
LO-LEITAo 1923 zu den kleinsten der Gattung.
Lebensweise
Die Weibchen wurden von VERDEZ, BRAUNSHAUSEN und TOMMASINI unter toten Baum-
stämmen in einem kleinen Wald während der Regenzeit gefangen. Der boden war zur Fang-
zeit trocken. Die Temperatur unter den Baumstämmen betrug 26° C (in der Sonne war es
über 50°). Die Tiere fraßen zahlreich Heimchen und Grashüpfer. In Gefangenschaft sind sie
zwar schnell, aber nicht aggressiv. Sie stellen keine wohnhöhlen her, fressen mäßig und
wachsen relativ langsam.
Zusammenfassung
Acanthosaurria acuminata sp. n., die bisher einzige Art der Gattung mit Carapaxaufsatz, lebt
in Brasilien und Bolivien. Die Gattung Acanthosurria wird charakterisiert. Acanthoscurria antil-
lenis POCOCK 1903 muß in eine andere Gattung gestellt werden.
6 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world· Oktober 2005
Danksagung
Wir danken Herrn Jean-Michel VERDEZ, Lievin, für die Überlassung des Materials und für
Angaben zu Fang und Lebensweise am Fundort sowie Herrn Dietmar PINZ, Münster, für die
Exuvie des Männchens.
Literatur
HUBER, S. et al. (1996): Theraphosidae der Welt. - 2. Sonderausgabe Arachnol. Mag., 66 pp.
RUDLOFF, J.-P. (1997): Briefliche Mitteilung an G. Schmidt.
SCHIAPELLI, R. & GERSCHMANN, B. (1964): En genero Acanthoscurria AUSSERER, 1871
(Araneae, Theraphosidae) en la Argentina.-Physis 24 (68): 391-417.
SCHMIDT, G. (1997): Bestimmungsschlüssel für die Gattungen der Unterfamilie Theraphosi-
nae (Araneae: Theraphosidae).-3. Sonderausgabe Arachnol. Mag., 28 pp.
SCHMIDT, G. (1998): Acanthoscurria muß sehr genau untersucht werden.-Mitt. Dtsch. Arach-
nol. Ges. 3 (11 ):4-5.
VERDEZ, J.-M. (1995): Briefliche Mitteilung an G. Schmidt.
WEST, R. (1997): Briefliche Mitteilung an G. Schmidt.
Autoren:
Dr. Günter SCHMIDT*Von-Kleist-Weg 4*D-21407 Deutsch Evern*BRD
Marc TESMOINGT*46, rue H. Ployaer*F-59260 Hellemmes*France
Günter SCHMIDT
Das Männchen von Acanthoscurria acuminata SCHMIDT & TES-
MOINGT, 2000 (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae)
Abstract
The male of Acanthoscurria acuminata belongs to the smallest species of the genus and dif-
fers from all other species by a carapax excrescence to the back, an inconspicous tibial spur
containing three strong thorns and an embolus very long and thin.
Keywords
Acanthoscurria acuminata, tibial spur, bulb and embolus.
Material und Methode
Am 5.5.2000 erhielt ich von Herrn VERDEZ ein Männchen von Acanthoscurria acuminata, das
er ca. 150 km nördlich von Santa CruzlBolivien im November 1995 erbeutet hatte. So konnte
erstmals bei einem intakten Männchen die Struktur des Carapaxaufsatzes, die Tibia-
Apophyse und der Taster studiert werden. Die Untersuchung des aus dem Alkohol genomme-
nen und getrockneten Tieres erfolgte unter dem Binokular bei 30facher Vergrößerung. Das
Männchen wird im Museum of Santa Cruz (Bolivien) hinterlegt.
Beschreibung (Mape in mm)
Körperlänge 25, Carapax 12x10, Carapaxaufsatz wie beim Weibchen, Opisthosoma 13x8,
Sternum 5x6 (also breiter als lang) mit zwei Paar Sigillen gegenüber Coxa 11 und 111. Beide um
ihren Längsdurchmesser vom Sternumrand entfernt. Länge des ersten Sigillums 0,33, Länge
des zweiten 0,66. Labium basal 2 breit, nach distal auf 1,3 verschmälert, 2 lang, mit 5 Reihen
von kleinen Dörnchen. Augen wie bei der Exuvie (SCHMIDT & TESMOINGT, 2000) beschrie-
ben.
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world· Oktober 2005 7
Gliedmaßen (in mm)
Femur Patella Tiba Metatarsus Tarsus Ges.-länge
Taster 7,0 3,0 6,0 2,0 18,0
Bein I 10,0 5,0 8,0 8,0 5,0 36,0
Bein 11 9,0 5,0 6,0 7,0 5,0 33,0
Bein 111 8,0 4,0 6,0 8,0 4,0 30,0
Bein IV 9,0 5,0 8,0 11,0 5,0 38,0
Augen wie bei der Exuvie. Spinnwarzen: Basalglied 2, Mittelglied 1,65, Endglied 2,13, Ge-
samtlänge 5,78. Bestachelung: Tastertibia pi 0-0-1, v2-2, rI 0-0-1, I: Ti v 0-2-1-2, M v a 1, 11: Ti
v 1-2-2, Mv 1-2-2, 111: Ti v 1-2-2, M v 1-2-2, pi 0-1-1, rl 0-1-1, IV: Ti pi 0-1-1, rl1-1-1, Mv 1-1-
1-4, rl 0-1-1.Skopula wie beim Weibchen. Stridulationsorgane s. Artdiagnose. Tibia-Apophyse
unscheinbar, sehr kurz, von Haaren verdeckt, mit 3 langen Domen, anstelle einer zweiten
Apophyse 2 auseinander stehende Stacheln (Abb. 1). bulbus mit langem spitzen Embolus
(Abb. 2). Färbung wie beim Weibchen grauschwarzbraun, weiße Querbänder distal an Femur,
Patella, Tibia und Metatarsus.
Diskussion und Zusammenfassung
Das Männchen von Acanthoscurria acuminata gehört mit 25 mm zu den kleinsten der Gat-
tung. Wie auch das Weibchen zeichnet es sich durch einen nach kaudal gerichteten Carapa-
xaufsatz vor allen anderen Arten der Gattung aus. Seine Tibia-Apophyse ist unscheinbar und
von Haaren verdeckt. Sie trägt am Ende 3 kräftige Dornen. Der Bulbus endet mit einem scharf
abgesetzten relativ langen Embolus.
Danksagung
Herrn Jean-Michel VERDEZ, Lievin, sei für die Überlassung eines Männchens von Acanthos-
curria acuminata herzlich gedankt.
literatur
SCHMIDT, G. & TESMOINGT, M. (2000): Eine weitere Acanthoscurria-Art aus Brasilien und
Bolivien /Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae).-Arachnol. Mag. 8 (1 ):1-6.
Autor: Dr. Günter SCHMIDT*Von-Kleist-Weg 4*21407 Deutsch Evern
Abb.1
Acanthoscurria acumi-
nata sp. n., Männchen,
Tibia-Apophyse Abb.2
Acanthoscurria acuminata sp. n.,
Männchen, Bulbus und Embolus
retrolateral
8 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005
Günter Schmidt
Argyrodes insectus sp. n. (Araneae: Theridiidae), eine Spezies von
Cabo Verde
Abstract
Argyrodes sp. 1 from the Cape Verde Islands, described in Arachnol. Mag. 7(9/10) 1999: 1-
15, is named A. insectus. The palpal bulb is illustrated. The species is characterized by the
wide gab between cephalic projection and clypeal preojection, eye position, shape of palpal
bulb and the opisthosoma not elevated.
Key words
Argyrodes insectus, Argyrodes sp. 1, A. argyrodes group sensu EXLINE and LEVI (1962).
Einleitung
Die 1999 als Argyrodes sp. 1 beschriebene Spezies kann nunmehr als A. insectus sp. n. be-
zeichnet werden.
Material und Methode
1 Männchen (Holotyp) SMF, erbeutet zusammen mit einem Weibchen aus einem in niedrigem
Gras gesponnenen Cyrtophora citricola-Gewebe 211996, das sich auf dem Weg von Sal Rei
zur Praia da Chave/Boavista/Cabo Verde befand. Das Pärchen wurde in Gefangenschaft in
einem bewohnten Nephila senegalensis-Netz gehalten, wo am 7.3.1996 auch die Kopulation
stattfand (SCHMIDT, 1999). Einige Tage danach blieb das Weibchen verschwunden.
Das Männchen wurde in 70%igem Alkohol konserviert, der rechte Taster wurde abgetrennt, in
Polyvinyllaktophenol eingebettet und gezeichnet.
Diagnose
Eine Spezies aus der A. argyrodes-Gruppe sensu EXLINE & LEVI (1962) mit distal breitem
Zwischenraum zwischen Clypeus- und Carapaxfortsatz. Augen nicht auf dem Carapaxfortsatz
(Abb. 6 b bei SCHMIDT, 1999), Opisthosoma nicht sehr erhöht, sich um etwas weniger als die
Hälfte seiner Länge über die Spinnwarzen erstreckend. Taster Abb. 1.
Abb. 1 Argyrodes insectus sp. n., rechter Taster
Derivatio nominis
Von lat. insectus =eingeschnitten, wegen der Form des Carapax.
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005 9
Beschreibung (Ergänzung zu den bereits 1999 gemachten Angaben)
Carapax schwarzgrau mit von der fovea ausgehenden breiten schwarzen Radialbändern.
Sternum schwarz. Opisthosoma dorsal silbergrau, ziemlich gleichmäßig 1,3 mm breit, sich
nicht über die Höhe des Carapax erstreckend, zu den Spinnwarzen hin abgeschrägt, diese im
2. Drittel seiner Gesamtlänge gelegen. Opisthosoma ventral auf blaßgelbem Grund mit vielen
kleinen schwarzen Pünktchen und silbrigen Flecken. Beine gelb. Bein I (Maße in mm): Tro-
chanter 0,3, Femur 3,6, Patella 0,5, Tibia 2,6, Metatarsus 2,9, Tarsus 1,3. Bulbus mit sehr
breiter Radix und langem Embolus (Abb. 1).
Diskussion
Das Männchen ist durch die Form der Radix und den relativ langen Embolus genitalmorphol0-
gisch gut charakterisiert. Zu den anderen Argyrodes-Arten der Makaronesischen Inseln, des
Mittelmeergebietes und großer Teile Afrikas bestehen offenbar keine näheren Beziehungen.
Gleiches gilt auch für die amerikanischen Spezies, die von EXLINE & LEVI behandelt wurden.
Ähnlichkeiten mit den von LOPEZ (1990) beschriebenene Arten von Reunion bestehen nicht.
Mit A. zonatus (WALCK., 1841), einer von Macias Nguems (Fernando Pool über Ostafrika
und Madagaskar bis Reunion verbreiteten Art, hat A. insectus die Form des Carapax gemein-
sam. Allerdings ist die Augenstellung unterschiedlich, worauf schon 1999 hingewiesen wurde.
Zusammenfassung
Argyrodes insectus ist durch die Form seines Tasters, die Carapaxgestalt und die AugensteI-
lung gut charakterisiert. Es bestehen lediglich im Hinblick auf die Carapax- und Clypeusfort-
sätze Ähnlichkeiten mit der afrikanischen Spezies A. zonatus.
Danksagung
Herrn Ralf Harald KRAUSE, Vögelsen, danke ich herzlich für die Zeichnungen des Tasters
von Argyrodes insectus sp. n ..
Literatur
EXLlNE, H. & LEVI, H. W. (19629. American spiders of the genus Argyrodes (Araneae, Theri-
diidae).-Bull. Mus. Comp. Zool. 127 (2): 75-202.
a
LOPEZ, A. (1990): Contribution I'etude des araigenees reunionnaises: Note preliminaire.-
Bull. Soc. Sci. nat. (Venette-Compiegne) 67: 13-22.
SCHMIDT, G. (1999): Spinnen von den kapverdischen Inseln Boavista, IIheu do Sal Rei und
Maio (Araneae).-Arachnol. Mag. 7 (9/10): 1-15.
Autor: Dr. Günter SCHMIDT*Von-Kleist-Weg 4*21407 Deutsch Evern*BRD
Günter Schmidt
Neues Phlogius-Material (Araneae: Theraphosidae: Selenocosmiinae)
aus Papua-Neuguinea und Beschreibung des Männchens von Phlogi-
us papuanus (KULCZVNSKI, 1908)
Abstract
Dried material of females of Phlogius sp. collected in Papua-New Guinea could be identified
as Phlogius papuanus. The spermathecae are presented for the first time. The male of this
species is described. It is nearly related to that of Phlogius lanipes (AUSSERER, 1875). Be-
cause of the shape of the spermathecae and the palpal bulb this species has to be transferred
from Selenocosmia AUSSERER, 1871 to Phlogius SIMON, 1887. It is possible that Phrictus
10 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world· Oktober 2005
validus THORELL,1881 and P. strenuus THORELL, 1881 belong to Ph/ogius as weil. The
synonymy of Phlogius with Se/enocosmia performed by RAVEN (2000) is emphatically rejec-
ted again.
Einleitung
a. Geschichtliches
Als erste Vogelspinne aus Papua-Neuguinea wurde Phrictus validus THORELL, 1881 nach
zwei Weibchen aus Katau beschrieben. 1896 wurde die Art von SIMON in die Gattung Ph/ogi-
us SIMON, 1887 gestellt. Ph/ogius wurde 1895 von POCOCK mit Se/enocosmia AUSSERER,
1871 synonymisiert. Seit SIMON (1903) wird sie allgemein als S. valida bezeichnet. 1995
revalidisierte SCHMIDT die Gattung Ph/ogius und meinte, es sei unklar, ob auch S. valida zu
Ph/ogius gehöre. 1901 schrieb HOGG, er sei in Neuguinea auf Exemplare von Se/enocosmia
stirlingi HOGG, 1901, beschrieben aus Australien, wo sie von Queensland bis Südaustralien
verbreitet ist, gestoßen. Dies wurde in der Folgezeit von anderen Autoren nicht bestätigt. Auch
besäße das Australische Museum in Sydney Exemplare von Se/enocosmia strenua
(THORELL, 1881) aus Neuguinea, die von RAINBOW identifiziert worden seien. Diese Spe-
zies war 1881 nach einem reifen Weibchen und einem Jungtier von Cape YOrk, Nordaustra-
lien, beschrieben worden. Nach SCHMIDT (1995) gehören Se/enocosmia stirlingi und die aus
Queensland beschriebene Spezies S. crassipes (l. KOCH, 1873) zu Ph/ogius, was er auch
von S. strenua vermutete. THORELL hatte seinerzeit seinen Phrictus strenuus mit Ph. crassi-
pes und Ph. validus, nicht aber mit Se/enocosmia javanensis (WALCKENAER, 1837) vergli-
chen. 1908 beschrieb KU LCZYNSKI Se/enocosmia papuana aufgrund zweier Weibchen aus
Papua-Neuguinea. 1942 erwähnte ROEWER das Vorkommen von S. crassipes in Neuguinea.
1985 meinte MAIN, die Spezies käme dort .vielleichf' vor. 1986 nannte SMITH ausschließlich
Neuguinea als Verbreitungsgebiet dieser Art. 1989 führte PLATNICK sowohl Queensland wie
auch Neuguinea als Herkunftsländer auf. 2000 behauptete RAVEN, S. crassipes sei in seiner
Verbreitung auf Queensland beschränkt. Auch PLATNICK 2000/2001 erwähnte Neuguinea
nicht mehr. Es hat demnach den Anschein, daß bisher aus Papua-Neuguinea lediglich Se/e-
nocosmia va/ida, S. papuana und S. strenua, und zwar ausschließlich als Weibchen, bekannt
sind, wenn man von Ph/ogius bie%r STRAND, 1911 absieht, der vom Bismarckarchipel be-
schrieben wurde. Demgegenüber kennt man aus Westpapua acht oder neun Arten.
b. Die Gattung Phlogius
Das Genus gehört zu den Selenocosmiinae und ist nach SCHMIDT (1995) durch 12 Kriterien
charakterisiert. Die wichtigsten sind:
1. Chelizeren prolateral ohne pflockartige Dornen
2. Keine 3. unpaare Klaue an Tarsus IV
3. Keine Pseudogelenke an den Tarsen
4. Fovea prokurv
5. Sehr viele Dörnchen auf dern Labium
6. Embolus stark gebogen und am Ende verbreitert
7. Zwei einzelne barrenförmige Receptacula serninis unterschiedlicher Länge
Typusart ist Ph/ogius crassipes (l. KOCH, 1873). Weitere Arten: P. stirlingi (HOGG, 1901)
und P. /anipes (AUSSERER, 1875). Wahrscheinlich gehören auch Phrietus validus und Ph.
strenuus in diese Gattung, die von den Molukken bis Australien verbreitet ist. Die Synonymie
von Ph/ogius mit Se/enocosmia, wie sie von RAVEN (2000) postuliert wurde, wird hier noch-
mals als unbegründet zurückgewiesen.
Material und Methoden
Im November 2001 schickte mir R. BARENSTEINER, Freiburg, 6 Trockenpräparate von Vo-
gelspinnen aus Papua-Neuguinea. Darunter war auch ein Männchen von Yamaha Village,
Aseki Subdistrict, das erste, das aus diesem Land bekannt wurde. Die übriegen fünf waren
Weibchen aus Manki Range Bulolo, Morobe Prov., Kainiba, Kerema, Gulf Provo Alle Fundorte
liegen im Umkreis von ca. 120 km nördlich des Golfs von Papua. Da sich an den sehr zer-
brechlichen Trockenpräparaten nicht alle Untersuchungen durchführen ließen, wurden die
Sonderausgabe TarantuJas ofthe world - Oktober 2005 11
Opisthosomata abgetrennt und in Wasser, dem ein Detergens zugesetzt wurde, aufgeweicht.
Dann wurde ein Block mit den Spermatheken herausgeschnitten und einige Tage in Milchsäu-
re gelegt. Anschließend wurden die Spermatheken herauspräpariert und in POlyvinyllaktophe-
not eingebettet. In diesem Einschlußmedium wurden die dreidimensionalen Strukturen leider
gequetscht, so daß sie jetzt viel breiter erscheinen, als sie ursprünglich waren. Eine der Sper-
matheken wurde fotografiert. Bei einem Weibchen wurden Carapax und Chelizeren seziert um
festzustellen, ob die für Selenocosmia charakteristischen protateral auf den Chelizeren liegen-
den Dornen vorhanden sind oder wie bei Phlogius fehlen. Bei einem Tier wurden die Tar-
salkrallen abgetrennt und auf Zähnchen hin untersucht. Anschließend wurden die Meßergeb-
nisse, die Spermatheken und der Bulbus mit den Literturangaben und Zeichnungen von Sele-
nocosmia- und Phlogius-Arten, die von Australien und Neuguinea beschrieben worden waren,
verglichen, und es wurde versucht, die Tiere zu identifizieren. Das bisher unbekannte Männ-
chen wurde beschrieben. Das Material wurde im Senckenbergmuseum, Frankfurt/M. hinter-
legt.
Ergebnisse und Diskussion
Es ergaben sich nur minimale Unterschiede zwischen den einzelnen Exemplaren. Bei allen
war die Vorderaugenreihe gerade oder schwach prokurv und die Hinteraugenreihe hinten
schwach rekurv. Alle hatten gelbe Hintermittelaugen (HMA), die fast so groß wie die Hintersei-
tenaugen (HSA) waren und die mit ihren Comeae die der HSA (fast) berührten. Bei einem '?
wurden die folgenden Augenmaße und -abstände ermittelt: VMA 0,46, VMA-VMA (Comeae)
0,20, VSA 0,66, VMA-VSA 0,26, HMA 0,46, VMA-HMA 0,13, HSA 0,53, VSA-HSA 0,26, HMA-
HSA 0,07 mm. Die Beine I und IV waren gleich lang (er =54 mm, \? =42-50 mm) oder Bein IV
war bei einem '? zwei mm länger als Bein I, das 48 mm maß. Nur ein Weibchen hatte einen
erhöhten Kopfteil. Sein Carapax war 21 x 18 mm groß. Bei einem anderen relativ großen
Weibchen maß er 16 x 14 mm, bei den übrigen 15 x 12 mm, beim er 14 x 13. Die Opisthoso-
mata schwankten zwischen 18 (er) und 15 - 20 (\? \?) mm. Die Chelizeren hatten keine pflock-
artigen Dornen prolateral. Es wurden an den Tarsalklauen 1 - 3 winzige Zähnchen festgestellt.
Dies steht im Gegensatz zu den Verhältnissen bei der Gattung Ph/ogius in Australien. Die
Receptacula seminis haben im durch die Einbettung gequetschten Zustand eine Länge von
1,65 und eine Breite von 1,32. Ursprünglich waren sie 1,15 breit.
Das er hat eine Körperlänge von 32 mm. Sein Bulbus ähnelt sehr dem von Phlogius stirfingi
aus Australien und dem von P. lanipes von den Molukken und von Westpapua. Das Tier ist
jedoch etwas kleiner als die australische Art und hat wesentlich kürzere Beine: Bein I 54, Bein
1146, Bein 11141, Bein IV 54 mm (P. stirlingi 33,5 mm Körperlänge, Bein I 63,5 mm, Bein IV 64
mm). Wie bei P. stirfingi ist auch die Vorderaugenreihe nur schwach prokurv und die Hinterau-
genreihe schwach rekurv. Im Gegensatz zu jener Art hat das Tier jedoch sehr große und gel-
be HMA, die fast so groß wie die HSA sind und diesen eng anliegen.
Dies spricht dagegen, daß es sich um P. stirfingi handeln könnte. Es ist möglich, daß HOGG
die Art mit P. stirfingi verwechselt hat.
Von anderen Arten der Gattungen Selenocosmia und Phlogius aus Australien und Neuguinea
weist das Männchen von P. crassipes einen unterschiedlich geformten Embolus und eine
andere Augenkonfiguration auf. Bei Selenocosmia honesta HIRST, 1909 und S. similis KULC-
ZYNSKI, 1911 aus Westpapua sind die Längenverhältnisse der Beine, die Augengrößen und
die Emboli anders.
Selenocosmia lanipes AUSSERER, 1875 aus West Papua hat einen ganz ähnlichen und am
Ende verbreiterten Embolus wie die Art aus Papua-Neuguinea. Allerdings sind hier die VSA
deutlich größer als die VMA, und die Beine sind beträchtlich länger (Bein I 74 , Bein IV 73,5
mm). Diese Art hat SCHMIDT (2002) in die Gattung Phlogius transferiert.
Die Trockenpräparate der Weibchen wurden mit Selenocosmia valida, S. strenua und S. pa-
puana verglichen, kleinen Arten, die einander sehr nahestehen.
S. valida wird 31 - 33,5 mm lang. Ihre Prosomamaße sind 14 x maximal 10,75 mm. Der Cara-
pax ist etwas kürzer als Patella + Tibia I. Sie hat eine gerade Vorderaugen- und eine rekurve
Hinteraugenreihe.
12 Sonderausgabe Tarantulas of the world - Oktober 2005
Die Vordermittelaugen (VMA) sind um ihren Durchmesser von einander getrennt. Die HMA
sind nur wenig kleiner als die HSA, die Beine I und IV sind bei dem einen Exemplar gleich
lang (43 mm), beim anderen ist Bein I etwas länger als Bein IV. Die Krallen haben 3 oder 4
zarte Zähnchen.
S. strenua ist ca. 34 mm lang, die Prosomamaße sind 14 x maximal 11,5 mm. Ihre Vorderau-
genreihe ist ein wenig stärker prokurv ("deor-sum curvata") als bei S. valida, die Augen sind
etwas kleiner als bei dieser. Bein I ist 50 mm, Bein IV 46,5 mm lang. Bei einem inadulten \?
mit 10,3 mm Carapaxlänge ist Bein I kaum länger als Bein IV. Auch hier tragen die Krallen 3
oder 4 zarte Zähnchen.
S. papuana ist 30,9 mm lang. Ihr Prosoma mißt 14,4 x 11 mm. Die Vorderaugenreihe ist pro-
kurv, die Hinteraugenreihe leicht rekurv. Die Linsen der VMA haben einen Durchmesser von
0,48 mm, die der VSA 0,63, die der HMA 0,45 und die der HSA 0,50, d.h. auch hier sind die
HMA fast so groß wie die HSA. Der Abstand VMA (Corneae) von einander beträgt 0,16, der
Abstand VMA-VSA (Corneae) 0,16. Bein I ist 39,9, Bein IV 42,3 mm lang. Leider gibt es keine
Abbildungen der Spermatheken dieser drei Arten. Lediglich über die von S. papuana schreibt
KULCZYNSKI, die Receptacula seminis seien 1,6 mm lang und 1,15 mm breit, gegen den
Apex nicht deutlich verschmälert und apikal etwas schief gerundet abgestutzt, im übrigen
ähnlich wie bei S. lanipes. KULCZYNSKI beschrieb noch ein zweites etwas kleineres Weib-
chen, das 26,8 mm lang ist und dessen Bein I 31 und Bein IV 32,8 mm lang sind.
Im Hinblick auf die relativen Beinlängen dürften die Trockenpräparate nicht zu S. strenua
gehören. Auch S. valida kommt kaum in Betracht, da hier die VMA um ihren Durchmesser von
einander entfernt sind. Die größte Ähnlichkeit besteht mit S. papuana. Eine Entscheidung zu
treffen, ob sie wirklich zu dieser Art gehören, ist schwierig. Denn erstens sind alle Trockenprä-
parate größer, zweitens sind ihre Beine länger, drittens sind Bein I und IV bei den meisten
gleich lang und viertens ist die Vorderaugenreihe nur bei Frontalansicht prokurv. Wenn sie
hier dennoch zu S. papuana gestellt werden, so vor allem wegen der sehr ähnlichen Augen-
größen und -abstände und wegen der identischen Form der Spermathek (Abb. 1). Allerdings
muß einschränkend festgestellt werden, daß die Spermatheken von S. valida und S. strenua
nicht bekannt sind. Aufgrund der Form der Sperrnathek muß S. papuana zur Gattung Phlogius
transferiert werden, zumal schon KULCZYNSKI auf die Ähnlichkeit mit S. lanipes (=Phlogius
lanipes) ausdrücklich hinweist.
Beschreibung des Männchens von Phlogius papunus (KULCZYNSKI, 1908) (Maße in
mm)
Carapax 14 x 13, Opisthosoma 18 x 7, Chelizeren 5,5 x 2,5, Klaue 3,9. Clypeus fehlend. Au-
genhügel flach, 1,65 lang, 2,33 breit. Vorderaugenreihe von oben betrachtet ganz schwach
prokurv, von vorn gesehen etwas deutlicher prokurv. Hinteraugenreihe schwach rekurv. VMA
(Linse) 0,33, VMA-VMA (Hornhaut) 0,20, VSA (Linse) 0,30, VMA-VSA (Hornhaut) 0,17, HMA
0,39 (Längsdurchmesser, Linse), VMA-HMA (Hornhaut) 0,13, HSA 0,39, HMA-HSA 0,07,
VSA-HSA (Linse) 0,26, HMA-HMA 2,53. Fovea prokurv, 3,0. Taster ähnlich wie bei P. lanipes,
Embolus apikal verbreitert (Abb. 2). Labium 2,0 lang, 2,6 breit, über mehr als 1/3 dicht mit
kleinen Dornen besetzt. Sternum 6 x 5, mit 2 Paar Sigilien. Paar 1 gegenüber Coxa 11, um
seinen Längsdurchmesser vom Sternumrand entfernt, Paar 2 gegenüber Coxa 111 0,86 lang,
0,92 vom Sternumrand entfernt.
Gliedmaßen
Femur Patella Tlba Metatarsus Tarsus Ges.-Länge
Taster 6 4 9 2 21
Beln I 16 7 14 11 6 54
Bein 11 13 6 11 10 6 46
Bein 111 11 6 9 10 5 41
Bein IV 14 6 13,5 13,5 7 54
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005 13
Skopula: Alle Tarsen sowie Metatarsus I und 11 voll, Metatarsus 111 3/4, Metatarsus IV 1/2 sko-
puliert. Bestachelung: 111: Metatarsus va 2, IV: Metatarsus va 2 und Längsreihe von Stacheln,
die die Skopula trennt. Spinnwarzen: Basalglied 2,0, Mittelglied 2,6, Endglied 3,3. Färbung:
Carapax, Chelizeren und Femora kastanienbraun, Patellen etwas heller, Opisthosoma dorsal,
Tibien und Metatarsen graubraun, Tarsen rehbraun; Labium, Stemum, Coxen ventral, Femora
ventral, Opisthosoma ventral und Spinnwarzen schwarzbraun.
Zusammenfassung
Trockenpräparate von 5 Weibchen und 1 Männchen aus Papua-Neuguinea wurden unter-
sucht. Von zwei Weibchen wurden die Spermatheken präpariert, von einem fotografiert. Vom
Männchen wurde der Bulbus des Tasters fotografiert. Die Tiere wurden als Phlogius papua-
nus identifiziert. Das bisher unbekannte Männchen dieser Art wurde beschrieben. Die Gattung
Ph/ogius ist von den Molukken bis Australien verbreitet. Wahrscheinlich gehören auch Se/eno-
cosmia valida und S. strenua zu dieser Gattung. Die Synonymie von Phlogius mit Selenocos-
mia, zuletzt verfochten von RAVEN (2000), wird nochmals als unbegründet zurückgewiesen.
Danksagung
Ich danke Frau Ruth BARENSTEINER, Freiburg, für die Überlassung des Materials zu Be-
stimmungszwecken und Herrn Rolf-Harald KRAUSE, Vögelsen, für die Anfertigung der Foto-
grafien.
Literatur
AUSSERER, A. (1875): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Arachnidenfamilie der Territelariae.-
Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 25: 187-188, fig. 32, 33
HOGG, H.R. (1901): On Australian and New Zealand spiders of the subfamily Mygalo-
morphae.-Proc. Zool. Soc. London (2): 218-279
KULCZYNSKI, V. (1908): Araneae musei nation. hung. in reg. Indica et Austral. a BIRO coll.-
6: 454-457
KULCZYNSKI, V. (1911): Spinnen aus Süd-Neu-Guinea.-Nova Guinea 9 (ZooI.2): 111-112.
fig.2,3
MAIN, B. (1985): Mygalomorphae. In: WALTON, D. (ed.), Zool. Catalogue of Australia 3, The-
raphosidae: 47-48
PLATNICK, N. (1989): Advances in spider taxonomy 1981.-Manchester University Press,
Manchester: 109
PLATNICK, N. (2000/2001): The Worid Spider Catalogue, Version 2,0. Fam. Theraphosidae
Thorell, 1870: 95. Seite
POCOCK, R (1895): On a newand natural grouping of some of the Oriental genera of Myga-
lomorphae, with description of new genera and species.-Ann. Mag. Hist. Nat. (6) 15: 165-184
RAVEN, R (2000): Taxonomica Araneae I: Barychelidae, Theraphosidae, Nemesiidae and
Dipluridae (Araneae).-Memoirs Queensld. Mus. 45 (2): 570-571
ROEWER, C.F. (1942): Katalog der Araneae von 1758 - 1940, 1. Band, Natura-Verlag Bre-
men: 267
SCHMIDT, G. (1995): Gehören .Se/enocosmia" crassipes (L. KOCH, 1873) und
.Se/enocosmia" stirlingi HOGG, 1901 (Araneida: Theraphosidae: Selenocosmiinae) wirklich zu
SelenocosmiaAUSSERER 1871?-Arachn. Mag. 3 (11): 1-12
SCHMIDT, G. (2002): Selenocosmia lanipes AUSSERER 1875 gehört zur Gattung Phlogius
SIMON, 1887.-Arachn. Mag. 10 i. Dr.
SIMON, E. (1896): Zool. Forschungsreise in Australien V.-Jenaische Denkschr. 8: 343
SIMON, E. (1903): Histoire naturelle des araignees 11, Roret, Paris: 149-151
SMITH, A. (1986): The Tarantula classification and identification guide. Fitzgerald, Lon-
don: 125.
THORELL, T. (1881): Studi sui ragni Malesie Papuani III.-Ann. Mus. Civ. Genova 17:
250-254
14 Sonderausgabe Tarantulas orthe world - Oktober 2005
Autor: Dr. Günter Schmidt, Von-Kleist-Weg, 4, 0 - 21407 Deutsch Evern
Verzeichnis der Abbildungen
1. Phlogius papuanus , Spermathek (durch Einbettung gequetscht)
2. Phlogius papuanus , Bulbus und Embolus
3. Kartenmaterial
Abb . 1 - Phlogius papuanus, Spermathek Abb . 2 - Phlogius papuanus, Bulbus + Embolus
Abb. 3 -Fundgebiete Phlogius papuanus
Sonderausgabe Taranrulas of the world - Oktober 2005 15
Günter SCHMIDT
Acanthoscurria bollei sp. n., eine sehr kleine neue Spezies aus Urugu-
ay und dem angrenzenden Argentinien (Arane-ae: Theraphosidae:
Theraphosinae)
Abstract
A new species of Acanthoscurria, A. bollei sp. n., is described. It is very closely related to A.
mino, AUSSERER, 1871 from Guyana. There is no bounded pad of feathered hairs retrolater-
ally on femur IV, and the weakly feathered hairs there are scarcely discernible. The palpal
trochanter shows about 8 to 10 stridulating bristles, the trochanter I no ones. The shape of the
palpal bulb is a little different from A. mino, (fig. 1,2) .
Key words
Acanthoscurria bollei, A. mino" A. altmanni, A. acuminata, A. suina, A. stemalis, Theraphosi-
dae, Uruguay, Argentinien, Guyana.
Einleitung
Im Jahre 1999 bekam ich von BOLLE zwei in Alkohol konservierte Männchen einer sehr
kleinen Acanthoscurria-Art, die er 1986 und 1999 in Uruguay und im angrenzenden Argenti-
nien gesammelt hatte. Sie würden sich nach der Beschreibung und Tasterzeichnung, die
AUSSERER von dieser Art angefertigt hatte, als A. mino, identifizieren lassen. Da jedoch der
Fundort von A. mino, mehr als 4000 km Luftlinie entfernt liegt, hielt ich es für ausgeschlossen,
dass es sich um dieselbe Spezies handeln könne. AUSSERER hatte als Herkunft seines
Exemplars lediglich Südamerika (trk.) angegeben. Erst SI MON (1892) hatte ein weiteres
Männchen dieser Art aus Guyana mitgebracht. Um zu klären, ob beide Exemplare wirklich zur
gleichen Art gehören, hatte ich Dr. GRUBER, Wien, um Übersendung des Holotypus gebe-
ten, von diesem jedoch erfahren, dass es sich dabei um ein Trocken-Exemplar (trk.!) gehan-
delt habe, das nach so langer Zeit nicht mehr existiere. 1990 hatte CAPOCASALE in seiner
Uste der Spinnen Uruguays neben A. suina POCOCK, 1903 auch A. stemalis POCOCK,
1903 und eine nicht identifizierte A. sp. erwähnt, über die PEREZ-MILES 1988 im Rahmen
einer Arbeit über die Spinnenfauna im Einflussgebiet des Staudammes von Salto Grande
berichtet hatte. Ob sie mit der jetzt beschriebenen Art identisch ist, ist unbekannt. Erst als
VOL (2000) anlässlich der Beschreibung von A. simoensi diese mit SIMON's Exemplar von
A. mino, verglichen und Fotos des Augenhügels, der Tibia-Apophyse und des Bulbus dieser
Spezies publiziert hatte, war eine erneute Beschäftigung mit dem Material von BOLLE mög-
lich. In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, dass bisher lediglich MELLO-LEITAO
(1939) über das Vorkommen von A. stemalis in Uruguay berichtete.
Material und Methoden
1 0' (Holotyp), Depto. Maldonado, Minas, Uruguay, April 1999; 1 0' (Paratyp), San Ciprianol
Entre Rios, Argentinien, Februar 1986, beide Exemplare leg. et ded. BOLLE.
Die Tiere wurden mit dem Binokular bei 30facher Vergrößerung untersucht, Reizhaare mit
dem Mikroskop bei 105facher Vergrößerung klassifiziert, ein Taster wurde fotografiert und mit
dem entsprechenden Foto des Tasters von A. mino, verglichen. Das Material wurde im Sen-
ckenbergmuseum, Frankfurt/M. hinterlegt.
Derivatio nominis
Zu Ehren meines geschätzten Kollegen, Herrn Sebastian Bolle, Munro/Argentinien.
16 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world· Oktober 2005
Diagnose
Sehr kleine Art der Gattung Acanthoscurria ohne deutlich abgesetztes Polster aus Fiederhaa-
ren retrolateral an Femur IV, mit wenigen Stridulationsborsten unterschiedlicher Länge nur am
Tastertrochanter, einem Rechen aus 5 Dornen, von denen der erste sehr lang ist, an der Ti-
bia-Apophyse, einer nur schwach entwickelten Protuberanz subapikal retrolateral an der
Tastertibia und einem apikal spitz endenden kurzen Embolus.
Beschreibung des Männchens (Holotyp) (alle Maßangaben in mm)
Körperlänge 26, Carapax 14 x maximal 12, vorn 8, Opisthosoma 13 x 8 (basal etwas über den
Carapax reichend), Chelizerengrundglied 6,5 x 3, Klaue 5,9, 7 Chelizerenzähne, von denen
die ersten 4 am größten sind. Kopfteil viel höher als Thoraxteil, gewölbt. Augenhügel 1,32
lang, 2,00 breit, direkt am Carapaxvorderrand, Vorderaugenreihe prokurv, Hinteraugenreihe
vorn gerade, hinten rekurv. VMA 0,33, VMA-VMA 0,39, VSA 0,53, VMA-VSA 0,53, HMA gelb,
Längsdurchmesser 0,30, VMA-HMA 0,33, HSA 0,33, HMA-HSA 0,07, VSA-HSA 0,13, HMA-
HMA 1,00. Fovea prokurv, 2,00 breit, tief, Fovea - Carapaxvorderrand 1,00. Sternum leicht
konvex, 6 x 4, Sigillen nicht erkennbar, Labium 1,65 lang, 2,00 breit, im apikalen Drittel mit
ca. 6 Reihen von kleinen dichtstehenden Dörnchen.
Gliedmaßen:
Femur Patella Tibia Metatarsus Tarsus Ges.-Länge
Taster 8 4 7 3 22
Bein I 13 5 10 10 7 45
Bein 11 13 5 8 10 7 43
Bein 111 9 4 9 11 6 39
Bein IV 12 5 10 15 7 49
Femur 111 etwas dicker als übrige Femora, Femur IV 1,65 breit, retrolateral ohne deutlich
abgesetztes Polster aus Fiedemaaren, jedoch mit langen, dünnen und schwach gefiederten
Haaren besetzt. Skopula: Alle Tarsen sowie Metatarsus I und 11 voll, Metatarsus 111 Y:z, Meta-
tarsus IV apikal skopulier!. Bestachelung: Taster: Tibia pi m 1, rI m 1, d a 3, pd 0-1-1. Beine
an Tibien und Metatarsen sehr zahlreich und unregelmäßig bestachelt. Tibia-Apophyse mit 5
dicken Stacheln, die einen Rechen bilden. Der erste dieser Stacheln ist sehr lang. Tarsalklau-
en IV mit einem Zähnchen. Taster ähnlich wie bei A. minor und A. altmanni SCHMIDT, 2003
(Abb. 1,2). Embolus spitz. Protuberanz an der Tastertibia ähnlich schwach ausgeprägt wie bei
A. minor und A. altmanni. Reizhaare: Typ 1 0,29, Typ 3 0,51. Spinnwarzen: Basalglied 1,65,
Mittelglied 2,00, Endglied 2,30, Gesamtlänge 5,95.
Färbung des schwach getrockneten Tieres dunkel-kastanienbraun, Opisthosoma dunkler als
Prosoma. Labium hellbraun, Sternum und Coxen schwarzbraun. Rötliche Haare an Opistho-
soma und Beinen.
Diskussion
Die neue Spezies gehört zusammen mit A. acuminata SCHMIDT & TESMOINGT, 2000 und
A. minor zu den kleinsten der Gattung. Sie steht A. minor hinsichtlich der Augengröße und -
stellung, des leicht gewölbten Sternums, der Bedornung der Tibia-Apophyse und der Form
des Bulbus und Embolus sowie der Protuberanz an der Tastertibia sehr nahe, was angesichts
der räumlichen Entfernung des Vorkommens beider Arten überrascht. Eine ähnlich geformte
Protuberanz findet sich auch bei A. altmanni. Besonders auffallend ist das Fehlen eines deutli-
chen Polsters aus Fiederhaaren retrolateral an Femur IV, was sich vielleicht mit der geringen
dafür zur Verfügung stehenden Fläche erklären lässt.
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005 17
IAbb. 1 - Bulbus und Embolus Acanthoscurria bollei
Abb . 2 - Bulbus und Embolus Acanthoscurria minor
18 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005
Danksagung
Ich danke herzlich Herrn Sebastian Bolle, Munro/Argentinien für die Übersendung der beiden
Männchen einer neuen Acanthoscurria-Art und Herrn Heinz-Josef Peters, Wegberg, für die
Anfertigung des Fotos.
Literatur
AUSSERER, A. (1871): Beiträge zur Kenntnis der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell
(Mygalidae Autor).- Verh. K.k. Zool.-Bo1. Ges. Wien 21: 177 - 224.
CAPOCASAlE, R. (1990): An annotated checklist of Uruguayan spiders.- Aracol. 11/12: 1 -
23.
MEllO-lEITAO, C. (1939): Aracnidios. Annexo I ao relatorio da excursao cientifica do Institu-
to Oswaldo Cruz.- Bol. Biologico (N.S.) 4 (2): 282 - 294.
PEREZ-MllES F.(1988): Araneofauna de la zona de influencia de la represa de Salto Grande
(Uruguay).- Aracnol. Montevideo 9: 1 - 5.
SCHMIDT,G. (2003): Das Männchen von Acanthoscurria altmanni SCHMIDT, 2003
(Theraphosidae: Theraphosinae).- Tarantulas of the world 8 (79): 3 - 11.
VOl, F. (2000): Description d'une deuxieme espece d'Acanthoscurria du bassin des Guya-
nas, Acanthoscurria simoensi sp. n. et comparaison avec I'espece meconnue Acanthoscurria
minor Ausserer, 1871.- Arachnides 47 : 8 - 15.
Autor:
Dr. Günter SCHMIDT, Von-Kleist-Weg 4,0-21407 Deutsch Evern, BRD
Abbildungen
Abb. 1 - Acanthoscurria bollei sp. n. Männchen, Bulbus und Embolus des rechten Tasters
ventral
Abb. 2 - Acanthoscurria minor Männchen, Bulbus und Embolus des rechten Tasters ventral
(VOl)
Günter SCHMIDT
Eine Phlogius-Art aus Papua-Neuguinea (Araneae: Theraphosidae:
Selenocosmiinae)
Abstract
The female here described perhaps belongs to Selenocosmia hirtipes STRAND, 1913. It is
true though that the description made by STRAND is very superficial. Unfortunately, the type
species does not exist inthe Senckenberg Museum. Differences between the description of
Selenocosmia hirtipes and the investigation of the recently found specimen concern the shape
of the PME and the spination of the legs. For that reason the tarantula here described is na-
med Phlogius sp. cf. hirtipes. It is characterized by peglike setae on prolateral cheliceral face
and unpaired third claw on tarsus IV absent, anterior row of eyes straight, AME larger thanA-
lE, lyra of butterknife.like setae on prolateral surtace of maxillae and very short and wide
spermathecae. The shape of PME is elliptical, caudad narrower. Spination is present on meta-
tarsi 111 and IV apically only.
Keywords
Phlogius hirtipes, Phlogius papuanus, Theraphosidae, Selenocosmiinae, Papua Neuguinea,
Westpapua.
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005 19
Einleitung
Im November 2002 sandte mir Barensteiner u.a. eine Selenocosmiinae, die sie am 5.4.1998
in Papua-Neuguinea gefangen hatte. Das Tier hatte sich am 2.10.1998 einmal gehäutet. Die
Exuvie erhielt von Wirth, der sich bisher jedoch nicht dazu geäußert hat. Die Bestimmung
konnte erst nach Vorliegen der gesamten relevanten Theraphosiden-Literatur von Neuguinea
und den Molukken vorgenommen werden.
Aus diesem Gebiet sind etwa 13 verschiedene Theraphosidae-Spezies bekannt geworden,
die alle zu den Selenocosmiinae gehören. Sie verteilen sich auf die Gattungen Chilocosmia,
Ph/ogiellus, Ph/ogius und vielleicht auch noch Se/enocosmia, obwohl letztere auf Neuguinea
sehr wahrscheinlich nicht vertreten ist. Papua-Neuguinea ist die Heimat von Ph/ogius bic%r
STRAND, 1911, Ph/ogius crassipes (L. KOCH, 1873), Ph/ogius papuanus (KULCZYNSKI,
1908), Ph/ogius strenuus (THORELL, 1881) und ?Se/enocosmia va/ida (THORELL, 1881).
Von Selenocosmia hirtipes ist nicht bekannt, ob sie von den Molukken oder von Neuguinea
stammt. Das Typenmaterial, das sich im Senckenbergmuseum befinden soll, ist nicht mehr
vorhanden.
Die Beschreibung, die STRAND von dieser Art gibt, umfasst 9 Zeilen. Sie könnte auf das
vorliegende Exemplar zutreffen (Körperlänge, Prosomamaße, Entfemung Clypeusrand - Fo-
vea, Beinmaße, Stridulationsorgan), wäre da nicht die Angabe, daß die HMA eine scharfecki-
ge, subtrianguläre Form aufweisen würden und daß die Bestachelung reichlicher als bei S.
papuana wäre. Aufgrund dieser Abweichungen wird das vorliegende Exemplar als Ph/ogius
sp. cf. hirtipes bezeichnet.
Material und Methoden
1 Weibchen, leg. Barensteiner 5.4.1998, Wau (1200 m hoch), Sekundärwald, Marobe Provinz,
Papua-Neuguinea (Karte Abb. 2). Die Untersuchung erfolgte mit dem Binokular bei 30facher
Vergrößerung. Die Bestimmung der Spezies wurde anhand der vorhandenen Literatur vorge-
nommen. Die Spermathek wurde präpariert und gezeichnet. Das Material wurde im Sencken-
bergmuseum, Frankfurt/M. hinterlegt.
Abb.1 - Ph/ogius sp. cf. hirtipes STRAND, 1913 '? Spermathek
20 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world· Oktober 2005
Diagnose
Eine mittelgroße Art der Gattung mit folgenden Kennzeichen:
Chelizeren prolateral ohne pflockartige Dornen, kleine 3. unpaare Klaue an Tarsus IV, Fovea
prokurv, sehr viele Dörnchen auf dem Labium, Receptacula seminis kurz und breit, Vorderau-
genreihe gerade, Vordermittelaugen deutlich größer als Vorderseitenaugen, Bein IV deutlich
länger als Bein I, Stridulationsborsten auf der Maxille buttermesserartig, kurze Stacheln nur an
Metatarsus 111 und IV ventral apikal.
Beschreibung (Maße in mm)
Körperlänge 37, Carapax 16,5 x 13, Chelizeren 9 x 4, ihre Klaue 7, Chelizerenzähne 12, die
ersten fünf vom Klauengelenk an gerechnet am Größten, neben den Zähnen 6 - 12 kleine
Zähnchen in 1 - 3 Reihen, Chelizeren prolateral teilweise runzelig, aber ohne Dornen, Augen-
hügel 1,65 lang, 2,97 breit, Clypeus breiter als Vordermittelaugen (VMA)-Durchmesser, Vor-
deraugenreihe von oben betrachtet gerade, Hinteraugenreihe schwach rekurv, VMA gelb,
0,59, VMA-VMA 0,39, VSDA 0,53, VMA-VSA 0,20, HMA gelb, ellipsoid, caudad schmaler,
Längsdurchmesser 0,45, VMA-HMA 0,20, HSA 0,48, HMA-HSA 0,13, VSA-HSA 0,33, HMA-
HMA 1,32, Fovea prokurv, ihre Entfernung vom Clypeusrand 12, Labium 2,60 lang, 3,30 breit,
mit vielen sehr kleinen Domen im apikalen Drittel, Sternum 8 x 8, größte Breite zwischen Co-
xa 11 und 111, 1 Paar Sternalsigillen sichtbar, Längsdurchmesser 0,99, 2,0 vom Strenumrand
entfernt.
Gliedmaßen:
Femur Patella Tiba Metatarsus Tarsus Ges.-Länge
Taster 10 6 6,5 6 28,5
Bein I 11 9 9 9,5 5 43,5
Bein 11 10 7 9 8 5 39
Bein 111 10 6 7 8 5 36
Bein IV 13 7 9 12 6 47
Bein IV misst weniger als der dreifachen Länge, Bein I mehr als der zweieinhalbfachen Länge
des Carapax entspricht. keine 3. Klaue an Tarsus IV. Tarsalklauen nicht gezähnt. Skopula:
Alle Tarsen und Metatarsen I und 11 voll, Metatarsus 111 und IV 4/5 skopuliert. Skopula an Me-
tatarsus IV geteilt, an Tarsen 1-111 ungeteilt, an Tarsus IV durch dichtstehende dünne Haare
gescheitelt. Bestachelung: Metatarsus 111 va 2, Metatarsus IV v a 3. Opisthosoma 20,5 x 12,
Spinnwarzen: Basalglied 2,60, Mittelglied 2,60, Endglied 3,63, Gesamtlänge 8,83. Sper-
mathek (Abb. 1): Länge des längeren Rezeptakulums 2,6, Breite 2,0. Stridulationsorgan: Che-
lizeren retrolateral mit mehreren Reihen von langen dünnen Stridulationsstäbchen, Lyra auf
Tastercoxa prolateral 2,5 lang, 1,5 breit, ellipsenförmig, ihre Stäbchen von oben nach unten
an Größe zunehmend, am größten am apikalen Ende, buttermesserartig. Färbung: Maxillen
und Labium gelbrot, sonst kastanienbraun.
Verhalten in Gefangenschaft (nach Barensteiner)
Die Spinne hat sich schon kurze Zeit nach dem Einsetzen ins Terrarium eine unterirdische
Höhle gebaut, aus der sie manchmal nachts auftauchte, sich aber auch wochenlang über-
haupt nicht blicken ließ. Am 06.08.1998 wurde bei einer Kontrolle mit der Taschenlampe fest-
gestellt, daß sie einen Kokon gebaut hatte, der einige Zeit später aber gefressen worden war.
Nach einer Hitzeperiode Mitte August 2002 hat das Tier den ganzen Boden und die Einrich-
tung des Terrariums mit einem Netz aus Seide überzogen. Am 02.10.1998 fand die Häutung
statt. Die Exuvie lag danach vor dem Eingang der Wohnröhre. Alle 3 - 4 Wochen wurde mit
Heimchen gefüttert. Die Terrarienerde wurde immer sehr stark mit Wasser getränkt. Zusätz-
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005 21
lieh wurde noch Wasser versprüht. Am 03.09.2002 ist die Spinne ohne Prodromalerscheinun-
gen verstorben.
Diskussion
STRAND hatte seine Selenocosmia hirtipes mit S. papuana in Bezug auf die Bestachelung
verglichen und konstatiert, daß diese bei S. hirlipes reichlicher sei. Das trifft auf das vorliegen-
de Tier mit seiner eher sparsamen Bestachelung jedoch nicht zu. Sonstige Unterschiede ge-
genüber dem offenbar sehr nahestehenden Phlogius papuanus betreffen die Augengrößen.
Während bei P. papuanus-Weibchen die VMA deutlich kleiner als die VSA sind, ist dies bei
dem vorliegenden Tier umgekehrt. Wenn dieses trotzdem nicht als P. hirlipes bezeichnet wird,
so ist dafür auch die Form der HMA verantwortlich, die bei dieser Spezies .scharfeckig, subtri-
angulär" ist. Davon kann bei dem vorliegenden Exemplar nicht die Rede sein.
Vergleicht man das vorliegende Weibchen mit den entsprechenden Trockenpräparaten, die
SCHMIDT 2002 mit einigem Vorbehalt als Phlogius papuanus identifiziert hatte, so könnte
man der Auffassung sein, daß es sich um dieselbe Spezies handelt. Eine endgültige Entschei-
dung in dieser Angelegenheit kann jedoch nicht getroffen werden, solange kein Männchen
bekannt ist, das diesem Weibchen mit Sicherheit zugeordnet werden kann. Auch ist zu beden-
ken, daß die Receptacula seminis größer als bei Phlogius papuanus sind.
Zusammenfassung
Möglicherweise gehört das hier beschriebene" zu Phlogius hirlipes. Allerdings ist die
STRAND·sche Beschreibung dieser Art sehr oberflächlich. Leider existiert auch das Typus-
material nicht mehr im Senckenbergmuseum. Unterschiede zwischen der Beschreibung von
P. hirlipes und dem vorliegenden Exemplar betreffen die Form der HMA und die Bestachelung
der Beine. Daher wird dieses "als P. cf. hirlipes bezeichnet. Es ist durch das Fehlen von
pflockartigen Dornen pi an den Chelizeren und die Abwesenheit einer dritten unpaaren Kralle
an Tarsus IV, eine gerade Vorderaugenreihe, VMA, die größer als die VSA sind, eine Lyra
aus buttermesserartigen Stridulationsborsten pi auf der Tastercoxa und relativ kurze und brei-
te Receptacula seminis gekennzeichnet. Die HMA sind elliptisch und nach hinten verschmä-
lert. Kurze Stacheln sind nur ventral apikal an Metatarsus 111 und IV vorhanden.
Danksagung
Ich danke Frau Dipl. Ing. Ruth BARENSTEINER, Sulz/Schweiz, für die Möglichkeit, ihr Phlogi-
us-Weibchen von Papua Neuguinea untersuchen zu können und Herrn Dr. Peter JÄGER vom
Senckenbergmuseum, Frankfurt/M., für die Übersendung einer Kopie der Beschreibung von
Selenocosmia hirlipes.
Literatur
KULCZYNSKI, V. (1908): Araneae musei nation. hung. in reg. Indica et Austral. a BIRO coll.-
Ann. Mus. Nation. Hungar. 6: 428 - 494.
SCHMIDT, G. (2002): Neues Phlogius-Material (Araneae: Thraphosidae: Selenocosmiinae)
aus Papua-Neuguinea und Beschreibung des Männchens von Phlogius papuanus
(KULCZYNSKI, 1908).-Tarantulas of the world 7 (70): 3 - 11.
STRAND, E. (1913): Neue indoaustralische und polynesische Spinnen des Senckenbergi-
sehen Museums.-Archiv f. Naturgeschichte A. 6: 113 - 123.
Anschrift des Verfassers:
Dr. Günter Schmidt, Von-Kleist-Weg 4,0-21407 Deutsch Evern, BRD
Verzeichnis der Abbildungen:
Abb. 1 - Phlogius sp. cf. hirlipes STRAND, 1913, " Spermathek
Abb. 2 - Verbreitungs karte
22 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005
nesla
r.toI.Inl
~. ~ ,
«iun~ • ". • Gor<*iiI
.p, ap,ua 11(
N.ew G~~
.·
Ka · ~':h4 ·
. h_ t obe
w~ K Po~
KO • • •
Port 0 K\JpIand
Moreaby ...
Acau
Abb. 2 - Verbreitungs karte
Günter SCHMIDT
Haplopelma vonwirthi Sp. n. , eine neue Art der Haplopelma minax-
Gruppe aus Südostasien (Araneae: Theraphosidae: Omithoctoni-
nae)
Abstract
The female of a new Haplopelma sp . from South-East Asia is described . It belongs to the
H. minax group. Its simple fused spermathecae (fig . 1) cannot be distinguished from
those of H. minax (THORELL, 1897) and H. Ividum SMITH , 1996 . Leg IV is a little longer
than leg I. The position of the thorn-like coxal spines on the prolateral face of the palp
and their size are quite different from those of the other species of the H. minax-group
(fig . 2). The male is known, but could not be studied . The species name H. vonwirthi sp.
n. is proposed.
Key words
Haplopelma vonwirthi, Haplopeima Iividum, Haplopelma albostriatum, Haplopelma minax,
Haplopelma hainanum, Haplopelma sChmidfi, Haplopelma salangense, Haplopelma
costale.
Einleitung
Anfang Februar 2005 erhielt ich von Herrn Dr. Baumgarten, Lüneburg, das Weibchen
einer Haplopelma-Spezies, das ihm als Haplopelma longipedum, Vietnam
Tigervogelspinne, angeboten worden war. Als Herkunft wurde Vietnam, als maximale
Sonderausgabe TarantuJas ofthe world - Oktober 2005
Größe 5 cm, mit ausgestreckten Beinen 15 cm genannt. Für die Haltung wurde eine
Temperatur von 24 - 28 Grad C und eine Luftfeuchtigkeit von 70 - 80 % empfohlen
Da eine Haplopelma-Art namens H. longipedum bisher offiziell nirgends beschrieben
wurde, versuchte ich eine Bestimmung aufgrund der spärlichen Angaben über diese Art
und ihrer fotografischen Abbildung bei v. WIRTH 2002. Dort steht, die Verbreitung der
betreffenden Spezies, die seit Ende der achtziger Jahre importiert werde, sei auf West-
Thailand beschränkt. Es müsse sich um eine anders gefärbte H. lividum handeln, die von
dieser taxonomisch kaum zu unterscheiden sei, und es bestehe der Verdacht, dass es
sich bei beiden Formen um dieselbe Art handeln könne. Bei Hybridisierung würden sich
Eikokons mit etwa 120 mittelgroßen Eiern entwickeln, während v. WIRTH bei H. lividum
etwa 50 große und bei H. "Iongipedum" etwa 200 kleine Eier pro Kokon zählen konnte. In
seinem Bestimmungsschlüssel zur Identifizierung der Weibchen von im Handel angebo-
tenen Ornthoctoninae kommt man auf H . •Iongipedum" nach folgenden Merkmalen: Bein
IV deutlich länger als Bein I, Kopfteil des Carapax gebogen, Carapax dunkel, Augenhü-
gel oval, Beine braun. Das Foto zeigt jedoch eine Spezies, deren Beine keineswegs
braun sind. Ob es sich hier um eine Verwechselung oder einen Fehler der Druckerei
handelt, bleibe dahingestellt. Jedenfalls ist es nach diesen dürftigen Angaben natürlich
unmöglich zu entscheiden, ob das mir vorliegende Weibchen zu H.•Iongipedum" oder zu
einer anderen Spezies gehört. Daher wird es im Folgenden beschrieben, da ich zu der
Feststellung gelangt bin, dass es auf jeden Fall kein Haplopelma Iividum ist. Auf die
Problematik der Etablierung einer Art namens H. longipedum wird in der Diskussion noch
eingegangen.
Material und Methoden
1 Weibchen (Holotyp) SMF, das nach seinem Tod etwa 3 Tage lang trocken aufbewahrt
worden war und dann 8 Tage lang in 70 %igen Alkohol gelegt wurde. Die Untersuchung
erfolgte mit dem Binokular bei 30facher Vergrößerung, die Vermessung mit dem Lineal.
Der prolaterale Teil der rechten Tastercoxa mit den Stridulationsdornen und die Sper-
mathek wurden präpariert und nach Einbettung in Polyvinyl-Laktophenol gezeichnet.
Ober die Herkunft des Tieres ist nur bekannt, dass es über Vietnam nach Deutschland
gelangte. Es kann aber ursprünglich durchaus auch aus Kambodscha oder Thailand
stammen. Sammler und Fangdatum sind unbekannt.
Ergebnisse
Haplopelma vonwirthi sp. n.
? Haplopelma sp. "Iongipedum" nomen nudum
Diagnose des Weibchens
Mittelgroße dunkelbraune Art der H. minax-Gruppe mit nur schwach ausgeprägtem
Fischgrätenmuster, Körperlänge 40 - 50 mm, viertes Bein etwas länger als erstes, Cara-
pax zwischen Coxa I und 11 am höchsten, höher als Augenhügel, Spermathek einteilig,
gerundet, in der Mitte nur schwach eingedellt (Abb. 1), ähnlich wie bei H. Iividum und H.
minax, 17 Stridulationsdornen auf der Tastercoxa völlig anders als bei den übrigen Mit-
gliedern der H. minax- Gruppe angeordnet (Abb. 2.).
Derivatio nominis
Nach Volker von WIRTH, der sich seit ca. 15 Jahren mit der Gattung Haplopelma be-
fasst.
Beschreibung des Weibchens (Maßangaben in mm)
Körperlänge 40, Carapax 22 x maximal 17, vorn 11, Opisthosoma 18 x maximal 12. Che-
lizeren 5,5 x 4,5, Klaue 10. 21 Chelizerenzähne, davon vom Klauengelenk an gerechnet
5 große, 6 mittlere und 10 kleine, letztere in zwei Reihen. Retrolateral basal auf den Che-
lizeren 4 gefiederte Schaufel borsten ( 3 große und 1 kleine), Abstand zwischen 2. und 3.
L..-.
24 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005
größer als zwischen 3. und 4. Prolateral auf der Tastercoxa 17 Stridulationsdornen unter-
schiedlicher Größe. Augenhügel oval, dunkler als übriger Carapax, 2 x 3,1. Carapax
zwischen Coxa I und 11 am höchsten. Clypeus 1, Fovea prokurv, 3,3. Vorderaugenreihe
leicht prokurv, Hinteraugenreihe leicht rekurv, wie bei H. Iividum. VMA 0,56, VMA-VMA
0,46, VSA 0,66, VMA-VSA 0,39, HMA 0,66, gelb, VMA-HMA 0,53, HSA 0,66, HMA-HSA
0,07, HMA-HMA 1,65. Labium breiter als lang, 2 x 3, im apikalen 1/37 Reihen von Dörn-
ehen, Sternum 9 x 7. 2. Paar der Sternalsigillen nicht so nahe am Sternumrand wie bei
H. Iividum, nicht so weit vom Rand entfernt wie bei H. minax.
Gliedmaßen (in mm)
Femur Patella Tiba Metatarsus Tarsus Ges.-Länge
Taster 10 6 8 7 31
Bein I 15 9 12 10 7 53
Bein 11 14 6 9 8 7 44
Bein 111 11 7 8 9 7 42
Bein IV 12 10 12 15 6 55
Bein I deutlich dicker als Bein IV. Tarsalklauen ohne Zähne.
Skopula: Alle Tarsen sowie Metatarsus I und 11 voll, Metatarsus 111 etwas mehr als 1/2,
Metatarsus IV mehr als 1/3, fast %2 skopulier!. Bestachelung: Taster: Tibia va 1; I: Ti va
2, M va 1; 11: Ti v a 2, M va 2; 111: Ti v a 2 (0), M pi 1-1-1, rI1-1-1, va 2. Spermathek
einteilig, in der Mitte leicht eingedellt, gerundet, 3,9 breit, 1,32 lang. Wie schon SMITH
(1996) schrieb, wahrscheinlich ohne diagnostischen Wert, da nicht von H. Iividum und H.
minax zu unterscheiden. Färbung dunkelbraun. Opisthosoma mit undeutlichem
Fischgrätenmuster, wie für die Gattung ty-pisch. Spinnwarzen: Basalglied 2,5, Mittelglied
1,5, Endglied 3,3, Gesamtlänge 7,3 .
. . . .~:~l. . -,."-."~·"~i!":~~~~~:·~_·~·:r".·:,~"~t-'~· ~
~\<,,<. -.~ "'>'~::. '. "
Abb.2 '. '-
.........
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005 25
Diskussion
Die Beziehungen der neuen Art zu den anderen Spezies der H. minax- Gruppe können
erst nach Untersuchung eines Männchens geklärt werden.
Ohne dass Typenmaterial hinterlegt und eine detaillierte Beschreibung angefertigt wurde,
ist es nicht möglich zu entscheiden, ob das hier vorgestellte Weibchen zu H.
.Iongipedum" nomen nudum gehört. Von H. Iividum ist es jedenfalls nicht nur durch seine
andere Färbung, sondern auch durch morphologische Merkmale, vor allem die völlig
abweichende Bedomung der Tastercoxa prolateral, ein im Großen und Ganzen bei
Haplopelma ziemlich konstantes Merkmal, zu unterscheiden.
Der Bestimmungsschlüssel von v. WIRTH (2002) für die Weibchen der im Handel ange-
botenen Ornithoctoninae ist absolut unzureichend, weil wichtige Arten nicht berücksich-
tigt wurden, und wegen gravierender Fehler weitgehend unbrauchbar und zudem irrefüh-
rend, da die relative Länge von Bein IV bei den Weibchen der aufgeführten Arten großen-
teils entweder falsch angegeben wurde oder wegen teilweiser Inkonstanz bei einigen Arten
überhaupt kein verwertbares Abgrenzungskriterium darstellt. Der Autor beginnt seinen
Schlüssel mit der Frage, ob Bein IV deutlich länger als Bein I (RF: ungefähr 89) oder etwa
so lang ist (RF: etwa 98). Abgesehen davon, dass natürlich jeder Leser seiner Arbeit genau
weiß, was unter RF zu verstehen ist, so dass er es nicht zu erklären brauchte, ist ein so
"weiches" Kriterium wie die relative Beinlänge, das in etwa 11 % nicht gilt, zum Bestimmen
einer Spezies, wie bereits gesagt, denkbar ungeeignet. Nach SMITH 1996 z. B. ist Bein IV
beim Weibchen von H. albostriatum, nach SMITH 1986 ist es beim Weibchen von H. minax
länger als Bein I. HALE 1997 gab bei den Weibchen von H, minax die Beinformel mit IV,I,
11, III an. Auch bei H. salangense (STRAND, 1907) hat das Weibchen die Beinformel
IV,I,II,III. Nach eigenen Feststellungen sind bei H. minax Bein I und IV fast gleich lang,
wobei mitunter Bein I länger als Bein IV oder umgekehrt Bein IV länger als Bein I ist. Im
Bestimmungsschlüssel von v. WIRTH fehlen darüber hinaus die Merkmale für H. costale
SCHMIDT, 1998, eine thailändische Art aus dem Erevan-Nationalpark, die durchaus ab und
zu im Handel angeboten wird und bei der Bein IV ebenfalls länger als Bein I ist. Leider gibt
26 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005
er lediglich unter der Bezeichnung "Ornithoctoninae sp." die Kennzeichen einer anderen,
aber nah mit ihr verwandten unbeschriebenen Haplopelma-Spezies an, die ich auch schon
1998 untersucht hatte. In den letzten Jahren konnte ich weitere noch unbeschriebene
Haplopelma-Arten studieren, die ebenfalls ab und zu im Handei angeboten werden und bei
denen die relativen Beinlängen nicht bekannt sind. Der Bestimmungsschlüssel war also
schon weitgehend überholt, als er gedruckt wurde. Abgesehen von den bisher genannten
Unrichtigkeiten wurde auch Selenocosmia hainana LlANG et al., 1999 unter dieser falschen
Bezeichnung in den Bestimmungsschlüssel eingeordnet, da die bereits 2001 erschienene
Revision dieser Art durch ZHU, SONG & LI überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Zwar
hatte v. WIRTH erkannt, dass es sich um das Schwestertaxon von Haplopelma schmidti v.
WIRTH, 1991 handelt. Warum er es aber dennoch nicht als H. hainanum (LiANG et al. ,
1999) bezeichnet hat, bleibt rätselhaft. Stattdessen behauptete er, im Rahmen einer größe-
ren phylogenetischen Analyse an der Transferierung der Art zu den Ornithoctoninae zu
arbeiten. Man hätte mit Recht erwarten können, dass er als der führende Spezialist für
asiatische Theraphosiden sich wenigstens um die aktuelle Literatur bemüht, noch dazu, wo
die Arbeit, in der dieser Transfer bereits vorgenommen wurde, in einer allgemein zugängli-
chen Zeitschrift mit ausführlichem englischsprachigem Textteil erschienen ist.
Ich hatte v. WIRTH bereits im Jahre 2002 schriftlich mitgeteilt, dass eine Spezies mit dem
Namen .H. longipedum" Schwierigkeiten haben dürfte, unter dieser Bezeichnung anerkannt
zu werden, da es nicht statthaft ist, dass der Artname im Genitiv Plural steht.
Es wäre zu wünschen, dass v. WIRTH jetzt klärt, ob es sich bei der hier beschriebenen
Spezies um sein H . .Iongipedum" nomen nudum oder etwas völlig anderes handelt.
Danksagung
Ich danke Herrn Dr. Klaus Baumgarten, Lüneburg, sehr für das Weibchen einer Haplo-
pelma-Spezies, das er unter der Bezeichnung Haplopelma longipedum erhalten hatte.
Zusammenfassung
Haplopelma vonwirthi sp. n. gehört wegen ihrer einfachen und nur wenig eingedellten
Spermathek zur H. minax-Gruppe. Beim Weibchen ist Bein IV etwas länger als Bein I.
Die Anordnung der Stridulationsdornen auf der Prolateralseite der Tastercoxa sowie ihre
Größe sind verschieden von den Verhältnissen bei anderen Arten der H. minax-Gruppe.
Es bleibt offen, ob es sich um jene Spezies handelt, die seit vielen Jahren unter der Be-
zeichnung "H. longipedum" nomen nudum im Handel ist. Der Bestimmungsschlüssel für
die im Handel angebotenen Ornithoctoninae von v. WIRTH wird ausführlich erörtert.
Literatur
HALE, R. (1997): An Introduction to the Tarantulas of South East Asia. A Study of the Genus Hap-
lope/ma.- Bradley, 49 pp.
SMITH, A. (1986): The Tarantula Classification and Identification Guide .. - Fitzgerald Publ. London,
179 pp.
SMITH, A. (1996): A new species of Haplopelma (Araneae: Theraphosidae), with notes on !wo close
relatives.- Mygalomorph 1 (2): 21 - 32.
SCHMIDT, G. (1998): Eine neue Haplopelma-Art aus Thailand? (Aralleae: Theraphosidae: Ornithoc-
toninae).- Arachnol. Mag. 6 (3): 1 -8.
Von WIRTH, V. (1991): Eine neue Vogelspinnenart aus Vietnam: Haplope/ma schmidti sp. n.
(Araneae: Theraphosidae: Ornithoctoninae).- Arachnol. Anz. 18: 6 -11.
Von WI RTH, V. (2002): Welche Spinne ist das? - DeARGe Mitteilungen 7 (11): 6 -13, Farbtafeln 1,2.
ZHU, M., SONG, D. & T. LI (2001) : A new species of the family Theraphosidae, with taxonomie
studyon the species Selenocosmia hainana (Arachnida: Araneae).- J. of Baoding Teachers College
14 (2): 5 - 6.
Autor: Dr. Günter Schmidt, Von-Kleist-Weg 4, D-21407 Deutsch Evem, BRD
Verzeichnis der Abbildungen
Abb. 1 Haplopelma vonwirthi sp. n. , Spermathek
Abb. 2 Haplopelma vonwirthi sp. n., Stridulationsdornen auf der Tastercoxa
Abb. 3 Haplopelma vonwirthi sp. n. ,Weibchen Foto: PETERS
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005 27
Günter SCHMIDT & H.-J. PETERS
Acanthoscurria borealis sp. n. (Araneae: Theraphosidae: Theraphosi-
nae), die erste Acanthoscurria-Art aus Mittelamerika
Abstract
A new species of the genus Acanthoscurria is described. It is the first member of this genus
living in Central America. In the strongly bent palpal bulb of the male the embolus is relatively
short and apically broad. The tibial spur is also short. It bears a comb of 7 thorns. Besides one
finds two stout black thorns instead of a second spur. There is a subapically situated weak
retrolateral protuberance on palpal tibia. In the female the spermathekae are very similar to
those of Acanthoscurria musculosa Simon, 1892. In both sexes the stridulatory bristles are
situated on the trochanter of palp only.
Key words
Acanthoscurria antillensis , A. bollei, A. borealis, A. chacoana, A. minor, A. musculosa, desc-
ription, behaviour, Guatemala.
Einleitung
Im Jahre 2003 erhielt SCHMIDT von PETERS die Exuvie des Weibchens einer Vogelspinne,
die seither aus Guatemala importiert wird mit der Bitte um Abklärung, ob es sich dabei um
eine Cyrtopholis- oder Acanthoscurria- Art handelt. Beide Gattungen waren bisher zwar auf
den Antillen, nicht aber auf dem mittelamerikanischen Festland gefunden worden. Damals
konnte SCHMIDT feststellen, dass zweifelsfrei eine Acanthoscurria sp. vorlag. Im April 2005
übersandte PETERS je ein konserviertes Männchen und Weibchen dieser Art, die sich
schnell als bisher unbeschrieben erwies und daher im Folgenden hier beschrieben werden
soll.
Material und Methoden
1 ci" (Holotyp), Guatemala (verm. "Lago de Izabal Sammler unbekannt, 1 ~ (Paratyp),
U
)
gleiche Gegend, 1 Exuvie eines Weibchens, gleiche Gegend, alles ded. PETERS.
Die Tiere wurden mit dem Binokular bei 30facher Vergrößerung untersucht. Die Spermathe-
ken wurden herauspräpariert, in Polyvinyllaktophenol eingebettet und ebenso wie die Bulbi
und Emboli sowie die Tibia-Apophyse des Männchens mit entsprechenden Organen anderer
Arten der Gattung Acanthoscurria verglichen. Die Reizhaare wurden mit einer Pinzette vom
Opisthosoma entfernt und unter dem Mikroskop bei 105facher Vergrößerung klassifiziert.
Ebenso wurde ermittelt, ob die Tarsalklauen bei dieser Art bezahnt sind. Die Ausmessung der
Extremitäten erfolgte mit dem Lineal. Das Material wurde im Senckenbergmuseum, Frank-
furUM. hinterlegt.
Diagnose
Mittelgroße Spezies mit Stridulationsorganen nur an den Trochanteren der Taster (Typ IV b),
Skopula retrolateral an Femur IV, Männchen mit stark gekrümmtem Genitalorgan und relativ
kurzem und apikal breitem Embolus, kurzer Tibia-Apophyse mit Kamm aus 7 schwarzen Dor-
nen sowie 2 starken schwarzen Dornen anstelle einer 2. Apophyse und subapikal gelegenem
schwach ausgebildetem retrolateralen Fortsatz an der Tastertibia. Weibchen mit einer Sper-
mathek mit breitem Basalteil, ähnlich wie von PETERS (2003) bei Acanthoscurria musculosa
abgebildet.
Derivatio nominis
Von lat. borealis =nördlich, wegen des nördlichen Vorkommens der Art.
28 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world· Oktober 2005
Beschreibung des Männchens (Holotyp) (alle Angaben in mm)
Körperlänge 40, Carapax 20 x maximal 17, vorn 11 , Chelizeren 8 x 3,5, Klaue 7, Zähne von
dichtem Haarsaum verdeckt, nicht erkennbar. Labium 2,3 lang, 2,6 breit, apikal mit 5 Reihen
Sonderausgabe Tarantulas of the w orld - Oktober 2005 29
von kleinen Dornen, Apikalteil durch leichte Delle vom übrigen Labium abgesetzt. Sternum 9
x 6, mit 3 Paar Sigillen, die durch dicke Haarpolster verdeckt sind. Labiosternalsutur mit 2
Mounds. Fovea leicht rekurv, 3,3. Abstand Prosoma-Vorderrand - Fovea 14, Augenhügel
2,0 lang, 2,6 breit. Clypeus etwas breiter als Durchmesser eines VMA. Augenvorderreihe
leicht prokurv, Augenhinterreihe leicht rekurv. VMA 0,46, VMA-VMA 0,46, VSA 0,59, VMA-
VSA 0,33, HMA (Längsdurchmesser) 0,39, VMA-HMA 0,26, HSA 0,39, HMA-HSA 0,20, VSA-
HSAO,39, HMA-HMA 1,3.
Gliedmaßen
Femur Patella Tiba Metatarsus Tarsus Ges.-Länge
Taster 11 5 9 2 27
Bein I 17 9 12,5 13,5 8 60
Bein 11 15 9 11 12 8 55
Bein 111 13 7 10 13 7 50
Bein IV 16 8 13 18
Tasterfemur schwach gebogen. Femur 111 5,3 dick, Femur IV rl mit Polster aus Fiederhaaren.
Coxa lohne Haarpolster.
cl' .'f: Skopula: Tarsen voll, Metatarsen I ,11 voll, Metatarsus 111 '/., Metatarsus IV apikal 1/5.
cl':Bestachelung: Taster: Tibia d 0-2-2, v 0-1-0, rl 1-1; I: Tibia
pi 0-1-1, v 0-1-2-1-2, rl 0-1-1, Metatarsus : Bestachelung durch dicke Skopula nicht erkennbar;
11: Tibia pi 1-1-1, v 0-1-1, rI1-1-1, Metatarsus va 2; 111: Tibia pi 0-1-1, v 1-1-2, rI1-1-O-O, Me-
tatarsus pi a 2, va 2, rl a 1; IV: Tibia pi 1-1-1-1, v und rl sehr stark und unregelmäßig besta-
chelt, Metatarsus unregelmäßig bestachelt. Tarsalklauen ohne Zähne. Reizhaaren: Typ I und
111. Taster sehr einfach, Genitalorgan stark gebogen mit relativ kurzem breitem Embolus, 4,6
lang. Tibia retrolateral subapikal mit unscheinbarer Protuberanz. Tibia-Apophyse kurz, mit
Kamm aus 7 gekrümmten schwarz glänzenden Dornen. Anstelle der 2. Apophyse 2 starke
schwarze Dornen. Stridulationsorgane: etwa 18 gefiederte Stridulationsborsten unterschiedli-
cher Länge nur am Tastertrochanter. Opisthosoma 20 x 13.
Spinnwarzen: Basalglied 2,6, Mittelglied 2,0, Endglied 3,5, Gesamtlänge 8,1. Färbung dunkel-
braun. An den Gelenken gelbweiße Querbinden, Haare weinrot.
Beschreibung des Weibchens (Paratyp)
Körperlänge 34 (nicht ausgewachsen), Carapax 18 x 16, vorn 10, Chelizeren 10 x 5, Klaue 8.
Zähne: sichtbar waren vom Klauengelenk an gezählt 2 große und 6 mittelgroße. Fovea leicht
prokurv, 3,3 lang. Abstand zum Carapax-Vorderrand 13. Dieser mit weißer Haarbinde. Kopf-
teil wesentlich höher als Thoraxteil. Augenhügel 2,0 lang, 2,6 breit, erhaben, direkt am Cara-
pax-Vorderrand. Vorderaugenreihe schwach prokurv, Hinteraugenreihe schwach rekurv. VMA
0,46, VMA-VMA 0,46, VSA 0,50, VMA-VSA 0,26, HMA gelb, ovoid, 0,33, VMA-HMA 0,20,
HSA 0,46, HMA-HSA 0,13, VSA-HSA 0,26, HMA-HMA 1,18. Labium 2,6 lang, 2,3 breit, apikal
mit etwa 8 Reihen von kleinen Dornen. Dieser Teil durch leichte Delle vom übrigen Labium
abgesetzt, Labiosternalsutur mit 2 Mounds, Sternum 7 x 5, hinten breit abgestutzt. Sigillen
durch dichtes Haar verdeckt.
Bestachelung: Taster: Tibia pi 0-2-0, v 0-2-2; I: Tibia v 0-1-2-2, rl 1-1-1, Metatarsus va 1; 11:
Tibia v a 2, Metatarsus v 1-0-2, rI1-0-0; 111: Tibia pi 1-0-1, rl 0-1-0, Metatarsus pi 0-0-1, va 2;
IV: Tibia pi 0-1-0, v 0-1-0, Metatarsus pi 1-1-0, v 1-1-1-1-2 (versetzt), rl a 1. Stridulationsorga-
ne nur an Tastertrochanter, Coxa I unterhalb der Sutur mit dichtem Polster aus Fiederhaaren.
Opisthosoma 16 x 10. Spinnwarzen: Basalglied 2,3, Mittelglied 2,6, Endglied 3,3, Gesamtlän-
ge 8,2. Spermathek mit breitem Basalteil, ähnlich wie bei A. musculosa, einer Spezies, die in
Argentinien, Paraguay, Bolivien und Brasilien (Mato Grosso) vorkommt. Färbung dunkel-
30 Sonderausgabe Tarantulas of the world . Oktober 2005
braun, blasse Längsstreifen auf Patellen und Tibien, Gelenkringe blassgelb, Haarborsten
weinrot.
Gliedmaßen
Femur Patella Tiba Metatarsus Tarsus Ges.-Länge
Taster 10 5 7 7 29
Bein I 12 8 9 8 5 42
Bein 11 11 8 8 7 5 39
Bein 111 10 7 6 10 5 38
Bein IV 13 7 9 13 6 48
Diskussion
Die Gattung Acanthoscurria war bisher mit 36 Arten in Südamerika und einer Art auf den
Kleinen Antillen verbreitet (A. antillensis POCOCK, 1903) (PLATNICK 2005). Sie ist vor allem
durch die Morphologie des männlichen Tasters und die Typen IV a und IV b der Stridulation-
sorgane sowie die Form der einteiligen Tibia-Apophyse, die apikal einen Kamm aus Dornen
trägt, charakterisiert. Die Weibchen verfügen über eine Spermathek mit häufig sehr breitem
Basalteil. Innerhalb der Gattung findet man Arten mit ähnlichen Genitalstrukturen in weit von
einander entfernten Gegenden. So ähnelt der Bulbus und Embolus von A. bollei SCHMIDT,
2004 aus Uruguay ganz außerordentlich dem von A. minor AUSSERER, 1871 von Guyana
(SCHMIDT 2004 ), und die Spermathek von A. borealis aus Guatemala sieht der von A. mus-
cu/osa, die von Argentinien bis zum Mato Grosso-Gebiet Brasiliens verbreitet ist, sehr ähnlich.
Die Protuberanz an der Tastertibia von A. chacoana BRETHES, 1909, einer in Argentinien,
Paraguay, Bolivien und Brasilien weit verbreiteten Art, ähnelt wiederum der von A. minor
(SCHMIDT 2003), aber auch der von A. borealis. Die verwandtschaftlichen Beziehungen der
neuen Art innerhalb der Gattung lassen sich allein anhand der morphologischen Merkmale
(Genitalien, Stridulationsorgane, Fortsatz der Tastertibia) nicht feststellen. Hierzu bedarf es
neuerer Methoden, vor allem der DNA-Analyse.
Allgemeiner Teil
Als ich (PETERS) vor ca. 2 Jahren ein Dutzend Tiere von Acanthoscurria borealis bekam, war
mir sofort klar, daß es sich um eine noch unbeschriebene Art handeln mußte. Eine erste Bes-
tätigung erhielt ich, nachdem Günter SCHMIDT die Spermathek einer Haut untersuchen konn-
te. Die Spinnen stammten aus einem Import aus Guatemala.
Von diesen 12 Tieren hatte ich bereits am Tage des Kaufes, ohne sie hinsichtlich ihrer Ge-
schlechter zu untersuchen, zwei weiterverkauft. Die Geschlechterbestimmung nahm ich einige
Tage später vor. Bei meinen verbliebenen 10 Tieren handelte es sich demnach um 9 Weib-
chen und um ein sehr kleines juveniles Männchen. Zu meinem Glück brachte mir jedoch einer
der Käufer der bei den veräußerten Spinnen ein Tier zurück, da er festgestellt hatte, daß es
sich um ein subadultes Männchen handelt. Natürlich tauschte ich das Tier gerne gegen ein
Weibchen um.
Nun besaß ich also 8 Weibchen, ein subadultes und ein juveniles Männchen. Damit konnte
ich schon etwas anfangen.
Ich brachte die Spinnen in Terrarien unter, um sie zunächst zu beobachten und natürlich, um
auf die Reifehäutung des subadulten Männchens zu warten. Diese ließ allerdings fast ein Jahr
auf sich warten. -
Das Verhalten der Tiere überraschte mich in der Folgezeit. Im Gegensatz zu allen anderen
Acanthoscurria-Arten, die ich bisher kennen gelernt habe, ist diese Art absolut nicht aggres-
siv. Kein drohendes Aufrichten, kein Schlagen mit den Tastern. Im Gegenteil. Sie lassen sich
ohne Schaden berühren und auf die Hand nehmen. Dieses Verhalten gilt für alle 8 Weibchen.
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005 31
Ganz anders jedoch das subadulte Männchen. Es richtet sich bei Störung sofort auf und ver-
harrt so mehrere Minuten. Nach der Reifehäutung veränderte sich das Verhalten jedoch. Es
wurde genau so passiv wie die Weibchen. Ja, es zeigte jetzt sogar so etwas wie Angst. Es lief
vor jedem Futtertier fort und verkroch sich in seiner Höhle oder flüchtete in die äußerste obere
Ecke des Terrariums.
Einige Wochen nach der Reifehäutung versuchte ich eine Verpaarung mit einem relativ frisch
gehäuteten Weibchen. Dazu hatte ich das Weibchen gut 4 Wochen zuvor (nach seiner letzten
Häutung) in ein größeres, bepflanztes Behältnis mit hohem Bodengrund gesetzt (60 x 40 x 60
cm). Dort hatte es sich eine von mir vorgegrabene Höhle, die ich mit einer Korkröhre verlän-
gerte - der Bau war jetzt gut 40 cm lang, verlief von der Oberfläche schräg bis zum Beckenbo-
den und endete an der seitlichen Terrariumscheibe (hier befestigte ich von außen ein Stück
Pappe, um die Spinne bei Bedarf zu beobachten) -, ausgebaut und bis auf eine kleine Öff-
nung von vielleicht 2 cm Durchmesser verschlossen. Über diesen kleinen Eingang wunderte
ich mich anfangs. Es klärte sich jedoch auf, als ich einmal nachts in den Terrarienraum muß-
te. Da befand sich das Tier im Bereich des Höhleneingangs (halb innerhalb, halb außerhalb
der Höhle) und die Öffnung war deutlich geweitet. Am nächsten Morgen war der Höhlenein-
gang dann wieder fast ganz verschlossen. Dieses Verhalten konnte ich aber nur bei diesem
einen Weibchen beobachten. Alle anderen, die in kleineren Terrarien untergebracht sind,
verschlossen ihre Höhlen nicht, gruben sogar mehrere Eingänge und waren auch am Tag
überwiegend präsent. Wenn diesen Tieren in den kleineren Behältern ein hoher Bodengrund
geboten wird, durchziehen sie ihn vollständig mit Gängen. Sie benötigen allerdings eine län-
gere Eingewöhnungszeit, um schließlich mit ihren Grabungen zu beginnen. Viele Wochen
bewegten sie sich kaum aus den ihnen zur Verfügung stehenden Höhlen heraus. Selbst zum
Fressen verließen sie diese nicht, sondern warteten ab, bis ein Futtertier sich in ihre Behau-
sung verirrte. Es kam vor, daß die Grillen oder Heimchen auch Tage nach der Fütterung noch
unberührt in den Terrarien lebten. Erst als ich die Insekten gezielt in die Höhlen setzte, fraßen
die Spinnen zügig.
Der erste Verpaarungsversuch verlief eigentlich unspektakulär. Nachdem ich das Männchen
in das Terrarium des Weibchens gesetzt hatte, verharrte es zunächst einige Minuten regungs-
los. Ich bugsierte es dann in Richtung des Höhleneinganges, den ich vorsichtig etwas erwei-
tert hatte. Das Weibchen befand sich nur wenige Zentimeter davon entfernt. Das Männchen
bemerkte das Weibchen und begann sofort mit seiner Werbung. Nach zittrigem, langsamen
Herantasten blieb es unmittelbar am Höhleneingang sitzen und trommelte munter drauf los.
Das muß das Weibchen erschreckt haben. Es verzog sofort sich bis in die äußerste Ecke
seines Baues und ließ sich auch nicht mehr blicken. Nach 45 Minuten (die Videokasette war
voll) beendete ich diesen Versuch.
Alle weiteren Versuche (insgesamt habe ich den Mann zehn mal zu fünf verschiedenen Weib-
chen gesetzt - auch in kleinere Terrarien -), die ich in den nächsten Wochen und Monaten
startete, verliefen ähnlich. Nur einmal flüchtete das Männchen, als ich es aus dem Terrarium
entfernen wollte, in die Höhle. Es lief bis zum Ende des Ganges und blieb beim Weibchen
sitzen. Sie berührten sich, verhielten sich aber völlig passiv. Ich konnte dies durch die Scheibe
gut beobachten. Ich war schon versucht, das Tier einfach beim Weibchen zu belassen, und
auf eine unbeobachtete Paarung zu hoffen. Allein, die Notwendigkeit, daß das Männchen für
eine künftige Beschreibung erhalten bleiben mußte, hielt mich davon ab. Auch hatte es bereits
6 beobachtete Spermaaufnahmen absolviert. Die Lebenserwartung war also nicht mehr allzu
hoch. Die Gefahr war daher sehr groß, daß das Weibchen ihn nach der Paarung nicht ent-
kommen lassen würde.
Danach konnte ich nur noch einen Paarungsversuch untemehmen. Das Männchen verstarb
unerwartet Ende März 2005. Jetzt hoffe ich auf den noch verbliebenen kleinen unreifen Mann.
Zusammenfassung
Acanthoscurria borealis ist die erste Art der Gattung, die in Mittelamerika gefunden wurde. Sie
ist gekennzeichnet durch einen sehr einfachen Genitalbulbus mit kurzem apikal breitem Em-
bolus, einer Tibia-Apophyse mit einem Kamm aus 7 Dornen und einem nur auf dem Tastertro-
chanter vorhandenem Stridulationsorgan. Die Spermathek ähnelt der, die von PETERS für A.
32 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005 33
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005
musculosa abgebildet wurde.
Literatur
PETERS, H.-J. (2003): Amerika's Vogelspinnen. -Tarantulas of the WorId-Verlag, Wegberg,
330 pp.
PLATNICK, N. (2005): The World Spider Catalog, Version 5,5, Fam. Theraphosidae Thorell,
1870, http://res earch. amnh.orgien tom ology/s piders/catalog
SCHMIDT, G. (2003): Das Miin- 1---~;:::__:__;:::::::::::::::::~::::::::::::;;:P'"':7'0'~
nchen von Acanthoscurria Abb. UP"1, -',
altmanni SCHMIDT, 2003
(Theraphosidae: Theraphosi-
nae).- TOW 8 (79): 3 - 11.
SCHMIDT, G. (2004): Acanthos-
curria ballei sp. n., eine sehr '.
kleine neue Spezies aus Urugu-
ay and dem angrenzenden Ar-
gentinien (Araneae: Theraphosi-
dae: Theraphosinae).-TOW 9
(91): 4 - 8.
I :
Anschrift der Verfasser: ';' I~~) GUatemala '
Dr. Günter SCHMIDT, Von- _~~'g" -:' . UOIJolr
Kleist-Weg 4, D-21407 Deutsch '. . : S,",a'ero~}' :;
Evem, BRD 8"'1 I<I~ ,rOJ1Q.J !:IM; ·.SlII&m6 ~
Heinz-Josef PETERS, Am Tömp ..::.~. • "-oml ~... .~J ;~J)jtl F .~~ -1
14, D- 41844 Wegberg, BRD . SQI~I;IIt~er'Wl!lr, EI ~ r~g~coo
A<IIOJlou • e • 81....~.
", " } f3 1.tilt rn 8 1;,'1 .
. R. t.lazMenan(;:J ,., . - .lu1lapA
~~dJ.•i:. \.). ,i;~ ~ •
Verzeichnis der Abbildungen:
Abb. 1 - Acanthoscurria borealis sp.n., Weibchen Foto: PETERS
Abb. 2 - Acanthoscurria borealis sp.n., Miinnchen Foto: PETERS
Abb. 3 - Acanthoscurria borealis sp.n., Spermathek ~ Foto: PETERS
Abb. 4 - Acanthoscurria borealis sp.n., Spermathek ~ Foto: PETERS
Abb. 5 - Acanthoscurria borealis sp.n., Spermathek ~ Grafik: SCHMIDT
Abb. 6 - Acanthoscurria borealis sp.n., Augenhügel ~ Foto: PETERS
Abb. 7 - Acanthoscurria borealis sp.n., Carapax ~ Foto: PETERS
Abb. 8 - Acanthoscurria borealis sp.n., ventral ~ Foto: PETERS
Abb. 9 - Acanthoscurria borealis sp.n., Bulbus a Foto: PETERS
Abb. 10 - Acanthoscurria borealis sp.n., Bulbus a Foto: PETERS
Abb. 11 - Acanthoscurria borealis sp.n., Tibia-Apophyse Foto: PETERS
Abb. 12 - Acanthoscurria borealis sp. n., Tibia-Apophyse Foto: PETERS
Abb. 13 - Acanthoscurria borealis sp.n., Augenhügel a Foto: PETERS
Abb. 14 - Acanthoscurria borealis sp.n., Spinnwarze ~ Foto: PETERS
Abb. 15 - Acanthoscurria borealis sp.n., Spinnwarze a Foto: PETERS
Abb. 16 - vermutliches Verbreitungsgebiet
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005 35
Günter Schmidt
Das Weibchen von Grammostola aureostriata SCHMIDT & BULLMER,
2001 (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae)
Abstract
The weil known female of Grammostola aureostriata is described. Because of the shape of its
spermathecae it belongs to the Grammostola iheringi - group. As in the male two golden yel-
low vertical stripes exist on femur, patella and tibia of the palps and additionally one vertical
stripe on the metatarsus of the legs.
Keywords
Grammostola aureostriata, Grammostola iheringi, description, Argentina, Paraguay.
Einleitung
Seit etwa 1999 ist diese Grammostola-Art, die in Argentinien und Paraguay vorkommt, in den
USA und Europa bekannt. Bereits im Sommer 2000 konnte BAUMGARTEN sechs Weibchen,
die aus dem Chaco nahe der Stadt Resistentia /Argentinien stammten, erfolgreich verpaaren,
und ein Jahr später schon wurde die Art in Deutschland regelmäßig angeboten. Das Männ-
chen wurde im Jahre 2001 beschrieben, wobei auch das Weibchen in Bezug auf Körpergrö-
ße, Form der Spermathek, Färbung, Zeichnung und Verhalten charakterisiert wurde. BAUM-
GARTEN konnte auch nachweisen, dass die Tiere in freier Wildbahn am Boden wachsende
Bromeliengewächse, aber auch Backsteinhaufen, als schattigen Unterschlupf bevorzugen.
Die Weibchen verhalten sich beim Einfangen recht aggressiv und stellen sich mit gespreizten
Chelizeren in Positur. Ihre Gelege enthalten durchschnittlich 500 - 600 Eier.
Da die meisten der in Mitteleuropa vorhandenen Weibchen noch leben, wird die Beschreibung
nach einer Exuvie angefertigt.
Material und Methoden
1 Exuvie eines Weibchens, ded. ALTMANN im Mai 2004. Die Untersuchung erfolgte mit dem
Binokular bei 30facher Vergrößerung. Die Reizhaare wurden vom Opisthosoma abgeklopft
und mittels des Mikroskops bei 105facher Vergrößerung klassifiziert und ausgemessen. Die
Augengrößen und -abstände wurden mit dem Messokular bei 30facher Vergrößerung be-
stimmt. Die Werte für Carapax, Sternum, Labium und Extremitäten wurden mit dem Lineal
ermittelt. Das Weibchen wird im Naturhistorischen Museum Wien hinterlegt werden.
Beschreibung des Weibchens (Angaben in mm)
Körperlänge 55, Carapax 25 x 21, vorn 14. Chelizeren 11 x 7, Klaue 10. Chelizerenzähne ?10
(sehr schwer zu erkennen). Augenhügel 2,0 lang, 3,3 breit, direkt am Carapax-Vorderrand.
Vorderaugenreihe prokurv, Hinteraugenreihe rekurv. Augenmaße (mit Cornea): VMA 0,59,
VMA-VMA 0,78, VSA 0,66, VMA-VSA 0,33, HMA (Längsdurchmesser) 0,46, VMA-HMA 0,26,
HSA 0,66, HMA- HSA 0,20, VSA-HSA 0,53, HMA-HMA 1,72. Fovea tief, ganz leicht prokurv,
4,6. Carapax-Vorderrand-Fovea 17, Labium 3,9 lang, 4,6 breit, mit 9 Reihen von Dörnchen im
apikalen Drittel. Sternum 10 x 8, mit 3 Paar Sigillen. 1. und 2. Paar randständig, 3. Paar 1,32
vom Sternumrand entfernt.
Femur 111 etwas dicker als Femur IV. Skopula: Alle Tarsen und Metatarsus I voll, Metatarsus 11
0/., Metatarsus 111 Y:z, Metatarsus IV im apikalen Drittel skopuliert. Bestachelung: Taster: Tibia
va 2, pi 1-1, rI1-1-1. I: Ti pi 1-1, rl1-1-0, Met pi 1-0-0, va 2 rl1. 11: Ti pi 1-1, v 0-1-0, Met p11,
va 1, rl b 1. 111: Ti pi 0-1-0, v 2-2-2, rI 0-0-1, Met v a 2, rI 1-1-1. IV: Ti pi 0-1-0, v 2-0-2, rl 0- 1-1,
Met pi 0-1-1, v a 2, rl 0-1-1. Stridulationsorgane aus vielen löeinen dichtstehenden Stachelbor-
sten bestehend. Opisthosoma 30 x 20. Spinnwarzen : Basalglied 3, Mittelglied 2, Endglied 4.
Reizhaare: Typ IV ca. 0,18 lang, Typ 111 ca. 0,37 lang, letztere sehr selten. Spermathek (Abb.
36 Sonderausgabe Tarantulas of the world - Oktober 2005
1) mit einwärts gekrümmten Receptacula seminis, ähnlich wie bei G. iheringi (KEYSERLlNG,
1891).
Färbung kastanienbraun, Opisthosoma dorsal dunkler, hinterer Teil des Labiums, Sternum,
Coxen, Opisthosoma ventral, Patellen bis Tarsen schwarz, Maxillen und Labium apikal fuchs-
rot. Zwei goldgelbe Längsstreifen an der Oberseite der Beine von Femur bis Tibia wie beim
Männchen, an den Femora allerdings nur schwach ausgeprägt. Metatarsus im basalen Drittel
zusätzlich mit einem goldgelben Längsstreifen. Auch an den an den Patellen und Tibien der
Taster derartige Längsstreifen. Weißgelbe Gelenkringe am Ende von Femur, Patella, Tibia
und, schwächer ausgebildet, auch am Metatarsus.
Gliedmaßen von Femur bis Tarsus:
Femur Patella Tiba Metatarsus Tarsus Ges.-Länge
Taster 11 9 9 8 37
Bein I 18 11,5 13 10 8 60,5
Bein 11 15 11 11,5 10 8 55,5
Bein 111 14 8 10 11 8 51
Bein IV 18,5 10,5 14 17 8 68
Diskussion
Das hier beschriebene Weibchen ist mit 55 mm Körperlänge noch recht klein. Es sind Tiere
bekannt geworden, deren Körperlänge mehr als 80 mm beträgt. Die Unterschiede gegenüber
der nächstverwandten Art, G. iheringi, die mit 47 mm im männlichen und 57 mm im weiblichen
Geschlecht deutlich kleiner bleibt, wurden von SCHMIDT & BULLMER 2001 sowie von
SCHMIDT 2001 dargelegt. Sie bestehen vor allem in der dunkleren Färbung und den goldgel-
ben Längsstreifen auf der Oberseite der Patellen und Tibien.
Zusammenfassung
Das Weibchen von Grammostola aureostriata ist wie das Männchen gefärbt und gezeichnet.
Seine Spermathek mit den nach innen eingekrümmten Köpfchen der Receptacula seminis
weist es als Angehörigen der G.iheringi- Gruppe aus.
Danksagung
Ich danke Herrn Wolfgang ALTMANN, Saalfelden/Österreich, herzlich für die Übersendung
der Exuvie eines Weibchens von Grammostola aureostriata.
Literatur
SCHMIDT, G. & M. BULLMER (2001): Grammostola aureostriata sp. nov., ein Vertreter der
Grammostola iheringi - Gruppe (Araneae: Theraphosidae, Theraphosinae) aus Argentinien
und Paraguay.- Entomo!. Z. 111 (6): 173 - 176, Stuttgart.
SCHMIDT, G. (2001): Grammostola fossor sp. n. (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae),
ein weiterer Vertreter der Grammostola iheringi - Gruppe.- Arthopoda 9 (3): 2 - 8, Wernigero-
deo
Anschrift des Verfassers:
Dr. Günter SCHMIDT, Von-Kleist-Weg 4,0-21407 Deutsch Evern, BRD
Verzeichnis der Abbildungen
Abb. 1 - Grammostola aureostriata SCHMIDT & BULLMER, 2001, Spermathek
Abb.2 - Grammostola aureostriata Wibchen, Foto: PETERS
Sonderausgabe Tarantulas of the world - Oktober 2005 37
38 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005
Günter Schmldt
Das Männchen von Grammostola schulze; (SCHMIDT, 1994) (Arane-
ae: Theraphosidae: Theraphosinae)
Abstract
The male of Grammostola schulzei from Argentina is described. It is very small and dorsally
quite black with ginger hairs, belonging to the Grammostola iheringi-group and closely related
to Grammostola fossor SCHMIDT, 2001. The shape of its palpal bulb is in no way different
from that of Grammostola fossor. There are short stout thorns on the retrolateral side of the
coxa of the palps, on the prolateral and retrolateral sides of coxa I - 111 and on the prolateral
side of coxa IV. Grammostola schulzei seems to be also related to G. gosse i (POCOCK,
1889), a species where the thorns are restricted to the retrolateral side of the palpal coxa.
Keywords
Grammostola schulzei, G. fossor, G. gossei, G. iheringi - group, description, Argentina.
Einleitung
Im Mai 2005 erhielt SCHMIDT von den Eheleuten Frank und Maja FRIEBOLIN ein in Alkohol
konserviertes Männchen von Grammostola "argentinensis". Es stellte sich schnell heraus,
dass es sich dabei um das bisher unbekannte Männchen von G. schulzei handelt, das hier im
Folgenden beschrieben wird.
Material und Methoden
1 d' (Allotyp), Argentinien, Nachzucht von VINMANN 2001, ded. FRIEBOLIN.
Die Untersuchung erfolgte mit dem Binokular bei 30facher Vergrößerung. Bulbus und Embo-
lus wurden mit entsprechenden Organen anderer Grammostola-Arten verglichen. Die Reiz-
haare wurden vom Opisthosoma abgestreift, mit dem Mikroskop bei 105facher Vergrößerung
klassifiziert und mit dem Messokular ausgemessen. Die Körper- und Extremitätenmaße wur-
den mit dem Lineal ermittteit. Das Männchen wird im Naturhistorischen Museum Basel hinter-
legt werden.
Ergebnisse
Grammostola schulzei (SCHMIDT, 1994)
Po/yspina schulzei SCHMIDT, 1994
Po/yspinosa schulzei SCHMIDT, 1999
Grammostola schulzei BERTANI & SAYURI FUKUSHIMA,2004
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005 39
Beschreibung des Männchens (alle Angaben in mm)
Körperlänge 30, Carapax 15 x 14, vorn 8, Chelizeren 7 x 3,5, Klaue 5, Chelizerenzähne
ohne Beschädigung des Tieres nicht zu erkennen. Stridulationsorganan Coxa I, stark redu-
ziert, nur aus wenigen sehr dünnen Fiederhaaren bestehend. Augenhügel 1,98 lang, 2,30
breit, Vorderaugenreihe prokurv, Hinteraugenreihe leicht rekurv, VMA 0,30 ,VMA-VMA 0,53,
VSA 0,66, VMA-VSA 0,20, HMA gelb, Längsdurchmesser 0,39, VMA-HMA 0,20, HSA 0,59,
HMA-HSA 0,07, VSA - HSA 0,39, HMA-HMA 1,12. Fovea tief, 3,30, Abstand zum Augenhü-
gel 10. Clypeus breiter als Durchmesser eines VMA. Labium 2,0 lang, 2,6 breit, apikal mit 6-
10 Reihen von Dörnchen. Sternum 7 x maximal 6, nach hinten verbreitert. Sternalsigillen nicht
zu erkennen.
Gliedmaßen
Femur Patella Tiba Metatarsus Tarsus Ges.-Länge
Taster 9 5 7 22
Bein I 14 7 10 10 7 48
Bein II 12 6 10 10 7 45
Bein 111 11 5 9 11 7 43
Bein IV 13 6 11 14 8 52
Skopulierung: Alle Tarsen voll, Metatarsus 10/., Met. 11 2/3, Met. 111 1/3, Met. IV 1/3.
Bestachelung: Taster; Tibia pi 1-1-1-1. I: Tibia pl1, v 1-0-1, rI1-1-0, prolaterale Apophyse
mit apikal stark gekrümmtem langem schwarzem Stachel, der ihrer Innenseite fast anliegt und
beinahe ihre Länge erreicht, Metatarsus a 1. 11: Tibia pi 0-1-0, v 2-2-1-2, rl 0-1-0, Met v 1-0-0,
rl 0-1-0.111: Ti pi 1-0-1, v 1-0-0, rl 0-1-1-0, Met pi 1-1-1-2, v 1-1-1, rl 0-1-0-1. IV: Ti pi 1-1-1-1, v
1-0-0, rl 0-1-1-0, Met pi 0-1-1-1, rl 0-1-2-1, vor allem der letzte stark gekrümmt.
Reizhaare Typ IV sehr zahlreich, ca. 0,19 lang, Typ 111, 0,37 lang, sehr selten. Opisthosoma
15 x 15. Tarsalklauen unbezahnt. Spinnwarzen: Basalglied 2,0, Mittelglied 1,3, Endglied 2,6,
Gesamtlänge 5,8. Bulbus und Embolus wie bei G. fossor, mit langgezogenem Embolus. Fär-
bung: grauschwarz mit fuchsroten Haaren.
Diskussion
Grammostola schulzei war ursprünglich für eine afrikanische Art gehalten worden. Erst BER-
TANI & SAYURI FUKUSHIMA erkannten im Jahre 2004, dass es sich um eine Grammostola
sp. handelte. Ebenfalls im Jahre 2004 bemerkte FRIEBOLlN, dass das ihm als G. argentinen-
sis verkaufte Weibchen keinesfalls zu G. rosea gehört, jener Art , mit der G. argentinensis
synonymisiert worden war, und sandte es zur Bestimmung an SCHMIDT. Dieser stellte fest,
dass dieses Weibchen in Wirklichkeit G. schulzei ist und publizierte darüber im November
2004. Im Mai 2005 erhielt er dann auch noch ein gerade verstorbenes Männchen dieser Art,
wiederum von FRIEBOLlN, das diesem erneut als G. •argentinensis" verkauft worden war.
Durch die Untersuchung dieses Tieres konnte bestätigt werden, dass G. schulzei , wie auf-
grund der Form der Spermathek, die der von G. fossor außerordentlich ähnelt, schon zu ver-
muten war, ein weiterer Vertreter der G. iheringi-Gruppe ist. Bulbus und Embolus sind nicht
von denen, die man bei G. fossor findet, zu unterscheiden. Man könnte G. schulzei als eine
G. fossor ansehen, der die kurzen kräftigen Dornen an den Coxen fehlen. Es ist bedauerlich,
dass bisher kein Material von G. gossei studiert werden konnte. Möglicherweise ist dies eine
Spezies, die G. schulzei ebenfalls sehr nahe steht und auch in Argentinien lebt. Es wäre zu
hoffen, dass bald bekannt wird, aus welchem Teil Argentiniens G. schulzei stammt.
Zusammenfassung
Grammostola schulzei ist, wie die Untersuchung auch des Männchens zeigt, ein weiterer
argentinischer Vertreter der G. iheringi-Gruppe und nahe mit G. fossor verwandt. Die männli-
40 Sonderausgabe Tarantulas of the world - Oktober 2005
chen Taster beider Arten lassen sich nicht unterscheiden. Charakteristisch für die Art sind die
wenigen dünnen und rudimentären Stridulationshaare, mit denen ein Stridulieren nicht mög-
lich ist, und die kurzen dicken Dornen retrolateral an den Coxen der Taster, pro- und retrolate-
ral an den Coxen I - 111 und prolateral an Coxa IV, über deren Bedeutung nichts bekannt ist.
Reizhaare von Typ IV sind zahlreich, von Typ III äußerst selten. Verwandtschaftliche Bezie-
hungen bestehen auch zu der argentinischen Spezies G. gosse i (POCOCK, 1889), die wie G.
schulzei an der Retrolateralseite der Tastercoxa Domen aufweist.
Danksagung
Ich danke den Eheleuten Frank und Maja FRIEBOLlN, Fischingen, für die Übersendung des
hier beschriebenen Männchens von Grammostola schulzei.
Literatur
BERTANI, R. & C. SAYURI FUKUSHIMA (2004): Po/yspinosa SCHMIDT, 1999 (Araneae,
Theraphosidae, Eumenophorinae) is a synonym of Grammostola SIMON, 1892 (Araneae,
Theraphosinae, Theraphosinae).- Revista Iberica de Aracnologia 9: 329 - 331.
POCOCK, R. (1903): On some genera and species of South-American Aviculariidae.- Ann.
Mag. Nat. His!. (7) 11: 81-115.
SCHMIDT, G. (1994): Eine neue Eumenophorine (Araneida: Theraphopsidae: Eumenophori-
nae).- Arachnol. Mag. 2 (1): 3 - 7.
Schmidt, G. (1999): Neuer Name für Polyspina schulzei SCHMIDT, 1994.- Arachnol. Mag. 7
(4): 14.
SCHMIDT, G. (2001): Grammostola fossor sp.
n. (Araneae: Therapho-sidae: Theraphosinae), ein
weiterer Vertreter der Grammostola iheringi - Abb.2
Gruppe.- Arthropoda 9 (3): 2 - 8.
SCHMIDT, G. (2004): Grammostola
.argentinensis" ist identisch mit Grammostola
schulzei (SCHMIDT, 1994) (Araneae: Theraphosi-
dae: Theraphosinae).- Tarantulas of the World 9
(99): 9 - 13.
Dr. Günter SCHMIDT, Von-Kleist-Weg 4, 0-21407
Deutsch Evern, BRD
Verzeichnis der Abbildungen:
Abb.1 Grammostola schulzei Ö', Bulbus und
Embolus
Abb.2 Grammostola schulzei Tibia-
Apophysen
Günter Schmldt und Robert Samm
Haplope/ma chrysothrix Sp. n. (Araneae: Thera-phosidae: Omithocto-
ninae), eine seit 1989 dokumentierte, aber bis heute unbeschriebene
Spezies aus Südostasien *
Abstract
Haplopelma chrysothrix sp. n. belongs to the H. schmidti- group according to von WIRTH
(1991) because its spermathecae are dented at the front. The female is mostly medium-sized
(body length about 5 cm). The male (holotype) has a body-size of 27 mm only. It is beige
-Herrn Heinz·Josef PetefS zum 50. Geburtstag am 12. 07. in freundschaftticher Verbundenheit mit den besten W{nschen von den Autoren gewidrret.
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005 4\
brown with black palps. Femora and tarsi of the legs are also black. Patellae, tibiae and meta-
tarsi are light brown. The palpal bulb looks very similar to that of H. lividum SMITH, 1996. In
the black female the outsides of patellae and tibiae of the forelegs bear an orange edge of
hairs. The leg formula is 1,4,2,3. This species is sometimes named "Thailand black tarantula"
just as Haplopelma minax (THORELL, 1897). Its dealer name is Hap/opelma aureopilosum .
Though it seems to be sure that under this name different, also brighter coloured species are
subsumed.
Key words
Araneae, Theraphosidae, Ornithoctoninae, Haplopelma lividum, H. minax, H. "aureopilosum~
H. "aureopilosum var.", Melopoeus minax, Haplopelma minax, H. schmidti, Ornithoctonus, O.
huwena, Schwarze Thai-Vogelspinne, taxonomy, Thailand, Myanmar, Malaysia.
Einleitung
Die Entdeckung dieser "neuen" Art hat eine ungewöhnlich lange Vorgeschichte. Nach von
WIRTH 2002 wird sie bereits bei KLAAS 1989 als Haplopelma minax (THORELL, 1897) be-
zeichnet. Das ist jedoch nicht ganz richtig. KLAAS bildet vielmehr ein Männchen als Melo-
poeus minax THORELL, 1897, Schwarze Thailand-Vogelspinne, ab und schreibt, dass es
nach der Reifehäutung schwarze Taster und Beine mit schwarzen Femora mit violettem
Schimmer, schwarzen Tarsen und hellbraunen Patellen bis Metatarsen aufweise. Das 0-
pisthosoma wird wie der Carapax als hellbraun mit schwarzer Streifenzeichnung charakteri-
siert. Die Tibia-Apophyse sei sehr kurz und dick. Die Weibchen werden als tiefschwarz, ihre
Opisthosomata als dunkelgrau mit schwarzer Mittellinie sowie schwarzen Querlinien be-
schrieben. Braungerandete Patellen und Tibien fänden sich an den Beinen I und 11. Und noch
ein Hinweis von KLAAS verdient Beachtung. Er schreibt, dass nicht Männchen wie Weibchen
aussehen. Als Verbreitung werden Sri Lanka, Borneo und Nias (Insel an der Westküste von
Sumatra) angegeben.
Diese Art ist jedoch mit Sicherheit nicht H. minax, wogegen schon die zweifarbig gefärbten
Beine der Männchen sprechen. Auch wenn es sich um den ersten schriftlichen Nachweis und
die erste Fotografie der jetzt als H. chrysothrix beschriebenen Art handelt, so muss die von
KLAAS angegebene Verbreitung doch stark in Zweifel gezogen werden. Interessant ist aber
sein Hinweis, es handele sich um die häufigste der seinerzeit aus Asien importierten Vo-
gelspinnen. Die Spezies muss also schon von 1989 bekannt gewesen sein.
Als "Schwarze Thailand-Vogelspinne" oder abgekürzt "Schwarze Thai" wurde und wird neben
Haplopelma minax auch eine als Haplopelma sp. "aureopilosum" bezeichnete Art im Handel
angeboten. Beide Spezies sind in der Vergangenheit immer wieder mit einander verwechselt
worden, was nicht verwundern kann, weil es von H. sp. "aureopiJosum" bisher keine Be-
schreibung gab.
Wenn v. WIRTH schreibt, auch SCHMIDT 1993 habe beide Arten verwechselt, so trifft das
jedoch nicht zu. Die Abb. 380 in seinem Buch zeigt eindeutig H. minax, während Abb. 398 ein
Männchen darstellt, das ihm v. WIRTH am 11. 03. 1991 als H. aureopiJosum zur Verfügung
gestellt hatte und das zweifelsfrei zu H. chrysothrix gehört. Den Spezies namen
"aureopiJosum" hatte SCHMIDT am 26. 2. 1991 in einem Brief an v. WIRTH für eine damals
als "Schwarze Thai" (= Ornithoctonus aureopiJosus nomen nudum) bezeichnete und bis dahin
unbeschriebene Art vorgeschlagen (SCHMIDT, 2003). V. WIRTH hatte ihm gestattet, sein
Foto dieser Spezies in der 4. Auflage des Buches "Vogelspinnen" zu verwenden, dessen
Manuskript SCHMIDT seinem Verlag am 07. 03. 1991 eingereicht hatte. Am 19. 06. 1991
hatte v. WIRTH an SCHMIDT geschrieben, er bereite einen Bericht vor, in dem diese neue Art
publiziert wird. Dieser werde wahrscheinlich schon in der August-Ausgabe des
"Arachnologischen Anzeigers" herauskommen. Aufgrund dieser Ankündigung sah SCHMIDT
keine Veranlassung, auf die Nennung des vorgesehenen Spezies namens zu verzichten. Denn
wohl niemand konnte damals ahnen, dass die Bsschreibung durch von WIRTH selbst 14
Jahre später immer noch nicht erfolgt sein würde, ein in der Arachnologie einmaliger Vorgang.
42 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005
Durch die Bezeichnung "Haplopelma aureopilosum von WIRTH 1996" im ersten Vogelspin-
nenbuch dieses Autors wird suggeriert, die Art sei damals bereits beschrieben worden. Hierin
liegt ein eklatanter Verstoß gegen die internationalen Regeln für die zoologische Nomenklatur
vor, den sich gerade ein so renommierter Arachnologe wie v. WIRTH nicht erlauben sollte.
Nach v. WIRTH wird diese Art auch als Omithoctonus sp. in Fachpublikationen bezeichnet.
PETERS 2000 nennt sie H. "aureopilosum" von WIRTH,?, weist jedoch ausdrücklich darauf
hin, dass sie noch nicht beschrieben wurde. Dem soll jetzt endlich ein Ende bereitet werden.
Material und Methoden
1 0' (Holotyp), Thailand, 1 inadultes 0', Fundort und Sammler unbekannt, ded. Peters, Exu-
vie eines ~ ex Thailand, ded. Peters, Exuvie eines ~ ex Thailand, von Sam m in Stuttgart
erworben. Die Untersuchung erfolgte mit dem Binokular bei 30facher Vergrößerung. Augen-
größen und -abstände, Labium, Fovea, Stridulationsdornen, Tarsalklauen und Spermathek
wurden mit dem Messokular ausgemessen, die übrige Vermessung erfolgte mit einem Lineal.
Stridulationsorgane, Bulbus und Embolus sowie Tibia-Apophyse des 0' und die Spermathe-
ken der ~ ~ wurden gezeichnet. Letztere wurden zuvor in Polyvinyl-Laktophenol eingebettet.
Der Holotyp wurde im Senckenbergmuseum, Frankfurt/M. deponiert. Die Weibchen werden
nach ihrem Ableben ebenfalls im Senckenbergmuseum hinterlegt.
Ergebnisse
Haplopelma chrysothrix sp. n.
Me/opoeus minax KLAAS 1989 (Fehlbestimmung)
Haplopelma aureopilosum SCHMIDT 1993 nomen nudum
Haplopelma aureopilosum von WIRTH, 1996 (part.) nomen nudum
Haplopelma "aureopilosum" (Händlerbezeichnung) nomen nudum
Haplopelma aureopilosum Von WIRTH, 199? SAMM 1999 nomen nudum
Haplopelma "aureopilosum" Von WIRTH,? PETERS 2000 nomen nudum
Haplopelma sp. "aureopilosum" Von WIRTH 2002 (part.) nomen nudum
Diagnose
Mittelgroße bis große hellbraune (0') bzw. schwarze Spezies (~). Körperlänge: 0' 25- 45
mm, ~46 (- 70 ) mm (PETERS, 2000)). 0' mit schwarzen Tastern und schwarzen Femora
und Tarsen der Beine, Patellen und Tibien der Beine lateral hellbraun, hellere Gelenkringe
zwischen Femur und Patella sowie zwischen Tibia und Metatarsus und Metatarsus und Tar-
sus schwach ausgeprägt, Taster sehr ähnlich wie bei H. lividum (Abb. 1a, 1b). ~ schwarz.
Außenseiten von Patella und Tibia der Beine I und 11 mit orangefarbigem Haarsaum (Färbung
verblasst mit der Zeit), Opisthosoma mit schwarzem Längsstrich und davon ausgehenden
schwächer ausgeprägten schwarzen Querstreifen (Fischgrätenmuster), Spermathek vom in
der Mitte eingedellt (Abb. 2a und ?2b). Stridulationsdornen auf der Maxille (Abb. 3, 6) in zwei
und drei Reihen. Chelizeren bei Weibchen rI mit 4 - 6 weißen Schaufelborsten, bei Männchen
mit nur 3 - 4. Subadulte Männchen wie Weibchen gefärbt.
Derivatio nominis
Von altgriechisch XPÜC1€o~ (chryseos = goldfarben) und Oplf (thrix = Haar), wegen des cha-
rakteristischen goldenen Haarsaums an den Patellen und Tibien der beiden ersten Beinpaare
beim Weibchen.
Beschreibung des Männchens (Holotyp) (Maßangaben in mm)
Körperlänge 27, Carapax 15 x max. 12, vorn 7, Opisthosoma 13 x max. 8. Chelizeren 7 x 3,
Klaue 5,3. Chelizerenzähne etwa 17, von denen die ersten 4, vom Klauengelenk an gerech-
net, am größten sind. Chelizeren rl mit dichtem Haarpolster und basal 3 oder 4 geraden und
gefiederten Schaufelborsten. Maxillen pi mit 7 sehr kurzen Stridulationsdornen unterhalb der
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world· Oktober 2005 43
Sutur, von denen 6 in zwei Reihen angeordnet sind (Abb. 3). Clypeus breiter als Durchmesser
eines VMA. Augenhügel 1,3 lang, 2,6 breit. Vorderaugenreihe prokurv, Hinteraugenreihe
leicht rekurv. VMA 0,46, VMA-VMA 0,40, VSA 0,39, VMA - VSA 0,26, HMA gelb, Längs-
durchmesser 0,30, VMA-HMA 0,20, HSA 0,39, HMA-HSA 0,07, VSA-HSA 0,33, HMA-HMA
1,25. Fovea flach, gerade, 33. Labium 1,32 lang, 2,31 breit, frontal spärlich mit kleinen Dornen
in zwei Reihen besetzt. Sternum 7 x 4,5, nach hinten verbreitert. Sternalsigillen kaum erkenn-
bar. Ein Paar liegt zwischen Coxa 11 und 111. Sein Abstand zum Sternumrand beträgt weniger
als sein Längsdurchmesser. Beinformel I, IV, 11, 111. Bein I etwas dicker als Bein IV. Femur 111
verdickt.
Gliedmaßen
Femur Patella Tiba Metatarsus Tarsus Ges.-Länge
Taster 8 5 7 3 23
Bein I 14 8 12 11 7 52
Bein 11 12 7 9 9 6 43
Bein 111 10 6 6 8 5 35
Bein IV 14 6 10 13 7 50
Skopula schwarz glänzend. Alle Tarsen und Metatarsus I voll, Metatarsus 11 2/3, Metatarsus 111
Y:z, Metatarsus IV weniger als 1/3 skopuliert. Bestachelung: Kranz aus 4 Stacheln apikal an
Metatarsus IV. Tibia-Apophyse (Abb. 4) außen etwa 4 lang, an der Innenseite mit dickem
schwarzen Dorn. Kein 2. Dorn apikal an Tibia I wie bei H. lividum, apikal mit mehr als 50 dicht-
stehenden langen schwarzen Dornen in mehreren Reihen. Tarsalklauen etwa 1.05, unbe-
zahnt. Taster 5, Bulbus mit schwarzem Basalteil. Spinnwarzen schwer ausmessbar, da stark
eingetrocknet. Basalglied ca. 2, Mittelglied ca. 0,7, Endglied 2. Färbung: dunkelbeige, Taster,
Femora und Tarsen der Beine fast schwarz, Carapax von der Fovea ausgehend mit schwar-
zen Zeichnungsmustern, entstanden durch fehlende Behaarung. Opisthosoma dorsal mit
dünner schwarzer, kaum erkennbarer Mittellinie und angedeuteten Querbinden.
Unreifes Männchen: rl an Patellen und Tibien von Bein I und 11 hellbraun gerandete Haarsäu-
me, sonst wie reife Weibchen.
Beschreibung des Weibchens (Allotyp)
Carapax 22 x maximal 16, vorn 9, höchster Punkt des Kopfteils in der Mitte zwischen Clypeus
und Fovea. Opisthosoma 24 x 15, Augenhügel erhaben, 2, 0 lang, 3,3 breit. Clypeus sehr
breit. Augenhügel um 1,0 vom Carapaxrand entfernt. Vorderaugenreihe prokurv, Hinterau-
genreihe schwach rekurv. VMA 0,66, VMA-VMA 0,39, VSA 0,79, VMSA-VSA 0,39, HMA
(Längsdurchmesser) 0,46, VMA-HMA 0,23, HSA 0,46, HMA-HSA 0,13, VSA-HSA 0,39, HMA-
HMA 1,45. Fovea flach, gerade, 3,0, Abstand vom Augenhügel 13. Chelizeren 10 x 6, Klaue
10. Bezahnung: vom Klauengelenk an gerechnet 4 große, von denen der letzte etwas mehr
vom vorletzten entfernt steht als die übrigen von einander, danach etwa 30 kleine Zähne in 2
Reihen. Labium 2,0 lang, 3,3 breit, apikal mit 4 - 5 Reihen von Dörnchen. Labiosternalsutur
mit 2 Mounds. Sternum 10 x maximal 7, hinten verbreitert und breit abgestutzt. Zwei Paar
Sternalsigillen gegenüber Coxa 11 und 111. Erstes Paar fast randständig, zweites länglich,
0,99, vom Sternumrand um 0,66 entfernt. Chelizeren rI mit kurzem dickem braunem Haarpols-
ter und langen geraden weißen Schaufelborsten, 4 an linker und 6 an rechter Chelizere (Abb.
5), sowie mehreren Reihen gefiederte~ Stridulationsborsten darunter, davor bzw. dazwischen.
Länge der großen Schaufelborsten bis zu 1 mm. Maxillen pi mit 8 maximal ca. 0,35 mm lan-
gen Stridulationsdornen unterhalb der Sutur und manchmal zusätzlich einem solchen Dorn
direkt oberhalb derselben (Abb. 6).
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005
Gliedmaßen
Femur Patella Tiba Metatarsus Tarsus Ges.-Länge
Taster 12 7 8 9 36
Bein I 18 10 12 11 9 60
Bein 11 15 9 10 9 7 50
Bein 111 12 8 7 9 7 43
Bein IV 16 9 11 13 7 56
Bein IV dünner als I. Tarsalklauen stark gekrümmt, unbezahnt. Abstand Klauenspitze - innere
Basis 1,32. Skopula: Alle Tarsen sowie Metatarsus I und 11 voll, Metatarsus 111 mehr als Yo,
Metatarsus IV mehr als 1/3 skopuliert. Bestachelung: 11: Tibia v a 1, Metatarsus va 1; 111: Ti v
a 2, Met va 1; IV: Ti va 2, Met v a 2. Spinnwarzen: Basalglied 3,2, Mittelglied 2,2, Endglied
3,7, Gesamtlänge 9,1. Spermathek (Abb. 2a) vom H. schmidti-Typ, eingedellt, 1,65 hoch, 4,00
breit, an eingedellter Stelle 0,66. Färbung: schwarz. Orangefarbiger oder rotbrauner Haar-
saum retrolateral an Patellen und Tibien I und 11.
Lebensweise und Verbreitung: Die Art lebt in Röhren im Regenwald von Zentral- und Süd-
Thailand, Nordmalaysia und Südmyanmar (SAMM 1999, PETERS 2000).
Diskussion
Die .neue" Art ähnelt im männlichen Geschlecht, was den Bulbus und Embolus betriffl, H.
lividum und im weiblichen hinsichtlich der Spermathek H. schmidti von WIRTH, 1991. Bei H.
lividum ist allerdings Metatarsus 11 voll skopuliert, und alle Tibien und Metatarsen der Beine
haben nach SMITH, 1996 basal ein Paar Stacheln.
Leider ist unklar, welche Art v. WIRTH unter Haplopelma sp . • aureopilosum" überhaupt ver-
steht. In seinem Bestimmungsschlüssel von 2002 weist er darauf hin, dass die Weibchen
keine deutlichen hellen Gelenkringe zwischen den Beinsegmenten aufweisen, bildet als Abb.
1 jedoch ein Exemplar mit deutlichen hellen Gelenkringen ab, wie es für sein H. sp .
• aureopi/osum var." typisch sein soll. Bis auf den Haarsaum sollen die Beine einheitlich
schwarz sein. Seine Abb. 1 zeigt jedoch ein relativ hell gefärbtes Weibchen, dessen
Femora , Metatarsen und Tarsen eindeutig dunkler als Patellen und Tibien sind. So ein Ex-
emplar würde wohl kaum jemand als .Schwarze Thailand-Vogelspinne" bezeichnen.1996
bildete er auf S. 28 seines Buchs ein Weibchen (ohne dass erwähnt wird, dass es sich um ein
solches handelt) mit einfarbig schwarzen Beinen ab, wohingegen auf S. 33 wiederum ein
Weibchen zu sehen ist, bei dem nur die Femora und Tarsen eindeutig schwarz sind. Das von
PETERS 2000 abgebildete Weibchen ist wesentlich dunkler als das von v. WIRTH 1996 auf
S. 33 und als Abb. 1 im Jahre 2002 dargestellte. Hier sind auch die hellen Gelenkringe wie-
derum sehr deutlich. Danach hat es den Anschein, dass unter der Händlerbezeichnung .H.
aureopilosum" unterschiedliche Arten subsumiert werden, ähnlich wie es auch bei der früher
und teilweise auch noch heute unter der Händlerbezeichnung • H. longipedum" angebotenen
Spezies der Fall ist, wofür in beiden Fällen allein v. WIRTH verantwortlich ist.
Untersuchungen an Material, das seinerzeit als H. aureopilosum identifiziert wurde, wiesen
eine eingedellte Spermathek auf, wie sie nach v. WIRTH (1991) für die.H. schmidti"-Gruppe
typisch ist. Allein aufgrund dieser Tatsache dürfte eine Verwechselung mit H. minax, dessen
Spermathek nicht oder kaum eingedellt ist, nicht mehr vorkommen. Andererseits sollte in
einer Revision aber geklärt werden, ob eine Unterscheidung der Gattung Haplopelma SI-
MON, 1892 von der Gattung Ornithoctonus POCOCK, 1892 allein aufgrund der Spermathe-
ken überhaupt möglich ist. Offenbar bestehen hier Schwierigkeiten, da z. B. ein- und dieselbe
Spezies einmal als H. schmidti v. WIRTH, 1991 und ein anderes Mal als Omithoctonus huwe-
na (WANG, PENG & XIE, 1993) bezeichnet wird.
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005 45
In diesem Zusammenhang klingt die Begründung v. WIRTH's (2002), warum er H.
"aureopilosum" bisher nicht beschrieben hat, geradezu grotesk: Er wolle erst die Ergebnisse
von Kreuzungsexperimenten zwischen H .•aureopilosum" und H. .aureopilosum var." kennen,
bevor er eine Arbeit über die Identität der beiden Formen publiziert. Auf diese Ergebnisse
warten wir bis heute. Das hat zur Folge, dass andere Arachnologen eine Art, die seit wenigs-
tens 16 Jahren im Handel ist, bis heute nicht zweifelsfrei identifizieren können, obgleich sie
seit Jahren sogar erfolgreich gezüchtet wird.
Ob die Spermathek, die unter Abb. 2 b dargestellt ist, zu H. chrysothrix gehört, bedarf weite-
rer Untersuchungen, vor allem auch am Männchen. Die Spermathek gleicht weitgehend der
von H. schmidti, ist aber so tief wie bei Ornithoctonus sp. eingeschnitten. Es fehlen der tief-
schwarzen Exuvie die weißen Gelenkringe und die orangeroten Haarsäume retrolateral an
den Patellen und Tibien I und 11. Nach der Häutung hatte das Weibchen hellbraune Ränder an
den Extremitäten, ist aber sonst identisch mit der Exuvie des Allotyps. Jedoch ist an der Exu-
vie Bein IV etwas länger als Bein I, was für H. chrysothrix nicht zutrifft.
Zusammenfassung
Männchen und Weibchen von Haplopelma chrysothrix sp. n. werden beschrieben. Es han-
delt sich um eine mittelgroße Spezies aus der H. schmidti-Gruppe nach von WIRTH. Die Art
war seit 1993 unter dem Händlernamen H ."aureopilosum" bekannt. Allerdings scheint es
ziemlich sicher, dass unter dieser Bezeichnung verschiedene, auch heller gefärbte Arten sub-
sumiert werden. Verwechselungen mit H. minax waren in der Vergangenheit und sind auch
jetzt noch häufig, lassen sich aber vermeiden, wenn man die Genitalien und die Färbung der
Extremitäten berücksichtigt. Charakteristisch für die .neue" Art ist die Schwarzfärbung der
weiblichen Tiere mit dem orangeroten Haarsaum retrolateral an den Patellen und Tibien I und
11 und die tief eingeschnittene Spermathek. Bei den beige-braun gefärbten Männchen sind die
Taster sowie Femora und Tarsen der Beine schwarz. Patellen und Tibien der Beine sind seit-
lich hellbraun. Der Taster ähnelt dem von H. lividum. Die Beinformel ist in beiden Geschlech-
tern 1.4,2,3.
Danksagung
Wir danken Herrn H.-J. PETERS, Wegberg, für die Überlassung eines reifen und inadulten
Männchens sowie eines Weibchens der neuen Art.
Literatur
KLAAS, P. (1989): Vogelspinnen im Terrarium, Ulmer, Stuttgart, 148 pp.
PETERS, H.-J. (2000): Kleiner Atlas der Vogelspinnen, Bd. 2, Tarantulas of the world, Weg-
berg, 161 pp.
SAMM, R. (1999): Arachnida: Araneae: Theraphosidae. Systematik Teil I, R. Samm, Nürn-
berg/lstanbul, 242 pp.
SCHMIDT, G. (1993): Vogelspinnen, 4. Aufl. Landbuch, Hannover, 151 pp.
SCHMIDT, G. (2003): Anmerkungen zu dem Beitrag .Welche Spinne ist das" in DeARGe Mitt.
7 (11): 8 -13.- DeArGe Mitt. 8 (1): 29 - 31.
WIRTH, V. von (1991): Eine neue Vogelspinnenart aus Vietnam: Hapiopelma schmidti sp. n.
(Araneae: Theraphosidae: Ornithoctoninae).- Arachnol. Anz. 18: 6 - 11.
WIRTH, V. von (1996): Vogels pinnen richtig pflegen und verstehen, GU Tier-Ratgeber, Mün-
chen, 65 pp.
WIRTH, V. von (2002): Welche Spinne ist das ?- DeArGe Mitt. 7 (11): 6 -13, Farbtafel1.
ZHU, Ming-sheng & Da-xiang SONG (2000): Taxonomic study on Selenocosmia huwena
WANG et al., 1993 (Araneae: Theraphosidae: Ornithoctoninae).- J. Hebei University 20 (1):
53-56.
Anschriften der Verfasser:
Dr. GOnter Schmidt, Von-Kleist-Weg 4, D-21407 Deutsch Evem, BRD
Robert Samm, Imbuschstr. 14, D-90473 NOmberg
46 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005
Verzeichnis der Abbildungen
Abb. 1 a-Haplopelma chrysothrix sp. n. ci' (Holotyp), linker Bulbus und Embolus retrolateral
Abb. 1 b-Haplope/ma chrysothrix sp. n. ci' (Holotyp), linker Bulbus und Embolus schräg
ventro-prolateral
Abb. 2 a-Haplopelma chrysothrix sp. n. + (Allotyp), Spermathek
Abb. 2 b-Haplopelma ? chrysothrix sp. n. +, Spermathek
Abb. 3-Haplopelma chrysothrix sp. n. ci', Stridulationsdornen prolateral auf der Maxille
Abb. 4-Haplopelma chrysothrix sp. n. ci', Tibia-Apophyse
Abb. 5-Haplopelma chrysothrix sp. n. +, Schaufel borsten retrolateral auf der rechten Cheli-
zere
Abb. 6 -Haplopelma chrysothrix sp. n. +. Stridulations dornen prolateral auf der Maxille
Abb. 7-Haplopelma chrysothrix sp. n. Weibchen (Foto: PETERS)
Abb. 8-Haplopelma chrysothrix sp. n. Männchen (Foto: PETERS)
Sonderausgabe Tarantulas of the world - Oktober 2005 47
· , ". , ...........
~ ' , .. '"
48 Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005
Sonderausgabe Tarantulas ofthe world - Oktober 2005 49
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Die Chihuahua-Bergkönigsnatter: Lampropeltis knoblochiVon EverandDie Chihuahua-Bergkönigsnatter: Lampropeltis knoblochiNoch keine Bewertungen
- 7159 Tinter 1991 Ara 16 6 10Dokument5 Seiten7159 Tinter 1991 Ara 16 6 10satyr01Noch keine Bewertungen
- Brehms Tierleben. Band 28. Ergänzungsband 4: SchmetterlingeVon EverandBrehms Tierleben. Band 28. Ergänzungsband 4: SchmetterlingeNoch keine Bewertungen
- 114 - Avicularia Aurantiaca, Bauer 1996Dokument8 Seiten114 - Avicularia Aurantiaca, Bauer 1996VulpesNoch keine Bewertungen
- Schlangenhaltung Schritt für Schritt - Schlangen halten ohne Vorkenntnisse: Das Buch mit allem Wissenswerten über die Schlangenhaltung zuhause - inkl. Selbsttest und ChecklisteVon EverandSchlangenhaltung Schritt für Schritt - Schlangen halten ohne Vorkenntnisse: Das Buch mit allem Wissenswerten über die Schlangenhaltung zuhause - inkl. Selbsttest und ChecklisteNoch keine Bewertungen
- SC004 Mohrig & Thaler (1982)Dokument6 SeitenSC004 Mohrig & Thaler (1982)el ouazzani nour el houdaNoch keine Bewertungen
- SC282 Rudzinski (1999)Dokument8 SeitenSC282 Rudzinski (1999)el ouazzani nour el houdaNoch keine Bewertungen
- Bremer 2006 Amarygmus XLIII PapuanischeDokument17 SeitenBremer 2006 Amarygmus XLIII PapuanischeDávid RédeiNoch keine Bewertungen
- Rohdendorf 1924 CalliphorinenStudien IDokument5 SeitenRohdendorf 1924 CalliphorinenStudien IDávid RédeiNoch keine Bewertungen
- Hartmann-Schroder. 1962a. Zweiter Beitrag Zur Polychaetenfauna Von PeruDokument59 SeitenHartmann-Schroder. 1962a. Zweiter Beitrag Zur Polychaetenfauna Von PeruAndrew AlvaradoNoch keine Bewertungen
- Uchida 1930 Neue Gattung Und Neue IchneumoninenArten Aus JapanDokument8 SeitenUchida 1930 Neue Gattung Und Neue IchneumoninenArten Aus JapanDávid RédeiNoch keine Bewertungen
- Gedächtnisprotokoll 2020 MorphologieDokument12 SeitenGedächtnisprotokoll 2020 MorphologieAdi SassonNoch keine Bewertungen
- Dorchymont 1913 Sauters FormosaAusbeute HydrophilidaeDokument19 SeitenDorchymont 1913 Sauters FormosaAusbeute HydrophilidaeDávid RédeiNoch keine Bewertungen
- Schumacher 1915 Sauters FormosaAusbeute HomopteraDokument35 SeitenSchumacher 1915 Sauters FormosaAusbeute HomopteraDávid RédeiNoch keine Bewertungen
- Kaszab 1952 Neue Epicautinen Aus Der Orientalischen RegionDokument11 SeitenKaszab 1952 Neue Epicautinen Aus Der Orientalischen RegionDávid RédeiNoch keine Bewertungen
- StiasnyDokument10 SeitenStiasnyLibertine Agatha DensingNoch keine Bewertungen
- AmniotaDokument4 SeitenAmniotaWolfbioNoch keine Bewertungen
- 70) Brunk (2016) Vachinius Luzoensis EB - 111 - 2015 - 005-010 - 02-BrunkDokument6 Seiten70) Brunk (2016) Vachinius Luzoensis EB - 111 - 2015 - 005-010 - 02-BrunkIngo Brunk0% (1)
- Huftgelenk 2018Dokument34 SeitenHuftgelenk 2018Márti TiNoch keine Bewertungen
- Becker 1925 Sauters FormosaAusbeute Asilinae III 3Dokument11 SeitenBecker 1925 Sauters FormosaAusbeute Asilinae III 3Dávid RédeiNoch keine Bewertungen
- Stämme Des Tierreichs: EuarthropodaDokument47 SeitenStämme Des Tierreichs: EuarthropodaKaledNoch keine Bewertungen
- SC005 Mohrig (1978)Dokument9 SeitenSC005 Mohrig (1978)el ouazzani nour el houdaNoch keine Bewertungen
- SC061 Rudzinski 1988Dokument5 SeitenSC061 Rudzinski 1988el ouazzani nour el houdaNoch keine Bewertungen
- Anatomie EselsbrückenDokument8 SeitenAnatomie EselsbrückenbejichuNoch keine Bewertungen
- Rohdendorf 1928 CalliphorinenStudien IIDokument3 SeitenRohdendorf 1928 CalliphorinenStudien IIDávid RédeiNoch keine Bewertungen
- Haft Franzen 1996 Schistometopum ThomenseDokument7 SeitenHaft Franzen 1996 Schistometopum ThomensejlkljhlkNoch keine Bewertungen
- Huene 1914 Beitrage Zur Geschichte Der ArchosaurierDokument75 SeitenHuene 1914 Beitrage Zur Geschichte Der ArchosaurierJ.D. NobleNoch keine Bewertungen
- Das HandskelettDokument4 SeitenDas HandskelettalphaprimeNoch keine Bewertungen
- Mollenkamp 1912 Sauters FormosaAusbeute LucanidaeDokument3 SeitenMollenkamp 1912 Sauters FormosaAusbeute LucanidaeDávid RédeiNoch keine Bewertungen
- Aphelenchus Avenae Como Agricola (Deman 1881b)Dokument4 SeitenAphelenchus Avenae Como Agricola (Deman 1881b)Filosophy2000Noch keine Bewertungen
- BF 00446Dokument12 SeitenBF 00446Neo StralizNoch keine Bewertungen
- Nemathelminthes - Rundwürmer: Andreas Schmidt-Rhaesa, Walter SudhausDokument2 SeitenNemathelminthes - Rundwürmer: Andreas Schmidt-Rhaesa, Walter SudhausMuhammad Reyza PahleviNoch keine Bewertungen
- EingangsüberprüfungDokument2 SeitenEingangsüberprüfungCTHkn1Noch keine Bewertungen
- Handelsbezeichnung Lat DDokument18 SeitenHandelsbezeichnung Lat DgamerNoch keine Bewertungen
- Bremer 2005 Amarygmus XXXVI Neu Guinea Aus Dem Naturkundemus ErfurtDokument5 SeitenBremer 2005 Amarygmus XXXVI Neu Guinea Aus Dem Naturkundemus ErfurtDávid RédeiNoch keine Bewertungen
- Stämme Des Tierreichs: Platyzoa Rotatoria Annelida (Lophotrochozoa)Dokument43 SeitenStämme Des Tierreichs: Platyzoa Rotatoria Annelida (Lophotrochozoa)KaledNoch keine Bewertungen
- Jordan 1909 Einige Neue Afrikanische AnthribidenDokument3 SeitenJordan 1909 Einige Neue Afrikanische AnthribidenDávid RédeiNoch keine Bewertungen
- FRAGEN ANATOMIE 1von 2Dokument4 SeitenFRAGEN ANATOMIE 1von 2phie.christNoch keine Bewertungen
- 2 TheorieDokument6 Seiten2 TheorieTom ZorecNoch keine Bewertungen
- FachbegriffeDokument24 SeitenFachbegriffeКсения БурдунNoch keine Bewertungen
- Verhandlungender 40 ZoolDokument548 SeitenVerhandlungender 40 ZoolFilippo Maria BuzzettiNoch keine Bewertungen
- 03 4 Sitzungtermi 27 10nichtlateiner 03 11lateinerostenDokument38 Seiten03 4 Sitzungtermi 27 10nichtlateiner 03 11lateinerostenКарина ВасилеваNoch keine Bewertungen
- A NATOMIEDokument71 SeitenA NATOMIERosuDianaGabrielaNoch keine Bewertungen
- 2a, 7 - Fachbegriffe. Hassan Ali. 04.2019Dokument25 Seiten2a, 7 - Fachbegriffe. Hassan Ali. 04.2019Eric Morris67% (3)
- Pagasa KmentiDokument7 SeitenPagasa KmentiRaul BaenaNoch keine Bewertungen
- Kopf/Hals-Testat: Fragen & AntwortenDokument97 SeitenKopf/Hals-Testat: Fragen & AntwortenkathiNoch keine Bewertungen
- BestimmungsDokument16 SeitenBestimmungsjasmin9109Noch keine Bewertungen
- Ulnares HG TFCCDokument14 SeitenUlnares HG TFCC4kfdjfrpxgNoch keine Bewertungen
- Micherdzinski 1980 - OrithonyssinaeDokument132 SeitenMicherdzinski 1980 - OrithonyssinaeMichelNoch keine Bewertungen
- Upper LimbsDokument41 SeitenUpper LimbsFagboladeNoch keine Bewertungen
- BiodiversitätDokument159 SeitenBiodiversitätulanNoch keine Bewertungen
- 8, 42 MM CPXLG., Mus. Washington Nr. 107097Dokument53 Seiten8, 42 MM CPXLG., Mus. Washington Nr. 107097MauricioVieiraNoch keine Bewertungen
- Muskeln Lernzettel?Dokument7 SeitenMuskeln Lernzettel?f2v9s99cf9Noch keine Bewertungen
- Ott 1986Dokument1 SeiteOtt 1986Gerhard OttNoch keine Bewertungen
- Zoologigv: Die Pseudothelphusidae (Crustacea Brachyura)Dokument77 SeitenZoologigv: Die Pseudothelphusidae (Crustacea Brachyura)MauricioVieiraNoch keine Bewertungen
- Arum AlpinumDokument11 SeitenArum AlpinumGürol AytepeNoch keine Bewertungen
- Fracturas Del Astrágalo en GatosDokument14 SeitenFracturas Del Astrágalo en GatosMau NNoch keine Bewertungen
- Chordata WS2021 I IIDokument5 SeitenChordata WS2021 I IIclaudiaNoch keine Bewertungen
- Kieffer 1912 Sauters FormosaAusbeute TendipedidaeDokument18 SeitenKieffer 1912 Sauters FormosaAusbeute TendipedidaeDávid RédeiNoch keine Bewertungen
- Bremer 2005 Amarygmus XXXV Bunamarygmus Javanus SP NDokument5 SeitenBremer 2005 Amarygmus XXXV Bunamarygmus Javanus SP NDávid RédeiNoch keine Bewertungen
- Angst vor Spinnen und ihre Giftigkeit: Mit 24 meist farbigen Abbildungen (Spinnenfotos, Spinnenkunst)Von EverandAngst vor Spinnen und ihre Giftigkeit: Mit 24 meist farbigen Abbildungen (Spinnenfotos, Spinnenkunst)Noch keine Bewertungen
- Meine beiden Prinzessinnen, die blöde Kuh und die Bitch: Im Spinnennetz der AbhängigkeitVon EverandMeine beiden Prinzessinnen, die blöde Kuh und die Bitch: Im Spinnennetz der AbhängigkeitNoch keine Bewertungen