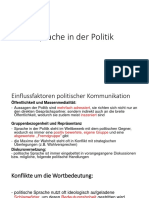Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
E Eggs Macht Der Sprache Senegal 2006
E Eggs Macht Der Sprache Senegal 2006
Hochgeladen von
bropenCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
E Eggs Macht Der Sprache Senegal 2006
E Eggs Macht Der Sprache Senegal 2006
Hochgeladen von
bropenCopyright:
Verfügbare Formate
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
Kolloquium Goethe-Institut Dakar, April 2006
Die Macht der Sprache ber die Lage der Nationalsprachen im Senegal
Die Etablierung der Nationalsprachen in Europa Ekkehard Eggs Universitt Hannover, Deutschland
bersetzung von Melanie Otto, Universitt Hannover
Die Macht der Sprache das ist zunchst die Macht einer jeden Sprache, eine begriffliche Aneignung oder Sicht der Welt zu schaffen und damit ein Kommunikationsmittel zu liefern, welches uns erlaubt, als soziale Wesen zu handeln, indem wir unsere Gedanken und Gefhle ausdrcken und uns dadurch dem Leben und den Traditionen einer ethnischen oder nationalen Gemeinschaft zugehrig fhlen. Die Macht der Sprache das ist sowohl die Macht, Dinge zu erhellen, als sie auch, dies muss betont werden, zu verdunkeln und zu mystifizieren. Nun ist aber gerade die Frage der Macht der Sprache oder der Macht der Sprachen Gegenstand von Mystifizierung und Mythen gewesen und ist es noch immer.
Die Etablierung des Italienischen
Einer dieser Mythen ist die Vorstellung, dass die Nationalsprachen, die sich in Europa seit der Renaissance konstituiert haben, auf der vom Volk gesprochenen Sprache grnden. Exemplarisch sei hier aus einem im vergangenen Jahr von Heinz Weinmann anlsslich des jhrlichen Kolloquiums LAssociation canadienne des professionnels de lenseignement du franais au collgial (Kanadische Franzsischlehrervereinigung) gehaltenen Vortrag zitiert: Ihm zufolge hat Dante in seiner Abhandlung De vulgari eloquentia (ber die Redegewandtheit in der Volkssprache) (1304) der vom Volk gesprochenen Sprache denselben Status wie der von den literati geschriebenen lateinischen Sprache zugestanden.
[] Diese revolutionre Neusicht der Volkssprache [] findet 1549 mit Joachim Du Bellays Dfense et illustration de la langue franaise (Verteidigung und Verherrlichung der franzsischen Sprache) ihre Vollendung. In der Zwischenzeit ist das Franzsische Muttersprache der Franzosen geworden, ihre Nationalsprache, wie man spter sagen wird. (http://www.cegep-rimouski.qc.ca/apefc/accueil.htm - 4/2/06)
Schauen wir uns Dantes Text, auf den Weinmann sich bezieht, nher an:
wir bewerten die Sprache als Volkssprache, die wir ohne das Erlernen von Regeln in die Wiege gelegt bekommen, indem wir unsere Amme nachahmen. Danach lernen wir eine Zweitsprache (also das Lateinische, E.E), die die Rmer Sprache der Grammatik genannt haben. Auch die Griechen besitzen eine solche, wie auch andere, aber nicht alle Vlker. Wenig zahlreich sind die, denen es gelingt, sie zu beherrschen, denn es braucht Zeit und ein kontinuierliches Studium, um ihre Regeln und ihr System zu verinnerlichen. Die Volkssprache ist die erhabenere dieser beiden Sprachen, zunchst, weil sie die erste war, die vom menschlichen Geschlecht Verwendung fand, dann, weil sie
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
auf der ganzen Welt verbreitet ist, obwohl sie sich durch Aussprache und Vokabular in verschiedene Zweige einteilen lsst, und schlielich, weil sie fr uns natrlich ist, wh1 rend die andere eher knstlich ist. (Dante 1304, De vulgari eloquentia, I, 1)
In der Tat unterscheidet Dante die lingua vulgaris, also die Sprache des Volkes, vom Lateinischen, welches standardisiert und grammatikalisiert ist und ber eine geschriebene Form verfgt. Erstere ist natrlich, letztere eher knstlich. Zu beachten ist allerdings: Das Lateinische wird, zur Zeit Dantes und im Mittelalter, nicht als Fremdsprache aufgefasst, sondern als Sprache, die demselben Sprachraum angehrt: Latein ist dabei die Distanzsprache, die allen bestehenden romanischen Sprachen, die als Nhesprache dienen, gegenbergestellt wird. Doch kommen wir auf Dantes Text zurck. Indem er betont, dass die Volkssprache erhabener als das Lateinische ist, weil die Menschen sie zuerst verwendet haben und weil sie in jeder Mundart auf der ganzen Welt gegenwrtig ist, kehrt Dante die Bewertung des Paares Latein vs. Volkssprache um. Aber mehr noch: Diese Umkehrung impliziert, dass alle Volkssprachen gleich sind, mit anderen Worten: Eine jede von ihnen kann als universelles Kommunikationsmittel dienen. Genau dies ist die unerhrte und revolutionre Vorstellung von der potentiellen Universalitt jeder Sprache, die in der Renaissance und in der Romantik erneut aufgegriffen wurde und die bekanntlich die Grundlage der aktuellen Debatte ber ethnische, Vernakular- oder Nationalsprachen bildet. Man beachte freilich: Dante behauptet an keiner Stelle, dass die Volkssprache, so wie sie existiert, als Vorbild fr eine Kommunikationssprache Italiens dienen knne. Genau hier tuscht sich Weinmann. Fr Dante ist die Volkssprache ganz im Gegenteil nicht stabil und verderblich (`lo volgare non stabile e corruttibile (Dante 1988, Convivio, I, 5, 14; cf. Apel 1980, 114)). Dies zeigt sich schon darin, dass sich das gesprochene Latein, Grundlage der romanischen Sprachen, in drei Sprachfamilien Spanisch, Franzsisch und Italienisch aufgefchert hat. Was das Italienische betrifft, findet man dieses volgare nur in einer Vielzahl von regionalen und stdtischen Dialekten vor. Welcher dieser Dialekte knnte als Referenzsprache dienen? Dante selbst behandelt nacheinander die wichtigsten Dialekte Italiens, wobei seine Feststellung stets dieselbe ist: Obwohl einige Dialekte geeigneter sind (wie etwa der Dialekt in Bologna), existiert kein Dialekt, der mit dem Lateinischen konkurrieren knnte. Dante bezeichnet diese konkurrenzfhige Sprache als volgare illustre, also als die herausragende Volkssprache. Diese herausragende Sprache ist allen italienischen Stdten eigen und scheint gleichzeitig keiner anzugehren; sie ist, nach Dante, ein Panther, der sich durch seinen Geruch ankndigt, der aber dennoch nirgendwo auftaucht (redolentem ubique et necubi apparentem; Dante 1304, I, 14, 1). Da diese Beschreibung auf das aristotelische Denken verweist, liee sich ganz einfach sagen, die herausragende Sprache komme
1
[] vulgarem locutionem asserimus, quam sine omni regula, nutricem imitantes, accipimus. Est et inde alia locutio secundaria nobis, quam Romani grammaticam vocaverunt. Hanc quidem secundariam Greci habent et alii, sed non omnes. Ad habitum vero hujus pauci perveniunt, quia nonnisi per spatium temporis et studii assiduitatem regulamur et doctrinamur in illa. Harum duarum nobilior est vulgaris, tum quia prima fuit humano generi usitata, tum quia totus orbis ipsa perfruitur, licet in diversas prolationes et vocabula sit divisa, tum quia naturalis est nobis, cum illa potius artificialis existat.
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
potentialiter in allen italienischen Mundarten vor, sie muss durch Dichter zur Wirklichkeit oder zur tatschlichen Perfektion werden. Schauen wir uns die von Dante geforderten weiteren Eigenschaften nher an: Die herausragende Volkssprache muss zentral, kniglich und hfisch sein (cardinale, aulicum et curiale; I, 16,6). Cardinale bedeutet, dass sie sttzender Pfeiler und Angelpunkt aller Mundarten sein muss, sie ist, wie Dante anhand eines metaphorischen Wortspiels erklrt, ein cardo, also eine Trangel, welche die Bewegungen der Dialekte regelt und bestimmt; in diesem Sinn ist die kardinale Volkssprache wie ein Familienvater, der nicht nur das Wort, sondern auch die Seele lenkt (vgl. I, 18, 1). Dann muss die Volkssprache in dem Sinne kniglich sein, als sie am Hofe verwendbar sein muss (Dante przisiert, dass, existierte ein Hof in Italien, die dort praktizierte Sprache die herausragende Volkssprache wre). Und schlielich muss die Volkssprache so exzellent, so przise und so elegant, kurzum so hfisch sein, dass sie den Hflingen als Kommunikations- und Konversationssprache dienen kann, um die Angelegenheiten eines Stadtstaates verwalten zu knnen. Soll man noch hinzufgen, dass das vortreffliche Wesen der Volkssprache sich letztlich in seinem Gebrauch durch die Verwaltung und die Regierung bekunden muss: Diese Volkssprache sagt Dante, wird durch die Verwaltung und die Regierung verfeinert und sie verfeinert die, die sie verwenden, mit Ehre und Ruhm. (et vulgare de quo loquimur et sublimatum est magistratu et potestate, et suos honore sublimat et gloria ; I, 17, 2) ? Mit diesem Begriff der herausragenden Volkssprache, die als Sprache der Literatur und der Kommunikation in allen Gebieten, wo Herausragendes gefordert ist, dienen muss, ist man offensichtlich vom romantischen Entstehungsmythos weit entfernt: Die Volkssprache Dantes ist nicht die Muttersprache des Volkes, sondern eine von und fr die italienische Elite geschaffene Sprache. Diese Feststellung trifft auch auf die questione della lingua, also auf die Debatte ber die Gemeinsprache, die in der Renaissance zu Beginn des 16. Jahrhunderts ausbricht, zu. In dieser Debatte stehen sich verschiedene Lager der italienischen Elite gegenber. Welche Sprachsituation finden wir zu dieser Zeit vor? Dante selbst hat sein literarisches Werk in Ermangelung eines Publikums, das diese knstliche Sprache verstehen knnte, nicht in der herausragenden Volkssprache verfasst, sondern in Florentinisch, einer Variante des toskanischen Dialekts. Die beiden anderen groen italienischen Autoren, Francesco Petrarca (1304-1374) und Giovanni Boccaccio (1313-1375), haben auch auf Toskanisch geschrieben. Mit diesen drei Kronen (Dante, Petrarca, Boccaccio) besitzt Italien bereits im 15. Jahrhundert eine klassische Literatur. In dieser Frage des volgare, also der italienischen Vulgrsprache, kann man vier Richtungen unterscheiden (vgl. Geckeler/Kattenbusch 1992, 152ff.): 1) Bevorzugung einer archaisierenden, literarischen, gesamtitalienischen Sprache, also einer knstlichen Sprache, die aus all den Dialekten zusammengestellt wird, die eine schriftliche Literatur besitzen. Diese Sichtweise Girolamo Muzios (1496-1575) ist, verglichen mit Dantes Konzeption, positivistisch und konservativ, weil sie auf bereits bestehenden schriftlichen Werken beruht.
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
2) Bevorzugung des Gebrauchs einer archaisierenden toskanischen Sprache; so lautet die Auffassung des Kardinals Pietro Bembo (1470-1547, vgl. Prose della Volgar lingua (1525)), fr den Petrarcas und Boccaccios Sprache den normativen Referenzrahmen bildet. Betont sei, dass es sich dabei um eine Sprache handelt, die nicht gesprochen wird. 3) Bevorzugung des zeitgenssischen Toskanischen, von Niccol Machiavelli (1469-1527) vertretener Standpunkt (vgl. sein Dialogo sulla lingua (1514)); es handelt sich hierbei um die von der politischen florentinischen Elite gesprochene Sprache. 4) Bevorzugung des Gebrauchs der hfischen Sprache, also der Sprache der Hflinge, der wie man spter in Frankreich sagen wird hommes honntes, die in den Kabinetten und Kanzleien der Signorien, des rmischen Hofes oder der ppstlichen Kurie arbeiten. Diese Experten in politischen und diplomatischen Geschften leiten mit Geschick und Erfahrung die Angelegenheiten eines Hofes oder einer Stadt. Ihr bekanntester Vertreter ist Baldassare Castiglione (1478-1529), der mit seiner Abhandlung Il Cortigiano (1528) der bedeutendste Vorlufer eines neuen Adelsstandes in Europa wird, den man spter in Frankreich noblesse de robe (Amtsadel) nennen wird. Hinter all diesen Positionen kann man leicht den Kampf der literarischen und politischen Elite um die ideologische Hegemonie feststellen. Der literarischen Elite liegen eine regionalistische Strmung (Bembo) sowie eine nationale (Muzio) zugrunde; beide sind konservativ, archaisierend und fuen auf der geschriebenen Sprache. Der sprachliche Bezugspunkt der politischen Elite ist die zeitgenssische Sprache, geschrieben wie gesprochen. Es ist sicherlich nicht erstaunlich, dass der Florentiner Machiavelli, Sekretr der Kanzlei in Florenz und herausragender Politiker, eine regionalistische Sichtweise vertritt, um die Macht der Stadt Florenz im kulturellen und politischen Bereich zu vergrern; und es ist vollkommen einleuchtend seitens des Hflings Castiglione, dass er eine zentralistische Position vertritt, dadurch, dass er die Sprache des besten Teils des Hofes privilegiert, wie Vaugelas es ein Jahrhundert spter in Frankreich formulieren wird. Das archaisierende Toskanisch wird sich schlielich durchsetzen (d.h. die Position Bembos), vor allem deshalb, weil die literarische und kulturelle Elite ber die politischen und konomischen Eliten dominiert, welche im Italien der Renaissance, einem polyzentrischen Land ohne Zentralmacht, regionalisiert waren. Aber dieser Erfolg setzt selbstverstndlich die Kodifizierung und die Normalisierung des Toskanischen durch Grammatiken und normative Wrterbcher voraus. Leonardo Salviati (15391589) schreibt im Jahre 1576 seine <Regeln der florentinischen Sprache> (Regole della toscana favella), eine didaktische und normative Grammatik des Toskanischen, und ein halbes Jahrhundert spter wird die zugleich philosophische und wissenschaftliche groe allgemeine Grammatik <ber die toskanische Sprache> (Della lingua toscana) von Benedetto Buommattei (1623 und 1646) verffentlicht. Die beiden Autoren waren Mitglieder der ersten Sprachakademie der Welt, der Accademia della Crusca, die 1583 in Florenz ins Leben gerufen wurde und noch heute existiert (zwi-
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
schen 1783 und 1809 war sie vorbergehend verboten). Im Jahre 1612 verffentlichte sie ihr erstes Wrterbuch (d.h. 82 Jahre vor der ersten Ausgabe des Dictionnaire de lAcadmie franaise); weitere Ausgaben folgten in recht kurzen Abstnden. Ihr Name Crusca verweist auf eine puristische Grundkonzeption: crusca bedeutet im Italienischen die Weizenkleie; ihre Funktion ist also, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das Ergebnis dieser Etablierung des archaisierenden Toskanischen als Schriftsprache stellt eine neue Diglossie dar, in der das Lateinische durch das literarische Toskanisch ersetzt worden ist. Dies erklrt, dass Voltaire die Sprachsituation in Italien als negatives Beispiel anfhren konnte, die sich freilich vom Terror der katholischen Inquisition in der Tatsache unterschied, dass die italienischen Puristen nicht denjenigen die Zunge abschnitten, die die Norm nicht beherzigten. In der Tat ist in seinem <Trait sur la tolrance> (Abhandlung ber die Toleranz) zu lesen:
Lieber Ordensbruder, Sie wissen, dass jede Provinz Italiens ihre Sprache hat und dass man in Venedig und in Bergamo nicht so spricht wie in Florenz. Die Accademia della Crusca hat die Sprache kodifiziert; ihr Wrterbuch ist der Standard, von dem man nicht abweichen darf, und Buommatteis Grammatik ist ein unfehlbarer Leitfaden, dem man folgen muss; aber glauben Sie, dass der Konsul der Akademie, und in seiner Abwesenheit Buommattei, allen Venezianern und allen Bergamasken die Zunge htten abschneiden lassen, die auf ihrem Dialekt beharrt htten? (Voltaire 1763, Abhandlung ber die Toleranz)
Dieses puristische Modell der italienischen Akademie hat es trotz erbitterter Kritik verstanden, sich in ganz Italien auszubreiten: Das literarische Toskanisch oder, wie man es nun nennen kann, das literarische Italienisch wird mehr und mehr von den regionalen und lokalen Eliten bernommen, fr die jedoch, man muss das betonen, dieses Italienische nur Schriftsprache war, die den jeweiligen Dialekten gegenberstand. Diese Eroberung der Eliten ging einher mit der Eroberung von Sprachdomnen wie der Verwaltungs- und der Kanzleisprache, denen bis dahin andere Dialekte zu Grunde lagen. Vor allem aber: Das literarische Italienisch hat das Lateinische als Sprache der Geistes- und der Naturwissenschaften abgelst. In diesem Ausbreitungsprozess des toskanischen Italienisch als Schrift- und Amtssprache kennzeichnet das Werk des mailndischen Schriftstellers Alessandro Manzoni eine wichtige Phase. Manzoni hatte die Erstfassung seines Romans <Die Verlobten> (Promessi Sposi; zunchst unter dem Titel Fermo und Lucia verffentlicht) um 1821 geschrieben, in einer eklektischen Sprache, in der sich lombardische Regionalismen neben Latinismen, Archaismen und Gallizismen fanden. Zweimal berarbeitete er den Roman, indem er die heterogenen Elemente entfernte und sich insbesondere in der dritten Ausgabe von 1842 an dem von der zeitgenssischen Elite der Toskana gesprochenen Toskanischen orientierte (vgl. Manzoni 1972, 19ff.). Es handelt sich also um eine Art Aktualisierung, Verjngung und Auffrischung der archaisierenden Literatursprache durch das moderne Toskanisch. Die letzte Version der <Verlobten> stellt den endgltigen Sieg des Bembo und der Crusca-Akademie in der Sprachfrage dar. Anders ausgedrckt: Das Italienische Manzonis, das in den wesentlichen Aspekten mit dem modernen Standarditalienisch bereinstimmt, ist eine
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
herausragende Volkssprache (volgare illustre), basierend auf der toskanischen Schriftsprache des 14. und des 15. Jahrhunderts, verjngt durch das Toskanische des 19. Jahrhunderts (was nicht ausschliet, dass auch andere literarische Dialekte eindringen konnten, sofern sie nicht den akzeptierten normativen Spielraum berschritten haben). Aber diese italienische Sprache ist erst mit dem Zusammenschluss Italiens und der Grndung eines Nationalstaates im Jahre 1861 zur Nationalsprache Italiens geworden, ein Vorgang, der von einer groen nationalen Bewegung, dem risorgimento (die Auferstehung), getragen wurde. Manzoni, ein romantischer Nationalist, hat zu Beginn dieser Bewegung eine wichtige Rolle gespielt. In einem Text von Mazzini von 1845 ist die Ideologie der Bewegung klar ausgedrckt:
Wir sind ein zwischen einundzwanzig und zweiundzwanzig Millionen Einwohnern zhlendes Volk, seit Urzeiten mit demselben Namen bezeichnet, dem des italienischen Volkes, zwischen den eindeutigsten natrlichen Grenzen eingeschlossen, die Gott je gezeichnet hat, wir sprechen dieselbe Sprache, haben denselben Glauben, dieselben Sitten, dieselben Gewohnheiten, sind stolz auf die ruhmvollste politische, wissenschaftliche, knstlerische Vergangenheit, die in der europischen Geschichte bekannt ist, und wir haben zwei Mal der Menschheit ein gemeinsames Band gegeben, einen Aufruf zur Einheit, einmal durch das Rom der Kaiserzeit, ein anderes Mal durch das ppstliche Rom und zwar, als die Ppste noch nicht ihre Mission verraten hatten Wir haben keine Fahne, keinen politischen Namen, keinen Platz unter den europischen Nationen. Wir haben kein gemeinsames Zentrum, keinen gemeinsamen Pakt, keinen gemeinsamen Markt. Wie sind in sieben Staaten zerstckelt []. Einer dieser Staaten, der etwa ein Viertel der Halbinsel umfasst, gehrt zu sterreich; die anderen, teilweise durch Familienbande, alle aber durch ein Gefhl ihrer Schwche, leiden unter seinem Einfluss. (Mazzini, LItalie, lAutriche et le Pape, in : Revue indpendante, September 1845).
In diesem Text von Mazzini finden wir den integralen nationalistischen Topos des Europas des 19. Jahrhunderts vor. Er lsst sich wie folgt zusammenfassen: <Ein Volk, welches eine gemeinsame Geschichte hat und eine Wertegemeinschaft bildet, hat dadurch, dass es sich durch dieselben Weisen des Tuns, des Handelns, des Sprechens und Denkens auszeichnet, das naturgeme Recht, einen Staat zu grnden>. Die einzige einigermaen korrekte Angabe in diesem Text ist die Anzahl der Einwohner. In der Tat zhlte Italien zur Zeit seiner Vereinigung ungefhr 25 Millionen Einwohner. Der Anteil der Alphabetisierten lag bei 22%, mit einer deutlichen Diskrepanz zwischen Nord und Sd. Und, um einem jeden Nationalisten eine sehr viel niederschmetterndere Zahl zu nennen: Nur 10%, also 2,5 Millionen der 25 Millionen Einwohner, waren italophon. (vgl. Koch / Oesterreicher 1990, S. 166ff.). Die Italiener mussten daher zunchst italienisiert werden. Zuerst durch die Volksschule, deren Besuch im Jahre 1877 obligatorisch wurde (Legge Coppino). Aber die italienische Schule war nicht so leistungsfhig wie die franzsische, erstens deshalb, weil die Kenntnisse der Lehrer des herausragenden Italienischen oftmals unzureichend waren, zum zweiten deshalb, weil die breite Masse des Volkes massiv den Schulzwang umging. Man muss also noch andere Gesichtspunkte bercksichtigen. Diese sind:
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
Industrialisierung und Urbanisierung; Militrdienst, Prsenz der nationalen Verwaltung auf lokaler Ebene und schlielich:
Massenmedien (Presse, Radio, Kino, Fernsehen und gegenwrtig das Internet)
All diese Aspekte haben dazu beigetragen, den Gegensatz zwischen Stadt und Land und, weniger ausgeprgt, den Gegensatz zwischen Arbeitern und Kapitalisten oder, allgemeiner ausgedrckt, zwischen den sozialen Schichten zu verwischen; diese Gegenstze waren die Garanten des Fortbestandes der Dialekte und Soziolekte. Ich fasse zusammen. Heute endlich! verstehen alle Italiener das Italienische und, wenn man die paar Millionen sekundren Analphabeten ausklammert, kann man sagen, dass der grte Teil von ihnen auch das Standarditalienische zu schreiben vermag. Das meint aber nicht, dass alle Italiener das Standarditalienische im persnlichen bzw. durch Nhe bestimmten Umgang miteinander sprechen. Der heutige italienische Sprachraum ist immer noch durch vielfltige Varianten regionaler und lokaler Mundarten gekennzeichnet. Unter diesen findet sich eine wachsende Anzahl an sekundren Mundarten, das heit, Varianten, die sich dank und entgegen der standardisierten Sprache entwickelt haben. Diese Tatsache spiegelt ein allgemeingltiges Gesetz historischer Schriftsprachen wider: Jede Zentralisierung und Standardisierung ruft eine Gegen- und Komplementrbewegung hervor, die sich in Varianten und Unterschieden zur Standardsprache manifestiert. Kurzum: Die zentripetalen Krfte, die fr die Etablierung einer nationalen Schriftsprache notwendig sind, bewirken immer auch vielfltige zentrifugale Krfte, die es den Individuen ermglichen, ihre spezifische Identitt auszubilden.
Die Stufen der Etablierung einer Nationalsprache in Europa der Fall des Franzsischen
Ausgehend vom Beispiel des Italienischen kann man mehrere wesentliche Stufen beim Entstehungsprozess einer Nationalsprache in Europa unterscheiden. 1) Ich beginne mit der objektivsten und entscheidendsten: Die groen modernen Nationalsprachen werden in Europa in der Renaissance geboren, einer Epoche, die eine grundlegende historische Schwelle bildet. Diese Schwelle kann man anhand mehrerer Brche aufzeigen: der bergang vom Feudalismus zu einem kapitalistischen Wirtschaftsmodell unter Herausbildung einer neuen Schicht, der Bourgeoisie die Entstehung moderner Staaten, die sich in der Verstaatlichung der Gesellschaften artikuliert die Erfindung des Buchdrucks, der eine kulturelle Revolution mit sich bringt, die hauptschlich durch die Schaffung eines fr alle zugnglichen ffentlichen Raumes zum Ausdruck kommt. Daraus resultiert ein bisher unerhrtes Anwachsen der Rolle des Schriftstellers als Individuum.
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
die Herausbildung der Naturwissenschaften, die das traditionelle rhetorischdiskursive Wissen ersetzen, bringt fr lange Zeit eine Skularisierung des Wissens mit sich.
Diese Vernderungen bringen auf sprachlicher Ebene die tendenzielle Ersetzung des Lateinischen als herausragende Sprache durch die Volkssprachen mit sich (vgl. fr andere europische Sprachen Eggs 1996, S. 1072ff.). Dieser Wechsel zeigt sich anhand mehrerer Charakteristika: 2) Ausgangspunkt ist ein Dialekt, der zunchst als Nhesprache fungiert. Auf italienischem Boden ist dies das Toskanische, auf franzsischem Gebiet ist es der Dialekt der Ile de France (der Region um Paris), das Franois, welches man heute mit dem Terminus Francique bezeichnet, weil das Franois oder Franais der Name der franzsischen Nationalsprache geworden ist (gem dieser Logik mssten die Italiener ihre Sprache das Toskanische nennen). 3) Dieser Dialekt muss ber einen solchen Grad schriftlicher Elaboriertheit verfgen, dass die Distanz-Kommunikation auf einem Exzellenz-Gebiet mglich wird (insbesondere im politisch-administrativen und im literarischen Bereich). Diese Ausarbeitung setzt stets eine Elite voraus, die im Besitz dieser herausragenden Sprache ist und fr die der Gebrauch dieser Exzellenz-Sprache zugleich ein Mittel sozialer Distinktion und Hegemonie ist. Die Frage, welche dieser Domnen historisch den anderen voranging, hngt von der spezifischen Konstellation eines Landes ab. Im polyzentrischen Italien ist der Bereich der literarischen Kommunikation derjenige, den die toskanischen Schriftsteller zuerst eroberten, was der literarischen Elite ein besonderes Gewicht in der Frage der Sprache verleiht. In Frankreich, das mit der Ile de France bereits ber ein starkes Zentrum verfgt, gelingt es der Rechts- und Verwaltungssprache, ein deutlich ausgereifteres Sprachniveau zu erreichen, wobei diese sich gleichzeitig mit der literarischen Sprache entwickelt. Das Gewicht der Rechtsund Verwaltungssprache zeigt sich im <Erlass von Villers-Cotterts> (Ordonnance de Villers-Cotterts), der im August 1539 von Franz I. unterzeichnet wurde und aus dem ich zwei Paragraphen zitiere:
Art. 110. Que les arretz soient clers et entendibles. Et afin quil ny ayt cause de doubter sur lintelligence desdictz arretz. Nous voulons et ordonnons quils soient faictz et escriptz si clerement quil ny ayt ne puisse avoir aulcune ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander interpretacion. ([Wir bestimmen:] Dass die Erlasse klar und verstndlich sein sollen. Um keinen Anlass aufkommen zu lassen, am Sinn der (Justiz)Erlasse zu zweifeln, wollen wir und ordnen wir an, dass sie so deutlich gemacht und geschrieben sind, dass es in ihnen keine Mehrdeutigkeit oder Ungewissheit, noch den Anlass gibt oder geben kann, um nach einer Erklrung zu fragen.) Art. 111. De prononcer et expedier tous actes en langaige franoys Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur lintelligence des mots latins contenus dans lesdits arrts, nous voulons dornavant que tous arrts, ensemble toutes autres procdures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et infrieures, soit de registres, enqutes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quel-
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
conques actes et exploits de justice, soient prononcs, enregistrs et dlivrs aux parties, en langage maternel franais et non autrement. ([Wir bestimmen:] dass alle Vorgnge auf Franzsisch formuliert und umgesetzt werden und weil solche Missverstndnisse sehr oft hinsichtlich des Verstehens der lateinischen Wrter, die in diesen Erlassen enthaltenen sind, vorgekommen sind, wollen wir, dass von nun an alle Erlasse und brigen Verfahren, gleichgltig ob bei den kniglichen oder anderen, untergeordneten und niedrigen Gerichten, sei es in Grundbchern und Standesregistern, Untersuchungen, Vertrgen, Kommissionen, Urteilen, Testamenten und alle anderen Justiz- oder Rechtsurkunden und Vollstreckungen, dass all diese Urkunden in franzsischer Muttersprache verhandelt, geschrieben und den Parteien ausgehndigt werden und nicht anders.)
Dieser Erlass, der das Lateinische als Verwaltungssprache ersetzt, zeigt, dass es bereits eine spezialisierte franzsische Rechts- und Verwaltungssprache gab, er drckt jedoch nicht explizit aus, dass er alle anderen regionalen Rechts- und Verwaltungssprachen, die zu der Zeit bereits existierten, ausklammert. Die modernen Regionalisten haben also vllig recht mit der Feststellung, dieser Erlass entzge allen regionalen Sprachen jeglichen offiziellen Charakter. Ich fge ein kleines Detail hinzu: In der Fassung von 1553 wird das Wort maternel (Mutter-) entfernt, also schreibt der Erlass nur mehr vor, dass alle Texte in franzsischer Sprache geschrieben werden mssen. Bekanntlich hat die franzsische literarische Elite diese Ideologie produziert, die notwendig ist, um den Rckstand des Franzsischen im Vergleich zum Italienischen aufzuholen. Ich nenne hier nur die Deffence et Illustration de la langue franoyse (1549) von Joachim du Bellay, die zehn Jahre nach dem Erlass von Villers-Cotterts verffentlicht wurde. Du Bellay zhlte zur Gruppe der Dichter im Kreis der Pliade, die versuchten, die literarische Sprache durch ihre Gedichte, aber auch durch ihre poetischen Abhandlungen auszuschmcken und zu bereichern. 4) Diese Schaffung einer gemeinsamen Sprache, die in Exzellenz-Domnen Verwendung findet, wird immer von einer Kodifizierung, Normalisierung und Standardisierung begleitet und verstrkt. Dieser Vorgang luft im Groen und Ganzen immer gleich ab: Zunchst wird die Rechtschreibung vereinheitlicht, dann werden Grammatik und Wortschatz normalisiert. Anfangs sind die Grammatiken didaktisch und normativ gehalten, danach entstehen allgemeine und philosophische Grammatiken, die gerade auch zeigen wollen, dass die fragliche Sprache Zugang zur Universalitt hat. 5) Die Kodifizierung und Normalisierung werden immer durch die Grndung von Akademien, in denen die Elite sich institutionalisiert, verstrkt. Dies erklrt, dass die Akademien per definitionem puristisch sind, da die herrschende Elite ihren sozialen Habitus (ihre kulturellen Muster) gegen vergleichbare auenstehende Eliten verteidigen will und muss. Der Grad der horizontalen Harmonisierung zwischen den Regionalsprachen (oder den regionalen Eliten) und der vertikalen Harmonisierung zwischen Zentrum und sozialen Peripherien hngt von der spezifischen historischen Konstellation jedes Landes ab.
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
Dieser sprachliche Prozess der Normalisierung wird immer von der Durchsetzung eines sozialen und kulturellen Habitus begleitet, was die Satzung der franzsischen Akademie illustriert (Hervorheb. von E.E.): Statute und Bestimmungen der Acadmie franaise (22. Februar 1635) XXII Die politischen und moralischen Angelegenheiten sind in der Akademie nur konform mit der Autoritt des Prinzen, der Verfassung der Regierung und den Gesetzen des Knigreichs zu behandeln. XXIII Zu beachten ist, dass in den Werken, die im Namen der Akademie oder eines Einzelnen in seiner Eigenschaft als Akademiker erscheinen, kein freidenkerischer oder unanstndiger Begriff Verwendung findet und keiner, der missverstndlich oder falsch interpretierbar ist. XXIV Die wesentliche Aufgabe der Akademie besteht darin, mit aller mglichen Sorge und Sorgfalt daran zu arbeiten, unserer Sprache klare Regeln zu geben und sie rein, eloquent und fhig werden zu lassen, die Knste und Wissenschaften zu behandeln. XXV Die besten Autoren der franzsischen Sprache werden in der Akademie verteilt, um Redewendungen ebenso wie Stze, die als allgemeingltige Regeln dienen knnen, in Augenschein zu nehmen und der Gesellschaft darber Bericht zu erstatten, die ber ihre Arbeit richten und sich in den zutreffenden Fllen ihrer bedienen wird. XXVI Entsprechend der Beobachtungen der Akademie werden ein Wrterbuch, eine Grammatik, eine Rhetorik und eine Poetik erstellt. Freilich: Die franzsische Akademie hat keine Grammatik, Rhetorik oder Poetik verffentlicht. Ihr Wrterbuch hat erst im Jahre 1694 am Ende des 17. Jahrhunderts das Tageslicht erblickt. Was nicht ausschliet, dass dieses Jahrhundert, das Zeitalter der franzsischen Klassik, eine gewaltige Produktion grammatikalischer, poetischer und besonders rhetorischer Abhandlungen erfahren hat, von denen ich nur Vaugelas Abhandlung <Bemerkungen ber die franzsische Sprache> (Remarques sur la langue franoise) (1647), Bernard Lamys Rhetorik <Von der Kunst des Sprechens> (De lart de parler) (1676) und Dominique Bouhours <Die Unterhaltungen von Ariste und Eugne> (Les entretiens dAriste et dEugne) (1671) anfhre. Fr Vaugelas ist der richtige Sprachgebrauch die Art und Weise, wie der beste Teil des Hofes spricht, konform mit der Art und Weise, wie der beste Teil der zeitgenssischen Autoren schreibt. (le bon Usage est la faon de parler de la plus saine partie de la cour, conformment la faon dcrire de la plus saine partie des auteurs du temps 2 ) Diese Definition
2
Er fhrt fort: Wenn ich Hof sage, verstehe ich darunter Frauen wie Mnner und eine Reihe von Personen der Stadt, in der der Prinz wohnt, die durch die Kommunikation, die sie mit den Leuten vom Hof fhren, an deren feinem Benehmen teilhaben. Es ist gewiss, dass der Hof wie ein Magazin ist, aus dem unsere Sprache viele schne Begriffe entnimmt, um unsere Gedanken auszudrcken, und dass zudem weder die Beredsamkeit der Kanzel noch die vor Gericht ber die erforderlichen Qualitten verfgen wrde, wenn sie diese Qualitten nicht fast ausschlielich dem Hof entlehnen wrde. (Vaugelas 1647, Vorwort, 3) ( Quand je dis la Cour, jy comprends les femmes comme les hommes, et plusieurs personnes de la ville o le Prince rside, qui par la communication quelles ont avec les gens de la Cour participent sa politesse. Il est certain que la Cour est comme un magazine, do notre langue tire quantit de beaux termes pour exprimer nos penses, et que lEloquence de la chaire, ni du barreau naurait pas les grces quelle demande, si elle ne les empruntait presque toutes de la Cour. )
10
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
zeigt deutlich, dass die literarische franzsische Elite einen Kompromiss mit der hfischen und politischen Elite geschlossen hatte, ganz anders als dies bei der italienischen Elite derselben Epoche der Fall war. Ich habe Lamys Rhetorik <ber die Kunst des Sprechens> gewhlt, weil Lamy in seiner Abhandlung Wert darauf legt, dass Sprechen nicht nur Kommunizieren bedeutet, sondern auch, sich gut auszudrcken. Man drckt sich gut aus, wenn man Stil hat was eine gewisse Feinfhligkeit (dlicatesse) und die Scharfsinnigkeit des Geistes (justesse desprit) erfordert. Ein prziser Geist wei wohl zwischen dem, was gesagt werden muss und dem, worber man schweigen muss, zu unterscheiden. (fait le discernement de tout ce qui se doit dire et de ce qui doit se taire) (Lamy, Art de parler, 1676, 218f.). In sprachpolitischen Begriffen ausgedrckt markieren die Abhandlungen Vaugelas und Lamys den bergang von der Stufe der Standardisierung (policy planning) zur Stufe des stilistischen und rhetorischen Ausbaus (cultivation). Aber vergessen wir nicht, dass dieser Prozess mit einer Idealisierung der Sprache einhergeht. In der Tat haben alle Autoren des 17. Jahrhunderts, insbesondere Bouhours 3 , ihren Teil dazu beigetragen, die Vorstellung (oder genauer: den Mythos) vom Genie und der Vortrefflichkeit der Sprache zu verbreiten. All das luft darauf hinaus, dass die franzsische Volkssprache am Ende des 17. Jahrhunderts eine in jeder Hinsicht herausragende Sprache ist, die sogar das Lateinische bertrifft, weil sie auch fr die politische und literarische Elite des gesamten franzsischen Territoriums eine Nhesprache darstellt. Aber diese franzsische Spra-
Das Spanische sagt Bouhours, ist malos im Gebrauch seiner Metaphern. [] liebt leidenschaftlich die bertreibungen. [] Das Franzsische aber ist wie diese schnen Flsse, die alle Orte, an denen sie vorbeiflieen, bereichern; die, ohne weder schnell noch langsam zu sein, majesttisch das Wasser vor sich herschaukeln und die einen immer gleichmigen Lauf haben. (Lespagnol na nulle mesure en ses mtaphores. [...] aime passionnment lhyperbole. [] Mais la langue franaise est comme ces belles rivires, qui enrichissent tous les lieux par o elles passent; qui sans tre ni lentes, ni rapides roulent majestueusement leurs eaux, & ont un cours toujours gal. ) (Bouhours 1671, 56f.) Diese gesamte Bewegung fhrt ein Jahrhundert spter in Rivarols Diskurs ber die Universalitt der franzsischen Sprache (De luniversalit de la langue franaise) (1784) zum extremsten Ausdruck dieses Mythos. (vgl. hierzu auch Fumaroli, M., 1994, Le gnie de la langue franaise. In: Trois institutions littraires, Paris: Gallimard, 211-314, und die Kritik von Trabant, 2002). Diese Vorstellung findet sich im Vorwort des Wrterbuchs der Franzsischen Akademie (Dictionnaire de lAcadmie franaise) von 1835 wieder: Eine Sprache, das ist die uere und sichtbare Form des Geistes eines Volkes; und wenn zugleich zu viele diesem Volk fremdartige Vorstellungen in diese Form eindringen, so zerbrechen und zersetzen sie diese; und anstelle einer nationalen und charakteristischen Physiognomie findet man etwas Vages und Kosmopolitisches vor. (IX-X) Diese Vorstellung ist noch immer gegenwrtig (wenn auch in weniger nationalistischer Form). So lesen wir in einem Gesetzesvorschlag des Abgeordneten J. Myard zur Verteidigung der Sprache (2000): Die Sprache ist nicht nur ein Instrument der Kommunikation, sie ist auch eine Denkstruktur, ein spezifischer Modus der Reflexion und Aneignung der Wirklichkeit. In einer globalisierten Welt und gegenber der fortschreitenden Hegemonie des Angloamerikanischen gebhrt es also, den Gebrauch des Franzsischen, dessen soziale, kulturelle, aber auch wirtschaftliche Herausforderungen eng miteinander verzahnt sind, zu sichern und auszubauen. (La langue est non seulement un instrument de communication, elle est une structure de pense, un mode spcifique de rflexion et d'apprhension de la ralit. Dans un monde globalis, et face la progression hgmonique de l'anglo-amricain, il importe donc de sauvegarder et de dvelopper l'usage du franais dont les enjeux sociaux, culturels mais aussi conomiques sont troitement imbriqus.) (www.languefrancaise.net/ dossiers/dossiers.php? id_dossier=60 3/5/2006)
11
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
che des Ancien Rgime ist keine Nationalsprache, da sie nicht die Sprache des Volkes oder, genauer, der franzsischen Vlkerfamilie bildet. 6) Die Etablierung einer Schriftsprache als Nationalsprache verlangt die Existenz eines Nationalstaates. (19. Jahrhundert). Die ideologischen Grundlagen hierfr wurden whrend der Franzsischen Revolution und des romantischen Nationalismus geschaffen. Die Vorstellung, alle Brger eines Staates mssten dieselbe Sprache sprechen, entstammt der Franzsischen Revolution; die Vorstellung, jedes Volk, das sich auf den nationalistischen Topos berufen kann, habe dadurch zugleich das Recht, sich als Staat zu konstituieren, hat ihren Ursprung im romantischen Nationalismus. Frankreich, ein schon selbstndiger Staat, hatte im Laufe des 19. Jahrhunderts eine nationale Ideologie entwickelt; in Italien wie in Deutschland wurde die Schaffung eines Staates durch die nationale Ideologie legitimiert. Das Deutsche Reich wurde 1871 gegrndet, also zehn Jahre nach dem italienischen Staat. Vereinfachend kann man also sagen, dass Deutschland und Italien Frankreich eingeholt haben, dessen Staatsbildung sich bereits im 16. und 17. Jahrhundert vollzogen hatte. Daraus folgt, dass sich die drei Nationalstaaten vor demselben Problem befanden: Sie sehen sich mit einer kulturellen und sprachlichen Vielfalt konfrontiert, gleichermaen auf diatopischer und regionaler Ebene wie im diastratischen und sozialen Bereich. Aber was am schlimmsten ist: In all diesen Nationalstaaten spricht die berwiegende Mehrheit der Brger im 19. Jahrhundert noch nicht die jeweilige Nationalsprache. 7) Dies erklrt, dass alle modernen Nationalstaaten auf diesen Tatbestand durch die Schaffung von Volksschulen als Transmissionsriemen reagieren, um die elaborierte Nationalsprache als geschriebene, gesprochene und von allen Brgern akzeptierte Standardsprache zu etablieren (Durchsetzung oder Harmonisierung von oben). Dieser Etablierungsprozess der Nationalsprachen wird von einem mehr oder minder starken Willen nach Auslschung der Regionalsprachen oder der patois, d.h. der Mundarten, begleitet. In Frankreich wird dieser Wille zur Staatsdoktrin, in Italien manifestiert er sich in Ermangelung einer zentralisierten und wirkungsvollen Verwaltung wesentlich schwcher, whrend der deutsche Staat, mit starken und vergleichsweise autonomen Regionen konfrontiert, dagegen mehr auf Prozesse sozialer Ausdifferenzierung setzt. Man muss freilich anmerken, dass die III. Republik diese Doktrin auf die berseeischen kolonisierten Vlker anwendet, um die territoriale Ausdehnung Frankreichs zu untermauern. Wie dem auch sei: Keiner dieser Varianten gelingt es, die Nationalsprachen in den Kpfen und Herzen der Franzosen, der Italiener und der Deutschen zu etablieren. Wie in Italien geschieht diese Etablierung erst durch Prozesse der Konzentrierung, Globalisierung und der Nivellierung von Unterschieden. Diese sind:
8) Industrialisierung und Urbanisierung, Militrdienst und vor allem Massenmedien (Presse, Radio, Kino, Fernsehen, Internet) Die wichtigsten Faktoren, die dazu beitragen, Nationalsprachen im Habitus der Menschen zu verankern, sind m.E. die Mediatisierung von Kommunikation und die
12
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
Aufhebung des Gegensatzes zwischen Stadt und Land. Letztere ist auch dem Aufkommen des Kapitalismus in der Landwirtschaft zuzuschreiben. Somit schliet sich der Kreis auch auf konomischer Ebene: Die Geburt der europischen Nationalsprachen geht einher mit der Herausbildung des Handels- und Finanzkapitalismus, die endgltige Etablierung der herausragenden Volkssprachen wird von der Durchsetzung des Kapitalismus in allen wirtschaftlichen Sektoren begleitet. Daraus gehen Nationalstaaten hervor, die jedoch durch die Globalisierung des internationalen Finanzkapitals tendenziell aufzubrechen scheinen und das nicht nur auf wirtschaftlicher und politischer Ebene, sondern vor allem im kulturellen und sprachlichen Bereich.
Das Deutsche ein Sonderfall?
Gngigerweise stellt man zwei Arten von Nationen gegenber: Die voluntaristische oder vertragliche (wie Frankreich) und die kommunitre oder kulturelle (mit Deutschland assoziiert). Auf sprachlicher Ebene wre die logische Konsequenz, dass es sich beim Franzsischen um eine knstliche Sprache handelt, die mit dem Deutschen als natrliche Sprache kontrastiert. Man knnte leicht zeigen, dass die franzsische III. Republik wie auch die anderen Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts einen evolutionistischen und kommunitren, kurz: romantischen Nationalismus propagiert haben. 4 Ebenso ist die Vorstellung, beim Deutschen handele es sich um eine natrliche Muttersprache, nicht gerechtfertigt. Um dies zu zeigen, gengt es, die groen Entwicklungsstufen der Etablierung des Hochdeutschen kurz zu umreien: 1) 16. Jahrhundert. Auswahl und Etablierung eines geschriebenen Dialekts. Den Ausgangspunkt markiert einerseits eine Verwaltungssprache, nmlich die der Kanzleien des Oberschsischen (besonders von Meissen), die auf dem Ostmitteldeutschen (Obersachsen, Thringen, Schlesien und ein Teil Bhmens) basieren, und andererseits die bersetzung der Bibel (1534) durch Martin Luther (Ich rede nach der Sechsischen Cantzelei, welcher nachfolgen alle Frsten und Knige in Deutschland. [] die gemeinste deutsche Sprache.). Sein Erfolg lsst sich auch dadurch erklren, dass er Elemente der gesprochenen Sprache in seine Texte integriert (dem Volk aufs Maul schauen). 2) 1650-1750. Phase der Kodifizierung und Ausarbeitung der Schriftsprache. Wie in Italien und Frankreich entstehen Akademien oder Sprachgesellschaften. Die wichtigste ist die Fruchtbringende Gesellschaft (lat. societas fructifera) (1617), die einen kulturellen Patriotismus propagiert. Die dominierende Elite setzt sich aus Beamten, Professoren, Schriftstellern und Priestern (insbesondere der evangelischen Kirche (Luther)) zusammen was Deutschland klar von Italien
4
Vgl. z.B. die Definition der Nation durch Renan: Eine Nation ist eine Seele, ein spirituelles Prinzip. [] Es ist die Vollendung einer langen Vergangenheit voller Anstrengungen, Opfer und Hingabe. Gemeinsamen Ruhm in der Vergangenheit erlangt zu haben, einen gemeinsamen Willen in der Gegenwart zu besitzen und groe Dinge miteinander erlebt zu haben und weiter erleben zu wollen, das sind die wesentlichen Bedingungen, um ein Volk zu sein. (Une nation est une me, un principe spirituel [...]. Cest laboutissement dun long pass defforts, de sacrifices et de dvouements. Avoir des gloires communes dans le pass, une volont commune dans le prsent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voil les conditions essentielles pour tre un peuple.) (E. Renan, Quest-ce quune nation?, 1982)
13
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
und Frankreich unterscheidet. Was die grammatische Kodifizierung betrifft, kann man zwei Tendenzen unterscheiden: a) die analogisierende und berdialektale Haltung die beste Grundform ist die, welche jeweils durch Analogie ausgehend von allen Dialekten (re)konstruiert wird (Justus Georg Schottel (1663)); b) die Tendenz, nach der der tatschliche Sprachgebrauch die Referenznorm bildet (Christian Gueintz (1592-1650)). Diese zweite Tendenz sollte sich durchsetzen. In Anbetracht des polyzentrischen Aufbaus Deutschlands besteht die Notwendigkeit, die Dialekte anzugleichen und Kompromisse zwischen den Eliten des Sdes und besonders denen des Sdwestens (alemannische Dialekte) zu finden (horizontale Harmonisierung (diatopisch)). Die poetische Verschnerung ist hauptschlich Martin Opitz (1597-1639), Friedrich von Logau, Paul Fleming, Philipp von Zesen und Andreas Gryphius (1618-1664) zuzuschreiben. Der ungefhre Anteil der Analphabeten betrgt (bis in die zweite Hlfte des 18. Jahrhunderts) 95%. 3) 1750-1800. Phase der abschlieenden Normalisierung. Die sddeutschen Gebiete erkennen endlich die vorherrschende Schriftsprache auf der Grundlage der Leitlinien von Johann Christoph Gottschedt (1748) an. Whrend dieses Prozesses spielen die Abhandlungen von Christoph Adelung (1781/1785) ber die Grammatik, die Rechtschreibung und den deutschen Stil eine entscheidende Rolle. Erst ab 1800 kann man von der Existenz einer vereinheitlichten deutschen Schriftsprache sprechen (das Hochdeutsche). 4) Ab 1800. Etablierung der Schriftsprache als Standardsprache fr alle Deutschen. Da diese standardisierte Sprache nicht von der Mehrheit der Deutschen gesprochen wird, muss man sie in allen Regionen und in allen sozialen Schichten des Volkes (vertikale Harmonisierung oder akzeptierte Durchsetzung) verbreiten. Diese Vorgehensweise wird wie in Italien und Frankreich von der nationalen politischen Bewegung getragen, verstrkt durch die Grndung des deutschen Nationalstaates (1871) und untersttzt durch die Volksschule. Die Kodifizierung und Vereinheitlichung der Orthographie werden durch Konrad Dudens <Vollstndiges orthographisches Wrterbuch der deutschen Sprache> (1880) und die <Zweite orthographische Konferenz> (1901/02) vollendet. 1903 wird das <Amtliche Wrterverzeichnis fr die deutsche Rechtschreibung zum Gebrauch in den preuischen Kanzleien> verffentlicht, welches 1907 fr den schulischen Unterricht in ganz Deutschland obligatorisch wird. Der <Duden> ist auch heute noch die Referenznorm. Der <Groe Duden> (Rechtschreibung, Grammatik, etymologisches Wrterbuch, Synonymwrterbuch etc.) umfasst neun Bnde. Alphabetisierungsrate: erste Hlfte des 19. Jahrhunderts: 35 % - Ende des 19. Jahrhunderts: 90%. 5) 20. Jahrhundert. Abschlieende Durchsetzung der Schriftsprache. Industrialisierung und Urbanisierung, Militrdienst, Massenmedien (Presse, Radio, Kino, Fernsehen und gegenwrtig das Internet) 6) 2006: die groe Mehrheit der Deutschen erkennt im Groen und Ganzen das Hochdeutsche als Standardsprache und Nationalsprache an und beherrscht es. Aber Deutschland bleibt auf Grund seiner spezifischen Geschichte der Entste-
14
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
hung des Deutschen ein Land mit einer groen Anzahl an regionalen Varietten, die gleichwohl weithin toleriert werden, im Unterschied zur Lage in Frankreich.
Die wesentlichen Faktoren der Etablierung einer Nationalsprache
Diese Gegebenheiten erlauben mir, die wesentlichen Faktoren der Etablierung einer Nationalsprache in Vergangenheit und Zukunft herauszustellen: Eine Epoche des Umbruchs Der Ausgangspunkt ist ein Dialekt, der zunchst als Nhesprache fungiert. Dieser Dialekt muss ber einen solchen Grad schriftlicher Elaboriertheit verfgen, dass die Distanz-Kommunikation auf einem Exzellenz-Gebiet mglich wird (insbesondere im politisch-administrativen und im literarischen Bereich). Diese Ausarbeitung setzt stets eine Elite voraus, die im Besitz dieser herausragenden Sprache ist und fr die der Gebrauch dieser Exzellenz-Sprache zugleich ein Mittel ihrer sozialen Distinktion und Hegemonie ist. Die historische Dominanz einer dieser Domnen hngt von der spezifischen Konstellation eines Landes ab. Die Herausbildung einer gemeinsamen Sprache, die in den ExzellenzDomnen fungiert, wird immer von einer Kodifizierung, Normalisierung und Standardisierung begleitet und verstrkt. Dieser Vorgang luft im Groen und Ganzen immer gleich ab: Zunchst wird die Rechtschreibung vereinheitlicht, dann werden Grammatik und Wortschatz normalisiert. Anfangs sind die Grammatiken didaktisch und normativ gehalten, die von allgemeinen und philosophischen Grammatiken abgelst werden, die zugleich auch zeigen wollen, dass die fragliche Sprache Zugang zur Universalitt hat. Diese Standardisierung umfasst notwendigerweise den Ausbau in Rhetorik und Stil, das heit, die Standardisierung von Redestilen und Texttypen. Kodifizierung und Normalisierung werden immer durch die Grndung von Akademien, in denen die Elite sich institutionalisiert, verstrkt. Dies erklrt, dass die Akademien per definitionem puristisch sind, da die herrschende Elite ihren sozialen Habitus gegen vergleichbare auenstehende Eliten verteidigen will und muss. Der Grad der horizontalen Harmonisierung zwischen den Regionalsprachen (oder den regionalen Eliten) und der vertikalen Harmonisierung zwischen Zentrum und sozialen Peripherien hngt von der spezifischen historischen Konstellation jedes Landes ab. Die Etablierung einer Schriftsprache als Nationalsprache verlangt die Existenz eines Nationalstaates. Ohne die Volksschule als Transmissionsriemen kann sich diese Nationalsprache nicht als geschriebene, gesprochene und von allen Brgern akzeptierte Standardsprache stabilisieren (Durchsetzung oder Harmonisierung von oben). Die fortschreitende und endgltige Standardisierung ist letztlich der Existenz nationaler Kommunikationsbereiche zu verdanken (Verwaltung, nationale Institutionen und vor allem Massenmedien).
15
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
Bibliographie
Apel, K.-O., 31980, Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante bis Vico. Bonn: Bouvier. Eggs, E., Grammatik. In : Historisches Wrterbuch der Rhetorik III, hg. v. G. Ueding, Tbingen : Niemeyer, 1030-1112. Koch, P. / Oesterreicher, W., 1990, Gesprochene Sprache in der Romania: Franzsisch, Italienisch, Spanisch. Tbingen: Niemeyer.
Deutsche Sprache
Besch, W. et al. (Hg.), 21998, Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Berlin, New York: de Gruyter. Elspa, S., 2004, Standardisierung des Deutschen. Ansichten aus der neueren Sprachgeschichte von unten. In: Eichinger, L. M./ Kallmeyer, W., (Hg.), Standardvariation: Wie viel Variation vertrgt die deutsche Sprache? Berlin, New York: de Gruyter. Elspa, S., 2005, Sprachgeschichte von unten. Untersuchungen zum geschriebenen Alltagsdeutsch im 19. Jahrhundert. Tbingen: Niemeyer. Gardt, A. et al., 1995, Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen. Tbingen: Niemeyer. Lenz, Alexandra N. / Mattheier, Klaus J. (Hg.), Varietten Theorie und Empirie. Frankfurt/M.: Lang. Luther, M., 1530, Ein Sendbrieff / von Dolmetschen / vnd Frbitte der Heiligen. D. Mart. Luther. Wittenberg (Hg. K. Bischoff, Halle/Saale 1951). Polenz, P. von, 1994-2000, Deutsche Sprachgeschichte vom Sptmittelalter bis zur Gegenwart, 3 Bde., Berlin: de Gruyter. Scharloth, J., 2003, Deutsche Sprache, deutsche Sitten. Die Sprachkonzeption von J. M. R. Lenz im Kontext der Sprachnormdebatte des 18. Jahrhunderts. In: Lenz-Jahrbuch 12, 89-118 (disponible www.ds.unizh.ch/ scharoth/publikationen/scharloth_lenz.pdf). Schmidt, W. 82000, Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch fr das germanistische Studium. Stuttgart/Leipzig: Hirzel.
Franzsische Sprache
Balibar, R., 1993, Le colinguisme. Paris: PUF. Bouhours, D., 1671, Les entretiens dAriste et dEugne, Amsterdam (neue Ed. Paris: Honor Champion, 2003). Caput, J.-P., La langue franaise. Histoire d'une institution. 2 tomes, Paris, 1972-1975. Certeau, M. de u.a., 1975, Une politique de la langue. Paris: Gallimard (Ed. 2002). Collinot, A. / Mazire, F. (Hg.), 1999, Le franais lcole. Un enjeu historique et politique. Paris: Hatier. Droixhe, D. / Dutilleul, T., 1990, Franzsisch: Externe Sprachgeschichte. Histoire externe de la langue. In: Holtus, G. u.a. (Hg.), Lexikon der Romanistischen Linguistik V, 1: Franzsisch. Tbingen: Niemeyer 437-471. Fumaroli, M., 1994, Le gnie de la langue franaise. In : Trois institutions litteraires, Paris : Gallimard, 211-314. Hagge, C., 1996, Le franais, histoire d'un combat. Boulogne-Billancourt, 1996. Lamy, B., 1676, De l'art de parler. Paris: Pralard. Renan, E., 1882, Qu'est-ce qu'une nation ? In: uvres compltes. Ed. H. Psichari, tome 1, Paris: Callmann-Lvy 1947, 887-906. Rivarol, A. de, 1784, Discours sur l'universalit de la langue franaise. Hg. v. H. Juin, Paris 1966. Settekorn, W., 1988, Sprachnorm und Sprachnormierung in Frankreich. Tbingen : Niemeyer. Trabant, J., 2002, Ursprung und Genie der Sprache: Condillac, Herder und die Folgen. In: Der gallische Herkules. Tbingen/Basel: Francke, 145-165. Vaugelas, C. F. de, 1647, Remarques sur la langue franaise. Paris (Ed. Paris 1981). Voltaire, 1763, Trait sur la tolrence (http://un2sg4.unige.ch/athena/voltaire/volt_tol.html).
16
Die Macht der Sprache
Ekkehard Eggs
Italienische Sprache
Berruto, G., 1991, Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo. Roma: La Nuova Italia Scientifica. Dante Alighieri, 1304, De vulgari eloquentia. In: Opere minore II, Milano/Napoli: R. Ricciardi, 3-237. Dante Alighieri , 1988, Convivio. In: Opere minore I, tome II. Milano/Napoli: R. Ricciardi. Devoto, G. / Giacomelli, G., 2002, I dialetti delle regioni dItalia, Milano: Bompiani. Geckeler, H. / Kattenbusch, D., 21992, Einfhrung in die italienische Sprachwissenschaft. Tbingen: Niemeyer. Manzoni, A., 1972, Scritti linguistici, Milano: Ed. Paoline. Marazzini, C. 1994, La lingua italiana: profilo storico. Bologna: Il Mulino.
Marazzini, C., 1999, Da Dante alla lingua selvaggia. Sette secoli di dibattiti sull'italiano, Roma.
Mazzacurati, G., 1965, La Questione della lingua dal Bembo all'Accademia fiorentina. Napoli: Liguor. Mauro, T. de, 1999, Storia linguistica dellItalia unita. Roma/Bari: Laterza, Michel, A., 2005, Italienische Sprachgeschichte. Hamburg: Kovac. Serianni, L. / Trifone, P. (Hg..) 1993/94, Storia della lingua italiana. 3 Bde., Torino: Einaudi. Sobrero, A.A. (Hg.), 1993, Introduzione allitaliano contemporaneo, Roma/Bari: Laterza. Vitale, M., 61978, La Questione della lingua italiana. Palermo: Palumba.
17
Das könnte Ihnen auch gefallen
- PetrovaDokument32 SeitenPetrovaNouhaila MedNoch keine Bewertungen
- Staatsnation KulturnationDokument1 SeiteStaatsnation Kulturnationa12534832100% (1)
- Text Lektion 13Dokument2 SeitenText Lektion 13Rui QinNoch keine Bewertungen
- Meine MasterarbeitDokument16 SeitenMeine MasterarbeitSouad Kara100% (1)
- Jnrgen Trabant-Was Ist Sprache - Beck C. H. (2008) PDFDokument321 SeitenJnrgen Trabant-Was Ist Sprache - Beck C. H. (2008) PDFAndrés Miguel Blumenbach100% (2)
- 2 - TextualitätDokument41 Seiten2 - TextualitätLuminita PopaNoch keine Bewertungen
- CP VP StrukturDokument49 SeitenCP VP Struktursven yangNoch keine Bewertungen
- Ammon Belgrad Nationale VariätetenDokument16 SeitenAmmon Belgrad Nationale VariätetenMareNoch keine Bewertungen
- SprachnotDokument4 SeitenSprachnotDiego HDZ100% (1)
- Rumaniche Sprache RomaniaDokument16 SeitenRumaniche Sprache RomaniaCristian AiojoaeiNoch keine Bewertungen
- Sprachgeschichte. Prüfungsfragen CoDokument2 SeitenSprachgeschichte. Prüfungsfragen CoНастя КузикNoch keine Bewertungen
- Internationalismen Im B/K/S (Proseminararbeit)Dokument14 SeitenInternationalismen Im B/K/S (Proseminararbeit)Aiko NadaNoch keine Bewertungen
- CH 8 SoziolinguistikDokument15 SeitenCH 8 SoziolinguistikSournouma DahNoch keine Bewertungen
- DialektenDokument2 SeitenDialektenЕлизавета СахноNoch keine Bewertungen
- 2012 Die Valenz in Der Zweisprachigen L PDFDokument10 Seiten2012 Die Valenz in Der Zweisprachigen L PDFMilenaNoch keine Bewertungen
- Latein-Lernzettel - KopieDokument13 SeitenLatein-Lernzettel - Kopieleon waßmusNoch keine Bewertungen
- Klemm Textbegriff AusgangspunkteDokument10 SeitenKlemm Textbegriff AusgangspunktekleervoyansNoch keine Bewertungen
- Niedersächsisch Und NiederdeutschDokument9 SeitenNiedersächsisch Und Niederdeutschissa_bella90Noch keine Bewertungen
- Bedeutung Und Sprache PDFDokument24 SeitenBedeutung Und Sprache PDFkarimane98Noch keine Bewertungen
- Bub GB 2colaaaaiaajDokument379 SeitenBub GB 2colaaaaiaajAntonia López Vicente100% (1)
- Jakobson PoetikDokument20 SeitenJakobson Poetikpawlik1100% (1)
- 646195.velimir Petrovi. Einfhrung in Die Linguistik FR Germanisten. Ein ArbeitsbuchDokument207 Seiten646195.velimir Petrovi. Einfhrung in Die Linguistik FR Germanisten. Ein ArbeitsbuchLamijaNoch keine Bewertungen
- Agamben - Homo - SacerDokument95 SeitenAgamben - Homo - SacerAndrea Alvarez LemarchandNoch keine Bewertungen
- Karl-Heinz Stierle - Gespräch Und Diskurs. Ein Versuch Im Blick Auf Montaigne, Descartes Und PascalDokument20 SeitenKarl-Heinz Stierle - Gespräch Und Diskurs. Ein Versuch Im Blick Auf Montaigne, Descartes Und PascalcohenmaNoch keine Bewertungen
- Heyne, Stamm. Ulfilas Oder, Die Uns Erhaltenen Denkmäler Der Gothischen Sprache Text, Grammatik Und Wörterbuch. 1865.Dokument410 SeitenHeyne, Stamm. Ulfilas Oder, Die Uns Erhaltenen Denkmäler Der Gothischen Sprache Text, Grammatik Und Wörterbuch. 1865.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNoch keine Bewertungen
- Rätoromanische SpracheDokument20 SeitenRätoromanische SpracheMetaleiroNoch keine Bewertungen
- Vongehr, Sprache Und Stil in HusserlDokument16 SeitenVongehr, Sprache Und Stil in Husserlsirjan84Noch keine Bewertungen
- PPP - Einführung in Die Sprachgeschichte 06.04.2022Dokument62 SeitenPPP - Einführung in Die Sprachgeschichte 06.04.2022Heinz Conti ZacherlNoch keine Bewertungen
- Kategorie Der ZeitDokument2 SeitenKategorie Der ZeitAnastasia SulejmanovaNoch keine Bewertungen
- Generative PhonologieDokument34 SeitenGenerative PhonologieAlan MottaNoch keine Bewertungen
- jg1980 PDFDokument13 Seitenjg1980 PDFgippertNoch keine Bewertungen
- Konversationelle Und Konventionelle ImplikaturenDokument10 SeitenKonversationelle Und Konventionelle ImplikaturenLaura ConstantinescuNoch keine Bewertungen
- 1.sitzung Was Ist Medienlinguistik 2017Dokument154 Seiten1.sitzung Was Ist Medienlinguistik 2017halmekNoch keine Bewertungen
- Politische Sprache Und Populismus ÜberblickswissenDokument9 SeitenPolitische Sprache Und Populismus ÜberblickswissenHai Hoang DuNoch keine Bewertungen
- Michael S. Batts (HG.) - Das Nibelungenlied - Paralleldruck Der Handschriften A, B Und C Nebst Lesarten Der Übrigen Handschriften-Max Niemeyer Verlag (1971) PDFDokument912 SeitenMichael S. Batts (HG.) - Das Nibelungenlied - Paralleldruck Der Handschriften A, B Und C Nebst Lesarten Der Übrigen Handschriften-Max Niemeyer Verlag (1971) PDFAnonymous UgqVuppNoch keine Bewertungen
- Pomino HispanistikDokument343 SeitenPomino HispanistikAntonella VeronicaNoch keine Bewertungen
- (9783110296136 - Handbuch Sprache in Sozialen Gruppen) Handbuch Sprache in Sozialen GruppenDokument528 Seiten(9783110296136 - Handbuch Sprache in Sozialen Gruppen) Handbuch Sprache in Sozialen GruppenEdirne GermanistikNoch keine Bewertungen
- Kapitel 1. Das Wort Als Sprachliches ZeichenDokument8 SeitenKapitel 1. Das Wort Als Sprachliches Zeichenг ыNoch keine Bewertungen
- Merkmale Der JugendspracheDokument4 SeitenMerkmale Der JugendspracheAndrej RomanowNoch keine Bewertungen
- Grundlagen Der KontaktlinguistikDokument57 SeitenGrundlagen Der Kontaktlinguistikdongliang xuNoch keine Bewertungen
- L10 - Isekenmeier, Böhns, Schrey - Intertextualität Und Intermdialität - Berlin 2021Dokument264 SeitenL10 - Isekenmeier, Böhns, Schrey - Intertextualität Und Intermdialität - Berlin 2021Elida VrajolliNoch keine Bewertungen
- Gegenströmungen Zum NaturalismusDokument11 SeitenGegenströmungen Zum NaturalismusDaillaNoch keine Bewertungen
- I.2.c. SprachanthropologieDokument13 SeitenI.2.c. SprachanthropologieFrank JablonkaNoch keine Bewertungen
- (Studia Samaritana 1) Rudolf Macuch-Grammatik Des Samaritanischen Hebrà Isch-Walter de Gruyter (2012)Dokument618 Seiten(Studia Samaritana 1) Rudolf Macuch-Grammatik Des Samaritanischen Hebrà Isch-Walter de Gruyter (2012)JMárcio De Souza AndradeNoch keine Bewertungen
- W S - NikolaDokument54 SeitenW S - NikolaNevena FP MaksimovicNoch keine Bewertungen
- Martinet - Grundzüge Der Allgemeinen Sprachwissenschaft (Auszüge)Dokument5 SeitenMartinet - Grundzüge Der Allgemeinen Sprachwissenschaft (Auszüge)lorenzh_1Noch keine Bewertungen
- Beitraege Zur Germanistik PDFDokument199 SeitenBeitraege Zur Germanistik PDFElisaNoch keine Bewertungen
- Entstehung Der Deutschen SpracheDokument6 SeitenEntstehung Der Deutschen SpracheEx ZombieSchafNoch keine Bewertungen
- Textanalyse - FaktorenDokument2 SeitenTextanalyse - FaktorenSharanyaa KarthikNoch keine Bewertungen
- Rössler - Das Ägyptische Als Semitische SpracheDokument64 SeitenRössler - Das Ägyptische Als Semitische SpracheAllan BomhardNoch keine Bewertungen
- Goethe Uni SprachwissenschaftDokument60 SeitenGoethe Uni SprachwissenschaftYusuf Birsen KızakNoch keine Bewertungen
- 5 Theoretischer TeilDokument53 Seiten5 Theoretischer TeilKarl RoßmannNoch keine Bewertungen
- LautschuleDokument29 SeitenLautschulehugo20102009100% (1)
- Deutsche Mediensprache Und Ihre EigentümlichkeitenDokument7 SeitenDeutsche Mediensprache Und Ihre EigentümlichkeitenWalid AhmadNoch keine Bewertungen
- Bachelor ArbeitDokument52 SeitenBachelor ArbeitgoochkrNoch keine Bewertungen
- Begriffe Der SemiotikDokument14 SeitenBegriffe Der SemiotikAlienne V.Noch keine Bewertungen
- Mehrsprachigkeit und Bildungsgerechtigkeit: Erkundungen einer didaktischen PerspektiveVon EverandMehrsprachigkeit und Bildungsgerechtigkeit: Erkundungen einer didaktischen PerspektiveNoch keine Bewertungen
- Info Basiswissen LitWiss PDFDokument59 SeitenInfo Basiswissen LitWiss PDFDániel SzászNoch keine Bewertungen
- Kultur und Übersetzung: Studien zu einem begrifflichen VerhältnisVon EverandKultur und Übersetzung: Studien zu einem begrifflichen VerhältnisLavinia HellerNoch keine Bewertungen