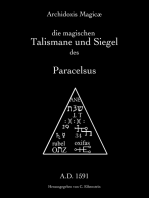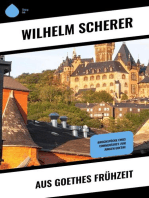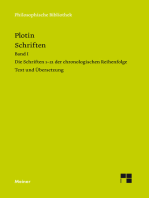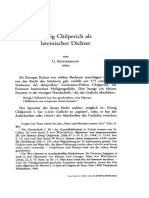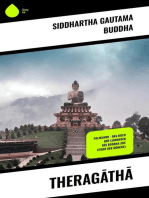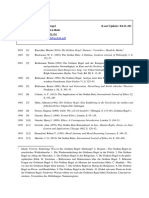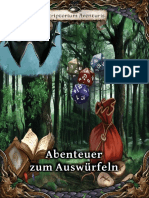Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Knecht - 1975 - Tempora Mutantur
Hochgeladen von
FritzWaltherCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Knecht - 1975 - Tempora Mutantur
Hochgeladen von
FritzWaltherCopyright:
Verfügbare Formate
Tempora mutantur
Von Theodor Knecht, Winterthur
Adalbert Stifter lsst seine Erzhlung Die drei Schmiede ihres Schicksals
mit einem Streit ber den Ursprung des altlateinisches Satzes beginnen, wo
nach jeder der Schmied seines Schicksals sei. Einige behauptetem sagt Stifter,
der Satz wre cht rmisch und stehe gewiss in diesem oder jenem Werke dieses
oder jenes Classikers; andere sagten, er sei ein neues Machwerk, und schleppe
sich erst seit kurzer Zeit durch unsere lateinischen Schulbcher. Dieser Streit
ist natrlich lngst in dem Sinne entschieden, dass tatschlich ein cht rmi
schen>, ein altlateinischer Satz vorliegt, denn nach Ps. Sall. Rep. I, 1,2 stammt
das Wort von Appius Claudius Caecus:
sed res docuit id verum esse, quod in
carminibus Appius ait, fabrum esse suae quemque fortunae. Strittig bleibt aller
dings, wie weit die Form der indirekten Rede dem ursprnglichen Wortlaut in
den Carmina des Appius entspricht. Teuffel und Baehrens gingen jedenfalls bei
ihren Versuchen, die Versform des Originals zu rekonstruierenl, davon aus,
dass der A. c.
I.fabrum esse suae quemquefortunae sich weder im
Umfang noch
in der Wortstellung mit der ursprnglichen Formulierung des Appius decke,
sondern nur das Wesentliche seiner Aussage wiederspiegle. Mit Bezug auf den
genauen Wortlaut haben also auch die andern bei Stifter in gewissem Sinne
recht, wenn sie behaupten,
Quilibet fortunae suae faber est
so das Motto der
Erzhlung - sei ein Schulspruch, ein ((Machwerk.
hnliche, allerdings erheblich schwierigere Fragen wirft ein anderer Schul
spruch auf, der bekannte mit den Worten
Tempora mutantur beginnende
Hexa
meter. Neueres Machwerk oder cht rmisch? Jedenfalls: der Schulvers ist
in zwei verschiedenen Fassungen im Umlauf, von denen jede eine bemerkens
werte Eigentmlichkeit aufweist. Die eine Fassung
(Tempora mutantur et nos
mutamur in illis) zeigt Krze vor der Penthemimeres, die andere (Tempora mu
tantur nos et mutamur in i/Iis) ein versptetes et. Dieses nachgestellte et lsst
sich zwar, wie andere eine Stelle
zu
spt2 stehende Konjunktionen, in der
klassischen Poesie von Horaz und Vergil an ziemlich oft nachweisen (z. B. Verg.
Ecl. 3, 89
Mellafluant illi,ferat et rubus asper amomum), whrend die metrisch
gedehnte Krze vor der Caesur bedeutend seltener auftritt. Immerhin finden
sich in Vergils Eklogen nicht weniger als fnf Beispiele, darunter zwei an sehr
bekannten Stellen: aus der ersten Ekloge Vers 38sq.
Tityrus hinc aberat. ipsae
te, Tityre, pinus, / ipsi te fontes, ipsa haec arbusta vocabant und aus der zehnten
1 A. Otto, Die Sprichwrter und sprichwrtlichen Redensarten der Rmer (Leipzig 1890)
Anm. zu Nr. 70 1.
2 F. Bmer in seinem Kommentar (Heidelberg 1969) zu Ov. Met. 2,89.
6 Museum Helveticum
82
Theodor Knecht
Ekloge der geflgelte - an unseren Schulvers im Bau anklingende - Vers 69:
Omnia vincit Amor: et nos cedamus Amori!3
Vom metrischen und stilistischen Standpunkt aus gesehen, knnten also
beide Fassungen des
Tempora mutantur
als cht rmisch gelten; allein die
Tatsache, dass zwei verschiedene Fassungen vorliegen und dass in beiden
Fassungen eine auffllige Naht die Vershlften zusammenhlt - im einen Fall
mit einer bekannten vergilischen Parallele -, lsst doch den Eindruck auf
kommen, als sei der Schulvers irgendwie zusammengesetzt oder einem Muster
nachgebildet worden.
Beide Fassungen des
chen Zeit
Tempora mutantur sind brigens ungefhr zur glei
erstmals bezeugt. Tempora mutantur nos et mutamur in iIIis steht z. B.
in den 1615 erschienenen Epigrammata des neulateinischen Dichters John
Owen; vor ihm soll der Vers bereits in einer Historical description of the Island
of Britaine von William Harrison gestanden haben, die 1577 gedruckt wurde4
Die andere Fassung mit
et nos taucht 1566 erstmals in den Proverbialia dicteria
des Andreas Gartnerus auf. Mit der Bemerkung, die Sentenz stamme von Kai
ser Lothar I. (795-855), war der Hexameter in der leicht abweichenden Form
Omnia mutantur nos et mutamur in iIIis unter den Dicta des
Matthias Borbonius
aufgefhrt, die in den 1612 verffentlichten Delitiae poetarum Germanorum
von Jan Gruter enthalten sind.
Als mgliche Quelle gibt Bchmann5 einen Vers aus einem sptantiken
Epos, aus der Johannis des Corippus, an. Corippus, dessen Text zahllose An
klnge an heidnische Dichter (vor allem an Vergil, Ovid und Lucan), aber auch
an christliche Schriftsteller und an die heiligen Schriften aufweist, fhrt im An
fang des siebentes Buches ein Gebet an, in dem nach einer drei Zeilen umfassen
den Anrede an den
Omnipotens genitor die beiden Verse
Tempora permutas nec tu mutaris in illis (7, 9 1)
Ordine cuncta novas nec tu renovaris ab ullo (7, 94)
stehen. Der Zusammenhang dieser Verse mit dem christlichen Schrifttum liegt
auf der Hand; die wichtigsten Parallelen, auf die in der Corippus-Literatur6 hin
gewiesen wird, sind etwa Vulg. Psalm. 10 1, 27sq. (Caeli)
ipsi peribunt, tu autem
permanes; et omnes sicut vestimentum veterascent. et sicut opertorium mutabis eos,
et mutabuntur; tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient; Vulgo Dan. 2, 21
Et ipse (Dominus) mutat tempora et aetates; Drac. Laud. dei 2, 587 Tempora
mutantur, te numquam tempora mutant und 3, 523sq. (Deus verus) qui saecula
mutat / nec mutant hunc saecla tamen7 Ob anderseits auch ein Zusammenhang
3 Die brigen drei Stellen: Ecl. 3, 97; 7, 23; 9, 66.
G. Bchmann, Geflgelte Worte (Berlin 1964) 653f.
Entsprechend z. B. auch K. BarteIs L. Huber, Veni, vidi, vici (Zrich 1966) 49.
Artikel Corippus in RE IV 1242.
Vergleiche ausserdem: Vulg. Mal. 3,6 Ego enim Dominus, et non mutor und Vulg. Jac.
4
5
6
7
1, 17 Descendens a Patre luminum, apud quem non est transmutatio nec vicissitudinis
obumbratio.
83
Tempora mutantur
zwischen Coripps Vers und unserem Schulvers besteht, ist eine Frage fr sich.
Wohl besticht auf den ersten Blick die weitgehende formale bereinstimmung,
und es fllt einem - wie Skutsch in seinem Coripp-Artikel8 - tatschlich schwer,
hier an einen Zufall zu glauben.
Aber man darf doch nicht bersehen, dass bei Coripp der betende Feld
herr, der seinen Gott anredet, genau das Gegenteil dessen ausspricht, was der
Schulvers von uns Menschen sagt. Bchmann denkt an zwei Mglichkeiten der
Erklrung: entweder sei der Schulvers bzw. das angebliche Wort Lothars in be
wusstem Gegensatz zu Coripp geprgt worden oder dann habe sich Coripp mit
seinem Vers gegen den Schulvers gewandt, der ((lteren Ursprungs sein, also
schon im
6.
Jh., zu Coripps Zeit, oder sogar schon vorher bestanden haben
knnte. Diese zweite Annahme - verallgemeinert in dem Sinne, dass christliche
Autoren unseren schon in der Sptantike umlaufenden Schulvers in Anlehnung
an Stellen der heiligen Schrift bewusst ins Gegenteil verkehrt haben - scheint
mir die wahrscheinlichere zu sein, nur schon deshalb, weil die erste Annahme
die Wirkung von Coripps Johannis doch wohl berschtzt. Damit aber stellt
sich gebieterisch die Frage nach der wirklichen Quelle und der Entstehungszeit
des Schulverses, ber die weder Skutsch noch Bchmann (noch andere Nach
schlagewerke) Auskunft geben.
Bevor man sich auf die Suche nach diesem Ursprung des
tur
Tempora mutan
macht, ist es vielleicht gut, sich in Erinnerung zu rufen, dass viele Schul
sprche und Schulverse ihre Form offensichtlich dem Bestreben verdanken,
einen Gedanken mglichst knapp und einprgsam auszudrcken oder grssere
Zusammenhnge auf einen mglichst einfachen und bndigen Nenner zu bringen.
Solche Schul sprche lassen sich hufig ohne Mhe auf entsprechend ausfJ,u
lichere, etwas weniger geraffte Sentenzen antiker Autoren zurckfhren und
sind in den einschlgigen Werken oft auch ausdrcklich als Kurzfassungen ohne Zeitangabe - mit aufgefhrt. Ein paar einfache Beispiele:
Dies diem docet: Publil. D 1 Discipulus est prioris posterior dies (Otto
Nr. 532); Docendo discimus: Sen. Epist. 7, 8 Homines, dum docent, discunt
(Otto Nr. 562); Multum, non multa: Plin. Epist. 7, 9, 15 Aiunt enim multum
legendum esse, non multa ( Otto Nr. 1159); QuaUs rex, taUs grex: Hier. Epist.
7, 5 Talisque si! rector, quales illi qui reguntur (Otto Nr. 1538); Si vis pacem,
para bellum: Veg. Mil. praef. 3 Qui desiderat pacem, praeparet bellum (Otto
Nr. 244); Vbi bene, ibi patria: Cic. Tusc. 5, 108 (Zitat aus Pacuvius) Patria est
ubicumque est bene (Otto Nr. 1356). In anderen Fllen liegt es nahe, an ein Zu
sammenwirken mehrerer Stellen zu denken. Whrend z. B. bei Multum, non
multa der Bezug auf die Pliniusstelle so schlagend ist, dass man die ebenfalls an
klingende Formulierung Quintilians (Inst. 10, 1, 59 Multa magis quam multorum
lectionejormanda mens) kaum als mitbeteiligt betrachten wird, drften z. B. bei
der Herausbildung des Wortes Dum spiro, spero ausser der Form, die Cicero
8 RE IV 1242.
84
Theodor Knecht
mitteilt (Att. 9, 10, 3
Aegroto, dum anima est, spes eSse dicitur), noch andere mit
gewirkt haben, so etwa Dum vivis, sperare deeet (Priap. 80, 9) oder Omnia
homini, dum vivit, speranda sunt (Sen. Epist. 70, 6). Ebenso scheint bei der Raf
fung der bekannten Aeneis-Stelle (4, 174sq.)
Fama malum, qua non aliud velocius ullum:
mobilitate viget viresque aequirit eundo
ein Vers aus der Blitzbeschreibung des Lukrez mit im Spiel gewesen zu sein
(6,
340sq.):
Denique quod longo venit impete, sumere debet
mobilitatem etiam atque etiam, quae erescit eundo.
Jedenfalls lautet der Schulspruch, gerafft, Fama crescit eundo.
Als aufschlussreich und beziehungsreich erweist sich in diesem Zusam
menhang der lteste Beleg fr den Spruch
Bis dat, qui cito dat. Er findet sich in
den 1500 erstmals verffentlichten Adagia des Erasmus (I, 8, 91): Memini, nisi
fallor, apud Seneeam alicubi legere Bis dat, qui cito dat. Falls Erasmus
sich nicht getuscht hat, meint er wohl den Anfang des zweiten Buches
von Senecas De beneficiis. Dort fhrt Seneca im ersten und zweiten Kapitel
breit aus, was kurz und bndig
Bis dat, qui cito dat heisst: Sie demus, quomodo
vellemus aeeipere. ante omnia libenter, cito, sine ulla dubitatione ... melius oecu
pare antequam rogemur, quia cum homini probo ad rogandum os eoncurrat et
sujJundatur rubor, qui hoc tormentum remittit, multiplieat munus suum ... si
praesto fuit (beneficium), si proximam quamque horam non perdidit, multum sibi
adieit. Sollte Erasmus sich aber im Autor getuscht haben, so betrifft seine Er
innerung wohl einen Vers (I 6) des Publilius Syrus, dessen Sentenzen er 1514
selbst herausgegeben und kommentiert hat (Inopi beneficium bis dat, qui dat
eeleriter). Bis dat, qui cito dat ist aber auf jeden Fall krzer und knapper gefasst
als beides, was Erasmus - vielleicht zugleich - vorgeschwebt hat.
Wenn wir nun, von den genannten Beispielen ausgehend, eine krzere
oder lngere Textpartie suchen, aus der unser
Tempora mutantur das
Wesent
liche zusammenfasst und aus dem es zugleich seine wesentlichen Wort-Elemente
geschpft hat, so kommen wie vielleicht zum Ziel. Denn ein einzelner Vers oder
ein einzelner Spruch, mit dem
Tempora mutantur zwingend
verknpft werden
knnte, hat sich bis jetzt nicht gefunden. Stellen wie Lucr. 5, 83 1sq.
(Omnia
(Omnia
migrant, omnia eommutat natura et vertere eogit) oder Manil. 1, 5 15
mortali mutantur lege ereata) liegen in der Formulierung doch zu weit ab.
lngere Textpartie aber, aus der sich - hnlich wie Bis dat, qui eito dat
Die
aus
Senecas De beneficiis - unser Schulvers fast Wort fr Wort zusammensetzen
lsst und die durch unsern Vers auch einprgsam zusammengefasst wird, steht
im 15. Buch der Metamorphosen, in dem Ovid eine philosophische Grundlage
fr die von ihm erzhlten Verwandlungssagen bietet. In der mehr als 400 Verse
umfassenden Darstellung der pythagoreischen Lehre, die Knig Numa vorge
tragen wird, liest man die folgenden, fr unsere Frage bedeutsamen Verse:
85
Tempora mutantur
Ov. Met. 15, 165
179ss.
214ss.
454ss.
O m n i a m u t a n t u r , nihil interit ...
Ipsa quoque assiduo labuntur t e m p o r a motu,
non secus ac flumen; neque enim consistere flumen
nec levis hora potest, sed ut unda impellitur unda
urgeturque eadem veniens urgetque priorem
t e m p o r a s i c fug i u n t pariter pariterque sequuntur
et nova sunt sem per.
N o s t r a q u o q u e ipsorum semper requieque sine uUa
c o r p o r a v e r t u nt u r, nec, quodfuimusve sumusve,
cras erimus.
Caelum et quodcumque sub i/lo est
immutatformas tellusque et quidquid in i l l a e s t ,
n o s q u o q u e , pars mundi, quoniam non corpora solum,
verum etiam volucres animae sumus ...
Ist es khn anzunehmen, dass auf Grund dieser Darstellung ein Anonymus,
rhetor oder grammaticus, zur kurzen, einfachen Charakterisierung der hier als
pythagoreisch vorgetragenen Lehre unseren Vers 'geschaffen' hat - so wie andere
die Lehre Heraklits in lIa:llm eei oder Benedikts Regel in
Ora et labora zu fassen
suchten - und dass ein Dracontius, ein Corippus diesen Merkvers mit Bezug
auf den christlichen Gott ins Gegenteil verkehrten? Als ursprngliche Fassung
wre wohl (in Anlehnung an Ov. Met. 15, 214
quoque ...)
die Formulierung mit
diesem Fall von der Mglichkeit
Nostra quoque ... und 456 Nos
nos et anzusetzen; unser Anonymus htte in
Gebrauch gemacht, quoque 'bequem' mit dem
'verspteten'
et wiederzugeben. Nachtrglich wre dann - vielleicht in Anleh
die
nung an Verg. Ecl. 10, 69 (Omnia vincit Amor: et nos cedamus Amori!)
Nahtstelle mit nos et in et lios umgewandelt worden. Also Wandlung ber
Wandlung, Krzungen, Vereinfachungen! Aber eben: Omnia mutantur ... 9
-
9 Die einzigen Hinweise, die sich mit der hier versuchten Herleitung des Schulverses be
rhren, habe ich bei Carl Weyman, Zu den Sprichwrtern und sprichwrtlichen Redens
arten der Rmer Uetzt nachgedruckt in R. Hussler, Nachtrge zu A. Olto Sprichwrter
und sprichwrtliche Redensarten der Rmer, Darmstadt 1968) und bei H. G. Reichert,
Urban und Human (Hamburg 1956) gefunden. Weyman weist S. 257 darauf hin, man
gebe unseren Schulvers als ovidisch aus, doch sei er bei Ovid nicht zu finden. Reichert
ussert sich im Kapitel Von der Zeit, das brigens recht vieles unklar lsst, zu Ov. Met.
15, 165 (Omnia mutantur, nihil interit) folgendermassen: Es ist sehr wahrscheinlich,
dass aus dieser Stelle unser tempora mutantur sich herleitet, weil man sie grndlich
missverstand (!).
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Opelt 1962 (RAC) - EpitomeDokument8 SeitenOpelt 1962 (RAC) - EpitomeVincenzodamianiNoch keine Bewertungen
- Lateinische PhrasenDokument314 SeitenLateinische Phrasenantonius133100% (2)
- CL Schumann Sie Liebten Sich BeideDokument2 SeitenCL Schumann Sie Liebten Sich BeideGeorges CrepeNoch keine Bewertungen
- Harald Weinrich - Knappe Zeit - Kunst Und Ökonomie Des Befristeten Lebens - TEXT PDFDokument29 SeitenHarald Weinrich - Knappe Zeit - Kunst Und Ökonomie Des Befristeten Lebens - TEXT PDFBojanNoch keine Bewertungen
- Handout EssayDokument2 SeitenHandout EssayFritzWaltherNoch keine Bewertungen
- Hierocles Der Stoiker - R. PhilippsonDokument18 SeitenHierocles Der Stoiker - R. PhilippsonGabriel Gómez FrancoNoch keine Bewertungen
- Brandenburger Müller Klijn ApokalypsepdfDokument140 SeitenBrandenburger Müller Klijn ApokalypsepdfacapboscqNoch keine Bewertungen
- Kruse, Zwei Geist-Epiklesen Der Syrischen ThomasaktenDokument11 SeitenKruse, Zwei Geist-Epiklesen Der Syrischen ThomasaktenA TNoch keine Bewertungen
- Lepsius - Das Todtenbuch Der Ägypter 1842Dokument102 SeitenLepsius - Das Todtenbuch Der Ägypter 1842cfc77lux100% (1)
- J. Wackernagel, Review of J.P. Postgate, A Short Guide To The Accentuation of Ancient GreekDokument12 SeitenJ. Wackernagel, Review of J.P. Postgate, A Short Guide To The Accentuation of Ancient GreekAntonNoch keine Bewertungen
- Sacris Erudiri - Volume 04 - 1952 PDFDokument412 SeitenSacris Erudiri - Volume 04 - 1952 PDFL'uomo della RinascitáNoch keine Bewertungen
- Kroll, Wilhelm - Catull - Lateinischer Text Mit Deutschsprachigen Anmerkungen-De Gruyter (1989)Dokument330 SeitenKroll, Wilhelm - Catull - Lateinischer Text Mit Deutschsprachigen Anmerkungen-De Gruyter (1989)Petr OzerskyNoch keine Bewertungen
- Auctor Actor Autor, Bulletin Du Cange: Archivium Latinatis Medii Aevi, 3, 1927, P. 81-86.Dokument6 SeitenAuctor Actor Autor, Bulletin Du Cange: Archivium Latinatis Medii Aevi, 3, 1927, P. 81-86.Dijana KapetanovićNoch keine Bewertungen
- J Bergemann Die Sogenannte Lutrophoros GDokument55 SeitenJ Bergemann Die Sogenannte Lutrophoros GJesús Martínez ClementeNoch keine Bewertungen
- Allam 1968Dokument8 SeitenAllam 1968Asmaa RagabNoch keine Bewertungen
- Die Fragmente Der 001 TextDokument515 SeitenDie Fragmente Der 001 TextOsíris Moura100% (1)
- Wurst - 1995 - Das Bemafest Der Ägyptischen Manichäer - Oros PDFDokument88 SeitenWurst - 1995 - Das Bemafest Der Ägyptischen Manichäer - Oros PDFslovanNoch keine Bewertungen
- Amsterdam: Rans Ieter Van TamDokument27 SeitenAmsterdam: Rans Ieter Van TamJasmine ateNoch keine Bewertungen
- Tolkiehn (1913) HieronymusDokument1 SeiteTolkiehn (1913) HieronymusRAMON GUTIERREZ GONZALEZNoch keine Bewertungen
- H. Hoppe, Syntax Und Stil Des Tertullian, Leipzig 1903Dokument233 SeitenH. Hoppe, Syntax Und Stil Des Tertullian, Leipzig 1903diadassNoch keine Bewertungen
- DeutschHA - Es Ist Alles EitelDokument2 SeitenDeutschHA - Es Ist Alles EitelhennyboyNoch keine Bewertungen
- Archidoxis Magicæ: Die magischen Talismane und Siegel des ParacelsusVon EverandArchidoxis Magicæ: Die magischen Talismane und Siegel des ParacelsusBewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)
- Das Konzil Von Chalkedon in Der Darstellung Des Liberatus Von Karthago (Breviarium 11-14)Dokument14 SeitenDas Konzil Von Chalkedon in Der Darstellung Des Liberatus Von Karthago (Breviarium 11-14)persa.carmen06Noch keine Bewertungen
- DAS THOMAS-EVANGELIUM: EINLEITUNG ZUR FRAGE DES HISTORISCHEN JESUS KOMMENTIERUNG ALLER 114 LOGIENVon EverandDAS THOMAS-EVANGELIUM: EINLEITUNG ZUR FRAGE DES HISTORISCHEN JESUS KOMMENTIERUNG ALLER 114 LOGIENNoch keine Bewertungen
- Ebert ParmenidesDokument18 SeitenEbert ParmenidesChema DurónNoch keine Bewertungen
- ADokument403 SeitenAJesson Gonzaga AlleriteNoch keine Bewertungen
- Pseudo-Dionysius Areopagita - de Divinis Nominibus (Ed. Suchla) PDFDokument145 SeitenPseudo-Dionysius Areopagita - de Divinis Nominibus (Ed. Suchla) PDFGustavo RiesgoNoch keine Bewertungen
- Dreves. Analecta Hymnica Medii Aevi. 1886. Volume XLVII.Dokument431 SeitenDreves. Analecta Hymnica Medii Aevi. 1886. Volume XLVII.Patrologia Latina, Graeca et Orientalis100% (1)
- Schilder, Klaas - Zur Allgemeinen Begriffsgeschichte Des ParadoxenDokument467 SeitenSchilder, Klaas - Zur Allgemeinen Begriffsgeschichte Des ParadoxenLars KieselNoch keine Bewertungen
- Dreves. Analecta Hymnica Medii Aevi. 1886. Volume VI.Dokument212 SeitenDreves. Analecta Hymnica Medii Aevi. 1886. Volume VI.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNoch keine Bewertungen
- Aus Goethes Frühzeit: Bruchstücke eines Commentares zum jungen GoetheVon EverandAus Goethes Frühzeit: Bruchstücke eines Commentares zum jungen GoetheNoch keine Bewertungen
- Gressmann. Das Lukasevangelium. 1919.Dokument266 SeitenGressmann. Das Lukasevangelium. 1919.Patrologia Latina, Graeca et Orientalis100% (1)
- Lucians Rezension Der Königsbücher. Septuaginta-StudienDokument444 SeitenLucians Rezension Der Königsbücher. Septuaginta-StudiencsbaloghNoch keine Bewertungen
- GCS 16 Hegemonius, Acta Archelai (1. Aufl. 1906: Charles Henry Beeson)Dokument184 SeitenGCS 16 Hegemonius, Acta Archelai (1. Aufl. 1906: Charles Henry Beeson)Patrologia Latina, Graeca et Orientalis100% (1)
- Diels, Kranz, Die Fragmente, Vol 1Dokument462 SeitenDiels, Kranz, Die Fragmente, Vol 1kerbusar100% (4)
- Bilfinger, Die Antiken StundenangabenDokument180 SeitenBilfinger, Die Antiken StundenangabenalverlinNoch keine Bewertungen
- Schriften. Band I: Die Schriften 1-21 der chronologischen Reihenfolge (Text und Übersetzung). Zweisprachige AusgabeVon EverandSchriften. Band I: Die Schriften 1-21 der chronologischen Reihenfolge (Text und Übersetzung). Zweisprachige AusgabeNoch keine Bewertungen
- Papyrusbriefe Aus Der Frühesten Römerzeit (Bror Olsson) (Z-Library)Dokument127 SeitenPapyrusbriefe Aus Der Frühesten Römerzeit (Bror Olsson) (Z-Library)thierryNoch keine Bewertungen
- 25.1 2.16. Adamik Th. Die Funktion Der Alliteration Bei MartialDokument7 Seiten25.1 2.16. Adamik Th. Die Funktion Der Alliteration Bei MartialBorjan AdziskiNoch keine Bewertungen
- Altercatio Simonis Iudaei Et Theophili Christiani - Ed - Gebhardt - 1883Dokument159 SeitenAltercatio Simonis Iudaei Et Theophili Christiani - Ed - Gebhardt - 1883Apache313Noch keine Bewertungen
- Hermann: Litauische StudienDokument4 SeitenHermann: Litauische StudienStefan GeorgNoch keine Bewertungen
- 8 Verdad y Compromiso en Los Discursos Sobre El Sentido Del Tiempo (Vera)Dokument8 Seiten8 Verdad y Compromiso en Los Discursos Sobre El Sentido Del Tiempo (Vera)Manuel LizNoch keine Bewertungen
- Ursprung Der UnzialschriftDokument35 SeitenUrsprung Der UnzialschriftcyganNoch keine Bewertungen
- Ein Pahlavi Fragment Des AlexanderromansDokument12 SeitenEin Pahlavi Fragment Des AlexanderromansSepide HakhamaneshiNoch keine Bewertungen
- Die Lebensalter (Franz Boll) 1913Dokument26 SeitenDie Lebensalter (Franz Boll) 1913hans dampfNoch keine Bewertungen
- Exzerpte Aus Proklos' Enneadenkommentar Bei PsellosDokument10 SeitenExzerpte Aus Proklos' Enneadenkommentar Bei PsellosAristeurNoch keine Bewertungen
- Φίλος τοῦ Καίσαρος. Ernst BammelDokument3 SeitenΦίλος τοῦ Καίσαρος. Ernst BammelDolores MonteroNoch keine Bewertungen
- 15 Seminare in Le ThorDokument25 Seiten15 Seminare in Le ThorEnergeionNoch keine Bewertungen
- Konig Chilperich Als Lateinischer Dichter Von U. KINDERMANNDokument26 SeitenKonig Chilperich Als Lateinischer Dichter Von U. KINDERMANNneddyteddyNoch keine Bewertungen
- Christopher Mitylene GedichteDokument154 SeitenChristopher Mitylene GedichteMaroula PerisanidiNoch keine Bewertungen
- Grass. La Vie Sainte Paule: Zum Ersten Male. 1908.Dokument139 SeitenGrass. La Vie Sainte Paule: Zum Ersten Male. 1908.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNoch keine Bewertungen
- Lektion 7: Zukunftsform Aorist Die ZukunftDokument10 SeitenLektion 7: Zukunftsform Aorist Die ZukunftblaNoch keine Bewertungen
- Diehl Die Vitae Vergilianae PDFDokument68 SeitenDiehl Die Vitae Vergilianae PDFEpercsik JánosNoch keine Bewertungen
- Behaghel (1878), Die Neuhochdeutschen ZwillingswörterDokument36 SeitenBehaghel (1878), Die Neuhochdeutschen ZwillingswörterGeorge WalkdenNoch keine Bewertungen
- Theragāthā: Palikanon – Das Buch der Lehrreden des Buddha (Die Lieder der Mönche)Von EverandTheragāthā: Palikanon – Das Buch der Lehrreden des Buddha (Die Lieder der Mönche)Noch keine Bewertungen
- ZAeS 040Dokument186 SeitenZAeS 040Ivan BogdanovNoch keine Bewertungen
- Frick. Die Quellen Augustins Im Xviii: Buche Seiner Schrift de Civitate Dei. 1886.Dokument92 SeitenFrick. Die Quellen Augustins Im Xviii: Buche Seiner Schrift de Civitate Dei. 1886.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNoch keine Bewertungen
- Ariston Von Keos Bei PhilodemDokument15 SeitenAriston Von Keos Bei PhilodembrysonruNoch keine Bewertungen
- Berve, Zur Themistokles-Inschrift Von TroizenDokument50 SeitenBerve, Zur Themistokles-Inschrift Von TroizenalverlinNoch keine Bewertungen
- Leo 1895 - Plautinische Forschungen PDFDokument362 SeitenLeo 1895 - Plautinische Forschungen PDFArawnNoch keine Bewertungen
- Prauss Kant Über Freiheit Als AutonomieDokument3 SeitenPrauss Kant Über Freiheit Als AutonomieFritzWaltherNoch keine Bewertungen
- Literatur Zur Goldenen RegelDokument3 SeitenLiteratur Zur Goldenen RegelFritzWaltherNoch keine Bewertungen
- Koller - 1975 - Die Ars Notoria Des ErasmusDokument5 SeitenKoller - 1975 - Die Ars Notoria Des ErasmusFritzWaltherNoch keine Bewertungen
- Thome Soziologische Wertforschung Ein Von Niklas Luhmann Inspirierter Vorschlag Für Die Engere Verknüpfung Von Theorie Und EmpirieDokument25 SeitenThome Soziologische Wertforschung Ein Von Niklas Luhmann Inspirierter Vorschlag Für Die Engere Verknüpfung Von Theorie Und EmpirieFritzWaltherNoch keine Bewertungen
- Niklas Luhmann Paradigm Lost. Über Die Ethische Reflexion Der Moral. Rede Anläß Lich Der Verleihung Des Hegel Preises 1989. ReszensionDokument18 SeitenNiklas Luhmann Paradigm Lost. Über Die Ethische Reflexion Der Moral. Rede Anläß Lich Der Verleihung Des Hegel Preises 1989. ReszensionFritzWaltherNoch keine Bewertungen
- Zur Emergenz Des Sozialen Bei Niklas Luhmann Simon Lohse Institut Für PhilosopDokument18 SeitenZur Emergenz Des Sozialen Bei Niklas Luhmann Simon Lohse Institut Für PhilosopFritzWaltherNoch keine Bewertungen
- (Franz Delitzsch-Vorlesungen 1958) Paul Kahle - Der Hebräische Bibeltext Seit Franz Delitzsch-Kohlhammer (1961)Dokument120 Seiten(Franz Delitzsch-Vorlesungen 1958) Paul Kahle - Der Hebräische Bibeltext Seit Franz Delitzsch-Kohlhammer (1961)Josue Gabriel da CostaNoch keine Bewertungen
- Hamlet Maschine: Konstrutiver Defaitmus Von Albert MeierDokument14 SeitenHamlet Maschine: Konstrutiver Defaitmus Von Albert MeierJohn Membership100% (1)
- Wendland (1912) KulturDokument501 SeitenWendland (1912) Kulturhans dampfNoch keine Bewertungen
- Schröter Jens - IntermedialitaetDokument14 SeitenSchröter Jens - IntermedialitaetMariana IlchukNoch keine Bewertungen
- FRAUENDIENSTDokument15 SeitenFRAUENDIENSTSofija NaskovićNoch keine Bewertungen
- Idensen Schreiben NetzDokument47 SeitenIdensen Schreiben NetzHeiko IdensenNoch keine Bewertungen
- Gerd Gutemann - Göttliche OffenbarungenDokument79 SeitenGerd Gutemann - Göttliche OffenbarungenluisperuscribdNoch keine Bewertungen
- Abenteuer Zum AuswürfelnDokument39 SeitenAbenteuer Zum AuswürfelnOliver Krüger100% (2)
- Bibliographie Büchner WoyzeckDokument21 SeitenBibliographie Büchner WoyzeckpiffererNoch keine Bewertungen
- Prüfungsregularien Erz - Prf.HamburgDokument16 SeitenPrüfungsregularien Erz - Prf.HamburgBen Wildstyle MansourNoch keine Bewertungen
- Німецька Мова Практичне Заняття 2Dokument3 SeitenНімецька Мова Практичне Заняття 2SundayNoch keine Bewertungen
- Glossar Zu GrammatikDokument18 SeitenGlossar Zu GrammatikkrocksldyfuegNoch keine Bewertungen