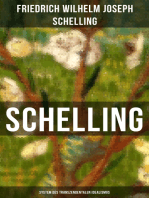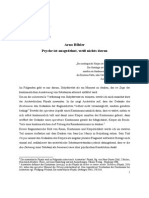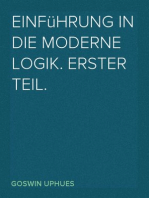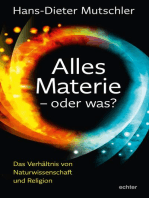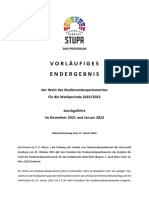Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
1 Husserl Londoner Vorträge
Hochgeladen von
matthias_kyska41540 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
114 Ansichten28 SeitenCopyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
114 Ansichten28 Seiten1 Husserl Londoner Vorträge
Hochgeladen von
matthias_kyska4154Copyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 28
200
E. Husserl: Phnomenologische Methode und
Phnomenologishe Philosophie
<Einleitung:> Das allgemeine ziel der phnomenologie schen
Philosophie
Der ehrenvollen Aufforderung, an dieser groen Sttte englischer Wissenschaft
einige Vorlesungen zu halten, glaube ich am besten genugzutun, indem ich
von einer neueren philosophischen Methode spreche, mit der sich das
unbekannte Reich der transzendentalen Subjektivitt der konkreten
Anschauung erschliet, und indem ich im Anschlu daran den Versuch wage,
Sie in die Gedankenkreise einer noch neuen philosophischen Grundwissenschaft
einzufhren, welche sich auf diesem konkret anschaulichen Boden angesiedelt
hat: Es ist die transzendentale Phnomenologie. Ich hoffe, fr die
unvergleichliche Eigenart dieser Wissenschaft als zugleich rein deskriptiver
und rein apriorischer einiges Verstndnis erwecken zu knnen und auch davon
zu berzeugen, da sie nicht ohne Grund hchste Ansprche auf
wissenschaftliche Strenge erheben darf. Es soll weiterhin die zentrale
Bedeutung der Phnomenologie im Gesamtreich der Wissenschaften
klargelegt und gezeigt werden, da die Phnomenologie das gesamte System
der Erkenntnisquellen in sich fat, aus denen alle echten Wissenschaften ihre
prinzipiellen Begriffe und Stze und alle Kraft ihrer letzten Rechtfertigung
ziehen mssen. Eben damit gewinnt sie den Beruf der im wahren Sinn so zu
nennenden Ersten Philosophie, den Beruf, allen anderen Wissenschaften
Einheit aus letzten Begrndungen und Beziehung auf letzte Prinzipien zu
verleihen und sie alle neu zu gestalten als lebendige Organe einer einzigen,
absolut universalen Wissenschaft, der Philosophie im ltesten Wortsinn.
Im wissenschaftlichen Leben unserer Epoche fllt danach der
Phnomenologie die Aufgabe zu, uns von dem vielbeklagten Fluch der
Zersplitterung der Erkenntnis in fast zusammenhangslose Fachwissenschaften
und von den Einseitigkeiten des Spezialistentums zu befreien. Andererseits
fllt ihr auch die Funktion zu, der hieraus erwachsenen wissenschaftsfeindlichen
Reaktion zu begegnen, die sich der gegenwrtigen Generation zu bemchtigen
droht und sie trben Mystizismen nur zu sehr geneigt machen mu. Die
Phnomenologie vertritt solchen Strmungen gegenber das ursprngliche,
unverbrchliche und in Sachen der Erkenntnis ausschlieliche Recht der
strengen Wissenschaft. Sie vertritt es aber, indem sie alle Wissenschaft aus
ihren Urquellen klrt und absolut rechtfertigt. Sie erweist, da nur der uerste
Radikalismus der Erkenntnisgesinnung, als Intention auf Klarheit und
einsichtige Rechtfertigung bis aufs denkbar Letzte, gegen alle Skeptizismen
und Mystizismen helfen kann, und sie zeigt, da die natrlich gewordenen
und natrlich bewhrten Wissenschaften in dieser Hinsicht versagen muten,
Quelle: Husserl Studies 16: 2000
201
weil dieser Radikalismus ihnen als natrlichen Wissenschaften notwendig
fehlt. Helfen kann nur letztverstehende Wissenschaft, und das ist Wissenschaft
gespeist aus den Urquellen der Phnomenologie.
Doch ich darf nicht lange Einleitungen machen. Ich gestatte mir, auf die
knappen Hauptthesen zu verweisen, die dem Syllabus
1
zu dieser Vorlesung
beigegeben sind als schematische Vorzeichnungen der Hauptgedanken, die
in den gesamten Vorlesungen Farbe und Flle erhalten sollen. Ich will sie
hier nicht wiederholen und lieber sogleich anfangen.
I. Der Cartesianische Weg zum ego cogito und die Methode der
phnomenologischen Reduktion
Es gibt verschiedene Wege in die Phnomenologie. Ich will fr diese
Vorlesungen den prinzipiellsten whlen. Er hebt an mit der Erneuerung der
antiken Idee philosophischer Erkenntnis und schliet daran an eine radikale
Erwgung der Methode, die zur Erzielung solcher philosophischen Erkenntnis
wesensnotwendig ist. Die transzendentale Phnomenologie resultiert dann als
die notwendige Wissenschaft von der Methode und als die Erste Philosophie.
Sollte ich heute unter dem Aspekt der mir zugereiften Gesamtberzeugungen
sagen, welche Philosophen mir im Rckblick auf die Geschichte der
Philosophie vor allen hervorleuchten, so wrde ich allen voran zwei nennen,
die ich darum nicht etwa auf eine Rangstufe stellen mchte: an erster Stelle
den allerdings ganz unvergleichlichen Platon, den Schpfer der Idee strenger
Wissenschaft oder philosophischer Wissenschaft, in dem ich berhaupt den
eigentlichen Begrnder unserer wissenschaftlichen Kultur sehen mchte. Als
zweiten Namen wrde ich <den des> Descartes nennen, ohne ihn damit als
den Grten der Neueren einschtzen zu wollen. Aber eine ganz
ausgezeichnete historische Stellung erhlt er dadurch, da seine Meditationes
dem philosophischen Denken eine feste Entwicklungsrichtung gegen eine
Transzendentalphilosophie erteilt haben. Nicht nur der Grundcharakter der
neuzeitlichen Philosophie, sondern, wie ich berzeugt bin, aller knftigen
Philosophie ist dadurch von Descartes her bestimmt.
Was zunchst Platon anbelangt, so wird er durch den Ernst, mit dem er die
sophistische Skepsis theoretisch zu berwinden und dabei Sokratische Im-
pulse theoretisch auszuwerten sucht, zum Begrnder der philosophischen Idee
des wahren Wissens und der echten Wissenschaft als der hchsten Zielidee
der Erkenntnis. In eins damit wird er zum Schpfer des Problems und der
Wissenschaft von der Methode, nmlich der Methode, dieses oberste Ziel in
aktueller Erkenntnis zu realisieren. Echte Erkenntnis, echte, das ist begrifflich
strenge Wahrheit und Seiendes in wahrem Sinn, werden zu Korrelaten. Der
Gesamtinbegriff aller echten Erkenntnis bzw. aller strengen begrifflichen
Wahrheiten bildet eine theoretisch verbundene Einheit, die einer einzigen
202
Wissenschaft, und das ist die Philosophie. Ihr Korrelat ist die Totalitt alles
wahrhaft Seienden. Eine neue Idee der Philosophie als universaler und absolut
gerechtfertigter Wissenschaft tritt damit die ganzen weiteren Entwicklungen
bestimmend auf den Plan; es deutet sich schon hier an, da eine Philosophie
erst mglich ist auf Grund einer prinzipiellen Erforschung der Bedingungen
der Mglichkeit einer Philosophie. Darin liegt die Idee einer notwendigen
Begrndung und Gliederung der Philosophie in zwei Stufen, einer radikalen,
sich in sich selbst rechtfertigenden Methodenlehre als Erster Philosophie und
einer auf sie in allen ihren rechtfertigenden Begrndungen zurckbezogenen
Zweiten Philosophie.
Ich erinnere noch daran, da fr den Sokratiker Platon Philosophie im
vollen und weiten Sinn nicht blo Wissenschaft ist; und da die Theorie oder
theoretische Vernunft ihre Wrde darin hat, praktische Vernunft allein mglich
zu machen.
Verweilen wir nicht, so interessant dies wre, bei der mangelhaften
Auswirkung der Platonischen Intentionen in den weiter folgenden
Philosophien. Wenden wir uns sogleich zu Descartes. In ihm lebt von Anfang
an die Platonische Idee der Philosophie in scharfer Ausprgung wieder auf,
in eins mit dem bestimmten Bewutsein des unphilosophischen Dogmatismus
aller berlieferten Philosophien oder Wissenschaften (was dasselbe besagt).
Sie sind keine echten Philosophien, das ist, sie entbehren der echten bis ins
Letzte sich rechtfertigenden Rationalitt, selbst die bewunderte Mathematik
nicht ausgenommen. Dem Skeptizismus gegenber sind sie daher, wie sie es
auch vordem immer waren, machtlos.
Schon in den Regulae werden die beiden Grundforderungen, die der
vollkommensten Rechtfertigung und die der Universalitt (unter Hinweis auf
die Einheit der Vernunft als der einheitlichen Quelle aller mglichen
Erkenntnisse) lebhaft betont; und in bedeutsamer Weise wird die Erfllung
solcher Forderungen zur Lebens- und Gewissensfrage des philosophischen
Subjekts selbst gemacht. Ich mchte diese subjektivierende Wendung als
erkenntnisethische bezeichnen, obschon sie bei Descartes nicht als wirklich
ethische eingefhrt wird. Es geht eben bei ihm vom philosophischen Ethos
Platons die spezifisch ethische Seite verloren: Die theoretische Philosophie
verselbstndigt sich. Also nicht mehr ist wie bei Platon die letztleitende Idee
die der echten Humanitt, die sich im philosophischen Menschen und nicht im
bloen Wissenschaftler verkrpere, wenn auch der Philosoph zunchst
Wissenschaftler sein mu. Immerhin bleibt aber auch in der Cartesianischen
Auffassung des Philosophen der Radikalismus erhalten, der zum Wesen der
ethischen Gesinnung gehrt, und er hat eine Form, die sich, worauf ich Wert
legen mchte, sehr wohl wieder ethisch interpretieren oder eigentlich ethisch
unterbauen lt. Kurz angedeutet kann dies in folgender Weise geschehen:
In dem Sinn der absolut ethischen Forderung liegt gewissermaen als
regulatives Urbild beschlossen, eine eigentmliche Form des menschlichen
203
Lebens. Der Mensch das sage jetzt immer der Einzelmensch oder auch der
Mensch im Groen, die vergemeinschaftete Menschheit der Mensch, sage
ich, darf nicht dabei bleiben, sozusagen naiv in den Tag hineinzuleben. Er mu
einmal ethisch erwachen, sich besinnen und jenen radikalen Entschlu fassen,
durch den er sich selbst erst zum wahren, dem ethischen Menschen macht. Der
Entschlu geht dahin, mit allen Krften nach einem neuartigen Leben (einem
Leben neuer allgemeiner Form, eines neuen Stils) zu streben, einem Leben aus
einem absolut klaren, sich vor sich selbst absolut rechtfertigenden Gewissen.
Dasselbe gilt im Besonderen vom erkennenden Menschen; es gilt, wenn
berhaupt Erkenntnis und Wissenschaft anzuerkennen ist als eine der groen
menschheitlichen Funktionen, die als Beruf zu erwhlen und
kontinuierlich zu bettigen ein eigenes Recht hat im universalen Rahmen
eines ethischen Lebens. Unbeschadet der Einschrnkungen, welche das
ethische Recht der Erkenntnisbettigung erfhrt durch die ethische
Rcksichtnahme auf das Mitrecht anderer Wertfunktionen unter den
wechselnden Umstnden, ergibt sich hier eine analoge regulative Idee als
spezifisch erkenntnisethische; nmlich soll ein der Erkenntnis hingegebenes
Leben berhaupt ein ethisches Recht, also letztzuvertretendes Recht haben
knnen, so mu es ein in der Idee der echten und wahren Erkenntnis
zentriertes Leben sein. Es darf also nicht ein Erkenntnisleben sein und
bleiben wollen in naiver Erkenntnishingabe an die Sachen, sondern es mu
sich fr den Erkennenden hinsichtlich seiner Echtheit durchaus rechtfertigen.
Auch hier ergibt sich die Forderung der radikalen Besinnung und eines
universalen, das ganze Erkenntnisleben bindenden Entschlusses, des
Entschlusses, ein Erkenntnisleben durchaus mit der bewuten Zielrichtung auf
Echtheit der Erkenntnis, also auf allseitige und letzte Erkenntnisrechtfertigung
anzustreben, ein neues echt wissenschaftliches Leben in einer bewuten
und jederzeit zu vertretenden Normgerechtigkeit. Wir knnen auch sagen:
ein Leben aus einem absolut klaren, theoretischen Gewissen, jeder
Selbstprfung standhaltend. Die Konsequenz dieses Entschlusses ist der
universelle Umsturz aller voranliegenden, nicht aus der Intention auf abso-
lute Rechtfertigung entsprungenen berzeugungen. Offenbar ist auch diese
Idee wie einzelmenschlich so <auch> als sozialmenschlich zu konstruieren
und im letzteren Falle zurckzubeziehen auf die universale Verstndigungs-
und Wirkungsgemeinschaft der speziell erkenntnisethisch aufeinander
angewiesenen, zu wechselseitiger Frderung berufenen Wissenschaftler.
Der soeben deduzierte Umsturz erinnert uns an Descartes. In der Tat,
geleitet von einer wesentlich selben, wenn auch nicht ethisch charakterisierten
Gesinnung, erfllt also von demselben wissenschaftlichen Radikalismus,
fordert Descartes den universellen Umsturz im Reich der eigenen
Vormeinungen von allen qui serio student ad bonam mentem,
2
oder wie er
sich quivalent ausdrckt, die die universalis sapientia
3
anstreben, das hchste
Erkenntnisziel.
204
In der Tat, das ist das erste, was die Phnomenologie wie an Platon so an
Descartes bewundert und was zugleich ihr eigenes philosophisches Ethos
charakterisieren mag: dieser wissenschaftliche Radikalismus bis aufs Letzte,
der sich nicht mit Halbheiten begngen will, wo nur das Ganze das Gesollte
und auch das allein Hilfreiche ist. Sie meint ganz ernstlich: Diesen radikalen
Entschlu zum neuen Anfang wie zum Umsturz mu einmal im Leben
4
jeder vollziehen, der Philosoph im wahren und echten Sinn werden und sein
will. Durch diesen Entschlu schafft jeder sich selbst zum Philosophen um.
Philosoph ist, wer als Wissenschaftler sich ganz und gar in den Dienst
der Idee letztgerechtfertigter, auf eine universalis sapientia gerichteter
Erkenntnis stellt, einer Erkenntnis, die er aus absolut klarem intellektuellen
Gewissen jederzeit vertreten kann.
In die Wirklichkeit tritt der Philosoph notwendig als anfangender, allererst
werdender. Denn das neue Ziel ist zunchst ein vages und fernes, vllig
unbestimmt noch die etwa hinfhrenden Wege. Das notwendig Erste fr den
anfangenden Philosophen sind daher meditationes de prima philosophia,
Besinnungen ber das Wesen jener absolut echten Erkenntnis und ber die
mglichen und notwendigen Wege ihrer Erzielung. Hier liegt ein Neues, was
wir an Descartes bewundern, die geniale Art, solche meditationes entworfen
zu haben, als methodische Besinnungen des werdenden Philosophen ber
den mglichen Anfang einer Philosophie als absolut gerechtfertigter
Erkenntnis, Besinnungen, die prinzipiell durchgefhrt als echte Erkenntnis,
sozusagen als die Eingangspforte der Philosophie ihren dauernden Bestand
behalten mssen.
Freilich versagte Descartes, wo es galt, diesem Geiste des Radikalismus in
wirklich radikaler Weise genugzutun. Der Cartesianische Anfangsweg entbehrt
der prinzipiellen Strenge und verliert sich unvermerkt in Abwege. Daher
stammt all das Unheil, das er ber die neuere Philosophie gebracht hat; freilich
in eins mit dem Segen, der von den gesunden Kernmotiven, trotz aller
Selbstmiverstndnisse, im Verborgenen ausstrahlte, indem sie fortgesetzt
auf eine Transzendentalphilosophie hindrngten.
Unser Interesse soll es jetzt sein, den sozusagen echten Cartesianischen Weg
zu konstruieren und dabei jenen wertvollen Kerngehalt der ersten meditationes
des groen Denkers auf die Hhe prinzipieller Reinheit und zwingender
Notwendigkeit zu erheben. Dieses tun heit nichts anderes als die radikale
Methode der neuen Phnomenologie, die der phnomenologischen Reduktion
entwickeln. Es handelt sich hier um den Weg zum ego cogito, womit also gesagt
ist, da diese Reduktion Reduktion auf dieses Ego ist aber freilich auf ein
Ego, das Descartes nur berhrt, aber alsbald mideutet hat.
Versetzen wir uns in die erkenntnisethische Einstellung, mit der der werdende
Philosoph beginnt. Wir mssen jetzt die Ichrede bevorzugen und jeder innerlich
Teilnehmende ist das Ich, von dem dabei gesprochen ist. Ich, so sage ich als
anfangender Philosoph, will ein neues Erkenntnisleben anfangen, ein
205
durchgngiges Erkennen aus absoluter Rechtfertigung und von einer Art, da
ich hoffen kann, in geordneter Weise zu einer universalis sapientia zu kommen.
Ich beginne demgem mit dem allgemeinen Umsturz aller meiner bisherigen
berzeugungen; ich lege sozusagen ein neues Grundbuch der Erkenntnis an
und keine darf hineinkommen, die ich nicht neu begrndet und bei der ich
mich nicht ihrer absoluten Rechtfertigung versichert habe. Aber auch auf die
gehrige Ordnung des Vorgehens kommt es an.
Die erste Frage scheint also zu sein: Wie fange ich an, wie gewinne ich
eine an sich erste Erkenntnis oder Erkenntnissphre, deren ich mich absolut
versichern kann und nicht nur als absolut zu rechtfertigender, sondern als
einer solchen, die notwendig allen anderen Erkenntnissen voranliegt, als ein
notwendiges Fundament jener gesuchten Philosophie, auf das alle anderen
mglicherweise zu rechtfertigenden Erkenntnisse unbedingt zurckbezogen
sein mssen?
Indessen, nher besehen geht doch eine andere Frage voraus. Allem voran
mu ich mich doch erst besinnen, was fr <eine> Vollkommenheit ich unter
dem Titel absoluter Rechtfertigung fr meine knftigen Erkenntnisse
eigentlich meine und fordere.
Zu diesem Zwecke berblicke ich die Erkenntnisse und Rechtfertigungen
meines bisherigen Lebens, ich entnehme daraus exemplarisches Material fr
die Klrung dieses Ideals. Von ihrer Geltung, ja selbst von ihrem faktischen
Gewesensein, will und darf ich keinen Gebrauch machen, aber als reine
Mglichkeiten darf ich sie doch bentzen, sie zu voller Klarheit gestalten,
blo um daran Begriffe zu bilden. So klre ich mir oder bilde mir in
ursprnglicher Klarheit zunchst den Begriff des Erkennens als eines Glaubens
oder Urteilens, und nher als eines in ausgezeichneter Weise motivierten
Urteilens. Das im prgnanten Sinn erkennende Urteilen richtet sich nmlich
nach einem Sehen oder Einsehen, derart, da das Geglaubte nicht blo
geglaubt, sondern selbst gesehen oder eingesehen, selbst erfat, selbst ergriffen
ist. Ein solcher nach evident Gegebenem sich richtender Glaube heit selbst
ein evidenter oder evident begrndeter. Einen nicht evidenten Glauben
begrnden heit ihn in einen evidenten, durch Anmessung an eine
Selbstgebung des Geglaubten, berfhren.
Ist das einmal gelungen, so mu es fr dieselbe berzeugung immer wieder
gelingen; er mte berhaupt standhalten, so bin ich zunchst geneigt
anzunehmen. Aber nun gedenke ich exemplarischer Mglichkeiten, der
Entrechtung frherer Begrndungen und Evidenzen durch sptere, ich
unterscheide zwischen vollkommeneren und unvollkommeneren Evidenzen.
An der Entwertung unvollkommener Evidenzen erfasse ich auch den Begriff
der Scheinevidenzen. Hieran bilde ich nun mein Ideal absoluter
Rechtfertigung. Ein wissenschaftliches Streben kann doch nur Sinn haben,
wenn was Recht ist, Recht bleiben kann, wenn also jedes Urteil und jede
unvollkommene Evidenz ihr absolutes Ma haben kann an einer
206
vollkommenen Evidenz, in der Wahrheit und Falschheit sich entscheiden kann.
Das sagt, es mte ein adquates Sehen oder Einsehen geben, ein Sehen,
Erfassen, das wirklich ist und durchaus ist, was es sein will, Selbsterfassen des
geglaubten Gegenstands. Es drfte also gar nichts von einem unklaren,
ungefhren Sehen, und nach keinem gegenstndlichen Moment, in sich bergen,
nichts von einem antizipierenden Meinen. Der Gegenstand mte voll und
ganz selbsterfater sein. Davon mte ich mich aber absolut berzeugen knnen,
und das wre nur denkbar in Form eines reflektiven Sehens. Unter Zergliederung
der Urteilsmeinung mte ich konstatieren knnen, da sie durchaus, nach
allen Momenten satt erfllte ist. Dieses reflektierende Sehen mte selbst wieder
adquat sein und sich genau so vor sich rechtfertigen knnen.
Es leuchtet aber ein, da zu einer adquaten Evidenz auch eine andere
mgliche Probe gehren mte, die des Durchgangs durch einen Negations-
und Zweifelsversuch. An einem adquat Gegebenen und absolut selbst
Erfaten mte jeder solche Versuch notwendig zerschellen. Es kme dabei
vielmehr die Unmglichkeit des Nichtseins und Zweifelhaftseins des adquat
Gegebenen ihrerseits zur adquaten Gegebenheit; mit anderen Worten,
whrend etwas adquat gegeben ist, kann es nicht negiert und nicht bezweifelt
werden. Das bezeichnet sich auch mit den Worten: Das adquat Evidente ist
in apodiktischer Gewiheit gegeben.
Damit gewinnt das von Descartes bentzte Kriterium der Zweifellosigkeit
fr eine absolut gerechtfertigte Erkenntnis seinen tieferen Sinn. Es wre leicht
zu zeigen, da Descartes selbst diesen Sinn nicht klar erfat hat und nicht
zum mindesten dadurch in groe Verirrungen geraten ist.
Doch bleiben wir bei der Sache und in der meditierenden Icheinstellung.
Das Ergebnis der Besinnung ist, da ich als leitendes Ideal fr absolut
gerechtfertigte Erkenntnis die Idee einer adquaten Evidenz nehmen mu.
Ich mu nun sehen, wie weit ich damit komme, wie ich damit eine Philosophie
in Gang bringen kann.
Doch ehe wir in das wirkliche Suchen nach einem Anfang eingehen knnen,
mssen wir noch berlegen, da wie Erkenntnis berhaupt, so auch adquate
Erkenntnisse, sich in unmittelbare und mittelbare scheiden werden. Da die
mittelbaren in ihrer adquaten Begrndung auf unmittelbare zurckfhren
mssen, so werden die ersten Erkenntnisse, auf die ich mein Suchen richten
mu, den Charakter absolut unmittelbarer haben mssen. Eine nhere
berlegung zeigt dann leicht, da als absolut unmittelbar nur schlichte
Anschauungen gelten knnen, ferner, da nur solche Begriffe und
Prdikationen zulssig sein knnen, die schlichten, adquat selbstgebenden
Anschauungen in strengster Adquation angepat worden sind. Rein aus dem
Angeschauten mu ich meine Begriffe schpfen und nur reine Deskription
ist fr den Anfang gestattet. Damit habe ich das hodegetische Prinzip des
Anfangs. Am nchsten liegt es dabei, unter adquaten Anschauungen
Wahrnehmungen zu verstehen, also nach einer Sphre individuellen Seins zu
207
suchen, die mir zu adquater Selbstgegebenheit oder, was gleichwertig ist, in
apodiktischer Seinsnotwendigkeit, in apodiktischer Zweifellosigkeit gegeben
sein kann. Versuchen wir es zunchst mit diesem spezielleren Leitgedanken.
Mit der jetzt sich erhebenden Frage, wie wir uns eine apodiktisch zweifellose
Seinssphre verschaffen sollen, stehen wir wieder in dem Cartesianischen
Gedankengang, der sehr zu seinem Schaden alle prinzipiellen Vorfragen
unerrtert gelassen hatte. Seinem Hauptzuge wollen wir nun folgen, obschon
unter bestndigen Umbildungen im Sinne prinzipieller Notwendigkeit, bis
hinauf zum ego cogito, dieser trivialsten Trivialitt fr den philosophisch
Blinden, diesem Wunder aller Wunder fr den philosophisch Sehenden.
Mit gutem Instinkt beginnt Descartes nicht damit, ohne weiteres das ego
cogito als absolut zweifellose Erkenntnis in Anspruch zu nehmen, als ein Reich
apodiktischer Evidenz, sondern vielmehr erst vorhergehen zu lassen den
Nachweis der Zweifelsmglichkeit der Welt sinnlicher Erfahrung und somit
der Unvollkommenheit dieser sinnlichen Erfahrung, ihrer Unfhigkeit, als Fun-
dament absoluter Rechtfertigungen zu dienen. Denn die natrliche und allzeit
bereite Evidenz des Ich bin ist nicht diejenige, welche philosophisch in Frage
kommt, ist nicht jenes ego cogito, das durch die methodische Ausschaltung der
sinnlichen Erfahrung und Erfahrungswelt gewonnen wird; und darin liegt die
ungeheure Bedeutung des Cartesianischen Weges.
Beginnen wir also wie Descartes mit der Prfung der sinnlichen Erfahrung.
Nach dem allgemeinen Umsturz luft meine raum-weltliche Erfahrung
ungebrochen fort, sie scheint durch ihn also nicht betroffen; bestndig steht
in klarem Bewutsein leibhaften Daseins diese Welt vor mir, und ich finde
mich als Mensch unter anderen Menschen, Tieren, Dingen usw. Es scheint
also, da die uere Erfahrung eine bestndig flieende Evidenzquelle sei,
ber die ich, der anfangende Philosoph, frei verfgen kann. Kann ich hier
vernnftigerweise zweifeln? Aber genauer besehen ist diese Evidenz keine
Evidenz apodiktischen Charakters, wie ich sie als Anfang fordern mte.
Denn mag ich irgendein rumliches Objekt noch so vollkommen wahrnehmen,
noch so grndlich besehen, betasten usw., niemals ist die Mglichkeit der
Nichtexistenz dieses so klar Erfahrenen ausgeschlossen. Der Gedanke, diese
Dinge da seien in Wahrheit nicht, whrend ich sie immerzu klar und einstimmig
sehe, mag unvernnftig, mag vllig ohne Grund sein, niemals ist er doch
apodiktisch widersinnig. Niemals ist ja auch, wie ich leicht bemerke, die
Wahrnehmung eine adquate Selbstgebung des rumlichen Gegenstands;
wie vollkommen er zur Wahrnehmung kommt, immerfort meint der
Wahrnehmungsglaube mehr als was wirklich gesehen ist und bleibt das
gesehene Ding ein Gemisch von eigentlich Gesehenem und nicht Gesehenem,
also immer bleibt es offen, da sich <im> Fortgang weiteren Wahrnehmens
herausstelle, da das Gesehene nicht so sei, als wie es vordem vermeintlich
gesehen war, oder gar da es berhaupt nicht sei, da sich das Gesehene in
Illusion oder Traum auflse.
208
Danach ist es ganz sicher kein Widersinn, sondern eine bestndige absolut
evidente Mglichkeit, da die gesamte Natur, die ich erfahre, berhaupt nicht
sei. Der hypothetische Ansatz ihrer Nichtexistenz ist also nicht etwa von der
Art wie die Hypothese, da 2 > 3 ist oder da ein Dreieck vier Seiten hat;
denn das sind apodiktisch unmgliche Hypothesen. Der gefhrte
Mglichkeitsbeweis wird von groer methodischer Bedeutung werden. Halten
wir dieses Resultat fest, das in Korrelation steht mit der absoluten Evidenz,
der absoluten Evidenz, da keine einzige raum-dingliche Erfahrung den
Charakter einer adquaten absolut selbstgebenden gewinnen kann und erst
recht also nicht die universale Erfahrung, die mir die unendliche Natur als
unmittelbare Gegebenheit darbietet. Oder was dasselbe: Mag meine uere
Erfahrung eine noch so vollkommene sein, sie schliet die Mglichkeit des
Nichtseins des Erfahrenen, also schlielich der ganzen Welt nie aus. Das
betrifft aber nicht blo die rein physische Naturerfahrung, sondern auch die
in ihr fundierte Erfahrung vom Animalischen und speziell vom Psychischen
braucht kein Erfahrungsding zu sein, obschon ich es klar erfahre, so auch
kein erfahrener Leib, kein Mensch, kein seelisches Leben irgendwelchen
Leibes. Nichts davon ist in apodiktischer Evidenz erfahren. Nach dem Prinzip
des Anfangs darf nichts davon fr mich da sein, das volle und ganze Weltall
mu in meinem Umsturz mit einbegriffen sein, mit der gesamten nicht blo
physischen, sondern auch psychophysischen objektiven Erfahrung.
Kann mir nun berhaupt noch etwas brigbleiben? Kann es berhaupt eine
Erfahrungsart geben, die adquat <ist>, die ihre Erfahrungsobjekte in
apodiktischer Gewiheit darbietet, also in einer Weise, da diese Erfahrung
das Nichtsein des Erfahrenen apodiktisch unmglich macht? Umschliet das
Weltall nicht das All des Erfahrbaren, das All des individuellen Seins
berhaupt? Wir antworten in bestndiger, prinzipieller Modifikation des
Cartesianischen Gedankenganges: Die apodiktisch erwiesene Mglichkeit des
Nichtseins des Weltalls, das ich soeben erfahre und whrend ich das tue,
berhrt in keiner Weise das Faktum dieser Erfahrung; genauer das Faktum,
da ich diese und diese Dinge, in der und der Weise sich gebend, diese
Raumwelt, mit diesen Krpern, Menschen usw. erfahre.
Mag diese Welt nicht sein, die ich da fortlaufend erfahre, das ist absolut
evident, da ich sie erfahre, da mir diese Dinge da als wahrgenommene
gegeben sind, da sie erscheinen, wie sie erscheinen, jetzt unklar und dann
etwa klar, jetzt in der und dann in anderer Perspektive usw., und da ich sie
wahrnehmend jetzt als rumliche Wirklichkeiten glaube. Das ist aber
apodiktisch gewi, wenn ich eben von dem naiven Erfahren dieser Dinge
dieser Welt in die Reflexion bergehe; und ich kann jederzeit reflektieren auf
das Ich nehme das und das wahr und nehme es in der und der
Erscheinungsweise wahr. Dieses Reflektieren ist ein neuartiges Wahrnehmen,
eine Wahrnehmung von den Dingwahrnehmungen und ihren Gehalten. Nennen
wir die eine Wahrnehmung die naturale oder berhaupt mundane Wahrnehmung,
209
so mag die neue reflektive Wahrnehmung als phnomenologische oder auch
egologische bezeichnet sein; in ihr ist der Gegenstand das Phnomen der
Hauswahrnehmung, Tischwahrnehmung usw. bzw. dieses ego cogito, dieses
Ich nehme dieses Haus, diesen Tisch u. dgl. wahr. Diese phnomenologische
Wahrnehmung ist absolut unaufhebbar, die Tatsache, die sie erfat, erfat sie
als eine apodiktisch evidente, als adquat gegebene Tatsache. So
Wahrgenommenes zu leugnen, ist apodiktisch unmglich. Reflektierend finde
ich ich bin das und das erfahrend und bin absolut, wenn ich diesen Ausdruck
Ich bin adquat deskriptiv verstehe.
Aber nun breitet sich der Bereich dieser apodiktischen Erfahrung alsbald
endlos aus. Mich an meine Reise, an Menschen, an Gesprche u. dgl.
wiedererinnernd mag es sein, da all das Traum, da es wirklich nicht war;
aber an dieser Tatsache der Wiedererinnerung kann ich, sie als dieses jetzige
Erlebnis erfassend, absolut nicht zweifeln. Und so, wenn ich denke, da ich
denke, wenn ich evident oder nicht evident urteile, mathematisiere u. dgl.,
da ich so und so urteile, wenn ich Gefallen an etwas habe, begehre, fhle,
will, da ich so <begehre usw.> Ob mein Erinnern und Erwarten, mein
jeweiliges theoretisches Denken, ob mein sthetisches Stellungnehmen, ob
mein Begehren und Wollen richtig oder unrichtig, vernnftig oder
unvernnftig ist, gut oder schlecht, das darf jetzt, wo ich die apodiktische
Evidenz der egologischen Wahrnehmung, der Wahrnehmung vom ego cogito
feststelle, nicht in Frage sein. Nicht auf Recht und Unrecht meines cogito
darf diese Evidenz im mindesten erstreckt werden; die Stellungnahmen, die
urteilenden und wertenden Meinungen, die Willensmeinungen, die ich jeweils
unter dem Titel ego cogito vollziehe, mgen wie immer beschaffen sein,
eventuell mgen sie eine Evidenz in sich haben, aber ihre Evidenz ist nicht
die Evidenz der egologisch reflektierenden Wahrnehmung. Was diese
apodiktisch feststellt, ist blo die Tatsache, da ich so und so erfahre, mich
erinnere, denke, fhle, will, da ich dabei die und die Stellungnahmen
vollziehe mit den und den Charakteren, die ihnen tatschlich zueigen sind.
Prinzipiell mu ich also beachten, da jedes solche cogito sein cogitatum
hat, zu dem es so und so Stellung nimmt, da ich aber in der reflektiven
egologischen Einstellung keine dieser Stellungnahmen zum cogitatum als
geltend mit aufnehmen darf, da ich keine mitmachen darf. Nur die
Phnomene als Fakta, nur die in ihnen beschlossenen Stellungnahmen als
Fakta konstatiere ich und darf ich konstatieren, wenn ich die rein egologische
Tatsachensphre gewinnen will. Derart also gewinne ich einen reinen Flu
apodiktisch zweifelloser und jederzeit erfassungsbereiter Tatsachen, deren
universaler Cartesianischer Titel ego cogito heit, oder, wie wir aus guten
Grnden dafr sagen werden, die transzendentale oder absolute
Subjektivitt.
Die Ausschaltung der jeweils natural erfahrenen Welt ist danach ein
Sonderfall der universalen Ausschaltung aller Stellungnahmen, die wir in
210
jedem cogito vollziehen mssen, um es als reines Phnomen, als absolute
egologische Tatsache zu gewinnen.
Indessen, es hatte guten Grund, warum wir den Nachweis der mglichen
Nichtexistenz der Welt, whrend sie erfahren ist, so sorgfltig fhrten; denn
es gibt kein anderes, sicher kein eindringlicheres Mittel, um das bergleiten
in den nur zu natrlichen Psychologismus und Naturalismus zu verhten, der
die transzendentale Subjektivitt, wie das schon bei Descartes geschehen ist,
psychologisiert als mens, sive animus, sive intellectus und damit schon im
ersten Anfang den Zugang zu einer echten Transzendentalphilosophie und
Erkenntnistheorie verbaut. Hier ist also der entscheidende Punkt, der
philosophische Scheideweg. Der Unterschied zwischen egologischer
Erfahrung und mundaner Erfahrung ist keineswegs der bliche Unterschied
zwischen uerer und innerer Erfahrung. In der Tat, im ganzen Sinn unserer
Ausfhrungen liegt: Die apodiktische, egologische Wahrnehmung ist
prinzipiell unterschieden von aller mundanen Erfahrung, die letztlich immer
fundiert ist <in> physischer Erfahrung. Und danach ist das apodiktisch
evidente Ego, konkret gesprochen die transzendentale Subjektivitt,
keineswegs die empirisch-introspektiv erfate Seele. Die Psychologie ist
selbst mundane Wissenschaft, Wissenschaft vom menschlichen und tierischen
Seelenleben, also von Tatschlichkeiten der Welt. Alle psychologische
Erfahrung, Selbsterfahrung wie Fremderfahrung, hat ihrem eigenen
psychologischen Sinn gem eine Fundierung in naturaler, in somatologischer
Erfahrung. Wer den Ansatz macht, die erfahrene Welt existiere nicht, wer
radikal dabei bleibt, keinerlei Urteilsstellung zu ihrem Dasein zu nehmen,
der hat der Psychologie so wie allen mundanen Wissenschaften den Boden
unter den Fen weggezogen, der hat alles Psychologisch-Psychische,
Seelische ebenso verloren wie alles Physische. Aber wie wir zeigen werden,
hat er eben damit der Phnomenologie und Philosophie den Boden bereitet.
Jedenfalls die Welt mit allen Seelen und auch mit meiner Seele haben wir
auer Spiel gesetzt durch die phnomenologische Reduktion; aber reduziert
haben wir auf das echte ego cogito, die mgliche Nichtexistenz der Welt zur
Hypothesis verwendet, sie sei nicht, lt unberhrt brig eben diese
transzendentale Tatsachensphre und zeigt zugleich, da diese absolut ist und
in sich geschlossen ist und schlechthin unabhngig ist von Existenz oder
Nichtexistenz der Welt, also in keiner Weise zu ihr gehrt.
Nur so gewinnen wir also die transzendentale Subjektivitt in ihrer
Eigenheit und Reinheit als eine Subjektivitt, die ohne Widersinn nie das
Thema der Psychologie werden kann, die selbst in ihr Phnomen ist. Man
darf hier nicht wie Descartes auf halbem Weg stehen bleiben, was also heit,
ans Ziel berhaupt nicht kommen. Man darf nicht damit sich begngen zu
sagen: Ich als das absolut evidente Ego bin natrlich nicht Ich dieser Mensch.
Denn mein Leib ist selbst nur sinnlich erfahren und braucht nicht zu sein, ich
schalte ihn aus, mache ihn zu meinem bloen Phnomen. Also bin ich reine
211
Seele oder gar, wie Descartes weiter sagt, substantia cogitans. Mit dem Leib
wird auch die Seele zum bloen Phnomen. Inhibieren wir aber alle unter
diesem Wort mitgemeinten naturalen und mundanen Stellungnahmen, dann
ist von Psychologie und Seele keine Rede mehr.
Der Ansatz des Nichtseins der Welt (oder das Sich-jeder-Entscheidung-
Enthalten in Beziehung <auf> die beiden Mglichkeiten des Seins und
Nichtseins der Welt) fhrt, wenn ich reflektiere, auf das absolute, apodiktisch
Evidente Ich habe die und die naturalen Erfahrungen, ich sehe dieses Haus,
whrend ich das Sein des Hauses offen lasse. Ich habe damit den flieenden
zusammenhngenden Zug der naturalen Erfahrung als ein absolut
Existierendes. Aber dieses absolute Ich erfahre dieses Haus, diese Straen
usw. ist nicht alles. Ich stoe nun sogleich auf einen ganz mannigfaltigen
Erlebnisstrom, auf das konkrete ego cogito. Z. B. das Haus sehend mag ich
zugleich Gefallen daran haben, den Wunsch, es zu kaufen, dann den Willen,
daran mag sich schlieen, da ich zu rechnen anfange usw. All das bekommt
seinen absoluten Sinn als ein absolut dahinstrmendes Sein, wenn ich
reflektierend es in seinem eigenwesentlichen Sein, in jener Epoch, nehme.
Es ist ein jeweilig jetzt Seiendes. Dabei ist es jetzt leicht, das, was dabei
individuell als jetzt Seiendes ist, zu unterscheiden von dem, was dabei gemeint
ist, aber nicht selbst als jetzt individuell erfat ist. Urteile ich gerade 2 < 3
und 2 7 = 15, so ist, was die Reflexion als absolutes Erlebnis fat: Ich
urteile 2 < 3, 2 7 = 15. Aber der eine und andere dieser Sachverhalte selbst
ist nicht das cogito, sondern das in ihm Geurteilte und dieses ist einmal ein
wirklich bestehender Sachverhalt und sogar ein apodiktisch evidenter, das
andere Mal ein widersinniger, nicht bestehender Sachverhalt. Aber der
Sachverhalt ist nicht das, was die Reflexion als ego cogito vorfindet. Das
Ich urteile A, das ist das absolut Gegebene; das A selbst findet nicht die
apodiktische Reflexion, sondern das Urteil selbst, wenn es evident ist. Wie
wir, um das absolute Ich erfahre dieses Haus <zu erhalten>, die Existenz
des Hauses ausschalten, den Erfahrungsglauben ansehen, aber nicht als
Reflektierende bettigen, mitmachen, ihn eben nur als Tatsache hinstellen, so
fixieren wir in der Reflexion, wenn wir urteilen 2 2 = 4, nur die Tatsache,
da wir so urteilen, aber nicht das Bestehen dieses Sachverhalts 2 2 = 4.
Wir knnen in dieser Weise konsequent auf jedes Ich erfahre, ich denke, ich
fhle, ich will reflektieren und immer nur diese Tatsache selbst erfassend
setzen und hinsichtlich alles dessen, was da im Erfahrungsglauben selbst
geglaubt, was da im Denken gedacht ist usw., uns jedes Urteils enthalten, wir
knnen berhaupt jede Stellungnahme, die in diesen Ichakten vollzogen ist,
jetzt auer Spiel setzen, in dem Sinn, da wir jetzt sie nicht mitmachen, sondern
nur als Tatsache setzen. Nur dann haben wir die reine egologische Erfahrung
und ihren absoluten Bereich, mgen diese Stellungnahmen richtig oder
unrichtig sein, als Tatsachen sind sie absolut. Die Bevorzugung der
Weltausschaltung besteht aber darin, da, wenn sie nicht bewut vollzogen
212
und nicht die Mglichkeit des Nichtseins erkannt ist, dies unvermeidlich dahin
fhrt, da man die ganze egologische Erfahrung als innere Erfahrung
interpretiert und nicht merkt, da man dann keine reine Erfahrung mehr hat,
sondern eine Belastung mit Voraussetzungen.
Das Prinzip der radikal werdenden Philosophie und das bleibende Prinzip
der Phnomenologie ist der extremste Radikalismus der intuitiven Adquatheit
aller Feststellungen in allen systematischen Stufen. Auf der jetzigen Stufe
sagt das: Nicht um eine Haaresbreite darf ich ber das apodiktisch Gegebene
der Reflexion hinausgehen und ber seine adquate und reine Deskription.
Also jedes Wort, das ich aussage, jeder Begriff, den ich verwende, mu rein
aus dem apodiktischen Wahrnehmungsbestand genommen sein. Ein
Hereinziehen von Begriffen, die ich andersher habe, etwa gar aus
philosophischer Tradition, von mens, animus, intellectus, substantia cogitans,
das ist ein vlliger Abfall von dem philosophischen Ziel, es ist eine Art
philosophischer Todsnde. Demgem nehmen wir also jetzt als Resultat nicht
mehr, als was wir absolut vertreten knnen; es gibt apodiktisch evidente,
reflektive Erfahrung, der ich mich methodisch durch jene eigentmliche
Ausschaltung, wir nennen sie die phnomenologische Reduktion, versichere.
In ihr gewinne ich einen absolut zweifellosen Erfahrungsboden, ein
Seinsgebiet in sich, absolut in sich geschlossen, und zwar als Gegenstand
reiner Wahrnehmung. Es ist, was es ist, ob die Welt existiert oder nicht existiert.
Anderseits htete ich mich zu sagen, es ist auerhalb der Welt, getrennt
von der Welt, wie ich mich hte zu sagen, es ist ein Stck, ein mir evident
gegebenes Stck der Welt. Nur das darf ich sagen, da zu dieser gegebenen
Sphre von Wahrgenommenheiten alle meine Erfahrungen von der Welt rein
als meine Erlebnisse gehren, und darin liegt eine Beziehung; was fr eine,
darber kann ich jetzt noch nichts sagen.
II. Das Reich der phnomenologischen Erfahrung und die
Mglichkeit einer phnomenologischen Wissenschaft. Die transzendentale
Phnomenologie als Wesenswissenschaft der transzendentalen
Subjektivitt
Versetzen wir uns wieder in die Einstellung der philosophischen Ichmeditation
und in die Ichrede. Also ich, der werdende Philosoph, bin, sozusagen um
meines erkenntnisethischen Seelenheiles willen, auf der Pilgerfahrt nach
universaler und absolut gerechtfertigter Erkenntnis begriffen und habe das
ego cogito erreicht als eine Sphre apodiktisch evidenter Erfahrung. Was kann
ich damit theoretisch anfangen? Gilt es, den Wegen Cartesianischer
Metaphysik <zu> folgen, also aus der mir angeblich zweifellos gegebenen
Realitt des eigenen Ich die brige reale Welt mittelbar zu erschlieen;
oder ist es auf eine spekulierende Ichmetaphysik abgesehen?
213
Das ist fr mich ausgeschlossen. Ich will nicht spekulieren, sondern ganz
ausschlielich aus den originalen Quellen adquater Anschauung schpfen.
Nur das, was ich schauend direkt erfasse, in adquater Weise selbst gegeben
habe, soll mein Grund sein. Nur daher darf das rechtfertigende Prinzip jedes
Denkschritts genommen sein.
Was wir andererseits gegen Descartes schon gesagt haben, das verschliet
uns eo ipso all seine weiteren Wege und alle von ihm sich ableitenden
kritischen Realismen. Das Ego ist nicht eine der Realitten, nur fr mich
durch adquate Evidenz ausgezeichnet. Es ist das Gegebene der
phnomenologischen Erfahrung, die ihre Kraft dadurch gewinnt, da alle
naturale Erfahrung und somit alle Realittserfahrung auer Kraft gesetzt ist.
Das Ego ist also keine Realitt und kein mglicher bergang fr
Realittsschlsse, die immer nur von Realem zu Realem laufen knnen und
an die natrliche Einstellung gebunden sind.
Wie will ich nun weiterkommen? Es ist klar, ehe ich weiter berlegen
kann, was ich an dem ego cogito habe, wiefern es als Boden einer Wissenschaft
tauglich sei, mu ich es mir nher ansehen. Und in der Tat, es tut sehr not, mich
im egologischen Erfahrungsbereich umzutun. Denn er ist mir ein vllig Fremdes.
Das Reich der mundanen Erfahrung war mir, dank der unermdlichen
Erfahrungsarbeit der Kinderjahre, nach ihrer konkreten Typik wohlvertraut,
lange ehe ich an Erfahrungswissenschaften herantrat; und ohne reich
durchgebildete Erfahrungskenntnis htte es nie zu einer Erfahrungswissenschaft
kommen knnen. Andererseits habe ich aber niemals reine Phnomene erschauen
und in ihrer eigentmlichen Typik kennen und beschreiben gelernt. Erst die
phnomenologische Reduktion hat mir, der ich vordem nur als natrlicher
Mensch unter Menschen und in der Welt gelebt hatte, das phnomenologische
Auge geffnet und mich gelehrt, das Transzendental-Subjektive zu erfassen.
Ich mu mich also erst umsehen und ein wenig in dem neuen Reich orientieren.
Freilich, eine gar lange phnomenologische Kinderzeit wird mir nicht erspart
sein, wenn ich weitreichende Kenntnis, ber die ich nachher theoretisch verfgen
kann, gewinnen will.
Zur Sicherung der Reinheit aller Erfassungen und Beschreibungen mu
ich dabei bestndig die unverbrchliche Regel der phnomenologischen
Reduktion, oder, wie wir auch sagen, die der phnomenologischen Epoch,
der phnomenologischen Einklammerung im Auge behalten; 1. nmlich
bei jedem bergang in die Ichreflexion, mit der ich zunchst nur ein
psychologisches oder psychophysisches Weltfaktum gewinne, mu ich jede
Mitsetzung objektiven realen Seins unterbinden und das in jeder mglichen
Richtung, also an dem jeweiligen Ich denke das und das, ich begehre, tue
das und das, ich gehe spazieren usw. sowohl bei dem Titel Ich wie bei
dem Titel Spazieren, Denken, nach Ruhm, nach Nahrung Begehren u.
dgl. Nur das pure Erleben als Tatsache, das, was unangefochten bleibt, auch
wenn ich annehme, es sei keine Welt, ist das apodiktische, das transzendentale
214
Phnomen der Phnomenologie. 2. Aber nicht nur jede Seinssetzung der
Welt und jede sonstige urteilende Stellungnahme in Bezug auf sie schalte ich
so aus, sondern berhaupt jede Stellungnahme, die im jeweiligen cogito selbst
liegt. Nur die Tatsache, da ich so und so urteile, so und so werte, die und die
Zwecke mir stelle usw., fixiere ich, nur sie ist mein Phnomen. Nur sie ist in
der phnomenologischen Reflexion apodiktisch gewi. Die Stellungnahme
aber, die im Urteil selbst, in der Wertung selbst, in der Zwecksetzung selbst
liegt, mache ich nicht mit. Miturteilen, Mitwerten, berhaupt Mit-Stellung-
Nehmen, das heit, wahrgenommenene Gegenstnde, den geurteilten
Sachverhalt, den gefhlten Wert usw. als wahrhaft seienden Sachverhalt, als
wirklichen Wert setzen. Es heit, etwas als seiend setzen, was nicht zum
adquat erschaubaren Bestand des cogito selbst gehrt. Wahrnehmend,
urteilend, wertend usw. meine ich das und das. Nur dieses wahrnehmende,
urteilende, wertende Meinen, das konkrete meinende Erleben ist das Faktum,
das die phnomenologische Reflexion rein und in berall gleicher Weise als
apodiktisch evidente Tatsache herausstellen kann. Ob das wahrgenommene
Ding wirklich existiert, ob der gemeinte Sachverhalt zu Recht besteht, ob der
vermeinte Wert ein wirklicher Wert ist, ist jetzt nicht in Frage, und sicher ist
jedenfalls, da Dinge, dingliche Gter und so die ganze erfahrene, gedachte,
gewertete Welt selbst im meinenden Erlebnis (im wahrnehmenden, urteilenden
usw.) nicht als reelle Komponente enthalten sind. Denn das Nichtsein der
Welt berhrt ja nicht das Sein dieser reinen Erlebnisse. Das gilt fr alles ber
den reellen Gehalt hinaus Gemeinte. Will ich gegebenenfalls das reine
Phnomen gewinnen, so mu ich zunchst berhaupt alles ausschalten,
was darin als Seiendes, Wahres, Rechtes gesetzt ist, d. i. Ich als Phnomenologe
darf nicht miturteilen, mitwerten usw.
Diese Unterbindung aller im natrlichen und zu reinigenden ego cogito
liegenden Stellungnahmen nennen wir die phnomenologische Epoch. Auch
die bildliche Rede von der Einklammerung, die wir viel gebrauchen, ist damit
verstndlich. Wo immer ich in die reflektive Einstellung bergehe, ein Stck
gelebtes Leben, ein Wahrnehmen, Urteilen etc. in der Gestalt Ich sehe,
Ich urteile erfasse und eventuell ausspreche, da bringe ich im Geiste sofort
einen Index der Ausschaltung, eine Klammer an, als Symbol, das da mahnt,
in jeder Hinsicht an diesem ersten Ich denke die Epoch zu ben, weil ich
erst dadurch das phnomenologische Datum ego cogito, die transzendentale
Tatsache, gewinne.
Diese Regel der Einklammerung mahnt mich zugleich, schlechthin keine
der natrlichen Aussagen in das phnomenologische Gebiet einzuschmuggeln.
Verwehrt ist jede Aussage ber ein Wahrgenommenes schlechthin, ber das
Gewertete schlechthin, Bezweckte schlechthin usw., wie sie der natrlich
Naive im Wahrnehmen, im Werten, Streben lebend ohne weiteres und
geradehin ausspricht, denn dabei spricht er ber die Dinge, die existierenden,
ber dieses Schne, jenes Ntzliche, in einer Weise, die all das als Seiendes,
215
Wahres setzt. Ich als Phnomenologe darf keine anderen Aussagen machen
als solche der Ichreflexion. Ich darf nicht sagen: Der Himmel ist blau,
sondern hchstens Ich sehe, da der Himmel blau ist. Das tut oft auch der
naive Mensch. Aber wenn er gelegentlich in reflexive Einstellung bergeht,
bleiben diese Setzungen erhalten. Aber nur dadurch, da ich nicht nur auf
mein soeben naiv gelebtes cogito reflektiere, sondern in eins damit alle darin
gelegenen Setzungen unterbinde, also Epoch be, verwandelt sich die
natrliche Reflexion in die phnomenologische Reflexion, und speziell, was
hier allein in Frage ist, in die phnomenologische Wahrnehmung, in der das
ego cogito als rein transzendentale Tatsache heraustritt. Nur als dieser
unbeteiligte Zuschauer meines natrlichen Icherlebens kann ich darin mein
absolutes Sein und Wesen erschauen.
5
Nun ist es aber wichtig zu beachten, da mit der Einklammerung nicht
etwa das Eingeklammerte aus dem Bereich der phnomenologischen
Betrachtung einfach verschwindet. Vielmehr in der Modifikation, die das Bild
der Klammer zugleich andeutet, gehrt doch wieder alles Eingeklammerte
mit zum transzendentalen Phnomen und zu seinem ganzen unabtrennbaren
Wesensbestand. Das wird am Beispiel klar. Sehe ich in den blhenden Garten
hinaus und freue ich mich an der Frhlingspracht, so ergibt die Reflexion als
transzendentales, als absolut egologisches Faktum eben dies Ich sehe das
und das, Ich freue mich u. dgl., wiefern ich nur nicht mitglaube, mitwerte,
nmlich als phnomenologischer Zuschauer. Ob dieser Garten existiert oder
nicht existiert, und mag die ganze Welt nicht existieren, das reine Phnomen
Ich nehme wahr bleibt bestehen; aber es bleibt auch bestehen das Ich
nehme diesen blhenden Garten wahr. Das Ganze steht in Klammer, ist reines
Phnomen. Aber untrennbar gehrt zum Wahrnehmen, als solchem reinen
Phnomen, da es Wahrnehmen von dem darin so und so wahrnehmungsmig
Vermeinten ist. Ebenso gehrt zum Schn-Werten dieses Gartens, da es
Werten dieser bestimmten Gartenschnheit ist und die Epoch gibt dem nur
eine Klammer. Also zum phnomenologischen Wesen der Wahrnehmung
gehrt, das Wahrgenommene als solches, der Wertung das Gewertete als
solches, zum Begehren das Begehrte als solches usw., genau so, wie es
eben darin Wahrgenommenes und sonstwie Bewutes ist.
Jedes cogito, und zwar so genommen, wie es transzendental gereinigtes
ist, wie es transzendentales oder phnomenologisches Datum heit, ist also
cogito seines cogitatum. Seines cogitatum, damit soll gesagt sein, es ist nicht
ein beliebiges, sondern deskriptiv bestimmtes; mag der Garten ein
Traumgarten, ein illusionrer sein, ich sehe ihn als diesen, in diesem Sehen
so und so bestimmten und zu beschreibenden. Urteile ich, in der Mathematik
schlecht unterrichtet, es gebe regelmige Dekaeder, so ergibt die
phnomenologische Reduktion auf das transzendentale Phnomen eben dieses
Urteilen als absolutes Erleben und so ist darin als Geurteiltes die Existenz
von regelmigen Dekaedern, in Klammern natrlich, also die geurteilte
216
Existenz als geurteilte. Ist das Urteilen ein evidentes, sagen wir 2 < 3, so ist
das deskriptiv zum absoluten Phnomen selbst Gehrige eben dieses, evidentes
Urteilen davon, da 2 < 3 ist. Aber auch hier habe ich als Phnomenologe
diese Evidenzsetzung nicht mitzumachen, sondern nur als tatschlichen
Charakter des Urteilens oder des Geurteilten als solchen ins Auge zu fassen.
Das also gilt von jedem cogito oder in blicher Rede von jedem
Bewutsein. Jedes Bewutsein ist Bewutsein von dem in ihm Bewuten,
und dieses Bewute als solches genommen, genau so, wie es im Bewutsein
zu finden ist, gehrt (in der Einstellung der Epoch) zum Bereich der
transzendentalen Subjektivitt. Also haben wir nicht, wie in der
Cartesianischen Rede ego cogito, einen Doppeltitel, sondern einen
dreifachen, der in der Tat, wie sich herausstellt, dreifache, obschon miteinander
untrennbar sich verflechtende Beschreibungen zult: ego-cogito-cogitatum.
Will man also die transzendentale Subjektivitt, oder wie wir auch gerne
sagen, das Reich egologischer Tatsachen kennenlernen, so mu man in unserer
Methode und im Rahmen der reinen Anschauung, die sie ermglicht, die
transzendentale Subjektivitt und ihr Bewutsein selbst befragen und
insbesondere einzeln jedes Bewutsein selbst befragen nach dem, was in ihm
das Bewute ist und genau, wie es da Bewutes ist. Bewut ist irgendwelches
Gegenstndliche, ein Gegenstndliches in Klammern, wir sagen intentionaler
Gegenstand, und dieses Gegenstndliche hat, je nachdem <wie> das
Bewutsein ist, hchst mannigfaltige Modi der Gegebenheit, des Wie es da
Bewutes dieses Bewutseins ist. Jeder intentionale Gegenstand, sagen wir, ist
in mannigfachen intentionalen Modis bewut. Das Bewutsein als
intentionales Erlebnis, sagen wir, hat mannigfache intentionale Gehalte. Bald
ist es bestimmt bewut, bald unbestimmt, <bald> aufmerksam, <bald> nicht
aufmerksam, bald klar, bald mehr oder minder unklar, bald anschaulich, bald
leer <und> unanschaulich, bald bekannt, bald fremd. Bald ist es ein schlichtes
Bewutsein bzw. ein in schlichter Weise Bewutes, bald ist es in fundiertem
oder in einem synthetischen Bewutsein Bewutes und hat dann als Bewutes
seine eventuell sehr komplizierten Schichten und Strukturen. Ist das Bewutsein
ein anschauendes, so kann es wahrnehmendes Bewutsein sein oder
wiedererinnerndes oder vorerinnerndes oder anschauend durch Abbildung usw.
Das anschauende kann eventuell aber auch ein nicht anschauendes in sich bergen
bzw. Unterlage eines darauf geschichteten ausdrckenden Bewutseins sein,
eines spachlichen Bewutseins mit Wortlautbewutsein, Bedeutungsbewutsein,
eventuell zugleich klar bezogen auf anschaulich Gegebenes.
Schon im ersten berschlag stt man auf mannigfaltige Titel, zunchst
als Titel natrlich-psychologischer und logischer, ethischer, sthetischer
Reflexionsbegriffe wie Erfahrung, Denken, begriffliches, prdikatives Urteilen,
Schlieen usw., aber auch Fhlen, sthetisch und ethisch Werten, Wnschen,
Begehren, Wollen. Zunchst sind es lauter Titel natrlich-psychologischer
Reflexion, deren jeder aber selbstverstndlich einen mglichen Anla gibt zu
217
phnomenologischen Reduktionen und zu Erfassungen egologischer Phnomene
und Phnomenstrukturen; bald solchen, die das Erlebnis selbst nach seinen
reellen Bestnden betreffen, bald seine intentionalen Gehalte, die intentionalen
Modi, in denen das Gegenstndliche bewut ist.
Allerdings, was der natrlichen Reflexion gar einfach erscheint, das stellt
sich, wenn man tiefer eindringt, bald als hchst verwickelt heraus. Und nicht
nur ist die Flle der Typen, auf welche uns schon jeder einzelne psychologische
Titel leitet, eine bergroe; schon die einfachsten Titel, wie der schlichten
sinnlichen Anschauung und zunchst der Wahrnehmung, fhren, sowie man
nur ernst anfngt, in Urwlder verschlungener Analysen. Freilich mu man
mhsam das reine Sehen lernen, das ist Lernen, alles Hineinmengen von
Gedanken und berzeugungen, die der natrlichen Einstellung entsprungen
sind, zu vermeiden. So wie man es darin im mindesten fehlen lt, hat man
die phnomenologische Deskription unheilbar verdorben.
Es wre beispielsweise ein ganz verkehrtes Vorgehen bei der ueren
Wahrnehmungsanalyse, wenn man geleitet durch sensualistische Traditionen
damit anfangen wollte zu sagen: Wahrgenommen sind Komplexe von
Sinnesdaten. Sinnesdaten sind und in der Regel sogar falsche Produkte
einer theoretischen Analyse in psychologischer Einstellung. Aber der
notwendige Anfang jeder phnomenologischen Beschreibung ist das konkret
volle Phnomen, genau so wie es der unmittelbaren Anschauung sich darbietet.
Direkt mu nach unserer Methode jede Aussage aus der reinen Anschauung
geschpft werden. In dieser Hinsicht ist es klar, da das Erste nicht ist: Ich
sehe Empfindungsdaten, sondern: Ich sehe Huser, Bume usw., Ich
hre von ferne her Glocken, einen Wagen rasseln etc. Also in der
Wahrnehmungsanalyse habe ich dieses Sehen als Sehen von Dingen zu
befragen, inwiefern unter den Dingen oder an den Dingen als gesehenen, als
in jedem anderen Sinne wahrgenommenen, so etwas vorkomme, was
Sinnesdatum zu nennen wre.
Gehen wir dem ein Stck nach, an irgendwelchen Exempeln von
Dingwahrnehmungen. Machen wir dabei einen ersten, noch ganz rohen
Versuch eines Anfangs phnomenologischer Wahrnehmungsanalyse. Ich
nehme etwa ein Haus wahr. Als Phnomenologe, als unbeteiligter Zuschauer
schaue ich mir dieses Wahrnehmen an. Sehend bewege ich die Augen, trete
einen Schritt vor oder zur Seite, trete heran und betaste usw. Geachtet sei auf
das transzendental reine Phnomen des Sehens und wie das Gesehene sich
rein phnomenologisch charakterisiert. Da bemerke ich, da hier ein
kontinuierlicher Wandel von Sehen und Gesehenem vorliegt. Kontinuierlich
bin ich wahrnehmend auf das Haus gerichtet, das als eines immerfort
wahrnehmungsmig vermeintes bleibt. Aber es, dasselbe Haus, sehe ich in
immer wieder verschiedener Weise, einmal jetzt von dieser, dann von jener
Seite und immer nur von irgendeiner Seite. Aber nicht blo das, wir bemerken
zugleich, da das Ding in verschiedener Perspektive sich darstellt und da
218
auch jedes Merkmal, jedes gesehene Flchenstck und seine Frbung im
wandelbaren Wahrnehmen seine Erscheinungsweise ndert. Dieselbe
Flchengestalt und dieselbe unvernderte Farbe des als unverndert gesehenen
Hauses sieht, wie wir zu sagen pflegen, sehr verschieden aus, je nach dem
Standpunkt, von dem aus wir es sehen. Nun ist es klar: Die gesehene Dingfarbe,
die des intentionalen Gegenstands, ist immerfort unterschieden von der Farbe,
in der sie erscheint. Zum reinen Phnomen gehrt beides; die eine Farbe, die
reelles Moment des momentanen Erlebnisses ist und im Flu der
Wahrnehmung sich ndert, knnen wir sehr wohl das Empfindungsdatum
Farbe nennen. Die darin sich darstellende Dingfarbe aber ndert sich nicht,
solange das Ding als unverndertes wahrnehmungsmig bewut ist. Sie ist
Farbe des intentionalen Gegenstands.
Die nhere Erforschung dieser Verhltnisse und der Fortgang der
Wahrnehmungsanalyse wrde ins Endlose fhren; klar ist aber schon, da
man nicht so einfach mit Sinnesdaten, die man nie phnomenologisch
herausgearbeitet hat, anfangen und sie wie eine selbstverstndliche Sache
behandeln kann. Eine rein deskriptive Einstellung in unserer Methode lt
bald hervortreten, da es eine beraus komplizierte Intentionalitt ist, welche
Raumdinge und ihre Eigenschaften anschaulich mglich macht und da die
Art, wie das durch mannigfaltige Erscheinungsweisen, Perspektiven etc.
zustande kommt, nicht eben leichte intentionale Analysen fordern drfte.
In der Tat, fngt man einmal ernstlich an, so erffnet sich eine endlose
Mannigfaltigkeit von rein phnomenologischen Eigenheiten; so am intentionalen
Naturgegenstand die mit dem Wandel der perspektivischen Erscheinungsweise
Hand in Hand gehenden Unterschiede der Orientierung, des Hier und Dort, der
Nhe und Ferne, die schlielich in den Fernhorizont bergeht; ferner die
Rckbezogenheit aller Erscheinung auf die eigene Leiblichkeit, die in ihrer
Sonderstellung eine Flle eigener phnomenologischer Charaktere hat. Mein
Leib ist stndiger Nullpunkt der Orientierung, das stndige Hier fr alles Dort;
er ist Trger der Sinnesfelder, ist frei beweglich in einem einzigartigen Sinn,
seine kinsthetische Bewegungsart ist vllig anders als die mechanische der
sonstigen erscheinenden Dinge. Er ist System von Wahrnehmungsorganen und
als Wahrnehmungsleib bei allen wahrgenommenen Dingen beteiligt usw. All
das ist hier nicht psychologisches noch physikalisches Thema, sondern ist unter
strenger Epoch hinsichtlich aller Objektivitt im Rahmen reiner Phnomene
aufzuweisen und <zu> beschreiben.
Hierher gehrt die phnomenologische Analyse der Einfhlung, der Art,
wie fremdes Bewutsein sich in einem fremden Leib ausdrckt, wobei es
sich um eine intentionale Analyse des Bewutseins fremder Leib und um
die intentionale Analyse dieses Ausdrucks handelt. Das alles sind Titel fr
sehr umfangreiche Analysen.
Richten wir unser Augenmerk noch auf einige neue deskriptive Richtungen.
Wir halten den Gegenstand, etwa das zunchst gesehene Haus, fest und lassen
219
verschiedenes und verschiedenartiges Bewutsein darauf bezogen sein, das
sich dadurch zugleich kontrastiert: also derselbe Gegenstand wahrgenommen
und die Wahrnehmungen von ihm, die Erscheinungsweisen, Orientierungen
etc. abgewandelt gedacht; derselbe Gegenstand dann als wiedererinnert, als
durch Abbilder dargestellt, als sonstwie vorgestellt, in die Phantasie versetzt
etc. Es ist aber nicht zu bersehen, da das Identittsbewutsein als Bewutsein
vom Einen und Selben eine eigene phnomenologische Grundtatsache
darstellt; jedes Bewutsein kann mit anderem und mannigfaltigem Bewutsein
(kontinuierlich oder diskret) so zur Einheit kommen, da ein synthetisches
Bewutsein von demselben hier und dort bewuten Gegenstand erwchst. Man
mache sich dabei folgendes klar: Wenn verschiedene Bewutseinserlebnisse
sich auf dasselbe beziehen, so gehrt zu jeder der Vorstellungen ihr
intentionales Etwas, ihr Gegenstand. Aber jede Vorstellung hat im Zeitstrom
der Phnomene ihre Zeitstelle und Zeiterstreckung und ist von jedem
nachfolgenden Erlebnis nach allen reellen Stcken getrennt. Trotzdem knnen
getrennte Wahrnehmungen und sonstige Bewutseinserlebnisse identisch
Selbes bewut haben, das eventuell in Evidenz als ihr identischer intentionaler
Gegenstand aufgewiesen werden kann. Dieses Selbe ist also gegenber den
einzelnen Erlebnissen ein Ideales, das heit nicht-reeller Teil. Beziehung
auf intentionale Gegenstndlichkeit besagt also eine phnomenologisch
aufweisbare Polarisierung der Erlebnisse, wonach mannigfaltige cogitationes
denselben idealen Pol in sich tragen. Auf ihn beziehen sich, um noch eine
allerwichtigste Seite der phnomenologischen Momente anzudeuten, alle
Stellungnahmen, so insbesondere alle Modalitten des Glaubens so wie die
Modalitten der Aufmerksamkeit, der Affektion.
Indem wir diese nennen, werden wir zugleich darauf aufmerksam, da
phnomenologische Momente nicht nur aufweisbar sind erstens als reelle
Momente des jeweiligen cogito, so wie es zeitverbreitetes Erleben ist, frs
zweite nicht nur als ideelle Momente am cogitatum als dem intentionalen
Gegenstand und dem Sinn, in dem er mit den und den Merkmalen bestimmt
oder unbestimmt bewuter ist; vielmehr wird drittens auch das Ich zum eigenen
Thema der Beschreibungen. Etwas kann mir bewut sein, aber ich bin nicht
dabei; es kann einen Reiz auf mich ben, wie ein scharfer Pfiff, der mich
strt, whrend ich mich <ihm> doch noch nicht zuwende. Er kann mich
schlielich zu sich hinreien; und nun geht nicht nur vom Gegenstand ein
Zug, ein Reiz auf mich, sondern ich werde zum Ich, das von sich aus auf den
Pfiff hinmerkt und fr ihn sozusagen wach wird.
Und nun wird das Ich zum stellungnehmenden Ich. Von sich aus erfat es
den Gegenstand, expliziert, identifiziert, unterscheidet und verhlt sich dabei
als ttig glaubendes Ich, als Ich, das solches Tun in Gewiheit oder vermutend,
fr wahrscheinlich haltend usw. vollzieht oder ttig begehrend nach dem
Vorgestellten strebt, realisierend eingreift oder sich nur entschliet. Das Ich
bezeichnet also eine eigenartige Zentralisierung oder Polarisierung aller
220
cogitationes, und eine total andere als die intentionalen Gegenstndlichkeiten;
es ist das eine, absolut identische Zentrum, auf das alle in den cogitationes
intentional beschlossenen Gegenstndlichkeiten in Form von Affektion und
Aktion bezogen sind. Wie das Ich, so modalisiert sich jedes cogito und jedes
cogitatum je nach Art solcher Akte oder Affekte. Ich bin gewi der
Gegenstand seinerseits steht da als gewi seiend, ebenso in anderen Fllen
als mglicher, als wahrscheinlicher, zweifelhafter, wieder in Gemtsakten
als schner, guter, als Zweck, als Handlungsziel, als Mittel usw.
Auf die spezifischen Akte, wie wahrnehmenden, erinnernden, prdizierenden,
wertenden bezieht sich dann der hchste phnomenologische Titel, der der
Vernunft. Hierher gehrt der Unterschied des sachfernen Vermeinens und
des Selbsterfassens, Selbsterschauens, Einsehens von seiten des Gegenstands
bezeichnet, das Eigentmliche der Selbstgebung der Unterschied des
vollkommenen und unvollkommenen Erschauens und dann die mannigfaltigen
phnomenalen Vorkommnisse, die sich auf die Titel Evidenz und Begrndung,
von Bewhrungen von Meinungen als richtig, von Abweisungen als nichtig
beziehen. Wo immer von wahrem Sein, von wahren Werten und Gtern, von
rechtmigen Zwecken und Mitteln, schon von normalen Erfahrungen
gegenber illusionren <die Rede ist>, werden wir auf diese phnomenologische
Sphre verwiesen und alle die eben gebrauchten Worte drcken ursprnglich
selbst solche intentionalen Charaktere aus.
Diese Andeutungen mssen uns gengen, um die berzeugung zu
erwecken, da hier ein fast unendliches Feld konkreter Phnomene unter dem
Titel ego cogito befat ist, sozusagen eine Welt fr sich und eine rein intuitiv
aufweisbare Welt, aber ausschlielich beschrnkt auf mein Ich, mein, des
phnomenologisch Reflektierenden. Ich, der ich die phnomenologische
Epoch vollziehe, mache mich zum unbeteiligten Zuschauer all dessen, was
ich als natrlich eingestelltes Ich durchlebe, darin an Realitten und Idealitten,
an Wirklichkeiten und Mglichkeiten, an Werten und an Gtern setze. Mein
zuschauendes Tun ist ein bestndiges Reflektieren, das als solches ein
sozusagen gerade <gerichtetes>, naives Hinleben und Tun voraussetzt. Von
der geraden Hinwendung auf die Sachen, <vom> Hinurteilen, Hinerfahren,
Hinwerten biege ich mich gleichsam zurck und sehe mir das Geschehen an
und dringe sogar in die passiven Untergrnde des Bewutseins ein; aber immer
einem rein augenhaften Geist gleichend, der keine Stellungnahme mittut,
sondern nur als Tatsache ersieht und fixiert.
Nachdem uns die Umschau in der phnomenologischen Sphre gezeigt
hat, da die scheinbar armselige Evidenz des ego cogito in der
phnomenologischen Reduktion einen endlosen Bereich vielverschlungener
Phnomene erffnet, einen phnomenologischen Urwald sozusagen, wird nun
die Frage brennend, wie wir von der bloen, wenn auch apodiktischen
Anschauung zu einer Phnomenologie, einer Wissenschaft von der
transzendentalen Subjektivitt kommen sollen. Als werdender Philosoph stand
221
ich zunchst in der erfahrenden Einstellung, reflektierend erfate ich mich
als das faktische Ego und meine faktischen cogitationes. Zunchst denke ich
also an eine Tatsachenwissenschaft und sie mu als erste durchaus den
geforderten Charakter der absoluten Rechtfertigung zeigen. Ist eine solche
hier mglich? Ist an eine Art Analogon der empirischen Psychologie zu denken,
einer rein egologischen Wissenschaft vom Ich und seinen Erlebnissen mit
ihren intentionalen Gehalten, nur nicht auf objektiver naturaler Erfahrung,
sondern auf phnomenologischer Erfahrung gegrndet?
Aber bald kommen mir ernste Bedenken. Zunchst bemerke ich, da die
phnomenologische Wahrnehmung neben sich auch eine phnomenologische
Erinnerung und Vorerwartung hat, die sekundre Erfahrungsfunktion ben
knnen. Wenn ich solche Erlebnisse nicht nur als besondere phnomenologische
Fakta der aktuellen Gegenwart hinnehme, sondern als Eingangstore der
Erkenntnis der Vergangenheit und Zukunft, so erkenne ich, da die
transzendentale Subjektivitt sich in eine endlose Vergangenheit und Zukunft
hinein erstreckt. In der Tat unwillkrlich tue ich so und nehme mich auch als
reines Ego bezogen auf einen unendlichen immanenten Zeitstrom. Aber mit
welchem Recht?
Reicht die apodiktische Evidenz ber die aktuelle Gegenwart hinaus? Schon
hinsichtlich der Gegenwart mu ich mir sagen, da vieles und das meiste
phnomenologisch Unerfahrene entfliegt, und selbst was ich zur
wahrnehmenden Erfassung bringe, entwindet sich der Wahrnehmung und ich
mte berlegen, wie es mit der Evidenz der unmittelbaren Retention steht;
erst recht aber hinsichtlich der Wiedererinnerung, deren apodiktische und
adquate Evidenz nicht so ohne weiteres wird behauptet werden knnen.
Vielleicht bin ich geneigt, auf die absolute Evidenz des Ich bin zu bestehen,
und zwar auch fr <die> Vergangenheit, also eine Vergangenheit als die meine
festhalten zu wollen. Aber schwerlich werde ich dann leugnen knnen, da
trotzdem die Adquation fehlen knne, nmlich hinsichtlich des konkreten
Gehaltes des Vergangenen. Es ist ja klar, da Erinnerungstuschungen nicht
nur in natrlicher Einstellung mglich sind, sondern phnomenologisch
reduziert phnomenologische Erinnerungstuschungen in sich bergen. Mu
ich aber eine phnomenologische Epoch neuer Stufe hinsichtlich aller
Wiedererinnerung und Erwartung fordern und verliere ich so das immanente
unendliche Zeitfeld, so ist nicht einmal mehr von einer objektiven Feststellung
von transzendentalen Phnomenen die Rede, geschweige denn von einer
Tatsachenwissenschaft. Denn eine Art Objektivitt fordert jede, auch
egologische Feststellung, um eben Feststellung heien zu knnen. Was ich
als seiend und so seiend feststelle, prtendiert damit mein bleibender geistiger
Besitz zu sein, auf den ich als den meinen immer wieder zurckkommen und
den ich in immer sich wiederholender Evidenz identifizieren kann.
Dergleichen setzt offenbar das Recht der Wiedererinnerung voraus. Die
Objektivittsform der immanenten Gegenstndlichkeiten als immer von neuem
222
durch Wiedererinnerung identifizierbare ist die immanente Zeit. Mit der
Einklammerung der Wiedererinnerung und der immanenten Zeit verliere ich
jedes identifizierbare Sein, mit den objektiven, gegenber der flchtigen
Wahrnehmung und momentanen Wiedererinnerung an sich seienden
egologischen Tatsachen verliere ich auch jede mgliche Wissenschaft dieser
Tatsachen.
So scheint unsere Fahrt nach dem gelobten Lande der Philosophie ein frhes
Ende zu erreichen; unser Schifflein ist gestrandet. Denn apodiktische
Evidenz lt sich nicht erzwingen und eine absolut zu rechtfertigende
Tatsachenwissenschaft ist, wenn berhaupt, mit den Mitteln des Anfangs nicht
zu begrnden. Dieses Ziel mssen wir also wirklich aufgeben, aber keineswegs
darum unser philosophisches Ziel berhaupt und unsere Methode mit der
Grundforderung der adquaten und apodiktischen Evidenz als Urquell aller
Rechtfertigungen.
Es gilt hier, eine entscheidende Einsicht zur Geltung zu bringen, von der
die Mglichkeit einer Phnomenologie und damit, wie zu zeigen sein wird,
die Mglichkeit einer Theorie der Vernunft und einer Philosophie durchaus
abhngig ist.
Es handelt sich darum, sich von einem verhngnisvollen Vorurteil zu
befreien, das Jahrtausende lang Empirismus und Rationalismus feindlich
voneinander trennte, whrend sie sich selbst besser verstehend in allem
einig sein mten. In der inneren Entwicklung der Phnomenologie aus
einer rein immanenten Deskription der Phnomene des nach seinem absolut
eigenen Wesen betrachteten Bewutseins mute das Nachdenken ber die
Art und Leistung solcher Deskription zur Einsicht fhren: 1. da das All
solcher Deskription doch nur auf das Allgemeine, das Typische gerichtet
sei und nur das erfassen knnte; 2. da alle solche reinen Beschreibungen
adquate Beschreibungen von allgemeinen Mglichkeiten, Notwendigkeiten
usw. waren, deren Geltung von der Existenz der zuflligen bentzten
Einzelexempel unabhngig sei; 3. da somit diese Beschreibungen den
Charakter von objektiven und apodiktischen Feststellungen hatten. Nehmen
wir dazu die parallel damit erwachsene Erkenntnis, da eine allgemeine
Logik als mathesis universalis, als Wissenschaft von Gegenstnden, Stzen,
Wahrheiten berhaupt unter dem Titel Gegenstand nicht speziell an Reales
denken drfe, sondern da Gegenstand etwas berhaupt bedeutet, d.i. alles und
jedes, was Substrat einer wahren Aussage werden kann; damit war alles
vorbereitet, das Auge fr <die> Einsicht zu ffnen, da wie jeder
Dinggegenstand seine Dingerfahrungen hat, so jeder Gegenstand berhaupt
jeder erdenklichen Gegenstandskategorie seine entsprechenden Erfahrungen
wird haben mssen; alle Erkenntnis beruht auf Erfahrung, aber fr jede Art
Gegenstand auf Erfahrung derjenigen Erfahrungsart, die ihm eigentmlich ist.
Was wir also fordern, ist eine ungeheure Extension des Begriffs der Erfahrung,
durch die er zum Korrelatbegriff fr den formallogischen Begriff des
223
Gegenstands wird. Ein Gegenstand ist ein Ding, ein Mensch, ein Verein, Volk,
Staat, ein phnomenologisches Datum, ein Sachverhalt, ein Satz, eine prdikative
Wahrheit, eine Zahl, eine Mannigfaltigkeit, eine Gattung kurz alles und
jedes, das als wahrhaft seiend bezeichnet werden darf. Und von all dem gibt es
also Erfahrung. (Fr Reales heit die ursprngliche Erfahrung Wahrnehmung
und hat ihre Abwandlungen, als Erinnerungen, Erwartungen usw. Dasselbe
soll gelten in der Erweiterung.) Es kommt jetzt nicht darauf an, ob es praktisch
ist, die Worte Erfahrung, Wahrnehmung usw., die unsere Sprachen vorwiegend
fr individuelle Gegenstndlichkeiten verwenden, allgemeiner zu verwenden
und terminologisch so weit zu fixieren. Sondern darauf kommt es an zu sehen,
da das Wesentlichste des engeren Begriffs, das, was in der engeren
Anwendungssphre seine Erkenntnisleistung ausmacht, in der weitesten Sphre
wiederkehrt und wiederkehren mu, wenn Erkenntnis berhaupt Erkenntnis
ist. Durch diese Erweiterung tritt die so viel beredete, aber nie aus dem
phnomenologisch reinen Erleben her direkt studierte Evidenz in eine
Wesensbeziehung zu Erfahrung, ja besser gesagt, Erfahrung im
verallgemeinerten Sinn ist dasselbe wie Evidenz.
Lassen wir uns von der gemeinen Erfahrung leiten, fragen wir sie selbst in
intuitiver Vergegenwrtigung von Exempeln, was sie als Gegenstands-
bewutsein charakterisiert gegenber einem beliebigen sonstigen
Bewutsein von demselben Gegenstand. Die Antwort lautet zunchst fr
die Erfahrung im gemeinen engen Sinn: Einen Gegenstand aktuell erfahren
heit, prgnant gesprochen, ihn selbst vor Augen haben, ihn selbst erschauen
und erfassen. Im ursprnglichsten und prgnantesten Sinn gilt das von der
Wahrnehmung. Das Wahrgenommene als solches hat den Charakter der
leibhaften, der originalen Gegenwart. Wahrnehmen ist also <das>
Bewutsein, den Gegenstand ganz unmittelbar, in seiner originalen
Selbstheit zu haben und zu erfassen. Genau das ist es, was wir in anderen
Gegenstandssphren als Evidenz bezeichnen. Somit sagen wir schon hier:
Die Erfahrung ist das evidente Haben des individuellen Gegenstands.
Eine Abwandlung davon ist schon die Wiedererinnerung, obschon etwas
von Evidenz auch in sie hineinreicht. Das Wiedererinnerte ist charakterisiert
als vergangen, und Vergangensein als Vergangensein ist ursprnglich nur
durch Wiedererinnerung gegeben; in dieser Hinsicht ist sie eine Evidenz.
Aber im Vergangen liegt beschlossen das gegenwrtig gewesen, und
hinsichtlich der individuellen Gegenwart selbst, die da gewesen ist, ist die
Wiedererinnerung keine unmittelbare Erfahrung, sie ist eben keine
Wahrnehmung.
Es tut nun aber sehr Not zu sehen, da Gegenstnde aller anderen Arten, das
Wort im allerweitesten Sinne also genommen, ihre mgliche Art der
Selbstgebung haben mssen, ihre evidente Gegebenheit. Mglichkeiten z.
B. knnen leer gedacht, knnen symbolisiert, sie knnen aber auch selbst
gegeben, direkt erfahren oder, wenn Sie wollen, evident erschaut sein. Wie
224
die gemeine individuelle Erfahrung und alles individuelle Bewutsein berhaupt
verschiedene Glaubensmodalitten haben kann, so auch das Bewutsein von
Mglichkeiten; und wie es dort zur berzeugung von Nichtsein oder zur
besttigenden Erkenntnis des Wirklichseins kommen kann, so hier. Auch
Mglichkeiten existieren oder existieren nicht, knnen vermeinte Mglichkeiten
sein (wie die des regelmigen Dekaeders), die sich als nichtig ausweisen. Und
wie dort alle Meinung sich ausweist an der ursprnglichen Erfahrung im Modus
ungebrochener Erfahrungsgewiheit, so bei Mglichkeiten. Was fr
Mglichkeiten gilt, gilt fr Allgemeinheiten, fr Gegenstnde der Form eine
Art A, irgendein einzelnes A, Ein A ist B, Jedes A ist B usw., fr
Sachverhalte ohne oder mit begrifflicher Fassung, fr Notwendigkeiten,
Unmglichkeiten usf. Ferner, wie wir in der individuellen Sphre von
inadquater Selbstgebung und nicht apodiktischer sprechen mssen (in der
Dingerfahrung z. B. die Behaftung mit vorgreifenden Antizipationen, die
Scheidung von eigentlich Gesehenem und nur Mitgemeintem machen), so
hnlich in der weiteren Sphre, und berall knnen wir fragen, inwiefern
adquate Selbstgebung der betreffenden Gegenstndlichkeiten mglich ist, durch
ihre kategoriale Art prinzipiell ermglicht oder ausgeschlossen.
Diese allgemeine Besinnung darf und soll nur ein Leitfaden sein fr uns,
die wir uns als werdende Philosophen wieder in die phnomenologische
Einstellung versetzen. Sie war nur in der Methode der phnomenologischen
Reduktion bisher eine erfahrende im engeren Sinn, fixierend gerichtet auf
das flieende jetzige ego cogito. Wir ndern jetzt die Einstellung, aber nur
insofern, da wir alle egologischen Tatsachen auer Spiel setzen, also
prinzipiell darauf verzichten, Tatsachenurteile zu fllen. Statt der
Wirklichkeiten betrachten wir die egologischen Mglichkeiten, reine
Mglichkeiten, die nicht das mindeste von Tatschlichem mit sich fhren;
und nicht auf einzelne Mglichkeiten soll es ankommen, sondern auf reine
Allgemeinheiten, die sich in einzeln erschauten Mglichkeiten
exemplifizieren. Die Mglichkeiten sind egologische (oder was dasselbe,
rein phnomenologische) Mglichkeiten, die wir uns exemplarisch in absoluter
Selbstgebung zueignen, sei es in exemplarischen phnomenologischen
Wahrnehmungen oder Erinnerungen oder freien Phantasieabwandlungen.
Fingiere ich mir in freier Phantasie eine Wahrnehmung, so ist nicht die
Wahrnehmung, aber eine mgliche Wahrnehmung selbst erfahren, und
bentzen wir eine Wiedererinnerung an eine frhere Wahrnehmung, so mag
die Erinnerung uns tuschen, aber nicht die wirkliche Wahrnehmung, sondern
die Mglichkeit solcher Wahrnehmung erfassen wir, und dies absolut; freilich
nicht die volle und letzte individuelle Mglichkeit mit den individuellen
Momenten. Aber absolut erfassen wir am Exemplarischen, am Einzelnen oder
Mehrfachen, und nur das soll unser Interesse sein, das Wesensallgemeine
Wahrnehmung berhaupt und spezieller etwa eine Dingwahrnehmung
berhaupt, psychologische Wahrnehmung berhaupt, somatologische,
225
animalische Wahrnehmung berhaupt usw.; ebenso hier sich ergebende
allgemeine Wesensmglichkeiten der Abwandlung so gearteter Erlebnisse,
der Synthesis, allgemeine Notwendigkeiten und Unmglichkeiten, kurz
Wesensgesetze. Gegenber den schwankenden Gestalten der Einzelheiten
erfassen wir das absolute Eidos und die eidetische Gesetzmigkeit, die in
absoluter Weise das Universum untergeordneter Mglichkeiten beherrscht.
Jede Feststellung, die wir machen, schpfen wir aus der selbstgebenden
Wesensanschauung, die fr Wesen und Wesensgesetze eine absolut adquate
und apodiktische ist. Jede Feststellung ist hier von der Tatsachengeltung
der Wiedererinnerung unabhngig, sie ist beliebig wiederholbar in
Wiedererinnerung der Selbstgebung oder Evidenz. Und hinsichtlich dessen,
was da originaliter gegeben <ist>, ist sie adquat identifizierbar, jede Aussage
von neuem evident zu begrnden. Also ich gewinne als der philosophisch
Meditierende neben der individuellen apodiktischen Evidenz des ego cogito,
die hinsichtlich der Mglichkeit tatsachenwissenschaftlicher Erforschung
fraglich bleibt, das unendliche Reich konkreter Wesensanschauungen und
konkret geschpfter unmittelbarer Wesensgesetze fr alle idealen
Mglichkeiten eines Ich und eines cogito berhaupt.
Damit erffnet sich eine erste Wissenschaft aus absoluter Rechtfertigung
in der Tat, wie es gefordert war, als eine Wissenschaft aus adquater und
apodiktischer Evidenz, eine erste Philosophie. Nicht eine Tatsachen-
wissenschaft von meinem Ego und seinen cogitationes, so wie es faktisch ist,
gewinnen wir als erste, sondern eine eidetische Wissenschaft. Genauer, wir
gewinnen zunchst ein unendliches Feld systematisch eidetischer
Deskription unmittelbar adquat erschaubarer und objektiv feststellbarer
Wesenseigenheiten einer transzendentalen Subjektivitt berhaupt, ihres
mglichen Bewutseins, ihrer mglichen intentionalen Leistungen. Aber es
ist vorauszusehen, da auf dem Mutterboden adquater Wesenserschauung
auch adquat zu rechtfertigende mittelbare Erkenntnisse zu gewinnen sein
werden, kurzum eine universale rein apriorische Phnomenologie als
Wissenschaft von der transzendentalen Subjektivitt berhaupt.
Nicht zu bersehen ist aber die Besonderheit, in der diese apriorische
Egologie auf dieser Stufe begrndet ist; sie ist auf mich, das philosophierende
Ich, das sein ego cogito ausspricht, zurckbezogen. Von einer Mehrheit
existierender Ich wei ich nichts, da fr mich andere Subjekte nur als
animalische gegeben sind und wie die ganze Welt der phnomenologischen
Epoch verfallen sind. Wenn ich von egologischen Mglichkeiten spreche
und ihren Wesensallgemeinheiten, werde ich, solange ich nicht einmal die
Mglichkeit der Erkenntnis anderer Ich erwogen habe, nur an Phan-
tasieabwandlungen meines Ego denken. Doch sind wir noch nicht so weit,
um diesen eidetischen Solipsismus beseitigen zu knnen.
Unser Endresultat ist, da eine eidetische Phnomenologie als erste aller
Philosophien ein mgliches und notwendiges Ziel ist, da sie die erste absolut
226
gerechtfertigte Wissenschaft ist im Sinne des leitenden Prinzips adquater
Evidenz. In den nchsten Vorlesungen wird sie sich als die universale
apriorische Philosophie und als Mutter aller apriorischen Wissenschaften
herausstellen. Wir werden zunchst zeigen, da sie die einzige sinnvolle
Erkenntnistheorie ist, und in weiterer Folge sogar, da eine voll entfaltete
Logik und Wissenschaftslehre sich mit ihr deckt.
III. Die transzendentale Phnomenologie und die Probleme mglicher
Erkenntnis, mglicher Wissenschaft, mglicher Gegenstndlichkeiten
und Welten
Der notwendige Weg zu aller im hchsten Sinne echten, letztbegrndeten
Erkenntnis, oder was fr uns dasselbe heit, der notwendige Weg zur
philosophischen Erkenntnis fhrt ber die Selbsterkenntnis. Das haben die
bisherigen Vorlesungen zu zeigen versucht. Das delphische Rtselwort gnwqi
sauton hat eine neue Bedeutung gewonnen. Es gibt eine Erfahrungsart, die
jedermann, der zum Philosophen werden will, sein absolutes, schlechthin
unleugbares ego cogito, seine transzendentale Subjektivitt erschliet, die aber
nicht unmittelbar die Begrndung einer philosophischen Tatsachenwissenschaft
ermglicht. Es gibt frs zweite eine Wesensanschauung, eine eidetische In-
tuition, wie wir auch sagen. Sie ist auf das Universum der rein egologischen
Mglichkeiten bezogen und erfat ihre allgemeinen Wesensgestaltungen und
Wesensgesetze in adquaten Deskriptionen, also durchaus als apodiktische
Notwendigkeiten. Sie erffnet, wie wir in der letzten Vorlesung schlossen,
die erste aller Philosophien, die transzendentale Phnomenologie. Nun erst
kommen uns die exemplarischen Aufweisungen egologischer Tatsachen, die
wir in der vorigen Vorlesung vollzogen haben, zugute. Und wir brauchen uns
jetzt nicht mehr an die flchtige Prsenzsphre zu binden, wir knnen
ebensogut in die Erinnerungssphre bertreten, aber nicht minder gut in die
frei abwandelnde Phantasie. Denn nun kommt es nur auf reine Mglichkeiten
an und nicht auf faktische Existenz der jeweiligen Erlebnisse, nicht auf das
faktische ego cogito kommt es an, sondern auf mgliches Ich, mgliches
Bewutsein, mgliche intentionale Gegenstndlichkeit, und es kommt darauf
an, an solchen klaren Mglichkeiten apodiktisch evidente Wesensformen und
Wesensgesetze in rein intuitiver Generalisierung zu erschauen und zum
adquaten Ausdruck zu bringen.
Man braucht hier nicht lange zu suchen. Alles, was sich in der Einstellung
auf die reinen Mglichkeiten ergibt, ist, wenn wirklich die Mglichkeiten
rein bleiben von Mitsetzungen von Faktizitten, ein Wesensallgemeines.
Beschreiben wir also, was Wahrnehmung und Wahrgenommenes als solches,
Erinnerung und Erinnertes als solches, Abbildung und Abbildung eines
Abgebildeten, Bezeichnung eines Bezeichneten usw. charakterisiert,
227
beschreiben wir es nach dem durch den Wandel reiner Mglichkeiten
hindurchgehenden typischen Was, so haben wir Wesensbeschreibungen
vollzogen. So auch, wenn wir etwa spezieller raumdingliche Wahrnehmung
und ihre Raumdinge rein als ihren intentionalen Gegenstand und nach der
reinen Typik beschreiben; etwa so, da wir zugleich die sich abwandelnde
Typik von Wahrnehmung und Wahrgenommenem als solchem verfolgen, die
zu einem mglichen identischen Ding gehrt. hnlich also, wie wir es in der
vorigen Vorlesung in der nun unerheblichen Bindung an die Faktizitt der
Selbstwahrnehmung taten. Wir gewinnen dann die typischen Mannigfaltigkeiten
der Erscheinungen, die Gegebenheitsweisen eines Dinges durch Aspekte, in
Bezug auf Kinsthesen, die Mannigfaltigkeit der Orientierungen, die
Unterschiede von Nahding, Fernding, Horizont usw.
Wir erkennen jetzt aber auch, da hier ein unendlich reichhaltiges Apriori
waltet, da alle diese Typik eine apriorische Typik ist. Das heit, kein Raumding
als Gegenstand mglicher Wahrnehmung und dann als Gegenstand mglicher
Anschauung berhaupt ist denkbar, ohne da es sich dieser Typik der
Erscheinungsweisen in allen ihren wundersamen systematischen Zusammen-
hangsformen fgte; auch ein Gott knnte ein krperliches Ding nicht anders
anschauen, denn gem dieser Typik der Perspektiven, der Orientierungen
etc. Es handelt sich also um apriorische Bedingungen der Mglichkeit
raumdinglicher Erfahrung, um ein apodiktisches und rein deskriptives
Apriori.
Aber das sind blo Beispiele. Es ist klar, da, wo wir im Reich der rein
egologischen Mglichkeiten zugreifen, dasselbe gelten mu. Es ergibt sich
somit die Aufgabe einer universalen apriorischen Deskription der mglichen
transzendentalen Subjektivitt berhaupt, welche das Universum der aus
unmittelbar eidetischer Intuition zu schpfenden Wesenstypen und
Wesensgesetze systematisch herausstellt. Es ist klar, da damit allem
vernnftigen Reden ber Bewutsein und Bewutes als solches und in letzter
Hinsicht ber alle mglichen Gegenstndlichkeiten als Gegenstndlichkeiten
mglicher Erfahrung, mglicher Erkenntnis, mglichen Vernunftbewutseins
jeder Art die absolute Norm vorgezeichnet wre.
Mit nicht geringem Erstaunen bemerkt man, schrittweise in dieses Reich
des reinen Bewutseins und der reinen Subjektivitt berhaupt eindringend,
wie gro, ja wie berwltigend mannigfaltig die festen Bindungen sind, die
dieses gleichsam eingeborene Apriori der transzendentalen Subjektivitt
auferlegt, und damit auch allen mglichen Gegenstnden auferlegt, die fr
ein Ich berhaupt sollen intentionale sein knnen. Es sind nicht vereinzelte
und gelegentliche Bindungen, sie sind allherrschend, sie betreffen alles und
jedes, was hier auftritt, den ganzen Gehalt jeder Wirklichkeit, weil sie mit
diesem ganzen Gehalt in die Mglichkeit eintritt. Sie betreffen sowohl das
passive, ohne aktive Ichbeteiligung sich entwickelnde Bewutsein, sie
betreffen nicht minder alle Formen mglicher Aktivitt, die schlichten und
228
synthetisch sich zusammenschlieenden Akte und die Art, wie durch solche
Akte und Aktsynthesen sich immer neue intentionale Gegenstndlichkeiten,
z. B. die theoretischen Gebilde oder die Zweckzusammenhnge der ethisch-
praktischen Sphre, konstituieren.
Die Flle der unmittelbaren Wesenseinsichten ist eine so groe, da die
Aufgabe zunchst als wie eine uferlose erscheint. Die Untersuchung droht in
zusammenhangslose Analysen und Feststellungen zu zerfallen. Doch es fehlt
von vornherein nicht an systematischen Leitfden zunchst fr einzelne
zusammengehrige Problemgruppen. Instinktiv bietet sich schon dem
Anfnger die festgehaltene Identitt des intentionalen Gegenstands als Leitung
an. Man hlt also einen exemplarischen Gegenstand ideell fest und lt die
fr ihn mglichen Bewutseinsweisen <sich> abwandeln, lt ihn einmal
angeschauten sein, dann leer vorgestellten, symbolisch angezeigten, im Abbild
vorgestellten, lt ihn sich explizieren in eigenschaftliche Sachverhalte, lt
ihn in Beziehungen zu anderen Gegenstnden treten usw.
a) Man nimmt nun etwa den exemplarischen Gegenstand als Exempel fr
irgendeinen Gegenstand berhaupt, lt ihn also sich vllig frei als
intentionalen variieren und erfat nun die allgemeinsten schlichten und
synthetischen Wesensformen mglichen Bewutseins, die zu einem
Gegenstand berhaupt wesensmig gehren: Anschauung berhaupt,
Leervorstellung berhaupt, signitives Bewutsein berhaupt, explizierendes,
kolligierendes, beziehendes und sonstiges Bewutsein berhaupt. Man
studiert dann systematisch fr jede solche allgemeine Gestalt die
Wesensnotwendigkeiten nach allen Seiten, nach cogito, nach cogitatum und
nach dem Ich selbst. Man untersucht auch die Wesensbezogenheiten dieser
verschiedenen Gestalten aufeinander.
b) Dann beschrnkt man den intentionalen Gegenstand auf einen
Gattungstypus, auf eine oberste Allgemeinheit, wie materielles Raumding,
organisches Wesen, Tier, Mensch, personale Gemeinschaft usw. und sieht nun
zu, wie im formalen Rahmen der allgemeinsten Wesenstypik entsprechende
Wesensbesonderungen eintreten. Man studiert also die wunderbaren apriorischen
Gesetzmigkeiten, ohne die Gegenstnde solcher gattungsmigen Regionen
nicht erfahrbar und nicht denkbar sind. Das gibt mindestens Linien geordneter
Untersuchung. Aber erst im Fortschreiten scheiden sich klar die groen
Disziplinen, das sind die notwendig sich voneinander abscheidenden
Problemgruppen in eins mit der Abscheidung der universalen Stufen, die zu
einer transzendentalen Subjektivitt als solcher eigenwesentlich gehren.
Also schlielich treten die universalsten Scheidungen hervor, die oberste
Systematik der Forschung bestimmend. Naturgem bewegen sich alle
Forschungen in dem ersten Bewutseinsfeld, das die phnomenologische
Reflexion erreicht und das man zunchst allein sieht; nmlich im Feld der
immanenten Zeit, als der universalen Form, in der die Erlebnisse der ersten
Reflexionsstufe ihre bleibende Stellung und Ordnung, ihre bestimmte
229
Zeiterstreckung haben. Erst spter wird man dessen inne, da jedes solche
Erlebnis, z. B. ein durch eine Zeitstrecke hindurch sich erstreckendes
Wahrnehmen, Urteilen, Schlieen, Begehren usw. als Ganzes, wie nach allen
Zeitphasen, nur ist und mglich ist als werdend in Form kontinuierlich sich
wandelnder zeitlicher Erscheinungsweisen, in bestndigem Wechsel
zeitlicher Orientierung nach Jetzt, soeben gewesen, ferner vergangen
usw. Es erwchst so die notwendige Idee einer eigenen Phnomenologie
des ursprnglichen Zeitbewutseins und der Aufklrung der innersten
Intentionalitt, in der nach einer starren genetischen Wesensgesetzmigkeit
sich in gleicher Weise alle und jede Erlebnisse als Einheiten in der
immanenten Zeit und als dauernde konstituieren. Offenbar steht diese
Disziplin fr sich.
Betrachten wir dann die nun als hhere Stufe charakterisierte
Phnomenologie der immanenten Zeitsphre, so ergeben sich hier die groen
Scheidungen: 1. die relativ arme Phnomenologie der sinnlichen Daten (in
ihren Sinnesfeldern), 2. die unendlich reichhaltige Phnomenologie der
Intentionalitt; in dieser aber die alles beherrschende Scheidung: frs erste
die Lehre von den allgemeinsten Wesensstrukturen, die in ihrer Allgemeinheit
vor allen Fragen bleiben, die sich auf Wahrheit und Evidenz beziehen, frs
zweite die hhere Stufe, die eben diese Vernunftprobleme betrifft. Also die
Phnomenologie der Vernunft und ihre groen Sonderdisziplinen.
Zur Charakteristik der Bedeutung und des Wesens der letzterwhnten,
unseren philosophischen Interessen am nchsten liegenden Scheidung werfen
wir einige Blicke auf die traditionelle transzendentale Erkenntnistheorie in
ihrer Beziehung zu unserer transzendentalen Phnomenologie. Wenn diese
Erkenntnistheorie sich als transzendentale bezeichnet, so drckt sie damit
ihre Bezogenheit auf das Problem der Transzendenz aus. Genauer ist es die
Frage: Wie ist Erkenntnis, zuhchst wissenschaftliche, von einer
transzendenten Welt mglich? Und welchen Sinn kann eine Welt haben, die
in unseren objektiven Wissenschaften erkannt wird?
Das Problem erwchst in der natrlichen Einstellung und wird auch weiter
in ihr behandelt. Als natrlicher Mensch finde ich mich in der Welt als ihr
Mitglied und zugleich sie erfahrend und wissenschaftlich erkennend. Nun
sage ich mir: Alles, was fr mich da ist, ist fr mich dank meinem erkennenden
Bewutsein da, alles, was ich erkenne, ist Erkanntes meines Erkennens, es ist
Erfahrenes, auf Grund meiner Erfahrung, Gedachtes, Theoretisiertes, als
wissenschaftlich wahr Begrndetes. Das Erfahren ist mein Erleben, und
Erfahrenes habe ich nur als Intentionales in diesem erfahrenden Erleben. Ohne
das htte ich fr all mein Denken berhaupt kein Substrat. Das Denken ist
aber wiederum mein Denken, ich bilde Begriffe und Stze, verknpfe die
Stze zu Schlssen, zu Theorien. Damit vollziehe ich ein hherstufiges
Bewutsein, in dem das zuunterst Erfahrene meines erfahrenden Bewutseins
seine neuen Denkbestimmungen erhlt.
230
Wenn ich dabei zwischen normaler und trgender Erfahrung scheide, so ist,
was das eine und andere charakterisiert, Sache meiner eigenen unterscheidenden
Akte, und die Charaktere sind in meinem Bewutseinsbereich selbst auftretende
Charaktere. Ebenso, wenn ich in hherer Stufe evidentes und nicht evidentes
Denken, wenn ich a priori notwendiges und a priori widersinniges oder
empirisch richtiges und verwerfliches Denken unterscheide. Evidenz,
Denknotwendigkeit, Widersinnigkeit usw. <sind> alles in meinem Bewutsein
selbst auftretende Charaktere. Und schlielich das wahr und wirklich, das
So ist es notwendig usw., das ich meinem intentionalen Gegenstand am Ende
meiner Erkenntnisabzielung, am Ende meiner evident machenden Begrndung
zuspreche, was bedeutet es anderes als ein Vorkommnis im Rahmen meines
Bewutseins?
Also nur als Bewutes meines Bewutseins, als Erkanntes meines Erkennens
gibt es fr mich, was es fr mich je geben kann, und gilt fr mich, was je fr
mich gelten kann. Also z. B. eine wahre Welt und strenge Wissenschaften.
Darin wird nun das groe Problem gesehen. Da ich meiner Bewutseins-
innerlichkeit, zunchst im Ich denke der Cartesianischen Evidenz, gewi
bin, da ich dann innerhalb dieser Sphre logischen Normen folgend ber
das Unmittelbare hinausgehe und Wissenschaft gewinne, das ist verstndlich.
Aber wie kann dieses Spiel der rein bei sich selbst verbleibenden Subjektivitt
und in ihr gerade das Spiel der logischen Notwendigkeiten, dieser angeblichen
Normen objektiv gltiger Erkenntnis, je eine objektive Bedeutung gewinnen?
Oder welchen Sinn mu diese objektive Bedeutung bei dieser Sachlage haben,
welchen Sinn die wissenschaftlich erkannte Welt als solche? Etwa nur den
einer menschlichen Erscheinungswelt fr vllig unerkennbare Dinge an sich?
Es ist, wie leicht zu sehen und nur feiner ausgesponnen, das Problem, das
schon in der antiken Skepsis aufgetreten ist in Form jenes genialen Para-
doxes, das unter dem Namen des Gorgias als zweites seiner berchtigten
Argumente
6
berliefert ist.
Nehmen wir einige Distanz zu dieser Problematik und ziehen wir Nutzen
von der Methode phnomenologischer Reduktion und der echten
transzendentalen Einstellung, die sie ermglicht. Ziehen wir vor allem Nutzen
von der mit dieser Einstellung sich erffnenden phnomenologischen
Wissenschaft, welche das Universum mglichen Bewutseins berhaupt eines
mglichen Ego berhaupt in Wesensgesetzen beherrscht, die aus unmittelbarer,
adquater, apodiktisch evidenter Intuition geschpft sind.
Wir erheben nun die Frage: Wer ist dann dieses Ich, fr das alles und jedes
und speziell alle objektiv wahre Welt Bewutseinsobjekt ist? Ich, dieser
natrliche Mensch, habe vorhin die skeptische berlegung begonnen, hatte
mich bewut als Glied dieser Welt vorgefunden und hingenommen und
ausgesagt: Alle Welt, alle erfahrene und wissenschaftlich wahr erkannte ist
Bewutes meines Bewutseins. Und so hatte ich auch das Transzendenzproblem
in der Form gestellt: Wie kann ich aus meiner Bewutseinssubjektivitt
231
heraus?, wie soll mein subjektives Bewutsein objektive Bedeutung
gewinnen? Aber bin ich als natrlicher Mensch, als Weltmitglied, der im
Raume lebt und auer sich andere Dinge und Animalien hat, mit denen er
kausal verflochten ist bin ich als all das nicht Erfahrenes meiner Erfahrung
und Gedachtes meines Denkens?
Ist es nicht meine kontinuierliche Welterfahrung, durch die fr mich die
Welt und in ihr beschlossen mein Mitgliedsein als Mensch in dieser Welt
Sinn und Geltung hat, den so und so bestimmten anschaulichen und
gedanklichen Sinn und seine Gewiheit und Geltung fr mich hat. Wer ist,
wiederhole ich, das Ich, fr das alles und jedes da ist? Was fr ein
Ichbewutsein ist es und Icherkennen, in dem alles und jedes Bewutes und
Erkanntes ist? Fr uns ist die Antwort schon gegeben. Selbstverstndlich nicht
das natrliche Ich, sondern das transzendentale. Die phnomenologische
Reduktion und ihre Epoch erhebt mich zu einer schauenden Position, in der
ich mich als das absolute und letzte Ich erfasse, als das Ich, fr das alles und
jedes intentionales Objekt ist. Und das Bewutsein, von dem da allein die
Rede sein kann, in dem alles und jedes Bewutes ist, ist selbstverstndlich
das absolute cogito, das, in dessen aktivem Vollzug oder passivem Erleben
ich das absolute Ego eben bin. Denn ich bin nur als cogitans und als darin
bezogen auf cogitata. Ich, das absolute Ego, bin es, der in meinen
mannigfaltigen Bewutseinserlebnissen, in meinen Passionen und Aktionen
die Sinngebungen leistet, durch die alles, was fr mich da ist, und so, wie
es fr mich da ist, eben da ist. Und dieses fr mich da besagt, es tritt in
meinem intentionalen Bereich auf als etwas, worauf ich hinachten kann oder
wirklich hinachte und <das> auftritt als ein Etwas dieses Sinnes, <das> in dieser
oder jener Gegebenheitsweise, Seinsmodalitt (als Wirkliches, Mgliches,
Vermutliches etc.) speziell auch auftritt im Modus eines Gesehen oder
Eingesehen oder <im> Modus eines trgenden Scheins, einer prdikativen
Wahrheit oder Falschheit und <das> eventuell auftritt als etwas, das an sich
existiert, das ich erfahren knnte, obschon ich es nicht erfahre usw.
Ist man so weit, dann wird man wohl nicht umhin knnen, der im Syllabus
ausgesprochenen These beizutreten: Alle vernnftigerweise an die Erkenntnis
als Vernunftleistung zu stellenden Fragen in Hinsicht auf Erkenntnissubjekt,
Erkenntnisakt, Erkenntnisgegenstndlichkeit sind entweder transzendental-
phnomenologische Fragen oder unklare, widersinnige Fragen.
7
Nmlich zunchst und frs erste ist es evident, da das gemeine
transzendentale Problem, das die Erkenntnistheorie gewhnlichen Stiles (auch
die Kantische) zu lsen fr <ihre> groe Aufgabe hlt, ein widersinniges
Problem ist. Denn welchen Sinn kann nun noch die Frage haben, wie die in
der immanenten Intentionalitt meines Bewutseins erzielte Wahrheit (etwa
die in einer physikalischen Theoretisierung in den und den Denkakten erzeugte
und erzielte) ber das Bewutsein hinaus eine objektive Bedeutung gewinnen
knnte? Welchen Sinn kann ein sogenanntes Ding an sich haben, das ber
232
all das hinausliegt, was in meinem Bewutsein mit dem Sinn des Ansichseins
sich bewhrt hat oder bewhren kann, sich ergeben hat in meinen
Begrndungen? Ist es das Bewutsein, das fr mich alle mglichen
Bedeutungen und speziell die als gltig charakterisierten schafft, so
umschliet das Universum des mglichen absoluten Bewutseins das
Universum aller sinnvollen Fragen und Antworten, aller sinnvollen Wahrheiten
und wahren Existenzen, alles und jedes, von dem ich eben auch nur als einem
mglichen soll reden knnen. Das Universum der Wahrheiten, die ich suchen
und finden kann (ich und ein Ich berhaupt in prinzipieller Allgemeinheit) ist
nichts weiter als das Universum gewisser unter dem Titel rechtmige
Begrndung ausgezeichneter intentionaler Leistungen. Also kann fr mich
und fr ein Ich berhaupt eine andere Wahrheit (und nun gar die Frage des
Stimmens oder Nichtstimmens dieser anderen Wahrheiten zu meinen
Wahrheiten) schlechthin keinen verstehbaren Sinn haben. Ein Auerhalb auer
dem Universum mglichen Sinnes ist ein Unsinn, somit auch eine andere
Wahrheit und anderes wahrhaft Seiendes auerhalb des Universums
derjenigen, die ihre Sinngebung in mir und ihre Erzielung in meinen Aktionen
gewonnen haben oder gewinnen knnen.
Frs zweite: Natrlich kann unsere Meinung nicht die sein, da
Erkenntnistheorie berhaupt ein leerer Titel ist und nicht vielmehr ein Titel
fr groe und vllig eigenartige Probleme, ja fr die grten Probleme, die
menschlichem Scharfsinn berhaupt gestellt sind. Was eine jede, auch die
abwegige Transzendentalphilosophie bewegt, ist doch die schon in der
natrlichen Einstellung zur philosophischen Pein werdende Unklarheit, wie
sich die in der Immanenz des Bewutseins verbleibende Beziehung auf
Bewutseinsobjekte, und zuhchst die der wissenschaftlichen Erkenntnis auf
erkannte Objekte, verstehen lt, was sie eigentlich bedeute, wie sich die im
Rahmen des erkennenden Bewutseins selbst sich konstituierende
Transzendenz und das diese Leistung vollziehende Erkennen selbst rational
aufklren lt. Es handelt sich hier offenbar nicht um ein spezielles oder gar
an individuelle Fakta gebundenes Problem. Es betrifft jedes Objekt berhaupt
als Objekt mglicher Erkenntnis und jede Erkenntnis berhaupt als Erkenntnis
von ihrem Objekt, und es besondert sich fr jede Objektart und die ihrer
angepaten mglichen Erkenntnis. Und schlielich betrifft es jedes
Bewutsein berhaupt als Bewutsein von etwas. Denn jedes kann schlielich
in Hinsicht auf sein intentionales Objekt Erkenntnisfunktion haben und ist in
einem allerweitesten Sinn unter den Titel Erkenntnis gehrig.
Also schlielich werden wir zurckgefhrt auf das universale Problem der
Intentionalitt und das universale Problem der ausgezeichneten Intentionalitt,
die das Wort Vernunft andeutet, das alles aber vor aller Faktizitt in reiner
Mglichkeit. Auch das Faktum des erkennenden Subjekts ist offenbar irrele-
vant. Wie immer ich ein Ich fingieren mag, als reine, tatsachenfreie
Mglichkeit, es ist wesensmig in derselben Lage, nur so weit urteilen zu
233
knnen, als die Intentionalitt seines Bewutseins reicht; es steht also jedes
als erkennend gedachte Ich vor denselben transzendentalen Problemen. Also
ist schon im voraus zu sehen, da nur eine rein apriorische und in Form einer
intuitiven Wesenslehre ausgebildete Erkenntnistheorie Sinn haben kann. Auf
die Frage, wie sie zu begrnden, wie sie anzufangen ist, haben wir aber
offenbar zu antworten: Sind wir ber Bewutsein als Bewutsein, ber
Erkenntnis als Erkenntnis, d.i. hinsichtlich ihrer Intentionalitt, im Unklaren,
so mssen wir uns selbstverstndlich erst eben dieses selbst klar machen, es
aus seiner ursprnglichen Gegebenheit studieren, und zwar eben in Hinsicht
auf ihre doch zu ihrem eigenen Wesen gehrige Intentionalitt. Sie ist allen
Formen das Unbekannte, in allen ihren Stufen liegen Stufen von Leistungen,
deren Sinn uns so fremd ist, da selbst schon diese Rede vom Leisten ihre
notwendige Dunkelheit hat. Denn wie sehr wir immerfort als lebende Ich in
cogitationes leben und immerfort im weiteren und engeren Sinn erkennen, so
wissen wir als natrliche Ich von allem anderen oder erkennen alles andere,
nur nicht unser Erkennen. Auch die natrliche Reflexion lehrt es nicht kennen,
da sie das reflektiv Erfate sofort mit weiterer, objektiver Erkenntnis verflicht
und objektiv fruktifiziert, wodurch gerade das ungeschieden und unsichtig bleibt,
worauf es hier ankommt, das Eigenwesentliche des Bewutseins und seine
eigenwesentliche einzelne und synthetische Leistung. Schon die einzelne hat
ihre Rtsel, schon das einfachste Bewutsein als Vermeinen von etwas, schon
das ist nie geklrt worden, wie die intentionale Gegenstndlichkeit als im
einzelnen Bewutsein vermeinte darin liege, wie sie zum reellen Erlebnisgehalt
stehe. Und erst recht das spezifisch abzielende Erkennen, auf Wahrheit und
wahres Sein abzielende, das in der sogenannten Evidenz und Begrndung
erzielende, an das wahre Sein als ein an sich wahrhaft Seiendes heranfhrende
Erkennen. Wie sieht das ganze hier und in den besonderen Erkenntnistypen
und Gegenstandsgebieten in besonderen Formen <sich> vollziehende
intentionale Leben aus, nach Ichaktivitt, nach seinen Wesensstrukturen, die
uns die intentionale Leistung aus ihr selbst verstndlich machen knnten?
Dazu bedarf es also einer Reflexion, die eine rein anschauende sein mu.
Offenbar kann es keine andere sein als diejenige, welche die Phnomenologie
lehrt. Denn nur ihre Methode der einklammernden Reduktion verhindert die
verflschenden Hineinmengungen in die intentionalen Gehalte, welche die
natrliche Erkenntniseinstellung durch ihre natrlichen Stellungnahmen
motiviert, unvermeidlich vollzieht. Ist aber einmal der absolute Boden erreicht
und das Universum des transzendentalen Ich und Bewutseins im Blickfeld
des Interesses, hat man den groen und entscheidenden Schritt getan,
einzusehen, da dieses ganze Feld einer universalen eidetischen und rein
deskriptiven Forschung zugnglich ist, dann ist es auch evident, da eine
allseitige Wesenserforschung hier alle vernnftig zu stellenden
Erkenntnisprobleme befat, aus dem einfachen Grunde, weil sie offenbar
Wesensprobleme sind, die ausschlielich das transzendental reine
234
Erkenntnissubjekt und die immanente Teleologie seiner intentionalen
Vernunftleistungen betreffen. Dieses Ich aber und seine Teleologie ist nicht
ein mythologisch konstruiertes Ich an sich, sondern das in der
phnomenologischen Einstellung nchtern anschaulich gegebene und der
Wesensdeskription zu Gebote stehende.
Alles in allem ist die ganze Fragestellung einer echten Erkenntnistheorie
gerichtet, und auf nichts anderes gerichtet, als auf ein aufklrendes Verstehen
mglicher Erkenntnis. Dieses aber vollzieht sich notwendig im Rahmen eines
universalen aufklrenden Verstehens der vollen transzendentalen Subjektivitt
nach allen ihren Bewutseinsleistungen. Aufklrendes Verstehen ist aber die
denkbar hchste Form der Rationalitt, der Einsicht aus apodiktischen
Wesenseinsichten der in unmittelbarer Adquation erschaubaren und
deskribierbaren Sphre, der des ego cogito.
Der Kampf, den die Phnomenologie fr ihre Art Erkenntnistheorie als
der einzig geforderten fhrt, ist nicht blo ein Kampf gegen jede naive
Erkenntnistheorie auf naturalistischem Boden, sondern auch ein Kampf gegen
jede Erkenntnistheorie bloer Allgemeinheiten, gegen jede Erkenntnistheorie,
welche dialektisch von oben her ber Erkenntnis spekuliert, statt sie nach
ihren konkreten anschaulichen Gestaltungen selbst kennenzulernen und einer
adquaten Wesensdeskription zu unterwerfen. Sie mu herabsteigen von der
Hhe ihrer Allgemeinheiten auf das fruchtbare ba Joj
8
der unmittelbar
adquaten phnomenologischen Wesenserschauung.
Dabei aber kann nicht Erkenntnis wie ein besonderer Titel einer besonderen
Wissenschaft behandelt werden und ihr gegenber objektive Wissenschaft
fr sich, getrennt behandelt werden. Es gibt in der transzendentalen
Subjektivitt keinerlei Bewutsein bis herab zu den niedersten Gestaltungen
sensuellen Bewutseins, auch kein Gemts- und Willensbewutsein, das nicht
unter den notwendig weitest zu fassenden Titel Erkenntnis mitgehrte; man
kann und darf hier keine Einschnitte machen, wie sehr sozusagen das Herz
des Wissenschaftlers an der Erkenntnis in einem prgnanten Sinn objektiv
gltiger Vernunfterkenntnis hngen mag. Eine wirklich fruchtbare, auf
wirkliche Aufklrung gerichtete Erkenntnistheorie drngt notwendig immer
weiter und deckt sich schlielich mit der universalen Wissenschaft von der
transzendentalen Subjektivitt, also mit der Phnomenologie.
Eine Erkenntnistheorie darf also auch nicht im Gebiet der formal-
allgemeinen, auf eine Klrung von Vernunfterkenntnis berhaupt, Wahrheit
berhaupt, wahrem Sein berhaupt gerichteten Untersuchungen hngen bleiben.
Vielmehr mu einer allgemeinen oder allgemeinsten Erkenntnistheorie sich
anschlieen eine ganze Reihe von Disziplinen, welche die von jeder der sich
a priori abgrenzenden Gegenstandsregionen gestellten besonderen
Vernunftprobleme behandeln. Eine solche Region bezeichnet z. B. die
materielle Natur und ihr entspricht eine besondere Theorie der Natur
erkennenden Vernunft, ebenso aber bedarf es einer Phnomenologie der
235
Leiblichkeit, einer Phnomenologie der Personalitten, der Einzelpersonalitt
und der personalen Verbnde, eine solche der Kulturgebilde usw. Jede re-
gional sich abscheidende Gattung von Gegenstndlichkeiten hat entsprechend
ihrer gattungsmigen Form ihre wesensverschiedenen Weisen selbstgebender
Erfahrung, hat ihre besondere Typik hinsichtlich der Art, wie eine solche
Gegenstndlichkeit in einer systematischen Mannigfaltigkeit mglicher
einstimmiger Erfahrungen ihren ontologischen Sinn enthllt und wie sie ihn
dabei bewutseinsmig konstituiert.
In dieser Weise ist z. B. schon dies eine ungeheure Aufgabe, die intuitive
Konstitution des physischen Naturdinges im System mglichen erfahrenden
Bewutseins allseitig klarzulegen, all die a priori zugehrigen
Erscheinungsweisen, Gegebenheitsmodi, in allen Korrelationen in gehriger
Weise in Wesensbegriffen zu beschreiben. In diesen Zusammenhang gehren
all die verwickelten rein phnomenologischen Probleme, die hinter dem viel
behandelten, aber prinzipiell unklaren Problem vom psychologischen
Ursprung der Raumvorstellung liegen. Es sind ihrem echten Kern nach
Probleme eines wesensmigen Verstehens und nicht empirisch-
psychologische Probleme, whrend das, was das Experiment und die Physiologie
an wirklichen Faktizitten hier aufweist, ohne die Wesenseinsichten empirische
Unverstndlichkeit bleibt.
Drittens:
9
Stellt man sich vollbewut auf den Boden des ego cogito und
studiert man in der geforderten absoluten Vorurteilslosigkeit das Universum
dieser Sttte aller Sinngebungen und Seinssetzungen, so versteht man den
unablssigen Zug der neuzeitlichen Philosophie zu einer immanenten
Transzendentalphilosophie oder, wie man auch sagt, zu einem transzendentalen
Idealismus. Allerdings ein Idealismus, der sozusagen die Materie totschlgt,
der die erfahrene Natur fr bloen Schein erklrt und nur das seelische Sein
fr das wahre erklrt, ist verkehrt, wenn auch nicht ganz so verkehrt wie der
Materialismus, der das Psychische fr eine bloe Erscheinung von Physischem
als dem allein Wahren und fr einen blo subjektiven Schein erklrt.
Andererseits liegt im Idealismus ebenso eine unklare Vorstufe des echten
Transzendentalismus, wie in der deskriptiven Psychologie rein aus innerer
Erfahrung eine unklare Vorstufe der Phnomenologie.
Wer den vollen Sinn phnomenologischer Methode verstanden und sich
wirklich der absolut transzendentalen Sphre versichert hat, wird, meine ich,
sich schlielich dieser folgenden von uns schon besprochenen Evidenz nicht
entziehen knnen: Kein intentionaler Gegenstand ist in dem jeweiligen cogito
ein reelles Moment; wenn viele Bewutseinsakte denselben intentionalen
Gegenstand evidenterweise in sich tragen, so haben sie nicht ein reelles Mo-
ment gemeinsam. Er ist ihr identifizierbarer Pol: ein ideal Identisches, das
nur als solches Identifizierbares Sinn hat. Aber man wird sich der weiteren
Evidenz nicht entziehen knnen, da auch das wahre Sein nur seinen Sinn
hat als das Korrelat der besonderen Intentionalitt der Vernunft, somit als
236
eine ideale Einheit, wesensmig unabtrennbar von Ich und Ichbewutsein;
es handelt sich um ein in ausgezeichneter Weise Vermeintes als solches, einmal
an sich evident Bestehendes und dann evidenterweise jederzeit wieder in
Evidenz zu Identifizierendes. Das wahre Sein, und speziell etwa das wahre
Sein der Natur, ist nicht ein Zweites neben dem blo intentionalen Sein. Das
gilt, obschon wir scheiden mssen zwischen der von uns jetzt gerade so und
unvollstndig, unter Prsumptionen vermeinten Natur und der Natur selbst.
In der Erfahrung ist dasselbe Ding als dasselbe im mannigfaltigen Wie der
Vermeintheit, in wechselndem Sinn und wechselnden Erscheinungsweisen
gegeben, aber die Natur an sich selbst als Kontrast zu allen einseitigen
unvollkommenen Gegebenheitsweisen ist nicht ein widersinniges Jenseits
alles Bewutseins berhaupt und aller mglichen Erkenntnissetzung, etwa
nur einem Gott in seinem Selbstsein zugnglich und von ihm adquat
anschaubar; sondern es ist eine im Ego selbst entsprungene und jederzeit zu
konstituierende regulative Idee, die einem System rechtmiger Prsumption
fr immer neue Erfahrungen und Erfahrungsbesttigungen die Regel
vorschreibt. Im brigen ist aber dieses an sich Seiende der Idee selbst als
Identittspunkt von Intentionen, nur in einer Unendlichkeit ideell einstimmiger
Intentionen, gemeint und gesetzt.
Dem Allgemeinsten nach ist alles wahre Sein ein Ideelles gegenber dem
reellen Bewutsein, aber eben ein in ihm selbst wesensmig vorgezeichneter
Pol. Das gilt von dem empirisch wahren Sein der Natur hnlich wie von dem
wahren Sein der Zahlen in der unendlichen Zahlenreihe. Es sind freilich
grundverschieden konstituierte Gegenstndlichkeiten, die einen mit dem
intentionalen Sinn individuellen Seins in raum-zeitlicher Wesensform
ausgestattet, die anderen allgemeine Wesenheiten und als das berzeitlich.
Aber intentionale Einheiten und als das von einer Subjektivitt, in der sie
erkennbar werden knnen, untrennbar sind sie, wie alle Gegenstnde.
Wie sehr eine natrliche, gerade auf ein Objekt gerichtete Erkenntnis nur
auf Bestimmungen dieses Objektes selbst stoen kann, also niemals auf die
transzendentale Subjektivitt, auf die es wesensmig bezogen ist, so besteht
eben doch, wie die phnomenologische Reflexion lehrt, diese apriorische
Wesenseinigkeit. Also kein Objekt ist wirklich selbstndig. Und zwar so, da
Wesensgegenstnde (wie apriorische Begriffe und Stze) auf wesensmgliche
Subjektivitten als Sttte ihrer mglichen Konstituierung zurckweisen,
whrend individuelle Gegenstnde nur denkbar sind in Beziehung auf
irgendwelche wirklichen Subjekte; auf wirkliche Subjekte, in deren faktisches
Bewutseinsleben sie hineingehren als reale Erkenntnismglichkeiten.
Das einzige absolut selbstndige Konkretum, das denkbar ist, ist danach
das absolute Ego, die konkrete transzendentale Subjektivitt, fr welche sehr
wohl der Leibnizsche Name Monade dienen knnte. Erinnert man sich
hier an die Substanzdefinition des Spinoza,
10
so bemerkt man sogleich, da
sie auf diese Monade vollkommen pat, aber auch nur auf sie. Sie ist die
237
Subjektivitt, fr welche alles, was sonst seiend heien kann, Objekt ist.
Andererseits ist sie selbst erkennbar und in ursprnglicher Erfahrung (der
phnomenologischen Selbstschauung) fr sich selbst und nur fr sich erfahrbar.
Ihr apriorisches Wesen ist es, nur sein zu knnen in einem Bewutseinsleben,
das nicht nur dahinstrmt, sondern fr das Ich als dieses strmende dieses
Inhalts konstituiert ist. Das Ich ist wesensmig fr sich Gegenstand mglicher
Erfahrung und eventuell mglicher weiterer Erkenntnis. Nur was in dieser
Weise auf <sich> selbst relativ ist, seiend fr sich selbst die Bedingungen
mglicher Erfahrung und Erkenntnis erfllt, kann absolut sein. Alles andere
Seiende ist subjektiv-relativ, aber nicht selbst Subjekt, ein konstituierendes
Subjekt voraussetzend und in ihm als Mglichkeit der Erkenntnis beschlossen,
aber nichts in sich selbst und fr sich selbst Seiendes, eben kein Absolutes.
Doch nun zum Schlu noch eine wichtige Ergnzung zur systematischen
Idee einer transzendentalen Phnomenologie. Ein Einwand wird sich Ihnen
schon lngst aufgedrngt haben. Die phnomenologische Wesenslehre, die in
den letzten Betrachtungen ihre metaphysische, wenn auch immanent
metaphysische Bedeutung vertreten hatte, soll eine Wesenslehre des Ego, also
eine Egologie sein. Wenn ich aber, das philosophierende Ich, ber das einzige
mir absolut und individuell gegebene eigene Ego hinausgehe und das Universum
der reinen Mglichkeiten von Ich und Bewutsein berhaupt erforsche, so sind
doch alle diese Mglichkeiten Abwandlungen meines faktischen Ego. Es sei
denn, da ich versuche, sie als mgliche fremde Subjekte zu denken. Aber
fremde Subjekte sind vom Wesenstypus Subjekte auer, rumlich auer mir.
Fremde Subjekte, wirkliche und mgliche, treten in meinem unmittelbaren
Mglichkeitsbereich nur auf als Transzendenzen, als Glieder einer objektiv
konstituierten Welt, als subjektiv relative intentionale Einheiten meiner
mglichen Erkenntnis. Gibt das nicht eine Art eidetischen Solipsismus?
Die systematisch vorgehende Phnomenologie wird in der Bearbeitung
der konstitutiven Probleme in der Tat zunchst aus gesunden methodischen
Grnden eine Art Solipsismus, aber voll bewut, durchfhren. Die konstitutive
Aufklrung der Natur in der Naturerkenntnis ist eine fr sich zu betrachtende
Unterstufe fr die transzendentale Aufklrung der Animalitt und Humanitt
und gar der Aufklrung der hheren Personalitten und ihrer Kulturwelt. Die
Phnomenologie wird daher zunchst im Rahmen des Ego Phnomenologie
der Natur in der Naturerkenntnis begrnden; dabei aber wird sie zunchst
von der Fiktion ausgehen, da im Bereich des erkennenden Ich nichts von
animalischen Wesen auftrete, da die phnomenale Welt bloe Natur sei. Die
transzendentale Aufklrung des wahren Sinnes einer Natur berhaupt ergibt
dann das Resultat, da das Sein einer Natur nichts anderes bedeuten kann als
ein gewisses in der betreffenden Erkenntnissubjektivitt wohl motiviertes
intentionales Polsystem, das in empirischer Evidenz (also freilich in stets
prsumptiver) immer wieder vernunftgem identifizierbar und identisch
bestimmbar ist.
238
Geben wir nun die solipsistische Fiktion auf. Wir ziehen also das an sich
mgliche Auftreten von fremden Leibern in den Kreis eidetischer Betrachtung.
Sie sind Dinge, die nicht ursprnglich wie der eigene Leib als Leiber erfahren
sind; aber vermge typischer Analogie mit der eigenen Leiblichkeit indizieren
sie Analoga von all dem, was in empirisch geregelter Weise in eins mit meinem
eigenen Leib als mein subjektives Erleben originaliter mitgegeben ist. So erfolgt
sogenannte Einfhlung, im fremden Leibkrper indiziert sich als mitgegenwrtig
<fremdes Seelenleben> in ursprnglicher, also selbstgebender Indikation.
Ursprngliche Indikation ist aber nicht Wahrnehmung. Miterfahrenes in der
Weise der Einfhlung ist nicht fr mich ursprnglich erfahrbar. Dahin gehrt
all das, was ursprnglich anschauliche Leiblichkeit und damit verbundenes Ich
und Ichleben kennzeichnet; freilich mit unvollkommener Bestimmtheit, soweit
eben die analogisierende Indikation reicht. Diese Indizierung in der eigenen
Art des Ausdrucks hat aber ihre eigene Art der konsequenten Besttigung
und damit der Rechtfertigung.
In der Phnomenologie der Einfhlung versteht sich der Sinn und das
eigentmliche Recht der Mitsetzung von Seelischem als zugehrig zu
erscheinender Leiblichkeit; und es versteht sich, da in dieser empirischen
Mitsetzung als einer rechtmigen Mitsetzung eines fremden ego cogito, einer
fremden transzendentalen Subjektivitt statthat. Es versteht sich also, da
ein fr mich konstituierter Naturgegenstand als idealer Pol in meiner
Subjektivitt ein zweites Ego, ein fr sich seiendes und sich selbst ursprnglich
erlebendes und in sich selbst Intentionalitt bendes Subjekt zum Ausdruck
bringt und zur rechtmigen Setzung desselben Motive bietet.
Ein Ego, eine Monade, eine transzendentale Subjektivitt kann also derart
sein, da sich im Rahmen ihres absoluten Bewutseins ein anderes absolutes
Ego ausdrckt, durch die Art des Ausdrucks seine fortgehende vernnftige
Besttigung findet und demgem rechtmig zu setzen ist als seiende
Wirklichkeit. Aber es ist seinem eigenen Sinn nach wirklich, nicht in der bloen
Weise eines Krpers, eines blo intentionalen Pols, sondern in der Weise eben
eines Ego, eines absoluten Seins, eines sich selbst erlebenden und sich fr sich
selbst konstituierenden. Fr mich, der ich den anderen nicht ursprnglich,
sondern in der Form der vergegenwrtigenden, indizierenden Einfhlung
erfahre, ist der andere eben anderer, alter ego, Objekt, aber ein Objekt, das
nicht blo Objekt ist, sondern fr sich selbst Subjekt ist, so wie ich in noch
ursprnglicherer Form Subjekt und fr mich selbst zugleich Objekt bin.
Somit bin ich, wenn ich im Zusammenhang meines Bewutseinslebens
vernnftig bewhrte Einfhlungserkenntnis habe, nicht solus ipse und der
transzendentale Subjektivismus der Phnomenologie fordert nichts weniger
als einen solchen Solipsismus, sondern ich mu mich auch in absoluter
Einstellung als ein Ich setzen, das ein Du hat, und so berhaupt setze ich
mich mit Grund, rechtmig als ein transzendentales Ego einer mit mir
koexistenten Mehrheit von transzendentalen Egos. Wesensmig hat aber
239
jede solche koexistente Mehrheit ihre notwendige Erscheinungs- (=
Orientierungs)form, und eine wechselnde in jedem einzelnen dieser Egos.
Sie kann immer nur in der Form ego-alteri sich darstellen. Ich habe fr mich
die originale Form Ego, jeder andere die nicht-originale Form des alter. Jeder,
der fr mich alter ist, fr den bin ich alter, whrend er fr sich Ego ist.
Das Absolute, auf das sich die Welt reduziert, ergibt sich als eine absolute
Vielheit von Egos, die einander in dieser orientierten Weise erscheinen und
einander des Nheren nur erscheinen knnen mittels einer Natur, sich
ausdrckend in Leibern in der Natur. Die Natur ist fr jedes einzelne Ego
Einheit seiner Erscheinungen, Polsystem seiner Subjektivitt. Aber durch das
Medium der Einfhlung wird jedes Ideale, jeder Pol berhaupt, den ich erfahre,
identifizierbar mit dem von einem anderen erfahrenen. So wie die Zahlenreihe
fr mich eine ideale Gegenstndlichkeit ist und zunchst bezogen ist auf mich,
den sie Denkenden, aber durch Einfhlung erkennbar wird als identisch
dieselbe, die auch jeder andere im Zhlen finden kann; so ist auch die Natur,
die ich erfahre, als dieselbe erkennbar wie die von einem anderen erfahrene
Natur, und das alles ist auf dem Boden meines ursprnglichen Ego
wesensmige Notwendigkeit. Eben die Idealitt der Natur, das ist ihre bloe
Existenz als idealer Pol mglicher Erkenntnis (und als solcher Pol von ihr
untrennbar), macht es verstndlich, da dieselbe Natur fr viele Egos erfahrbar
sein kann. Zugleich ist klar: Nur wenn sie in jedem Ego konstituiert ist in
entsprechenden Erscheinungssystemen, so kann sie eine Gemeinschaft
verschiedener absoluter Subjekte (Monaden) ermglichen.
So klrt der transzendentale Subjektivismus die Mglichkeit des
Freinanderseins einer Mehrheit von absoluten Egos auf, in der notwendigen
Form der Animalitt und einer konstituierten psychophysischen Welt. Damit
in eins klrt er die Mglichkeit intersubjektiver Erkenntnis auf, aber auch
intersubjektiver Aktion, vor allem personaler Aktion in sozialen Akten und
so sozialer Kultur. Umgekehrt sind von hier aus transzendentale Rckschlsse
zu machen von der Annahme einer koexistenten Mehrheit von Monaden auf
die Bedingungen der Mglichkeit dieser Koexistenz, auf ihre notwendige
Rckbezogenheit auf ein und dasselbe in ihnen allen gemeinsam postulierte
Polsystem.
Selbstverstndlich ist auch die Phnomenologie selbst wie jede eidetische
Erkenntnis Gemeingut aller Egos; sie ist die Wissenschaft von dem, was einem
Ego als solchem eingeboren ist.
IV. Die konkrete Idee einer Logik als Wissenschaftslehre und das System
aller Ontologien. Das konkrete Ziel der phnomenologischen Philosophie
der Zukunft
Die letzte Vorlesung galt ganz der Vertiefung in die Idee der Phnomenologie
und der Konstrastierung der in ihr liegenden phnomenologischen Theorie
240
der Vernunft mit der traditionellen transzendentalen Erkenntnistheorie,
wobei wir sogleich auch den phnomenologischen Idealismus <im Vergleich
mit> dem gewhnlichen transzendentalen Idealismus charakterisieren
konnten.
Aber es heit nun wieder die Zgel straffer anzuziehen und dessen wieder
zu gedenken, da wir werdende Philosophen sind, da wir fest gerichtet sein
wollten auf das oberste erkenntnisethische Ziel, dessen Korrelat die
Philosophie ist, d.i. eine universale Wissenschaft aus absoluter
Rechtfertigung. Demnach mssen wir unsere groe Aufgabe zu Ende fhren,
nmlich in apodiktisch zwingender Weise die Wege zu einer solchen
Philosophie freizulegen, um sie dann womglich ins Werk setzen zu knnen.
Geleitet sind wir dabei von dem Prinzip der adquaten Evidenz, das uns die
ersten Besinnungen als notwendiges Prinzip eines Anfangens ergeben hatten.
<So> gewannen wir das echte ego cogito und das Reich der rein egologischen
Wesensmglichkeiten. Hiermit zugleich gewannen wir aber, eigentlich unverhofft,
einen wirklichen Anfang, nmlich eine an sich erste Wissenschaft, die als rein
deskriptive Wissenschaft adquater Wesensgegebenheiten durchaus der leitenden
Idee absoluter Rechtfertigung entsprach. Wie steht es nun aber mit weiteren,
neuen Wissenschaften? Ist ihr Auffinden und Rechtfertigen dem Zufall berlassen?
Und kann fr sie eine gleiche Art der Rechtfertigung erhofft werden? Dann mten
ja alle Wissenschaften adquate Wesenswissenschaften sein.
Hier nehmen wir unsere Meditationen wieder auf; und zunchst beginnen
wir damit, uns zu berzeugen, da wir die uns vorgezeichneten Wege eigentlich
nicht verlassen haben und schon ein gut Stck weitergekommen sind. In der
Tat haben wir in der letzten Vorlesung nachgewiesen, da eine systematisch
fortgefhrte Phnomenologie das Universum aller unter dem Titel Vernunft
zu stellenden Wesensprobleme in sich birgt; es ist uns klar geworden, da die
auf das unmittelbare Apriori der transzendentalen Sphre gerichtete deskriptive
Phnomenologie die Gesamtheit aller unmittelbar einsichtigen Wesensgesetze
der Vernunfterkenntnis gewinnen mte, und zwar nach allen Wesens-
korrelationen (einsichtiges Erkennen, Wahrheit, wahrhaft Seiendes). Mit
Beziehung darauf leuchtet es aber ein, da die Phnomenologie nicht blo in
dem uerlichen Sinne Erste Philosophie ist, da sie die erste strenge
Wissenschaft ist, auf die wir auf unserem Wege stoen, und etwa gar eine
Wissenschaft, die mit den anderen prinzipiell nichts zu tun htte und die wie
zufllig nacheinander zur Begrndung kommen knnten. Vielmehr ist sie ja,
wie gezeigt, Wesenslehre der Vernunft, und darin liegt, da sie fr alle
mglichen Wissenschaften die Prinzipien ihrer absoluten Rechtfertigung in
sich birgt, da sie also alle Wissenschaften als echte, als absolut zu
rechtfertigende mglich macht. Damit gewinnt die Phnomenologie in einem
ganz ausgezeichneten Sinn die Stellung als Erste Philosophie, nmlich als
universale Normenlehre, nmlich als Prinzipienlehre absoluter Rechtfertigung
fr alle mglichen Wissenschaften.
241
Doch das bedarf eines tieferen Verstndnisses. Vor allem fhlen wir, da
in diesen Reden der Begriff der absoluten Rechtfertigung eine Verschiebung
erfhrt. Als Leitbegriff des Anfangs hatten wir den Begriff der Rechtfertigung
durch adquate Intuition gewonnen, fr den Anfang als quivalent fr abso-
lute Rechtfertigung, und darunter absolute, vorbehaltlose Selbstgebung
verstanden. In der diesem Ideal angemessenen transzendentalen
Phnomenologie haben wir aber eine Wissenschaft, zu deren eigenem
Aufgabenkreis es gehrt, die Idee der Vernunft berhaupt und alle zu diesem
Titel gehrigen besonderen Vernunftarten, also alle Arten und regionalen Ge-
stalten rechtgebender Evidenz und evidenter Begrndung, herauszustellen
und im Rahmen adquater Intuition nach Wesensmomenten und
Wesensgesetzen vollkommen zu klren.
In der Phnomenologie wird also, wie jeder mgliche Erkenntnistypus so
auch das ihren eigenen Aufbau leitende Erkenntnisideal selbst zum
Forschungsthema; im Rahmen adquaten Schauens erforscht sie reflektierend
das allgemeine Wesen der adquaten Erkenntnis und der rechtfertigenden
Begrndungen durch sie. Andererseits ist aber adquate Erkenntnis nicht die
einzige Erkenntnisart. Der Phnomenologe zeigt auch andere Evidenz- und
Begrndungsarten auf, klrt jede nach ihrem eigentmlichen Wesen und nach
allen Korrelationen, weist also auch nach, wie Evidenztypus und
Gegenstandstypus aufeinander wesensmig bezogen sind, wie man nicht
jeder beliebigen Gegenstndlichkeit ihrem eigenen Sinn gem jede beliebige
Evidenz vorschreiben kann, wie daher die Begrndungstypen sich notwendig
nach mglichen Gegenstandsgebieten differenzieren usw. Es wre, wie sich
also auf dem letzterdenklichen Forum, dem der Phnomenologie, entscheidet,
grundverkehrt, mit einem naiv von auen herangebrachten und zudem nie
radikal geklrten Erkenntnisideal alle Erkenntnis in gleicher Weise normieren,
irgendeines als das eine und einzig magebende behandeln zu wollen. Die
erkenntnismig zusammengehrigen Bewutseinsprozesse, die des
urteilenden Abzielens und entsprechenden Erzielens (bzw. Verfehlens), haben
ihre a priori feste Wesenstypik, und ein jeder differente solche Typus gibt
den Begriffen von Richtigkeit, Wahrheit, wahres Sein einen eigenen
normativen Sinn fr eigene Erkenntnissphren.
Haben wir also einmal die Stufe der Phnomenologie erreicht, so knnen
wir nicht mehr in Fehler nach Art der traditionellen Empirismen und
Rationalismen verfallen und speziell nicht in den hier in Frage stehenden
Fehler, der den Cartesianischen Gedankengang in den Meditationes
mitbestimmt; nmlich den Fehler, meinen zu wollen: Die Norm aller echten
Wissenschaftlichkeit mu in dem Sinn in der absolut adquaten Evidenz
liegen, da alle echte Wissenschaft eigentlich adquate Wesenswissenschaft
sein msse wie die Phnomenologie selbst. Jede aus wirklicher Evidenz
geschpfte Erkenntnis hat ein Recht, und wo die Evidenz ihre Gradualitten
und Stufen, wo die auf Wahrheit und wahres Sein gerichteten Erzielungsprozesse
242
der Begrndung ihre wesensmigen Modalitten der Approximation unter
Leitung erschauter regulativer Ideen haben, wie das bei der Naturerkenntnis
der Fall ist, da gehrt all das mit zum Gehalte des Rechtes.
Und doch bleibt auch der idealen Forderung einer absoluten Rechtfertigung
aller Erkenntnis, als einer Rechtfertigung aus Quellen adquater, absolut
selbstgebender Evidenz, ein unverbrchliches Recht; es bleibt diese unseren
ganzen Gedankengang beherrschende Forderung erhalten, wonach keine
Evidenz, keine Begrndung als letztgerechtfertigte gelten knne, die nicht
auf dem Forum der absolut adquaten Evidenz ihr Recht ausgewiesen hat.
Damit kann offenbar nur Folgendes gemeint sein: Allem anderen Erkennen
vorangehend, mu eine transzendentale Phnomenologie die Wesensformen
der Vernunft zu adquater, konkret allseitiger Erkenntnis bringen. Diese in
adquater Reinheit und letzter Verstndlichkeit herausgestellten Formen, die
Wesensgestalten und Gesetze eines mglichen Vernunftverfahrens berhaupt,
haben den notwendigen Beruf, als absolute Normen jedes wirklich ins Spiel
zu setzenden Erkennens zu fungieren. Also eine Erkenntnis ist nicht frher
absolut gerechtfertigt, und ihre Rechtfertigung heit so lange nicht absolute
Rechtfertigung, als sie nicht auf die in der Phnomenologie adquat erfaten
und beschriebenen Wesensgestalten und Wesensgesetze, auf die sie durch ihren
Typus verweist, zurckbezogen ist; mit anderen Worten: Rechtfertigung ist
zunchst jede naiv vollzogene Begrndung in ihrer naiv bettigten Evidenz.
Aber jede naive Rechtfertigung bedarf selbst wieder einer Rechtfertigung,
einer reflektiven und prinzipiellen Rechtfertigung ihrer Echtheit und in eins
damit eines tiefsten Verstehens des prinzipiellen Wesens ihrer Leistung; und
darin liegt, sie bedarf der Rckbeziehung auf die Phnomenologie, auf das
absolute Ego und seine prinzipiellen Zusammenhnge; hier springen die letzten
Quellen alles Rechts und aller Wahrheit, alles Seins.
Eben damit erweist die adquate Erkenntnis ihren einzigartigen Vorzug
vor allen anderen Erkenntnissen und erweist die an den Rahmen solcher
Adquation (und, was gleichwertig ist, des absoluten Ego) gebundene
Phnomenologie ihre einzigartige Stellung und Funktion gegenber allen
anderen Wissenschaften, da diese alle nur durch sie, die Phnomenologie,
zu absolut gerechtfertigten, zu im letzten Sinne strengen oder
philosophischen Wissenschaften werden knnen. Sie ist also die Wissenschaft
von aller Methode letztstrenger Erkenntnis und Wissenschaft.
Doch die Notwendigkeit dieser normativen Funktion mu erst gezeigt
werden. Warum gengt es denn nicht, werden Sie fragen, in schlichter
Hingabe an die Sachen, also sozusagen naiv, Evidenz zu bettigen? Wozu
noch eine nachkommende Normierung und Rechtfertigung der bettigten
Evidenz aus allgemeinen Wesensprinzipien der Evidenz; wozu der Rekurs
auf eine Phnomenologie, welche diese Prinzipien aus adquater Intui-
tion schpft und aus den universalen Bewutseinszusammenhngen
letztverstndlich macht?
243
Zudem, gleicht die Phnomenologie hier nicht dem Mnchhausen, der
sich beim eigenen Zopfe aus dem Sumpf herauszieht? Ihre adquate
Erkenntnisweise htte sie zu rechtfertigen durch Rekurs auf Prinzipien, die
sie selbst (und in ihrem System recht spt) herausstellt. Hier liegen Zirkel
und unendlicher Regre.
Aber es ist, um gleich an diesen Punkt anzuknpfen, fraglich, ob man
nicht besser tte, statt dieser verchtlich wertenden Ausdrcke weniger
belastete zu bentzen. Wir sprechen besser und ganz rechtmig von einer
theoretischen und normativen Rckbezogenheit der Phnomenologie auf sich
selbst, die sie gerade als Erste Philosophie charakterisiert und auszeichnet.
Natrlich stellt eine Wesenslehre des Ich und Ichbewutseins Gesetze auf,
unter welchen, als einzelnes Faktum, das jeweils forschende Ich und sein
Forschen selbst steht, so wie berhaupt, so auch hinsichtlich des Erkennens.
Und wenn die Phnomenologie das Wesen des praktischen Ich mitbefat,
und darunter des praktisch erkennenden, und wenn sie selbstverstndlich auch
die Wesensgesetze der vernnftigen Erkenntnispraxis wie aller Praxis aus
letzten Quellen aufzeigt, so wird die Rckbeziehung der in praktische
Vernunftnormen umgewendeten Wesensgesetze adquater Erkenntnis auf das
phnomenologische Erfahren selbst keine unlslichen Schwierigkeiten
machen knnen. Dabei mchte ich nicht verweilen.
Doch wichtiger ist es fr uns, die Wissenschaften auer der Phnomenologie
zu betrachten und unsere sehr khne These zu begrnden, da sie nur durch
methodische Rckbeziehung auf Phnomenologie (und zum Teil nur durch
unmittelbare Einpflanzung in sie) den Rang strenger, letztgerechtfertigter
Wissenschaften gewinnen knnen.
Nach der allgemeinen Meinung der Wissenschaftler ist die Transzen-
dentalphilosophie ein kurioser, aus weltanschaulichen Grnden hoch zu
bewertender Appendix zu den auertranszendentalen Wissenschaften, die
ihrerseits vllig autonom seien und zudem dazu berufen, alle philosophischen
Disziplinen zu unterbauen und ihnen durch ihre selbsterworbene Strenge zum
Vorbild zu dienen. Der Spezialforscher als solcher, im abgeschlossenen Kreis
seiner fachlichen Interessen, braucht sich also um Philosophie nicht zu
kmmern. Wir vertreten hier also die scharf entgegengesetzte Auffassung,
aber freilich nicht fr eine beliebige Philosophie, sondern fr <die>
transzendentale Phnomenologie als Wissenschaft von der absoluten
Subjektivitt; dabei sei die Phnomenologie zunchst, wie bisher, betrachtet
als Wissenschaft unmittelbarer, aber apriorischer Deskriptionen.
Stellen wir eine berlegung an. Es ist die Art aller wissenschaftlichen
Denkarbeit, keinen Satz hinstellen zu wollen, der nicht einsichtig, sei es
unmittelbar oder mittelbar, etwa durch Erfahrung oder Schlufolgerung,
begrndet worden ist. Aber damit begngt sie sich keineswegs. Wissenschaft
will nicht eine Erkenntnis aus blo naiver Begrndung sein, vielmehr fordert
sie eine bestndig begleitende Nachprfung und Kritik jeder zunchst naiv
244
vollzogenen Begrndung. So ist denn tatschlich jedes aktuell vollzogene
wissenschaftliche Begrnden und der ganze Zug des aktuellen wissenschaft-
lichen Denkens, in dem die Theorie als wissenschaftliche sich konstituiert,
doppelschichtig. Die sozusagen gerade Evidenz, die auf die Sachen, auf die
so und so umgriffenen Sachen und Sachverhalte gerichtete Evidenz, ist
bestndig begleitet von einem kritischen Bewutsein, das wir in seiner
Abschluform als Bewutsein der Normgerechtigkeit <be>nennen knnten.
Es erwchst in ursprnglicher Form direkt aus expliziter Kritik der naiven
Evidenz und der in ihr vollzogenen Begrndungen oder in sekundrer Form
als Nachwirkung frherer solcher Kritiken, als Bewutsein also einer
habituellen inneren Gewiheit, da bei diesen evidenten Begrndungen hier
alles in Ordnung sei und sie (als frher schon geprfte oder aufgrund
wohlbekannter Prinzipien u. dgl.) jederzeit wieder explizit gerechtfertigt
werden knnte.
Insofern ist also wissenschaftliche Denkart ihrer herrschenden Intention
nach wesentlich verschieden von der natrlich-naiven. Der Wissenschaftler
ist und je strenger wissenschaftlich er vorgeht immer mehr darauf aus,
sich bestndig zu fragen, was in der jeweiligen Beobachtung wirklich und
eigentlich beobachtet sei und was bloe Antizipation oder gedanklich
vermittelte Mitmeinung sei; oder im Gebrauche seiner Begriffsworte, wie es
mit dem allgemeinen Sinn derselben stehe, ob er sich nicht verschoben habe,
wie er streng zu umgrenzen und an Beispielen eindeutig zu klren sei; ebenso
bei allen Schlssen und in allen ihren Schritten, ob das wirklich folge, das ist,
ob die Evidenz eine vollkommene sei und in der vervollkommneten sich das
Folgen wirklich besttige usw. Evidente Begrndung schlechthin, schlichte,
in der Blickrichtung auf die Sachen vollzogene, gengt also der Wissenschaft
nicht, es bedarf, und prinzipiell berall, einer Begrndung der Begrndungen
selbst in Form reflektiver Kritik. Was hier berall unter dem Titel Kritik erfolgt,
ist offenbar (phnomenologisch gesprochen) eine reflektive intentionale Ana-
lyse, die die Reichweite der erfllenden Erzielung und die berschsse
unerfllt verbleibender Meinungen herausstellt.
Sehen wir nher zu, so verstehen wir nun die methodische Funktion aller
apriorischen Prinzipien und in weiterer Folge aller apriorischen
Wissenschaften. Sie dienen, einmal herausgestellt, als bestndig bereite
Hilfsmittel der eigentliche Wissenschaftlichkeit schaffenden Kritik; sie
ermglichen einen leistungsfhigen Wissenschaftstypus, den der exakten
Wissenschaft, der Wissenschaft aus Prinzipien. Jedes Apriori hebt uns ber
das Zufllige, Besondere und Faktische hinaus in das ideale Reich reiner
Mglichkeiten und Wesensnotwendigkeiten. Einmal eingesehen und zu
habitueller Bereitschaft gebracht, macht es die explizite Kritik aller besonderen
Evidenzen entbehrlich, die dem apriorischen Wesenstypus entsprechen. Es
bedarf nur der einmaligen Rechtfertigung des prinzipiellen Apriori und fr
das deduktive Apriori der einmaligen Rechtfertigung der Deduktion gem
245
den Prinzipien der Deduktion. Andererseits gewinnt jede besondere Evidenz
im Bewutsein der Rckbezogenheit auf ein entsprechendes Apriori die hhere
methodische Dignitt einer Notwendigkeit der Geltung aus der bloen und
reinen Mglichkeit her.
In dieser Art kennen wir ganze Reihen apriorischer Wissenschaften, die
teils von vornherein konzipiert sind um dieser Abzweckung willen, wie vor
allem die formale Syllogistik und in der Neuzeit die Mathematik der
Wahrscheinlichkeiten, teils diese methodische Funktion bernommen haben
und ihr seitdem vorzglich dienen, wie die Arithmetik, die Geometrie und
die brigen mathematischen Disziplinen. In dieser Reihe finden wir
selbstverstndlich, da der ganze traditionelle Wissenschaftsbetrieb sich in
der natrlichen Einstellung hlt, die apriorische Wissenschaft vom
transzendentalen Ego nicht. Sie sind alle apriorische Wissenschaften von
Gegenstnden mglichen Bewutseins, aber nicht vom Bewutsein selbst
als transzendental Konstituierendem. Diese Gegenberstellung hat eine
bleibende prinzipielle Bedeutung. Nennen wir alle apriorischen
Wissenschaften der natrlich geraden Blickrichtung, also die Wissenschaften
von allem im natrlichen Sinn Seienden, Ontologien, so sind also alle
historisch berlieferten apriorischen Disziplinen Ontologien. Sie sind nher
besehen von zweierlei Art: Die einen enthllen das Apriori, das zur formal
allgemeinsten Idee der Gegenstndlichkeit berhaupt gehrt (Analysis,
Mannigfaltigkeitslehre), die anderen binden sich an die Idee individueller
realer Gegenstndlichkeit bzw. an eine ausgezeichnete Realittskategorie,
nmlich an die Idee einer mglichen Natur berhaupt. Hierher gehren die
Geometrie und berhaupt die apriorische Wissenschaft von Raum und Zeit
und die apriorische Mechanik, wenn man eine solche rein umgrenzt. Alle
diese Wissenschaften wollen strenge und eigentliche Wissenschaft sein; sie
wrden es sein, wenn einerseits ihre prinzipiellen Axiome der reflektiven
Kritik vollkommen genugtun wrden, und andererseits, wenn jeder Schritt
deduktiver Ableitung sein formuliertes Prinzip hinter sich htte, das selbst in
hnlichem Sinn voll zu rechtfertigen wre. Fungiert dann eine solche, sagen
wir z. B. eine mathematische Wissenschaft als methodisches Instrument
sonstiger, etwa der Naturwissenschaften, so erteilt sie diesen Rationalitt
der Begrndung, und sie sind genau so weit exakt, als solche
Mathematisierung reicht.
Gehen wir als Philosophen bis ans Letzte, an den idealen Limes, so ergbe
sich uns eine Abwandlung einer bekannten Kantischen Lehre:
11
In einer
empirischen Wissenschaft ist genau so viel eigentliche Wissenschaft zu
finden, als sie aus apriorischen Wissenschaften rechtfertigen, als notwendig
geltend nachweisen kann. Was dann aber die apriorischen Wissenschaften
anlangt, so ist jede solche Wissenschaft soweit gerechtfertigt und nur soweit
eigentliche Wissenschaft, als sie in Reflexion auf jedes zunchst immer naiv
einsetzende Begrnden fr dieses selbst apriorische Prinzipien rechtfertigender
246
Kritik aufweisen kann. Beispielsweise jeder Schlu, den eine vollkommen
streng gerechtfertigte Mathematik zieht, mte ein formuliertes Schluprinzip
hinter sich haben und drfte nur daraus und nicht durch eine vereinzelte
Nachprfung seiner Evidenz gerechtfertigt sein.
Darin liegt aber: Eigentliche Wissenschaft ist ein Ideal, eine Idee im
Kantischen Sinn, und fordert eine wissenschaftlich herausgestellte Totalitt
alles Apriori berhaupt; mit anderen Worten, eigentliche Wissenschaft fordert
ein universales System apriorischer Wissenschaften, dessen Rechtfertigung
auf es selbst zurckbezogen ist. Die reflektive Kritik innerhalb dieses Sy-
stems drfte auf kein apriorisches Prinzip mehr stoen, das nicht im System
selbst schon aufgestellt wre. Dieses universale, synthetisch vereinheitlichte
Apriori wre der ideale Quell aller Methode, es wre das berhaupt und berall
strenge Wissenschaftlichkeit Machende. Die eigentlichen Wissenschaften
zerfielen dann in apriorische Wissenschaften und in angewandte, in
empirische, aber durchaus aus apriorischen Prinzipien erklrende und sich
selbst rechtfertigende. In allen eigentlichen Wissenschaften herrschte
vollkommene, d.i. denkbar grte Rationalitt, innerhalb deren kein Raum
brigbliebe fr ein Unverstndliches. Nur das hic et nunc der Tatsache, das
zu allem Empirischen gehrt, wre der bestndige Diskontinuittspunkt der
Rationalitt der empirischen Wissenschaften, er ist das Irrationale, das Apriori-
Wissenschaft prinzipiell nicht rationalisieren kann.
Nachdem wir das Ideal klargestellt haben, gehen wir an die anerkannt
vollkommensten Wissenschaften heran, an die mathematischen (reine
Mathematik und mathematische Naturwissenschaft). Sie rhmen sich ihrer
Exaktheit gerne, und jedenfalls sind sie berzeugt, fr die Sicherheit und
Vervollkommnung ihrer wissenschaftlichen Strenge in ihrer spezialistischen
Abgeschlossenheit selbst sorgen zu mssen. Hier fllt es uns aber auf, da sie
dem entworfenen Exaktheitsideal nur in einer Richtung in einigem Mae
<sich> annhern und da sie nur in dieser einen Richtung seit langem schon
ihm bewut zu gengen suchen; nmlich in Richtung der deduktiven
Theoretisierung. Ganz anders verhlt es sich mit der in ihrer Bedeutung allzu
lange verkannten Rechtfertigung der Grundbegriffe und Axiome bzw. ihrer
kritischen Umbildung in vollkommen zu rechtfertigende. Das leidenschaftliche
Bemhen, hier echte Grundlegungen zu schaffen, fhrte bekanntlich zu
revolutionren Reformversuchen, welche einschneidende nderungen des
Gehaltes der Wissenschaft selbst zur Folge haben sollten. Wir denken hier an
den Kampf um die Neuformung der geometrischen und physikalischen
Grundbegriffe und an die Einsteinsche Relativittstheorie, aber auch an den
Kampf um die Neugestaltung der Grundbegriffe der reinen Analysis (Menge,
Zahl, Kontinuum) und an die revolutionren Theorien von Brouwer und Weyl.
Die Sachlage ist insofern eine hchst paradoxe, als es sich doch um
Axiomatisches handelt, welches prtendiert, in apodiktischer Evidenz
eingesehen zu sein. Und in der Tat, wer knnte sich z. B. der Evidenz der
247
geometrischen Grundstze entziehen? Und doch, die wissenschaftlich
nachkommende reflektive Kritik fordert Neubildungen.
Wenn man als Phnomenologe an die Probleme der Grundlagenforschung
der objektiven Wissenschaften herantritt, so hat man von vornherein eine
klare Vorstellung von dem einen, aber allerdings auch berwltigend Groen,
was hier nottut, wenn mindestens in Zukunft die Sachlage gnstiger werden
soll. Und ber diese Sachlage mssen wir doch hinauskommen, ber
Wissenschaften dieser Art, die mit all ihrer wunderbaren theoretischen Technik
und mit ihren nicht minder wunderbaren praktischen Erfolgen es zu keiner
wirklichen Rechtfertigung, zu keiner rationalen Durchsichtigkeit und Klarheit
bringen knnen. Diese Wissenschaften lehren es, um an ein Lotzesches Wort
zu erinnern, vortrefflich die Welt zu berechnen, aber da sie sich selbst nicht
verstehen, verstehen sie auch nicht den Sinn der Welt, die sie berechnen.
12
Und sollte nicht mit diesen prinzipiellen Unklarheiten der relativ
vollkommensten Wissenschaften, der von der Natur, auch jener grundverkehrte
Naturalismus zusammenhngen, der unsere Epoche seelisch so kraftlos macht,
und die Unfhigkeit, den Geisteswissenschaften <die> richtige Stellung und
Funktion, richtige Grundlegungen und schon Zielstellungen zu geben?
Nun ist es uns doch evident, da wahres Sein, aus welcher erdenklichen
Wissenschaft immer, seine konstitutive Ursprungssttte in der transzendentalen
Subjektivitt hat und da jede Seinsregion, wie z. B. (die als unterste
Weltstruktur fungierende) Natur, zunchst und allem Theoretisieren
vorangehend, sich in der unmittelbaren Selbstgebung der Erfahrung evident
darbietet. Theoretische Wissenschaft ist offenbar eine hhere Stufe
konstitutiver Leistungen, es sind Leistungen der vernnftigen Aktitivt, die
aber in ihrer Sinngebung und in ihrem Recht durchaus abhngig bleiben von
den entsprechenden Leistungen der Erfahrung. Wie sollte es nun je zu einer
ursprnglich geschpften und kritisch bewut sich rechtfertigenden
Begriffsbildung kommen, wenn man nicht vorher die konstitutive Leistung
der entsprechenden Erfahrungen verstanden htte und wenn man nicht den
Gang der ersten sinnlichen Begriffsbildung bis zur Bildung exakter
Limesbegriffe im Rahmen ursprnglicher Intuition und prinzipieller
Wesensallgemeinheit, d.i. durch Wesensdeskription erforscht htte?
Also mu man zunchst das vortheoretische Ding als intentionale Einheit
einstimmiger Erfahrung und rein aus ihr selbst heraus studieren, und darin
liegt natrlich weiter, ohne sich durch Vorurteile wie die der bloen
Subjektivitt der Sinnendinge und ihrer blo sekundren Qualitten bestimmen
zu lassen. Man wei als Phnomenologe von vornherein, da es hier im
Wesensmigen nichts verchtlich beiseite zu Schiebendes gibt, da alles
hier seine sinngebende Funktion haben mu, die den Sinn des theoretisch
naturwissenschaftlichen Dinges mitbestimmt. Nach Studium all der hchst
komplizierten Schichtungen des Sinnendinges mu man dann an die
Grundfragen der Theoretisierung und zunchst der Quantifizierung treten,
248
also klarlegen, wie an das sinnlich Flieende mit seinen roh morphologischen
Begriffen von Gro und Klein, von stetigen bergngen, von Figur usw.
die exakten mathematischen Begriffe herankommen, oder vielmehr, welche
sinngebenden Prozesse hier neue Sinne und Begriffe, eben diese quantitativen,
gestalten. Kurzum, es handelt sich hier um rein phnomenologische Probleme,
Probleme einer gewissen Schicht der transzendentalen Phnomenologie,
betreffend die Objektivierung in Form passiver Sinnlichkeit und in hherer
Stufe einer quantifizierenden und konstruierenden mathematischen Aktivitt.
Als Phnomenologe achtet man dann auf die Selbstverstndlichkeit, da
die Konstitution der Natur nichts Isoliertes ist, sondern wesensbezogen auf
die Konstitution der Leiblichkeit als System von Wahrnehmungsorganen, als
Trger der notwendigen Kinsthesen und der Sinnesfelder etc. So ist dann
berhaupt die phnomenologische Konstitution der gesamten Welt mit allen
Typen von Objektivitten eine innig verflochtene Einheit, und alles Verstehen,
das da Grenzen macht, ist ein nur halbes Verstehen. Aber es ist auch zu
beachten, da die Wesensbetrachtungen nicht blo in der geraden
Blickrichtung auf die jeweiligen Gegenstnde, zuunterst die Gegenstnde in
der Sinngebung der Erfahrung, erfolgen darf. Das Erfahrene ist eben
Erfahrenes eines Erfahrens und erfahrenden Ich, das nicht ein Nichts, sondern
ein leistendes ist. Also schlielich ist es klar, man kann nirgend haltmachen,
so weit die Einheit der Wesenszusammenhnge und der Wesenskorrelationen
luft, so weit hngt Sinn von Sinn, Wesen von Wesen ab, und so kann nur
eine vollkommene, allseitig sich entwickelnde Phnomenologie die Quelle
aller vollkommenen Einsichten, aller allseitigen und letzten Rechtfertigungen
sein. In der Idee gesprochen birgt sie das Prinzipiensystem fr die Klrung,
ja ursprngliche Bildung aller Grundbegriffe und Grundstze in sich. Nur sie
mu also die methodischen Mittel herausstellen, um alle anderen
Wissenschaften in Wissenschaften aus letzter Rechtfertigung zu gestalten.
Ja es ist sogar einleuchtend, da sie nicht blo Kritik zu ben brauchte fr
ihr uerlich dargebotene Begriffe und Wissenschaften, sondern in ihrer
systematischen Entwicklung mssen all die Erkenntnisgestaltungen, die sich
in prinzipiellen Begriffen ausdrcken, von selbst auftreten. Das Apriori der
absoluten Subjektivitt, voll und nach allen Korrelationen genommen, ist
nicht ein spezielles Apriori, sondern ist das Universum alles Apriori berhaupt.
Dahin gehren also auch alle regionalen Grundbegriffe, welche die
ontologischen Disziplinen voneinander scheiden, Begriffe wie individuelles
Reales oder Ding (und die Formen der Individualitt wie Raum und Zeit),
Animalitt und Mensch, Sozialitt, Kultur. Eine rein deskriptive
Phnomenologie denken wir uns bezogen auf alles unmittelbare Apriori im
systematischen Zusammenhang, das unmittelbar Gefate beschreibt sie, sie
drckt es nur adquat aus. Doch will es mir scheinen, da kein Grund besteht,
nun noch eine ernstliche Trennung zwischen transzendentaler Phnomenologie
und den verschiedenen apriorischen Wissenschaften gelten zu lassen. Denn
249
alle deduktiven Theoretisierungen aus unmittelbar evidenten Grundlagen sind
doch nur kompliziertere Gebilde der transzendentalen Subjektivitt. Danach
sehe ich in den apriorischen Wissenschaften nur Zweige aus dem
Wurzelsystem und Stamm der deskriptiven Phnomenologie. Voll genommen
ist die Phnomenologie, ideal entwickelt gedacht, danach nichts anderes als
das universale System alles unmittelbaren und mittelbaren Apriori, sie ist die
synthetisch einheitliche universitas aller apriorischen Wissenschaften aber
nur in diesem vollstndigen und systematisch sich wechselseitig
rationalisierenden Zusammenhang ist jede dieser Wissenschaften und diese
ganze universitas absolut rational, rational im hchsten denkbaren Sinn.
Erkenntnis
13
ist freilich nicht blo ein mgliches transzendentales,
sondern auch ein naturales Faktum: Vorkommnis in menschlichen und in
niederster Stufe in tierischen Seelen auf dieser Erde, mit deren Natur sich
die Psychologie als Erfahrungswissenschaft und weltbezogene Wissenschaft
beschftigt. Es ist aber klar, da alles, was sie an wirklich Naturalem und
Empirischem zu sagen hat, nicht das Wesen der Erkenntnis angeht, sondern
es voraussetzt. Es ist ein Widersinn, aus der Psychologie irgendetwas ber
das Wesen der Erkenntnis, ber das Wesen des Ich, des Bewutseins und
seiner Wesensmglichkeiten und -notwendigkeiten intentionaler Konstitution
von Gegenstndlichkeiten lernen zu wollen und somit von ihr etwas lernen
zu wollen ber die Vernunft, nicht als eine empirische Charaktereigenschaft,
sondern als einen Titel fr Wesensstrukturen der Erkenntnisgeltung, in der
sich erkenntnismig Abzielung und Erzielung abspielen, in der eine
teleologisch geordnete Sinngebung unter dem Telos wahres Sein erfolgen
und jede Gegenstandsregion ihre mgliche Selbstgegebenheit, ihre gltige
Anerkennung als seiend und ihre logische Bestimmung erfahren kann.
Es ist ein Widersinn, von der Psychologie solches erfahren zu wollen, was
Erkenntnis nach Sinn und Geltung verstndlich macht, weil eben das gesuchte
Verstndnis sinnvoll nur Wesenserkenntnis sein kann, und solche im
Empirischen zu suchen, wre genauso weise, wie etwa aus der
Naturwissenschaft arithmetische und sonstige mathematische Erkenntnis
schpfen zu wollen. Natrlich kommen Zahlen, Gren, Figuren in der Natur
vor. Aber im Beobachten feststellen kann man nur zwei Planeten, aber nicht
die Zahl 2; empirisch feststellen kann man, da es heute zweimal vorkam,
da zwei Kometen sichtbar geworden sind, aber nicht, da 2 2 = 4 ist.
Diese Weisheit aber einer Begrndung schon der objektiven Logik und erst
recht der Erkenntnistheorie durch Psychologie bietet man uns seit
Jahrhunderten an.
Transzendentale Probleme jeder Art, und zunchst das gewhnlich so
genannte transzendentale Problem der Mglichkeit einer transzendenten Natur-
und Welterkenntnis, durch Psychologie lsen zu wollen, die selbst transzendente
Wissenschaft ist, ist nichts weiter als eine Naivitt, die ein Problem lsen will,
dessen Sinn sie berhaupt nicht versteht. Von all solchem Vorbeisehen ber
250
den wahren und echten Sinn der Probleme, auf die alle neue Philosophie im
Innersten hinauswollte, und ber ihren Grundcharakter von apriorischen
Problemen der transzendentalen Subjektivitt heilt uns aber die Methode der
transzendentalen Reduktion und die Grunderkenntnis, da in dieser nun erst
rein ersichtlichen Subjektivitt ein unendliches Feld apriorischer
Wesensstrukturen beschlossen ist, in deren Studium alle vernnftigen
Erkenntnisprobleme zur exakten Formulierung und Auflsung kommen mssen.
Eben damit realisiert die transzendentale Phnomenologie zugleich in
vollkommener Weise die ursprngliche und als Prtention nie erstorbene Idee
der Logik oder Wissenschaftslehre. Sie verwirklicht also die Intentionen der
Platonischen Dialektik. Denn das war ja die ursprngliche Idee der Logik;
sie sollte die allen Wissenschaften vorangehende Methodenlehre echter
Wissenschaft sein, echter, d.i. nach ihren Prinzipien absolut zu rechtfertigender.
Darum ging ihr ursprngliches Interesse nach allen korrelativen Seiten hin;
sie reflektierte ber das Wesen des Vernunftbewutseins und seiner
Vernunftleistung, sie betrachtet das geleistete Produkt, den begrifflich gedachten
Gegenstand und den Urteilssatz, die Prinzipien mglicher Wahrheit, mglicher
wahrer Schlsse, und sie spricht Stze fr Gegenstnde berhaupt aus.
Aber vergeblich erhob sie ihre groen Prtentionen einer Methodenlehre
aller strengen Erkenntnis, einerseits weil sie sich vergeblich mhte, den Weg
zu finden von den formal allgemeinsten Allgemeinheiten zu den regionalen
Besonderheiten, und andererseits weil es ihr so wenig gelang, selbst zu einer
strengen Erkenntnis zu werden. Sie selbst war nahezu die schlechtest fundierte
aller ernsten Wissenschaften, ihre Grundbegriffe und Grundstze voller
Unklarheiten, ganz abgesehen von ihren engbrstigen Einschrnkungen. Sie
war durchaus dogmatische Wissenschaft, Wissenschaft aus natrlicher
Einstellung. Gerade als Logik konnte sie das nicht sein. In dem Bemhen um
eine wissenschaftliche Fundierung verfiel sie auf den Widersinn des
Psychologismus, sie behandelte die erkenntnistheoretischen Probleme statt
als solche einer transzendentalen Wesenslehre der absoluten Subjektivitt
vielmehr als psychologische und biologische Probleme des Menschen in der
Welt. Der empiristische Naturalismus verfiel sogar auch in den Widersinn,
die syllogistische Logik als psychologische Disziplin zu interpretieren.
Historisch war die Erkenntnis dieses Versagens der universalen Logik und
die tastenden Versuche, sie so zu reformieren, da sie wirklich sich selbst
verstehen und dann zur Normierung helfen knne, die Etappen der
Entwicklung der neuen Phnomenologie.
Wenn wir danach der Phnomenologie diese groe Stellung vindizieren,
universelle Methodenlehre und Mutter aller apriorischen Wissenschaften zu
sein, so wchst ihr natrlich auch die wichtige Aufgabe zu, die sich in seiner
Weise und eng begrenzt schon Kant in dem bekannten Paragraphen ber den
systematischen Leitfaden zur Aufsuchung aller reinen Verstandesbegriffe
14
gestellt hat. Es gilt, so wrde die Aufgabe sich fr uns darstellen, das
251
vollstndige und geordnete System der obersten Regionen mglichen Seins
in transzendentaler Ursprnglichkeit zu entwickeln und von da aus das Sy-
stem aller apriorischen Wissenschaften geordnet und ursprnglich
gerechtfertigt aufzubauen. Einen Leitfaden bietet dabei der Ausgang von
der formalen Mathematik als mathesis universalis und das systematische
Herabsteigen zur Idee individueller Realitt und einer individuellen Welt
und zu den notwendigen besonderen Stufen und Differenzierungen, die diese
Idee a priori erfahren kann. Es zeigt sich dabei, da die formale Grundstruktur
der faktisch gegebenen Welt als einer psychophysischen Natur, einer Welt,
die in hherer Stufe zur Sozial- und Kulturwelt sich entwickelt, ihre
transzendentalen Grnde haben mu.
Die Auffassung einer transzendentalen Phnomenologie als Logik ist ihre
Auffassung unter normativem Gesichtspunkt. Nimmt man sie fr sich selbst
und als reine Theorie, so ist sie die Wissenschaft von allen reinen
Mglichkeiten und den sie regelnden Notwendigkeiten, und damit ist sie die
Wissenschaft von allen mglichen Mannigfaltigkeiten und auf Individuelles
bezogen, auf alle mglichen Welten und allem mglichen absoluten Sinn
von Welten. Frei variabel bleibt dabei die letzte Hyle. Die Theorie ist formale,
auf rein kategoriale Gestalten bezogen. Das fhrt zurck zu ihrer Auffassung
als absoluter Monadologie oder Metaphysik, aber blo in Wesenseinstellung,
nicht von faktisch wirklichen Monaden und den mit ihnen sich
konstituierenden phnomenalen Welten, sondern von mglichen Monaden
und was dazu reell und ideell notwendig gehrt.
So z. B. die wesensmige Harmonie der Monaden, die miteinander
und freinander nur sein knnen durch die Konstitution einer ihnen allen
gemeinsamen Welt, als in jeder sich bereinstimmend konstituierenden. In
hchster Stufe erwachsen in dieser Monadologie natrlich auch die
theologischen Probleme; sie hngen innig zusammen mit den Problemen einer
durch das absolute Universum hindurchgehenden und sich in der
Menschheitsgeschichte eventuell bekundenden Entwicklung; einer
Entwicklung, die der Welt in ausgezeichnetem Sinn Sinn gibt, nmlich
eine teleologische Richtung gegen die Idee des Guten.
15
Durch den logischen Normsinn der Phnomenologie als Erster Philosophie
bestimmen sich alle empirischen Wissenschaften als zweite, von der
Phnomenologie abhngige Wissenschaften; abhngig nmlich, wenn sie als
letztstrenge gelten sollen, somit als Philosophien. Exaktheit im engeren Sinne
ist mathematisch-quantitative Exaktheit. Im weiteren Sinn ist es aber das reine
und universale Apriori, das exakt macht, das den ursprnglich in der Idee
der Wissenschaft liegenden Trieb nach letzter Rechtfertigung erfllt. Wrden
wir das schne Wort mathesis in seinem ursprnglich weitesten Sinn
verwenden drfen, so knnten wir sagen, empirische Wissenschaften werden
zu philosophischen durch die vollkommenst denkbare Mathematisierung,
wobei die Erste Philosophie, die universale mathesis in dem weitesten Sinn,
252
hnlich alle reinen Theorien parat htte wie die reine Mathematik
gewhnlichen Sinnes in Hinsicht auf die Naturwissenschaft. Eben dadurch
haben aber alle exakt gewordenen empirischen Wissenschaften systematische
Ordnung und Verknpfung, vermittelt durch die apriorische Systematik der
Regionen und ihrer apriorischen Disziplinen.
Mitbeschlossen in dem eben Ausgefhrten ist die Metaphysik der faktischen
Welt oder die Feststellung des absoluten Sinnes in der Ordnung und Einigung
alles faktischen Seins. Was die Erste Philosophie in dieser Hinsicht fr alle
mglichen Welten festgestellt hat, findet Anwendung zur absoluten
Sinnesbestimmung des Faktums.
Als wichtige Anmerkung mchte ich noch beifgen, da die phnome-
nologische Aufklrung des Sinnes rechtmiger empirischer Wissenschaften
zugleich das Problem lst, inwiefern es eine Tatsachenwissenschaft von der
transzendentalen Subjektivitt geben kann. Die Antwort lautet: nur in Form
der transzendental begrndeten Erfahrungswissenschaften. Denn ihrem
absoluten Sinne nach drcken sie Regelungen der faktischen transzendentalen
Subjektivitten aus; jede empirische Wahrheit fr Dinge z. B. drckt,
quivalent und absolut verstanden, eine konstitutive Regel fr alle miteinander
kommunizierenden transzendentalen Subjekte aus.
Nach unseren allgemein und unter verschiedenen Gesichtspunkten
vollzogenen Charakteristiken der mglichen und notwendigen Ziele der
Phnomenologie knnen wir uns auch eine Vorstellung von der Zukunft
der Philosophie im Sinne ihrer Intentionen bilden. In der Gegenwart finden
wir aus historischen Grnden, die freilich nicht eines teleologischen Sinnes
entbehren, eine Trennung zwischen Philosophie und auerphilosophischen
Wissenschaften. Sub specie aeterni<tatis> betrachtet ist diese Trennung
nicht zu halten. Die Philosophie vertritt die Idee einer absoluten Erkenntnis,
d.i. einer Erkenntnis von letzterdenklicher Rationalitt. Eine solche ist aber,
wie zu zeigen versucht worden ist, nur als eine universale Erkenntnis, nur
in einem Universum phnomenologisch begrndeter Wissenschaften
mglich mit der Stufenfolge erster und zweiter Philosophie. Daraus ergibt
sich klar die Zukunftsaufgabe der Philosophie oder, was gleichwertig ist,
das der ganzen wissenschaftlichen Zukunft der Menschheit vorgezeichnete
Ziel.
Frs erste, als die unmittelbarste und grte der uns berhaupt gestellten
theoretischen Aufgaben scheint mir gelten zu mssen zunchst die
systematische Ausbildung der im Werden befindlichen deskriptiven
Phnomenologie. Das Wertvolle und Entscheidende liegt hier in der konkreten
phnomenologischen Arbeit, wie denn ihr ganzes Absehen, und notwendig,
gerichtet ist auf nchterne Arbeit im Feld unmittelbarer Wesensanschauung.
Alle Philosophie von oben her, alle Philosophie genialer Vorahnung, mu
ihre Rolle ausgespielt haben, wenn es einen festen Arbeitsboden gibt, auf
dem man, obschon mhselig, sen und ernten kann.
253
Was die Spezialwissenschaften anlangt, so wird es solche, aber nur um
der Arbeitsteilung willen, immer geben mssen. Aber ihre spezialistische
Sonderung darf nicht erhalten bleiben. Phnomenologische und
spezialwissenschaftliche Arbeit werden sich verbinden und im gezeichneten
Stile zur Einheit einer universalen philosophischen Funktion zusammentreten
mssen. Man wird sich von beiden Seiten die Hnde reichen, und nur so
wird den Spezialwissenschaften die strengste Wissenschaftlichkeit zuteil
werden, natrlich im allmhlichen Fortschreiten; ferner, soweit noch
Seinsregionen apriorischer Forschung nicht unterzogen worden sind, wird
die Phnomenologie von sich aus diese Disziplinen zu begrnden <haben>,
und diese werden von vornherein schon in radikaler Klrung erwachsen
und fest eingewurzelt bleiben am Mutterstamme. In der idealen Zukunft
wird jeder Spezialforscher in der entsprechend hoch entwickelten
Phnomenologie genauso, meine ich, zu Hause sein wie der Physiker in der
Mathematik. Sie wird aber auch das gemeinsame Mutterhaus sein, in dem
alle geschwisterlichen Wissenschaften zusammenkommen; sie wird die
Ursprungssttte einer Metaphysik sein, die streng wissenschaftlich uns
im Allgemeinen, und durch das Medium der Spezialwissenschaften im
Besonderen, den Sinn der Welt erschliet.
Anmerkungen
1. Zu dem den Hrern von Husserls Vortrgen vorliegenden Syllabus in englischer Sprache
vgl. Spiegelberg, Husserl in England, a.a.O., S. 16f. Anm. d. Hrsg.
2. Descartes, Regulae ad directionem ingenii. Oeuvres de Descartes, hrsg. v. Ch. Adam u.
P. Tannery, 11 Bde., Paris 18971910, Bd. X, S. 395. Anm. d. Hrsg.
3. Descartes, ebd., S. 360. Anm. d. Hrsg.
4. Gem Descartes immer wiederkehrender Formel semel in vita, vgl. Meditationes
de prima philosophia. Oeuvres, Bd. VII, S. 17; Principia philosophiae. Oeuvres, Bd.
VIII, S. 15 sowie Regulae. Oeuvres, Bd. X, S. 395. Anm. d. Hrsg.
5. <Anmerkung Husserls:> Immer wieder geht das natrlich eingestellte Ich in die
phnomenologische Einstellung des unbeteiligten Zuschauers und von dieser wieder in
die natrliche zurck etc.
6. Vgl. Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch von H. Diels, 10. Aufl.,
hrsg. v. W. Kranz, 3 Bde., Berlin 1961 (unv. Nachdr. d. 6. Aufl. 1951), Bd. 2, Fr. B 3
(bes. S. 281 f.). Anm. d. Hrsg.
7. Das von Husserl durch Anfhrungszeichen gekennzeichnete Selbstzitat ist nicht wrtlich.
Der Text lautet im den Hrern in englischer Sprache vorliegenden Syllabus: All ration-
ally framed questions proposed to knowledge as the work of reason are either transcen-
dental phenomenological questions or confused and absurd questions. (So in H.
Spiegelbergs Syllabusedition, a.a.O., S. 21). Im ursprnglichen, deutschen Text des Syl-
labus, der insgesamt nicht genau mit der bersetzungsvorlage bereinstimmt, lautet der
entsprechende Passus: Alle vernnftigerweise an die Erkenntnis als Vernunftleistung
zu stellenden Fragen in jeder Hinsicht, an das Erkenntnissubjekt, die Erkenntnisakte,
an deren Sinnesgehalte und an die Erkenntnisgegenstndlichkeiten sind entweder
254
transzendental-phnomenologische Fragen oder es sind wissenschaftlich unklare und
widersinnige Fragen. (M II 3b, Bl. 7a). Anm. des Hrsg.
8. Anspielung auf Kant, Prolegomena zu einer jeden knftigen Metaphysik, die als
Wissenschaft wird auftreten knnen. Kants gesammelte Schriften, hrsg. v. der (Kniglich)
Preuischen Akademie der Wissenschaften, Bd. I XXII, von der Deutschen Akademie
der Wissenschaften, Bd. XIII ff., Berlin 1910 ff., Bd. IV, S. 373 Anm. Vgl. auch Husserls
Nachwort zu meinen Ideen, Hua V, S. 162, wo allerdings nicht ba Joj (Bathos),
sondern fehlerhaft Pathos zu lesen ist. Anm. d. Hrsg.
9. Vor dem mit Drittens: begonnenen Absatz befand sich ursprnglich der Textpassus,
beginnend mit Erkenntnis und endend mit Auflsung kommen mssen., der hier
im IV. Vortrag erscheint, da Husserl ihn spter, aber wohl noch vor den Vortrgen in
London, umgestellt hat. Am Rand des betreffenden Manuskriptbl. 59b, von Husserl mit
III. <Vortrag, Bl.> 12 paginiert, befindet sich von seiner Hand m. Bleist. der Hinweis
kann auch als IV 8a stehen. Husserl hat die in der Paginierung entstandene Lcke
geschlossen, indem er ein Bl., auf dem der Inhalt der vormaligen Bl. III 10 u. 11 verkrzt
ist, mit III 1012 paginiert. Da die Krzung sicher im Rahmen der Vorarbeiten zu den
LV erfolgt ist, so mu auch das Bl. III 12 schon im Vorfeld der LV umgelegt worden sein
und nicht erst im Kontext der Einleitungsvorlesung, in welchem es, an seinem neuen
Ort fortlaufend paginiert, die Blattzahl 182 erhalten hat. Diese Zahl deutet jedoch darauf
hin, da die Bezeichnung IV 8a das erste von zwei Bl. IV 8 meint, also da es vor dem
ursprnglich einzigen Bl. IV 8 (das vergessen wurde in 8b umzupaginieren) zu liegen
kommen mu. Nur dort ergibt es auch inhaltlich einen Sinn. Anm. d. Hrsg.
10. Vgl. Spinoza, Ethica ordine geometrico demonstrata, pars I, def. III. Opera, im Auftrag
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, hrsg. v. C. Gebhardt, Heidelberg 1925,
4 Bde., Bd. 2, S. 45: Per substantiam intelligo id, quod in se est, & per se concipitur:
hoc est id, cujus conceptus non indiget conceptus alterius rei, quo formari debeat.
Anm. d. Hrsg.
11. Husserl drfte hier die Stelle (Akademieausgabe Bd. IV, S. 470) aus Kants
Metaphysischen Anfangsgrnden der Naturwissenschaft im Auge haben, wo es heit:
Ich behaupte aber, da in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche
Wissenschaft angetroffen werden knne, als darin Mathematik anzutreffen ist. - Anm.
d. Hrsg.
12. Gemeint ist das Schluwort von H. Lotze, Logik. Drei Bcher vom Denken vom
Untersuchen und vom Erkennen (System der Philosophie, I. Teil) 2. Aufl., Leipzig 1880,
S. 608, worin der Vf. der Hoffnung Ausdruck verleiht, da die deutsche Philosophie
gegen die empirische <. . .> Forschung sich zu dem Versuche immer wiedererheben
werde, den Weltlauf zu verstehen und ihn nicht blo zu berechnen. <Kursivierungen im
Original gesperrt gedruckt>. Vgl. auch Husserls Formale und transzendentale Logik,
Hua XVII, S. 19. Anm. d. Hrsg.
13. Der Passus von Erkenntnis bis Auflsung kommen mssen. ist der gem Anm. 9
umgestellte. Anm. d. Hrsg.
14. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 90 ff. Anm. d. Hrsg.
15. <Anmerkung Husserls:> So mu sich die Welt dem auf wahre Selbsterhaltung
bedachten und sein Leben unter absoluter Zielgebung ordnenden Menschen darstellen
hier sind die Probleme der Irrationalitt (des Schicksals, der Snde, des Unwerts in aller
Welt) und die des Vernunftglaubens an einen Weltsinn als eines rechtverstandenen,
trotz allem wesensnotwendigen Glaubens.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Monika Albrecht, Dirk Göttsche (Eds.) - Bachmann-Handbuch - Leben - Werk - Wirkung-J.B. Metzler (2013)Dokument336 SeitenMonika Albrecht, Dirk Göttsche (Eds.) - Bachmann-Handbuch - Leben - Werk - Wirkung-J.B. Metzler (2013)matthias_kyska415450% (2)
- Ingeborg Bachmann - Sämtliche Gedichte-Piper (2016)Dokument268 SeitenIngeborg Bachmann - Sämtliche Gedichte-Piper (2016)matthias_kyska4154100% (2)
- Russell, Bertrand - Probleme Der Philosophie (Edition Suhrkamp)Dokument156 SeitenRussell, Bertrand - Probleme Der Philosophie (Edition Suhrkamp)matthias_kyska4154100% (4)
- Adorno - Erkenntnistheorie - Geist Und MenschDokument13 SeitenAdorno - Erkenntnistheorie - Geist Und MenschAnonymous eOlHy5kK1Noch keine Bewertungen
- Schellings Philosophie Der Offenbarung. Gehalt Und Theologiegeschichtliche BedeutungDokument18 SeitenSchellings Philosophie Der Offenbarung. Gehalt Und Theologiegeschichtliche Bedeutung7 9Noch keine Bewertungen
- Ulrike Santozki AntikeTheorie&KantDokument485 SeitenUlrike Santozki AntikeTheorie&Kantpehein52zen100% (1)
- GottesbeweiseDokument115 SeitenGottesbeweisedijonNoch keine Bewertungen
- Leib Seele Book1Dokument202 SeitenLeib Seele Book1Ernest Tamagni100% (1)
- Kommentarzusammenfassung Für Nietzsche I PDFDokument1.340 SeitenKommentarzusammenfassung Für Nietzsche I PDFAlexander RitterNoch keine Bewertungen
- SCHELLING - System des transzendentalen Idealismus: Schlüsselwerk des Deutschen Idealismus: System der theoretischen Philosophie nach Grundsätzen des transzendentalen IdealismusVon EverandSCHELLING - System des transzendentalen Idealismus: Schlüsselwerk des Deutschen Idealismus: System der theoretischen Philosophie nach Grundsätzen des transzendentalen IdealismusNoch keine Bewertungen
- SartreDokument25 SeitenSartreStefan DacicNoch keine Bewertungen
- Fink Husserl in Gegenwärtiger KritikDokument65 SeitenFink Husserl in Gegenwärtiger KritikrcarturoNoch keine Bewertungen
- Psyche Ist Ausgedehnt Vortrag Akademie Der Bildenden K Nste Tagung Ich Bin Die VielenDokument20 SeitenPsyche Ist Ausgedehnt Vortrag Akademie Der Bildenden K Nste Tagung Ich Bin Die VielenatelierimkellerNoch keine Bewertungen
- Becker RealismusproblemDokument28 SeitenBecker RealismusproblemTrad AnonNoch keine Bewertungen
- Existiert Das Unbewusste AnnerlDokument14 SeitenExistiert Das Unbewusste AnnerlNicolas Caballero100% (1)
- Karl Philberth-Im Anfang Schuf Gott Himmel Und ErdeDokument9 SeitenKarl Philberth-Im Anfang Schuf Gott Himmel Und ErdeMirceaNoch keine Bewertungen
- Husserl Transzendentaler IdealismusDokument24 SeitenHusserl Transzendentaler IdealismusPhiblogsophoNoch keine Bewertungen
- Tetens (2013) - Der Naturalismus - Das Metaphysische Vorurteil Unserer ZeitDokument5 SeitenTetens (2013) - Der Naturalismus - Das Metaphysische Vorurteil Unserer Zeitexddidrl2768Noch keine Bewertungen
- Edmund Sandermann - Die Moral Der Vernunft - Kant - 1989Dokument184 SeitenEdmund Sandermann - Die Moral Der Vernunft - Kant - 1989Nicholas DieterNoch keine Bewertungen
- Selbstreferenz Als Thema Der ModerneDokument14 SeitenSelbstreferenz Als Thema Der ModerneHelli HellNoch keine Bewertungen
- Marten Fragen An PlatonDokument28 SeitenMarten Fragen An PlatonRand ErscheinungNoch keine Bewertungen
- AufklaerungDokument14 SeitenAufklaerungRITIK KUMARNoch keine Bewertungen
- Die Erkenntnistheorie Der Stoa (Ludwig Stein) PDFDokument407 SeitenDie Erkenntnistheorie Der Stoa (Ludwig Stein) PDFVitali TerletskyNoch keine Bewertungen
- Lapp WahrheitDokument96 SeitenLapp WahrheitTrad AnonNoch keine Bewertungen
- Trauer Und Trost Der MusikDokument283 SeitenTrauer Und Trost Der Musikmatthias_kyska4154Noch keine Bewertungen
- Kuhn - Das Problem Des Standpunkts Und Die Geschichtliche Erkenntnis (Kant.1930.35.1-4.496)Dokument15 SeitenKuhn - Das Problem Des Standpunkts Und Die Geschichtliche Erkenntnis (Kant.1930.35.1-4.496)kafirunNoch keine Bewertungen
- Grondin Heidegger Sein Und ZeitDokument37 SeitenGrondin Heidegger Sein Und ZeitDuque39Noch keine Bewertungen
- Evolution - Wie Enstand Das Leben Auf Der ErdeDokument14 SeitenEvolution - Wie Enstand Das Leben Auf Der ErdelenzouNoch keine Bewertungen
- Geschichte Des MaterialismusDokument17 SeitenGeschichte Des MaterialismusПрофессор Иоанн Марк БрандетNoch keine Bewertungen
- Hans Albert - Pladoyer Fur Kritischen RationalismusDokument149 SeitenHans Albert - Pladoyer Fur Kritischen RationalismusMirko Irenej VlkNoch keine Bewertungen
- Tengelyi Einführung in Die Philosophie Der Antike 01.02.16 PDFDokument96 SeitenTengelyi Einführung in Die Philosophie Der Antike 01.02.16 PDFMigellangoNoch keine Bewertungen
- Zum Problem Der Ontologischen Erfahrung - Eugen FinkDokument15 SeitenZum Problem Der Ontologischen Erfahrung - Eugen FinkGermán Olmedo DíazNoch keine Bewertungen
- Die Erkenntnistheoretischen Grundlagen Des Positivismus.: SeiendeDokument66 SeitenDie Erkenntnistheoretischen Grundlagen Des Positivismus.: SeiendeMika ReisslandtNoch keine Bewertungen
- Grundlegung Und Aufbau Der EthikDokument447 SeitenGrundlegung Und Aufbau Der Ethik小兔子乖乖Noch keine Bewertungen
- Klarstellung Oder Der Existentialismus Ist Ein HumanismusDokument4 SeitenKlarstellung Oder Der Existentialismus Ist Ein HumanismusfanzefirlNoch keine Bewertungen
- Nagarjuna Und Alfred North Whitehead Über Das Zwischen Den Dingen LiegendeDokument111 SeitenNagarjuna Und Alfred North Whitehead Über Das Zwischen Den Dingen LiegendechristianthomaskohlNoch keine Bewertungen
- Platon Epistemologie SZAIFDokument32 SeitenPlaton Epistemologie SZAIFannipNoch keine Bewertungen
- Philosophische Schriften 2 TheorieDokument329 SeitenPhilosophische Schriften 2 TheoriePancho VegaNoch keine Bewertungen
- Manfred Frank - Selbstbewusstsein Und SelbserkenntniseDokument16 SeitenManfred Frank - Selbstbewusstsein Und SelbserkenntnisecvejicNoch keine Bewertungen
- Peter Pörtner Das Wichtigste Aber Ist Die HarmonieDokument25 SeitenPeter Pörtner Das Wichtigste Aber Ist Die HarmoniepetzpoertnerNoch keine Bewertungen
- Alles Materie - oder was?: Das Verhältnis von Naturwissenschaft und ReligionVon EverandAlles Materie - oder was?: Das Verhältnis von Naturwissenschaft und ReligionNoch keine Bewertungen
- Einführungsvorlesung Kant KRV SchnellDokument93 SeitenEinführungsvorlesung Kant KRV SchnellsaironweNoch keine Bewertungen
- Figal - Gibt Es Wirklich Etwas Draußen? Skizze Einer Realistischen PhänomenologieDokument8 SeitenFigal - Gibt Es Wirklich Etwas Draußen? Skizze Einer Realistischen PhänomenologieFabian SkyNoch keine Bewertungen
- Stemmer 1988 Der Grundriß Der Platonischen Ethik. Karlfried Gründer Zum 60. GeburtstagDokument42 SeitenStemmer 1988 Der Grundriß Der Platonischen Ethik. Karlfried Gründer Zum 60. GeburtstagLijuan LinNoch keine Bewertungen
- David Lauer - Kant Lektüre-Einführung PDFDokument7 SeitenDavid Lauer - Kant Lektüre-Einführung PDFWen-Ti LiaoNoch keine Bewertungen
- Kant. Metaphysik NaturanlageDokument7 SeitenKant. Metaphysik NaturanlageThomas PawelekNoch keine Bewertungen
- Das Erhabene Und Die AvantgardeDokument4 SeitenDas Erhabene Und Die AvantgardeazraNoch keine Bewertungen
- DissertationDokument414 SeitenDissertationJuliane DuftNoch keine Bewertungen
- Kannetzky Methode Und Systematik Der PhilosophieDokument38 SeitenKannetzky Methode Und Systematik Der PhilosophieJohn O'sheaNoch keine Bewertungen
- A. Leibniz' Monadologie Und Die Universielle CharakteristikDokument15 SeitenA. Leibniz' Monadologie Und Die Universielle CharakteristikWolfgang CernochNoch keine Bewertungen
- Diss OssenkoppDokument227 SeitenDiss OssenkoppFrank WurstNoch keine Bewertungen
- Meister Eckhart Der MystikerDokument390 SeitenMeister Eckhart Der MystikerJustin Horky50% (2)
- Thesis WeitzelDokument229 SeitenThesis WeitzelQendresaNoch keine Bewertungen
- Transzendentaler Tausch Bei HöffeDokument19 SeitenTranszendentaler Tausch Bei HöffeSven GolobNoch keine Bewertungen
- Kant. Leben Und WerkDokument29 SeitenKant. Leben Und WerkAdolfo Alvarez BlancoNoch keine Bewertungen
- Ich und Welt: Zur konstitutiven Rolle der Transzendentalen Apperzeption bei Kant, Hegel und HusserlVon EverandIch und Welt: Zur konstitutiven Rolle der Transzendentalen Apperzeption bei Kant, Hegel und HusserlNoch keine Bewertungen
- Newton Und Leibniz - Absolut Oder RelationalDokument10 SeitenNewton Und Leibniz - Absolut Oder RelationalUwe KlaasNoch keine Bewertungen
- Holzkamp - 1983 - Der Mensch Als Subjekt Wissenschaftlicher MethodikDokument30 SeitenHolzkamp - 1983 - Der Mensch Als Subjekt Wissenschaftlicher Methodikdimaberglin100% (1)
- Schopenhauer - Kritik Der Kantischen Philosophie BackupDokument107 SeitenSchopenhauer - Kritik Der Kantischen Philosophie BackuphaziboNoch keine Bewertungen
- Knittermeyer, H. - Schelling Und Die RomantischeDokument483 SeitenKnittermeyer, H. - Schelling Und Die RomantischePedro F.Noch keine Bewertungen
- 【莱布尼茨研究】Leibniz' PhilosophieDokument520 Seiten【莱布尼茨研究】Leibniz' PhilosophieTu Alex100% (2)
- Experimenta-02 17 Februar DSDokument46 SeitenExperimenta-02 17 Februar DSmatthias_kyska4154Noch keine Bewertungen
- Gesamtuebersicht Russland-SanktionenDokument63 SeitenGesamtuebersicht Russland-Sanktionenmatthias_kyska4154Noch keine Bewertungen
- Husserl Und Der BuddhismusDokument18 SeitenHusserl Und Der Buddhismusmatthias_kyska4154Noch keine Bewertungen
- Zur Erhaltung Umgebindehaus PDFDokument119 SeitenZur Erhaltung Umgebindehaus PDFlaszlotekeNoch keine Bewertungen
- Eplo CL Modelo Prova Gabarito n1Dokument5 SeitenEplo CL Modelo Prova Gabarito n1felipeNoch keine Bewertungen
- Bek WahlergebnisDokument18 SeitenBek WahlergebnisSocialNoch keine Bewertungen
- EoI For Empanelment of DSP DT 09-Mar-2018Dokument49 SeitenEoI For Empanelment of DSP DT 09-Mar-2018deepak.smart4931Noch keine Bewertungen
- Ægteskabsattest PDFDokument2 SeitenÆgteskabsattest PDFElmer HiddlestonNoch keine Bewertungen