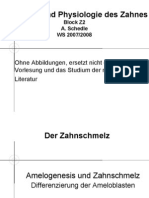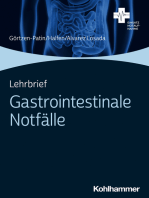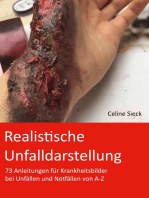Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Lernen Am PC - Auge, Retina
Lernen Am PC - Auge, Retina
Hochgeladen von
David PereyraOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Lernen Am PC - Auge, Retina
Lernen Am PC - Auge, Retina
Hochgeladen von
David PereyraCopyright:
Verfügbare Formate
Das Auge Fenster zur Welt
Im Kern des Augapfels befindet sich der Glaskrper, ein gallertartiger Krper, der als Stodmpfer und optischer Fllkrper dient. Die davon ventral liegende Linse ist bikonkav und sorgt fr die Bndelung der einfallenden Lichtstrahlen. Um diese beiden Einrichtungen zieht die vielschichtige Augenhaut, wie die Hute einer Zwiebel. Deshalb nennt man das Auge in der anatomischen Fachsprache auch Bulbus oculi, vom lateinischen Wort bulbus fr Zwiebel. Man unterteilt die Augenhaut in drei Schichten: Die uere Augenhaut besteht aus straffem kollagenem Bindegewebe. Sie ist in die weie Lederhaut, die das Auge zum Groteil einhllt, und die Hornhaut gegliedert. Letztere ist transparent, da sie geffrei ist. Die mittlere Augenhaut nennt man Uvea. Sie ist fr die Blutversorgung des Auges, die Sekretion des Kammerwassers, das fr eine gute Optik notwendig, und die Anpassung an die Lichteinstrahlung verantwortlich. In ihr trennt man deshalb drei Vorrichtungen ab: die versorgende Aderhaut, die Strukturen des Ziliarkrpers und die Iris. Der Ziliarkrper besteht aus Ziliarmuskel und Ziliarfortstzen. Der Ziliarmuskel kann durch seine Kontraktion die Linse stauchen und sorgt somit fr die Schrfeeinstellung des Auges. Die Ziliarfortstze produzieren das Kammerwasser. Die Iris ist ein Ringmuskel, der als Blendeapparat dient. Je nach Lichtintensitt kann sie sich erweitern oder verengern. Sie begrenzt das Sehloch, das von auen als dunkle Pupille wahrgenommen wird. Die innere Augenhaut besteht aus einem Pigmentepithel und der Netzhaut. Das Pigmentepithel ist dazu da strende Streuungen oder Reflektionen im Auge zu verhindern. Die Netzhaut oder Retina ist ihrerseits aus neun kompliziert verschalteten Schichten aufgebaut. Dabei sind vor allem Nervenzellen mit Photorezeptoren, Gliazellen und Gefzellen beteiligt. Man unterteilt die Retina in zwei Teile: die Pars caeca, bestehend aus den Retinaabschnitten, die die Rckseite der Iris und den Ziliarkrper bedecken, und die restliche Pars optica, die im Gegensatz zu ersterer dicht mit Photorezeptoren besetzt ist. Auch auf der Pars optica gibt es eine kleine Stelle, die frei von Photorezeptoren ist. Man bezeichnet sie als blinden Fleck. Es ist jene Stelle, an der der Sehnerv eintritt. Neben dem blinden Fleck gibt es noch den gelben Fleck. Dieser wird von der Sehgrube, der Fovea centralis, gebildet und beschreibt den Ort des schrfsten Sehens. Er liegt dem Mittelpunkt der Pupille genau gegenber. Die Netzhaut ist der eigentliche sehende Anteil des Auges. Durch Auslsen einer chemischen Kaskade in den Photorezeptoren bei Lichteintritt wird ein Signal an das Hirn weitergeleitet. Dabei unterscheidet man zwei Arten von Photorezeptoren: farbsehende Stbchen, und schwarz-wei-wahrnehmende Zapfen. Zapfen reagieren grundstzlich beim Eintreffen jedes Photons. Deshalb sehen wir auch im Dunkeln, allerdings nur in schwarz-wei. Macht man nun ein Bild der Retina mit einem Retinascanner, wie im linzer Ars Electronica Center, so sieht man nicht etwa die Anordnung von Zapfen und Stbchen, sondern vor allem das enge Netz an Kapillaren, das die Retina durchzieht. Es ist fr jeden Menschen charakteristisch. Da es nicht
vollstndig von genetischen Faktoren abhngig ist, haben nicht einmal eineiige Zwillinge dieselbe Retinalkapillarstruktur. Zur Anfertigung eines Retinascans wird ein Strahl infraroten Lichtes in das Auge geschickt. Dieser wird an der Retina reflektiert. Die Reflexionen werden von einem Transistor aufgenommen, in Computerdaten umgewandelt und zu einem Bild verarbeitet. Da die Blutgefe das Licht strker absorbieren, als das umliegende Gewebe, sind diese Stellen auf dem verarbeiteten Bild leicht zu lokalisieren. Normalerweise bleibt die Struktur der Kapillaren in der Retina von Geburt an gleich. Deshalb nutzt man den Retinascanner als Erkennungsmethode. Dabei wird ein Bild der Retina aufgenommen und gespeichert. Bei jeder Erkennung wird die Retina der Person mit dem gespeicherten Bild abgeglichen. Diese Technik wird heute nicht mehr nur von Behrden (NASA, CSI, FBI,), sondern auch fr Bankautomaten und in Gefngnissen benutzt. Fr dieselben Zwecke kann auch ein Irisscanner benutzt werden. Im Prinzip funktioniert dieser gleich, nur dass die Iris, nicht die Netzhaut, kartographiert wird. Allerdings ist der Irisscanner beeinflussbar. Durch Verwendung medizinischer Augentropfen kann die Pupille fr kurze Zeit erweitert werden, wodurch die Iris schrumpft und falsch oder auch nicht gescannt werden kann. Der Retinascan wird auch zu Diagnosezwecken verwendet. Krankheiten wie Diabetes, AIDS, Leukmie, Syphilis, aber auch Schwangerschaften knnen das Auge verndern und sind am Retinascan erkennbar. Selbiges gilt auch fr Arteriosklerose und andere Gefpathologien. Sie knnen ber die Vernderung der Retinalkapillaren erkannt werden.
Quellenverzeichnis: - Internetquellen: http://flexikon.doccheck.com/de/Auge http://flexikon.doccheck.com/de/Retina http://www.teachsam.de/psy/psy_wahrn/psy_wahrn_2_2_2.htm http://de.wikipedia.org/wiki/Netzhaut http://de.wikipedia.org/wiki/Auge#Augapfel http://en.wikipedia.org/wiki/Retinal_scan Buchquellen: Paulsen, Friedrich / Waschke, Jens (Hrsg.): Sobotta Atlas der Anatomie des Menschen. Kopf, Hals und Neuroanatomie, Mnchen: Urban & Fischer Verlag 23. Auflage 2010, S. 98 132 Golenhofen, Klaus: Physiologie Heute. Lehrbuch, Kompendium, Fragen und Antworten, Mnchen: Urban & Fischer Verlag 2000, S. 457 479 eBookquellen: Waldeyer Anatomie des Menschen: http://han.srv.meduniwien.ac.at/han/eBookKatalog/www.degruyter.com/view/books/9783110221046/9783110221046.551/978311022 1046.551.xml Springer Augenheilkunde: http://han.srv.meduniwien.ac.at/han/eBookKatalog/link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-75275-2_13 Elsevier Klinische Ophthalmologie: http://han.srv.meduniwien.ac.at/han/eBookKatalog/www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9783437234712500188
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Anatomie LösungDokument20 SeitenAnatomie LösungThao ThrishaNoch keine Bewertungen
- TU Wien-Anatomie Und Histologie VO (Felsenreich) - Anatomie Und Histologie Zusammenfassung 2017wsDokument49 SeitenTU Wien-Anatomie Und Histologie VO (Felsenreich) - Anatomie Und Histologie Zusammenfassung 2017wsMarecum LecturioNoch keine Bewertungen
- Aufbau Der NetzhautDokument6 SeitenAufbau Der NetzhautStefan Cel MareNoch keine Bewertungen
- Formularsatz Vertrag Ausbildungen Rettungsdienst Und DesinfektorDokument8 SeitenFormularsatz Vertrag Ausbildungen Rettungsdienst Und DesinfektorI like PVPNoch keine Bewertungen
- Allgemeine AugenheilkundeDokument31 SeitenAllgemeine AugenheilkundeSebastian Küpper100% (2)
- Augenaerztliche Fachausdruecke SZB 2015 04Dokument38 SeitenAugenaerztliche Fachausdruecke SZB 2015 04Andreas MaagNoch keine Bewertungen
- 3931 - Augenskript VorlesungDokument85 Seiten3931 - Augenskript VorlesungSterne01Noch keine Bewertungen
- Innere Medizin AtmungDokument16 SeitenInnere Medizin Atmungjouddd100% (1)
- Uak - Heft 6.semesterDokument94 SeitenUak - Heft 6.semesterMax MeierNoch keine Bewertungen
- Zusammenfassung GewebeDokument2 SeitenZusammenfassung GewebeMikiatlantulNoch keine Bewertungen
- Abschied für immer: Sterben, Tod und Trauer, für Kinder gefühlvoll erklärtVon EverandAbschied für immer: Sterben, Tod und Trauer, für Kinder gefühlvoll erklärtBewertung: 1 von 5 Sternen1/5 (1)
- Medizinische RepetitorienDokument112 SeitenMedizinische Repetitorienerrmalt0% (1)
- Skript - Physiologie IDokument17 SeitenSkript - Physiologie IMeltem SahinNoch keine Bewertungen
- Das Auge Und Seine AnhangsgebildeDokument41 SeitenDas Auge Und Seine AnhangsgebildeEnisa OmerovicNoch keine Bewertungen
- AugeDokument4 SeitenAugeHELLONoch keine Bewertungen
- FachbegriffeDokument11 SeitenFachbegriffedimiNoch keine Bewertungen
- Vo Schielen StifterDokument56 SeitenVo Schielen StifterCTHkn1Noch keine Bewertungen
- Makula-Degeneration, Diabetische Retinopathie: Mit Naturheilkunde erfolgreich selbst behandelnVon EverandMakula-Degeneration, Diabetische Retinopathie: Mit Naturheilkunde erfolgreich selbst behandelnNoch keine Bewertungen
- Vo Glaukom VassDokument63 SeitenVo Glaukom VassCTHkn1Noch keine Bewertungen
- GlaskörpertrübungenDokument6 SeitenGlaskörpertrübungenbuschruNoch keine Bewertungen
- Augenheilkunde Skript SS 2008Dokument40 SeitenAugenheilkunde Skript SS 2008Marek FichtlNoch keine Bewertungen
- 3540799435kataraktchirurgie PDFDokument142 Seiten3540799435kataraktchirurgie PDFNguyen Minh PhuNoch keine Bewertungen
- Katara KTDokument3 SeitenKatara KTbuschruNoch keine Bewertungen
- 100fragen Augenheilkunde WS 2004 PDFDokument23 Seiten100fragen Augenheilkunde WS 2004 PDFFrank Gonzales100% (2)
- H. Braus - Band 3Dokument840 SeitenH. Braus - Band 3mitroisergiuNoch keine Bewertungen
- Histologie Und Physiologie Der Zähne (Schedle)Dokument122 SeitenHistologie Und Physiologie Der Zähne (Schedle)sam4sbNoch keine Bewertungen
- KopfDokument65 SeitenKopfalphaprimeNoch keine Bewertungen
- Endspurt KlinikDokument2 SeitenEndspurt KlinikPavlina ZdravkovaNoch keine Bewertungen
- H. Braus - Band 2Dokument692 SeitenH. Braus - Band 2mitroisergiuNoch keine Bewertungen
- 9 StoffwechselerkrankungenDokument4 Seiten9 StoffwechselerkrankungenJulie KNoch keine Bewertungen
- VertigoooDokument29 SeitenVertigooomusyawarah melalaNoch keine Bewertungen
- Neurologische Notfälle 2023Dokument25 SeitenNeurologische Notfälle 2023vitorNoch keine Bewertungen
- Dokumentationsblatt Pupillen Vigilanz KontrolleDokument1 SeiteDokumentationsblatt Pupillen Vigilanz KontrollePeter MariottiNoch keine Bewertungen
- Encefalopatia HepaticaDokument10 SeitenEncefalopatia HepaticaMiguel Angel Muñoz CastroNoch keine Bewertungen
- Vo Neuroophthalmologie ReitnerDokument52 SeitenVo Neuroophthalmologie ReitnerCTHkn1Noch keine Bewertungen
- Fördern Durch Pflege Bei Schweren HirnschädenDokument203 SeitenFördern Durch Pflege Bei Schweren HirnschädenIsabella Ritter100% (1)
- Lernzielkatalog+Deskriptive+Anatomie Richter 2022Dokument21 SeitenLernzielkatalog+Deskriptive+Anatomie Richter 2022Schubert AlexanderNoch keine Bewertungen
- Trepel NeuroanatomieDokument36 SeitenTrepel NeuroanatomiecavingarashNoch keine Bewertungen
- 10 Plexus Cervicalis Und BrachialisDokument27 Seiten10 Plexus Cervicalis Und BrachialisVeronika Tataru0% (1)
- Respiratorische Notfälle Und Atemwegsmanagement Im KindesalterDokument22 SeitenRespiratorische Notfälle Und Atemwegsmanagement Im KindesalterGeorgios Lavasidis100% (1)
- Neonatal HirninfarktDokument84 SeitenNeonatal HirninfarktVlatka TomićNoch keine Bewertungen
- PJ OSCE ÜberarbeitetDokument41 SeitenPJ OSCE ÜberarbeitetNico HerbigNoch keine Bewertungen
- An 228 Sthesie Bei Seltenen Erkrankungen 4 Auflage PDFDokument305 SeitenAn 228 Sthesie Bei Seltenen Erkrankungen 4 Auflage PDFSimina GligaNoch keine Bewertungen
- Bosenberg SchwindelDokument20 SeitenBosenberg SchwindelJohanna Franke100% (1)
- BlutgaseDokument80 SeitenBlutgaseCornelia SescuNoch keine Bewertungen
- MIAMED - Examens-Lernplan Herbst 2014Dokument34 SeitenMIAMED - Examens-Lernplan Herbst 2014autumnsoliloquyNoch keine Bewertungen
- KP FreiburgUniKlinik 20181121 PDFDokument3 SeitenKP FreiburgUniKlinik 20181121 PDFZiatiNoch keine Bewertungen
- NeuroanatomieDokument49 SeitenNeuroanatomiePelea Teodor100% (1)
- Behandlung ventrikulärer Herz-RhythmusstörungenVon EverandBehandlung ventrikulärer Herz-RhythmusstörungenNoch keine Bewertungen
- Neuro LogieDokument25 SeitenNeuro LogieCristina LyudmilovNoch keine Bewertungen
- Neuroanatomie Tutorium IIDokument49 SeitenNeuroanatomie Tutorium IIarabicprincess22100% (1)
- Patientenaufklaerung Herzkatheter 2018Dokument3 SeitenPatientenaufklaerung Herzkatheter 2018tjaaaNoch keine Bewertungen
- Realistische Unfalldarstellung: 73 Anleitungen für Krankheitsbilder bei Unfällen und Notfällen von A-ZVon EverandRealistische Unfalldarstellung: 73 Anleitungen für Krankheitsbilder bei Unfällen und Notfällen von A-ZNoch keine Bewertungen
- RöntgenuntersuchungDokument10 SeitenRöntgenuntersuchungdotto2822Noch keine Bewertungen
- Mikrobewegungen Wismann PDFDokument4 SeitenMikrobewegungen Wismann PDFRenNoch keine Bewertungen
- MukoviszidosegN AufgabeDokument7 SeitenMukoviszidosegN AufgabeElisabeth WegardNoch keine Bewertungen
- Gynäkologie Dr. EppelDokument25 SeitenGynäkologie Dr. EppelKikiNoch keine Bewertungen
- Vo Lider Und Traenenwege KucharDokument53 SeitenVo Lider Und Traenenwege KucharCTHkn1Noch keine Bewertungen
- Allgemeine KnochenlehreDokument17 SeitenAllgemeine KnochenlehreZina MagomaevaNoch keine Bewertungen
- Äußeres - Übungen Zum Wortschatz - 1Dokument3 SeitenÄußeres - Übungen Zum Wortschatz - 1ЕкатнринаNoch keine Bewertungen
- Für Die FSP PDFDokument5 SeitenFür Die FSP PDFAnastsiaNoch keine Bewertungen
- Gallenblase Handout AufbaukursDokument94 SeitenGallenblase Handout AufbaukursIvanaBegicNoch keine Bewertungen