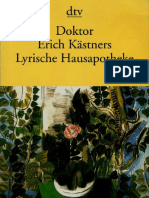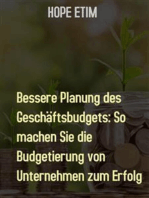Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Segmentberichterstattung Nach HGB Und IFRS
Segmentberichterstattung Nach HGB Und IFRS
Hochgeladen von
Adi AlibabicCopyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Segmentberichterstattung Nach HGB Und IFRS
Segmentberichterstattung Nach HGB Und IFRS
Hochgeladen von
Adi AlibabicCopyright:
Verfügbare Formate
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
1 Zielsetzung und Nutzen der Segmentberichterstattung (HI1849442)
Rz. 1
Allgemeine Zielsetzung der Segmentberichterstattung ist die Gewährung von entscheidungsrelevanten
Informationen über Teilbereiche (Segmente) des berichtenden Unternehmens bzw. Konzerns. Gerade
in diversifizierten Unternehmen, vor allem aber Konzernen, spiegeln die Daten von Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung ausschließlich
aggregierte Informationen über die gesamten Unternehmens- bzw. Konzernaktivitäten wider. Damit
können insbesondere gegenläufige operative Entwicklungen in den Segmenten ver- bzw. überdeckt
werden. Somit ist Zielsetzung der Segmentberichterstattung die Bereitstellung disaggregierter
Segmentinformationen, die gerade bei diversifizierten global agierenden Unternehmen im Rahmen
der Aggregation der gesamten unternehmerischen Aktivitäten in Gestalt von Konzernbilanz und
Konzern-GuV (bzw. Unternehmensbilanz und unternehmensbezogener GuV) verloren gegangen sind.
[1]
Rz. 2
Die Bereitstellung von disaggregierten Informationen soll dem Abschlussadressaten insbesondere
helfen, die Ertragskraft des Konzerns bzw. Unternehmens besser zu verstehen, die unterschiedlichen
Risiken und Chancen des Konzerns bzw. Unternehmens besser einzuschätzen und damit die
berichtende Einheit als Ganzes hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Generierung künftiger Erträge und
Cashflows fundierter beurteilen zu können.[2] Die in der Segmentberichterstattung präsentierten
Informationen lassen sich zumeist mittels der traditionellen Abschlussanalyse entlehnten
Kennzahlen auswerten.[3]
Darüber hinaus können jedoch die Segmentkennzahlen auch Hinweise auf die Entwicklung von
Segmenten geben. Sofern diese – möglicherweise unter Verwendung zusätzlicher ergänzender
qualitativer Informationen und zukunftsgerichteter Informationen (z. B. weiterführende Angaben zu
künftigen Investitionsschwerpunkten in operativer und regionaler Hinsicht) – durch den
Abschlussanalysten in die Zukunft prognostiziert werden, lässt sich auch auf Basis der
Segmentberichterstattung eine wertorientierte Unternehmensberichterstattung (value reporting)
aufbauen.[4]
Rz. 3
Im Unternehmensvergleich dient die Offenlegung von segmentierten Unternehmens- bzw.
Konzerninformationen dazu, die Position der berichtenden Einheit mit Konkurrenten, die ähnliche
Segmente besitzen, zu bestimmen.[5] Damit kann die Segmentberichterstattung ein wichtiges
Element einer Wettbewerbsanalyse bilden.
Rz. 4
Darüber hinaus gewährt eine Segmentberichterstattung regelmäßig Informationen über die Planungs-
und Entscheidungsstruktur eines Unternehmens bzw. Konzerns.[6] Der Segmentbericht stellt dem
Abschlussadressaten aggregierte Informationen über die Entwicklung der berichtenden Einheit in den
Teilbereichen des Unternehmens bzw. Konzerns zur Verfügung. Der Abschlussadressat wird somit in
Haufe Finance Office Professional Online Seite 1
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
die Position eines "Entscheidungsträgers" gerückt. Auf Basis der präsentierten Ist-Informationen
kann er die aus seiner Sicht zutreffenden strategischen und operativen Schlussfolgerungen ableiten
und sie mit der Strategie des Managements, die beispielsweise in der management´s analysis (bzw.
Lagebericht), im Anhang oder gegebenenfalls als freiwillige Information in der
Segmentberichterstattung veröffentlicht wird, abgleichen.
Rz. 5
Zuletzt dient die Bereitstellung von Segmentinformationen auch der Rechenschaftslegung und der
Kontrolle von diversifizierten Unternehmen. Diese Funktion kann die Segmentberichterstattung
immer dann wahrnehmen, wenn bzw. soweit die in der Segmentberichterstattung dargestellten
Segmente mit Verantwortungsbereichen der berichtenden Einheit übereinstimmen. Insbesondere
kann die Segmentberichterstattung in diesem Falle die Aufgabe der Performance-Messung des
Managements der einzelnen Geschäftsbereiche übernehmen.[7] Weiterhin ist für die Wahrnehmung
dieser Funktion stets Voraussetzung, dass die Segmente über die Zeit vergleichbar sind und Aussagen,
insbesondere Prognoseaussagen, welche in den Vorjahresabschlüssen enthalten waren, sich an den
eingetretenen Resultaten der aktuellen Periode messen lassen.
Rz. 6
Allerdings stehen den Nutzenkomponenten der Segmentberichterstattung auch folgende Nachteile
gegenüber, die regelmäßig als Probleme der Offenlegung von Segmentinformationen in der Literatur
genannt werden:[8]
drohende Nachteile wegen der Gewährung eines tief gehenden Einblicks in
Unternehmensinformationen gegenüber Konkurrenten,
Abstimmungsbedarf bzw. Erklärungsbedarf zu den in Bilanz und GuV veröffentlichten
Informationen,
Entstehung zusätzlicher Kosten für Erstellung und Prüfung der Segmentinformationen,
Gefahr eines information overload der externen Abschlussadressaten,
möglicherweise nur eingeschränkte Aussagekraft bei Verwendung unternehmens- bzw.
konzerninterner Verrechnungspreise.
2 Methodische Grundlagen der Segmentberichterstattung (HI1849443)
2.1 Dimensionen der Segmentierung (HI1849444)
2.1.1 Eindimensionale Segmentierung vs. mehrdimensionale
Segmentierung (HI1849445)
Rz. 7
Hinsichtlich der Dimensionen der Segmentierungen kann man zunächst zwischen ein- und
mehrdimensionaler Segmentierung unterscheiden. Eine eindimensionale Segmentierung liegt vor,
wenn sämtliche Unternehmens- bzw. Konzernaktivitäten anhand eines einzigen
Segmentierungskriteriums in Segmente untergliedert werden (z. B. Art der Produkte und
Dienstleistungen).
Von einer mehrdimensionalen Segmentierung spricht man, wenn durch Anwendung
unterschiedlicher Segmentierungskriterien (z. B. Art der Produkte und Dienstleistungen einerseits
und geographische Regionen andererseits) die gesamten Geschäftsaktivitäten des Unternehmens bzw.
Haufe Finance Office Professional Online Seite 2
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Konzerns in verschiedene parallele Segmentierungen zerlegt werden. Beispielsweise unterschied der
frühere und durch IFRS 8 aufgehobene IAS 14 zwischen primären und sekundären Segmenten. Gemäß
dem in diesem Standard verfolgten risks and rewards approach waren primäre Segmente solche, aus
denen die dominierenden Chancen und Risiken für den Geschäftsverlauf resultierten (häufig
Geschäftsfelder). Das sekundäre Berichterstattungsformat stellte die nach dem primären
Berichterstattungsformat folgende bedeutendste Einteilungsform für die Chancen und Risiken des
künftigen Geschäftsverlaufs dar (zumeist Regionen).
2.1.2 Einstufige Segmentierung vs. mehrstufige Segmentierung (HI1849446)
Rz. 8
Nach der Anzahl der Hierarchieebenen, welche für ein Segment in den Segmentinformationen
abgebildet werden, lässt sich zwischen ein- und mehrstufiger Segmentierung unterscheiden.
Im Regelfall werden nur Daten, welche auf einer, nämlich der höchsten, Hierarchieebene stehen, dem
Abschlussadressaten offengelegt.
Sofern die auf der obersten Hierarchieebene, auf der Segmente gebildet werden, erhobenen
Segmentdaten nach weiteren Segmentierungskriterien auf tiefer liegende Hierarchieebenen aufgeteilt
werden, spricht man von mehrstufiger Segmentierung.
Rz. 9
Praxis-Beispiel
Mehrstufige Segmentierung
Die Berichtsgrößen werden auf der obersten Hierarchieebene nach Geschäftsbereichen
differenziert. Möglich wäre es, im Rahmen einer mehrstufigen Segmentierung die jeweiligen
Berichtsgrößen der einzelnen Segmente auf weitere Ebenen nach geographischen Regionen,
Produktgruppen oder Kundengruppen feiner aufzuteilen.
Rz. 10
Sämtliche aktuell in Kraft befindlichen Rechnungslegungsstandards zur Segmentberichterstattung
basieren auf einer einstufigen Segmentierung. Eine mehrstufige Segmentierung wird allenfalls von
einzelnen Unternehmen freiwillig vorgenommen.[1] Insbesondere kann sich jedoch eine mehrstufige
Segmentberichterstattung (im Regelfall dürfte eine zweistufige Segmentberichterstattung ausreichend
sein) empfehlen, falls die auf der obersten Konzern- oder Unternehmensebene gebildeten Segmente
eine sehr unterschiedliche Größe aufweisen, sodass insbesondere im Falle sehr umsatzstarker und
/oder vermögensintensiver Segmente sich eine Untergliederung in die auf der nächsten Konzern- oder
Unternehmenshierarchieebene gebildeten Segmente anbietet.
2.2 Ableitung der berichtspflichtigen Segmente: management approach vs.
risks and rewards approach (HI1849447)
Rz. 11
Haufe Finance Office Professional Online Seite 3
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Hinsichtlich der Methoden der Segmentabgrenzung können zwei alternative Methoden unterschieden
werden: der management approach und der risks and rewards approach. Gemäß dem Management
Approach knüpft die Segmentberichterstattung im externen Abschluss unmittelbar an der internen
Finanzberichterstattung an. Dies betrifft sowohl
die Segmentdefinition und Segmentabgrenzung als auch
die Segmentberichtsgrößen (z. B. Segmentergebnis) und deren
Rechnungslegungsnormen (z. B. Ermittlung nach den internen
Finanzberichterstattungsgrundsätzen, die insbesondere auch von den extern
verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden abweichen können) sowie
deren
Zusammensetzung (z. B. Abgrenzung der Komponenten des Segmentergebnisses,
beispielsweise Einbeziehung des Beteiligungs- und/oder Zinsergebnisses).[1]
Der Management Approach basiert auf der Annahme, dass es der Unternehmensleitung gelingt,
sämtliche Vermögenswerte und Schulden, Aufwendungen und Erträge des Unternehmens bzw.
Konzerns auf die einzelnen Segmente entweder verursachungsgerecht oder mittels sachlicher
Schlüssel zu verteilen. Voraussetzung für die Anwendung des Management Approachs bildet daher ein
funktionierendes internes Finanzberichtswesen, aus dem sämtliche extern berichtspflichtige
Segmentinformationen übernommen werden können.[2] Aufgrund des unmittelbaren Bezugs zum
internen Planungs-, Kontroll- und Steuerungssystem soll dem externen Berichtsadressaten ein
operativer Einblick in das Unternehmen bzw. den Konzern quasi aus der Perspektive des Top-
Managements gegeben werden.[3]
Rz. 12
Nach dem risks and rewards approach werden die Segmente nach homogenen Chancen- und
Risikenverhältnissen gegeneinander abgegrenzt. Demnach sind die Segmente so abzugrenzen, dass
sich die Chancen- und Risikenstrukturen innerhalb der Segmente möglichst homogen und die
Chancen- und Risikenstrukturen zwischen den Segmenten möglichst heterogen verhalten.[4]
Eine Homogenität von Chancen- und Risikopotenzialen der in einem Segment
zusammengeschlossenen Geschäftsaktivitäten besitzt den Vorteil, dass eine verlässlichere Prognose
der künftigen Geschäftsentwicklung möglich ist.[5] Zudem werden durch diesen Ansatz die Segmente
so abgegrenzt, dass ein Vergleich von Segmenten mit Geschäftsaktivitäten anderer Unternehmen
leichter möglich ist.[6] Daher wird dieser Ansatz auch als "Industriesparten-Konzept" oder "industry
approach" bezeichnet.[7]
Um eine inhaltliche Vergleichbarkeit mit ähnlichen Segmenten anderer Unternehmen bzw. Konzerne
zu ermöglichen, sollten die Segmentberichtsgrößen vergleichbar sein. Dies schließt im Regelfall
sowohl die Vorgabe von Rechnungslegungsnormen (beispielsweise verbindliches Vorschreiben von
Segmentbilanzierungs- und Segmentbewertungsmethoden in Übereinstimmung mit den für die
Bilanzierung und Bewertung in Bilanz und GuV angewendeten Rechnungslegungsmethoden) als auch
die exakte Abgrenzung von berichtspflichtigen Posten (beispielsweise präzise Definition von
Segmenterlösen und Segmentaufwendungen) ein.
Rz. 13
Vorteile der grundsätzlichen Ausrichtung der Segmentberichterstattung nach dem management
approach gegenüber einer Ausrichtung am risks and rewards approach sind:[8]
Haufe Finance Office Professional Online Seite 4
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Vermeidung zusätzlicher Kosten durch Umgliederung von Daten der internen
Finanzberichterstattung,
Datenharmonisierung von Informationen der internen und externen Berichterstattung,
höhere Vertrautheit des Managements mit den extern offengelegten Daten,
höhere Entscheidungsrelevanz der Daten und
bessere Nachprüfbarkeit der Daten (bzw. höhere Objektivität).
Diesen Vorteilen stehen folgende Nachteile des management approachs gegenüber:
mangelnde zwischenbetriebliche Vergleichbarkeit der Segmentdaten (sowohl hinsichtlich
der Segmentabgrenzung als auch hinsichtlich des materiellen Inhalts der
Segmentinformationen)[9],
geringere Stetigkeit der Segmentinformationen sowohl hinsichtlich der Segmentbildung als
auch hinsichtlich der inhaltlichen Abgrenzung der Segmentinformationen[10],
möglicherweise geringere Prognosetauglichkeit der Segmentdaten,
Gefahr der Ausrichtung interner Berichtsstrukturen am gewünschten externen Bild.[11]
Beispielsweise könnte die Unternehmensleitung beschließen, ihre wachstumsträchtigen
Aktivitäten als "neue Geschäftsfelder" bewusst zusammenzufassen, weil sich diese
hinsichtlich Chancen und Risiken signifikant von den bereits in einem Reife- oder
Sättigungsstadium befindlichen Geschäftsfeldern unterscheiden. Innerhalb dieses – aus
Sicht der Unternehmensleitung strategisch zukunftsträchtigen – Segments "neue
Geschäftsfelder" kann die Unternehmensleitung dem Abschlussleser gezielt
Wachstumsraten bei Umsatz, Investitionen und möglicherweise Ergebnis demonstrieren.[12]
Die Vorteile und Nachteile des Risks and Rewards Approachs entsprechen spiegelbildlich den
Nachteilen und Vorteilen des Management Approachs.
Rz. 14
Management Approach und Risks and Rewards Approach stellen idealtypische Konzepte der
Ausgestaltung der Segmentberichterstattung dar, sodass die in den einzelnen
Rechnungslegungsnormen erfolgende Ausgestaltung mehr oder weniger einem bestimmten Ansatz
zuneigen. So basiert die Segmentberichterstattung sowohl nach IFRS 8 als auch nach SFAS 131 in sehr
starkem Ausmaß auf dem Management Approach[13], wenngleich der Management Approach nicht
konsequent bei allen Fragestellungen umgesetzt wurde. DRS 3 enthält im Vergleich zu den genannten
IFRS 8 und FAS 131 deutlich mehr Elemente des Risks and Rewards Approachs, wenngleich auch DRS 3
grundsätzlich dem Management Approach folgt.
Rz. 15
Dagegen stellte der aufgehobene IAS 14 eine Mischform zwischen management approach und risks and
rewards approach dar ("Management Approach with a Risks and Rewards Safety Net"[14]). Innerhalb der
Segmente sollte zwar das Chancen-Risiken-Profil der zusammengefassten Aktivitäten möglichst
homogen sein und sich demgegenüber das Chancen-Risiken-Profil zwischen den einzelnen
Segmenten signifikant unterscheiden (Prinzip der Homogenität der Chancen und Risiken innerhalb
eines Segments und der Heterogenität der Chancen und Risiken zwischen den Segmenten). Allerdings
bedeutete dieser risks and rewards approach des IAS 14 in der Regel jedoch nicht, dass ein Konzern oder
Unternehmen zur Erfüllung dieser Anforderung eine neue Gliederung der Segmente vorzunehmen
hatte, da von den nach der internen Organisations- und Führungsstruktur abgegrenzten Segmenten
vermutet wurde, dass diese dem Risks and Rewards Approach entsprachen.[15]
2.3 Möglichkeiten der Wertansatzermittlung (HI1849448)
Haufe Finance Office Professional Online Seite 5
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Rz. 16
Hinsichtlich des konzeptionellen Vorgehens bei der Datenermittlung auf Segmentebene können drei
Dimensionen unterschieden werden:
Bezugsobjekt für die Datenermittlung auf Segmentebene
Hierarchieebene für die Datenermittlung der Segmente
Bilanzierungs- und Bewertungsmaßstäbe für die Segmentdaten
2.3.1 Autonomieansatz vs. Disaggregationsansatz (HI1849449)
Rz. 17
Nach dem gewählten Bezugsobjekt für die Datenermittlung auf Segmentebene kann man den
autonomous entity approach (Autonomieansatz) und den disaggregation approach
(Disaggregationsansatz) unterscheiden.
Dem Autonomieansatz liegt die Fiktion wirtschaftlicher Selbstständigkeit der einzelnen Segmente
zugrunde. Dies bedeutet, dass im Falle des Vorliegens von Verbundbeziehungen zwischen Segmenten
nicht die auf Ebene des Gesamtunternehmens bzw. Konzerns angefallenen Werte – mit welcher
Zurechnungskonvention auch immer – auf die Segmente verteilt werden; stattdessen sind den
Segmenten diejenigen Werte zuzurechnen, die entstünden, falls das Segment wirtschaftlich von den
anderen Segmenten unabhängig wäre. Dies führt regelmäßig zur Zurechnung von mehr oder weniger
hypothetischen Werten auf die Segmente; vorteilhaft ist jedoch an diesem Ansatz, dass grundsätzlich
eine bessere externe Vergleichbarkeit der Segmentdaten ermöglicht wird.[1] Weiterhin werden
tatsächlich bei der berichtenden Einheit vorliegende Synergiepotenziale nicht berücksichtigt, sondern
bewusst eliminiert.[2]
Rz. 18
Dagegen teilt der Disaggregationsansatz die Gesamtunternehmenswerte bzw. die konsolidierten
Wertansätze des Konzernabschlusses auf die Segmente auf. Falls eine verursachungsgerechte
Zurechnung auf die Segmente nicht möglich ist, werden die nicht direkt zurechenbaren Werte mittels
eines vernünftigen und nachvollziehbaren Schlüssels aufgeteilt.[3] Allerdings können auch einzelne
nicht mittels einer vernünftigen Schlüsselgröße aufteilbare Konzern- bzw. Unternehmenswerte in
einer separaten Gruppe (nicht auf die Segmente verteilte Werte) zusammengefasst und entsprechend
ausgewiesen werden.[4]
Rz. 19
Praxis-Beispiel
Ein Unternehmen umfasst mehrere Segmente. Das Unternehmen hat ein
Hauptverwaltungsgebäude, das zentrale Funktionen für alle Segmente erfüllt.
Nach dem Autonomieansatz sind die Aufwendungen (und entsprechend das Vermögen) auf die
Segmente zuzurechnen, welche für die Erfüllung der Zentralverwaltungsaufgaben erforderlich
Haufe Finance Office Professional Online Seite 6
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
gewesen wären, falls die Segmente voneinander völlig unabhängig operieren würden. Dies schließt
auch eine mehrfache Zurechnung des Verwaltungsgebäudes und der mit ihm verbundenen
Aufwendungen nicht aus.[5]
Nach dem Disaggregationsansatz sind zwei Lösungsmöglichkeiten vorstellbar: Entweder werden
anteilige Aufwendungen und Vermögenswerte auf die Segmente mit einem bestimmten Schlüssel
zugerechnet oder die Aufwendungen bzw. Vermögenswerte werden als
Gesamtunternehmensaufwendungen bzw. Gesamtunternehmensvermögen gesondert mit anderen
ebenfalls zentral anfallenden Aufwendungen und zentral verwalteten Vermögenswerten ausgewiesen
(z. B. Ausweis unter "Zentralaufwendungen" bzw. "Unternehmens- bzw. Konzernvermögen" oder
unter "Sonstiges").
Rz. 20
Sämtliche gegenwärtig aktuellen Rechnungslegungsstandards basieren auf dem
Disaggregationsansatz. Dies ist sicherlich dadurch erklärlich, dass die im Anhang veröffentlichten
Segmentdaten auch der Prüfungspflicht unterliegen und hypothetische Werte des Autonomieansatzes
selten objektivierbar sind.
2.3.2 top-down approach vs. bottom-up approach (HI1849450)
Rz. 21
Hinsichtlich der Hierarchieebene, von der aus die Segmentdaten abgeleitet werden, kann man den
Top-down Approach und den Bottom-up Approach unterscheiden.[1]
Beim Top-down Approach werden die auf Konzernebene bzw. Unternehmensebene ermittelten Werte
auf die Segmente heruntergebrochen. Dies bedeutet, dass sich hinsichtlich der Ableitung der
Segmentergebnisse durch die Umkehrung der Zwischengewinnkonsolidierung zwischen den
Segmenten eine Erhöhung der Segmentergebnisse um die im Konzernergebnis nicht enthaltenen
intersegmentären Beträge ergibt.[2] (Invers hierzu werden bei Erstellung der Konzernbilanz
eliminierte Zwischenverluste aufgehoben, sodass in diesem Fall die Summe der unkonsolidierten
Segmentergebnisse geringer ist als das entsprechende konsolidierte Ergebnis.)
Rz. 22
Demgegenüber erhebt der bottom-up approach die Daten auf Ebene der Segmente oder Teilsegmente.
Im Rahmen von segmentspezifischen Konsolidierungen werden die Daten anschließend "nach oben"
zu den extern offengelegten Segmenten verdichtet.[3] Die Technik entspricht der auch bei Erstellung
des Konzernabschlusses angewandten üblichen Konsolidierung, jedoch mit der Besonderheit, dass nur
intrasegmentäre Beziehungen eliminiert und intersegmentäre Beziehungen wie Beziehungen
gegenüber Dritten behandelt werden.
Rz. 23
Obwohl der Aufwand der beiden Verfahren grundsätzlich vergleichbar ist, da die Schritte der
Konsolidierung (von unten nach oben) theoretisch den Schritten der umgekehrten Konsolidierung
(von oben nach unten) entsprechen müssten,[4] lässt sich in der Praxis dennoch eher eine Tendenz
zum bottom-up approach feststellen; dieser wird vor allem damit begründet, dass zum einen die
Haufe Finance Office Professional Online Seite 7
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Segmentdaten zeitgleich mit den Daten des Konzernabschlusses vorliegen sollten und zum anderen
die Mitarbeiter im Konzernrechnungswesen eher mit der Konsolidierungstechnik als mit der
Segmentierungstechnik vertraut sind.[5]
2.3.3 Extern ableitbare Segmentwertansätze vs. intern berichtete
Segmentwertansätze (HI1849451)
Rz. 24
Hinsichtlich der in der Segmentberichterstattung herangezogenen Wertansätze können extern
ableitbare Segmentwertansätze und solche Wertansätze unterschieden werden, die sich aus der
internen Finanzberichterstattung ergeben.
Rz. 25
Extern ableitbare Segmentwertansätze haben den Vorteil, dass die für Segmente berichteten Daten
konsistent mit den Wertansätzen des Konzernabschlusses sind. Damit erübrigt sich eine gesonderte
Erläuterung der speziell in der Segmentberichterstattung verwendeten Bewertungsmaßstäbe. Im
Unternehmensvergleich hat die Nutzung externer Segmentwertansätze darüber hinaus den Vorteil,
dass die ein bestimmtes Rechnungslegungssystem anwendenden Unternehmen nicht nur
grundsätzlich vergleichbar hinsichtlich der Konzernzahlen, sondern in prinzipiell gleichem Umfang
auch vergleichbar hinsichtlich der Segmentzahlen sind.
Auch wenn nicht zwingend notwendig, geht die Entscheidung für den risks and rewards approach[1]
zumeist mit der Verwendung extern ableitbarer Segmentwertansätze einher.[2]
Rz. 26
Falls das eine Segmentberichterstattung erstellende Unternehmen bzw. der Konzern Wertansätze
ohne Bindung an die in Konzernbilanz und Konzern-GuV verwendeten Rechnungslegungsgrundsätze
anwendet, handelt es sich um intern verwendete Segmentwertansätze. Im Regelfall dürfte es sich bei
diesen Wertansätzen um die in der internen Finanzberichterstattung angewendeten Wertansätze
handeln. Die Verwendung von aus der internen Finanzberichterstattung stammenden Wertansätzen
hat den Nachteil, dass die Vergleichbarkeit mit ähnlichen Segmenten anderer Konzerne und
Unternehmen regelmäßig nicht gegeben ist.
Intern verwendete Segmentwertansätze werden stets bei konsequenter Umsetzung des management
approachs gewählt.[3] Der Vorteil besteht – wie oben aufgeführt – in der konsequenten
Berichterstattung sowohl an unternehmensinterne Entscheidungsträger als auch an externe
Abschlussadressaten auf Grundlage derselben Datenbasis.
3 Normen zur Segmentberichterstattung in Deutschland (HI1849452)
3.1 Jahresabschluss und Einzelabschluss (HI1849453)
Rz. 27
§ 285 Nr. 4 HGB verlangt im Anhang zum Jahresabschluss Angaben über die Aufgliederung der
Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen sowie nach geographisch bestimmten Märkten, soweit sich,
unter Berücksichtigung der Organisation des Verkaufs, der Vermietung oder Verpachtung von
Haufe Finance Office Professional Online Seite 8
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Produkten und der Erbringung von Dienstleistungen der Kapitalgesellschaft die Tätigkeitsbereiche
und geografisch bestimmten Märkte untereinander erheblich unterscheiden.Zweck dieser
Offenlegungspflicht ist die Vermittlung eines tieferen Einblicks in die Ertragslage der Gesellschaft,
damit Hinweise auf mögliche Ergebnisrisiken, die sich aus der Umsatzstruktur ergeben, geliefert
werden können.[1]
Rz. 28
Die Angabepflicht betrifft nur große Kapitalgesellschaften; kleine und mittelgroße
Kapitalgesellschaften sind gemäß § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB und § 288 Abs. 2 Satz 1 HGB davon befreit.
Rz. 29
Für die Offenlegung des Einzelabschlusses gewährt der Gesetzgeber in § 325 Abs. 2a HGB das
Wahlrecht, entweder den Jahresabschluss nach HGB oder den nach internationalen
Bilanzierungsvorschriften erstellten Jahresabschluss (Einzelabschluss) offenzulegen. Unberührt von
der Möglichkeit, einen Jahresabschluss nach IFRS offenzulegen, ist jedoch das Aufstellungsgebot des
HGB-Jahresabschlusses nach §§ 264 ff. HGB.[2]
Sofern ein nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften erstellter Jahresabschluss anstelle
eines HGB-Jahresabschlusses offengelegt werden soll, sind für den Anhang zudem die Vorschriften
des § 285 Nr. 7, 8b), 9–11a, 14–17 HGB, § 286 Abs. 1, 3, 5 und ggfs. § 264 Abs. 1a HGB zu beachten. [3]
Dies bedeutet, dass ein deutsches Unternehmen für die Offenlegung des Einzelabschlusses
entscheiden kann, ob es der Offenlegungspflicht des § 285 Nr. 4 HGB nachkommt oder alternativ die
Vorschriften zur Segmentberichterstattung nach IFRS beachtet. IFRS 8 ist jedoch gemäß IFRS 8.2
verpflichtend nur von denjenigen Unternehmen anzuwenden, deren Wertpapiere öffentlich gehandelt
werden oder die eine Inanspruchnahme des Kapitalmarktes ernsthaft in die Wege geleitet haben. [4]
Mit anderen Worten: Sofern große Kapitalgesellschaften entweder keine Wertpapiere ausgegeben
(z. B. GmbH) oder nur Wertpapiere im Wege der Privatplatzierung ausgegeben haben (und auch
keinen öffentlichen Handel mit Wertpapieren ernsthaft in die Wege geleitet haben), kann bei
freiwilliger Offenlegung eines IFRS-Abschlusses die Segmentberichterstattung unterbleiben, da in
diesem Fall kein Anwendungszwang für IFRS 8 besteht.
Rz. 30
Falls eine freiwillige Offenlegung des IFRS-Einzelabschlusses mit befreiender Wirkung für die
Offenlegung des HGB-Jahresabschluss erfolgt, sind, sofern das Unternehmen dem
Anwendungsbereich des IFRS 8 unterliegt, auch die Segmentinformationen für den Einzelabschluss in
diesen offenzulegenden Einzelabschluss einzubeziehen.
Rz. 30a
Im Zuge der Novellierung des Handelsrechts durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurde der
Umfang des Jahresabschlusses kapitalmarktorientierter Kapitalgesellschaften, die nicht zur
Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet sind, erweitert. Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 2 HGB ist
der bei Kapitalgesellschaften aus Bilanz, GuV-Rechnung und Anhang bestehende Jahresabschluss
zumindest um eine Kapitalflussrechnung und einen Eigenkapitalspiegel zu erweitern. Eine
Erweiterung des Jahresabschlusses dieser kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften um eine
Segmentberichterstattung ist freiwillig.
Haufe Finance Office Professional Online Seite 9
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Rz. 30b
Der Gesetzgeber bezweckte mit der Ergänzung des § 264 Abs. 1 HGB um § 264 Abs. 1 Satz 2 HGB eine
vollständige Gleichstellung aller kapitalmarktorientierten Unternehmen – unabhängig von ihrer
rechtlichen Struktur – hinsichtlich ihrer handelsrechtlichen Berichterstattungspflichten zu erreichen.
[5] Allerdings ist diese Gleichstellung nicht vollständig erreicht worden, da alle
kapitalmarktorientierten Mutterunternehmen gemäß § 315a HGB verpflichtet sind ihren
Konzernabschluss nach Maßgabe der IFRS aufzustellen. Der vollständige IFRS-Abschluss besteht gem.
IAS 1.10 aus Bilanz, GuV-Rechnung und sonstiges Gesamtergebnis (bzw. Gesamtergebnisrechnung),
Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang sowie bei
Kapitalmarktorientierung nach IFRS 8.2 zusätzlich noch aus der Segmentberichterstattung. Die für
kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften, die nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses
verpflichtet sind, vorgeschriebenen Abschlussbestandteile entsprechen vielmehr denjenigen, die § 297
Abs. 1 HGB für den Konzernabschluss nicht kapitalmarktorientierter Mutterunternehmen vorschreibt.
Eine zu § 264 Abs. 1 Satz 2 HGB analoge Erweiterungspflicht für den Jahresabschluss findet sich in § 5
Abs. 2a PublG auch für publizitätspflichtige Unternehmen, die kapitalmarktorientiert i. S. d. § 264
Abs. 1 Satz 2 HGB sind.
3.2 Konzernabschluss (HI1849454)
3.2.1 Konzernabschluss nach HGB (HI1849455)
Rz. 31
Nach § 315a Abs. 1, 2 HGB besteht eine Konzernrechnungslegungspflicht für kapitalmarktorientierte
Unternehmen (d. h. Inanspruchnahme eines organisierten Marktes i. S. d. § 2 Abs. 5 WpHG durch das
zur Konzernrechnungslegung verpflichtete Mutterunternehmen[1]) oder solche Unternehmen, die bis
zum Abschlussstichtag die Zulassung eines Wertpapiers zum Handel an einem organisierten
Kapitalmarkt beantragt haben, nach IFRS. Diese unterliegen daher nicht der Anwendungspflicht der
Regeln für den HGB-Abschluss. Weiterhin können nach § 315a Abs. 3 HGB auch alle übrigen
Unternehmen wahlweise einen IFRS-Konzernabschluss aufstellen.
Für diejenigen Mutterunternehmen, die der Konzernabschlusspflicht nach §§ 290 ff. HGB
unterliegen und welche weder verpflichtend die IFRS-Rechnungslegung anzuwenden haben noch die
IFRS-Rechnungslegung freiwillig anwenden, ist ein Konzernabschluss nach Maßgabe des § 297
Abs. 1 HGB zu erstellen. Der handelsrechtliche Konzernabschluss besteht aus Konzernbilanz, Konzern-
GuV, Konzernanhang, (Konzern-)Kapitalflussrechnung und (Konzern-)Eigenkapitalspiegel.
Der Konzernabschluss kann nach § 297 Abs. 1 Satz 2 HGB um eine Segmentberichterstattung
erweitert werden. Dementsprechend ist die Aufstellung der Segmentberichterstattung für die einen
HGB-Konzernabschluss aufstellenden Unternehmen freiwillig.
Rz. 32
Das deutsche Handelsrecht hält keine spezifischen Normen zur Ausgestaltung der
Segmentberichterstattung bereit. Diese Aufgabe fiel dem DRSC zu, das mit dem Deutschen
Rechnungslegungsstandard DRS 3 für die Ausfüllung dieses Begriffs gesorgt hat.[2] Hinsichtlich der
vom DRSC verabschiedeten und anschließend vom BMJ bzw. nunmehr BMJV veröffentlichten DRS wird
vermutet, dass diesen der Charakter von Grundsätzen ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung
zukommt.[3]
Haufe Finance Office Professional Online Seite 10
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Rz. 33
Sofern die einen HGB-Konzernabschluss aufstellenden Unternehmen nicht freiwillig eine
Segmentberichterstattung nach § 297 Abs. 1 Satz 2 HGB aufstellen, trifft diese Unternehmen die
Verpflichtung nach § 314 Abs. 1 Nr. 3 HGB, eine Aufgliederung der Umsatzerlöse des Konzerns nach
Tätigkeitsbereichen sowie nach geographisch bestimmten Märkten vorzunehmen, soweit sich unter
Berücksichtigung der Organisation des Verkaufs, der Vermietung oder Verpachtung von Produkten
und der Erbringung von Dienstleistungen des Konzerns die Tätigkeitsbereiche und geographisch
bestimmten Märkte erheblich unterscheiden.[4] Falls eine freiwillige Segmentberichterstattung
erfolgt, so ist das den Konzernabschluss aufstellende Mutterunternehmen von der
Aufgliederungspflicht des § 314 Abs. 1 Nr. 3 HGB befreit.[5]
3.2.2 Konzernabschluss nach IFRS (HI1849456)
Rz. 34
Der Anwendungsbereich der Segmentberichterstattung nach IFRS ergibt sich aus IFRS 8.2.[1] Eine
faktische Befreiung von der IFRS-Segmentberichterstattung besteht dann, wenn die berichtende
Einheit nur über ein berichtspflichtiges Segment verfügt.[2] Allerdings müssen in diesem Fall die
Angabepflichten des IFRS 8.32 IFRS 8.34 beachtet werden.[3]
Rz. 35
Vorläufig frei
Rz. 36
Vorläufig frei
Rz. 37
Vorläufig frei
3.3 Schutzklauseln (HI1849458)
Rz. 38
Da segmentbezogene Informationen Daten sind, welche unter wettbewerblichen Gesichtspunkten
gerade Konkurrenten interessante Aufschlüsse geben,[1] bestehen bei segmentbezogenen
Informationen auch Schutzklauseln. Allgemein muss stets zwischen den berechtigten
Informationsinteressen der Jahresabschlussadressaten und den schutzwürdigen Interessen des
offenlegenden Unternehmens bzw. Konzerns abgewogen werden.
Rz. 39
Für die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen sowie nach geographisch
bestimmten Märkten gemäß § 285 Nr. 4 HGB besteht gemäß § 286 Abs. 2 HGB folgende
Schutzklausel: Große Kapitalgesellschaften dürfen die Aufgliederung der Umsatzerlöse unterlassen,
Haufe Finance Office Professional Online Seite 11
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
wenn die Aufgliederung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der
Kapitalgesellschaft einen erheblichen Nachteil zuzufügen. Darüber hinaus ist die Anwendung der
Ausnahmeregelung im Anhang anzugeben.[2] Die vor Erstanwendung des Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetzes[3] ebenfalls bestehende Ausnahmemöglichkeit von der Aufgliederungspflicht der
Umsatzerlöse nach § 285 Nr. 4 HGB auch in dem Falle, dass diese Aufgliederung einem Unternehmen,
von dem die (Kapital-)Gesellschaft mindestens den 5. Teil der Anteile besitzt, wurde aufgrund der in
der Richtlinie 2013/34/EU nicht mehr vorgesehenen Ausnahmemöglichkeit gestrichen.
Ebenso wurde durch das BilRUG darüber hinaus die auf Art. 18 Abs. 2 Satz 3 der Richtlinie 2013/34/EU
basierende Angabepflicht der Anwendung der Ausnahmeregelung zur Aufgliederung der Netto-
Umsatzerlöse eingeführt. Somit schreibt § 286 Abs. 2 1. Halbsatz HGB ab Erstanwendung der
Rechnungslegungsvorschriften des BilRUG vor, dass im Anhang die Anwendung der
Ausnahmeregelung des § 286 Abs. 2 1. Halbsatz HGB anzugeben ist.
Weiterhin ist auch die Schutzklausel nach § 286 Abs. 1 HGB zu beachten, die grundsätzlich sämtliche
Anhangangaben im Einzelabschluss umfasst.
Im Gegensatz dazu existiert keine vergleichbare Schutzklausel für die Aufgliederung der
Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen sowie nach geographisch bestimmten Märkten nach § 314
Abs. 1 Nr. 3 HGB im Konzernabschluss. Der Grund kann darin gesehen werden, dass die Aufteilung
solcher über den Konzern hinweg aggregierter Daten nur einen begrenzten Rückschluss auf einzelne
Unternehmen erlaubt und daher das Informationsinteresse der Abschlussadressaten höher gewichtet
wird.
Rz. 40
Aufgrund der dominierenden Informationsfunktion des IFRS-Abschlusses für die
Abschlussadressaten haben Schutzklauseln, welche die Veröffentlichung für das Unternehmen bzw.
den Konzern nachteiliger Informationen vermeiden (sollen), praktisch keine wesentliche Bedeutung.
Die IFRS-Rechnungslegung kennt derzeit nur eine explizite und eine implizite (jeweils spezifische)
Schutzklausel, die beide im Unternehmensinteresse liegen[4] und sich beide nicht auf den
Geltungsbereich der Segmentberichterstattung erstrecken.[5]
Auch wenn die Frage des öffentlichen Geheimhaltungsinteresses im IFRS-Regelungswerk keine Rolle
spielt, könnte beispielsweise ein für die Bundesrepublik Deutschland tätiges Rüstungsunternehmen
durch die §§ 93 ff. StGB angehalten sein, zur Vermeidung von Landesverrat die durch einen
Segmentbericht geforderten Detailangaben zum Produktionsprogramm zu unterlassen. Bei einem
derartigen Konflikt von Normen dürfte das nationale Recht vorrangig sein. Die nach IFRS
erforderlichen Angaben sind dann in notwendigem Umfang zu begrenzen und die nach IAS 1.16
verlangte Compliance-Erklärung ist entsprechend einzuschränken.[6]
4 Inhalt der Segmentberichterstattung nach IFRS, DRS und HGB (HI1849459)
4.1 Ableitung der berichtspflichtigen Segmente (HI1849460)
4.1.1 Segmentberichterstattung nach IFRS 8 (HI1849461)
Rz. 41
Haufe Finance Office Professional Online Seite 12
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
IFRS 8 verfolgt eine weitgehend konsequente Ausrichtung am management approach.[1] Als operating
segment[2] wird – ausgehend von der internen Organisationsstruktur – ein Unternehmens- bzw.
Konzernbestandteil verstanden,
der Geschäftstätigkeiten betreibt, mit denen Umsatzerlöse erwirtschaftet werden und bei
denen Aufwendungen anfallen können (einschließlich Umsatzerlöse und Aufwendungen im
Zusammenhang mit Geschäftsvorfällen mit anderen Unternehmens- bzw.
Konzernbestandteilen desselben Unternehmens bzw. Konzerns),
dessen operative Ergebnisse regelmäßig von dem bzw. den zentralen
Entscheidungsträgern überwacht und im Hinblick auf die Allokation von Ressourcen und
zur Bewertung der Ertragskraft verwendet werden und
für den gesonderte Finanzberichtsinformationen verfügbar sind.[3]
Ausgeschlossen von der Definition der operativen Segmente sind Zentralverwaltungseinheiten gemäß
IFRS 8.6. Demgegenüber ist keine Bedingung, dass die operativen Segmente Umsätze überwiegend an
Konzernfremde erbringen. Zudem können auch Aktivitäten, die aktuell noch keine Umsätze erzielen (
start-up activities), als operating segments gemäß IFRS 8.5 geführt werden.[4]
Ansonsten macht IFRS 8 keine Vorgabe, nach welchen Kriterien Segmente abgegrenzt werden, und
folgt somit einer strikten Auslegung des management approach. So ist beispielsweise auch eine
Segmentierung nach rechtlichen Einheiten oder Marktsektoren (z. B. Kundengruppen) möglich, wenn
die interne Finanzberichterstattung auf diesen Kriterien basiert.[5] Ebenfalls kann auch ein
aufgegebener Geschäftsbereich i. S. d. IFRS 5 die Voraussetzungen für ein operating segment erfüllen,
sofern die Kriterien des IFRS 8.5 vorliegen.[6]
Rz. 42
Im Falle mehrerer implementierter Berichtsstrukturen für die zentralen Entscheidungsträger sind
nach IFRS 8.8 zusätzliche Kriterien für eine eindeutige Segmentabgrenzung zu verwenden. Hierzu
zählen die Art der Geschäftsaktivitäten der einzelnen Teileinheiten, die Existenz klar abgegrenzter
Verantwortungsbereiche sowie die zentrale Berichtsstruktur an die oberste Führungsebene.
Bei einer unternehmensintern angewandten parallelen Segmentierung nach unterschiedlichen
Segmentierungskriterien ist zunächst auf die Segmentierung abzustellen, die ausschlaggebend für die
Verantwortlichkeit gegenüber der Unternehmens- bzw. Konzernleitung ist. Bestehen mehrere
Segmentierungsdimensionen und entsprechend den Segmentierungsdimensionen auch kongruent
Verantwortlichkeiten (Matrixorganisation), dann entscheidet gemäß IFRS 8.10 das Management über
die Segmentierungsdimension unter Berücksichtigung des Kerngrundsatzes ("core principle") des IFRS
8.1. Dieser fordert die Offenlegung von Informationen im Jahresabschluss, mittels derer die
Adressaten die Art und die finanziellen Effekte der Geschäftsaktivitäten und der wirtschaftlichen
Umfeldbedingungen beurteilen können. Letztlich dürfte damit die Entscheidungsrelevanz das
bestimmende Merkmal zur Selektion von Segmentierungsdimensionen sein.[7] Durch diese
Festlegung weicht IFRS 8 in dieser Hinsicht vom theoretisch sauberen management approach ab, da in
diesem speziellen Fall Finanzinformationen in der Matrixstruktur den Abschlussadressaten
vorenthalten werden.[8]
Rz. 43
IFRS 8 unterscheidet zwischen den berichtsfähigen und den berichtspflichtigen Segmenten (
reportable segments). Die Verdichtung von Segmenten auf berichtspflichtige Segmente basiert auf dem
Haufe Finance Office Professional Online Seite 13
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Grundsatz der Wesentlichkeit[9]; die Aggregation soll insbesondere vermeiden, dass der Nutzen der
Segmentberichterstattung durch eine Vielzahl von Detailinformationen über viele kleine Segmente
möglicherweise verwässert wird.[10]
Dementsprechend enthält IFRS 8.12 Aggregationskriterien, die auf die in der 1. Stufe ermittelten
berichtsfähigen Segmente angewendet werden müssen. Eine Zusammenfassung von 2 oder mehr
operativen Segmenten zu einem berichtspflichtigen Segment ist danach möglich, sofern die
zusammengefassten (berichtsfähigen) Segmente ähnliche wirtschaftliche Charakteristika aufweisen
und diese Zusammenfassung mit dem in IFRS 8.1 verankerten Kerngrundsatz[11] (Gewährung
entscheidungsrelevanter Informationen über die Art und die finanziellen Daten der wirtschaftlichen
Geschäftsaktivitäten) vereinbar ist. Die wirtschaftlich ähnlichen Charakteristika der Segmente,
welche für die Zusammenfassung heranzuziehen sind, bestimmen sich anhand folgender Kriterien:
Art der Produkte bzw. Dienstleistungen,
Art der Produktions- bzw. Dienstleistungsprozesse,
Kundengruppen für die Produkte bzw. Dienstleistungen,
Vertriebsmethoden und
(soweit anwendbar) regulatorisches Umfeld, beispielsweise bei Banken, Versicherungen oder
Anbietern öffentlicher Infrastrukturleistungen, z. B. Versorgungsunternehmen.[12]
IFRS 8.12 Sätze 1 f. führen aus, dass operative Segmente, wenn sie vergleichbare wirtschaftliche
Merkmale haben, oftmals eine ähnliche langfristige Ertragsentwicklung aufweisen. Vereinzelt wird
hieraus geschlossen, dass auch ähnliche langfristige Ertragsperspektiven bei den Kriterien für das
Vorliegen wirtschaftlich ähnlicher Charakteristika zu berücksichtigen sind.[13]
Rz. 43a
Die in IFRS 8.12 enthaltenen Aggregationskriterien setzen implizit eine produktorientierte
Segmentierung der Unternehmens- bzw. Konzernaktivitäten voraus;[14] geographisch abgegrenzte
Segmente lassen sich mit ihnen nur verdichten, falls unterschiedliche Regionen sich auch in ihrem
Produkt- bzw. Kundenportfolio signifikant unterscheiden.
Zur Verdichtung von geographisch abgegrenzten Segmenten zu berichtspflichtigen regional gebildeten
Segmenten können sich vor allem gebildete Wirtschaftsräume, aber auch ökonomische
Langfristerwartungen zur Entwicklung der unterschiedlichen geographisch abgegrenzten Segmente
anbieten.[15]
Rz. 44
Für den Prozess der Verdichtung von berichtsfähigen zu berichtspflichtigen Segmenten enthält IFRS
8.13 folgende quantitativen Größenmerkmale, wobei das Erreichen einer der unten genannten
Schwellen bereits das Segment als berichtspflichtig qualifiziert:
Die Segmenterlöse einschließlich der Erlöse an anderen Segmente betragen mindestens
10 % der gesamten externen Erlöse und intersegmentären Erlöse,
das Segmentergebnis beträgt mindestens 10 % des zusammengefassten Ergebnisses aller
operativen Segmente mit positivem Ergebnis oder aller operativen Segmente mit negativem
Ergebnis, wobei der jeweils absolut größere Betrag zugrunde zu legen ist, oder
das Segmentvermögen beträgt mindestens 10 % des zusammengefassten
Segmentvermögens aller operativen Segmente.
Falls ein Segment unterhalb der quantitativen Schwellenwerte liegt, bestehen folgende
Berichtsmöglichkeiten:
Haufe Finance Office Professional Online Seite 14
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Aufführung dieses Segments als berichtspflichtiges Segment trotz Nichterreichen der
Größenkriterien, falls das Management die Informationen für entscheidungsrelevant aus
Sicht der Abschlussadressaten hält[16]
Zusammenfassung von Segmenten zu einem berichtspflichtigen Segment, falls zumindest
die Mehrheit der Aggregationskriterien des IFRS 8.12 erfüllt sind,[17]
freiwilliger Ausweis[18],
Zusammenfassung von Segmenten unter dem Ausweis "alle übrigen Segmente".[19]
Zuletzt ist für die Bildung von berichtspflichtigen Segmenten noch die Vorschrift des IFRS 8.15 zu
beachten. Diese Regelung will einer zu geringen Anzahl bzw. Bedeutung von berichtspflichtigen
Segmenten vorbeugen. Danach sollen weitere berichtspflichtige Segmente gebildet werden, selbst
wenn diese nicht die quantitativen Grenzen des IFRS 8.13 erfüllen, bis die den berichtspflichtigen
Segmenten zugehörigen Außenumsätze zumindest 75 % des (konsolidierten) Gesamtumsatzes des
Unternehmens bzw. Konzerns abdecken.
Rz. 45
Hinsichtlich der abweichenden Erfüllung der quantitativen Größenkriterien in aufeinander folgenden
Perioden enthalten die IFRS 8.17 und IFRS 8.18 folgende Regeln, die durch die Grundsätze der
Entscheidungsrelevanz und Vergleichbarkeit von Informationen gekennzeichnet sind:
Erfüllt ein in der vergangenen Periode berichtspflichtiges Segment in der aktuellen Periode
nicht die Größenkriterien des IFRS 8.13, so hat das Management zu beurteilen
(Ermessensspielraum), ob diesem Segment unverändert besondere Bedeutung (continuing
significance) zukommt. Ist dies der Fall, so ist das Segment auch in der aktuellen Periode
berichtspflichtig.[20]
Falls ein Segment in der aktuellen Periode erstmals die quantitativen Größenkriterien für
ein berichtspflichtiges Segment erfüllt, ist dies im Segmentbericht als berichtspflichtig zu
kennzeichnen und die Vorjahreswerte sind entsprechend auszuweisen (durch Umgliederung
aus den Positionen, in denen sie im Vorjahr enthalten waren). Allerdings ist das restatement
der Vorjahresinformation nur dann vorzunehmen, wenn die für die Umgliederung bzw. den
Ausweis erforderlichen Information verfügbar und die Kosten für die Bereitstellung der
angepassten Informationen nicht übermäßig hoch sind. Letztgenannter Fall ist Ausfluss des
Grundsatzes der Berücksichtigung der Kosten gemäß Conceptual Framework QC 35–39, der
die entscheidungsrelevante und verlässliche Informationsvermittlung beschränkt.
Klarstellend ist darauf hinzuweisen, dass bei der Entscheidung über den Verzicht auf die
Bereitstellung von Informationen neben den Kosten- auch die Nutzenaspekte aus Sicht der
Abschlussadressaten zu berücksichtigen sind.[21]
Rz. 46
Hinsichtlich der Anzahl der berichtspflichtigen Segmente spricht IFRS 8.19 die Empfehlung aus, die
Anzahl der Segmente auf 10 zu limitieren, um ein "information overload" beim Abschlussadressaten
zu vermeiden.[22]
4.1.2 Segmentberichterstattung nach DRS 3 (HI1849462)
Rz. 47
DRS 3.8 definiert ein operatives Segment als einen Teil des Unternehmens,
Haufe Finance Office Professional Online Seite 15
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
1. der geschäftliche Tätigkeiten entfaltet, die potenziell oder tatsächlich zu externen bzw.
intersegmentären Umsätzen führen, und
2. der regelmäßig von der Unternehmensleitung überwacht wird, um seine wirtschaftliche Lage zu
beurteilen.
Obwohl die Verfügbarkeit entsprechender gesonderter rechnungslegungsbezogener Informationen
nach DRS 3 im Gegensatz zu IFRS 8 keine explizite Bedingung ist, dürfte diesem Kriterium wohl keine
zu dominante Bedeutung zukommen, da im Normalfall der regelmäßigen Überwachung durch die
Unternehmensleitung zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage – rationales Verhalten der
Unternehmensleitung vorausgesetzt – auch ein entsprechendes Finanzberichtssystem zugrunde liegen
dürfte.
DRS 3.10 führt zunächst in Übereinstimmung mit dem management approach aus, dass die
Segmentierung sich aus der internen Organisations- und Berichtsstruktur der berichtenden Einheit
ergibt.
Allerdings unterstellt DRS 3.10, dass die interne Berichtsstruktur auf die unterschiedlichen Chancen
und Risiken abstellt, und weiterhin, dass sich in der Regel entweder eine produktorientierte oder eine
geographische Segmentierung der Unternehmensaktivitäten ergibt.
DRS 3 lässt es offen, wie zu verfahren ist, falls die interne Berichtsstruktur nicht dem risks and
rewards approach entspricht. Im Zweifelsfall dürfte bei der Abgrenzung von Segmenten die interne
Berichts- und Organisationsstruktur entscheidend sein.
Die 2. in DRS 3.10 ausgesprochene Vermutung, dass sich im Regelfall entweder eine produktorientierte
oder eine geographische Segmentierung ergibt, beinhaltet ebenfalls keine echte Einschränkung des
management approachs, da auch hier letztlich auf die Berichtsstruktur abzustellen ist. So ist auch nach
DRS 3.10 eine nach rechtlichen Einheiten vorgenommene Segmentierung vertretbar, auch wenn sie
weder produktorientierten noch geographischen Segmentierungskriterien genügt, falls die interne
Organisations- und Berichtsstruktur nach diesen Kriterien ausgerichtet ist (beispielsweise
Überwachung der rechtlich selbstständigen Unternehmen durch eine reine Finanz-Holding).
Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass die Abgrenzung der Segmente nach DRS 3 bei
Vorhandensein nur einer Segmentierungsdimension innerhalb der internen Organisations- und
Berichtsstruktur grundsätzlich dem management approach folgt und im Regelfall mit IFRS 8.5
übereinstimmen wird. Dennoch fließen durch die Unterstellungen Elemente des risks and rewards
approachs in die Segmentabgrenzung ein.[1]
Rz. 48
Ein noch deutlich stärkerer Einfluss des Risks and Rewards Approachs kann sich jedoch ergeben, falls
die interne Organisations- und Berichtsstruktur nach verschiedenen Segmentierungsdimensionen
erfolgt. In diesem Fall ist nach DRS 3.11 die Segmentierungsdimension zu wählen, welche die
Chancen-Risiken-Struktur des Unternehmens bzw. Konzerns am besten widerspiegelt. Diese
Regelung wird gewöhnlich mit IFRS 8.9 und dem Kerngrundsatz der Segmentberichterstattung
übereinstimmen.[2]
Rz. 49
Ebenso wie in der IFRS-Rechnungslegung wird zwischen berichtsfähigen und berichtspflichtigen
bzw. anzugebenden Segmenten unterschieden.
Haufe Finance Office Professional Online Seite 16
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Operative Segmente, die im Verhältnis zueinander homogene Chancen und Risiken aufweisen, dürfen
nach DRS 3.13 zusammengefasst werden, wenn dadurch die Klarheit und Übersichtlichkeit verbessert
wird. Zur Beurteilung der homogenen Chancen-Risiken-Struktur sind dabei die in Tab. 1 aufgezeigten
Kriterien heranzuziehen.[3]
Aggregationsmerkmale bei produktorientierter Aggregationsmerkmale bei geographischer
Segmentierung Segmentierung
Gleichartigkeit der Produkte und Gleichartigkeit der wirtschaftlichen
Dienstleistungen und politischen Rahmenbedingungen
Gleichartigkeit der Produktions- oder Nähe der Beziehungen
Dienstleistungsprozesse zwischen Tätigkeiten in
Gleichartigkeit der Kundengruppen unterschiedlichen geographischen
Gleichartigkeit von Vertriebsmethoden Regionen
geschäftszweigbedingte räumliche Nähe der Tätigkeiten
Besonderheiten, z. B. für zueinander
Kreditinstitute, Versicherungen oder spezielle Risiken von Tätigkeiten in
für öffentliche Versorgungsbetriebe einem bestimmten Gebiet
Gleichartigkeit der Außenhandels-
und Devisenbestimmungen
gleichartiges Währungsrisiko
Tab. 1: Aggregationsmerkmale zur Verdichtung von berichtsfähigen zu anzugebenden Segmenten
nach DRS 3.8
Im Vergleich zu IFRS 8 fällt auf, dass sich DRS 3 explizit auf den risks and rewards approach bezieht,
wohingegen IFRS 8 nur die ähnlichen wirtschaftlichen Charakteristika erwähnt. Vergleicht man die
verwendeten Aggregationskriterien, so stellt man fest, dass DRS 3 differenzierte Merkmale für die
produktorientierte Segmentierung und für die geographische Segmentierung vorhält. Demgegenüber
enthält IFRS 8 ausschließlich Aggregationsmerkmale, die für eine eher produktorientierte Abgrenzung
typisch sind.[4]
Rz. 50
Wie IFRS 8 enthält auch DRS 3 für die Verdichtung von berichtsfähigen zu berichtspflichtigen bzw.
anzugebenden Kriterien quantitative Wesentlichkeitsschwellen. Die quantitativen
Wesentlichkeitskriterien nach DRS 3.15 entsprechen den Wesentlichkeitsschwellen nach IFRS 8.13.[5]
Falls ein Segment die quantitativen Schwellenwerte nach DRS 3.15 nicht erreicht, kann dieses
trotzdem als anzugebendes Segment aufgeführt werden, falls hierdurch weder die Klarheit noch die
Übersichtlichkeit der Segmentberichterstattung beeinträchtigt werden.
Im Vergleich zu IFRS 8 hat das eine Segmentberichterstattung nach DRS 3 aufstellende Unternehmen
deutlich weniger Ermessensspielräume; insbesondere ist es nicht möglich, Segmente zu einem
angabepflichtigen Segment zusammenzufassen, wenn nur ein Teil der Aggregationsmerkmale erfüllt
ist. Hierdurch betont DRS 3 indirekt auch stärker den risks and rewards approach als IFRS 8, da nur
solche Segmente zu einem anzugebenden Segment zusammengefasst werden können, welche
homogene Chancen und Risiken im Sinne des DRS 3.13 i. V. m. DRS 3.8 aufweisen.
Ebenfalls wie in IFRS 8.15 gilt auch nach DRS 3.12 die so genannte 75 %-Regel, nach der die im
Segmentbericht anzugebenden Segmente zumindest 75 % des konsolidierten Außenumsatzes des
Unternehmens bzw. Konzerns abdecken müssen.
Haufe Finance Office Professional Online Seite 17
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Rz. 51
Hinsichtlich der abweichenden Erfüllung der quantitativen Größenkriterien in aufeinander
folgenden Perioden enthalten DRS 3.17 und DRS 3.18 die folgenden Regeln:
Erfüllt ein in der vergangenen Periode berichtspflichtiges Segment in der aktuellen Periode
nicht die Größenkriterien des DRS 3.15, so hat das Management zu beurteilen
(Ermessensspielraum), ob diesem Segment unverändert eine wesentliche Bedeutung
zukommt. Ist dies der Fall, so ist das Segment auch in der aktuellen Periode
berichtspflichtig. Diese Regelung stimmt mit IFRS 8.17 überein.
Nach DRS 3.18 kann vom Ausweis als anzugebendes Segment abgesehen werden, wenn für
ein Segment eines der quantitativen Größenkriterien aufgrund außergewöhnlicher Umstände
voraussichtlich einmal überschritten wird und dieses bisher kein anzugebendes Segment
war. Im Umkehrschluss handelt es sich bei Überschreitung mehrerer quantitativer
Schwellenwerte und gleichzeitigem Auftreten außergewöhnlicher Umstände sowie bei
Überschreitung mindestens eines Schwellenwerts und Nichtvorliegen außergewöhnlicher
Umstände stets um Ereignisse, die zur Identifizierung eines anzugebenden Segments führen.
Bei Änderung der in der Segmentberichterstattung anzugebenden Segmente sind die Vorjahreszahlen
gemäß DRS 3.47 Satz 2 anzupassen.
4.1.3 Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen und
geographischen Regionen (HI1849464)
Rz. 52
Eine Pflicht zur Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen sowohl nach § 285 Nr. 4
HGB sowie § 314 Abs. 1 Nr. 3 HGB besteht nur dann, wenn sich die Tätigkeitsbereiche untereinander
erheblich unterscheiden. Die Unterschiede müssen sich auf die Risiken der jeweiligen Bereiche bzw.
Märkte beziehen und erhebliches Gewicht haben.[1] Die Unterschiedlichkeit beurteilt sich im
Einzelnen nach Abweichungen bei der Art der Produkte, dem Abnehmerkreis, den Marktverhältnissen,
der Kostenstruktur, der Forschungsintensität und den Konkurrenzverhältnissen.[2]
Rz. 53
Beispiele für Abgrenzungsmerkmale, anhand derer Tätigkeitsbereiche identifiziert werden (können),
sind:[3]
Art des Produkts bzw. der Produktgruppe (Produkte für ähnliche oder verwandte
Anwendungsgebiete, -zwecke),
Art des Produktionsprozesses (gleiche oder ähnliche Produktionsverfahren, ähnliche
Rohstoffe),
unternehmensorganisatorische Einheiten (z. B. Unternehmensbereiche, Sparten, Profit-
Center, Produktstandort),
Kundengruppen (z. B. Weiterverarbeiter bzw. -veräußerer oder Endverbraucher, Groß- oder
Kleinabnehmer, regionale Standorte, Wirtschaftszweig),
Vertriebswege (stationärer Handel, Internet-Handel, Direktvertrieb).
Bei der konkreten Einteilung des Unternehmens in Tätigkeitsbereiche ist jedoch aufgrund des
Gesetzeswortlauts die Verkaufsorganisation stets zu berücksichtigen. Die im Gesetz genannte
Berücksichtigung der Verkaufsorganisation bei der Umsatzaufgliederung deutet darauf hin, dass
insbesondere produkt- und absatzbezogene Merkmale für die Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche
heranzuziehen sind, da sie Anhaltspunkte für mögliche Absatzrisiken liefern.[4]
Haufe Finance Office Professional Online Seite 18
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Ohne Zweifel gibt es in der Praxis viele Grenzfälle, in denen es fraglich ist, ob sich die
Tätigkeitsbereiche wirklich "erheblich unterscheiden". Hier gibt es für das abschlusserstellende
Unternehmen Ermessensspielräume, die auch unter bilanzpolitischen Aspekten genutzt werden
können.
Weiterhin ist bei Anwendung der Aufgliederungskriterien der Stetigkeitsgrundsatz des § 265 Abs. 1
Satz 1 HGB zu beachten, da andernfalls die Angabe die Funktion der Informationsvermittlung nicht
ausreichend erfüllen kann. Die Kriterien der Aufgliederung (der Umsätze nach Tätigkeitsbereichen)
sind daher nicht ohne hinreichende Gründe zu ändern. Ebenso ist die Form der Darstellung
grundsätzlich beizubehalten.[5]
Rz. 54
Die Pflicht zur regionalen Aufgliederung der Umsatzerlöse setzt ebenfalls erhebliche Unterschiede
voraus. Die Aufgliederung erfolgt hierbei nach unterschiedlichen Absatzgebieten; hierfür spricht
insbesondere auch die Formulierung des Gesetzestextes, der den Terminus "geografisch bestimmte
Märkte" verwendet. Das bezieht sich hauptsächlich auf die Marktkonditionen, die
Währungsverhältnisse sowie allgemein auf die wirtschaftlichen Verhältnisse. Ebenso wie für die
Aufgliederung nach Tätigkeitsbereichen ist der Stetigkeitsgrundsatz zu beachten.[6]
Als geographisch abgegrenzte Märkte kommen u. a. Kontinente, wirtschaftlich gemeinsam
auftretende Ländergruppen (insbes. Wirtschaftsräume) oder einzelne Staaten in Betracht. Hinsichtlich
der Aufgliederung kann zunächst das Inland als einheitlicher geographischer Markt abgegrenzt
werden. Eine Unterteilung der Umsätze in Inland und Ausland kann nur dann für die geforderte
Aufteilungspflicht ausreichen, wenn die Auslandsumsätze insgesamt nur gering sind.[7]
Je bedeutender die Auslandsumsätze am Gesamtumsatz des Unternehmens sind, umso detaillierter
muss die regionale Unterteilung erfolgen. Bei weltweit operierenden Unternehmen könnte eine
Aufteilung in folgende Regionen vorgenommen werden: Inland (Deutschland), EU-Länder, übriges
Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Afrika und Australien,[8] ggfs. mit weitergehender
Untergliederung besonders bedeutender Kontinente (z. B. China, Indien, Vorder- und Mittelasien,
übriges Asien). Dagegen könnten sich überwiegend in Europa tätige Unternehmen mit der Aufteilung
Deutschland, EU-Länder, übriges Europa und übrige Welt im Regelfall begnügen.
Rz. 55
Die Literatur empfiehlt sowohl bei der Aufteilung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen als auch
nach Regionen als quantitativen Maßstab einen Grenzwert für den Umsatzanteil je Segment von ca.
10 % unter der Voraussetzung, dass durch die Segmentierung mindestens 75 % des Gesamtumsatzes
erklärt werden können.[9]
4.2 Segment-Bilanzierungsmethoden und -Bewertungsmethoden (HI1849465)
Rz. 56
Die Segment-Bilanzierungs- und -Bewertungsmethoden umfassen sowohl die zur Ableitung der
Wertansätze angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im engeren Sinne als auch die
inhaltliche Abgrenzung der auszuweisenden Segmentdaten sowie die Zurechnung von
gemeinschaftlich durch mehrere Segmente verursachten GuV- und Bilanzposten auf die einzelnen
Segmente.
Haufe Finance Office Professional Online Seite 19
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
4.2.1 Segmentberichterstattung nach IFRS 8 (HI1849466)
Rz. 57
Hinsichtlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im engeren Sinne hat die Ermittlung der
im Segmentbericht anzugebenden Daten gemäß IFRS 8.25 – entsprechend dem Management Approach
– auf Basis der internen Grundsätze und Methoden zu erfolgen; dies gilt selbst dann, wenn diese
intern verwendeten Finanzberichterstattungsgrundsätze von den in Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung verwendeten Rechnungslegungsmethoden abweichen.
Falls intern verschiedene Rechnungslegungsmethoden angewendet werden, dann sind gemäß IFRS
8.26 Satz 2 für die Darstellung im Segmentbericht die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu
verwenden, die denjenigen im konsolidierten Abschluss am ähnlichsten sind.[1]
Rz. 58
Die Verwendung interner Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in der Segmentberichterstattung
verfolgt den Zweck, dem Abschlussadressaten die Segmente nicht nur in der internen Abgrenzung,
sondern vor allem auch mit den Wertansätzen zu präsentieren, wie sie gegenüber dem Management
präsentiert werden.
Dafür nimmt IFRS 8 in Kauf, dass die Segmentdaten sich nicht als unmittelbare Aufgliederung der für
die externe Abschlusspublizität ermittelten Zahlen ergeben.[2]
Rz. 59
So ist es beispielsweise möglich, dass das Betriebsergebnis unter Einbeziehung von kalkulatorischen
Abschreibungen auf Basis von Wiederbeschaffungskosten, kalkulatorischen Zinsen und unter
Verwendung kalkulatorischer Wechselkurse ermittelt und berichtet wird. Auch veröffentlichen
Unternehmen, die den ebenfalls auf dem Management Approach basierenden SFAS 131 anwenden,
teilweise anstelle des Betriebsergebnisses auch andere Ergebnisgrößen, die intern zur Steuerung
verwendet werden (z. B. Deckungsbeitrag).
Im Bereich des Segmentvermögens könnte, um Verzerrungen vorzubeugen, die aus unterschiedlichen
Anschaffungszeitpunkten des Sachanlagevermögens resultieren, das Sachanlagevermögen intern auch
mit aktuellen Zeitwerten bewertet sein.[3] In diesem Fall wäre auch dieselbe Bewertung in der
externen Segmentberichterstattung vorzunehmen.
Rz. 60
Dem management approach folgend schreibt IFRS 8 keine inhaltliche Definition der Größen
Segmentergebnis und Segmentvermögen vor. Damit nimmt IFRS 8 bewusst auch eine geringere
zwischenbetriebliche Vergleichbarkeit und indirekt Ermessensspielräume bei der Gestaltung des
Segmentberichts durch das die Segmentberichterstattung erstellende Unternehmen in Kauf.[4]
Einen Ausgleich für die fehlende Definition von Segmentergebnis und Segmentvermögen sollen
Überleitungsrechnungen zu den extern veröffentlichten Abschlussgrößen sowie ausführliche
Erläuterungen bestehender Unterschiede zu den im Rahmen der Abschlusspublizität verwendeten
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze bilden. Insbesondere anhand der Überleitungsrechnungen
sollen die Auswirkungen aus der Anwendung interner Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Haufe Finance Office Professional Online Seite 20
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
(beispielsweise Verwendung kalkulatorischer Zinsen und Abschreibungen, durchgängige
Wertermittlung auf Basis von Zeitwerten) transparent gemacht werden, da diese gemäß IFRS 8.28 zu
den wesentlichen Überleitungsposten, für die eine gesonderte Angabepflicht besteht, zählen.[5]
Rz. 61
Nach IFRS 8.25 erfolgt die Verteilung von gemeinschaftlich verursachten Abschlussposten
(insbesondere Ergebniskomponenten oder Vermögensposten) auf die Segmente nach einer
vernünftigen und begründbaren Vorgehensweise. Eine solche Aufteilung schließt nicht aus, dass es
mehrere vertretbare Zuschlüsselungen von gemeinschaftlich verursachten Abschlussposten geben
kann,[6] sodass Ermessensspielräume vorhanden sind.
Zudem ist es auch grundsätzlich möglich, dass eine asymmetrische Zuordnung von Vermögensposten
und zugehörigen Ergebniskomponenten vorkommen kann[7], wenngleich die Wahrscheinlichkeit
solcher Inkonsistenzen bei Unterstellung der Existenz eines effizienten Steuerungs- und
Finanzberichtsystems im Regelfall gering sein dürfte.[8]
4.2.2 Segmentberichterstattung nach DRS 3 (HI1849467)
Rz. 62
Nach DRS 3.19 hat die Segmentberichterstattung in Übereinstimmung mit den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden des zugrunde liegenden Abschlusses zu erfolgen. Die Beträge sind nach
intrasegmentärer Konsolidierung, aber vor Konsolidierung zwischen den Segmenten anzugeben.
Im Gegensatz zu IFRS 8 vertritt der DRS 3 die Auffassung, dass eine Kongruenz der dem externen
Abschluss zugrunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsansätze für das Verständnis des
Abschlusses unverzichtbar ist.[1] Der Informationsgehalt wird nach dieser im DRS 3 vertretenen
Ansicht für den Abschlussadressaten nicht durch Verwendung interner Steuerungsgrößen erhöht, da
der Abschlussadressat weder die Hintergründe für die Verwendung kalkulatorischer Größen kennt
noch eine Überleitung zum Gesamtergebnis herstellen kann.[2] Damit wendet sich DRS 3 bei der Wahl
der Segment-Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden eindeutig vom management approach ab.
Rz. 63
Ebenso wie IFRS 8 schreibt DRS 3 keine inhaltliche Definition des Segmentergebnisses vor. Nach DRS
3.24 ist das Segmentergebnis von der Unternehmensleitung zu definieren, wobei
geschäftszweigbedingte Besonderheiten berücksichtigt werden.
In Abhängigkeit des Umfangs des Segmentergebnisses schreiben DRS 3.32 und DRS 3.33 weitere
angabepflichtige Segmentergebniskomponenten vor. Mittels dieser Angaben sowie der in DRS 3.31 b)
vorgeschriebenen Davon-Angaben kann jedoch ein externer Abschlussadressat als eine
standardisierte Segmentergebnisgröße sowohl das Segment-Betriebsergebnis (vor Zins- und
Beteiligungsergebnis; korrespondierend zum EBIT) als auch das Segment-Betriebsergebnis vor
Abschreibungen und vor Zins- und Betriebsergebnis (korrespondierend zum EBITDA) ermitteln.
Insoweit strebt DRS 3 bei der Angabepflicht des Segmentergebnisses eine Zwischenlösung zwischen
management approach und risks and rewards approach an.
Im Gegensatz hierzu schreibt DRS 3 für das Segmentvermögen vor, dass die Angabe einschließlich
(des Buchwerts) der Beteiligungen erfolgen soll.
Haufe Finance Office Professional Online Seite 21
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Ebenso wird in DRS 3.8 der sachliche Umfang der Segmentschulden vorgeschrieben; diese enthalten
die dem working capital zuzurechnenden Schulden und können auch die Finanzschulden einschließen.
[3]
Rz. 64
Nach DRS 3.23 erfolgt die Verteilung von gemeinschaftlich verursachten Abschlussposten
(insbesondere Segmentergebnis, Ergebniskomponenten, Vermögens- und Schuldposten) auf die
Segmente nach einem sachgerechten Schlüssel. Wie auch nach IFRS 8.25 kann es mehrere sachlich
vertretbare Zuschlüsselungen von gemeinschaftlich verursachten Abschlussposten geben.
Im Unterschied zu IFRS 8 enthält DRS 3.22 explizit die Vorschrift nach einer symmetrischen bzw.
korrespondierenden Zuordnung von Vermögenswerten und Schulden sowie damit
zusammenhängender Aufwendungen und Erträge auf die Segmente.[4]
4.3 Berichtsgrößen nach IFRS 8 und DRS 3 im Einzelnen (HI1849468)
4.3.1 Berichtsgrößen der operativen Segmente (HI1849469)
Rz. 65
Tab. 2 zeigt die für die anzugebenden Segmente offenzulegenden Segmentdaten in der Übersicht auf.
IFRS 8
DRS 3
bzw. IAS
36
Informationen zur GuV
Umsatzerlöse mit Dritten ×[1] ×
Innenumsätze ×100 ×
Segmentergebnis × ×
Abschreibungen ×100 ×
Wertminderungsaufwand ×
Wertaufholungen ×
wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge ×100 ×
außergewöhnliche Posten i. S. d. IAS 1.97 ×100
Ergebnis aus Beteiligungen at equity bewerteten assoziierten Unternehmen ×
(Perioden-)Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und ×100
Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bewertet werden
Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen ×
Zinserträge ×100 ×[2]
Zinsaufwendungen ×100 ×101))102)
Ertragsteueraufwendungen/-erträge ×100 ×102
Haufe Finance Office Professional Online Seite 22
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Informationen zur Bilanz
Segmentvermögen ×103 ×
Segmentschulden ×[3] ×
Buchwerte der at equity bewerteten Beteiligungen ×[4]
Informationen zur Kapitalflussrechnung
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ×[5]
Investitionen in das langfristige Vermögen ×104 ×
Tab. 2: Berichtsgrößen für die anzugebenden Segmente nach IFRS 8 und DRS 3
Rz. 66
Wie Tab. 2 zeigt, hängt der Umfang der nach IFRS 8 für die operativen Segmente erforderlichen
Angaben signifikant von der Ausgestaltung der internen Finanzberichterstattung ab. Verpflichtend ist
grundsätzlich nach IFRS 8.23 Satz 1 allein die Angabe eines Maßes für den Segmenterfolg.[6]
Daher basieren die folgenden Aussagen über diese Berichtsgrößen stets auf der Annahme, dass für
diese eine Berichtspflicht existiert.
4.3.1.1 Berichtsgrößen zur GuV (HI1849470)
Rz. 67
Segmenterlöse
Sowohl nach IFRS 8 als auch nach DRS 3 sind die Erlöse für die anzugebenden Segmente zu berichten.
Dabei schreiben sowohl IFRS 8.23 a) und IFRS 8.23 b) bzw. DRS 3.31 a) jeweils einen unterteilten
Ausweis von Erlösen mit Externen und von Erlösen mit anderen Segmenten vor.
Die Segmenterlöse beinhalten sowohl die (unternehmens- bzw. konzern-)externen als auch die
unternehmens- bzw. konzerninternen Erlöse, sofern diese entweder verursachungsgerecht oder auf
einer vernünftigen Basis den Segmenten zugeordnet werden.[1]
Bildet die berichtende Einheit einen Konzern, dann schließen die Segmenterlöse nach DRS 3 auch die
anteiligen Erlöse eines nach § 310 HGB quotal konsolidierten Unternehmens ein.
Rz. 68
Da IFRS 8 keine Angaben zur Abgrenzung der berichtspflichtigen Segmente enthält, ist eine
zwingende Orientierung an der Erlösabgrenzung i. S. d. IAS 18 bzw. künftig des IFRS 15 nicht
zwingend. Entscheidend ist vielmehr die Erlösabgrenzung i. S. d. internen Finanzberichterstattung an
den bzw. die zentralen Entscheidungsträger.[2]
Rz. 68a
Anders dürfte dies sich jedoch hinsichtlich der Berichterstattung nach DRS 3 verhalten. Nach DRS 3.19
hat die Segmentberichterstattung in Übereinstimmung mit den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden des zugrunde liegenden Abschlusses zu erfolgen. Dies dürfte auch die
inhaltliche Abgrenzung der jeweiligen Berichtsposition umfassen.
Haufe Finance Office Professional Online Seite 23
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Hier ist zu beachten, dass das BilRUG zu einer deutlichen inhaltlichen Ausweitung der Umsatzerlöse
geführt hat. So umfassen die Umsatzerlöse ab Erstanwendung des HGB i. d. F. des BilRUG sämtliche
Erlöse aus der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, auch wenn es sich um nicht betriebstypische
oder sogar außergewöhnliche Umsätze handelt. Zu den nicht betriebstypischen Umsätzen zählen u. a.
auch Nebenerlöse aus Verkäufen (z. B. Erlöse aus Schrottverkäufen und der Verkauf nicht mehr
benötigter Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe), Miet- und Pachteinnahmen, beispielsweise aus der
entgeltlichen Überlassung von Werkswohnungen, sämtliche Patent- und Lizenzeinnahmen,
Kantinenerlöse, Entgelte für die Verleihung von Arbeitskräften auch von Handels- oder
Produktionsunternehmen oder Erlöse aus der Erbringung von nicht innerhalb des Kerngeschäfts
liegenden Verwaltungsdienstleistungen (sowohl innerhalb als auch außerhalb des Konzerns).
Außergewöhnlichen Charakter haben Umsatzerlöse im Zusammenhang mit Räumungsverkäufen
anlässlich der Schließung von Geschäftseinheiten. Dagegen dürften Erlöse aus dem Verkauf von
Vermögenswerten des Anlagevermögens (z. B. Maschinen, Gebäude) nicht unter die Umsatzerlöse
fallen, da es sich hierbei nicht um Erzeugnisse oder Waren des Unternehmens bzw. Konzerns handelt.
[3] Weiterhin sind nach § 277 Abs. 1 HGB von den Umsatzerlösen zwingend sowohl die Umsatzsteuer
als auch sonstige direkt mit dem Umsatz verbundene Steuern abzusetzen.
Auch wenn die Segmenterlöse der Abgrenzung der Umsatzerlöse i. S. d. § 277 Abs. 1 HGB folgen
müssen (allein schon wegen des Eingehens dieser Position in die Berechnung des
Segmentergebnisses), so spricht nach der hier vertretenen Meinung nichts gegen eine freiwillige
Untergliederung des Zustandekommens der Segmenterlöse, sofern die Klarheit und Übersichtlichkeit
des Jahres- bzw. Konzernabschlusses nicht gefährdet wird.[4] Insbesondere wenn den
Entscheidungsträgern die Umsatzerlöse auch aus der gewöhnlichen Tätigkeit oder
Kerngeschäftstätigkeit nach Segmenten berichtet wird, spricht vieles dafür auch diese Informationen
den Abschlussadressaten gegenüber offen zu legen.
Rz. 69
Die Segmenterlöse aus Transaktionen mit anderen Segmenten sind entsprechend dem management
approach auf Basis der in der internen Finanzberichterstattung enthaltenen Wertansätze anzusetzen.
Damit erfolgt die Bewertung im Regelfall auf der Grundlage der tatsächlich verwendeten
Verrechnungspreise für solche Transfers zwischen den Segmenten.
Es besteht damit keine Notwendigkeit zur (Um-)Bewertung der Segmenterlöse aus Transaktionen mit
Preisen, die unter fremden Dritten üblich wären.[5]
Im Ausgleich hierzu verlangen IFRS 8.27 a) bzw. DRS 3.45 die Angabe der Grundsätze der
Verrechnungspreisbildung.[6]
Rz. 70
Hinsichtlich sonstiger Angaben, die sich auf die Segmenterlöse beziehen, sei auf Abschnitt 4.4
verwiesen.
Rz. 71
Segmentergebnis
Gemeinsam ist sowohl IFRS 8 als auch DRS 3, dass beide Standards keinen inhaltlichen Umfang für
das Segmentergebnis vorgeben. Damit sind – in Abhängigkeit der Ausgestaltung der
Finanzberichterstattung – unterschiedliche Möglichkeiten der inhaltlichen Abgrenzung vorstellbar.
Haufe Finance Office Professional Online Seite 24
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Beispiele: Brutto-Betriebsergebnis, Deckungsbeitrag[7] (gegebenenfalls unterschiedlicher Stufen bei
Anwendung einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung), EBITDA (earnings before interests, tax,
depreciation and amortization), Betriebsergebnis, EBIT (earnings before interests and tax), Ergebnis vor
Steuern, Jahresüberschuss/-fehlbetrag.
Rz. 72
Nach IFRS 8 ist das Segmentergebnis in der Abgrenzung zu berichten, das zur internen Steuerung
und Berichterstattung herangezogen wird; dies entspricht einer konsequenten Ausrichtung am
management approach.
Sofern das oberste Entscheidungsgremium mehr als eine Kategorie von Segmentergebnissen zur
Steuerung der Ressourcen verwendet, so ist nach IFRS 8.26 Satz 2 dasjenige Segmentergebnis extern
zu veröffentlichen, welches hinsichtlich der Segmentbilanzierungs- und
Segmentbewertungsmethoden die größte Übereinstimmung mit den im Einzelabschluss bzw.
Konzernabschluss verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufweist.
Rz. 73
Anpassungen und Eliminierungen, die zur Aufstellung des Einzelabschlusses des Unternehmens bzw.
des Konzernabschlusses vorgenommen werden, sind nur dann auch im extern veröffentlichten
Segmentergebnis nach IFRS 8 zu berücksichtigen, falls diese auch bei der internen Berichterstattung
an das oberste Entscheidungsgremium in das Segmentergebnis einbezogen werden.[8] Hinsichtlich
der Erläuterungen zum Segmentergebnis vgl. Rz. 104.
Rz. 74
DRS 3.24 enthält nur die Vorschrift, dass das Segmentergebnis von der Unternehmensleitung zu
definieren ist. Damit steht es der Unternehmensführung zunächst offen, im Segmentbericht eine
möglicherweise nur in der Branche verbreitete oder besonders aussagefähige Größe zu verwenden, die
mit den aus dem Ergebnisrechnungsschema des § 275 HGB ableitbaren Ergebnisgrößen nur
unvollständig korreliert.[9]
Auch wäre es (theoretisch) vertretbar, eine Ergebnisgröße zu wählen, die weder für die
Unternehmensleitung eine besondere Rolle für die Ressourcenverteilung spielt noch eine besonders
signifikante Bedeutung in der Branche besitzt, da DRS 3.24 Satz 2 nur davon spricht, dass
geschäftszweigbedingte Besonderheiten berücksichtigt werden können. Insoweit kann nicht der
Auffassung gefolgt werden, dass es sich bei der Festlegung des Segmentergebnisses durch die
Unternehmensleitung um eine "klare Ausprägung des management approach"[10] handelt. Damit
eröffnet sich für die Unternehmensleitung ein nicht unerheblicher Ermessensspielraum bei der
Festlegung bzw. Abgrenzung des veröffentlichten Segmentergebnisses.
Trotz des in DRS 3.24 vorhandenen Ermessensspielraums des Managements wird dieser durch DRS
3.31 b) und DRS 3.32 f. nicht unerheblich eingeschränkt. So müssen nach DRS 3.31 b) die
Abschreibungen, die anderen nicht zahlungswirksamen Posten, das Ergebnis aus Beteiligungen an
assoziierten Unternehmen sowie die Erträge aus sonstigen Beteiligungen Bestandteile des
Segmentergebnisses sein.[11] Dementsprechend besteht nach DRS 3.24 i. V. m. DRS 3.31 b), DRS 3.32
und DRS 3.33 die Wahl, entweder ein um das Betriebsergebnis erweitertes Beteiligungsergebnis als
Segmentergebnis auszuweisen (Minimalumfang) oder ein umfassenderes Segmentergebnis
(insbesondere Ergebnis vor Steuern oder Periodenergebnis, aber grundsätzlich auch dazwischen
liegende Segmentergebnisabgrenzungen, beispielsweise Segmentergebnis entsprechend
Minimalumfang zuzüglich Zinserträge) auszuweisen.
Haufe Finance Office Professional Online Seite 25
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Rz. 75
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen
Nach IFRS 8.23 e) sind die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte für die Segmente nur dann anzugeben, wenn entweder die Abschreibungen
Bestandteil des Segmentergebnisses sind oder die Abschreibungen dem obersten
Entscheidungsgremium regelmäßig zur Verfügung gestellt werden.
Demgegenüber sind die außerplanmäßigen Wertminderungen und die Wertaufholungen gemäß IAS
36.129 für jedes operative Segment getrennt anzugeben; dies gilt unabhängig davon, ob diese
Segmentinformationen in das Segmentergebnis eingehen oder regelmäßig dem obersten
Entscheidungsgremium zur Verfügung gestellt werden.
Rz. 76
Nach DRS 3.31 b) aa) besteht eine Angabepflicht für die im Segmentergebnis enthaltenen
Abschreibungen. Der Begriff der Abschreibungen schließt dabei sowohl die planmäßigen als auch die
außerplanmäßigen Abschreibungen ein; zudem erstreckt er sich auch auf Abschreibungen des
Umlaufvermögens, soweit sie das übliche Maß überschreiten.[12]
Je nach dem von der Unternehmensleitung gewählten Umfang des Segmentergebnisses schließen die
Abschreibungen auch Abschreibungen auf Finanzanlagen (ausgenommen Beteiligungen) und auf
Wertpapiere des Umlaufvermögens sowie gegebenenfalls Abschreibungen auf Steuerforderungen
oder Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern ein.
Die Angabe des DRS 3.31 b) aa) kann entfallen, wenn im Rahmen der Segmentberichterstattung eine
freiwillige Veröffentlichung des Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit erfolgt.[13]
Rz. 77
Wesentliche nicht zahlungswirksame GuV-Posten sowie wesentliche GuV-Posten i. S. d. IAS 1.97
Wesentliche nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen sind nach IFRS 8.23 i)
offenzulegen, wenn entweder die wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge
Bestandteil des Segmentergebnisses sind oder die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und
Erträge dem obersten Entscheidungsgremium regelmäßig zur Verfügung gestellt werden.
Der Umfang der wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge hängt vom
Umfang des nach IFRS 8.23 abgegrenzten Segmentergebnisses bzw. von der Abgrenzung der
Berichtsinformation an das oberste Entscheidungsgremium ab. Hierzu können insbesondere Erträge
aus der Auflösung von Rückstellungen bzw. Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen,
Wertminderungen und Wertaufholungen auf langfristige und kurzfristige Vermögenswerte zählen.
Rz. 78
Die Angabepflicht des IFRS 8.23 i) ist nicht überschneidungsfrei mit der Angabepflicht für alle
wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten i. S. d. IAS 1.97 nach IFRS 8.23 f). Vielmehr sind die
wesentlichen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen[14] im Regelfall eine Teilmenge
der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten. Zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen
i. S. d. IAS 1.97 zählen insbesondere die außerplanmäßigen Abschreibungen der Vorräte oder der
Sachanlagen und der immateriellen Vermögenswerte einschließlich korrespondierender
Haufe Finance Office Professional Online Seite 26
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Werterhöhungen, Erträge und Aufwendungen aus der Restrukturierung von Geschäftsaktivitäten,
Abgang von Vermögenswerten des langfristigen Vermögens und von Finanzinstrumenten, Erträge und
Aufwendungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, Erträge und Aufwendungen aus der Beendigung
von Rechtsstreitigkeiten sowie Erträge und Aufwendungen aus sonstigen Rückstellungsauflösungen.
Ebenso wie die übrigen Angaben zur GuV ist die Angabepflicht des IFRS 8.23 f) davon abhängig, ob
die wesentlichen Erträge und Aufwendungen i. S. d. IAS 1.97 Bestandteil des Segmentergebnisses sind
oder diese dem obersten Entscheidungsgremium regelmäßig zur Verfügung gestellt werden.
Rz. 79
Nach DRS 3.31 b) bb) besteht eine Angabepflicht für die im Segmentergebnis enthaltenen anderen
nicht zahlungswirksamen Posten. Der Begriffsumfang nach DRS 3.31 b) bb) ist wesentlich enger als
nach IFRS 8.23 i), da nach DRS 3.31 b) aa) die Abschreibungen auch die außerplanmäßigen
Abschreibungen einschließen. Dementsprechend handelt es sich bei der Angabepflicht nach DRS 3.31
b) bb) im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Aufwendungen für die
Bildung von Rückstellungen. Auch wenn in DRS 3.31 b) bb) nicht explizit erwähnt, besteht die
Angabepflicht nur für wesentliche Posten; dies ergibt sich unmittelbar aus DRS 3.36.
Die Angabe des DRS 3.31 b) bb) kann entfallen, wenn im Rahmen der Segmentberichterstattung eine
freiwillige Veröffentlichung des Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit erfolgt.[15]
Rz. 80
Beteiligungsergebnis
Nach IFRS 8.23 g) besteht eine Angabepflicht für den Anteil am Periodenergebnis aus Beteiligungen
an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen, soweit diese Beteiligungen nach der
Equity-Methode einbezogen werden. Diese Formulierung schließt nur die jährliche Fortschreibung der
der Equity-Methode unterliegenden Beteiligungen ein, nicht jedoch gegebenenfalls erforderliche
Wertminderungen auf diese Beteiligungen. Zudem werden die anteiligen sonstigen Gesamtergebnisse
, welche auf die at equity bewerteten Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und
Gemeinschaftsunternehmen entfallen, ebenfalls nicht auf die operativen Segmente aufgeteilt.
Das Equity-Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen
je operatives Segment ist allerdings nur dann zu veröffentlichen, wenn entweder das Equity-Ergebnis
Bestandteil des Segmentergebnisses ist oder das Equity-Ergebnis der operativen Segmente dem
obersten Entscheidungsgremium regelmäßig zur Verfügung gestellt wird.
Rz. 81
DRS 3.31 b) cc) und DRS 3.31 b) dd) sehen eine vollständige Zuordnung des Beteiligungsergebnisses
auf die Segmente vor. Hierbei erfolgt eine Unterteilung in
das Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und
die Erträge aus sonstigen Beteiligungen.
Rz. 82
Das Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen beinhaltet im Unterschied zu IFRS 8.23
g) – zumindest nicht ausdrücklich – die Ergebnisse aus Gemeinschaftsunternehmen. Allerdings kann
der Umfang des Ergebnisses aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen auch umfassender als
das Equity-Ergebnis gemäß IFRS 8.23 g) sein, da der Begriff des "Ergebnisses aus Beteiligungen an
assoziierten Beteiligungen" auch außerplanmäßige Abschreibungen bzw. spätere Wertaufholungen –
Haufe Finance Office Professional Online Seite 27
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
unabhängig von Fortschreibungen des Buchwerts – mit einbezieht (beispielsweise Auswirkungen
einer Patronatszusage für assoziierte Unternehmen).
Rz. 83
Die Erträge (besser Ergebnisse) aus sonstigen Beteiligungen schließen dementsprechend Ergebnisse
aus Gemeinschaftsunternehmen ein, die at equity bilanziert wurden, sämtliche Ergebnisse aus
Tochterunternehmen und Gemeinschaftsunternehmen, welche infolge des Vorliegens eines
Konsolidierungsverbots oder Konsolidierungswahlrechts nicht konsolidiert wurden, sowie die
Ergebnisse aller weiteren Beteiligungen, für die weder ein Beherrschungsverhältnis noch gemeinsame
Führung oder wesentlicher Einfluss vorliegen und die zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert
werden.
Ebenso wie bei den Ergebnissen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen sind vom Umfang her
sowohl die laufenden Beteiligungserträge als auch aperiodisch auftretende Ergebniskomponenten
(außerplanmäßige Abschreibungen und Zuschreibungen) in das Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen
einzubeziehen.
Rz. 84
Zinsergebnis und Ertragsteuern
Nach IFRS 8.23 c), IFRS 8.23 d) bzw. IFRS 8.23 h) sind die Zinserträge, Zinsaufwendungen sowie die
Ertragsteuern (saldierter Ausweis von Ertragsteueraufwendungen und -erträgen) im Segmentbericht
offenzulegen, wenn entweder diese Ergebniskomponenten Bestandteil(e) des Segmentergebnisses sind
oder diese Ergebniskomponenten dem obersten Entscheidungsgremium regelmäßig zur Verfügung
gestellt werden.
Die Abgrenzung von Zinserträgen, Zinsaufwendungen und Ertragsteuern ergibt sich aus den
entsprechenden IAS/IFRS-Standards.
Rz. 85
Nach DRS 3.32 bzw. DRS 3.33 sind Zinsertrag und Zinsaufwand im Segmentbericht gesondert
anzugeben, falls als Segmentergebnis entweder das Ergebnis vor Steuern oder das Periodenergebnis
(nach Kommentierung Jahresüberschuss/-fehlbetrag bzw. Konzern-Jahresüberschuss/-fehlbetrag[16])
gewählt wird.
Entscheidet sich das die Segmentberichterstattung aufstellende Unternehmen für die Segmentierung
des Ergebnisses nach Steuern[17] oder des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrags, so sind zusätzlich
noch die Ertragsteuern (ebenfalls Saldierung von Ertragsteueraufwendungen und
Ertragsteuererträgen) auf die Segmente aufzuteilen.
Hinsichtlich des Umfangs der berichtspflichtigen Erträge und Aufwendungen bestehen keine
grundsätzlichen Unterschiede zu IFRS 8.
4.3.1.2 Berichtsgrößen zur Bilanz (HI1849477)
Rz. 86
Segmentvermögen
Haufe Finance Office Professional Online Seite 28
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Sofern das Segmentvermögen intern regelmäßig dem obersten Entscheidungsgremium berichtet wird,
dann ist das Segmentvermögen im Rahmen der externen Segmentberichterstattung nach IFRS 8
anzugeben.[1] Entsprechend dem management approach wird der Umfang des Segmentvermögens in
IFRS 8.26 nicht festgelegt. Vielmehr ist nach IFRS 8.26 Satz 1 in der Segmentberichterstattung das
Segmentvermögen in der Abgrenzung und mit den Bewertungsmaßstäben offenzulegen, wie das
Segmentvermögen auch dem obersten Entscheidungsgremium berichtet wird. Voraussetzung für die
Zuordnung von Vermögenswerten zu den Segmenten bildet neben der synchronen Verfahrensweise in
der internen Finanzberichterstattung die Zuordenbarkeit dieser Vermögenswerte auf einer
vernünftigen Basis.[2]
Grundsätzliche Möglichkeiten der Abgrenzung des Segmentvermögens:
Zuordnung sämtlicher Vermögenswerte, die sich entweder verursachungsgerecht zuordnen
lassen oder auf einer vernünftigen Basis zuordenbar sind. Hierbei kann in der internen
Finanzberichterstattung auch beispielsweise eine Zuordnung solcher immateriellen
Vermögenswerte erfolgen, für welche nicht sämtliche Ansatzvoraussetzungen des IAS 38.57
vorliegen.
Zuordnung nur solcher Vermögenswerte, die sich verursachungsgerecht zuordnen lassen
Zuordnung nur langfristiger Vermögenswerte
Zuordnung nur langfristiger Vermögenswerte (ohne Beteiligungen)
Weiterhin besteht auch die Möglichkeit der Verwendung unterschiedlicher Wertmaßstäbe für die
zugeordneten Vermögenswerte in der internen Finanzberichterstattung (z. B. fortgeführte
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, Zeit- oder Neuwerte, gegebenenfalls mit unterschiedlicher
Aktualisierung der Wertansätze).
Rz. 87
Sofern dem obersten Entscheidungsgremium das Segmentvermögen in verschiedenen Varianten (z. B.
auf Basis historischer Wertansätze oder zu aktuellen Wertansätzen) berichtet wird, so ist nach IFRS
8.26 Satz 2 dasjenige Segmentvermögen extern zu veröffentlichen, welches hinsichtlich der
Segmentbilanzierungs- und Segmentbewertungsmethoden die größte Übereinstimmung mit den im
Einzelabschluss bzw. Konzernabschluss verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
aufweist.[3]
Bei der Abgrenzung und der Bewertung des Segmentvermögens besteht weiterhin kein Erfordernis
einer symmetrischen Zuordnung von Vermögenspositionen und den damit im Zusammenhang
stehenden Aufwendungen und Erträgen.[4]
Rz. 88
Nach DRS 3.31 c) ist das Segmentvermögen einschließlich der Beteiligungen zu segmentieren. Zum
Segmentvermögen zählen sowohl Vermögensgegenstände, die sich verursachungsgerecht auf die
Segmente zuordnen lassen, als auch Vermögensgegenstände, die indirekt aufgrund eines
sachgerechten Schlüssels den Segmenten zuordenbar sind.[5]
Das Segmentvermögen umfasst insbesondere das entweder direkt oder indirekt zuordenbare
Anlagevermögen, die Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, aktive
Rechnungsabgrenzungsposten sowie gegebenenfalls auch zuordenbare Steuerforderungen
einschließlich aktiver latenter Steuern. Die Abgrenzung des Segmentvermögens muss jedoch
hinsichtlich der Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu den Segmenten stets symmetrisch
Haufe Finance Office Professional Online Seite 29
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
erfolgen.[6] So wäre es beispielsweise nicht möglich, das Segmentergebnis auf Basis des
Periodenergebnisses zu veröffentlichen und gleichzeitig nicht die aktiven latenten Steuern und die
Steuerforderungen in das Segmentvermögen einzubeziehen.
Wegen unterschiedlich möglicher Abgrenzungen des Segmentvermögens (beispielsweise im Hinblick
auf die Einbeziehung von Steuerposten) sind die Grundsätze für die Zusammensetzung des
Segmentvermögens sowie etwaiger Aufteilungen gemeinsam genutzter Vermögenswerte nach DRS
3.44 Satz 1 zu erläutern.
Rz. 89
Buchwerte der at equity bewerteten Beteiligungen
Nach IFRS 8.24 a) ist der Beteiligungsbuchwert der nach der Equity-Methode bewerteten
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen im Segmentbericht
nach Segmenten getrennt offenzulegen, falls die Equity-Buchwerte entweder Bestandteile des
Segmentvermögens sind oder die Equity-Buchwerte nach Segmenten intern den
Entscheidungsträgern regelmäßig bereitgestellt werden.
Rz. 90
Nach DRS 3 gibt es keine äquivalente Offenlegungspflicht; die Equity-Buchwerte von assoziierten
Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen sind vielmehr Bestandteil des Segmentvermögens.
Rz. 91
Segmentschulden
Nach IFRS 8.23 Satz 2 sind die Segmentschulden in den extern veröffentlichten Segmentbericht
aufzunehmen, falls die Segmentschulden intern regelmäßig dem obersten Entscheidungsgremium
berichtet werden. Ebenso wie die Berichterstattung über das Segmentvermögen[7] sind gemäß IFRS
8.26 Satz 1 die Segmentschulden in der Abgrenzung und mit den Wertansätzen offenzulegen, wie die
Segmentschulden intern auch dem obersten Entscheidungsgremium berichtet werden. Sofern die
Berichterstattung über die Segmentschulden in verschiedenen Abgrenzungen und nach
unterschiedlichen Wertmaßstäben erfolgt, sind im externen Segmentbericht die Segmentschulden in
der Abgrenzung und nach den Wertansätzen zu berichten, sodass diese die größtmögliche
Übereinstimmung mit den im Einzel- bzw. Konzernabschluss verwendeten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden aufweisen.[8]
Rz. 92
Segmentschulden sind nach DRS 3.8 Schulden, die einem Segment direkt zugeordnet oder nach einem
sachgerechten Schlüssel den Segmenten zugerechnet werden können.
Bei der Zuordnung von Schulden zu Segmenten ist – wie beim Vermögen – das Erfordernis der
symmetrischen Zuordnung zu beachten. Dementsprechend sind Finanzschulden nur dann Bestandteil
der Segmentschulden, wenn auch die korrespondierenden Zinsaufwendungen in das Segmentergebnis
eingeflossen sind.[9] Ebenso schließen die Segmentschulden auch passive latente Steuern oder
Steuerverbindlichkeiten ein, sofern das Periodenergebnis oder das Ergebnis nach Steuern[10] in der
Segmentberichterstattung segmentiert wird.
Haufe Finance Office Professional Online Seite 30
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Zu den unstrittig den Segmenten zuzurechnenden Schulden zählen Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen und im Regelfall auch Garantierückstellungen und mitarbeiterbezogene
Rückstellungen.
4.3.1.3 Berichtsgrößen zur Kapitalflussrechnung (HI1849481)
Rz. 93
IFRS 8 schreibt als einzige Berichtsgröße, die sich unmittelbar auf die Kapitalflussrechnung bezieht,
die Angabe der Investitionen in das langfristige Vermögen (ohne aktive latente Steuern,
Finanzinstrumente, Vermögenswerte aus leistungsorientierten Versorgungsplänen und aus
Versicherungsverträgen entstehende Rechte) vor. Eine Berichterstattung ist jedoch nur
vorgeschrieben, wenn die zugehörigen Vermögenswerte im Segmentvermögen enthalten sind
(Regelfall)[1] oder die Investitionen in das langfristige Vermögen dem obersten
Entscheidungsgremium regelmäßig berichtet werden.[2]
Es sind stets die Zugänge in das langfristige Vermögen zu berichten, d. h., nicht zahlungswirksame
Transaktionen (z. B. Einlage von Grundstücken gegen Gewährung von Gesellschaftsanteilen) werden
ebenfalls von dieser Angabe grundsätzlich erfasst.
Bei den Investitionen handelt es sich weiterhin immer um eine Bruttogröße, d. h., Abschreibungen
oder gegebenenfalls erforderliche Wertminderungen sind nicht abzusetzen.
Rz. 94
Auch wenn IFRS 8 keine Empfehlung für die Segmentierung des Cashflows aus der betrieblichen
Tätigkeit ausspricht, kann jedoch diese Größe auch näherungsweise als Summe aus Segmentergebnis,
Abschreibungen sowie wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen
approximiert werden. Hierbei ist zwar der nach dem management approach unterschiedliche Umfang
des Segmentergebnisses zu berücksichtigen; jedoch sind gegebenenfalls im Segmentergebnis
enthaltene Zinsaufwendungen und -erträge sowie Ertragsteueraufwendungen und -erträge durch die
ebenfalls dann erforderliche Segmentierung identifizierbar und können damit auch grundsätzlich
eliminiert werden.[3]
Rz. 95
Nach DRS 3.31 d) sind Segmentinvestitionen in das langfristige Vermögen in der
Segmentberichterstattung offenzulegen. Trotz fehlender Definition des "langfristigen Vermögens" in
DRS 3 bzw. im HGB wird man entsprechend der handelsrechtlichen Abgrenzung einen Zugang zum
Anlagevermögen annehmen können; dabei ist im Zeitraum der Anschaffung von einer beabsichtigten
Nutzung von einem Jahr oder länger auszugehen.[4] Das langfristige Vermögen umfasst im
Unterschied zu der offenlegungspflichtigen Größe nach IFRS 8.24 b) stets auch Ausleihungen und
Wertpapiere des Anlagevermögens.[5]
Da der Begriff der Investitionen in DRS 3.31 d) nicht näher präzisiert wird, bleibt offen, ob Brutto-
oder Nettoinvestitionen zu berichten und ob nicht zahlungswirksame Anschaffungen zu
berücksichtigen sind. Die herrschende Meinung nimmt in Anlehnung an IFRS 8 und SFAS 131 an, dass
der Ausweis von Investitionen nach DRS 3.31 die Angabe von Bruttogrößen verlangt.[6]
Rz. 96
Haufe Finance Office Professional Online Seite 31
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
DRS 3.36 empfiehlt den eine Segmentberichterstattung aufstellenden Unternehmen bzw. Konzernen
die Angabe des Segment-Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit.
Sofern der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit offengelegt wird, darf in der
Segmentberichterstattung auf die segmentspezifische Angabe der Abschreibungen und der
wesentlichen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen verzichtet werden. DRS 3.36
enthält keine Abgrenzung des Segment-Cashflows; vielmehr ist dieser unternehmensspezifisch
abzugrenzen.
Sofern keine freiwillige Offenlegung der Segment-Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit erfolgt,
kann der Segment-Cashflow ebenso wie in der Berichterstattung nach IFRS 8 näherungsweise aus
Segmentergebnis, Abschreibungen und wesentlichen nicht zahlungswirksamen Erträgen und
Aufwendungen geschätzt werden. Hinsichtlich der Bereinigung des Segmentergebnisses um
Zinserträge und -aufwendungen sowie Ertragsteueraufwendungen und -erträge gilt grundsätzlich
das Gleiche wie bei IFRS 8.[7] Zusätzlich muss bei einer Ermittlung des Cashflows aus laufender
Geschäftstätigkeit auch das Segmentergebnis um die im Segmentergebnis nach DRS 3.31 b) cc) und
DRS 3.31 b) dd) enthaltenen Beteiligungsergebnisse bereinigt werden.
4.3.2 Überleitungsrechnungen (HI1849482)
Rz. 97
Sowohl nach IFRS 8 als auch nach DRS 3 sind für die Angaben zu den operativen Segmenten
Überleitungsrechnungen erforderlich. Diese Überleitungsrechnungen dienen dem Zweck der
Herstellung einer Verbindung zwischen den aufgeteilten Daten des Segmentberichts und den
zusammengefassten Daten aus dem Einzel-/Jahresabschluss bzw. Konzernabschluss. Im Einzelnen
sind sowohl bei IFRS 8 als auch DRS 3 folgende im Segmentbericht aufgeteilte Größen überzuleiten:
Segmenterlöse,
Segmentergebnis,
Segmentvermögen,
Segmentschulden (bei IFRS 8 nur dann, wenn die Segmentschulden intern dem obersten
Entscheidungsgremium regelmäßig berichtet werden) und
andere wesentliche Segmentgrößen.
Rz. 98
Bei den Überleitungsrechnungen sind sowohl nach IFRS 8 als auch nach DRS 3 alle wichtigen
Überleitungsposten separat zu identifizieren und zu beschreiben.
Rz. 99
Segmentdaten aller nicht berichtspflichtigen Segmente sind nach IFRS 8 gesondert in einem
Überleitungsposten "all other" anzugeben.[1] Zudem sind Konsolidierungseffekte und gegebenenfalls
rechnungsbedingte Differenzbeträge aufgrund kalkulatorischer Anpassungen zu eliminieren.[2]
Rz. 100
Obwohl bei DRS 3 eine Zusammenfassung der Segmentdaten aller nicht berichtspflichtigen Segmente
unter einen Sammelposten "übrige nicht angabepflichtige Segmente" nicht explizit vorgeschrieben
ist, dürfte es sich jedoch um eine ebenfalls sinnvolle und dem Gebot der Angabe und Erläuterung
wesentlicher Überleitungsposten entsprechende Lösung handeln.
Haufe Finance Office Professional Online Seite 32
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Eine Zusammenfassung sämtlicher "sonstigen Segmente" mit den anderen Überleitungsposten zu
einem Differenzposten ist nicht zulässig.[3]
Neben dem Sammelposten "übrige nicht angabepflichtige Segmente" sind die
Konsolidierungsvorgänge in jedem Fall getrennt auszuweisen, da sie die Austauschbeziehungen
zwischen den Segmenten transparent machen. Als weiterer Überleitungsposten können weitere
Sachverhalte, insbesondere nicht durch Schlüsselung verteilbare Segmentpositionen, hinzutreten.[4]
4.3.3 Sonstige Angaben zu operativen Segmenten (HI1849483)
Rz. 101
Darüber hinaus fordern sowohl IFRS 8 als auch DRS 3 neben der quantitativen Überleitungsrechnung
noch zusätzliche erläuternde Angaben.
Rz. 102
Diese betreffen bei IFRS 8 die folgenden Mindestangaben:[1]
1. Allgemeine Erläuterungspflichten über die operativen Segmente nach IFRS 8.21 a) i. V. m. IFRS
8.22.
2. Angaben über die Bilanzierungs- und Bewertungsmaßstäbe auf Ebene der operativen Segmente.
Rz. 103
Zu den allgemeinen Erläuterungspflichten zählen nach IFRS 8.22:
verbale Ausführungen zu den Bestimmungsfaktoren der Segmentabgrenzung einschließlich
der Beschreibung der internen Organisationsstruktur sowie der Angabe, ob Segmente
zusammengefasst wurden.
Darstellung der Produkte und Dienstleistungen, mit denen die operativen Segmente ihre
Erträge erzielen.
Die allgemeinen Erläuterungspflichten dienen in erster Linie der Veranschaulichung der internen
Organisations- und Berichtsstruktur sowie der Darstellung der vom obersten Entscheidungsgremium
konkret gewählten Ausgestaltung des management approachs.[2]
Rz. 104
Die Angaben über die Bilanzierungs- und Bewertungsmaßstäbe auf Ebene der operativen Segmente
beziehen sich auf folgende Mindestangaben:[3]
Grundlagen der Bilanzierung und Bewertung von Transaktionen zwischen Segmenten
einschließlich der Grundlage der Verrechnungspreisbildung,
Unterschiede zwischen den in der Segmentberichterstattung verwendeten
Segmentbilanzierungs- und Segmentbewertungsmethoden gegenüber den im
Jahresabschluss bzw. Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden (sofern nicht aus der Überleitungsrechnung nach IFRS 8.28 b), IFRS
8.28 c) und IFRS 8.28 d) ersichtlich),
Erläuterungen eines Wechsels bei den Segmentbilanzierungs- und
Segmentbewertungsmethoden, einschließlich der Grundsätze der Zuordnung von
gemeinschaftlichen Vermögenswerten und Aufwendungen und Erträgen auf die Segmente,
Haufe Finance Office Professional Online Seite 33
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Erläuterungen eines Wechsels der erfolgsbezogenen Segmentbilanzierungs- und
Segmentbewertungsmethoden sowie Angabe des Effekts aus einer Änderung der
erfolgsbezogenen Segmentbilanzierungs- und Segmentbewertungsmethoden auf das
Segmentergebnis,
Angaben zu Art und Auswirkungen asymmetrischer Aufteilungen einzelner Segmentdaten,
insbesondere von Vermögen und korrespondierenden Aufwendungen.
Insbesondere die Angaben des IFRS 8.28 b) –IFRS 8.28 f) sind Ausfluss der vergleichsweise
konsequenten Umsetzung des management approachs in IFRS 8.
Rz. 105
Ebenso wie IFRS 8 fordert auch DRS 3 allgemeine Angaben zur Beschreibung des Segments sowie
Angaben zu den Bewertungsmaßstäben. Im Einzelnen erstreckt sich die Berichterstattungspflicht über
die allgemeinen Angaben auf folgende Aspekte:[4]
Beschreibung der Segmente und Bestimmungsfaktoren der Segmentabgrenzung, die näher
zu erläutern sind. Die Beschreibung beinhaltet u. a. die zuordenbaren Produkte oder
Dienstleistungen, die Tätigkeiten oder die geographische Zusammensetzung des Segments.
Hierbei sind die Bestimmungsfaktoren der Abgrenzungen und die Zusammenfassung der
operativen Segmente zu erläutern.[5]
Zusammenfassung heterogener Segmente, sofern ausnahmsweise Geschäftsfelder mit
unterschiedlichen Chancen und Risiken zusammengefasst worden sind. In diesem Fall ist
neben der Angabe noch eine Erläuterung erforderlich.[6]
Angabe der Produkte und Dienstleistungen für jedes anzugebende Segment,[7] falls keine
produktorientierte Abgrenzung der Segmente erfolgt.[8]
Rz. 106
Da die Segmentbilanzierungs- und Segmentbewertungsmethoden nach DRS 3.19 den im externen
Jahresabschluss bzw. Konzernabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
entsprechen müssen, bestehen hinsichtlich der Bewertungsmaßstäbe nach DRS 3 deutlich weniger
Offenlegungsvorschriften als nach IFRS 8.[9] Im Einzelnen sind anzugeben:
die Ermittlung der Segmentdaten und die Ergebnisdefinition, deren Zusammensetzung und
im Falle von Positionen, die zu mehreren Segmenten gehören, die Grundsätze für die
Zurechnung bzw. Aufteilung auf die Segmente[10] und
die Grundsätze der Bildung von Verrechnungspreisen.[11]
4.4 Sonstige Angabepflichten (HI1849484)
Rz. 107
Ergänzend zu den Berichtsangaben für die operativen Segmente schreiben sowohl IFRS 8 als auch DRS
3 weitere Erläuterungen vor. Diese Erläuterungen beziehen sich zum einen auf segmentspezifische
produktorientierte, geographische und kundenbezogene Angabepflichten. Diese Angabepflichten sind
auch dann zu erfüllen, wenn es sich bei dem Unternehmen um ein Einsegmentunternehmen handelt,
welches keine operativen Segmente hat.
4.4.1 Produktorientierte Angaben (HI1849485)
Haufe Finance Office Professional Online Seite 34
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Rz. 108
Nach IFRS 8.32 sind die Segmenterlöse mit unternehmensexternen Kunden für einzelne Produkte und
Dienstleistungen bzw. homogene Produktgruppen und Dienstleistungsbereiche zu nennen. Diese
Angabepflicht kann jedoch unterbleiben, falls die erforderlichen Informationen nicht verfügbar sind
oder die Kosten für die Informationsbereitstellung übermäßig hoch wären. Im Falle der
Nichtdurchführbarkeit der Angabe ist ein gesonderter Hinweis erforderlich.
Rz. 109
DRS 3.38 Satz 1 fordert für den Fall nicht produktorientiert abgegrenzter Segmente die Angabe der
Umsatzerlöse nach Produkt- bzw. Dienstleistungsgruppen. Diese Angabepflicht, die nur bei nicht
produktorientierter Abgrenzung zu erfüllen ist, entspricht im Wesentlichen dem Inhalt von IFRS 8.32.
Darüber hinaus verlangt jedoch DRS 3.38 Satz 2 ebenfalls bei nicht produktorientierter Abgrenzung
der Segmente die Angabe des Segmentvermögens und der Segmentinvestitionen nach Produkt- bzw.
Dienstleistungsgruppen.
4.4.2 Geographische Angaben (HI1849486)
Rz. 110
Für geographische Segmente sind nach IFRS 8.33 folgende Informationen erforderlich:
Segmenterlöse mit Externen: Hierbei ist zumindest zwischen Inlands- und
Auslandsumsätzen zu unterscheiden. Darüber hinaus sind betragsmäßig bedeutsame Staaten
jeweils separat unter Angabe der Segmenterlöse anzugeben. Weiterhin ist darzulegen, nach
welchen Prinzipien die Zuordnung von Segmenterlösen auf die geographischen Regionen
erfolgt (Zuordnung nach dem Sitz der Gesellschaft oder nach dem Sitz der Kunden).
Langfristiges Segmentvermögen ohne Finanzinstrumente, latente Steuern, Vermögenswerte
für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses und aus Versicherungsverträgen
entstehende Rechte: Das so abgegrenzte langfristige Segmentvermögen ist zunächst nach
dem Standort der Vermögenswerte auf Inland und Ausland aufzuteilen. Befinden sich in
einzelnen Staaten wesentliche Vermögenswerte, so sind diese Staaten mit den Werten für
das langfristige Vermögen anzugeben.
Sofern die Informationen nicht verfügbar oder nicht zu vertretbaren Kosten beschaffbar sind, ist diese
Tatsache anzugeben.
Rz. 111
Wurden in der Segmentberichterstattung nach DRS 3 die anzugebenden operativen Segmente nicht
geographisch abgegrenzt, sind nach DRS 3.39 folgende geographischen Informationen nach Regionen
offenzulegen:
Umsatzerlöse (mit Externen)[1] nach dem Standort der Kunden,
Segmentvermögen, abgegrenzt nach dem Standort der Vermögenswerte,
Investitionen in langfristiges Vermögen, ebenfalls abgegrenzt nach dem Standort der
Vermögenswerte
für sämtliche unternehmensrelevante geographische Regionen. Als unternehmensrelevant gilt nach
DRS 3.40 dabei eine geographische Region, wenn in dieser mindestens 10 % der Umsatzerlöse des
Unternehmens bzw. Konzerns erzielt werden oder in dieser mehr als 10 % des Unternehmens- bzw.
Konzernvermögens belegen ist.
Haufe Finance Office Professional Online Seite 35
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
4.4.3 Angabe der Existenz und Bedeutung von Großkunden (HI1849487)
Rz. 112
IFRS 8.34 verlangt die Angabe von Umsätzen mit Kunden, mit denen die berichtende Einheit
mindestens 10 % der aggregierten Umsätze (major customers) tätigt. Weiterhin ist anzugeben, welche
(operativen) Segmente von Umsätzen mit diesen major customers betroffen sind, nicht jedoch die
Identität des Kunden.
Unternehmen eines Konzerns werden für die Frage der Identifizierung von Großkunden als eine
wirtschaftliche Einheit betrachtet.
Rz. 113
Übersteigen die Umsatzerlöse mit einem externen Kunden 10 % der gesamten externen und
intersegmentären Außenumsatzerlöse, sind zumindest die Größenordnung (nicht exakter Betrag!)
sowie die betroffenen Segmente anzugeben.[1]
Ebenso wie bei IFRS 8.34 gelten Konzernunternehmen als ein Kunde und es wird ebenfalls nicht die
Angabe des Großkunden gefordert.
4.5 Generierung von Berichtsgrößen aus dem internen Berichtswesen
(Exkurs) (HI1849488)
Rz. 114
Die in der Segmentberichterstattung offenzulegenden Berichtsgrößen lassen sich unmittelbar aus der
der internen Finanzberichterstattung vorgeschalteten Kosten- und Leistungsrechnung oder in
Einzelfällen bereits direkt aus der Finanzbuchhaltung generieren. Im Folgenden werden typische
Möglichkeiten der Generierung aufgeführt:
Rz. 115
Für die Aufteilung der Segmenterlöse sind entweder in der Finanzbuchhaltung oder in der Kosten-
und Leistungsrechnung die Möglichkeiten für eine Mehrfachauswertung der Umsatzerlöse nach
verschiedenen Selektionskriterien zu schaffen. Die Zuordnung der Umsatzerlöse einschließlich der
Transfers innerhalb des Unternehmens bzw. Konzerns hat zunächst zu den verschiedenen operativen
Segmenten zu erfolgen.
Hierfür ist bereits auf Ebene der Datenerfassung eine entsprechende Zuordnung von
Umsatzvorgängen zu den operativen Segmenten vorzunehmen. Beispielsweise wird bei einer
produktorientierten Abgrenzung der operativen Segmente eine Zuordnung der einzelnen Produkte
bzw. Dienstleistungen zu Produktgruppen bzw. Dienstleistungsbereichen und weiter zu operativen
Segmenten erfolgen ("Produktbäume" bzw. "Dienstleistungsbäume").
Darüber hinaus müssen Umsätze – sowohl nach IFRS 8 als auch nach DRS 3 – nach geographischen
Regionen aufgeteilt werden. Sofern die geographische Aufteilung nach dem Sitz der Gesellschaften
erfolgt, müssen lediglich die konsolidierten Umsätze der Gesellschaften nach Ländern aggregiert
werden. Erfolgt jedoch die Aufteilung nach dem Standort der Kunden,[1] so sind die externen Umsätze
nach dem Sitzland der Kunden zu verdichten (die Information über das Sitzland der Kunden wird
dabei im Regelfall über die Auswertung des Kundenkontokorrents gewonnen).
Haufe Finance Office Professional Online Seite 36
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Ebenfalls über die Auswertung des Kundenkontokorrents ist der Segmenterlös nach Kunden zu
ermitteln, aus der sich die Angabe über Existenz und Bedeutung von Großkunden ableitet.
Rz. 116
Das Segmentergebnis leitet sich aus der Kostenträgerzeitrechnung oder Ergebnisrechnung als
periodische Gegenüberstellung von Leistungen und Kosten in einer Periode ab. Im Falle einer
produktorientierten Abgrenzung der Segmente werden dabei die Ergebnisse der Produkte bzw.
Produktgruppen über entsprechende Produktzuordnungen (analog den Segmenterlösen) den
operativen Segmenten zugeordnet.
Da nach IFRS 8 in der externen Segmentberichterstattung keine anderen Segmentbilanzierungs- und
Segmentbewertungsmethoden für die Ermittlung des Segmentergebnisses als in der internen
Finanzberichterstattung angewendet werden, ist keine Umbewertung auf externe Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze erforderlich. Ebenfalls entfällt eine abweichende Abgrenzung der in der
Segmentberichterstattung offen zu legenden Berichtspositionen von den in der internen
Finanzberichterstattung enthaltenen.
Da bei DRS 3 die in der Segmentberichterstattung angewendeten Segmentbilanzierungs- und
Segmentbewertungsmethoden den im externen Jahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden entsprechen müssen, ist es hier zwingend erforderlich, dass im internen
Rechnungswesen auf den gesonderten Ausweis von kalkulatorischen Kosten- und
Leistungsbestandteilen geachtet wird und in einer "Brückenrechnung" für sämtliche operativen
Segmente die im internen Segmentergebnis enthaltenen kalkulatorischen Kosten- und
Leistungsbestandteile durch pagatorische Aufwendungen und Erträge ersetzt werden (können).
Zudem muss im Falle eines unterschiedlichen Umfangs von Berichtspositionen in der internen
Finanzberichterstattung und dem externen Jahres-/Konzernabschluss auf die Ableitbarkeit der
entsprechenden Überleitungspositionen geachtet werden.
Rz. 117
Sämtliche sich auf das Segmentergebnis beziehenden Angabepflichten (Abschreibungen,
Wertminderungen und Wertaufholungen, wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen,
außergewöhnliche Posten im Sinne des IAS 1.97, Beteiligungsergebnis, einschließlich Equity-Ergebnis,
Zinserträge und -aufwendungen, Ertragsteuern) können ebenfalls, sofern diese in der Kosten- und
Leistungsrechnung verarbeitet werden bzw. Bestandteil des Segmentergebnisses sind, über die
Betriebsergebnisrechnung (als Vorstufe oder Element der internen Finanzberichterstattung) abgeleitet
werden. Einzige Voraussetzung ist hier, dass bereits in der Kostenartenrechnung auf den gesonderten
Ausweis der oben genannten Ergebnisrechnungspositionen geachtet wird. Ebenso wie beim
Segmentergebnis sind die einzelnen – im Betriebsergebnis – separat ausgewiesenen
Ergebnisrechnungspositionen auf die entsprechenden operativen Segmente zu verdichten.
Im Falle der Segmentberichterstattung nach DRS 3 ist wie beim Segmentergebnis darauf zu achten,
dass im Fall der Verwendung kalkulatorischer Größen für die einzelnen Berichtspositionen diese
zwecks Aufstellung des externen Segmentberichts durch entsprechende pagatorische Größen ersetzt
werden (können).
Rz. 118
Die Buchwerte des Segmentvermögens erhält man im Regelfall durch die Aufzeichnung des
operativen Vermögens auf den Kostenstellen. Durch Hinterlegung der Zugehörigkeit jeder Kostenstelle
sowohl zu genau einem operativen Segment als auch zu einer Region schafft man die
organisatorischen Voraussetzungen für die Aufteilung des Segmentvermögens nach operativen
Haufe Finance Office Professional Online Seite 37
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Segmenten und nach geographischen Regionen. Darüber hinaus fordert DRS 3.38 Satz 2 ebenfalls bei
nicht produktorientierter Abgrenzung der Segmente die Angabe des Segmentvermögens und der
Segmentinvestitionen nach Produkt- bzw. Dienstleistungsgruppen,[2] sodass gegebenenfalls noch
eine Zuordnung der Kostenstellen zu Produkt- bzw. Dienstleistungsbereichen erforderlich ist.
Während bei IFRS 8 weder bei abweichendem Umfang des intern abgegrenzten Segmentvermögens
(z. B. Einbeziehung auch selbst erstellter immaterieller Vermögenswerte, für die nicht die
Aktivierungsvoraussetzungen nach IAS 38.57 vorliegen, in das intern berichtete Segmentvermögen)
noch bei abweichender Bewertung die in der internen Finanzberichterstattung vorhandenen Werte für
die Aufstellung des externen Segmentberichts korrigiert werden müssen, sind nach DRS 3
gegebenenfalls beim operativen Vermögen verwendete kalkulatorische Vermögensabgrenzungen und
Wertansätze durch pagatorische Bilanz- und Bewertungsansätze zu ersetzen. Somit ist, wie unter
Rz. 116 und Rz. 117 dargestellt, auch beim Segmentvermögen darauf zu achten, dass im Falle eines
Abweichens zwischen dem kalkulatorischen und dem pagatorischen Segmentvermögen sämtliche
diesbezüglichen Unterschiede sich identifizieren und für die Erstellung des externen Segmentberichts
auch eliminieren lassen.
Rz. 119
Investitionen in das langfristige Segmentvermögen (ohne aktive latente Steuern, Finanzinstrumente,
Vermögenswerte aus leistungsorientierten Versorgungsplänen und ohne aus Versicherungsverträgen
entstehende Rechte) lassen sich ebenfalls nach operativen Segmenten und Regionen (Standort der
Vermögenswerte) bestimmen, indem bereits in der Finanzbuchhaltung über die Mitgabe der
beschaffenden Kostenstelle (Zuordnung der Kostenstelle zu genau einem operativen Segment und zu
genau einer Region) in der Buchung die Zugehörigkeit zu einem bestimmten operativen Segment und
zu einer bestimmten geographischen Region dokumentiert wird.
Rz. 120
Die höchsten Anforderungen an das Rechnungswesen stellen die Segmentschulden, da je nach Art der
aufzuteilenden Schulden das Controlling, die Kostenrechnung und/oder die Finanzbuchhaltung stärker
heranzuziehen sind.[3] Beispielsweise erfolgt die Aufteilung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sowie einschließlich aus Investitionsvorgängen durch Mitgabe der
Kostenstelleninformation in der Buchung. Dagegen können die nach Segmenten aufgegliederten
Garantierückstellungen nur aus unternehmensinternen Unterlagen generiert werden. Ausgangspunkt
hierfür bildet die produkt- bzw. produktgruppenspezifische Erfassung der
Eintrittswahrscheinlichkeit der Garantieverpflichtung. Diese Wahrscheinlichkeitswerte können
durch das Qualitäts-Controlling im Rahmen der Überwachung der Leistungsqualität der vom
Unternehmen vertriebenen Produkte und Dienstleistungen erhoben werden.
Rz. 121
Falls das Equity-Ergebnis und die Equity-Buchwerte der Segmente nicht im Rahmen der Aufteilung
des Segmentergebnisses bzw. des Segmentvermögens erfasst werden, liegt die funktionale
Zuständigkeit für die Aufteilung des Equity-Ergebnisses und der Equity-Buchwerte auf die Segmente
entweder bei der Finanzbuchhaltung oder bei einer eigenständigen Einheit "Beteiligungs-Controlling
", welche die Beteiligungsbewertung durchführt und auch die Aufteilung auf die operativen Segmente
(im Regelfall eindeutige Zuordnung oder Schlüsselung mit Ergebnis- oder Vermögenskennzahlen)
vornehmen kann.
4.6 Sonderfragen der Segmentberichterstattung (HI1849489)
Haufe Finance Office Professional Online Seite 38
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
4.6.1 Änderung von Segmenten und Segmentinformationen (HI1849490)
Rz. 122
Grundsätzlich hat die Segmentabgrenzung sowie die Darstellung der Segmentdaten sowohl bei IFRS 8
als auch DRS 3 stetig zu erfolgen, da andernfalls eine sachgerechte Beurteilung im Zeitverlauf nicht
möglich ist. Stetigkeitsdurchbrechungen können demnach hinsichtlich folgender Aspekte vorliegen:
Änderung der Segmentabgrenzung wegen erstmaliger Erreichung bzw. erstmaliger
Nichterfüllung der Größenkriterien für berichtspflichtige operative Segmente,[1]
Änderung der Segmentbildung wegen neuer Abgrenzung der operativen Segmente durch
Abbildung neuer Strukturen in der internen Finanzberichterstattung,
Änderung des Inhalts der Segmentinformationen (insbesondere inhaltliche Definition des
Segmentergebnisses, Segmentvermögens oder der Segmentschulden).[2]
Rz. 123
Falls die berichtende Einheit ihre interne Struktur ändert und die Zusammensetzung oder die
Abgrenzung der operativen Segmente verändert wird oder der inhaltliche Umfang von Segmentdaten
sich ändert,[3] ist gemäß IFRS 8.29 die in der Vergangenheit offengelegte Information entsprechend
der neuen Berichtsstruktur anzupassen, ausgenommen diese Information ist nicht verfügbar oder
nicht zu vertretbaren Kosten beschaffbar. Da der Vergleichbarkeit ein hoher Stellenwert für die
Informationsvermittlung an die Abschlussadressaten eingeräumt wird, ist die Beurteilung der
Nichtverfügbarkeit bzw. Nichtbeschaffbarkeit von Informationen für jede Information einzeln zu
treffen.[4] Darüber hinaus hat die berichtende Einheit die Tatsache offenzulegen, dass die
Zusammensetzung, die Abgrenzung der operativen Segmente oder der inhaltliche Umfang der
Segmentdaten verändert wurde.[5]
Für den Fall, dass bei einer Änderung der internen Struktur oder der inhaltlichen Definition von
Segmentdaten kein restatement der bislang veröffentlichten Information der Vergangenheitsperiode
stattfindet, hat die berichtende Einheit in dem Jahr, in dem die Änderung der internen Struktur
stattfindet, die Segmentinformationen der aktuellen Periode grundsätzlich sowohl auf Basis der alten
als auch der neuen Segmentierung bzw. der alten und neuen inhaltlichen Definition der Segmentdaten
zu berichten.[6] Hierdurch soll zumindest eine Vergleichbarkeit auf Basis der früher angewendeten
Segmentierung bzw. der früher angewendeten inhaltlichen Abgrenzung der Segmentdaten erreicht
werden.
Rz. 124
Nach DRS 3 ist eine Durchbrechung der Stetigkeit nur in Ausnahmefällen möglich. Die Durchbrechung
der Stetigkeit ist zu begründen und die Posten des Vorjahres sind entsprechend anzupassen.[7]
Allerdings wird in der Literatur es bereits als ausreichend für die Durchbrechung der Stetigkeit
angesehen, wenn die gesamte Geschäftsführung oder auch allein der Finanzvorstand ausgewechselt
wird.[8] Letztlich muss jedoch die Durchbrechung der Stetigkeit in einer Änderung der
Berichtsstruktur begründet liegen. Dies kann neben dem Wechsel des Führungspersonals vor allem
auch in entsprechenden Entscheidungen des obersten Führungsgremiums begründet sein, unabhängig
aus welchen Ursachen heraus diese Entscheidungen getroffen werden.
Für den Sonderfall des Wegfalls eines Segments (z. B. aufgrund von Veräußerung oder Stilllegung)
sind die Beträge des Berichtszeitraums und des Vorjahres anzugeben. Zusätzlich ist auf den Wegfall
gesondert hinzuweisen.[9]
Haufe Finance Office Professional Online Seite 39
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
4.6.2 Zwischenberichterstattung (HI1849491)
Rz. 125
Die IFRS-Rechnungslegung schreibt explizit keine Zwischenberichterstattung vor, sondern verweist
hierzu auf die national geltenden Regeln. Sofern jedoch die nationalen Regeln die Veröffentlichung
von Zwischenberichten nach Maßgabe der IFRS vorschreiben, sind die Regeln des IAS 34 anzuwenden.
Nach deutschem Recht sind gemäß § 37w WpHG i. V. m. § 37y WpHG Unternehmen, die als
Inlandsemittenten Aktien oder Schuldtitel i. S. d. § 2 Abs. 1 WpHG begeben, verpflichtet, einen
Halbjahresbericht zu veröffentlichen.[1]
Rz. 126
Nach IAS 34.16 g) wird die Angabe der folgenden Segmentinformationen nur gefordert, wenn die
berichtende Einheit zur Angabe von Segmentdaten im Konzern- bzw. Jahres-/Einzelabschluss
verpflichtet ist. Im Einzelnen sind folgende Informationen im Zwischenbericht anzugeben:
Segmenterlöse von externen Kunden[2],
intersegmentäre Segmenterlöse171,
Segmentergebnis,
Segmentvermögen[3], sofern eine wesentliche Änderung zum letzten Konzern- bzw. Jahres-
/Einzelabschluss vorliegt,
Angabe und Beschreibung wesentlicher Veränderungen in der Zusammensetzung der
operativen Segmente und der zur Ermittlung des Segmentergebnisses herangezogenen
Segmentbilanzierungs- und Segmentbewertungsmethoden und
Abstimmungsrechnung zwischen der Summe der Segmentergebnisse und dem in der GuV
des Zwischenabschlusses ausgewiesenen Ergebnis vor Steuern und vor aufgegebenen
Geschäftsbereichen bzw. – bei Zuordnung der Ertragsteuern zu den Segmenten – zum
entsprechenden Ergebnis nach Steuern.
Rz. 127
Nach dem DRS 16 "Zwischenberichterstattung", der für alle Unternehmen gilt, die
gemäß WpHG zur Halbjahresfinanzberichterstattung oder zur Zwischenmitteilung der
Geschäftsführung verpflichtet sind und
Mutterunternehmen sind, die gesetzlich zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und
eines Konzernabschlusses verpflichtet sind[4],
besteht der Zwischenabschluss nur aus einer verkürzten Bilanz zum Stichtag des Berichtszeitraums,
einer verkürzten GuV-Rechnung für den Berichtszeitraum, einschließlich der korrespondierenden
Rechnungslegungsinstrumente zum jeweiligen Vorjahresstichtag bzw. für den jeweiligen Vorjahres-
Berichtszeitraum und einem verkürzten Anhang.[5] Eine Verpflichtung zur Segmentberichterstattung
bzw. zur Offenlegung bestimmter Segmentinformationen ist nicht vorgeschrieben.
5 Segmentberichterstattung aus Sicht der Abschlussanalyse (HI1849492)
5.1 Bedeutung der methodischen Festlegungen für die Abschlussanalyse (
HI1849493)
Haufe Finance Office Professional Online Seite 40
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Rz. 128
Die methodischen Festlegungen, welche die unterschiedlichen Segmentberichterstattungskonzepte
vornehmen, haben einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Aussagekraft der in einer
Abschlussanalyse gewonnenen Erkenntnisse. Daher sind die abgeleiteten Kennzahlenwerte stets vor
dem Spiegel des jeweils verwendeten Konzepts der Segmentberichterstattung zu betrachten.
Rz. 129
Bei den methodischen Festlegungen, welche Auswirkungen auf die Abschlussanalyse haben, sind
insbesondere zu nennen:
Entscheidung zwischen ein- und mehrdimensionaler Segmentierung,
Entscheidung zwischen management approach und risks and rewards approach (sowohl
hinsichtlich der Segmentabgrenzung, der Verdichtung von Segmenten zu berichtspflichtigen
Segmenten und hinsichtlich der Segmentbilanzierungs- und Segmentbewertungsmethoden),
Entscheidung zwischen Autonomie- und Disaggregationsansatz.
Die gegenwärtig in der IFRS- und DRS-Rechnungslegung (sowie auch in der US-GAAP-
Rechnungslegung) bestehenden Konzepte zur Segmentberichterstattung weisen nur hinsichtlich der
Ausgestaltung des 2. Kriteriums Unterschiede auf. Hierbei kann nochmals zwischen der Abgrenzung
der Segmente, der Verdichtung zu berichtspflichtigen Segmenten und den Segmentbilanzierungs- und
Segmentbewertungsmethoden unterschieden werden.
So verfolgen hinsichtlich der Abgrenzung der Segmente sowohl IFRS 8 als auch DRS 3 zunächst
konsequent den management approach.
Bei der Verdichtung von Segmenten zu berichtspflichtigen operativen Segmenten sind beide Ansätze
stark durch den risks and rewards approach geprägt.
Die signifikanten Unterschiede bestehen hinsichtlich der Segmentbilanzierungs- und
Segmentbewertungsmethoden. Hier setzt IFRS 8 sowohl hinsichtlich der inhaltlichen Definition als
auch der Wertmaßstäbe stringent den management approach um. Dagegen verfolgt DRS 3 einen
Mischansatz, indem hinsichtlich der inhaltlichen Definition im Wesentlichen dem management
approach gefolgt wird, aber hinsichtlich der Bilanzierung und Bewertung die Übereinstimmung der in
der Segmentberichterstattung angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit den im
externen Jahresabschluss bzw. Konzernabschluss verwendeten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gefordert und insoweit dem risks and rewards approach gefolgt wird.
Rz. 130
Tendenziell besitzt der risks and rewards approach den Vorteil, dass die aus der
Segmentberichterstattung abgeleiteten Segmentinformationen nicht nur mit den Zahlenwerten der
Vorperioden der berichtenden Einheit vergleichbar sind, sondern grundsätzlich auch eine
Vergleichbarkeit zwischen ähnlichen Segmenten anderer Konzerne und Unternehmen möglich ist,
sofern sie die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anwenden.
Der management approach stellt für die Abschlussanalyse eine nicht unerhebliche Einschränkung dar,
da weder die Abgrenzung der Segmente noch die veröffentlichten Segmentdaten hinsichtlich ihres
inhaltlichen Umfangs und der herangezogenen Bilanzierungs- und Bewertungsmaßstäbe vergleichbar
sind. Daher eignen sich bei Verwendung eines management approachs die aus der Abschlussanalyse
abgeleiteten Daten in erster Linie für einen innerbetrieblichen Zeitvergleich der Entwicklung der
Segmente.
Haufe Finance Office Professional Online Seite 41
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
5.2 Kennzahlenanalyse (HI1849494)
Rz. 131
In den Geschäftsberichten der meisten börsennotierten Unternehmen wird die
Segmentberichterstattung durch Kennzahlen, die aus den Segmentangaben abgeleitet werden können,
angereichert. Diese erlauben Aussagen über die Rentabilität, die Produktivität, das Wachstum und im
Einzelfall die Wertorientierung[1] der einzelnen Unternehmenssegmente. Aufgrund der nur teilweisen
Zurechnung des Fremdkapitals der berichtenden Einheit auf die Segmente und mangels Unterteilung
des Segmentvermögens nach Gruppen sind aus den Pflichtangaben keine Kennzahlen einer
bestandsorientierten Liquiditätsanalyse nach Segmenten ableitbar. In einer operativen
Abschlussanalyse stehen somit Rentabilitäts-, Produktivitäts- und Investitions- und
Wachstumskennzahlen im Mittelpunkt.
5.2.1 Rentabilitätskennzahlen und Produktivitätskennzahlen (HI1849495)
Rz. 132
Aus den Angaben für die operativen Segmente können – vorbehaltlich des Umfangs der
berichtspflichtigen Daten[1] – grundsätzlich folgende Rentabilitätskennzahlen gebildet werden:
Segment-Umsatzrentabilität = Segmentergebnis × 100
(in %) Segmenterlöse
Segment- = Segmentergebnis × 100
Gesamtkapitalrentabilität (in %) Buchwerte des Segmentvermögens
Segment- = Equity-Ergebnis eines Segments × 100
Beteiligungsrentabilität der Equity-Buchwerte eines Segments
Equity-Gesellschaften (in %)
Segment-Cashflow- = Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit × 100
Umsatzverdienstrate (in %) eines Segments
Gesamtsegmenterlöse
Segment-Cashflow- = Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit × 100
Gesamtkapitalrentabilität (in %) eines Segments
Buchwerte des Segmentvermögens
Rz. 133
Die Segment-Umsatzrentabilität bildet die Übertragung der Umsatzrendite auf die einzelnen
Segmente. Je nach Umfang des Segmentergebnisses hat diese Kennzahl entweder den Charakter einer
operativen Umsatzrentabilität (bei Abgrenzung des Segmentergebnisses auf Basis einer EBIT-
Ergebnisgröße), einer Umsatzrendite vor Steuern oder auch einer Umsatzrendite nach Steuern.
Der Nenner sollte – unabhängig von der inhaltlichen Definition des Segmentergebnisses – die
Gesamtsegmenterlöse (einschließlich der Segmenterlöse gegenüber anderen Segmenten innerhalb der
berichtenden Einheit) enthalten, wenn der Zähler das Segmentergebnis auf unkonsolidierter Basis
beinhaltet. Sofern nach IFRS 8.25 Satz 2 die intersegmentären Eliminierungen auch auf die Segmente
in der internen Finanzberichterstattung heruntergebrochen und dem Management damit intern nur
konsolidierte Segmentergebnisse berichtet werden, darf der Nenner in diesem Fall
konsequenterweise dann auch nur die Segmenterlöse gegenüber Externen einschließen. Mit dieser
Quotientenbildung stehen im Zähler und Nenner damit sachlogisch vergleichbare Größen.[2]
Haufe Finance Office Professional Online Seite 42
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Die inhaltliche Erweiterung der Umsatz- und damit der Segmenterlöse nach § 277 Abs. 1 HGB i. d. F.
des BilRUG[3] fördert tendenziell die Aussagekraft der Segment-Umsatzrentabilität, da in die
Segmenterlöse grundsätzlich sämtliche Erlöse – auch aus Nebengeschäften oder nicht
betriebstypischer Geschäftstätigkeit – eingehen und diesen kongruent auch das hierauf entfallende
betriebliche Ergebnis oder das gesamte Periodenergebnis vor oder nach Steuern gegenübergestellt
werden. Allerdings handelt es sich hierbei stets um eine auf die gesamte Erlöstätigkeit bezogene
Umsatzrendite, die sich damit nicht mehr nur auf das unternehmerische Kerngeschäft bezieht.
Rz. 134
Der Quotient aus Segmentergebnis und dem Buchwert des Segmentvermögens stellt eine
Gesamtkapitalrentabilität auf Ebene der Segmente dar. Wie bei der Segment-Umsatzrentabilität hat
die Segment-Gesamtkapitalrentabilität je nach der Abgrenzung des zugrunde gelegten
Segmentergebnisses und des Segmentvermögens einen unterschiedlichen Inhalt bzw. eine
unterschiedliche Aussagekraft. Sofern das Betriebsergebnis als relevante zu segmentierende
Ergebnisebene gewählt wird und das Segmentvermögen die langfristigen Vermögenswerte (ohne
Beteiligungen und Finanzinstrumente), das Vorratsvermögen und die Forderungen, insbesondere die
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (ohne Finanzforderungen) umfasst, hat der als Quotient
aus dem so abgegrenzten Segmentergebnis und dem Segmentvermögen die Qualität einer operativen
Segment-Gesamtkapitalrentabilität vor Steuern.[4]
Rz. 135
Da nach DRS 3 auch die Segmentschulden offenzulegen sind, kann im Falle der Offenlegung einer
Segmentberichterstattung nach DRS 3 auch eine Segment-Eigenkapitalrendite ermittelt werden.
Allerdings ist deren Aussagekraft insbesondere von der Zuordnung der Finanzschulden zu den
Segmentschulden abhängig. Im Falle der Einbeziehung von Finanzschulden in die Segmentschulden
ist parallel auch das Zinsergebnis in das Segmentergebnis einzubeziehen; somit kann die Segment-
Eigenkapitalrendite entweder das Segmentergebnis vor Steuern oder sogar das Segmentergebnis nach
Steuern im Verhältnis zum Segmenteigenkapital messen.
Falls die Segmentschulden die Finanzschulden nicht beinhalten, wird das Segmenteigenkapital,
welches als Differenz aus Segmentvermögen abzüglich Segmentschulden ermittelt werden könnte, in
dieser Berechnung überschätzt mit der Folge einer geringen Aussagefähigkeit der abgeleiteten
Eigenkapitalrenditen.
Bei IFRS 8 hängen die Offenlegung der Segmentschulden sowie die inhaltliche Abgrenzung von der
Berichterstattung dieser Informationen an das oberste Entscheidungsgremium ab.
Rz. 136
Die Beteiligungsrentabilität der Equity-Gesellschaften stellt aus Sicht der investierenden Gesellschaft
die in Gestalt des Periodenergebnisses gemessene Rendite des in Equity-Gesellschaften gebundenen
Kapitals dar. Aus Perspektive der Equity-Gesellschaften handelt es sich um die Eigenkapitalrendite
der in einem Segment zusammengeschlossenen Equity-Gesellschaften. Insbesondere in Konzernen
mit einer Holdingstruktur und einer entsprechend großen Anzahl bedeutender at equity bewerteter
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen kann die Segment-
Beteiligungsrentabilität der at equity bewerteten Gesellschaften eine durchaus aussagekräftige
(partielle) Rentabilitätskennzahl sein; Einschränkungen ergeben sich jedoch aufgrund der
Nichtaufteilung des sonstigen Gesamtergebnisses, soweit es den at equity bewerteten assoziierten
Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen zuzurechnen ist.[5]
Haufe Finance Office Professional Online Seite 43
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Rz. 137
Die Segment-Cashflow-Umsatzverdienstrate zeigt den Anteil der aus dem operativen Geschäft
erzielbaren Einzahlungsüberschüsse als Prozentsatz vom Umsatz auf. Falls der Cashflow aus
operativer Tätigkeit nicht freiwillig angegeben wird, kann dieser näherungsweise als Summe aus
Segmentergebnis, Abschreibungen und sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und
Erträgen (außer Abschreibungen und Amortisation) sowie ggfs. unter Verwendung der Informationen
über Zinsaufwendungen, Zinserträge und Steuern geschätzt werden. Analog zu den Ausführungen
über die Rentabilitätskennzahlen auf Ebene des Unternehmens bzw. Konzerns besteht der Vorteil der
Segment-Cashflow-Umsatzverdienstrate – im Vergleich zur Segment-Umsatzrentabilität – in der
geringen Beeinflussbarkeit durch Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte.[6]
Rz. 138
Die Segment-Cashflow-Gesamtkapitalrentabilität bildet die Übertragung der Cashflow-
Gesamtkapitalrentabilität auf Ebene der Segmente. Falls im Nenner der Segment-Cashflow-
Gesamtkapitalrentabilität von den Buchwerten des Segmentvermögens die – zumindest nach DRS 3
angabepflichtigen – Buchwerte der Segmentschulden subtrahiert werden, welche nur die operativen
Schulden der Segmente beinhalten, gelangt man zu einer Segment-Cashflow-Rentabilität des
investierten Kapitals:
Segment-Cashflow-Rendite = Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit eines × 100
des investierten Kapitals (in %) Segments
des Segmentvermögens durchschnittliche durchschnittliche
Buchwerte des Buchwerte der
Segmentvermögens Segmentschulden
Diese Kennzahl wird häufig als Segment-CFROI bezeichnet und stellt in gewisser Hinsicht eine
Übertragung des CFROI[7] auf die Ebene der Segmente dar. Hierbei gilt jedoch zu beachten, dass die
abgeleitete Segment-Cashflow-Rendite des investierten Kapitals im Vergleich zum CFROI keine
Rendite auf Basis von Bruttowerten (historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten beim
Anlagevermögen und Buchwerte beim Netto-Umlaufvermögen), sondern eine Rendite auf Basis von
Nettoinvestitionswerten ist. Außerdem gehen in die durchschnittlichen Buchwerte des
Segmentvermögens sowohl aktuelle Wertansätze als auch fortgeführte historische Kosten ein. Trotz
dieser Einschränkungen wird diese Kennzahl in Geschäftsberichten zur Messung der
Wertorientierung der berichtenden Einheit verwendet.
Rz. 139
Aus den Pflichtangaben der Segmente kann als einzige Produktivitätskennzahl für die operativen
Segmente nur der Segment-Kapitalumschlag ermittelt werden:
Segment-Kapitalumschlag = Gesamtsegmenterlöse
durchschnittliche Buchwerte des Segmentvermögens
Der Segment-Kapitalumschlag misst, wie schnell sich das im Segmentvermögen gebundene Kapital
über den bzw. im korrespondierenden Segmentumsatz umschlägt. Weitere Produktivitätskennzahlen
sind mangels Aufteilung der Mitarbeiter und/oder des Personalaufwands auf die Segmente nicht
ableitbar.
5.2.2 Investitionskennzahlen und Wachstumskennzahlen (HI1849496)
Haufe Finance Office Professional Online Seite 44
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Rz. 140
Wachstumskennzahlen der Segmente haben für den Abschlussadressaten insbesondere deshalb
Bedeutung, da sich aus diesen erkennen lässt, in welchem Segment das Unternehmen
Wachstumsschwerpunkte setzt oder eine Abschöpfungsstrategie verfolgt. Ein Investor kann daher
einen Abgleich mit der aus seiner Sicht zu präferierenden Wachstumsstrategie vornehmen. Neben dem
Umsatz bzw. der Umsatzveränderung spiegeln folgende aus den Daten für die operativen Segmente
generierbaren Kennzahlen das Wachstum wider:
Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Vermögen
– planmäßige Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen und das immaterielle Vermögen
= Nettoinvestitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Vermögen vor
Berücksichtigung von Wertminderungen
– Wertminderungen
= Nettoinvestitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Vermögen unter
Berücksichtigung von Wertminderungen
Während auf Konzern- oder Unternehmensebene insbesondere die als Differenz aus Investitionen und
planmäßigen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen definierten Nettoinvestitionen in das
Sachanlagevermögen eine aussagefähige Kennzahl bilden,[1] kann eine solche Kennzahl nicht auf
Ebene der Segmente gebildet werden, da IFRS 8 weder eine Trennung von Investitionen noch von
planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen verlangt. Da sowohl die
im immateriellen Vermögen erfassten derivativen Geschäftswerte als auch die immateriellen
Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer nicht planmäßig abgeschrieben werden, ist eine
Gegenüberstellung der Zugänge und der planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen und
immaterielles Vermögen nur begrenzt aussagefähig. Aus diesem Grund empfiehlt sich, zur Messung
des Unternehmenswachstums neben den Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen und
immaterielles Vermögen (vor Abzug von Wertminderungen) auch die – im Regelfall – stärkeren
zufälligen Schwankungen unterliegenden Nettoinvestitionen in das Sachanlagevermögen und das
immaterielle Vermögen unter Berücksichtigung von Wertminderungen[2] zu bestimmen. Der
Aussagegehalt der Nettoinvestitionen wird weiterhin dadurch geschmälert, dass es sich bei dieser
Kennzahl um eine absolute Größe – ohne Beziehung zur Segmentgröße bzw. der
Innenfinanzierungskraft des Segments – handelt.
Rz. 141
Segmentinvestitionen in % des = Investitionen in Sachanlage- und immat. × 100
Cashflows Vermögen
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit
eines Segments
Die Kennzahl "Segmentinvestitionen" in Prozent des Cashflows misst das Wachstum der Segmente –
im Gegensatz zur Nettoinvestition – als relative Größe, bezogen auf die gegenwärtig aus der
Segmentaktivität erzielten Einnahmenüberschüsse. Hohe Kennzahlenwerte (insbesondere größer als 1)
deuten auf einen starken Ausbau des Segments hin, während niedrige Kennzahlenwerte eine
Schrumpfungs- bzw. Abschöpfungsstrategie anzeigen.
Rz. 142
Investitionen in % der Buchwerte des = Investitionen in Sachanlage- und immat. × 100
Haufe Finance Office Professional Online Seite 45
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Segmentvermögens Vermögen
Buchwerte des Segmentvermögens
Diese Kennzahl gibt die Investitionen im Verhältnis zum aktuellen Segmentvermögen an. Auch diese
Kennzahl spiegelt ein relatives Wachstum wider, nämlich in Relation zur vorhandenen
Produktionssubstanz. Sofern die Buchwerte des Segmentvermögens jedoch auch das kurzfristige und
häufig volatilere Vermögen einbeziehen, unterliegt diese Kennzahl auch häufig deutlicheren
Schwankungen. Problematisch ist bei der Interpretation dieser Kennzahl, dass die Investitionen in das
Sachanlagevermögen und das immaterielle Vermögen nur einen Teil der Zugänge zum gesamten
Segmentvermögen erfassen und die Buchwerte des Segmentvermögens im Regelfall keine Bruttobasis
des gebundenen Segmentvermögens darstellen.
Rz. 143
Durch Kombination von Rentabilitätskennzahlen und Wachstumskennzahlen in einer Darstellung
(z. B. Abbildung als Achsen eines Koordinatensystems) lässt sich für die Segmente einer berichtenden
Einheit eine Portfolio-Analyse der einzelnen operativen Segmente durchführen. Hierfür bestehen
verschiedene Möglichkeiten.[3]
5.3 Einschränkungen der Kennzahlenanalyse auf Ebene von Segmenten (
HI1849497)
Rz. 143a
Abgesehen von den sich unmittelbar aus der Umsetzung des management approach bei der Abgrenzung
und Bildung von Segmenten ergebenden Einschränkungen[1] sind vor allem folgende Begrenzungen
der Kennzahlenanalyse auf Ebene der Segmentberichterstattung festzustellen:
5.3.1 Bilanzierungsmethoden und Bewertungsmethoden (HI1849498)
Rz. 144
Da die Segmentbilanzierungs- und Segmentbewertungsmethoden in der Segmentberichterstattung
nach IFRS 8 mit den in der internen Finanzberichterstattung angewendeten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden übereinstimmen müssen, können diese von den IFRS-Bilanzierungs- und -
Bewertungsmethoden abweichen. Trotz der in der IFRS-Rechnungslegung wohl unstrittig
vorhandenen offenen und verdeckten Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte[1] kann jedoch im
Regelfall ein deutlich höheres Maß an Standardisierung und Vergleichbarkeit angenommen werden,
als wenn die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in das Belieben des jeweiligen Managements
gestellt sind.[2] Die Offenlegung der Segmentbilanzierungs- und Segmentbewertungsmethoden nach
IFRS 8.25 – IFRS 8.27 kann diesen aus bilanzanalytischer Sicht vorhandenen Mangel – insbesondere
im zwischenbetrieblichen Unternehmensvergleich – nicht umfassend beheben.
Zudem können sich die von der Unternehmensführung gewählten Segmentbilanzierungs- und
Segmentbewertungsmethoden auch einseitig auf die operativen Segmente auswirken und damit sogar
den innerbetrieblichen Vergleich verzerren. Beispielsweise führt die Anwendung der
Zeitwertbewertung bei Finanzinvestitionen sowie gleichzeitiger Bewertung der übrigen Sachanlagen
und immateriellen Vermögenswerten zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten
insbesondere dann zu Verzerrungen, falls zwischen den Segmenten ein signifikanter Unterschied
hinsichtlich deren Anteil an Finanzinvestitionen besteht.[3] Dies liegt immer dann vor, wenn ein
eigenes Unternehmenssegment "Anlage-Immobilien" gebildet würde, in welchem sämtliche oder
Haufe Finance Office Professional Online Seite 46
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
zumindest der überwiegende Teil der Finanzinvestitionen der berichtenden Einheit zusammengefasst
sind.
Rz. 145
Da nach DRS 3.19 die Bilanzierung und Bewertung in der Segmentberichterstattung in
Übereinstimmung mit den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgt, die für die Aufstellung
und Darstellung der Abschlüsse eines Konzerns oder Unternehmens angewendet werden, gehen in die
Segmentdaten und damit die aus diesen abgeleiteten Segmentkennzahlen sämtliche in der HGB-/DRS-
Rechnungslegung vorhandenen offenen Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte sowie verdeckten
Wahlrechte ein. Daher unterliegen die Segmentkennzahlen denselben materiellen Einschränkungen
wie die auf Konzern- bzw. Unternehmensebene abgeleiteten Kennzahlenwerte.
Die Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte schränken insbesondere den Unternehmensvergleich
zwischen ähnlichen Segmenten unterschiedlicher Unternehmen und Konzerne ein, sofern die
Unternehmen bzw. Konzerne unterschiedliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur
Abbildung wirtschaftlicher Sachverhalte wählen.
Dennoch wird man im Vergleich zur IFRS-Segmentberichterstattung nach IFRS 8 davon ausgehen
können, dass aufgrund der Normierung der Segmentberichterstattung auf die HGB-/DRS-
Bilanzierungs- und -Bewertungsmethoden insgesamt eine deutlich größere Vergleichbarkeit besteht,
als wenn die Segment-Bilanzierungs- und Segment-Bewertungsmethoden in der alleinigen
Entscheidungsbefugnis der jeweiligen Unternehmens- bzw. Konzernführung stehen.
5.3.2 Zurechnung von gemeinschaftlichen Vermögenswerten und
Ergebnisposten (HI1849499)
Rz. 146
Bei der Zurechnung von Abschlussposten auf die Segmente ergeben sich in zweifacher Hinsicht
Freiräume, die aufgrund vorhandener Gestaltungsspielräume nicht zu eindeutigen Ergebnissen
führen und damit einen anhand der offengelegten Zahlen durchgeführten Wirtschaftlichkeitsvergleich
beeinträchtigen.
Rz. 147
Die Abschlussposten sind auf die operativen Segmente – sowohl bei IFRS 8 als auch DRS 3 – nicht
zwingend vollständig aufzuteilen. Auch wenn weder in IFRS 8 noch in DRS 3 ein Verbot der
Zuschlüsselung von allgemeinen Verwaltungsaufwendungen und von Aufwand der
Hauptgeschäftsstelle und anderer Aufwendungen, die auf Unternehmensebene bzw. Konzernebene
entstehen und sich auf das Unternehmen bzw. den Konzern als Ganzes (z. B. eine zentrale
Forschungs- und Entwicklungsabteilung) beziehen, enthält, hat die berichtende Einheit ein nicht
unbeträchtliches Wahlrecht, solche und ähnliche Ergebnisposten entweder komplett nicht den
Segmenten zuzuordnen oder vollständig auf die Segmente aufzuteilen sowie innerhalb dieses
faktischen Wahlrechts die nicht zuzurechnenden Ergebnisposten weit oder eng auszulegen. Damit
entscheidet die in der internen Finanzberichterstattung getroffene Festlegung über die Zuordnung von
gemeinschaftlichen Vermögenswerten und Ergebnisposten auch über die in der externen
Berichterstattung auszuweisenden Segmentwerte.
Beispielsweise gelingt es damit der Unternehmensführung bei entsprechend großzügig gewählter
Abgrenzung von nicht auf die Segmente zugerechneten Segmentaufwendungen, dass die aus der
externen Segmentberichterstattung ermittelbaren Rentabilitätskennzahlen tendenziell (zu) positiv
dargestellt werden.
Haufe Finance Office Professional Online Seite 47
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Segmentberichterstattung nach HGB und IFRS (HI1849438)
Bei IFRS 8 tritt zusätzlich noch als Möglichkeit hinzu, Vermögenswerte und Ergebnisposten
asymmetrisch den Segmenten zuzurechnen.
Rz. 148
Ein weiterer Ermessensspielraum besteht bei allen auf die Segmente aufzuteilenden
Abschlusspositionen, welche nicht verursachungsgerecht einem Segment zugeordnet werden können.
Abschlussposten, die nicht direkt einem Segment zuordenbar sind, werden sowohl gemäß IFRS 8 als
auch gemäß DRS 3 auf einer vernünftigen Basis auf die Segmente verteilt. Beide
Rechnungslegungsstandards zur Segmentberichterstattung lassen offen, welche Maßstäbe zur
Verteilung von gemeinsam anfallenden Erträgen und Aufwendungen sowie von Vermögenswerten
und gegebenenfalls Schulden auf die Segmente heranzuziehen sind. Hier können grundsätzlich
sämtliche aus der Kosten- und Leistungsrechnung bekannten Verteilungsmaßstäbe angewendet
werden.[1]
Haufe Finance Office Professional Online Seite 48
Stand Produktdatenbank: 04.06.2019, Ausdruck vom 13.06.2019
Das könnte Ihnen auch gefallen
- 1936 - Erich Kästner - Doktor Erich Kästners Lyrische HausapothekeDokument149 Seiten1936 - Erich Kästner - Doktor Erich Kästners Lyrische HausapothekeVangelis Ninis100% (2)
- Liedermappe KiTa BentfeldDokument156 SeitenLiedermappe KiTa BentfeldAdamescu AlinaNoch keine Bewertungen
- Die Balanced Scorecard: Vier essentielle Dimensionen der langfristigen UnternehmensausrichtungVon EverandDie Balanced Scorecard: Vier essentielle Dimensionen der langfristigen UnternehmensausrichtungNoch keine Bewertungen
- 4 RechnungswesenDokument16 Seiten4 Rechnungswesenr_osi100% (1)
- Kosten- und Leistungsrechnung für Fachwirte: mit Übungsaufgaben und LösungenVon EverandKosten- und Leistungsrechnung für Fachwirte: mit Übungsaufgaben und LösungenNoch keine Bewertungen
- Die Wertkette nach Porter: Wettbewerbsvorteile erkennen und ausbauenVon EverandDie Wertkette nach Porter: Wettbewerbsvorteile erkennen und ausbauenNoch keine Bewertungen
- Konzernabschluss verstehen: Für Controller und BilanzanalystenVon EverandKonzernabschluss verstehen: Für Controller und BilanzanalystenNoch keine Bewertungen
- Sap VariantenDokument32 SeitenSap VariantenPerforista OutllookNoch keine Bewertungen
- Operatives Controlling zielorientiert umsetzen: Der Leitfaden für eine erfolgreiche operative Controlling UmsetzungVon EverandOperatives Controlling zielorientiert umsetzen: Der Leitfaden für eine erfolgreiche operative Controlling UmsetzungNoch keine Bewertungen
- SAP FSCM Credit MGMT 2021Dokument78 SeitenSAP FSCM Credit MGMT 2021Mario DauthNoch keine Bewertungen
- Zusammenfassung Kapitel 2 - OrganisationselementeDokument2 SeitenZusammenfassung Kapitel 2 - OrganisationselementeM ReuNoch keine Bewertungen
- KonzernabschlussDokument247 SeitenKonzernabschlussdanicalalalaNoch keine Bewertungen
- Variantenkonfiguration Mit SapDokument32 SeitenVariantenkonfiguration Mit SapPerforista OutllookNoch keine Bewertungen
- Bi Lanz AnalyseDokument2 SeitenBi Lanz AnalyseRoman SchönebornNoch keine Bewertungen
- B1 Vorläufiges Anwerderhandbuch PDFDokument48 SeitenB1 Vorläufiges Anwerderhandbuch PDFkamiNoch keine Bewertungen
- CML04Dokument79 SeitenCML04victor_3030Noch keine Bewertungen
- FinanceDokument14 SeitenFinanceelmoumni10Noch keine Bewertungen
- Marketing-Controlling ganzheitlich praktizieren: Praxisbewährtes System zur erfolgreichen Erfassung und Bewertung der Marketing-Controlling KennzahlenVon EverandMarketing-Controlling ganzheitlich praktizieren: Praxisbewährtes System zur erfolgreichen Erfassung und Bewertung der Marketing-Controlling KennzahlenNoch keine Bewertungen
- Halfmann2018 Übungsaufgaben Und LösungenDokument10 SeitenHalfmann2018 Übungsaufgaben Und LösungenSCProfessionalNoch keine Bewertungen
- CML02Dokument155 SeitenCML02victor_3030Noch keine Bewertungen
- Funktionsreferenzmodell für ERP-Software: Teil 5: ControllingVon EverandFunktionsreferenzmodell für ERP-Software: Teil 5: ControllingNoch keine Bewertungen
- Evu Spezifische Abrechnungskennzahlen Auf Einen BlickDokument4 SeitenEvu Spezifische Abrechnungskennzahlen Auf Einen BlickCognizantNoch keine Bewertungen
- SAP Organisationseinheiten-und-StrukturenDokument15 SeitenSAP Organisationseinheiten-und-StrukturenFrancisco MartinsNoch keine Bewertungen
- Beschreibung Von IKS Und RMS Im LageberichtDokument7 SeitenBeschreibung Von IKS Und RMS Im LageberichtDzenita Beciragic KasicNoch keine Bewertungen
- Tugas ManagemenDokument3 SeitenTugas ManagemenAfiifah FifahNoch keine Bewertungen
- Mündliches Kostenrechnung 2Dokument5 SeitenMündliches Kostenrechnung 2dilarakatirciNoch keine Bewertungen
- Skript KLR Grundlagen Bereich TeilkostenrechnungDokument26 SeitenSkript KLR Grundlagen Bereich TeilkostenrechnungfabetayfunNoch keine Bewertungen
- Koste - Und Erlösrechnung Als Teilbereich Der UnternehmengsführungDokument31 SeitenKoste - Und Erlösrechnung Als Teilbereich Der Unternehmengsführungslyk1993Noch keine Bewertungen
- Als Ergebnis Der Kalkulation Unterscheidet Man Die Herstellkosten Und Die SelbstkostenDokument7 SeitenAls Ergebnis Der Kalkulation Unterscheidet Man Die Herstellkosten Und Die Selbstkostensebastien ESTOCQNoch keine Bewertungen
- Strategisches Controlling erfolgsorientiert entwickeln: Der Leitfaden für die erfolgreich Entwicklung des strategischen Controlling anhand praxisbewährter MethodenVon EverandStrategisches Controlling erfolgsorientiert entwickeln: Der Leitfaden für die erfolgreich Entwicklung des strategischen Controlling anhand praxisbewährter MethodenNoch keine Bewertungen
- Vertriebscontrolling kundenorientiert anlegen: Praxisbewährte Methoden und Techniken für eine erfolgreiches VertriebscontrollingVon EverandVertriebscontrolling kundenorientiert anlegen: Praxisbewährte Methoden und Techniken für eine erfolgreiches VertriebscontrollingNoch keine Bewertungen
- Bain Case ExampleDokument8 SeitenBain Case ExampleAINoch keine Bewertungen
- PdfdownloadDokument13 SeitenPdfdownloadHusseinNoch keine Bewertungen
- SAP Klausur1Dokument21 SeitenSAP Klausur1David Montani SchnickmannNoch keine Bewertungen
- Versicherungsaufsichtliche Anforderungen An Die IT (VAIT)Dokument23 SeitenVersicherungsaufsichtliche Anforderungen An Die IT (VAIT)Martin MillerNoch keine Bewertungen
- 04 Handout KennzahlenDokument14 Seiten04 Handout KennzahlenmoSphaereNoch keine Bewertungen
- Leseprobe Sappress Sap S4hana Finance Prozesse Funktionen MigrationDokument32 SeitenLeseprobe Sappress Sap S4hana Finance Prozesse Funktionen MigrationOnur OnukNoch keine Bewertungen
- Fachbeitrag Von Tanja MagnusDokument4 SeitenFachbeitrag Von Tanja MagnusBerndNoch keine Bewertungen
- 8.19. NjemDokument20 Seiten8.19. NjemAlisaSpahicNoch keine Bewertungen
- 2020 AA49 RechnungslegungDokument2 Seiten2020 AA49 RechnungslegungBader DahmaniNoch keine Bewertungen
- Preisfindung - nie mehr unter Wert verkaufen!: Von der BWA zur agilen ProjektkalkulationVon EverandPreisfindung - nie mehr unter Wert verkaufen!: Von der BWA zur agilen ProjektkalkulationNoch keine Bewertungen
- Präsentationsvorlage Für Eine Private-Equity-FallstudieDokument22 SeitenPräsentationsvorlage Für Eine Private-Equity-FallstudieScribdTranslationsNoch keine Bewertungen
- Benchmarking in der Automobilindustrie: Der Service als Positionierungsinstrument eines NutzfahrzeugesVon EverandBenchmarking in der Automobilindustrie: Der Service als Positionierungsinstrument eines NutzfahrzeugesNoch keine Bewertungen
- SAP FSCM Dispute MGMT 042021Dokument60 SeitenSAP FSCM Dispute MGMT 042021Mario DauthNoch keine Bewertungen
- Bessere Planung des Geschäftsbudgets: So Machen Sie die Budgetierung von Unternehmen zum ErfolgVon EverandBessere Planung des Geschäftsbudgets: So Machen Sie die Budgetierung von Unternehmen zum ErfolgNoch keine Bewertungen
- PWC Swiss GaapDokument54 SeitenPWC Swiss GaapJustine991Noch keine Bewertungen
- 5 Kostenstellenrechnung Teil 1Dokument6 Seiten5 Kostenstellenrechnung Teil 1sebastien ESTOCQNoch keine Bewertungen
- Kommissionspolitik - 9Dokument3 SeitenKommissionspolitik - 9ScribdTranslationsNoch keine Bewertungen
- Die 7 P des Marketing - Bedienungsanleitung: Marktorientierte Unternehmensführung: Planung, Budgeting, Controlling und ProjektsteuerungVon EverandDie 7 P des Marketing - Bedienungsanleitung: Marktorientierte Unternehmensführung: Planung, Budgeting, Controlling und ProjektsteuerungNoch keine Bewertungen
- Details DEDokument12 SeitenDetails DEmayoorNoch keine Bewertungen
- Entgelttarifvertrag Fuer Die SystemgastronomieDokument10 SeitenEntgelttarifvertrag Fuer Die SystemgastronomieLightning IINoch keine Bewertungen
- Bilanzorientierte Kennzahlen Für Wertorientierte SteuerungDokument5 SeitenBilanzorientierte Kennzahlen Für Wertorientierte SteuerungStefan SchmidtNoch keine Bewertungen
- Strategieanalyse-MACY IncDokument28 SeitenStrategieanalyse-MACY IncScribdTranslationsNoch keine Bewertungen
- D3e3 RBR EmpDokument2 SeitenD3e3 RBR EmpRolando BenavidesNoch keine Bewertungen
- 13 Handout Business PlanDokument4 Seiten13 Handout Business PlanmoSphaereNoch keine Bewertungen
- MarktprozesseDokument34 SeitenMarktprozesseDoganNoch keine Bewertungen
- SAP-Geschäftspartner (SAP-GP)Dokument23 SeitenSAP-Geschäftspartner (SAP-GP)nepumuk63Noch keine Bewertungen
- Bilanzen - Die Gewinn - Und VerlustrechnungDokument49 SeitenBilanzen - Die Gewinn - Und Verlustrechnungdaschawat100% (1)
- Logistik- und Industriemeister Basisqualifikation - Zusammenfassung der IHK-Prüfungen: Betriebswirtschaftliches HandelnVon EverandLogistik- und Industriemeister Basisqualifikation - Zusammenfassung der IHK-Prüfungen: Betriebswirtschaftliches HandelnNoch keine Bewertungen
- Berechnung Der Gewinnverwendung Einer AGDokument11 SeitenBerechnung Der Gewinnverwendung Einer AGthyoalexNoch keine Bewertungen
- IFRS 16 - LeasingverhaeltnisseDokument48 SeitenIFRS 16 - LeasingverhaeltnisseAdi AlibabicNoch keine Bewertungen
- Bilanz Check-Up 2019 Internationale RechnungslegungDokument19 SeitenBilanz Check-Up 2019 Internationale RechnungslegungAdi AlibabicNoch keine Bewertungen
- Rechnungslegung Nach IFRSDokument32 SeitenRechnungslegung Nach IFRSAdi AlibabicNoch keine Bewertungen
- Latente Steuern Im Einzelabschluss Und KonzernabschlussDokument54 SeitenLatente Steuern Im Einzelabschluss Und KonzernabschlussAdi AlibabicNoch keine Bewertungen
- Die Bewertung Von Aktien Mit Der Fundamental AnalyseDokument5 SeitenDie Bewertung Von Aktien Mit Der Fundamental AnalyseAdi AlibabicNoch keine Bewertungen
- BR Kellerdicht A06 - 072Dokument20 SeitenBR Kellerdicht A06 - 072Adrian SasekNoch keine Bewertungen
- Prospekt Nano Marinus DDokument36 SeitenProspekt Nano Marinus DStefan Trey100% (1)
- Novalis ReferatDokument4 SeitenNovalis Referatfg82Noch keine Bewertungen
- 100 Jahre WieslauterbahnDokument39 Seiten100 Jahre WieslauterbahnPablo DanielNoch keine Bewertungen
- Lektion 5 - Zusammenfassung Der Lektion - Menschen A1 (Lehrer)Dokument4 SeitenLektion 5 - Zusammenfassung Der Lektion - Menschen A1 (Lehrer)caioponceNoch keine Bewertungen
- 1 Aufloes WiderstandswuerfelDokument2 Seiten1 Aufloes WiderstandswuerfeldiegocabNoch keine Bewertungen
- Din en 60958-3 2007-02Dokument64 SeitenDin en 60958-3 2007-02Ahmed AlzubaidiNoch keine Bewertungen
- Lektion 4Dokument7 SeitenLektion 4hamiitaddeNoch keine Bewertungen
- Umbruch OW 19-08 WebDokument47 SeitenUmbruch OW 19-08 WebAnonymous ormUGGHUENoch keine Bewertungen