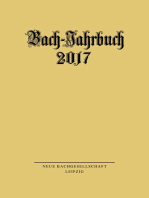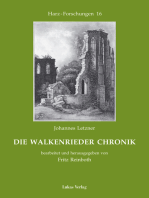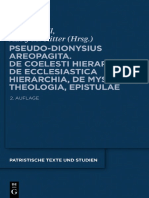Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Aland Text
Hochgeladen von
bookfriend0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
22 Ansichten4 SeitenOriginaltitel
Aland_Text
Copyright
© © All Rights Reserved
Verfügbare Formate
PDF, TXT oder online auf Scribd lesen
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)
22 Ansichten4 SeitenAland Text
Hochgeladen von
bookfriendCopyright:
© All Rights Reserved
Verfügbare Formate
Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen
Sie sind auf Seite 1von 4
Kurt Aland - 1981: Der Text des Neuen Testaments Seite - 1
Exzerpt von
Kurt und Barbara Aland:
Der Text des Neuen Testaments
Einführung in die wissenschaftlichen Ausgaben sowie in
Theorie und Praxis der modernen Textkritik
Stuttgart, 1981
gelesen April 1996
13 I. Die Ausgaben des Neuen Testaments
1. Von Erasmus bis Griesbach
Der griechische Text wurde erst Anfang des 16. Jahrhunderts erstmals gedruckt,
nachdem schon 100 Drucke der lateinischen Bibel entstanden waren, mit der die
Theologen damals offenbar zufrieden gewesen waren. 1514 erschien die
Complutnesis, 1516 das Novum Instrumentum omne von Erasmus von
Rotterdam. Für die Complutensische Polyglotte waren Schriften aus dem Vatikan
entliehen worden (14), welche, ist unklar, anders als bei Erasmus, der die bequem
zugänglichen nahm (je eine pro Schrift, aus dem 12./13. Jahrhundert, die
schlechteste der zugänglichen Texttypen) und nach seinem Belieben korrigierte,
u.a. nach der lateinischen Übersetzung. - ::Was er hätte besser machen können::
Seit 1633 wird der Text von Erasmus als textus receptus bezeichnet (16). ::Warum
der Text damals keineswes unverändert von Erasmus erhalten war:: Den größten
Einfluß nach Erasmus haben auf das 16. Jahrhundert die Ausgaben des Franzosen
Robert Estienne (Stephanus, 1503-1559, Ausgabe 1551 erstmals mit
Verseinteilung) und auf das 17. Jahrhundert die der holländischen Verlegerfamilie
Elzevier gehabt (Ausgaben 1624-1678), ferner gab es Polyglotten (also
mehrsprachige Ausgaben). Man blieb lange bei der Grundlage des textus rezeptus,
was einen Fortschritt verhinderte. Die Verbalinspirationslehre wurde von der
Orthodoxie beider evangelischer Konfessionen verfochten, in bezug auf den
textus rezeptus (17), auch wenn man inzwischen zusätzliche Handschriften
zugrundelegte ::Beispiel:: (19), was aber zunächst zu keinen Änderungen am
textus rezeptus führte, das erst im 18. Jahrhundert durch immer größere kritische
Apparate oder direkte Korrektur - besonders durch die Engländer John Mill,
Richard Bentley u.a. sowie die Deutschen Johann Albrecht Bengel 1734
(Klassifizierung im Apparat) und Johann Jakob Wettstein 1751/52, der eine bis
dahin unübertroffene Zahl von Handschriften berücksichtigte. Er führte die Sigla
ein, später von Gregory weiterentwickelt. Johann Jakob Griesbach bildete den
Höhepunkt der Editionen des 18. Jahrhunderts (21), wird aber heute überbewertet.
Bengel formulierte bereits die entscheidenden Grundsätze der Textkritik.
..21 2. Von Lachmann bis Nestle
Karl Lachmann (1793-1851) schlug die entscheidende Schlacht gegen den
Inspirationsglauben an den textus rezeptus, er wollte zurück zum Text der Kirche
Kurt Aland - 1981: Der Text des Neuen Testaments Seite - 2
-
des 4. Jahrhunderts. Constantin von Tischendorf (1815-1874) verwirklichte sein
Programm, zunächst durch die Entzifferung von Codex Ephraemi Syri rescriptus
(C) (5. Jh, Palimpsest). Auf seinen Reisen hat er den Codex Sinaiticus (4. Jh) im
Katharinenkloster auf dem Sinai und 21 andere Majuskeln entdeckt (24), 1869/72
gab er die editio octava critica maior heraus, eine vollständige und zuverlässige
Darbietung allen ihm bekannten Materials, wobei er den Sinaiticus sehr hoch
bewertete (wie sich an der Bennenung durch das Sigel ) zeigt, was manche ihm
verübelten), zum Vaticanus (4. Jh) hatte er nur beschränkt Zugang. - Die
Engländer Brooke Foss Westcott (1825-1901) und Fenton John Anthony Hort
(1828-1892) gaben 1881 The New Testament in the Original Greek (mutig!)
heraus, dessen Leitstern der Vaticanus ist, den sie für den „neutralen“ Text hielten
(einen solchen gibt es natürlich nicht) (28), der aber nur in den Evangelien dem
Sinaiticus (und allen anderen Majuskeln) überlegen ist, in den Paulinen nicht.
Westcott und Hort mußten hinter das 4. Jahrhundert rückschließen, sie schrieben
irrtümlich den Codex Bezae Cantabrigiensis (5. Jh) dem 2. Jahrhundert zu. Sie
hatten keine Originale vorliegen, schrieben keinen kritischen Apparat (nur im
Anhang). (29) - So wurde der textus receptus für die Wissenschaft überwunden
(Verteidiger war vor allem Dean Burgon), endgültig verloren war die Schlacht mit
dem Novum Testamentum graece von Eberhard Nestle (1898), der den textus
rezeptus auch aus Kirche und Unterricht verdrängte, 1904 von der British and
Foreign Bible Society übernommen. - Nestle verglich die Texte von Tischendorf
und Westcott/Hort miteinander und nahm eine dritte Ausgabe hinzu (Weymouth
1892, dann Weiss) , so daß Mehrheitsentscheid über den Text bestimmte, der Rest
kam in den Apparat (30) - eine Zusammenfassung der textkritischen Arbeit des
19. Jahrhunderts.
..30 3. Von Nestle bis zum neuen „Standard-Text“
Mit der 13. Auflage des „Nestle“ 1927 von Erwin Nestle beginnt eine neue
Epoche, das Mehrheitsprinzip wurde systematisch durchgezogen, der textkritische
Apparat gründlich erstellt ((32) mit Hilfe der Ausgabe von Hermann von Soden
(1852-1914, der 40 Mitarbeiter zu den Handschriftenkollationen in den
Bibliotheken Europas sandte, aber selbst eine eher mißglückte Ausgabe
zusammenstellte. ::Was er falsch machte: falsche Grundvoraussetzungen in der
Bewertung und (33) ein eigenes Sigelsystem::) (31) nach den bezeugenden
griechischen Handschriften, Übersetzungen und Kirchenvätern: konkurrenzlos,
die Verbreitung stieg. Erwin Nestle hatte jedoch die Quellen aus den Angaben der
Ausgaben seit Tischendorf geschlossen (und nur bei Widersprüchen nachgefragt)
(32). K.Aland machte sich, ab 1950 in der Mitarbeit, an die Überprüfung anhand
der Originale. (33) ::Der dennoch beachtliche Verdienst v. Sodens und die
Ausgabe von S.C.E.Legg, über das von E.C.Colwell 1942 initiierte amerikanische
Komitee (34) für das Lukas-Evangelium, Vinton A.Dearing, der umfassend mit
Computer am Johannes-Evangelium arbeitet, die in Arbeit befindliche kritische
Ausgabe von Novi Testamenti editio critica maior aus Münster:: Insgesamt hat
das 20. Jahrhundert noch keine vollständige, zuverlässige Übersicht
hervorgebracht wie seinerzeit Tischendorf, freilich wegen der Explosion des
Materials. Weitere Handausgaben: (35) Alexander Souter 1910 und 1947,
R.V.G.Tasker 1964, G.D.Kilpatrick, H.Greeven, Huck-Lietzmann; H.J.Vogels
1920 bis 1955, A.Merk 1933 bis 1964 (9.Aufl.), J.M.Bover 1943 bis 1968 (5.
Aufl.): drei griechisch-lateinische (nach Sixto-Clementinischer Vulgata)
Ausgaben, katholisch als (36) Gegenprogramm zum Nestle. Die Textsituation in
den letzten hundert Jahren in einem Schaubild. (37) zeigt, daß Soden und Vogel
Kurt Aland - 1981: Der Text des Neuen Testaments Seite - 3
-
am meisten von Nestle abweichen, danach Bover. ::Das Verhältnis von Nestle zu
Tischendorf und Westcott-Hort:: Die Ausgabe v. Sodens hat auf die
Handausgaben des 20. Jahrhunderts die stärksten Auswirkungen gehabt: Merk,
Bover, Vogel. - Insgesamt sind selbst ca. 2000 Abweichungen auf 657 Nestle-
Druckseiten gesehen nicht viel. (38) Das Verhältnis der wichtigen Varianten
zwischen verschiedenen Ausgaben entspricht relativ der Variantenzahl insgesamt.
- Bei der Beurteilung des Textes wird alles in allem viel zu wenig auf das Ganze
und viel zu sehr - von Außenstehenden wie Spezialisten - auf die Varianten
gesehen: viele Differenzen sind auch nur Zufälligkeiten. Die Übereinstimmung
zwischen den bisher behandelten Ausgaben ist erheblich größer als man allgemein
glaubt. Tischendorf, Westcott-Hort,v. Soden, Vogels, Merk und Bover stimmen
mit dem Nestle-Text in (39) 4999 von 7947 Versen des NT vollkommen überein,
wobei der Grad der Übereinstimmung bei den Briefen (allerdings nicht den
Katholischen Briefen) am höchsten ist. (40) ::Gründe dafür:: (41) Wie kam es zu
dem heutigen „Standard-Text“ (Bezeichnung durch Zeitschriften bei Erscheinen
der 26. Ausgabe des Nestle), den man im Greek New Testament, 3. Aufl., im
Nestle-Aland, 26. Ausgabe, in der Synopsis Quattuor Evangeliorum gleich
wiederfindet (bei aller Unterschiedlichkeit des Apparates)? - K.Aland überprüfte
ab 1950 zunächst den Apparat des Nestle, revidierte aber auch den Text. 1955
wurde ein internationales Komitee gegründet, das eine griechische Grundlage für
die weltweite Übersetzung des NT schaffen sollte - u.a. für die fällige Revision
vieler durch Missionare verfaßter Übersetzungen, damals oft das erste gedruckte
Buch der Landessprache -. Der zu schaffende griechische Text sollte nur wichtige
Varianten enthalten und „durchsichtig“ sein, ein Kommentar sollte die
Entscheidungen des Komitees erläutern. (42) K.Aland gehörte auch diesem
Komitee an (u.a. auch B.M.Metzger), arbeitete also an konkurrierenden
Ausgaben. Die Breitenwirkung der Arbeit verdeutlichte sich in dem späteren
Beitritt verschiedener Bibelgesellschaften. Weichte die erste Ausgabe des Greek
New Testament 1966 noch vielfach vom Nestle ab, so war die 2. Ausgabe schon
viel näher (43), vermittelt durch die Person K.Alands, so daß die Ausgaben des
Greek New Testament und des Nestle-Aland schließlich zu einer Einheit
zusammengewachsen sind - in bezug auf den Wortbestand des Textes, nicht die
Orthogrphie und Interpunktion und Absatzgliederung. - Freilich ist ein solcher
Komiteetext ein Kompromiß (44), streng philologisch ist Textentscheidung mit
wechselnden Mehrheiten ein Unding, die Prinzipien sind uneinheitlich. Allerdings
wechselt die handschriftliche Situation des NT ohnehin ständig, so daß jeweils
neue Diskussion sowieso nötig ist (lokal-genealogische Methode). - Überdies ist
die hohe Verantwortung, die Grundlage für alle Übersetzungen und Auslegungen
und Revisionen bisheriger Übersetzungen zu schaffen (45) leichter von einer
Herausgebergemeinschaft zu tragen. - Der Standard-Text wird nun von beiden
Großkirchen, in Universität und Kirche verbreitet und wird sich bald ganz
durchsetzen. Er ist selbstverständlich „ad experimentum“ veröffentlicht, für jede
Änderung offen, wozu der Apparat des Nestle-Aland (26. Ausgabe) reichlich
Anregungen bietet. Faktisch ist der neue „Standard-Text“ ein neuer textus
receptus, diesmal in verantwortlicher (46) Arbeit entstanden. Nestle-Aland (26)
und die Fourth Edition des Greek New Testament sind an den Originalen
ausgerichtet, nicht an überlieferten textkritischen Angaben.
..46 Vergleichende Betrachtung der wichtigsten Ausgaben: Tischendorf, v. Soden,
Nestle-Aland26, Greek New Testament3, Westcott/Hort
(47) Soden hat durch die ausführlichste Sammlung von Varianten, Tischendorf
Kurt Aland - 1981: Der Text des Neuen Testaments Seite - 4
-
durch die zuverlässigste Darstellung ihrer Bezeugung weiterhin bleibenden Wert,
auch der Student sollte mit ihnen vertraut sein und auch von Westcott/Hort gehört
haben.
Westcott/Hort bietet nur die „Western non-interpolations“ (später zugefügte
Textteile) und einige „Alternative Readings“ am Rand, (48) die man am besten
mit Hilfe des Nestle bewertet. - Tischendorf hat auf 4/5 der Seite kritischen
Apparat, allerdings ausführlich geschrieben und daher im Beispiel nur 50%
umfangreicher als Nestle, und das auch nur um unbedeutende Varianten. (49)
Seine Sigel weichen z.T. erheblich von Gregory ab. Daher ist Vorsicht bei der
Zitation geboten, Sigellisten sind nötig! Tischendorf notiert im Apparat auch die
Entscheidung anderer Ausgaben, was heute übergangen werden kann, weil es
belanglos oder durch neue Ausgaben (etwa der Kirchenvätertexte) nicht mehr
aktuell ist. Nochmals ist allerdings auf die Bedeutung von Tischendorf und seiner
Arbeit zu verweisen. (50), u.a. angesichts seiner Entzifferung von Christus,04. -
Zur Ausgabe v. Sodens siehe S. 32f. Er hat seine eigenen, komplizierten Sigla (sie
geben Auskunft über Inhalt, Alter und Textcharakter) (Umwandlungsliste nötig!)
und den Apparat nach Wichtigkeit dreigeteilt. ::Über Sodens Siglasystem (51) und
seine Probleme. Beispielhafte Entschlüsselung des Apparats an einer Stelle und
dessen Fehler und (52) Irrtümer sowie die Überlegenheit des Nestle-Apparates::
Diese Ausführungen können erst nach Lektüre des übrigen Buches voll
verstanden werden. (53) Nestle reicht selbst für einen hohe Ansprüche stellenden
akademischen Unterricht aus.
Nestle-Aland(26) ist in Varianten und Parallelstellen ausführlicher als das Greek
New Testament (GNT). Nestle-Aland bietet die Eusebianischen Kanonzahlen und
die Kapiteleinteilung der neutestamentlichen Handschriften, GNT dafür einen
Apparat der Interpunktionsunterschiede der griechischen Ausgaben und der
wichtigen Übersetzungen. (54) Das GNT bietet an wenigen Stellen einen dafür
sehr ausführlichen Apparat, dessen Aussage im Nestle, der viel mehr Stellen
bearbeitet, in einem Extrakt genauso getroffen wird. GNT bietet mit den
Buchstaben A-D den (zunehmenden) Grad der Wahrscheinlichkeit eines Zweifels
am Text, nützlich für die Übersetzerkomitees in den Jungen Kirchen (55) und für
Studenten. - Nestle-Aland strebt in der Absatzeinteilung viel stärker zur
ursprünglichen Gliederung des Textes. Auch in der Interpunktion gibt es
Differenzen, GNT folgte den Regeln der englischen, Nestle denen der
griechischen Sprache, ab Auflage 3a hat GNT aber das Nestle-System
übernommen. GNT hat Perikopenüberschriften, (56) Nestle nur auf dem
nichtgriechischen Teil der zweisprachigen Ausgaben. Wer eine wissenschaftliche
Handausgabe will, muß den Nestle-Aland wählen, wer in moderne Sprachen
übersetzt und vornehmlich praktische Zwecke verfolgt, das GNT
57 II. Die Überlieferung des griechischen Neuen Testaments
1. Die Sammlung der neutestamentlichen Schriften
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Tu quis es (De principio). Über den Ursprung: Zweisprachige Ausgabe (lateinisch-deutsche Parallelausgabe, Heft 23)Von EverandTu quis es (De principio). Über den Ursprung: Zweisprachige Ausgabe (lateinisch-deutsche Parallelausgabe, Heft 23)Noch keine Bewertungen
- Konzilstagebuch Sebastian Tromp S.J. mit Erläuterungen und Akten aus der Arbeit der Kommission für Glauben und Sitten II. Vatikanisches KonzilVon EverandKonzilstagebuch Sebastian Tromp S.J. mit Erläuterungen und Akten aus der Arbeit der Kommission für Glauben und Sitten II. Vatikanisches KonzilNoch keine Bewertungen
- Meister Eckhart - Die Deutschen Werke BD IV.1. Predigten 87-105Dokument677 SeitenMeister Eckhart - Die Deutschen Werke BD IV.1. Predigten 87-105FRStrange100% (2)
- Lactantius - Divinarum Institutionum - 1 (BT)Dokument255 SeitenLactantius - Divinarum Institutionum - 1 (BT)Basil LouriéNoch keine Bewertungen
- Sacris Erudiri - Volume 07 - 1955 PDFDokument414 SeitenSacris Erudiri - Volume 07 - 1955 PDFL'uomo della RinascitáNoch keine Bewertungen
- (1911) Lewin-R., Luthers Stellung Zu Den Juden: Ein Beitrag Zur Geschichte Der Juden in Deutschland Während Des ReformationszeitaltersDokument135 Seiten(1911) Lewin-R., Luthers Stellung Zu Den Juden: Ein Beitrag Zur Geschichte Der Juden in Deutschland Während Des Reformationszeitaltersgabritolo100% (1)
- Winkelmann 2004Dokument20 SeitenWinkelmann 2004Alejandro Sánchez GarcíaNoch keine Bewertungen
- Texte Und Untersuchungen Zur Geschichte Der Altchristlichen Literatur. 1883. Volume 37.Dokument948 SeitenTexte Und Untersuchungen Zur Geschichte Der Altchristlichen Literatur. 1883. Volume 37.Patrologia Latina, Graeca et Orientalis100% (1)
- Kopt Namen HasitzkaDokument120 SeitenKopt Namen HasitzkatrimitheusNoch keine Bewertungen
- Koptisch-Gnostische Schriften - Pistis Sophia - Die Zwei Bücher Des Jeû - Fragmente - Unbekanntes Altgnostisches Werk - HRSG v. Carl Schmitt, 1905 - PDF 448 S.Dokument448 SeitenKoptisch-Gnostische Schriften - Pistis Sophia - Die Zwei Bücher Des Jeû - Fragmente - Unbekanntes Altgnostisches Werk - HRSG v. Carl Schmitt, 1905 - PDF 448 S.Bookbobby100% (1)
- Wutz Onomastica Sacra IDokument1.252 SeitenWutz Onomastica Sacra IdamianjflemingNoch keine Bewertungen
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ-ΒΕΗΣ ΩΡΙΓΕΝΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣDokument177 SeitenΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ-ΒΕΗΣ ΩΡΙΓΕΝΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣΤάκης ΜαζαράκηςNoch keine Bewertungen
- Il Viaggio e La Memoria Il de Reditu SuDokument23 SeitenIl Viaggio e La Memoria Il de Reditu SucarloshdezrdizNoch keine Bewertungen
- StrategikonDokument557 SeitenStrategikonGeorge Leroi100% (1)
- PTS 60 3110181347Dokument528 SeitenPTS 60 3110181347sholariosNoch keine Bewertungen
- SCHMALZRIEDT, Egidius. Peri Physeos (Περὶ φύσεως) - Zur Frühgeschichte der Buchtitel (1970)Dokument141 SeitenSCHMALZRIEDT, Egidius. Peri Physeos (Περὶ φύσεως) - Zur Frühgeschichte der Buchtitel (1970)silencioemmovimentoNoch keine Bewertungen
- Kleine große Orgelwelt: 25 Beiträge von verschiedener Art gesammelt und herausgegeben von Silke BerduxVon EverandKleine große Orgelwelt: 25 Beiträge von verschiedener Art gesammelt und herausgegeben von Silke BerduxNoch keine Bewertungen
- (Sammlung Metzler) Klaus Peter (Auth.) - Friedrich Schlegel-J.B. Metzler (1978) PDFDokument103 Seiten(Sammlung Metzler) Klaus Peter (Auth.) - Friedrich Schlegel-J.B. Metzler (1978) PDFAnonymous uWo9lMaNoch keine Bewertungen
- Koptisch-Gnostische SchriftenDokument448 SeitenKoptisch-Gnostische Schriftenfer753100% (1)
- Texte Und Untersuchungen Zur Geschichte Der Altchristlichen Literatur. 1883. Volume 32.Dokument886 SeitenTexte Und Untersuchungen Zur Geschichte Der Altchristlichen Literatur. 1883. Volume 32.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNoch keine Bewertungen
- Sutler«Sberfe: Tit Sixt<SαίDokument452 SeitenSutler«Sberfe: Tit Sixt<SαίJonathan Pimentel ChacónNoch keine Bewertungen
- PTS 36 - Pseudo-Dionysius Areopagita, Band II. de Coelesti Hierarchia, de Ecclesiastica Hierarchia, de Mystica Theologia, Epistulae PDFDokument316 SeitenPTS 36 - Pseudo-Dionysius Areopagita, Band II. de Coelesti Hierarchia, de Ecclesiastica Hierarchia, de Mystica Theologia, Epistulae PDFnovitestamentistudiosus100% (3)
- Rudolf Kassel - C. Austin - Poetae Comici Graeci VII - Menecrates-Xenophon. 7-Walter de Gruyter (1989)Dokument848 SeitenRudolf Kassel - C. Austin - Poetae Comici Graeci VII - Menecrates-Xenophon. 7-Walter de Gruyter (1989)tfgfgfNoch keine Bewertungen
- Francois Bovon 2001 Lukas 3Dokument314 SeitenFrancois Bovon 2001 Lukas 3argirocano100% (1)
- Sic Et NonDokument19 SeitenSic Et NonHeliosa von OpetiNoch keine Bewertungen
- Fatouros - Krischer, Johannes Kantakuzenos. Geschichte, IDokument344 SeitenFatouros - Krischer, Johannes Kantakuzenos. Geschichte, IMiodrag MarkovicNoch keine Bewertungen
- Nicetae Choniatae Historia Pars Prior Praefationem Et Textum Continens PDFDokument780 SeitenNicetae Choniatae Historia Pars Prior Praefationem Et Textum Continens PDFMiguel FloresNoch keine Bewertungen
- Bulgakov Maestrul Si MargaretaDokument349 SeitenBulgakov Maestrul Si MargaretaIonut Biliuta0% (1)
- Meister EckhartDokument91 SeitenMeister EckhartkahisieNoch keine Bewertungen
- Allgemeines Kns 61 MLDokument324 SeitenAllgemeines Kns 61 MLEduardo BrandaoNoch keine Bewertungen
- Preisendanz, 1928 Papyri Graecae MagicaeDokument465 SeitenPreisendanz, 1928 Papyri Graecae MagicaeToni BaghiuNoch keine Bewertungen
- Einige Neue Beispiele Für HumanistaDokument26 SeitenEinige Neue Beispiele Für Humanistaj.ramminger618Noch keine Bewertungen
- Grützmacher. Synesios Von Kyrene: Ein Charakterbild Aus Dem Untergang Des Hellenentums. 1913.Dokument200 SeitenGrützmacher. Synesios Von Kyrene: Ein Charakterbild Aus Dem Untergang Des Hellenentums. 1913.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNoch keine Bewertungen
- Margarethe Billerbeck, Christian Zubler-Stephanus Von Byzanz - Stephani Byzantii Ethnica, Volumen II - Δ-Ι-Walter de Gruyter (2010)Dokument342 SeitenMargarethe Billerbeck, Christian Zubler-Stephanus Von Byzanz - Stephani Byzantii Ethnica, Volumen II - Δ-Ι-Walter de Gruyter (2010)Centar slobodarskih delatnosti d. o. o.Noch keine Bewertungen
- Sebastian Haffner - Anmerkungen Zu HitlerDokument31 SeitenSebastian Haffner - Anmerkungen Zu HitlertechjNoch keine Bewertungen
- GCS 29 Origenes Werke VI. Homilien Zum Hexateuch (1. Aufl. 1920: W. A. Baehrens)Dokument556 SeitenGCS 29 Origenes Werke VI. Homilien Zum Hexateuch (1. Aufl. 1920: W. A. Baehrens)Patrologia Latina, Graeca et Orientalis100% (2)
- Funk. Die Apostolischen Väter. 1901.Dokument298 SeitenFunk. Die Apostolischen Väter. 1901.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNoch keine Bewertungen
- Unveröffentlichte Schriften: Lennart HåkansonDokument184 SeitenUnveröffentlichte Schriften: Lennart Håkansonasssasin098Noch keine Bewertungen
- HUBERTI, Ludwig (1892) StudienZurRechtsgeseschichteDokument622 SeitenHUBERTI, Ludwig (1892) StudienZurRechtsgeseschichtejuan_de_heratNoch keine Bewertungen
- MARTIN OPITZ: Briefwechsel Und LebenszeugnisseDokument2 SeitenMARTIN OPITZ: Briefwechsel Und LebenszeugnisseXi JinpingNoch keine Bewertungen
- Jerome. Das Geschichtliche M-BildDokument58 SeitenJerome. Das Geschichtliche M-BildAlexandra KovacevicNoch keine Bewertungen
- Antike Christliche Apokryphen - BD - II - s.1059-1061Dokument3 SeitenAntike Christliche Apokryphen - BD - II - s.1059-1061bookfriendNoch keine Bewertungen
- Die Walkenrieder Chronik: Chronica und historische Beschreibung des löblichen und weltberümbten keyserlichen freien Stiffts und Closters Walckenrieth (1598)Von EverandDie Walkenrieder Chronik: Chronica und historische Beschreibung des löblichen und weltberümbten keyserlichen freien Stiffts und Closters Walckenrieth (1598)Noch keine Bewertungen
- Johannes Duns Scotus Opera Omnia Volume 1Dokument688 SeitenJohannes Duns Scotus Opera Omnia Volume 1Linas Kondratas100% (7)
- Karl Heinrich Menges: Briefe. Teil II: Briefwechsel mit M. Vasmer aus den Jahren 1950-1960Von EverandKarl Heinrich Menges: Briefe. Teil II: Briefwechsel mit M. Vasmer aus den Jahren 1950-1960Noch keine Bewertungen
- Kirchengeschicht 21 PhiluoftDokument522 SeitenKirchengeschicht 21 PhiluoftPeter SmirinNoch keine Bewertungen
- Calvin, Eberhard Busch U.A. (HG.) - Calvin-Studienausgabe, Band 1. Reformatorische Anfänge (1533-1541), 2 Teilbände-Neukirchener Verlag (1994) PDFDokument544 SeitenCalvin, Eberhard Busch U.A. (HG.) - Calvin-Studienausgabe, Band 1. Reformatorische Anfänge (1533-1541), 2 Teilbände-Neukirchener Verlag (1994) PDFLeopoldo Cervantes-OrtizNoch keine Bewertungen
- Ga 038 PDFDokument341 SeitenGa 038 PDFodysseetheaterNoch keine Bewertungen
- Griechische Kalendar 1 Antiochus Boll 1910Dokument27 SeitenGriechische Kalendar 1 Antiochus Boll 1910roger_pearseNoch keine Bewertungen
- (Patristische Texte und Studien 67) Günter Heil, Adolf Martin Ritter-Corpus Dionysiacum II. Pseudo-Dionysius Areopagita_ De Coelesti Hierarchia, De Ecclesiastica Hierarchia, De Mystica Theologia, Epis.pdfDokument317 Seiten(Patristische Texte und Studien 67) Günter Heil, Adolf Martin Ritter-Corpus Dionysiacum II. Pseudo-Dionysius Areopagita_ De Coelesti Hierarchia, De Ecclesiastica Hierarchia, De Mystica Theologia, Epis.pdfNita RobertNoch keine Bewertungen
- Texte Und Untersuchungen Zur Geschichte Der Altchristlichen Literatur. 1883. Volume 42.Dokument808 SeitenTexte Und Untersuchungen Zur Geschichte Der Altchristlichen Literatur. 1883. Volume 42.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNoch keine Bewertungen
- Schmidt, Gespräche Jesu Mit Seinen Jüngern Nach Der AuferstehungDokument840 SeitenSchmidt, Gespräche Jesu Mit Seinen Jüngern Nach Der AuferstehungalverlinNoch keine Bewertungen
- Geschichte Der Englischen Sprache Und Literaturvon Den Ältesten Zeiten Bis Zur Einführung Der Buchdruckerkunst by Behnsch, Ottomar, 1813-1869Dokument158 SeitenGeschichte Der Englischen Sprache Und Literaturvon Den Ältesten Zeiten Bis Zur Einführung Der Buchdruckerkunst by Behnsch, Ottomar, 1813-1869Gutenberg.org100% (1)
- M. Akerman, Über Die Echtheit Der Letzteren Hälfte Von Tertullians Adversus Iudaeos, Lund 1918Dokument130 SeitenM. Akerman, Über Die Echtheit Der Letzteren Hälfte Von Tertullians Adversus Iudaeos, Lund 1918diadassNoch keine Bewertungen
- Brot des Evangeliums - Verteidigung der Franziskus-Regel: Kritische Edition des Textes mit Einführung und Übersetzung von Johannes Karl Schlageter OFMVon EverandBrot des Evangeliums - Verteidigung der Franziskus-Regel: Kritische Edition des Textes mit Einführung und Übersetzung von Johannes Karl Schlageter OFMNoch keine Bewertungen
- Wolf, Johannes - Handbuch Der Notationskunde (Breitkopf & Härtel, 1913-1919)Dokument1.142 SeitenWolf, Johannes - Handbuch Der Notationskunde (Breitkopf & Härtel, 1913-1919)fefefeNoch keine Bewertungen
- Merkblatt Zur Abfassung Von WUNT BändenDokument5 SeitenMerkblatt Zur Abfassung Von WUNT BändenbookfriendNoch keine Bewertungen
- STT8 2013 CWassermann DEDokument12 SeitenSTT8 2013 CWassermann DEbookfriendNoch keine Bewertungen
- Wehnert - FestschriftenDokument32 SeitenWehnert - FestschriftenbookfriendNoch keine Bewertungen
- STT10 3 Goldsmith DEDokument8 SeitenSTT10 3 Goldsmith DEbookfriendNoch keine Bewertungen
- STT08 4 Piennisch DEDokument19 SeitenSTT08 4 Piennisch DEbookfriendNoch keine Bewertungen
- STT7 2012 PWassermann DEDokument16 SeitenSTT7 2012 PWassermann DEbookfriendNoch keine Bewertungen
- Entstehung Und Überlieferung Des Neuen TestamentsDokument23 SeitenEntstehung Und Überlieferung Des Neuen TestamentsbookfriendNoch keine Bewertungen
- m1 Einfuehrung in Das NTDokument174 Seitenm1 Einfuehrung in Das NTbookfriendNoch keine Bewertungen
- Billeter - GottDokument32 SeitenBilleter - GottbookfriendNoch keine Bewertungen
- Remmert - Bibelexte in Der MusikDokument232 SeitenRemmert - Bibelexte in Der MusikbookfriendNoch keine Bewertungen
- Die Bibel - Eine BibliothekDokument14 SeitenDie Bibel - Eine BibliothekbookfriendNoch keine Bewertungen
- Skript Grabner-Haider - Kulturphilosophie GR RömDokument39 SeitenSkript Grabner-Haider - Kulturphilosophie GR RömbookfriendNoch keine Bewertungen
- Impulse - BibelDokument24 SeitenImpulse - BibelbookfriendNoch keine Bewertungen
- Orientierung Zitieren VDokument14 SeitenOrientierung Zitieren VbookfriendNoch keine Bewertungen
- Skript GottheitenDokument78 SeitenSkript GottheitenbookfriendNoch keine Bewertungen
- Siebenbürgens Geographisch TopographiscDokument495 SeitenSiebenbürgens Geographisch TopographiscCarlos_RuedasNoch keine Bewertungen
- Muster Untermietvertrag 123um deDokument2 SeitenMuster Untermietvertrag 123um deAndre DuvenNoch keine Bewertungen
- b1 Das Verb Lassen Teil 2 7 Arbeitsblatter Grammatikerklarungen Grammatikubung 128126Dokument9 Seitenb1 Das Verb Lassen Teil 2 7 Arbeitsblatter Grammatikerklarungen Grammatikubung 128126indy25% (4)
- Script - Investment Punkt - Warum Ihr Schuftet Und Wir Reich WerdenDokument2 SeitenScript - Investment Punkt - Warum Ihr Schuftet Und Wir Reich WerdennitikaNoch keine Bewertungen
- Deutschklasse Lektion 6 B Transitive Verben - Akkusativ - VerblisteDokument2 SeitenDeutschklasse Lektion 6 B Transitive Verben - Akkusativ - VerblisteAmmiel Trejo FloresNoch keine Bewertungen
- Sia 358Dokument28 SeitenSia 358asfdad100% (2)
- Weg Zum Selbst - Zen-Wirklichkeit (Von Uchiyama Roshi)Dokument44 SeitenWeg Zum Selbst - Zen-Wirklichkeit (Von Uchiyama Roshi)Zorita Campeanu100% (3)