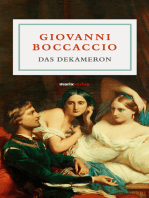Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
14.01 Interpretation
14.01 Interpretation
Hochgeladen von
kirud222777999Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
14.01 Interpretation
14.01 Interpretation
Hochgeladen von
kirud222777999Copyright:
Verfügbare Formate
Kyrylo Udovychenko
Das Sonett “Menschliche Elende” von Andreas Gryphius wurde im Jahr 1663 veröffentlicht. Darin
schreibt der Dichter über das Problem der Schmerzlichkeit, Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit des
menschlichen Lebens. Bereits der Titel lässt diesen Eindruck erkennen. Das Gedicht kann der Epoche
des Barock zugeordnet werden.
Das Gedicht ist in 4 Strophen gegliedert, in jeweils 2 Quartette und 2 Terzette. Insgesamt besteht das
Sonett aus 14 Versen. Es lassen sich 2 Reimschemen erkennen. Die Quartette weisen den
umarmenden Reim auf. In denen wechseln sich weibliche und männliche Kadenzen ab. Gleichzeitig
gibt es in den Terzetten den Schweifreim. Männliche und weibliche Kadenzen wechseln sich ab. Ein
Blick auf Versmaß offenbart den Lesern, dass im Gedicht der 6-hebiger Jambus vorhanden ist. In der
literarischen Sprache nennt sich solcher Versfuß Alexandriner. Manche Verse sind durch die Zäsur in
der Mitte getrennt.
Das Sonett ist im 17. Jahrhundert verfasst und es lässt sich eine veraltete Schreibweise von den
deutschen Worten erkennen. In der ersten Strophe wird gleich eine gewaltige rhetorische Frage
gestellt, die das Problem des menschlichen Seins beschreibt. Gleich darauf folgt die Metapher, die
den menschlichen Körper als „ein Wohnhauß grimmer Schmertzen“ darstellt. „Das falsche Gluck“ im
zweiten Vers besagt, dass das Glück nicht echt ist, dass die Welt nur aus Betrug besteht. In der
Strophe werden weitere Stilmittel verwendet, die das Leben sehr widersprüchlich schildern. Diese
Gegensätzlichkeit ist ein typisches Merkmal der Barockzeit, das wiederum in anderen auftretenden
Wörtern wie „Schauplatz herber Angst“ oder „abgebrannte Kerzen“ beschreibt, wie vergänglich das
Leben ist. In beiden Quartetten und im letzten Terzett sind Anaphern vorhanden. Im ersten Vers der
zweiten Strophe gibt es eine Personifikation, die wieder die Vergänglichkeit des Lebens verdeutlicht.
In der letzten Zeile des ersten Terzetts lässt sich ein Polysyndeton erkennen. Gleich danach sieht man
eine Antithese, die die vorhandenen Motive unterstreicht. In den dritten und vierten Strophen sind
Alliterationen vorhanden.
Im Sonett werden die negativen Stellen des Menschen und die schmerzlichen Dinge im Leben
aufgegriffen. Durch mehrere Stilmittel und Ausdrücke betont der Autor, dass das Leben schnell
vergeht und jeder sterben wird. Er hebt die Unwichtigkeit der Menschen auf der Erde hervor. Dafür
steht das typische Motiv dieser Zeit, der Vanitas-Gedanke, der besagt, dass das Irdische wertlos ist
und dass uns ein erfülltes Leben nach dem Tod erwartet. Memento mori ist ein weiteres Motiv der
Barockzeit, wobei das Leben als unbedeutend dargestellt wird. Damit versucht der Autor, uns
entsprechend seiner Zeit zu übermitteln, dass man sich das eigene Leben neu überdenken soll.
408 Wörter
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Einfuhrung in Die Deutsche LiteraturDokument99 SeitenEinfuhrung in Die Deutsche LiteraturErko Erko100% (1)
- Anne-Kathrin Reif - Zur Bedeutung Der Liebe Im Werk Von Albert CamusDokument333 SeitenAnne-Kathrin Reif - Zur Bedeutung Der Liebe Im Werk Von Albert Camusmike960Noch keine Bewertungen
- Beispiel Einer GedichtanalyseDokument2 SeitenBeispiel Einer GedichtanalyseYavuz Selim DemirkurtNoch keine Bewertungen
- Ab Schluss ArbeitDokument31 SeitenAb Schluss ArbeitAnna NersesyanNoch keine Bewertungen
- Gedichtsvergleich - Vergänglichkeit Der Schönheit Und Beobachtungen An Einer Jungen FrauDokument5 SeitenGedichtsvergleich - Vergänglichkeit Der Schönheit Und Beobachtungen An Einer Jungen FrauMatze Friedrich100% (1)
- Perfekt 1Dokument1 SeitePerfekt 1MădălinaElenaNoch keine Bewertungen
- Die Konjunktionen Damit Und Um... ZuDokument25 SeitenDie Konjunktionen Damit Und Um... ZuGabriel Bessa MaesNoch keine Bewertungen
- LiteraturgeschichteDokument37 SeitenLiteraturgeschichteIvana Radovanovic100% (1)
- Verben Mit PräpositionalobjektDokument2 SeitenVerben Mit PräpositionalobjektGirindra Wiratni PuspaNoch keine Bewertungen
- Infinitiz + Zu Und Dass-SätzeDokument3 SeitenInfinitiz + Zu Und Dass-SätzeMilan Ristic100% (1)
- Básico 1 Starten Wir Korrigiert.Dokument4 SeitenBásico 1 Starten Wir Korrigiert.Carlo Tellez WithbrownNoch keine Bewertungen
- Gediichtsinterpretation PDFDokument3 SeitenGediichtsinterpretation PDFjormaNoch keine Bewertungen
- Nominativ VerbenDokument6 SeitenNominativ VerbenAarti100% (1)
- Ebenbild Unseres LebensDokument2 SeitenEbenbild Unseres Lebensluis 1012Noch keine Bewertungen
- GedichtinterpretationDokument2 SeitenGedichtinterpretationLaura MiggianoNoch keine Bewertungen
- Lyrik Des BarocksDokument16 SeitenLyrik Des BarocksNeha UpadhyayaNoch keine Bewertungen
- Gedichtsanalyse 3Dokument1 SeiteGedichtsanalyse 3walter.treehackerNoch keine Bewertungen
- Die RomantikDokument7 SeitenDie Romantikgbn2tfhqm2Noch keine Bewertungen
- Gedichtsanalyse 1Dokument1 SeiteGedichtsanalyse 1walter.treehackerNoch keine Bewertungen
- Medea - Ingeborg BachmannDokument7 SeitenMedea - Ingeborg BachmannAlieNoch keine Bewertungen
- Das Gespenst Der Nachträglichkeit (Peter Handke)Dokument12 SeitenDas Gespenst Der Nachträglichkeit (Peter Handke)Christian Soazo AhumadaNoch keine Bewertungen
- Ha Zauberlehrling Ss2003Dokument11 SeitenHa Zauberlehrling Ss2003Gruia AndreeaNoch keine Bewertungen
- TRISTANA - EINE WERKAUSGABE: Ausgewählte Texte 1988 - 2018Von EverandTRISTANA - EINE WERKAUSGABE: Ausgewählte Texte 1988 - 2018Noch keine Bewertungen
- TextinterpretationDokument1 SeiteTextinterpretationana.ist.coolxxNoch keine Bewertungen
- Friedrich Gottlieb KlopstockDokument7 SeitenFriedrich Gottlieb Klopstockhcba333Noch keine Bewertungen
- Das Lyrische Werk Des Alvaro de CamposDokument2 SeitenDas Lyrische Werk Des Alvaro de CamposKatie FagottiNoch keine Bewertungen
- Deutsch HandoutDokument8 SeitenDeutsch Handoutمهدان بومNoch keine Bewertungen
- Bachmann UndineDokument7 SeitenBachmann UndineHelena PavićNoch keine Bewertungen
- Von Rimbaud zu Camus: Fünf Autoren des Existentialismus Arthur Rimbaud, Rainer Maria Rilke, Lion Feuchtwanger, François Mauriac, Albert CamusVon EverandVon Rimbaud zu Camus: Fünf Autoren des Existentialismus Arthur Rimbaud, Rainer Maria Rilke, Lion Feuchtwanger, François Mauriac, Albert CamusNoch keine Bewertungen
- Lektuere Gruppe 8Dokument3 SeitenLektuere Gruppe 8buzzerjobsNoch keine Bewertungen
- Interpretation WeltuntergangDokument1 SeiteInterpretation WeltuntergangElmo54321Noch keine Bewertungen
- Lissabonner Dichter. Camões, Cesário, Sá-Carneiro, Florbela, PessoaVon EverandLissabonner Dichter. Camões, Cesário, Sá-Carneiro, Florbela, PessoaNoch keine Bewertungen
- Dane On Brecht PDFDokument14 SeitenDane On Brecht PDFAnonymous t3eur8OH8Noch keine Bewertungen
- Toderita - Die Wege Und Die BegegnungenDokument2 SeitenToderita - Die Wege Und Die BegegnungenToamsNoch keine Bewertungen
- Günter Eich-Latrine-GedichinterpretationDokument1 SeiteGünter Eich-Latrine-GedichinterpretationStefan Cel MareNoch keine Bewertungen
- Rainer Maria Rilkes Gedichte: Das Stunden-Buch, Das Buch der Bilder, Neue Gedichte, Der neuen Gedichte anderer Teil, Requiem, Das Marien-Leben, Duineser Elegien, Die Sonette an OrpheusVon EverandRainer Maria Rilkes Gedichte: Das Stunden-Buch, Das Buch der Bilder, Neue Gedichte, Der neuen Gedichte anderer Teil, Requiem, Das Marien-Leben, Duineser Elegien, Die Sonette an OrpheusNoch keine Bewertungen
- Gedichtsvergleich Deutsch LKDokument4 SeitenGedichtsvergleich Deutsch LKkarlNoch keine Bewertungen
- Romantische Merkmale in Der NovelleDokument2 SeitenRomantische Merkmale in Der NovelleCyntia HoborNoch keine Bewertungen
- Mauerschau 4 ConternoDokument21 SeitenMauerschau 4 Conternosara_23896Noch keine Bewertungen
- Eichendorff Sehnsucht 02Dokument2 SeitenEichendorff Sehnsucht 02JiJiMimitattouNoch keine Bewertungen
- Gedichtinterpretation: Weltende" (1905) Von Else Lasker-SchülerDokument2 SeitenGedichtinterpretation: Weltende" (1905) Von Else Lasker-SchülerNils LainerNoch keine Bewertungen
- Referat Lyrik Shaswati MamDokument13 SeitenReferat Lyrik Shaswati MamNeha UpadhyayaNoch keine Bewertungen
- Jean Philippe ToussaintDokument13 SeitenJean Philippe ToussaintEdgar Maier0% (1)
- MondnachtDokument2 SeitenMondnachtqf5m489yrfNoch keine Bewertungen
- Acht Thesen Zu Christoph Ransmayrs Roman Die Letzte Welt"Dokument10 SeitenAcht Thesen Zu Christoph Ransmayrs Roman Die Letzte Welt"Akissi Eugenie KouassiNoch keine Bewertungen
- Literatur Der PostmoderneDokument2 SeitenLiteratur Der PostmoderneDjurdja KrnjetaNoch keine Bewertungen
- Diplomski-Chamisso AndjelkaDokument12 SeitenDiplomski-Chamisso Andjelkabata dzordzNoch keine Bewertungen
- Rainer Maria Rilkes Prosa: Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke, Malte Laurids Brigge, Erzählungen, Geschichten vom lieben Gott, Auguste RodinVon EverandRainer Maria Rilkes Prosa: Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke, Malte Laurids Brigge, Erzählungen, Geschichten vom lieben Gott, Auguste RodinNoch keine Bewertungen
- Hauptthemen Expressionismus VelikovDokument13 SeitenHauptthemen Expressionismus VelikovElena Rusu100% (1)
- Sehnsucht GedichtsanalyseDokument3 SeitenSehnsucht GedichtsanalysesofiaNoch keine Bewertungen
- DeutschHA - Es Ist Alles EitelDokument2 SeitenDeutschHA - Es Ist Alles EitelhennyboyNoch keine Bewertungen
- Amobo Ebook 1474Dokument336 SeitenAmobo Ebook 1474André KovàcsNoch keine Bewertungen
- Boschenstein-Studien Zur Dichtung Des Absoluten PDFDokument178 SeitenBoschenstein-Studien Zur Dichtung Des Absoluten PDFTrad AnonNoch keine Bewertungen
- Konig Chilperich Als Lateinischer Dichter Von U. KINDERMANNDokument26 SeitenKonig Chilperich Als Lateinischer Dichter Von U. KINDERMANNneddyteddyNoch keine Bewertungen
- Ge Dicht Ver GleichDokument4 SeitenGe Dicht Ver GleichMonica PuscasuNoch keine Bewertungen
- Soare Frau BouraDokument8 SeitenSoare Frau BouraSoare VafoungbeNoch keine Bewertungen
- Der Panther AnalyseDokument1 SeiteDer Panther AnalysejoresskeNoch keine Bewertungen
- Französisches Gedicht - AnalyseDokument4 SeitenFranzösisches Gedicht - AnalyseSophie FrischknechtNoch keine Bewertungen
- Seminar ArbeitDokument14 SeitenSeminar ArbeitVeronika MačuhováNoch keine Bewertungen
- Augen in Der Großstadt OneDokument5 SeitenAugen in Der Großstadt OneT Series Ka BapNoch keine Bewertungen
- Die Welt GedichtDokument1 SeiteDie Welt Gedichthennyboy100% (1)
- Stefan Zweig. Das Gesamtwerk. illustriert: Der Amokläufer, Verwirrung der Gefühle, Schachnovelle, Sternstunden der MenschheitVon EverandStefan Zweig. Das Gesamtwerk. illustriert: Der Amokläufer, Verwirrung der Gefühle, Schachnovelle, Sternstunden der MenschheitNoch keine Bewertungen
- Der Deutsche Roman.: Zur Notwendigkeit Einer Theorie Und Zur Herkunft Des RomansDokument23 SeitenDer Deutsche Roman.: Zur Notwendigkeit Einer Theorie Und Zur Herkunft Des RomansDash FaceNoch keine Bewertungen
- TonioDokument6 SeitenToniocezymaryNoch keine Bewertungen
- Besonderheiten Im Gebrauch Von Sekundaren PrapositionenDokument14 SeitenBesonderheiten Im Gebrauch Von Sekundaren PrapositionenLinuleaNoch keine Bewertungen
- DativDokument1 SeiteDativFlorina LozaNoch keine Bewertungen
- Allgemeine Vergleichende SprachwissenschaftDokument18 SeitenAllgemeine Vergleichende SprachwissenschaftCilia JesikaNoch keine Bewertungen
- Busuu+Live+Lesson+18+ (I+Feel+Like+Eating+Bratwurst) + +de+a1+ +studentDokument21 SeitenBusuu+Live+Lesson+18+ (I+Feel+Like+Eating+Bratwurst) + +de+a1+ +studentالمصمم:- ياسين الاسدNoch keine Bewertungen
- Mensch Sprachen Kulturen PDFDokument502 SeitenMensch Sprachen Kulturen PDFElisaNoch keine Bewertungen
- DSD II. Kobor AgiDokument15 SeitenDSD II. Kobor AgiKatalin MolnárNoch keine Bewertungen
- Kapitel 2. Paradigmatische Und Syntagmatische Beziehungen Im Lexisch-Semantischen SysteDokument7 SeitenKapitel 2. Paradigmatische Und Syntagmatische Beziehungen Im Lexisch-Semantischen Systeг ыNoch keine Bewertungen
- Expresii Cu Adjective Si Adverbe La DativDokument2 SeitenExpresii Cu Adjective Si Adverbe La Dativdan_petre_popescuNoch keine Bewertungen
- Lingu Semester 2-4Dokument30 SeitenLingu Semester 2-4Hager HassanNoch keine Bewertungen
- Present Progressive - Verlaufsform Der GegenwartDokument17 SeitenPresent Progressive - Verlaufsform Der GegenwartwengNoch keine Bewertungen
- Gedichtinterpretation MailiedDokument2 SeitenGedichtinterpretation Mailiedschray9822Noch keine Bewertungen
- Muster 25Dokument4 SeitenMuster 25bar.tsogzolmaaNoch keine Bewertungen
- Partizipformen (0302)Dokument2 SeitenPartizipformen (0302)smiller benololNoch keine Bewertungen
- Zeitangaben B1 16 Juin 2020Dokument12 SeitenZeitangaben B1 16 Juin 2020CoWorking C-Class Tana0% (1)
- Wortarten Erkennen 2 Adjektive Nomen Und Verben Arbeitsblatter - 135753Dokument5 SeitenWortarten Erkennen 2 Adjektive Nomen Und Verben Arbeitsblatter - 135753ibtihel khallediNoch keine Bewertungen
- Say It Better - Marianna PascalDokument388 SeitenSay It Better - Marianna Pascalwai monNoch keine Bewertungen
- Förderung Der SchreibkompetenzDokument18 SeitenFörderung Der SchreibkompetenzTrần Diễm Ngọc HuyềnNoch keine Bewertungen
- Wortschatz B1 So Geht Zu Lesen MT 4Dokument4 SeitenWortschatz B1 So Geht Zu Lesen MT 4Salsa BilaNoch keine Bewertungen
- Der AkkusativDokument5 SeitenDer AkkusativBimo AdiyantoNoch keine Bewertungen
- Wie Findest Du Die KleidungDokument2 SeitenWie Findest Du Die KleidungElisa AryaniNoch keine Bewertungen
- Althochdeutsches00mansuoft PDFDokument200 SeitenAlthochdeutsches00mansuoft PDFLuca BenelliNoch keine Bewertungen