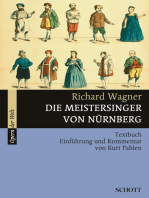Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
William Walton Viola Concerto in A Minor
Hochgeladen von
marcel bajanianOriginaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
William Walton Viola Concerto in A Minor
Hochgeladen von
marcel bajanianCopyright:
Verfügbare Formate
William Walton: Violakonzert a-Moll
Werkeinführung von Wendelin Bitzan
Viele bedeutende und fest in den Spielplänen verankerte symphonische Werke teilen ein gemeinsames
Schicksal: sie wurden von Zeitgenossen und ersten Interpreten zunächst nicht gewürdigt und konnten sich
erst mit einer gewissen Verspätung durchsetzen. Dies betrifft insbesondere Konzerte für ein Soloinstrument
und Orchester – es ranken sich Legenden um Werke von Brahms, Tschaikowskij und anderer Autoren, die
von den Virtuosen, welchen sie in die Finger geschrieben worden waren, aufgrund der enthaltenen techni-
schen Schwierigkeiten als unspielbar zurückgewiesen wurden. Häufig bedurfte es dann anderer Interpreten,
die einsprangen und dem suspekten Solopart schließlich zu einer triumphalen Premiere verhalfen, so dass
sich viele der Werke, die ihren Widmungsträgern als eine Zumutung galten, in der Folge zu Kernstücken des
Repertoires und zu Prüfsteinen für Generationen folgender Instrumentalisten entwickelten.
Auch das heute erklingende, in den Jahren 1928 und 1929 entstandene Violakonzert des Engländers William
Walton weiß eine solche Geschichte zu erzählen – und besitzt eine besondere Verbindung zu dem Kompo-
nisten und Bratschisten Paul Hindemith, einer der profiliertesten Gestalten des Berliner Musiklebens im ver-
gangenen Jahrhundert. Der englische Bratschenvirtuose Lionel Tertis, für den Walton das Konzert auf Anre-
gung des Dirigenten Sir Thomas Beecham geschrieben hatte, zeigte sich wenig angetan und sandte die Parti-
tur umgehend an Walton zurück, mit der Begründung, das Werk sei »zu modern«. Glücklicherweise war
Hindemith anderer Meinung und brachte das Konzert im Oktober 1929 in der Londoner Queen’s Hall zur
Uraufführung, die vom Komponisten selbst geleitet wurde. Damit setzte Hindemith sich gegen seinen Kon-
zertagenten durch, der diese Aufführung gern zugunsten einer Premiere in einer finanziell einträglicheren
Konzertreihe verhindert hätte. Gleichwohl wurde das Violakonzert enthusiastisch gefeiert, und Tertis, der die
Uraufführung gehört hatte, sah sich veranlasst, sich bei Walton zu entschuldigen und das Werk doch ins Pro-
gramm zu nehmen. Er spielte es später in Lüttich und 1932 in Worcester, wo auch das einzige Zusammen-
treffen Waltons mit Edward Elgar stattfand, dessen Gleichgültigkeit den jungen Komponisten nicht davon
abhielt, seinen älteren Kollegen zutiefst zu verehren.
Tertis’ spontanes Urteil muss den Hörer aus heutiger Perspektive verwundern, denn das Violakonzert gilt als
eines der Werke, in denen der junge Walton nach einer eher experimentellen Phase zu einem ungetrübt tona-
len, von der Spätromantik inspirierten Kompositionsstil zurückfand. Der in Lancashire in eine Musikerfami-
lie geborene und in Oxford ausgebildete Komponist war zunächst mit der gewagten Lyrikvertonung Façade
– An Entertainment hervorgetreten, welche ihn als Avantgardisten bekannt machte. Die in der Folge vollzo-
gene Hinwendung zur Harmonik des 19. Jahrhunderts führte Walton in den 1920er Jahren zu durchaus be-
merkenswerten Resultaten, für die das dreisätzige Violakonzert als erstes Beispiel dienen kann. Der Kompo-
nist unterzog es im Jahr 1962 einer Revision, die den Orchesterapparat gegenüber der Originalbesetzung,
welche dreifache Holzbläser verlangt hatte, verkleinerte. Er verzichtete auch auf eine dritte Trompete und
eine Tuba, fügte aber eine Harfenstimme hinzu, welche an vielen Stellen prägnant hervortritt. Heute zu hören
ist die revidierte Fassung, welche vom Komponisten bevorzugt wurde.
Der getragene Kopfsatz exponiert nach dreitaktiger Orchestereinleitung das lyrische Hauptthema in der
Grundtonart a-Moll, zunächst von der Soloviola vorgestellt und später von der Oboe übernommen. Ein apar-
tes Seitenthema, wieder der Bratsche in Sexten-Doppelgriffen gewidmet, schwankt zwischen Dur und Moll,
bevor der Satz sich zweimal zu dynamischen, brillant instrumentierten Gipfeln aufschwingt. Der zweite Satz,
eine virtuose Caprice mit dem unwiderstehlichen Charme eines perpetuum mobile, kontrastiert in allen Be-
langen; Soloinstrument und Orchester ergehen sich gleichermaßen in Sechzehntelkaskaden und rhythmi-
schen Raffinessen. Das tonikale e-Moll besitzt nur für Beginn und Schluss des Satzes Bedeutung. Im Finale,
welches etwa so lang dauert wie die beiden vorangegangenen Sätze, werden beide Charaktere versöhnt. Wal-
ton hebt mit einem burlesken Fagottsolo an, das eine Quinte höher von der Soloviola übernommen und im
weiteren Verlauf vielfältig transponiert und auch augmentiert wird. Eine längere Passage ohne Beteiligung
des Solisten schließt sich an, in welcher der stilistische Einfluss Hindemiths unverkennbar ist. Schließlich
gelangt das Fagott-Thema mit dem Hauptthema des ersten Satzes zur Synthese. Das Werk endet, im Tonge-
schlecht ambivalent, mit einer Reminiszenz an die Sexten-Doppelgriffe seines Beginns.
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Booklet Sol Gabetta Schumann 2019Dokument11 SeitenBooklet Sol Gabetta Schumann 2019Carlos DaneriNoch keine Bewertungen
- Geschichte Der Sinfonie Und SuiteDokument362 SeitenGeschichte Der Sinfonie Und SuiteJean-Marie Poirier0% (1)
- Woyrsch - Sinfonías 4 y 5Dokument33 SeitenWoyrsch - Sinfonías 4 y 5César SalazarNoch keine Bewertungen
- Sinfonie (Beethoven) : InhaltsverzeichnisDokument15 SeitenSinfonie (Beethoven) : InhaltsverzeichnisdrsartorisNoch keine Bewertungen
- Sergej RachmaninowDokument13 SeitenSergej Rachmaninowsmeets1984Noch keine Bewertungen
- 201302271216Dokument3 Seiten201302271216GiuliBa100% (1)
- Felix Mendelssohn - SchottischeDokument4 SeitenFelix Mendelssohn - SchottischeYu-Chen FanNoch keine Bewertungen
- Eichendorff Und Die MusikDokument20 SeitenEichendorff Und Die Musikzonkwc100% (1)
- Streichtrio Der Akademie St. BlasiusDokument8 SeitenStreichtrio Der Akademie St. BlasiusEva SchintlmeisterNoch keine Bewertungen
- Albetchberger Jew's Harp ConcertoDokument21 SeitenAlbetchberger Jew's Harp Concertothe_eriolNoch keine Bewertungen
- BookletDokument15 SeitenBookletMarioAdrover0% (1)
- Wirén - Sinfonías 4 y 5 PDFDokument25 SeitenWirén - Sinfonías 4 y 5 PDFCésar SalazarNoch keine Bewertungen
- Britten Simple SymphonyDokument1 SeiteBritten Simple SymphonyScribdTranslationsNoch keine Bewertungen
- 201302271216Dokument3 Seiten201302271216Geovanni de Jesús ValleNoch keine Bewertungen
- Na 7391 PDFDokument10 SeitenNa 7391 PDFLatoya Cain0% (1)
- Dittersdorf Concerto No 2 in Do Ed Trumpf Contrabass PDFDokument16 SeitenDittersdorf Concerto No 2 in Do Ed Trumpf Contrabass PDFjavierdb93Noch keine Bewertungen
- Analyse Und Kontextualisierung Eines WerkesDokument5 SeitenAnalyse Und Kontextualisierung Eines WerkesSilvia MacejovaNoch keine Bewertungen
- Bachelor ArbeitDokument13 SeitenBachelor ArbeitMiguel Moreira MataNoch keine Bewertungen
- Beethoven Folge 24Dokument13 SeitenBeethoven Folge 24music79210Noch keine Bewertungen
- Telemann - Der SchulmeisterDokument51 SeitenTelemann - Der SchulmeisterGiovanniNoch keine Bewertungen
- 10 - Das InstrumentalkonzertDokument4 Seiten10 - Das InstrumentalkonzertmasterbjNoch keine Bewertungen
- 8 PDFDokument20 Seiten8 PDFJorgeNoch keine Bewertungen
- Französischer HochbarockDokument8 SeitenFranzösischer HochbarockPetra MusicNoch keine Bewertungen
- 076 - Jannibelli POur Orgue Ou HarmoniumDokument19 Seiten076 - Jannibelli POur Orgue Ou HarmoniumisseauNoch keine Bewertungen
- Bruckner Sinfonia 7 (Análisis)Dokument16 SeitenBruckner Sinfonia 7 (Análisis)J Ignacio ÁlvarezNoch keine Bewertungen
- Booklet - Fascination OperaDokument16 SeitenBooklet - Fascination OperaAdilson J. de AssisNoch keine Bewertungen
- Digital Booklet - Brahms Violin Concerto - Double Concerto PDFDokument15 SeitenDigital Booklet - Brahms Violin Concerto - Double Concerto PDFpedroNoch keine Bewertungen
- Vorwort: Society Und Der Ancient Concerts, AlsDokument3 SeitenVorwort: Society Und Der Ancient Concerts, AlsJavier DazaNoch keine Bewertungen
- Amerikanische Experimentalmusik (Wolfgang Rebner, 1954)Dokument7 SeitenAmerikanische Experimentalmusik (Wolfgang Rebner, 1954)Thomas PattesonNoch keine Bewertungen
- Novalis CD 150 201-2 Booklet WebDokument20 SeitenNovalis CD 150 201-2 Booklet WebMarkManionNoch keine Bewertungen
- Webern Op 6 AnalyseDokument8 SeitenWebern Op 6 AnalyseWen Yee TangNoch keine Bewertungen
- Russische Klavierschule - Von Rubinstein Bis SchostakowitschDokument3 SeitenRussische Klavierschule - Von Rubinstein Bis Schostakowitschmaiakinfo100% (1)
- Wiese Floete Undine 4 2012Dokument16 SeitenWiese Floete Undine 4 2012Novica Jovanovic-NockaNoch keine Bewertungen
- медтнерDokument2 SeitenмедтнерOksanaNoch keine Bewertungen
- Weber Trio G Minor Op. 63 For Piano, Flute and Violoncello (Henle)Dokument44 SeitenWeber Trio G Minor Op. 63 For Piano, Flute and Violoncello (Henle)kowoyoshiNoch keine Bewertungen
- Konzertdokumentation Karoline Borleis Form.Dokument13 SeitenKonzertdokumentation Karoline Borleis Form.BorleisNoch keine Bewertungen
- CV 18011Dokument32 SeitenCV 18011Moritz SchönauerNoch keine Bewertungen
- HMC902216Dokument9 SeitenHMC902216Eloy ArósioNoch keine Bewertungen
- Die Meistersinger von Nürnberg: Textbuch - Einführung und KommentarVon EverandDie Meistersinger von Nürnberg: Textbuch - Einführung und KommentarBewertung: 3.5 von 5 Sternen3.5/5 (8)
- Referat MozartDokument1 SeiteReferat MozartcesilalindaNoch keine Bewertungen
- Storia Dell'oboe PDFDokument0 SeitenStoria Dell'oboe PDFRaz Marin100% (1)
- Mahler Sinfonia N 9 Leonard BernsteinDokument8 SeitenMahler Sinfonia N 9 Leonard BernsteinCarlos DaneriNoch keine Bewertungen
- Mozart! Aber auch Bach und Beethoven!: Mein Leben mit den MeisternVon EverandMozart! Aber auch Bach und Beethoven!: Mein Leben mit den MeisternNoch keine Bewertungen
- Musik GeschichtezusammenfassungDokument6 SeitenMusik GeschichtezusammenfassungRené MateiNoch keine Bewertungen
- Musik Des BarocksDokument2 SeitenMusik Des BarockslinaalaskaNoch keine Bewertungen
- Programm Sabine Meyer Fazil SayDokument13 SeitenProgramm Sabine Meyer Fazil SayБатыржан ИматаевNoch keine Bewertungen
- Zusammenfassung - Musikgeschichte - Vokalmusik in Der KlassikDokument7 SeitenZusammenfassung - Musikgeschichte - Vokalmusik in Der KlassikDebora Sanny TeohNoch keine Bewertungen
- Élisabeth-Claude Jacquet de La GuerreDokument9 SeitenÉlisabeth-Claude Jacquet de La GuerreMAB3103Noch keine Bewertungen
- Martin Hegel - MozartDokument12 SeitenMartin Hegel - MozartGuillermo David TorresNoch keine Bewertungen
- Concerto Per TromboneDokument26 SeitenConcerto Per TromboneWerner D. SchröderNoch keine Bewertungen
- Ap 28062020Dokument23 SeitenAp 28062020Lea TrenkwalderNoch keine Bewertungen
- Langentwurf Concerto GrossoDokument32 SeitenLangentwurf Concerto GrossoEva WeidnerNoch keine Bewertungen
- Geschichte Des Klavichord - GoehlingerDokument142 SeitenGeschichte Des Klavichord - GoehlingerThiago Endrigo100% (1)
- GIUSEPPE VERDIS WIENBESUCHE: Vom Kärntnertortheater in die HofoperVon EverandGIUSEPPE VERDIS WIENBESUCHE: Vom Kärntnertortheater in die HofoperNoch keine Bewertungen
- Programm Heft 431Dokument9 SeitenProgramm Heft 431pasuasafcoNoch keine Bewertungen
- Je Ne Vis Onques L Amye A Tous - 1450-1521.Dokument4 SeitenJe Ne Vis Onques L Amye A Tous - 1450-1521.laura_389785679Noch keine Bewertungen
- KontrapunktDokument30 SeitenKontrapunktDiego_chg100% (1)
- Spaceflute Einzeln PDFDokument2 SeitenSpaceflute Einzeln PDFAnonymous xCH8eoFXVNoch keine Bewertungen
- Handbuch RealLPC 3 DeutschDokument88 SeitenHandbuch RealLPC 3 DeutschHubert SuschkaNoch keine Bewertungen
- Anhang-KIA4Dokument5 SeitenAnhang-KIA4alexandrNoch keine Bewertungen
- Klavierschule 1 Und 2Dokument45 SeitenKlavierschule 1 Und 2Dominik SchmidNoch keine Bewertungen
- Schumann-Romanzen Op.94 OboeDokument16 SeitenSchumann-Romanzen Op.94 OboeAlessandro SoccorsiNoch keine Bewertungen
- Mahlers InstrumentationDokument303 SeitenMahlers InstrumentationInventioneNoch keine Bewertungen
- Skandal Im Sperrbezirk - KeysDokument2 SeitenSkandal Im Sperrbezirk - KeysEvelyn KincsesNoch keine Bewertungen
- Klavier LernenDokument3 SeitenKlavier LernenYavsiNoch keine Bewertungen
- Klose Vs BaermannDokument2 SeitenKlose Vs BaermannStrahinja PavlovicNoch keine Bewertungen
- Allgemeine MusiklehreDokument17 SeitenAllgemeine MusiklehreHenrique97489573496100% (1)
- Songanalyse: Ed Sheeran PerfectDokument12 SeitenSonganalyse: Ed Sheeran PerfectShutaleva XeniaNoch keine Bewertungen
- Klavier Akkorde Spielen HandbuchDokument35 SeitenKlavier Akkorde Spielen Handbuchgigabert100% (2)
- Matehmatik in Der MusikDokument11 SeitenMatehmatik in Der MusikStephanie MerkerNoch keine Bewertungen
- Hoffmeister - Konzert 1 CB (Urtext)Dokument23 SeitenHoffmeister - Konzert 1 CB (Urtext)AndreaCoccoNoch keine Bewertungen