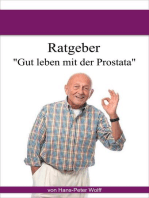Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Kurzübersicht Kolon Ca 1
Kurzübersicht Kolon Ca 1
Hochgeladen von
smatir025Originaltitel
Copyright
Verfügbare Formate
Dieses Dokument teilen
Dokument teilen oder einbetten
Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?
Sind diese Inhalte unangemessen?
Dieses Dokument meldenCopyright:
Verfügbare Formate
Kurzübersicht Kolon Ca 1
Kurzübersicht Kolon Ca 1
Hochgeladen von
smatir025Copyright:
Verfügbare Formate
Kurzüberblick: Kolon CA
Definition ● Bösartige Neubildung in Colon (Sigma) und
Rektum
Ursachen ● Zweithäufigstes Malignom bei beiden
Geschlechtern
● durchschnittliches Erkrankungsalter im 2. -3.
Jahrzehnt (ca. 65 Jahres)
● Zweithäufigste krebsbedingte Todesursache
nach männlichen Lungenkrebs / weiblichen
Brustkrebs
● 10 jährige Entwicklungsphase von Adenom zu
Karzinom
● Multifaktorielle Umwelteinflüssen
● Nahrung - Ernährungsgewohnheiten spielt
wesentliche Rolle
● Ballastoffreiche Kost reduziert Risiko
● Genetische Faktoren (1. Graduierung)
● Neigung zu familiär adenom. Polyposis
● Kolorektale Adenome, Colitis ulcerosa
● Karzinomerkrankungen (Mamma etc.)
● lymphogen / hämatogene Metastasierung
● Übergewicht
Symptome ● Asymptomatik möglich
● Unspezifische Zeichen: Müdigkeit, Schwäche,
Leistungsminderung, Später gastrointestinale
Symptome
● B-Symptomatik - Fieber, Nachtschweiß,
Gewichtsabnahme
● Ab 40. Lebensjahr plötzliche Änderung der
Stuhlgewohnheiten - Verdachtsänderung
● Blut- und Schleimauflagen im Stuhl und beim
Stuhlgang
● Reduzierung Sphinktertonus
● Wechselstuhl - Obstipation und Diarrhö
● Abnorme Windgerüche
● Ileussymptomatiken
Stadieneinteilung Der Tumor wird nach der internationalen TNM
Klassifikation eingeteilt (Staging). Es geht dabei um die
Beurteilung der Tumorausbreitung.
T - steht dabei für Tumor bzw. Tumorausbreitung - Wo wird
der Tumor lokalisiert und gibt es eine scharfe Begrenzung.
Der Primärtumor wird durch die Unterkategorien 0 - 4
weiter beschrieben. T0 - Kein Tumor nachweisbar, T1-T4
Tumorwachstum und Eindringen ins Gewebe.
N - steht für Befall der Lymphknoten (Nodalerbefall). Sind
Lymphknoten befallen und wenn ja, wo sind diese
lokalisiert.
Bei den Lymphknotenbefall wird ebenfalls der Fortschritt
beurteilt. N0 - Lymphknoten sind nicht befallen. N 1 - 3
Befall und Ausbreitung.
M - Metastasenbefall - Liegen Fernmetastasen vor.
M 0 bedeutet, dass keine Metastasen vorliegen. Beim
Befund M 1 wurden Fernmetastanden in anderen Organen
oder Knochen nachgewiesen. Tumorzellen worden somit
verschleppt.
Grading
Das Grading erfolgt durch die Untersuchung von
histologischen Materials. Somit ist eine Aussage zur
Aggressivität / Wachstum des Tumors (Malignitätsgrad)
möglich. Die Stufen G1 - G4 geben diese an.
G 1 - Geringer Malignitätsgrad
G 2 - Mittlerer Grad
G 3 - Hoher Grad
G 4 - Keine Abgrenzung möglich - sehr hohe Malignität
Diagnostik ● Sorgfältige Anamnese - Erhebung Ess- &
Stuhlgewohnheiten
● digitale - rektale Untersuchung
● Blutentnahme - Blutbild (Eisen, CEA
Tumormarker)
● AB 50. Lebensjahr Guajak Test / Hämocult Test
● Ab 55. Coloskopie (10 Jahres Rhythmus)
● Biopsie (Histologische Untersuchung)
● Staging
● Bildgebende Verfahren (Sonografie des
Enddarms oder gesamt Abdomens, CT - MRT)
● ggf. Röntgenthorax bei Metastasierung
● Staging und Grading sind entscheidend für
Therapie ● Kurative Heilung:
Operative Tumorentfernung (Hemicolektomien,
wenn Fernmetastasen ausgeschlossen:
Ausnahme bei Einzellbefall Leber &
Lebermetastasen, diese werden in separater
OP entfernt)
Möglich OP: Hemicolektomien rechts / links,
Transversalresektion und Sigmaresktion
● Bei Fortschreitender Erkrankung Adjuvante 6
Monatige Chemotherapie mit Folinsäure +
Fluorouracil (5 - FU) + Folfox / Oxaliplatin oder
Irinocetan (Lebensrate steigt)
Vorgehensweise Chemo im Überblick
Colonkarzinom - Fortgeschrittenes
Adjuvant (Postop.) Rektumkarzinom -
Neoadjuvant (Präop.)
Folinsäure + Strahlentherapie +
5-Fluorouracil plus Chemo (5-FU)
Oxaliplatin oder
Irinocetan
Rektumkarzinom:
● Bei frühen Stadien und abgrenzbaren Befund
kann lokale Exzision des Tumorgewebes
erfolgen und somit der Erhalt des Sphinkter ani
gewährleistet werden.
● Je nach Befund Kontinenzerhaltendes / Nicht
Kontinenzerhaltendes Vorgehen.
Palliative Behandlung:
● Operative Entfernung von Tumoren zur
Verhinderung weiterer Komplikationen
z.B. Ileus und Milderung von
Symptomen, Keine Aussicht auf Heilung
aber Verbesserung der Lebensqualität.
Pflegerische Intervention Allgemeine Maßnahmen:
● Kommunikation zum Behandlungsablauf mit
Pat.
● Begleitung / Beratung des Patienten und
seinen Angehörigen
● Diagnostische Maßnahmen organisieren /
anmelden (Labor, Röntgen, EKG, Sonografie
etc.)
● Untersuchungsmaterial vorbereiten
(Blutentnahme, Urinkontrolle, Stuhlprobe etc.)
● Kontrolle der Vitalwerte (Temperatur, RR, Puls
…)
● Gewichtskontrolle
● Eingehen auf Fatigue
● Hygienemaßnahmen durchführen und den
Patienten hier anleiten (Infektneigung)
● Dokumentation
● Ernährungsmanagement vor OP:
Ballaststoffarme Nahrung / ggf. parenterale
Ernährung über ZVK reichen
● Hautpflege
Präoperative Pflege:
● Karenz vor OP
● Darmreinigung / Vorbereitung:
Nach Anordnung des Arztes erfolgt eine
gründliche Reinigung des Darms durch 4 - 6
Liter Elektrolytlösung. Patient trinkt Lösung
zügig ca. 1 Liter in 30 bis 34 Min.
Verabreichung durch Magensonde auch
möglich. Spülung bis Pat. klare Flüssigkeit
ausscheidet.
Bei Nutzung einer Magensonde, wird
Infusionssystem an Magensonde geschlossen
und 1 Liter Lösung in 30 Min. laufen gelassen.
Rest der Lösung kann bei guter Verträglichkeit
in einem Zeitraum 2 bis 4 Stunden verabreicht
werden. Kontrolle von Blutdruck und Puls
während dem Ablauf.
● Bei Rektumkarzinom wird meistens ein
Reinigungseinlauf oder Klysma verwendet.
● Kontrolle der benötigte Dokumente
(Einwilligung OP vorhanden mit Unterschrift)
● Ggf. Stomamarkierung erfolgt:
● Ohne Markierung gibt es intraoperativ keinen
gute Positionierung für das Stoma. Hierfür
sollten Arzt, Pflegekraft / Stomatherapeut die
Lage am liegenden Patienten markieren.
Wasserfesten Stift nutzen, Stoma für Patienten
erreichbar? Glatte Fläche nutzen,
Knochenvorsprünge, Narben und Falten
meiden. Die Position des Stomabeutels sollte
nicht im Genitalbereich verlaufen. Bei
Bestrahlung Stoma außerhalb des
Bestrahlungsfeldes setzen. Bewegungsaktivität
und Radius überprüfen. Patient in diesen
Prozess aktiv einbeziehen!
Mehrere Stellen sollten markiert werden, um
intraoperative Befunde und Änderungen zu
berücksichtigen.
● Terminierung Stomatherapeut
● Vorbereitung auf chirurgischen Eingriff:
abdominale Haarentfernung im Wundgebiet
nach Hausstandard
Postoperative Pflege
● Kontrolle Stoma (Durchgängigkeit, Menge,
Häufigkeit, Farbe, Hautzustand, Wundgebiet=
● Kontrolle Vitalparameter (RR, Puls, Atmung)
● Kontrolle Stuhlgang (Pat. sollte 4 - 7 Tage nach
Eingriff wieder Stuhlgang haben, auf Blut im
Stuhl achten)
● Schmerzmanagement (Schmerzskala
erfassen) / Bedarfsmedikation
● Positionierung und Mobilisierung:
Frühmobilisierung am 1. postop. Tag
● Wundmanagement - Inspektion Wundgebiet /
auf Nachblutungen und Entzündungen
● Verbandswechsel
● Drainagenkontrolle (Fördermenge, Farbe,
Aussehen)
● ggf. Stomamanagement - Stomapflege -
Wechselstomabeutel - (Hinweis siehe hier
Stomapflege)
● Kostaufbau
● Pflege bei Verdauungsproblemen (Obstipation,
Übelkeit und Erbrechen)
Auf postoperative Komplikationen achten
● Blutungen
● Infektionen
● Kreislaufproblematiken
● Thrombosen und Embolien
● Pneumonie
● Anastomoseninsuffizienz
● Verdauungsproblematiken / Stuhlverhalt
● Blasenentleerungs- und Potenzstörungen
Prophylaxen
● Kontrakturenprophylaxen (Fehlhaltungen)
● Atemgymnastik - Pneumonieprophylaxe
(Schonatmung)
● Obstipationsprophylaxe
● Soor- und Parotitisprophylaxe
● Dehydrationsprophylaxe
Psychosoziale Begleitung/Aufklärung und Beratung
● Psychotherapie - psychoonkologische
Betreuung
● Selbsthilfegruppen
● Anleitung / Beratung zur korrekten Selbstpflege
des Stomas
● Beratung zur Akzeptanz Stomaanlage und
Umgang
● Anschlussheilbehandlung
● Überleitung zum Sozialdienst - Organisation
Anschlussheilbehandlung
● Engmaschige Nachsorge, um Rezidive
frühzeitig zu erkennen
● Onkologische Sterbebegleitung - Hospiz /
Palliative Begleitung
● Empathisches Eingehen auf Ängste,
Schmerzen, Veränderung des Körpers,
Belastung des sozialen Umfeldes etc.
Onkologische Begleitung / Pflege im Zuge von
Chemotherapie
● Umgang mit Zytostatika nach Einweisung zur
Vorbereitung, Applikation etc.
● Pflege bei Nebenwirkung (Infektanfälligkeit,
Blutungsneigung, Stomatitis, Mukositis,
Übelkeit und Erbrechen, Antiemetische
Prophylaxe, Fatigue, Strahlenreaktion, )
● Ggf. Beratung Hinweis vor Therapiebeginn das
Haarausfall (Alopezie) eintritt. Hierzu Beratung
zum Thema Haarersatz (Perückenanfertigung)
● Bei Alopezie Schutz der Kopfhaut vor
Sonneneinstrahlung, Hitze und Kälte
● Hautschutz
● Störung der Fertilität - durch Therapie kommt
es zur Unfruchtbarkeit (Sterilität) des
Patienten. Die Pflegekraft kann Hinweis auf
Mögliche Konservierung von Sperma und
Ovarialgewebe geben und mit Patient erörtern.
● Ernährungs- / Flüssigkeitsmanagement:
Essverhalten durch Vorlieben des Patienten
motivieren, ausgewogene Ernährung
ballaststoff-, vitamin- und eiweißreiche Kost
● Ggf. bei Schluckstörung Sondenkost über PEG
Sonde oder parenterale Ernährung
● Gewichtskontrolle
Stomapflege
Kolostoma: können endständig oder zurück verlegbar
sein
● liegen zum Teil auch prominent
● je nach Ort der Anlage unterschiedliche Namen
○ Zökostoma
○ Sigmoidostoma
○ Transversostoma
● spätestens am 5. postop Tag sollte Stuhlgang
fördern, vorher blutig seröses Sekret ist normal
● wenn keine Flüssigkeit kommt dann sofortige Info
an den Arzt
Ileostoma: liegen etwas prominenter über der Haut, da
die sauren Darmenzyme die Haut schädigen würden
● hohe Flüssigkeitsabgabe da der Stuhl im Ileum
nocht nicht eingedickt ist, muss das Stoma
regelmäßig geleert werden
● nach etwa 8-10 Wochen hat sich der Körper so
umgestellt, dass auch dort eine breiige Konsistenz
hinausläuft
● Dehydratation ist zu vermeiden
● bei Resektion großer Anteile des Ileums muss auf
Vitamin B12 Gabe
(intravenös/intramuskulär/subcutan) geachtet
werden, da dort die Resorption des Vitamin B12
stattfindet
● nach spätestens 2 Tagen sollte das Stoma fördern
StomaVersorgung:
● die Anlage und auch die Versorgung eines Stomas
ist ein sehr intimes und zum Teil auch mit scham
erfülltes Ereignis und sollte daher mit der größten
Akzeptanz, Einfühlsamkeit und Respekt behandelt
werden
● die Pflegefachkraft muss den Pflegeempfänger
beraten, anleiten und schulen im Umgang mit dem
Stoma im Alltag
● der Pflegeempfänger muss lernen sein Stoma
möglichst selbst versorgen zu können, bei
Einschränkungen können Pflegefachkräfte
assistieren und auch für die häusliche Versorgung
Kontakte herstellen bzw. den Arzt darüber in
Kenntnis setzen
● in Pflegeeinrichtungen gibt es auch
Stomatherapeuten, die die Versorgung
übernehmen (Wechsel der Beutel und Platten,
Beraten und Anleiten); es gibt auch ambulante
Stomatherapeuten, die dann auch in die
Häuslichkeit kommen können
● regelmäßiges leeren des Stomabeutels und
Bilanzieren ist erforderlich um mögliche
Dehydratationen zu erkennen und Maßnahmen zu
ergreifen (Flüssigkeitsgabe)
● regelmäßige Kontrolle des Stomabeutels und der
Ausscheidung darüber ist zu Beginn sehr wichtig.
Das Stoma muss fördern - Auskultation von
Darmgeräuschen ist ebenso wichtig
● wenn das Stoma nicht fördert, Darmgeräusche zu
gering sind und der Bauch eventuell prall aussieht
dann sofortige Arztinformation - Ileus oder
Anastomosengefahr
● abführende Maßnahmen über das Stoma nur nach
Arztanordnung (Miniklist, oder Klistier)
Anlage eines Stomabeutels
(einteilig oder zweiteilig) ● bei einteiligen Stomabeuteln muss der Wechsel
mindestens 1x/Tag erfolgen und bei Bedarf. Bei
zweiteiligen Systemen (Basisplatte und Beutel)
muss die Basisplatte alle 3 Tage gewechselt
werden und der Beutel je nach Art des Beutels
(Ausstreifbeutel/Ablass Beutel/Beutel ohne
Auslass)
Vorbereitung Material:
● sterile und unsterile KOmpressen
● Schleimhautdesinfektion
● unsterile Handschuhe, Schutzschürze
● Bettschutz (wasserundurchlässig)
● Nierenschale
● Feuchttücher
● Sichtschutz
● Stomapaste
● richtige Größe des Stomabeutels und der
Basisplatte (zweiteiliges System)
● Schere zum zuschneiden
● Abwurf
Reinigung des Stomas und Neuanlage des Stomabeutels:
● die Haut um das Stoma kann mit
Schleimhautdesinfektionsmittel oder Feuchttüchern
gereinigt werden
● Stoma neigen dazu beim Reinigen und Druck mit
Peristaltik zu reagieren und auszulaufen - Stoma
kann mit steriler kompresse abgedeckt werden
(ohne Druck daraufauszuüben)
● Begutachten des Stomas - Aussehen
(Ödeme?Durchblutung?Nekrosen),
Ausscheidungen (Menge, Farbe, Beimengungen
und Konsistenz)
● Hautschutz auftragen (Cavilon)
● Stomaplatte zurechtschneiden (Stoma muss frei
liegen und darf nicht eingeengt sein, nicht zu viel
Haut frei liegen lassen - Sekret greift die Haut an)
● bei unebenheiten Stomapaste unter die Basisplatte
aufbringen
● Stomabeutel anmodellieren ankleben und mit der
hand mit leichtem Druck 2 Minuten draufhalten
(Wärme der Hand lässt die Platte besser mit der
Haut verbinden)
● das anbringen der Basisplatte erfolgt in Richtung
unten seitlich oder bei mobilen Pflegeempfängern
unten nach innen
Nachbereitung:
● Materialien entsorgen
● Handschuhe verwerfen, Händedesinfektion
● Flächendesinfektion
● Dokumentation (Stoma, verwendete
Stomamaterialien)
Das könnte Ihnen auch gefallen
- Die Approbation NotizenDokument83 SeitenDie Approbation NotizenSascha Guz100% (1)
- Untersuchungskurs Manual NephrologieDokument13 SeitenUntersuchungskurs Manual NephrologiealerijbagNoch keine Bewertungen
- Oberer GI-Trakt III - Benigne Und Maligne Magenerkrankungen - OP-TechnikenDokument59 SeitenOberer GI-Trakt III - Benigne Und Maligne Magenerkrankungen - OP-TechnikenMayssa FrijiNoch keine Bewertungen
- Oberer GI-Trakt III - Benigne Und Maligne Magenerkrankungen - OP-TechnikenDokument59 SeitenOberer GI-Trakt III - Benigne Und Maligne Magenerkrankungen - OP-TechnikenMayssa FrijiNoch keine Bewertungen
- Chirurgie + GIT: (Ösophagusvarizen)Dokument10 SeitenChirurgie + GIT: (Ösophagusvarizen)Dildora AbdurakhimovaNoch keine Bewertungen
- Pflege Bei Krebserkrankungen 2022Dokument26 SeitenPflege Bei Krebserkrankungen 2022Roussel RAKOTOMALALANoch keine Bewertungen
- Subiecte FSPDokument103 SeitenSubiecte FSPAdelina Badea100% (1)
- SKL Gy ZusammenfassungDokument11 SeitenSKL Gy ZusammenfassungSiegfried SkilettiNoch keine Bewertungen
- Chronische Entzündungen Des DarmsDokument5 SeitenChronische Entzündungen Des DarmsJeannette DickNoch keine Bewertungen
- Gonarthrose 2Dokument2 SeitenGonarthrose 2Constantin ȚurcanNoch keine Bewertungen
- All Akute Lymphoblastische LeukämieDokument4 SeitenAll Akute Lymphoblastische Leukämiesmatir025Noch keine Bewertungen
- ChirurgieDokument7 SeitenChirurgieparthhh007Noch keine Bewertungen
- ÖsophaguskarzinomDokument3 SeitenÖsophaguskarzinomTural TagiyevNoch keine Bewertungen
- Tag 3 PankreatitisDokument53 SeitenTag 3 PankreatitisAlfonso Peñarroya100% (2)
- 2016 - 10 - 26 Glomeruläre ErkrankungenDokument13 Seiten2016 - 10 - 26 Glomeruläre ErkrankungenJasminNoch keine Bewertungen
- Mamma Karzinom 1Dokument4 SeitenMamma Karzinom 1smatir025Noch keine Bewertungen
- GastroDokument4 SeitenGastrochunyan199211Noch keine Bewertungen
- Prävention Gastrointestinaler Tumore - PschowskiDokument17 SeitenPrävention Gastrointestinaler Tumore - PschowskiVictoria MünzerNoch keine Bewertungen
- Bacteriologie Si Imunologie - Anca BaicusDokument45 SeitenBacteriologie Si Imunologie - Anca BaicusTeo Nica0% (1)
- KrankheitsbilderDokument85 SeitenKrankheitsbilderRabee HaydarNoch keine Bewertungen
- Ärzteblatt 2020 CholezystolithiasisDokument12 SeitenÄrzteblatt 2020 CholezystolithiasisMartin BergerNoch keine Bewertungen
- Krankheit FinalDokument50 SeitenKrankheit FinalPaula OviedoNoch keine Bewertungen
- KKB CHR BauchspeicheldruesenerkrankungenDokument24 SeitenKKB CHR BauchspeicheldruesenerkrankungenChristian AlejandroNoch keine Bewertungen
- LaborAktuell ChronischeDiarrhoeDokument5 SeitenLaborAktuell ChronischeDiarrhoeAaron Thomas LeonardNoch keine Bewertungen
- Vortrag - Junge Chirurgen - MegacolonDokument41 SeitenVortrag - Junge Chirurgen - MegacolonIamandei GeorgeNoch keine Bewertungen
- Patophysiologie VerdauungDokument13 SeitenPatophysiologie VerdauungNeevoNoch keine Bewertungen
- Chronische NiereinsuffienzDokument6 SeitenChronische NiereinsuffienznilayyildizercNoch keine Bewertungen
- Spezielle Patho Modul 87Dokument182 SeitenSpezielle Patho Modul 87Fahd Abdullah Al-refaiNoch keine Bewertungen
- DarmkrebsDokument96 SeitenDarmkrebsbipai100% (1)
- ProtokollDokument187 SeitenProtokollYesmine NasraNoch keine Bewertungen
- OnkologieDokument6 SeitenOnkologieMiharijaona UchiwaNoch keine Bewertungen
- Urinuntersuchung-Schritt Für SchrittDokument5 SeitenUrinuntersuchung-Schritt Für Schrittanjakozachenko.deNoch keine Bewertungen
- Kuliah 2 Gastritis, Ulkus PeptikumDokument50 SeitenKuliah 2 Gastritis, Ulkus PeptikumTommy HardiantoNoch keine Bewertungen
- Tumore Im KindesalterDokument28 SeitenTumore Im KindesalterAmila Sabljica-ŠojkoNoch keine Bewertungen
- Akute PankreatitisDokument8 SeitenAkute PankreatitisbashirNoch keine Bewertungen
- Morbus CrohnDokument11 SeitenMorbus CrohnPearl MykaNoch keine Bewertungen
- Ist Hworoby PielonefritDokument11 SeitenIst Hworoby PielonefritSteffi SvenssonNoch keine Bewertungen
- Gallenblase, Pankreas Und LeberDokument5 SeitenGallenblase, Pankreas Und Lebercfdbj4kybfNoch keine Bewertungen
- Chirurgie Hüser 3.ÄP JFDokument2 SeitenChirurgie Hüser 3.ÄP JFomerkaya.dzsNoch keine Bewertungen
- Milzruptur 2022 - 230415 - 170953Dokument5 SeitenMilzruptur 2022 - 230415 - 170953Jasmin OsmančevićNoch keine Bewertungen
- Nodulo TiroideoDokument6 SeitenNodulo TiroideoFabian Camelo OtorrinoNoch keine Bewertungen
- CR Hischprung DiseaseDokument35 SeitenCR Hischprung DiseaseNurulia AstriNoch keine Bewertungen
- Infekt: PhlegmoneDokument32 SeitenInfekt: PhlegmoneAlejandra Sime CoronelNoch keine Bewertungen
- Innere Gastro Hepato v1Dokument24 SeitenInnere Gastro Hepato v1VasilevasiloviciNoch keine Bewertungen
- FSP Lektion 5Dokument53 SeitenFSP Lektion 5ardaballiceNoch keine Bewertungen
- FoBi EUG GTD - 2015Dokument39 SeitenFoBi EUG GTD - 2015Tijana ČolićNoch keine Bewertungen
- Gastroduodenale UlkuskrankheitDokument11 SeitenGastroduodenale UlkuskrankheitPati MuresanNoch keine Bewertungen
- LeberzirrhoseDokument7 SeitenLeberzirrhoseNico HerbigNoch keine Bewertungen
- Prostata PresentationDokument21 SeitenProstata PresentationVeronika SynenkoNoch keine Bewertungen
- Ösophagus ErkrankungenDokument33 SeitenÖsophagus Erkrankungenmidlit4Noch keine Bewertungen
- PneumonieDokument5 SeitenPneumonieAilenei AndradaNoch keine Bewertungen
- PankreaskarzinomDokument2 SeitenPankreaskarzinomFahd Abdullah Al-refaiNoch keine Bewertungen
- Gesundheits Und Krankenpflege Mit Morbus CrohnDokument18 SeitenGesundheits Und Krankenpflege Mit Morbus CrohnPearl MykaNoch keine Bewertungen
- Arbeitsauftrag. MammakarzinomDokument5 SeitenArbeitsauftrag. MammakarzinomАня КибальникNoch keine Bewertungen
- Gutartige Gynäkologische ErkrankungenDokument5 SeitenGutartige Gynäkologische ErkrankungenNatz BatzNoch keine Bewertungen
- FallDokument41 SeitenFallAjla TihicNoch keine Bewertungen
- Chronische PankreatitisDokument18 SeitenChronische PankreatitisjindabinaNoch keine Bewertungen
- Arzt-Gespräche der FSP Medizin Studienjahr2024: FSP Medizin Teil 3 bundesweitVon EverandArzt-Gespräche der FSP Medizin Studienjahr2024: FSP Medizin Teil 3 bundesweitNoch keine Bewertungen
- Krebs und Homöopathie: Natürliche Hilfe bei den häufigsten Nebenwirkungen von Chemo-, Strahlentherapie und OperationVon EverandKrebs und Homöopathie: Natürliche Hilfe bei den häufigsten Nebenwirkungen von Chemo-, Strahlentherapie und OperationNoch keine Bewertungen